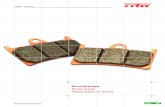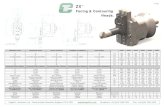Analyzing Free-Improvised Music: Four Improvisations by Trombonist Ben Gerstein
111509
-
Upload
fontis-brunnen-basel -
Category
Documents
-
view
252 -
download
4
description
Transcript of 111509


Gerlinde und Volkhard ScheunemannHauptsache: Geführt!

Die Autoren
Gerlinde und Volkhard Scheunemann, geboren 1935 bzw. 1934in Handorf bei Peine bzw. Lübeck, waren Theologen, Missiona-re, Institutsleiter, Autoren, Heimleiter des «Haus Frieden Hägel-berg», WEC-Leiter, Redner und Seelsorger während über fünfzigJahren. Heute sind sie im aktiven Ruhestand. Sie haben vier er-wachsene Kinder und acht Enkel.

Gerlinde und VolkhardScheunemann
Hauptsache:Geführt!
Lebenserfahrungenmit dem lebendigen Gott

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind imInternet über www.dnb.de abrufbar.
Die Bibelstellen in diesem Buch wurden entwederfolgenden Bibelübersetzungen entnommen:
Revidierte Elberfelder Bibel � 1985, 1991, 2008 SCM R. Brockhausim SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten
Lutherbibel � 1984, 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart,oder sie wurden selbst übersetzt.
� 2012 by Brunnen Verlag Basel
Umschlag: Spoon Design, Olaf Johannson, LanggçnsBilder Umschlag und Fotos Innenteil:Gerlinde und Volkhard Scheunemann
Satz: Innoset AG, Justin Messmer, BaselDruck: Bercker, Kevelaer
Printed in Germany
ISBN 978-3-7655-1509-5

Inhalt
Teil 1: Erinnerungen von Gerlinde Scheunemann......... 111. Vorwort ....................................................................... 132. Erste Erinnerungen....................................................... 163. Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen ...................... 174. Ja, so war das damals!.................................................. 205. Meine Eltern und Großeltern – wo kamen sie her? ..... 216. Unser Zuhause in Handorf .......................................... 247. Das Kriegsende im Mai 1945....................................... 278. «Noch ehe ich dich im Mutterleib bildete …» ............. 289. Das Samstagabendläuten............................................. 30
10. Mein Weg zur Oberschule........................................... 3611. Unter dem Einfluss von Lessing, Goethe und Hesse.... 3912. Meine Schreibfreundin Shirley Hyman ....................... 4213. Unter Christen............................................................. 4614. Volkhard ...................................................................... 4815. Wunderbare Verlobungszeit ........................................ 5716. Unsere Tübinger Zeit .................................................. 5917. Erste Begegnung mit dem WEC International ............. 6118. Kiel – die helle Stadt an der Fçrde................................ 6519. Die Lübecker St. Gertrud-Gemeinde ........................... 6720. Vorbereitung für das MTC in Glasgow ....................... 7221. Auf dem WEC Missionary Training College
in Schottland................................................................ 7322. Als Missionskandidatin in der Londoner
WEC-Zentrale.............................................................. 8023. Bei den Leitern des WEC in Deutschland .................... 8224. Endlich Heiraten!......................................................... 8425. Reisedienst in Deutschland.......................................... 8526. Aufbruch nach Indonesien........................................... 87
— 5 —

27. Nach sechs Wochen endlich in Indonesien.................. 9128. Erste Eindrücke in Batu................................................ 9629. Wieder lernen .............................................................. 10130. Gunnars Geburt........................................................... 10431. Einüben in neue Verhältnisse....................................... 10532. Erste Schritte in Verantwortung................................... 11033. Erste Konfrontation mit okkulten Mächten................. 11234. Besuch aus Ostafrika ................................................... 11535. Die erste indonesische Missionskonferenz.................. 11836. Ein politischer Umsturz bahnt sich an......................... 12137. Die zweite indonesische Missionskonferenz .............. 12338. Jahre des Wiederaufbaus ............................................. 12439. Gerapi, die erste cityweite Kampagne in Bandung ...... 12640. Volkhards Gastgeber Pak Makalewy........................... 12941. Gunnar-Nugroho, Sçnke-Sumadi und Kai-Sutrisno..... 13242. Erweckung am Bibelinstitut......................................... 13643. Unser erster Heimataufenthalt, März 1968 ................. 14144. Zurück nach Indonesien .............................................. 14545. Ein Brief aus Holland ................................................... 14846. Unsere neue Aufgabe bei der Indonesischen
Missionsgemeinschaft ................................................. 15147. Einprägsame Erfahrungen mit verschiedenen Gästen.. 15448. Die deutsche Missionarskinderschule ......................... 15949. Elterlicher Besuch ........................................................ 16250. Frauen warten in der Universitätsstadt Malang ........... 16451. In Todesgefahr............................................................. 16952. Ehe-Themen in einer asiatischen Kultur ...................... 17353. Verstimmungen zwischen uns beiden ......................... 17654. Und die eigene Familie?............................................... 17855. Deutschland im Jahr 1973............................................ 18056. Einschulung unserer drei Jungen auf eine
indonesische Schule..................................................... 182
— 6 —

57. Batu wird bekannt ....................................................... 18958. Wir mussten bauen...................................................... 19059. Auch die Außendienste nehmen zu............................. 19560. Die Kraft des Evangeliums im Batakland..................... 19661. Gottes Wirken auf Timor ............................................ 20062. Trifenas Gebet um einen Ehepartner ........................... 20163. Die Begleitung indonesischer Missionare .................... 20464. Folgenschwerer Einsatz auf Nias ................................. 20865. Die Abendbibelschulen ............................................... 21166. Notwendige Krankheit ................................................ 21467. Abschied von Indonesien ............................................ 21668. Rückkehr nach Deutschland........................................ 21669. Wieder einleben in Deutschland.................................. 21870. Unser Wiedereinstieg in Deutschland: Eheseminare ... 22071. Besuche unserer Missionare auf ihren Feldern............. 22472. Aufbruch zu neuen Ufern ............................................ 23973. Zehn reiche Jahre im «Haus Frieden»........................... 24174. Die Hausgemeinde im Haus Frieden ........................... 24675. Die Folgen okkulter Belastung in der Eheseelsorge...... 24876. Die wohl letzte Station: Winterberg im
Hochsauerland............................................................. 25077. Und ein letztes Kapitel ................................................ 253
Teil 2: Erinnerungen von Volkhard ................................. 26578. Aus meinem Blickwinkel............................................. 26679. Auch Eltern sind eine Gabe Gottes.............................. 26880. Kriegs- und Nachkriegserlebnisse................................ 26981. Meine Jugendjahre....................................................... 27282. «Geschaffen in Christus Jesus» .................................... 27483. Frühe Sehnsucht .......................................................... 27584. Erste Schritte als Christ................................................ 27885. Theologiestudium ....................................................... 279
— 7 —

86. Auslandsvikariat in der Schweiz ................................. 28687. Die «zuvor bereiteten Werke» ..................................... 28988. «Verkaufe, was du hast!» – Ausgesandt ohne
Geldbeutel ................................................................... 29189. «Verkaufe alles, was du hast» ....................................... 29590. «Der Schatz im Himmel»............................................. 29691. Zwanzig Jahre Indonesien – «der Sommer seiner
Gnad» .......................................................................... 30192. Unterricht im asiatischen Kontext ............................... 30293. Der Studentenchor des Instituts .................................. 31394. Ein kirchenübergreifendes Gesangbuch entsteht......... 31495. Adelshofen und Batu – es war ein Geben und
Nehmen....................................................................... 31596. Ich setze mich hin, um zu schreiben ........................... 31797. Indonesier fühlen sich verantwortlich für die
Großfamilie ................................................................. 32198. Wenn ich an Deutschland denke ................................. 32799. Wider den Mainstream der sexuellen Überflutung ...... 330
100. Zehn Jahre Eppsteiner Missionshaus ........................... 332101. Volle Bibelschulen, volle Missionshäuser .................... 333102. Berufung in die Leitung des WEC International in
Deutschland ................................................................ 334103. Der WEC – ein internationales Missionswerk............. 337104. Reichlich gefordert in Eppstein.................................... 341105. Leiderfahrungen .......................................................... 343106. Ausblick: Sturmzeichen am Himmel der Mission ....... 346107. Zehn Jahre «Haus Frieden Hägelberg» ......................... 348108. Die Entstehung des Hauses ......................................... 349109. Haus Frieden und seine Gäste...................................... 352110. Die Hausgemeinde ...................................................... 354111. Haus Frieden und die Weltmission .............................. 355112. Das Schniewind-Haus in Schçnebeck an der Elbe....... 357
— 8 —

113. Abschließende Gedanken............................................ 359114. Menschen, die mich geprägt haben ............................. 361115. Menschen der Sehnsucht bleiben! …........................... 364
Anmerkungen.............................................................. 368
— 9 —


Teil 1Erinnerungen
von Gerlinde Scheunemann
Für den immer gegenwärtigen besten Freund und Vaterin Ehrfurcht und tiefer Dankbarkeitfür seine Gnade und viel Vergebung.
Für die vielen Treuen,die unser Leben und unseren Dienstmit ihrem Gebet und ihren Gaben
begleitet und ermçglicht haben: Danke!Und: Vergelt’s Euch Gott!
Für unsere geliebten vier Kinderfamilien,für die ich mit dem Schreiben begann.
Gott vergelte Euch, dass Ihr unsmit so vielen Menschen geteilt habt.
Und für meinen wunderbaren Mann,dessen Liebe und Treue,
Geduld und Unterstützungmir ein Leben lang
Geborgenheit und Freude waren – und noch sind.


1. Vorwort
Erst im Alter von 22 Jahren, als meine Eltern sich mit meinemWunsch, die Frau eines zukünftigen Pfarrers zu werden, aus-einandersetzen mussten – in ihren Augen damals ein Berufohne Zukunft –, erfuhr ich aus dem Mund meiner Mutter dasGeheimnis der Gnade, die auf meinem Leben lag:
«Ich kann ja nicht Nein sagen», erläuterte sie mir. «Als ich mitdir schwanger war, habe ich, wie wohl jede Mutter für ihr wer-dendes Kind, darüber nachgedacht, was ich für dich wünschensollte: Reichtum, Schçnheit oder eine gute Partie? Begabung?Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und so habe ichschließlich gedacht: Ich übergebe dieses Kind Gott.»
Obwohl ich das erst so spät erfuhr – ich wuchs in einem El-ternhaus auf, in dem Gott zu der Zeit keine besondere Rollespielte –, hatte dieser doch von klein auf sein Eigentumsrechtan mir wahrgenommen und die Weichen gestellt für ein Lebenin der Nachfolge.
Nun leben wir, mein geliebter Mann und ich, nach 54 Jahrengemeinsamer Wanderschaft in Winterberg im Hochsauerland,dem wohl letzten uns von Gott zugewiesenen Ort auf seinerschçnen Erde. Als wir mit fast siebzig Jahren «in den Ruhe-stand» gingen, wünschten wir uns, das Lebensende in der Näheeines unserer Kinder verbringen zu kçnnen. Dass wir aus demsonnigen Südwesten Deutschlands mit seinen warmherzigenMenschen in diese rauere Gegend kamen, konnten unsereneuen Nachbarn gar nicht verstehen.
Aber meinem Mann war in seinem Fragen nach unserem Al-terssitz zweimal das Wort begegnet: «Wenn du alt wirst, wirdein anderer dich gürten und führen, wohin du nicht willst»(Johannes 21,18).
— 13 —

Als er mir davon erzählte, sagte ich spontan: «Hauptsache:Geführt!»
Das kçnnte als Motto über all den Stationen unseres Lebensstehen – und keine müssen wir bereuen!
Am Tag, an dem wir uns auf den Weg machten, um unsere neueWohnung zu erkunden, stand im Wort zum Tag im Losungs-büchlein: «Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land!» (Psalm16,6). Und das war nicht zu viel versprochen. Wir haben die her-bere Schçnheit des uns vorher vçllig fremden Sauerlandes liebgewonnen, es tut uns wohl, und seine Menschen tun es auch.
Das erste Lied, das wir in unserem ersten Gottesdienst hier san-gen, war: «Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr unsweist …» Und mit uns ging eine Verheißung, die eine liebe Be-terin mir zum Abschied aus dem lieb gewonnenen Hägelberggab: «Meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht der Herr»(Jesaja 54,10). Und sie sagte: «Dieses Wort wird als Verheißungund Zusage über eurem weiteren Weg stehen.» Dem Herrn seiDank!
Dennoch sehe ich, trotz der großen Segenslinie, auch die Man-gelhaftigkeit meines Lebens; oft so mangelhaft an treuem Hor-chen auf die leisen Impulse des Geistes und an augenblick-lichem Gehorchen, mangelhaft an Demut des Herzens. Inschlaflosen Nächten steht es mir vor Augen. Und ich kann nurum Vergebung flehen vor Ihm, der gerne mehr getan hätte durchein vçllig Ihm ausgeliefertes Leben. Seine große Treue undGnade bis in unser Alter bewegt mich: «Sind wir untreu, sobleibt Er treu, Er kann sich selbst nicht verleugnen» (2. Timo-theus 2,13). Alles ist Gnade.
— 14 —

«Mir ist Erbarmung widerfahren,Erbarmung, deren ich nicht wert;das zähl ich zu dem Wunderbaren,mein stolzes Herz hat’s nie begehrt.Nun weiß ich das und bin erfreutund rühme die Barmherzigkeit.»
Philipp Friedrich Hiller
PS. Am Anfang schrieb ich meinen Lebensbericht allein für un-sere Kinder und Enkel. Zur Verçffentlichung drängten immerwieder Frauen, denen ich als unseren Gästen im Haus FriedenBeispiele daraus erzählte. In wiederholten Anfechtungen, obmeine so persçnlichen Erfahrungen es wert wären, der Fülle gu-ter Bücher ein weiteres hinzuzufügen, antwortete Gott mir miteiner Seite vom 10. Februar aus C. H. Spurgeons Kleinoden gçtt-licher Verheißungen über Apostelgeschichte 22,15:
«Jeder von uns soll nach seinem Maß Zeuge dessen sein, wasder Herr uns offenbart hat, und es ist gefährlich für uns, wennwir die gçttliche Offenbarung verbergen. Zuerst müssen wir se-hen und hçren, sonst werden wir nichts zu erzählen haben; aberwenn wir das getan haben, müssen wir begierig sein, unserZeugnis abzulegen. Es muss persçnlich sein: Du wirst Zeuge sein.Es muss für Christus sein. Du wirst für ihn Zeuge sein … UnserZeugnis darf nicht vor wenigen Auserlesenen abgelegt werden,die uns freudig zustimmen, sondern vor allen Menschen, vor al-len, die wir erreichen kçnnen. Denn der vorliegende Spruch ist einGebot und eine Verheißung, derer wir eingedenk sein müssen:‹Du sollst mein Zeuge sein.› – ‹Ihr werdet meine Zeugen sein›,spricht der Herr.»
— 15 —

2. Erste Erinnerungen
Meine früheste Erinnerung reicht vor den Beginn des ZweitenWeltkriegs, ich muss etwa drei Jahre alt gewesen sein. Wirmachten einen Ausflug mit dem Opel P4, den mein Großvater– Bauer und Viehverkäufer, dazu leidenschaftlicher Heger undJäger auf dem sandigen Boden und in den Fçhren- und Kiefern-wäldern der Letzlinger Heide in der Altmark – seinem Schwie-gersohn, dem armen Lehrer, geschenkt hatte. Der Weg führte aneiner Kaserne vorbei. Da sprengte von den hçher gelegenenHäusern ein Reiter auf schwarzem Pferd auf uns zu. «Es gibt si-cher bald Krieg!», sagte daraufhin mein Vater.
Dieser Krieg überschattete dann sieben Jahre meines Lebens.Vom ersten bis zum letzten Tag war mein Vater Soldat, Muttiwar allein mit ihren beiden Tçchtern, abgesehen von Vatis kur-zen Urlauben, an die ich mich kaum erinnere. Nur als Mutti denblauen Feldpostbrief in ihren Händen hielt und weinte: «Vati istverwundet!», und wir ihn später in Hildesheim besuchen konn-ten, wo er seine Genesungszeit verbrachte, das steht mir nochdeutlich vor Augen.
Wir waren bei einer katholischen Hauswirtin untergebracht,und in unserem Zimmer stand ihr dunkelbrauner Betstuhl. Fürmich – Kind evangelischer Eltern, die dem Glauben damalsnoch fern, dafür der Ideologie des Dritten Reiches näher standen– eine fremde Welt, die einen Eindruck hinterließ.
Hildesheim, damals noch in seiner unberührten, mittelalterli-chen Pracht: das beeindruckende «Knochenhauer Amtshaus»,der «Zuckerhut», der 1000-jährige Rosenstock … Das alles gingspäter im Bombenhagel und im Feuer unter und blieb doch imHerzen fotografiert. Der Dom und die Michaeliskirche interes-sierten wohl damals die Eltern nicht. Sie sah ich erst Jahrzehnte
— 16 —

nach dem Krieg, zusammen mit meinem Mann, bestmçglichrestauriert. Die Stadt wurde nicht wieder das, was ich als acht-jähriges Mädchen gesehen hatte.
3. Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen
Verglichen mit dem, was andere erlitten – Verlust von Ehemän-nern und Vätern, von Haus und Hof, von Heimat, Hab undGut –, kamen wir glimpflich durch den Krieg. Vom Bombenha-gel blieb unser kleines Dorf verschont. Wir sahen die in derSonne blinkenden Schwärme von Flugzeugen, die ihre Tod undVerderben bringende Bombenlast über den Städten entluden,hoch über uns am Himmel vorbeiziehen. Und in den Bomben-nächten leuchtete der Horizont hochrot über Hannover, Braun-schweig und Hildesheim um uns herum.
Bei uns landeten wohl mehr aus Versehen zwei Bomben imFeld am Dorfrand und hinterließen tiefe Krater. Wir sahen siefallen und sausten aus dem ersten Stock in den Luftschutzkeller,in dem sich bei Luftalarm außer uns dreien auch Nachbarn ein-fanden: Opa Schaperjahn und der alte Onkel Ernst, der mit Vatiam gleichen Tag Geburtstag hatte und es sich nicht nehmenließ, ihm jedes Mal selbstgebackenen Junggesellen-Pflaumenku-chen zu bringen – die hell gescheuerten Dielen seines altenHauses wurden zur Feier jedes Sonntags mit weißen Heide-sandkringeln bestreut –, dazu Oma Wittneben, die wir, weilunsere eigenen Großeltern zu weit entfernt wohnten, «adop-tiert» hatten.
Bald gehçrten auch Flüchtlinge dazu, die aus Kçln den Bom-ben hatten weichen müssen: Frau Engel mit ihren zwei kleinenKindern, auch ihr Vater war im Krieg, und gegen Ende des Krie-
— 17 —

ges noch ein Großvater aus Schlesien mit seinen vier erwachse-nen Tçchtern, von denen die eine ihre vier Kinder bei sich hatte,die andere drei. Die Väter waren beim Einmarsch der russischenArmee erschossen worden.
Sie alle fanden Platz in der einen Lehrerwohnung über demKlassenraum der neuen Schule, wo mein Vater vor dem Kriegunterrichtet hatte. Auch in der alten Schule gegenüber war nurein Klassenzimmer, in dem der Kollege unterrichtete. Der Zu-strom von Flüchtlingen machte bald nach dem Krieg den Anbaueines dritten Klassenraumes an die alte Schule notwendig.
Meiner Mutter mit uns beiden Tçchtern blieb das großeWohnzimmer in der neuen Schule. Es war die gute Stube fürFeiertage und Besuch gewesen, selten benutzt. Mit seiner wein-roten Tapete, Blumengirlanden und Goldsprenkeln darauf, undden schweren altrosa-grauen Sesseln und dem passenden Sofa,einem Stilllebendruck mit Früchten und einem toten Rebhuhnin schwerem Rahmen war es ein festlich-feierlicher Raum.
An heißen Sommernachmittagen hatte ich mich als Kind aufden Teppich unter den Esstisch gelegt und die Kühle im abge-dunkelten Raum genossen. Nun wurde auch das Schlafzimmerdarin untergebracht. Dazu hatten wir einen drei mal drei Meterkleinen Raum hinter der Küche, der nach Vaters Heimkehr Kin-derzimmer wurde, nebst der großen Küche mit ihrem kalten,rot gefliesten Fußboden. Nur hier wurde im Winter geheizt. Ja,weil die Fußkälte nicht zu ertragen war, hängten wir die Holztürdes Holzstalles ab und legten sie als wärmenden Fußboden vorden Herd.
Ich liebte den weiten Ausblick aus dem breiten Küchenfens-ter. Über den Grashof mit drei Pflaumenbäumen, Hühnern,Gänsen und Enten, den Gemüsegarten, der lebensnotwendigwar – daneben bewirtschaftete meine fleißige Mutter noch dreiweitere Gärten, um uns durchzubringen –, schweifte der Blick
— 18 —

über die Wiesen des Nachbarn, durch die ein Bächlein floss, undüber fruchtbare Felder. Er endete an der Landstraße, auf der wirspäter die Panzer der siegreichen Engländer und Amerikanereinfahren sahen.
Unsichtbar dahinter lag der Mittellandkanal. Dort wurdeKohle transportiert zur Versorgung der Ilseder Hütte, der kriegs-wichtigen Eisenindustrie. In den letzten kalten Kriegsjahrentauschte Mutti am Hafen selbst angebauten, fein geschnittenenoder zu krummen Zigarren gerollten Tabak gegen große Bro-cken Steinkohle oder auch einmal gegen einen großen Sack vol-ler Zucker. Das alles schob sie dann auf ihrem Fahrrad heim.Unser Opel P4 war ja schon zu Beginn des Krieges für die Armeerequiriert worden.
Die Eisenwerke mit ihren aus der Landschaft ragenden Hoch-çfen waren natürlich in Bombengefahr. Das bekamen schon wirSchulkinder mit. Denn weil unsere Lehrer zum Militär einge-zogen waren, mussten die Handorfer Kinder durch den Waldnach Bülten zur Schule gehen, etwa zwei Kilometer. In diesemWald aber waren Ölfelder angelegt, die nachts brannten, um dieBomber von den Stahlwerken abzulenken. Darum erhieltenschon wir Erst- und Zweitklässler Erste-Hilfe-Unterricht undtrugen jeden Tag außer unserem Tornister mit Schiefertafel, Le-se- und Rechenbuch und der Frühstückstasche, in der unser Pau-senbrot steckte, noch eine Tasche mit Verbandsmaterial undDreieckstuch bei uns. Ich kann mich aber nicht erinnern, dassuns das besonders bedrückt hätte. Der Schulweg durch denWald war viel zu interessant dazu.
— 19 —

4. Ja, so war das damals!
Bewundernswert ist, was die Frauen und Mütter jener Zeit leis-teten, um ohne ihre Männer, ja mit ständigem Bangen um derenLeben, an der Kriegsfront ihre Kinder aufzuziehen. Sowohl Le-bensmittel als auch Kleidung wurden immer knapper und wa-ren schmal rationiert. Was man auf Lebensmittelkarten bekam,reichte kaum aus. Das Bestellen von Gärten, das Einwecken, dasTrocknen von Früchten und Gemüse, das Sammeln von Eichelnund Bucheckern zum Austausch gegen Öl, das Stoppeln undNachlesen von Weizen-, Roggen- und Haferähren, das Ausgra-ben von Zuckerrüben im kalten November und deren mühsameVerarbeitung zu Sirup, das Gewinnen von Stärke aus Kartoffeln… alles war sehr zeitaufwendig und mühsam.
Es gab auch noch keine Waschmaschinen. Die große Wäschewar immer ein voller Arbeitstag. Er begann schon am Vortag mitdem Wassertragen. Im Sommer trocknete unsere Pumpe aufdem Hof aus, und Wasserleitungen gab es auf dem Dorf nochnicht. Die große, lange Wanne musste zum nächtlichen Einwei-chen der Wäsche gefüllt werden. Übrigens wurde diese Wanneim Winter aus dem Keller in die warme Küche im ersten Stockgetragen zum Wochenendbad von Klein und Groß. Auch dergroße Waschkessel im Keller wollte gefüllt sein, damit am frü-hen Morgen angeheizt werden konnte. Nachdem die Wäschegekocht war und noch im Kessel gestampft, wurde sie im Holz-bottich auf dem gewellten Waschbrett einzeln gerubbelt, inzwei Wannen gespült und auf dem Hof oder bei Regen und imWinter auf dem Wäscheboden im zweiten Stock aufgehängt.Was für eine Schlepperei!
Dass wir früh darauf zu achten hatten, uns nicht unnçtigschmutzig zu machen, und der Mutter schon einmal die Hand
— 20 —

ausrutschte, wenn uns das nicht gelungen war, ist nur allzu ver-ständlich! Schließlich blieb ihr allein der grçßte Anteil am Wasser-schleppen, und den ganzen Waschtag lang konnte man sie in derWaschküche voller Briet1 nur wie durch dichten Nebel erblicken.
Die Abende waren ausgefüllt mit Flicken und Stopfen, Stri-cken und Nähen. Dass meine Mutter sich neben all der Plackereiaber noch die Mühe machte, auf Leibchen und Taschentuch-täschchen des gelben Kleides, das sie mir aus einem alten Kleidvon sich selbst nähte, mit einigen bunten Fäden Blumen zu sti-cken, ebenso auf die schlichte Passe einer grauen Strickjacke, diesie mir aus aufgeribbelten Scheuertüchern mit aufwendigemLochmuster strickte, daran erinnere ich mich bis heute mit war-mem Herzen.
Ja, sie fand noch Zeit, mich früh Lesen und Schreiben zu leh-ren, damit ich meinem Vater im Krieg eigenhändig Grüße sen-den konnte. Sie fuhr schließlich sogar mit meinen Schreibheftenzum Schulrat, und der ließ sich überzeugen, dass ich ein Jahr vorder Zeit eingeschult werden durfte, weil ich ja schon schreibenund lesen konnte.
5. Meine Eltern und Großeltern – wo kamensie her?
Große Mühe machte meiner Mutter, dass sie als Lehrersfrau dieLeitung der Frauenschaft im Dorf übernehmen musste. Sie warja als Zugezogene eine Außenseiterin, und wegen ihrer abgebro-chenen Schulbildung innerlich unsicher.
Ihr Vater, der seinen wohlhabenden Schwiegereltern mit Er-folg imponieren wollte, aber kurz vor dem Kauf eines grçßerenBauernhofes durch die Inflation sein Erspartes verloren hatte,
— 21 —

forderte seine vier Kinder (Mutti war die ¾lteste) übermäßig. Erstand mittags schon ungeduldig wartend an der Haustür, dul-dete kein Bummeln auf dem Heimweg von der Schule, trieb siezu schnellem Essen und danach zur Arbeit auf dem Feld oder imWald an. Mutti erzählte mir, wie sie oft schon in der Schule dieEnglisch-Vokabeln oder andere Aufgaben auf Zettel schrieb, diesie in der Schürzentasche mit sich nahm, um beim Unkrautha-cken zu lernen. Wie gern hätte sie die interessante Schule zuEnde besucht. Aber der Vater duldete es nicht.
Immerhin hat sie dort meinen Vater kennen gelernt, der alsjunger arbeitsloser Lehrer an der Privatschule auf dem LetzlingerSchloss für ein Taschengeld Anstellung gefunden hatte. Für ihn,der als zweiter Sohn eines Kleinbauern, vormals Wassermüllersaus der Gçttinger Gegend, einen Beruf erlernen musste, wardiese Schule eine wunderbare Horizonterweiterung.
Ich kann nur mit innerer Bewegung an die Erzählung meinesGroßvaters in Landolfshausen denken, den ich als Studentinvon Gçttingen aus auf seinem Sterbebett pflegte:
Eines Tages hatte der Lehrer seines Sohnes ihn zu sich geru-fen. Auf dem Rand des Stuhles habe er gesessen und seineMütze zwischen den Knien in seinen Händen gedreht, als derLehrer ihm mitteilte, sein zweiter Sohn sei zu begabt, um einenHandwerksberuf zu erlernen. Der müsse Lehrer werden. Ja, undweil der Lehrer es meinte, habe er ja zustimmen müssen. Aberschwer war es!
Nach der Volksschule musste Vati also auf die so genanntePräparandie, eine Vorbereitungsstufe in Northeim, dreißig Kilo-meter von zu Hause entfernt. Dort wurde ihm von seinem älte-ren Cousin das Plattdütsch ausgetrieben, und jedes Wochenenderadelte er heim, um auf dem Hof und dem Feld zu helfen unddamit seine Ausbildung zu verdienen.
— 22 —

Die Privatschule auf dem Letzlinger Schloss, einem ehemali-gen Jagdschloss der preußischen Kçnige, gehçrte zu einerGruppe pädagogischer Neuaufbrüche. Unter der Leitung einesbegabten Juden sammelten sich Kinder von Forschern und Ent-deckern, Schauspielern und anderen vielreisenden Eltern in die-sem Internat, um neben der schulischen Ausbildung ein Hand-werk zu erlernen. Auch einige Dorfkinder waren zugelassen.
Theatergruppen, ein Orchester, Ausflüge in der Umgebung,Begegnung mit den interessanten Eltern und deren Erfahrungs-bereich schufen einen weiten Bildungsrahmen. Für meinen Va-ter war die Anstellung dort gewiss ein «Quantensprung». Wiegern wäre auch ich an diese Schule gegangen! Aber da das Leh-rergehalt zu gering war, um eine Familie zu ernähren, musstemein Vater sich vor seiner Heirat nach einer Stelle an einer staat-lichen Schule umsehen. Er fand sie in Eberholzen bei Alfeld, beiden Sieben Bergen, wo ich geboren wurde.
Wenig später musste der jüdische Direktor fliehen, und dasSchloss wurde vom NS-Staat zu seinen Zwecken umfunktio-niert. Letzlingen aber blieb uns vertraut, weil Mutti alle Ferienmit uns beiden Mädchen bei ihren Eltern verbrachte, um aufdem Bauernhof zu helfen.
Ich erinnere mich gern an das Paddeln auf dem Wassergraben,der das Schloss umgab, an sein Schwanenpaar und an die Aus-flüge mit Sybille, dem Kind von Berliner Eltern, die in einem derbeiden Hotels, in denen vorwiegend Gäste aus der Hauptstadtwohnten, ihre Ferien verbrachten. Als einmal Sybilles kleineSchildkrçte über unserem Spielen verloren ging, gab es eine trä-nenreiche Suche im Sand der Heide unter Fçhren und Birken.
— 23 —

6. Unser Zuhause in Handorf
Wir lebten inzwischen längst in Handorf. Die Mini-Lehrerwoh-nung in Eberholzen war für Familienzuwachs zu klein gewor-den. So war mein Vater froh, im flachen Hannoverland, fünf Ki-lometer von der Kreisstadt Peine entfernt, eine neue Stelle zufinden. Das Schulhaus mit der geräumigen Lehrerwohnung imersten und zweiten Stock, im großzügigen Stil des beginnenden20. Jahrhunderts gebaut, war eine riesige Verbesserung. «Wennder Kaiser von China Handorf besucht, müsste er bei euch woh-nen!», sagte später ein Schulfreund zu mir.
Die Lage am Dorfrand, zwei Gärten – vorn Obst und Blumen,hinten Gemüse –, ein weiter Grashof hinter dem Haus mitzweistçckigem Stall für Hühner, Gänse, Enten, Kaninchen, einSchwein und für Holz und Heu, ein Klohäuschen für uns unddie Schüler: Alles war großzügig und nach damaligem Maßstabkomfortabel. Das Plumpsklo draußen, ohne Wasserspülung undLicht und im Winter ziemlich kalt und zugig, war damals nochallgemein üblich auf den Dçrfern.
Für uns Kinder war es nur unangenehm, wenn wir imDunkeln das Örtchen aufsuchen mussten, mit Taschenlampeoder, wenn es keine Batterien gab, auch mit einer Kerzebewaffnet. Im Sommer konnten uns auch zuweilen ein an-griffslustiger Hahn oder unsere zischenden Graugänse denWeg versperren. Dann brauchte man einen Stock, um sichRespekt zu verschaffen.
An Handorf knüpfen sich die meisten meiner Kindheitserinne-rungen. Herrliche Spielzeit! Wir brauchten wenig Spielzeug.Ein paar Bauklçtze und die Figuren von Mensch-ärgere-dich-nicht, Halma, Mühle und Dame zum Bauen im Winter. Meine
— 24 —

schçne Puppe Eva-Maria, die leider im Gardinenreste-Brautkleidvom Tisch auf unseren Steinfußboden stürzte und sich ihre Por-zellanfüße brach, reparierten wir notdürftig mit Hansaplast.
Im Sommer waren Wiesen und Wälder und der herrlich ver-wilderte Nachbargarten, wo wir unter ausladenden Holunder-büschen wohnten und in verrosteten Blechdosen aus Stçcken,Blättern und Steinchen die leckersten Gerichte «kochten», unserweites Reich. Wir mussten nur aufpassen, wenn der uralte Hein-rich-Bauer mit seinem schwarzen Harald kam, dass wir unsschnell genug vor dem Hund durch das Loch im Zaun auf unse-ren Hof retteten!
Dort konnten wir auf dem von Asphalt und Pflaster verschon-ten Boden überall Ritzen auskratzen zum Stockschlagen oderKuhlen für unser Murmelspiel. Die asphaltierte Hauptstraßewar fast autofrei, und so trieben wir stundenlang Kreisel, meistselbst gebastelt und bemalt, mit unseren Peitschen darüber hin-weg. Im Sommer durften wir Ziegen, Schafe und Kühe hüten inden Fuhsewiesen, die im Winter überschwemmt und vereistwaren, herrlich zum Schlittschuhlaufen!
Dabei konnte es auch zu schmerzlichen Erfahrungen kom-men. Einmal vergaßen wir meine kleine Schwester Giesela (daszusätzliche «e» war ein Schreibfehler des Standesamtes!) auf derWiese. Sie besaß eine uns damals sehr willkommene Fähigkeit.Sie konnte jederzeit einschlafen. Wenn die Kleine uns Großenalso lästig wurde, spielten wir Vater, Mutter und Kind und leg-ten unser folgsames Kind bald schlafen. Dann konnten wir unsfreier bewegen – und vergaßen abends beim Heimgehen, dasswir sie mitgenommen hatten. Was für ein Schreck, als die Mut-ter nach ihr fragte! Ich bekam einen kräftigen Hosenboden vollund wurde zur Strafe in den Keller gesteckt, wovor ich großeAngst hatte.
Ein weiteres Mal wurde ich an meiner kleinen Schwester
— 25 —

schuldig. Über den Oppergraben zwischen Pfarrhaus und Kircheführte eine kleine Brücke. Das Geländer, ein glattes Eisenrohr,eignete sich wunderbar zum Kobolzschlagen. Die dreijährigeGiesel wollte uns Großen nicht nachstehen. Jemand hob sie andie Stange. Sie hielt sich aber nicht richtig fest und landete kopf-über im Bach, ja schlimmer: steckte mit dem Kopf im morasti-gen Grund. Zu meiner Scham: Nicht ich war es, die hinein-watete und sie herauszog, sondern einer der grçßeren Jungen.Schlamm tropfte aus ihren Haaren, Augen und Ohren. Die gutealte Nachbarin, Frau Dohr, steckte sie in eine große Wasch-schüssel, und so war sie wieder ansehnlich, als Mutti auf demFahrrad von Peine zurückkam. Auch da gab es einen tüchtigenHosenboden voll, weil ich nicht besser auf meine Schwester ge-achtet hatte.
Diese Strafe habe ich ebenso wenig vergessen wie die Haue,die meine ärgerliche Mutter mir verpasste, als ich zum x-tenMale, trotz wiederholter Ermahnung, den zusammengefegtenSchmutz unter den Teppich gekehrt hatte. Ach, noch ein wei-teres Mal ist mir in Erinnerung. Am großen Waschtag sollte ichschnell etwas Vergessenes einkaufen – und verspielte mich un-terwegs. Mutti war so ärgerlich, dass es gleich was hinter dieOhren gab.
Damals war kçrperliche Strafe noch nicht so verpçnt wieheute. Und geschadet hat sie mir offenbar nicht. Ich habe auchdie Liebe meiner Mutter niemals angezweifelt. Sie lebte und ar-beitete ja für uns und gab ihr Letztes, um es uns an nichts fehlenzu lassen. Und wie sehr war sie gefordert! Ich habe es ihr garnicht genug danken kçnnen.
— 26 —

7. Das Kriegsende im Mai 1945
Im April 1945 stand ich in unserem dritten Garten am west-lichen Dorfrand. Plçtzlich kamen Panzer aus dem Wald, circaanderthalb Kilometer entfernt. Ich stürzte hinter eine alteScheune in Deckung, so erschreckt, dass ich nicht auf die Kuh-fladen auf der Straße achtete und mit meinen Sçckchen, dieHolzpantinen hatte ich schon verloren, mitten in einen hinein-trat. Alle Häuser flaggten weiß, bereit zur Kapitulation. Muttiwurde noch gescholten, weil sie das nicht mitbekommen hatte.Unser hohes Schulhaus am Rand des Dorfes war ja weithinsichtbar. So hängte auch sie schnell weiße Bettlaken aus denFenstern.
Später sahen wir lange Schlangen amerikanischer Panzer aufder Reichsstraße vor dem Kanal Richtung Peine und Braun-schweig rollen. Ein letztes deutsches Flugzeug im Tiefflug überunserem Dorf wurde von ihnen beschossen – und wir gingen inDeckung, um später die Munitionssplitter auf dem Hof zu sam-meln. In der Schule wurde dann stolz die Beute verglichen: Werhatte den grçßten Splitter gefunden? Gott sei Dank war keinerverletzt worden!
Mein viertes Schuljahr fiel zusammen mit dem Kriegsendeund der Heimkehr meines Vaters. Unvergesslich bleibt mir die-ser Augenblick. Wir Kinder spielten unter der großen Eiche vorder Kirche. Von dort aus sah man die Dorfstraße bis zum Aus-gang des Dorfes hinauf. Und plçtzlich – ein Soldat, der auf unszukam: mein Vater! Wir konnten es kaum glauben. Es war ihmgelungen, sich mit ein paar Kameraden durchzuschlagen, bisnach Hause. Die gefährlichsten Tage zwischen Krieg und Frie-den hatten sie in einer Molkerei in Schleswig-Holstein überlebt,mit Käse, aber ohne Brot.
— 27 —

Es war ein Wunder, dass sie nicht gefangen genommen wor-den waren und ganz ohne Kriegsgefangenschaft davonkamen.
8. «Noch ehe ich dich im Mutterleibbildete …»
Wie konnte es geschehen, dass ich aus einer Familie, die Gottnicht persçnlich kannte, ihn doch finden und erkennen durfte?Brach da ein lange unterirdisch verborgener Gnadenstrom wie-der ans Licht? Ich war über fünfzig Jahre alt, als eine Cousinemeiner Mutter mir mitteilte, was ihre Familie auf der Suchenach ihrem Stammbaum herausgefunden hatte:
Meine Ur-Urgroßmutter war eine Hugenottin gewesen, einegeborene Hector. Ihre Familie stammte aus Südfrankreich undwar, um ihres Glaubens willen vertrieben, ins Land der preußi-schen Kçnige gekommen, die ihr armes, rückständiges Land mitHilfe der Glaubensflüchtlinge aus Frankreich und Österreich zurBlüte brachten. Das war die Erklärung für den olivfarbenenTeint meiner Großmutter mütterlicherseits und für ihre großendunklen Augen.
Der verkarstete Boden über dem verborgenen Gnadenstromwurde aufgebrochen durch die Not der Kinderlosigkeit einerTante meiner Mutter, die auch ihre Patentante und Vertrautewurde. Sie muss ins Herz meiner Mutter ein Samenkorn desGlaubens gelegt haben. Obwohl es unter dem Einfluss des Na-tionalsozialismus später verschüttet wurde, war es doch so weitaufgegangen, dass Mutti uns Kindergebete lehrte:
«Ich bin klein, mein Herz mach rein,soll niemand drin wohnen als Jesus allein.»
— 28 —

Und das Abendgebet:
«Müde bin ich, geh zur Ruh,schließe beide ¾uglein zu.Vater, lass die Augen deinüber meinem Bette sein.
Hab ich Unrecht heut getan,sieh es, lieber Gott, nicht an.Deine Gnad und Christi Blutmachen allen Schaden gut.
Alle, die mir sind verwandt,Gott, lass ruh’n in deiner Hand.Alle Menschen groß und kleinsollen dir befohlen sein.»
Es tut mir leid, dass der Eiserne Vorhang uns von den Verwand-ten in Letzlingen so lange trennte, dass wenig Austausch ge-schah. So weiß ich auch nichts Genaueres über den Ursprungdes Jesusglaubens bei der Patentante meiner Mutter, Tante Frie-da. Jedoch ist mir aus einer kurzen Begegnung ein Satz in Erin-nerung geblieben: «Auf Jesus allein kommt es an!»
In meiner Familie starb der Glaube. Mein Vater war geprägtvon der humanistischen Freigeistigkeit der Letzlinger Schule,danach war er Mitläufer des Nationalsozialismus. So gab es da-mals daheim weder Bibel noch Gebet noch Kirchenbesuch, ob-wohl die Handorfer Kirche in direkter Sichtweite jenseits desSchulhofs stand. Nur an Heiligabend ging die Familie zum Got-tesdienst – jedenfalls später, als Vati aus dem Krieg heimgekehrtwar. Ich erinnere mich, dass er vor Ende der Christmette heim-lief, um die Kerzen am Weihnachtsbaum anzuzünden, die wirdann schon beim Herauskommen aus dem Kirchenportal durchdie hohen Fenster unserer Wohnung leuchten sahen.
— 29 —

Doch der Herr selbst ergriff die Initiative, um mein Leben zusich zu ziehen.
9. Das Samstagabendläuten
Es war an einem Samstagnachmittag im Sommer. Ich hatte imGarten gespielt, barfuß, in dem gestreiften Hängekleidchen, dasMutti mir aus Matratzenstoff genäht hatte, spielschmutzig …da läuteten die Glocken den Sonntag ein. So deutlich war es inmeinem Herzen ein «Komm, komm, komm, komm!», dass ich,so wie ich war, hinüberlief in die Kirche. Acht oder neun Jahrealt mag ich da gewesen sein.
Ich kann mich nicht erinnern, was mir dort geschah, aber vonda an ging ich regelmäßig in den Kindergottesdienst, der nachdem Hauptgottesdienst angeboten wurde. Pastor Hans Brandes,mein späterer Konfirmator, leitete den liturgischen Eingangsteil,dann wurde die kleine Kinderschar in zwei Gruppen geteilt: DieGroßen unterrichtete er selbst, die Kleinen, zu denen auch ichgehçrte, durften Tante Elise zuhçren.
Tante Elise war eine Ohofer Schwester, trug das hellblau-weiß gestreifte Diakonissenkleid mit dunkler Schürze und warschon damals uralt. Sie war eine kleine, zierliche Person mit lie-bem Gesicht, die uns Kinder liebte. Durch irgendein Unglückhatte sie ein Bein verloren und trug eine Prothese, die nichtmehr war als ein armdicker Stab, der an den Stumpf des Ober-schenkels angeschnallt war. Denke ich zurück, so kann ichheute noch das «Tock, tock, tock» ihrer Schritte hçren, wennsie vom Kirchenportal her durch den langen Gang bis zu unsKindern nach vorn kam, die im Querschiff rechts vor den Augender wenigen Gottesdienstbesucher still zu halten waren.
— 30 —

Gegenüber auf der linken Seite des Ganges saßen die Vor-und Hauptkonfirmanden unter den Augen des Pastors, direktvor der Kanzel, die damals vor der Renovation der Kirche nochmit Gipsrepliken der Fischer-Apostel geschmückt war. Auf un-serer Seite hing über dem Taufstein ein großer, schwebender En-gel, der erhalten blieb. Um den hohen Altar mit seinen «Mar-morsäulen» war es nicht schade. Heute ist die Kirche viellichter geworden.
Tante Elise – ja, sie säte Gottes Wort kindgemäß in unsereHerzen. Wie hat sie uns lieb gehabt! Im Sommer humpelte siemit uns in den Wald am Südwestrand des Dorfes, die Mühsalnicht achtend. Sie ließ uns Verstecken, Fangen und Bäumchen-wechsel-dich spielen, bis wir müde waren. Dann saßen wir aufherumliegenden Baumstämmen, aßen und tranken, was unsereMütter uns eingepackt hatten, und Tante Elise erzählte Jesus-geschichten und Missionsgeschichten … bis zum Heimgehen.Danke, liebe Tante Elise! Vergelt’s dir Gott!
Während unseres ersten Heimataufenthalts nach fünf Jahrenin Indonesien wollte ich ihr noch einmal persçnlich danken. Wirhatten gehçrt, dass sie – fast 100-jährig – noch im OhoferSchwesternheim lebte. Sie war seit langem bettlägerig. Ob siedas Rosensträußchen und meine Worte noch wahrnahm? Ichweiß es nicht. Die pflegenden Schwestern aber nannten sie «un-ser Engelchen».
Nach ihr war Pastor Brandes Gottes Sprachrohr zu meinerSeele. Zuerst durch die Krippenspiele, die er mit uns Kinderneinübte. Der lange Weg durch den Pfarrgarten bis zur Kirche,vor Kälte zitternd im Engelchen-Nachthemd, das mit Gold- undSilbersternen benäht war, oder als Kind, das mit seiner Laterneandere zum Stall führte, dann auch als Maria mit aufgelçstemHaar … so erhielt Weihnachten seinen Sinn, über die Freude anGeschenken hinaus.
— 31 —

Der zweijährige Konfirmandenunterricht eine Stunde proWoche legte dann feste Grundlagen. Bis heute bin ich dankbarfür die vielen auswendig gelernten Choräle und Bibelverse. Ja,auch große Teile aus Luthers Katechismus mit den Erklärungenmussten wir auswendig lernen. Damals keine große Freude,aber ein Schatz fürs Leben! Und zwei Prüfungen waren amEnde vor der Konfirmation zu bestehen: zuerst vor dem Super-intendenten in Oberg, zu dem wir mit unserem Pastor den sie-ben Kilometer langen Weg radelten, dann vor der Gemeinde.
Bei der feierlichen Konfirmation bebte ich unter der segnen-den Hand des Konfirmators. Ich spürte Gottes Gegenwart. Dervon Pastor Brandes für mich gewählte Konfirmationsspruch wardas Jesuswort an den ungläubigen Thomas: «Selig sind, die nichtsehen und doch glauben» (Johannes 20,29).
Ich war derart ergriffen von der Wahrheit des Evangeliums,dass ich es so gern weitersagen wollte. Ich erinnere mich aneine Szene im Milchladen. Die lose Milch wurde mit unter-schiedlichen Maßen – ein Liter, ein halber Liter, ein viertel Liter– in die mitgebrachten Kannen gemessen. Und in meinem Her-zen das Drängen: Sag es den Leuten, sie müssen an Jesus glau-ben! Aber mein Mund çffnete sich nicht. Es fehlte die Kraft.Hätte es mir weitergeholfen, wenn wir gelehrt worden wären,wie man ein Eigentum Jesu wird? Die Frage, wie man ein JüngerJesu würde, beantwortete unser Pastor: «Es ist zu hundert Pro-zent Gottes Werk und zu hundert Prozent das des Menschen.»Erst sechs Jahre später in England wurde ich weitergeführt.
Aus der Christenlehre – ein Jahr Pflichtbesuch der Gottes-dienste nach der Konfirmation mit anschließender Unterwei-sung der Konfirmierten – haftet, was uns Pastor Brandes mitselbst gemalten Bildern einprägte. Zum Beispiel die Jahreszahlvon Martin Luthers Thesenanschlag an der Schlosskirche zuWittenberg, auf das Dach einer Kirche gemalt, Vorläufer der
— 32 —

später so stark entfalteten «visual aids» als Anschauungsunter-richt.
Diese persçnliche Erfahrung stand hinter meiner Unterstüt-zung von Ruth Läufers Ausbildung von Kindergottesdiensthel-fern später in Batu, Indonesien. Mit welcher Liebe beschafftesie das Bildmaterial für ihre Sonntagsschulhelfer!
Die Jugendstunde bei Pastor Brandes war von frçhlichemSpiel begleitet: Tischtennis und Versteckspiel im weiten Pfarr-garten, Ausflüge und Zeltlager prägten die erste Zeit nach derKonfirmation. Ach ja – das Zeltlager in Meinersen an der Allerum 1948/49, noch im Zeichen des Nachkriegsmangels! Wirschliefen in ausgedienten Wehrmachtszelten auf Stroh, je zehnoder zwçlf Mädchen oder Jungen in einem Zelt. Pastor Brandesund Superintendent Schneider, sein Freund, zu zweit in einemkleinen Zelt, das wir eines Nachts über den Schnarchenden ab-bauten. Sie verstanden Spaß!
Schwierig muss es gewesen sein, die Verpflegung zu beschaf-fen. Gekocht wurde in großen Tçpfen auf offenem Feuer. KeinWunder, dass die kçstliche Schokoladensuppe, mit der die müdeund hungrig auf Fahrrädern eintreffende Jugend empfangenwerden sollte, hoffnungslos angebrannt war. Aber anderes gabes nicht. Wir mussten sie lçffeln! Und der Sojabrei am nächstenTag, ungewohnte Kost aus amerikanischen Armeebeständen,ging allen Geschmacksnerven verquer und wollte nicht rutschen– mit dem Ergebnis, dass wir ihn am nächsten Tag noch einmal,aufgewärmt und leicht angesäuert, bekamen. Der Hunger trieb’srein!
Und trotzdem war es eine herrliche Zeit! Singen, Spielen, Bi-belstunden, Plantschen im flachen Wasser der Aller … wir wa-ren nicht verwçhnt. Es war noch nicht die Zeit des Tourismus.Überhaupt von zu Hause fortzukommen, und wenn es sich nurum dreißig Kilometer handelte, war schon ein Erlebnis. Meiner
— 33 —

Mutter wurde die Woche zu lang. Nach drei Tagen radelte siehinter uns her, um nachzuschauen, ob es der Tochter gut ging,und radelte, nachdem sie sich davon überzeugt hatte, beruhigtzurück.
Ein folgenreiches Erlebnis dieser Jahre war die Erfahrung einesMissionsberichtes. Zwar hatte unser «Opfergroschen» im Kin-dergottesdienst schon immer den Kopf eines Afrikaners zumdankbaren Nicken bewegt. Aber was Mission bedeutete,wurde mir erst durch diesen speziellen Vortrag bewusst. Unddoch habe ich den Inhalt nicht mehr im Gedächtnis. Nur dieschçne Radtour nach Rosenthal, zurück am lauen Maienabendunter Maikäferschwärmen. Aber seit diesem Vortrag war mirklar, dass ich einmal einen Pastor oder einen Missionar hei-raten würde!
Hinzu kam ein mehrmals wiederholter Kindertraum, der ein-zige, den ich behielt: Mit einer Schar kleiner, brauner Leute ret-tete ich Menschen aus Seenot, später aus brennenden Häusern.Diesen braunen Menschen begegneten wir später in Indonesien,und das Bild zeichnete sehr genau unsere Tätigkeit dort – ge-heimnisvolle Spuren Gottes, Vorahnungen unseres künftigenWeges!
Unvergessen sind die Jugendabende im Pfarrhaus. Für die kon-firmierte Jugend gab es in jeder Woche einen geselligen Abend,der mit Bibelarbeit begann und mit Spielen endete. Im SommerTischtennis und Verstecken im weiten Pfarrgarten, der mit Bäu-men und Büschen bestanden war.
Daran nahmen oft auch die teil, die als Flüchtlinge im Pfarr-haus Zuflucht gefunden hatten: der Sohn einer Mennonitin,ein Student, sie setzten bald ihren Weg nach Kanada fort, und«Onkel Rohr», gestrandeter Jurist und Junggeselle, der sonn-
— 34 —

tags die Orgel spielte. Er war ein Original und gewann beimTischtennis oft, weil seine komische Figur – mit unterschiedli-chen Socken, mit Schuhen, die er zu binden vergessen hatte,und mit unnachahmlichen Grimassen – den Gegner durch La-chen ausschaltete. Als ich nach Jahren hçrte, er habe eine Fraugefunden und arbeite in hoher Position im Ruhrgebiet, konnteich es kaum glauben.
Zur Ökumene im Pfarrhaus gehçrte auch ein Ehepaar, das ei-ner Pfingstgemeinde angehçrte. Herr Bender verdiente sein Brotals Herrenfrisçr von Haus zu Haus und gebrauchte die Gelegen-heit, um seine Kunden zu evangelisieren – etwas sehr Unge-wçhnliches in einem niedersächsischen Dorf und zu einer Zeit,in der Glaube schon «Privatsache» war. Aber die Kirche warsonntags gut gefüllt in dieser Nachkriegszeit, vor allem mit denvielen Flüchtlingen, die der Krieg in unser Dorf gebracht hatte.
Auch meine Eltern gingen nun oft in den Gottesdienst, meinekleine Schwester in ihrer Mitte an den Händen haltend. «UnserPlatz war in der vierten Bank von hinten an der rechten Seite!»,erinnerte sie mich.
Zwei Jahre nach meiner Konfirmation ließ Pastor Brandessich versetzen. Sein Nachfolger hatte keine so gute Hand mitder Jugend. Dass seine Frau einmal äußerte: «Ich bin froh, dasser zum Gottesdienst einen Talar anzieht. Dann ist er ein andererMensch!», machte ihn nicht glaubwürdiger vor kritischen Ju-gendlichen. So driftete ich allmählich von der Kirche fort. Einegroße Rolle spielte dabei der humanistische Einfluss der Ober-schule.
— 35 —

10. Mein Weg zur Oberschule
Als ich in der vierten Klasse unserer zweiklassigen Volksschulewar – herrlich, immer schon dem interessanteren Unterricht der¾lteren nebenbei folgen zu kçnnen, denn das 1. und 2. Schuljahrund dann das 3. bis 8. wurden zusammen unterrichtet –, fragteeines Tages der Lehrer: «Wer von euch will die Oberschule inPeine besuchen? Die Anmeldungen zur Prüfung müssen einge-reicht werden.» Spontan meldete ich mich an, ohne zuvormeine Eltern gefragt zu haben. Aus unserem Dorf war ich daserste Mädchen, das zur Oberschule ging und Abitur machte –eine Entscheidung, die für mein Leben Weichen stellte.
Aber die Aufnahmeprüfung! Meine Mutter drängte den Vater,mich darauf vorzubereiten. Er war kurz zuvor aus dem Kriegheimgekehrt, war aber wegen der Entnazifizierung noch nichtwieder als Lehrer eingestellt worden und verdiente den Lebens-unterhalt als Hilfsarbeiter mit Holzfällen im Harz und bei einerEisenfirma in Peine.
Aber – mich durch die Prüfung pauken? Nein! Dazu hatte erzu viele Eltern erlebt, die ihre Kinder über deren Begabung hi-naus fçrdern wollten, aus persçnlichem Ehrgeiz, und ihren Kin-dern untragbare Lasten auferlegten. «Wenn sie auf die Ober-schule gehen will, muss sie die Prüfung allein schaffen.»
Ich schaffte es! Und willig trugen meine Eltern die zusätzli-chen finanziellen Belastungen. Denn Schulgeldfreiheit gab esnoch nicht. Jedes Buch musste selbst bezahlt werden, über diedreißig DM monatliche Schulgebühr hinaus. Das war damalsviel Geld. Dazu kamen noch die Transportkosten. Zum Glückwaren die fünf Kilometer mit dem Fahrrad gut zu bewältigen.
Aber woher bekam man in dieser Zeit, 1946, ein Kinderfahr-rad? Schließlich trieben die Eltern eines auf, ein Jungenfahrrad
— 36 —

zwar, mit Stange, aber das machte nichts aus. Schwieriger war,dass die Schläuche nichts mehr taugten. Oft reichte die Luft biszur Schule, aber beim Heimweg war der Reifen platt, und ichmusste heimwärts schieben oder zu Vaters Firma am entgegen-gesetzten Ende der Stadt, damit er schnell den Reifen reparierte.
Im schneereichen Winter musste ich andere Mçglichkeitensuchen. Der Bus war übervoll, wenn er in unserem Dorf, derletzten Station vor der Kreisstadt, ankam. Also zur Kleinbahnnach Klein Ilsede, zwei Kilometer Fußmarsch durch die Wie-sen! – auf dem Rückweg abgekürzt, indem wir etliche hundertMeter vor dem Bahnhof aus dem fahrenden Zug sprangen, un-seren Schultornistern hinterher, die wir vorher abgeworfen hat-ten. Es war nicht ungefährlich und verboten, aber keinem ge-schah etwas.
Eine andere kostenlose Mçglichkeit gab es, indem wir mitdem Milchtrecker fuhren, der die großen Milchkannen der Bau-ern aus Handorf zur Molkerei nach Peine brachte. Dazu mussteman flink und gelenkig sein, denn der Fahrer nahm keine Rück-sicht auf uns Kinder. So hieß es schnellstens auf- und absteigen,solange er die Milchkannen auflud. Dann saßen wir oben aufden Kannen auf dem offenen Anhänger, passten auf, dass wir un-sere Beine nicht zwischen den schweren Gefäßen einklemmtenund zogen gegen Regen, Schnee und Sturm unsere Kapuzen tiefins Gesicht. Meist war das die Lçsung für den Hinweg, währendwir für den Rückweg die Bahn nach Klein Ilsede bevorzugten.
Die Klassen waren übervoll zu jener Zeit. Am Lyzeum, derOberschule für Mädchen, gab es drei Parallelklassen zu Beginn,mit je über fünfzig Schülerinnen – zum Abitur waren wir ausallen dreien noch ganze elf. Etliche Familien waren weggezo-gen, aber es wurde auch sehr gesiebt! Ich erinnere mich, dassunsere Franzçsischlehrerin in der 13. Klasse zu uns sagte: «Nungehçrt ihr zur Elite Deutschlands!»
— 37 —

Die Anzahl der Abiturienten zu jener Zeit lag bei fünf Prozentmeines Jahrgangs, wobei die Mädchen wiederum weniger alsein Fünftel davon ausmachten. Wir waren an unserem Lyzeumüberhaupt die erste Klasse, die bis zum Abitur geführt wurde.Mädchen, die vor uns in Peine Abitur gemacht hatten, musstenan die Oberschule für Jungen wechseln, das waren dann kaummehr als drei bis fünf Mädchen pro Jahrgang.
Als erste Abiturklasse des Lyzeums bekamen wir besondersviel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Natürlich wollten Schul-leitung und Lehrer gut dastehen und den Weg in die Selbständig-keit des Lyzeums mit guten Leistungen bestätigt sehen.
Mein erstes Zeugnis an der Oberschule war jedoch ein Schock!War ich vorher daran gewçhnt, immer die Beste zu sein, sotrübten plçtzlich eine ganze Anzahl Vierer («ausreichend») dieFreude. Es brauchte wohl doch eine große Umstellung von dergemütlichen Dorfschule in die Stadt mit der Konkurrenz derBesten aus dem ganzen Kreis. Aber es dauerte nicht so lange,bis die Vierer verschwanden und auch die Dreier («befriedi-gend») immer weniger wurden. Das Abitur konnte ich alsZweitbeste ablegen.
Von klein auf interessierte mich alles. Eines der frühesten Fo-tos zeigt mich als Dreijährige auf der Schulbank mit ernstemGesicht über einer Fibel. Die Dorfbibliothek verließ ich beimwçchentlichen Büchertausch stets mit einem ganzen Arm vol-ler Bücher, die dann in Stçßen auf meinem Nachttisch lagen.Es konnte geschehen, dass ich eine ganze Nacht hindurch lasund nur schnell, wenn ich die Mutter morgens hinunterkom-men hçrte, noch das Licht lçschte und mich schlafend stellte.Und wenn ich später meine Bücher aus der Leihbücherei inPeine bezog, kam es wohl vor, dass ich auf halbem Weg vom
— 38 —

Fahrrad stieg und, neugierig im Straßengraben sitzend, zu le-sen begann.
Lesen, lesen, lesen – das war fast eine Sucht geworden. Undich las einfach alles, besonders gern Entdecker- und Abenteuer-geschichten, die mir fremde Welten und Kulturen erschlossen.Das vermittelte mir zwar ein breites Allgemeinwissen und ei-nen guten Stil in meinen Aufsätzen, aber oft stahl diese Suchtmir auch die Zeit und Treue gegenüber den erteilten Aufgabenund Pflichten, so dass ich nicht das mir mçgliche Beste erreichte.
Im Alter von dreizehn, vierzehn Jahren fielen mir ständig Ge-dichte ein. Es konnte geschehen, dass ich mitten im Abtrocknendas Geschirrtuch fortwarf, um die Verse aufzuschreiben. Undnatürlich war es ein erhebendes Gefühl, als unsere Zeitung einFrühlingsgedicht unter meinem Namen abdruckte! Als sich da-raufhin ein «Dichter» bei mir meldete und mit grüner Tintelange Briefe mit seinen Gedichten und Kompositionen schrieb,die mit rotem Siegellack versiegelt waren, war ich schwer be-eindruckt. Doch als er mich besuchen wollte, wehrte ich ab –sicher eine Bewahrung.
11. Unter dem Einfluss von Lessing,Goethe und Hesse
Von der Mittelstufe an geriet die Lehre des Humanismus, diebesonders im Deutschunterricht durch die Lektüre von LessingsRingparabel in «Nathan der Weise» und den Goethe verehren-den Deutschlehrer an uns herangetragen wurde, in Konkurrenzzu meinem christlichen Glauben.
Zwar hatte ich mich einer kleinen Schülergruppe angeschlos-sen, die sich unter der Leitung eines frommen Abiturienten all-
— 39 —

26. Aufbruch nach Indonesien
Dann standen wir Mitte Februar 1963 auf dem Lübecker Haupt-bahnhof. Es war ein trüber, kalter Wintertag. Mitten im mor-gendlichen Menschengetümmel eine kleine Schar Treuer, dieuns verabschiedeten, darunter auch David Batchelor, der ausEckenfçrde angereist war. Wir sangen miteinander die vierteStrophe aus dem altbekannten Missionslied «Einer ist’s, an demwir hangen»:
«Heiland, deine grçßten Dingebeginnest du still und geringe,was sind wir Armen, Herr, vor dir?Aber du wirst für uns streitenund uns mit deinen Augen leiten,auf deine Kraft vertrauen wir.Dein Senfkorn, arm und klein,wird endlich, ohne Scheindoch zum Baume, weil du,Herr Christ, sein Hüter bist,dem es von Gott vertrauet ist.»
Unter dem Singen, so erzählte uns Volkhards Mutter später – siegab nun auch ihren zweiten Sohn in die Mission, nicht ohneSchmerzen –, schenkte Gott ihr eine Vision: Sie sah plçtzlichhinter uns eine große Menge brauner Menschen mit strahlendenGesichtern. Es war eine trçstende Verheißung für das Opfer, dassie ihrem Herrn brachte.
Zunächst ging es zu Freunden nach Rotterdam. Tina van derGaag, die mir am MTC in Glasgow begegnet war, hatte uns zuihrer Familie eingeladen. Unsere erste Erfahrung mit hollän-
— 87 —

dischen Sitten: Bohnenkaffee kurz vor dem Schlafengehen. Siebegleitete uns am nächsten Tag nach Amsterdam, wo die MSBraunschweig startbereit im Hafen lag. Im Wasser schwammenEisschollen, der Himmel grau. Wie gut, dass unsere Eltern nichtmitgekommen waren. Der lange Abschied von den Winkendenam Kai, während das Schiff langsam ablegte und seinen Wegnahm, wäre herzzerreißend gewesen. Ade, Europa!
Mit einem Frachtschiff zu reisen hat besondere Reize. Die ganzeZeit speisten wir beide und eine Dame im besten Alter, die täg-lich in neuer Garderobe erschien, am Tisch des Kapitäns und desSteuermanns. Drei katholische Priester, die einzigen anderenPassagiere, saßen beim Schiffsingenieur.
Kapitän Eichholz, zu dem sich ein herzliches Verhältnis ent-spann, nahm uns in jedem Hafen, wo wir anlegen und Frachtlçschen oder laden mussten, in seinem Auto mit auf interessanteTouren: von Port Said nach Kairo zu den Pyramiden, von Adenin die Wüste des Südjemens, in Ceylon (heute: Sri Lanka) hinaufnach Kandy, und von Belawan, der brütend heißen HafenstadtNordsumatras, nach Medan – ein Riesenbonus, den unser Vaterim Himmel sich für uns ausgedacht hatte. Später besuchte unsder Kapitän in Batu, um sich zu überzeugen, wie wir wohnten.
Zunächst aber bekamen wir, was ich mir schon immer ge-wünscht hatte – aber eine solche Erfahrung reicht fürs Leben! –,in der Biscaya einen ordentlichen Sturm. Unser Schiff, das keineschwere Fracht in den Laderäumen hatte, dafür aber schwereGlasfässer mit Ameisensäure für die Kautschuk-Produktion aufSumatra an Deck, schwankte von einer Seite zur anderen.
Nun verstand ich, warum die geräumige Kajüte mit eigenemBad eine Notwendigkeit war. Man schaffte es sogar nicht immerbis dahin, wenn man sich übergeben musste. Drei Tage undNächte blieb ich im Bett, hielt mich krampfhaft an beiden Seiten
— 88 —

fest und schaute einer Weinbeere zu, die zum Bullauge rollte,wenn es fast in die rollende See tauchte, und auf die andere Seitedes Raumes, wenn nur Himmel zu sehen war.
Volkhard konnte zu den Mahlzeiten gehen, wobei Tische undStühle am Boden befestigt wurden, Teller und Gläser nur halbgefüllt, damit nichts rutschen oder überschwappen konnte. Ichkonnte nichts essen. Erst als wir durch die Meerenge von Gibral-tar ins Mittelmeer eingebogen waren, beruhigte sich mein Ma-gen. Ich erinnere mich heute noch – nach gut vierzig Jahren –daran, wie mir die erste Schwarzbrotschnitte mit Butter danachmundete. Volkhard neckte mich lange: «Drei Tage lang hast dumich überhaupt nicht angesehen!»
Doch dann standen wir fasziniert am Bug des Schiffes. Überder afrikanischen Küste, die wir zum ersten Mal sahen, breitetesich ein zartgrüner Hauch von Frühling aus. In der Nähe vonKreta, wo Paulus in Seenot geriet, noch einmal bewegte See:«O bitte, nicht noch einmal Sturm!» Es blieb erträglich.
Port Said am Eingang des Suezkanals. Ein halbes Jahr nachunserer Durchfahrt wurde er gesperrt. Wir konnten ihn nochpassieren, eine große Bereicherung! Unser Schiff musste bun-kern, und weil gerade ein großer islamischer Feiertag war undim Hafen nicht gearbeitet wurde, kamen wir zu einem unver-hofften Aufenthalt.
«Habt ihr ein Glück!», sagte Kapitän Eichholz. «Ich bin dieseRoute schon etliche Male gefahren, aber noch nie konnte ichhier an Land gehen!»
Wir wurden zusammen mit den anderen Gästen eingeladen,die Gelegenheit zu nutzen und nach Kairo und zu den Pyrami-den zu fahren. Welch ein Vorrecht! Entlang den Seitenkanälendes Nils, von denen das Wasser auf die Felder geschçpft wurde,so dass fruchtbares Grün uns begleitete – und auf der anderenSeite Wüste.
— 89 —

Wir standen ergriffen vor den Pyramiden, die wahrscheinlichvon Tausenden von Sklaven in harter Fronarbeit erbaut wurden,kraxelten in ihrem Innern in die leeren Grabkammern und stan-den später im Museum von Kairo vor den Mumien der Pharao-nen. Volkhard ließ es sich nicht nehmen, ein Kamel zu bestei-gen, wovon mir wegen meiner Schwangerschaft abgeratenwurde – leider!
Verleidet wurde mir der sonst so fesselnde Aufenthalt durchdie Zudringlichkeit der bettelnden Araber und ihre Betrügerei-en. Einfache Steine vom Wegesrand boten sie uns schreiend zuteuren Preisen an. Briefmarken, die Pfennige wert waren, ließensie uns teuer bezahlen. Später habe ich es verstehen und ent-schuldigen kçnnen. Wie hart sind ihre Lebensbedingungen!Aber damals erlitt ich einen Kulturschock, den ich noch nichtüberwunden hatte, als wir später auf Ceylon zu einem berühm-ten buddhistischen Tempel, in dem der Zahn Buddhas angebe-tet wurde, mitgenommen werden sollten – ich ließ es mir ent-gehen. Kairo dagegen nicht mit seinen vielen Moscheen, vorbeian der Al-Aksa-Universität, dem Zentrum islamischer Gelehr-samkeit, die Luft erfüllt vom hallenden Gebetsruf von Hunder-ten von Minaretten!
Unvergesslich bleibt die Fahrt durch den Suezkanal. DieSonne ging auf über dem Sinai, am nahen Ufer ritt ein Beduineauf einem Esel, seine baumelnden Beine berührten fast dieErde: wirklich kein erhebender Anblick, dieser Ritt auf einemLasttier, auf dem einmal der Herr aller Herren in Jerusalemeinzog!
Unser nächster Stopp: Aden. Wieder war Zeit zu einer Aus-fahrt in die Wüste. Ein Beduinenzelt, umgeben von Schafen,Ziegen, Menschen in wollenen Gewändern, eine junge Frautrieb mit einem Stecken eine Ziegenherde über den kargenSand – Jahrhunderte alte Abläufe, unverändert!
— 90 —

Nach dem Golf von Aden empfing uns die unendliche Weitedes Indischen Ozeans. Tagelang nur Wasser, tags tiefblau undnachts tausende funkelnde Leuchtalgen in den schwarzen Wo-gen, die am Bug hochschäumten. Darüber wçlbte sich ein herr-licher Sternenhimmel. «Wie groß bist DU!»
Irgendwann kam uns ein anderes Hapag-Lloyd-Schiff ent-gegen, Hupen und Winken von Schiff zu Schiff. Wir spüren dasHeimweh des Ersten Offiziers nach seiner Frau und seinen Kin-dern: «Die da drüben sind bald zu Haus.» Er trug sich mit demGedanken, nach dieser Fahrt einen längeren Landurlaub ein-zulegen.
Danach Ceylon: ein Juwel. Über eine sich den Berg hinauf-windende Straße, vorbei an Bäumen, in denen Kolonien vonFlughunden (große Geschwister unserer Fledermäuse) kopf-unter hängend den Tag verschlafen. Endlich Kandy und seinweltberühmter Park mit seltenen exotischen Pflanzen. Auf sei-nen gepflegten Wegen Singhalesinnen in ihren leuchtend roten,gelben, blauen und grünen Saris lustwandelnd. Ein bezaubern-des Bild!
27. Nach sechs Wochen endlich in Indonesien
Und wieder Indischer Ozean, tagelang, bis wir uns Sumatra nä-hern. Die ersten Fischerboote mit indonesischen Menschen tau-chen auf. Mein Herz, mein Geist wird überflutet mit einer Welleder Liebe: «Dieses ist nun mein Volk!» Von da an habe ich michin Indonesien nie fremd gefühlt. Eine kostbare Erfahrung!
Vor Medan lagen wir zehn lange Tage weit außerhalb des Ha-fens vor Anker, zusammen mit vielen anderen Schiffen, dieFracht lçschen wollten. Es gab nur einen Kai und überalterte
— 91 —

Kräne, viel Menschenpower war zum Entladen nçtig. Heiß,heiß, heiß! Wir waren ja fast am ¾quator. Und dazu Windstilleund hohe Luftfeuchtigkeit. Wegen meiner Schwangerschaft warmir besonders heiß, oft konnte ich keinen Faden auf mir ertra-gen und legte mich im Evaskostüm auf den kühlen Fußbodenunserer Kajüte. Die Tage dehnten sich. Wann ging es endlichweiter? Es war eine Erlçsung, als wir endlich, endlich den Hafenanlaufen konnten.
In Medan hatte unser Kapitän Freunde. Sie luden uns mit einin ihre Villa; er Deutscher, verheiratet mit einer wunderschçnenFrau mit holländischem und indonesischem Blut. Und an ihrerSchlafzimmertür der Reim: «Auch bei dreißig Grad im Schattendarf die Liebe nicht ermatten!» Es gab eine festliche Reistafel,viele, viele kleine Schalen mit unbekannten Kçstlichkeiten. Einewurde mir zum Verhängnis, ich hielt den Inhalt für zarte, grüneBohnen und führte einen Lçffel voll zum Mund. Hui, war dasscharf! Unhçflich wollte ich nicht sein und schluckte das Zeughinunter. Mir war, als schlügen Flammen aus meinem Mund:grüne Peperoni! Damals in Deutschland noch kaum bekannt.Den Rest der Mahlzeit konnte ich nichts mehr schmecken.
Unser nächster Hafen war Singapur, schon damals aufstre-bende Handelsstadt. Wir staunten über modernstes Spielzeugund über die Sauberkeit der Straßen. «Schaut sie euch noch ein-mal gut an», sagte unser Kapitän, «das sind für euch die letztengepflegten Straßen mit europäischem Standard.»
Die Fahrt nach Singapur, vorbei an den Riau-Inseln, hatte unsahnen lassen, welch ein Inselreich wir ansteuerten. Das Landder über 13.000 Inseln, grçßere und kleine, mit tropischemWald und weißen Stränden, viele unbewohnt, geheimnisvollund verlockend.
Hier überquerten wir den ¾quator. Und natürlich gab esfür alle, die das zum ersten Mal machten, die ¾quatortaufe.
— 92 —

Ein großes Spektakel, die jungen Matrosen wurden hart ran-genommen. Eine der Mutproben: durch einen halb mit Was-ser gefüllten Schlauch von circa sechzig Zentimetern Durch-messer hindurchkriechen, in den auch noch hineingespritztwurde.
Für die Passagiere ging es humaner zu. Aber alle mussten zurTaufe auf einem Bild des Meeresgottes Poseidon niederknienund auf seinen Namen getauft werden, um dann eine Tauf-urkunde aus der Hand des Kapitäns zu empfangen. Ich schämemich bis heute, dass wir das mitmachten, um keine Spielverder-ber zu sein – im Grunde eine unverzeihliche Feigheit. Wir sindsehr dankbar, dass Gott es während der Erweckung ans Lichtbrachte, um uns davon zu reinigen und zu lçsen. Doch davonspäter.
Endlich Jakarta, die Hauptstadt unserer neuen Heimat! Eigent-lich sollten wir hier das Schiff verlassen und mit dem Flugzeugnach Surabaya fliegen, um die Jahreskonferenz des WEC nichtzu verpassen, auf der wir unsere künftigen Mitarbeiter von denverschiedenen Inseln hätten kennen lernen kçnnen.
Aber in Jakarta hçrten wir, dass keine Flugzeuge in Surabayalanden konnten, weil gerade der Vulkan Gunung Agung auf Baliausgebrochen und die Luft so voller Asche war, dass keine Sichtwar. Also blieb uns nur übrig, mit dem Schiff nach Surabayaweiterzufahren.
Um die für uns deponierten indonesischen Rupiah für dasFlugticket abzuholen, mussten wir ein Taxi in die Stadt nehmen,unsere erste Erfahrung mit der Hilflosigkeit sprachunkundigerNeulinge. Der Taxifahrer kurvte und kurvte herum, bis es Volk-hard zu dumm wurde und er an einer Kreuzung aus dem halten-den Wagen sprang. Endlich fand der Fahrer das Ziel – aber dieFahrt kostete uns ein Gutteil des Flugpreises.
— 93 —

Die andere Erfahrung war positiver. Wir genossen einige Tagedie liebe- und verständnisvolle Gastfreundschaft des EhepaarsLavalata, während das Schiff die Ladung lçschte und die Reisefortsetzte.
Jakarta, feuchtheiß um dreißig Grad. Kaum hatte ich mich einwenig erfrischt mit der indonesischen Dusche – aus einem ge-mauerten Becken im Badezimmer, in dem das Wasser aufgefan-gen wird, solange es läuft, begießt man sich mit einem Schçpfervon oben bis unten –, war ich während des Ankleidens schonwieder schweißnass und hätte am liebsten wieder von vorn be-gonnen. Ja, das Badezimmer wurde mein Lieblingsort.
Endlich ging es weiter. Semarang war der nächste Stopp. Wirverzichteten auf den Landgang und hçrten uns das Schwärmenunserer Mitpassagierin von den smaragdenen Reisfeldern in derGewissheit an: Hier würden wir ja bleiben. Gewiss konnten wires später nachholen.
Allmählich fieberten wir unserem Ziel entgegen: Surabaya. Werwürde uns abholen? Vom hohen Bug schauten wir auf den Kaihinunter, auf dem sich eine Menschenmenge drängte. BrauneMenschen; aber nicht nur ihre Kçrperfarbe erweckte den Ein-druck von Dunkelheit, mehr noch der Ausdruck ihrer Gesichter.
Und dann plçtzlich sahen wir unsere Abholer, mitten in derdunklen Menge drei Gesichter, die uns strahlend anlächeltenund heraufwinkten: Pak Octavianus und Pak Djami2, unserekünftigen indonesischen Mitarbeiter, und unser Bruder undSchwager Detmar.
Die beiden Indonesier waren ebenso braun wie die anderenMenschen um sie herum und doch irgendwie hell. Vom erstenAnblick an verbanden uns Vertrauen und Liebe. Es dauerte nochStunden, bis uns erlaubt wurde auszuschiffen. Unsere Kistenblieben beim Zoll. Und dann sollte es noch Wochen dauern und
— 94 —

viele vergebliche Autofahrten zwischen Batu und Surabayabrauchen, bis sie endlich freigegeben wurden.
Doch nun fuhren wir mit unseren drei Brüdern die neunzigKilometer bis Batu durch unser neues Land. Es wurde schnelldunkel, wir befanden uns ja auf dem siebten Breitengrad unterdem ¾quator, wo die Dämmerung nur kurz ist. Wenig Beleuch-tung in den Dçrfern, durch die wir fuhren, zumeist nur Öllam-pen. Auch in den kleineren Städten nur hier und da Öllaternenals Straßenbeleuchtung. Umso heller leuchteten die Sterne.
Viel unterhalten konnten wir uns auf der Fahrt nicht. Die paarBrocken Indonesisch, die wir uns während der Schiffsreise an-geeignet hatten, reichten nicht weit, und ebenso gering warendie Englischkenntnisse unserer Begleiter. Ein Satz kehrte immerwieder: «Yes, he is a spiritual man», wenn wir auf Freunde zusprechen kamen.
Es gab damals noch keine Indonesischkurse in Deutschland,und Detmar hatte uns geraten, mit dem Erlernen der Spracheerst im Land zu beginnen, um uns nicht falsche Aussprache undBetonung anzugewçhnen. Im Herzen dankten wir laut demHerrn: am Ziel! In unserem Land und unter unserem Volk!
Gisela, unsere Schwägerin, empfing uns auf dem dunklenSchulkomplex und lud uns in ihre Wohnung ein. Die Studenten,die den ganzen Tag bereit gestanden hatten, uns zu empfangen,waren auf ihre Zimmer gegangen. Es war ja ungewiss, wannund ob wir an diesem Tag noch ankommen würden. Es warlange vor der Zeit der Handys, und auch das Telefonierenklappte nur, wenn man Glück hatte und verbunden wurdebzw. die Person am anderen Ende verstehen konnte.
Aber da waren wir endlich, alle übermüdet, so dass sie unsnach kurzer Erfrischung auf unser Zimmer brachten: das Gäs-tezimmer der noch nicht lange erweiterten Schule, spärlichmçbliert. Aber für uns waren jetzt nur die Betten wichtig. Sie
— 95 —

waren feuchtklamm, wir waren aus der feuchtwarmen Ebeneachthundert Meter in die Hçhe gefahren. Das kühlere Klimahatte uns angenehm überrascht.
Die Abkühlung in der Nacht lernten wir bald zu schätzen,denn wenn die Sonne aufging, konnte es schnell heiß werden.
28. Erste Eindrücke in Batu
Unser erster Morgen in Batu – unvergesslich! Sonnenaufganghinter dem nahe gelegenen Vulkan Arjuno bei Tretes, ein leuch-tendes Morgenrot über frischen, smaragdfarbenen Reisfeldernund einigen hohen Palmen. Bald würde die schnelle Sonne überden Arjuno steigen, immerhin 3360 Meter! Es war gerade sechsUhr in der Frühe. Von den hçher gelegenen Feldern, auf denenHolländer während der Kolonialzeit europäische Gemüsesorteneingeführt hatten, kamen zierliche, aber zähe Männer in federn-dem, fast tänzerischem Laufschritt. Auf ihrer Schulter an einerwippenden Bambusstange schwere Kçrbe mit Mçhren undKohl. Von der anderen Seite aus dem Dorf ein Bauer mit seinenweißen Zebukühen. Sie trugen Glçckchen am Hals, die zu unsheraufklangen.
Wir tranken diese ersten Eindrücke mit staunenden Augen,am großen Fenster des Gästezimmers im ersten Stock stehend:diese Farben! Diese Stimmung! Unweit vor und unter uns flossein Flüsschen, in der Regenzeit später erlebten wir seine tosendeFlut, momentan war es nur ein Bach. Der Bauer hielt an undwusch darin seine kostbaren Kühe. Ein wenig später tauchtendie Gemüsebauern an derselben Stelle ihre Kçrbe ein und be-sprengten deren Inhalt, damit die Mçhren und der Kohl leuch-tender und frischer auf dem Markt ankamen, der nur noch zwei
— 96 —

Kilometer entfernt war. Bis zu zwçlf Kilometer hatten die Trä-ger mit ihren schweren Lasten schon hinter sich.
Und dann wurde derselbe Platz zum Zähneputzen und zumErledigen notwendiger menschlicher Geschäfte benutzt! – Ichmuss gestehen, dass ich in den nächsten Tagen ein wenig Mühehatte, das Gemüse zu essen, aber durchaus keine Mühe zu ver-stehen, dass Salate zuerst in einer Lçsung aus Kaliumpermanga-nat gebadet werden mussten.
Detmar holte uns ab zum Frühstück. Sie wohnten – er war jainzwischen Rektor des Instituts – in einem Haus hinter der Kir-che, vor Jahren einmal Kirche der Holländer, die in Batu ihre Fe-rien verbrachten. Im Unabhängigkeitskrieg war sie zum Teilzerstçrt und zu einer Lagerhalle für Holzkohle geworden, undsogar Ziegenstall. Bis Heinrich (Heini) German-Edey, SchweizerWEC-Missionar, sie dann auf der Suche nach einem hçher gele-genen Standort für seine in der staubigen Kediri-Ebene vonAsthma geplagte Frau gefunden hatte.
Sie waren dann zunächst in ein Haus in der Nähe gezogen,von wo aus Heinrich vor allem Literaturarbeit betrieb. Indone-sien lernte soeben lesen. Die Holländer hatten nur eine kleineBevçlkerungsschicht geschult, gerade so viel, wie sie für ihre Re-gierungsbeamten bençtigten. Die breite Masse waren Analpha-beten geblieben, dazu in viele Regionalsprachen zersplittert.
Doch seit der Unabhängigkeit 1945 hatte Indonesien zweigroße Errungenschaften ausgebaut: eine gemeinsame Sprachefür alle und Schulen in jedem Dorf. Ein Riesenprojekt, mit enor-mer Opferbereitschaft und Patriotismus betrieben! Natürlichkam man mit der Lehrerausbildung kaum nach, und Lesemate-rial für so viele Wissbegierige gab es kaum.
Das war die große Zeit der Literaturmission, die immerstärker die davor betriebene Schallplattenmission ablçste. In
— 97 —

einem Schuppen lagerten noch Hunderte von Platten in ver-schiedenen indonesischen Sprachen, hergestellt von GospelRecordings, einer bewundernswerten amerikanischen Mis-sion. Sie wurden auch noch mit einfachsten Plattenspielern,von Hand betrieben, von den Bibelschülern bei ihren Einsät-zen gebraucht.
Aber jetzt begann die Zeit der neuen Leser. Heini Germanwar ein Visionär, immer am Ball, und einer, der in großem Maß-stab arbeitete. Traktate wurden tonnenweise eingeführt undnicht nur einzeln verteilt, sondern auf Fahrten durch das Ge-birge oder in anderen Ortschaften bündelweise abgeworfen.Jung und Alt stürzte sich auf das Lesematerial.
Da diese Aussaat mit viel Gebet begleitet wurde, brachtesie in den Jahren darauf Frucht: erste Gläubige, bald Gemein-den und Kirchen an den viel befahrenen Straßen entlang. DieBibelschüler konnten bei ihren Wochenendeinsätzen undPraktika die junge Saat pflegen und begießen und nach weni-gen Jahren, als Gott Erweckung schenkte, schon eine großeErnte einbringen.
Inzwischen sah Heinrich German eine neue Aufgabe. An sei-nem Familientisch hatte er ein paar Studenten, die in Malang zueinem lebendigen Glauben an Jesus gekommen waren. Nun hal-fen sie ihm bei der Literaturarbeit, und er unterwies sie auf ihrDrängen hin jeden Morgen in der Bibel. Es wurden mehr, diesich Gott zur Verfügung stellten und eine Ausbildung brauchten.
So hatte Heini German sich schließlich um die Kirchenruinebemüht und sie mit einem Stück Land pachten kçnnen. Aufdem Grundstück hinter der Kirche baute er ein einfaches Lang-haus, halbhoch mit selbst gebrannten Backsteinen, darüber ausgespaltetem Bambus geflochtene Mattenwände, deren Ritzenmit Kalkweißung verschmiert waren. Ein Wohnraum, eineHandvoll Schlafzimmer, dahinter eine Küche.
— 98 —

Die Kirche wurde wiederhergestellt als Klassen- und An-dachtsraum und Schwager Detmar, der als Bibellehrer in Mittel-java an die Neukirchner Mission ausgeliehen war, zur Mithilfeherbeigerufen. Im Jahr vor unserer Ankunft hatte sich die Zahlder Studierenden auf 65 verdoppelt. Mehr Wohnraum und grç-ßere Klassenzimmer waren nçtig geworden. Hinter der Kirchewaren sie mit Unterstützung von «World Vision» gebaut wor-den. Dazu Lagerräume für Literatur und Kassetten und das Leh-rerhaus, in dem wir nun mit Detmar und Gisela frühstückten.
Heini German hatte die Leitung der Schule Detmar überge-ben und sich mit seiner Organisationsgabe World Vision zurVerfügung gestellt, das gerade anfing, sein großes Hilfsprojektfür die Opfer des Vulkanausbruchs auf Bali zu entwickeln.
Die Mahlzeiten bei Detmar und Gisela wurden unsere inoffi-zielle Einführungszeit in Land und Leute und in unsere Auf-gaben. Wir hatten sie bitter nçtig, denn zu Hause gab es nochkeine Einführung in «Crosscultural Communication».
Den ersten Schock mit seinen neuen, unerfahrenen Mitarbei-tern erlebte Detmar nach der ersten Mahlzeit. Die Studentenwollten uns begrüßen und empfingen uns in der Kirche mit ei-nem Lied, das sie in deutscher Sprache einstudiert hatten. Wirwaren zu Tränen gerührt. Welche Liebesmüh stand dahinter!Pak Oktav sprach wegweisend zu uns über die Grundlage unse-res Arbeitens: «Jesus Christus in euch, die Hoffnung der Herr-lichkeit!» (Kolosser 1,21).
Danach das obligatorische Gruppenfoto vor der Kirche. Volk-hard legte seinen Arm um meine Schultern. Detmar bekam fasteinen Schlag. Da kamen die neuen Lehrer und führten sich beiihren zukünftigen Schülern mit etwas kulturell Unmçglichemein! Nicht einmal Händchenhalten war zu jener Zeit in der Öf-fentlichkeit üblich. Ehepaare auf den Dçrfern gingen nicht ne-
— 99 —

beneinander, sondern die Frau immer einen Schritt oder mehrhinter ihrem Mann.
Vierzehn Tage lang wohnten wir im Gästehaus und aßenbei Detmar und Gisela, lernten von ihnen, was nçtig war, umselbständig weiterzukommen. Dann konnten wir in ein Mit-arbeiterhaus ziehen, das gerade frei geworden war, weil daskanadische WEC-Ehepaar sich einer Arbeit in Mitteljava an-schließen wollte.
Einen Teil ihrer Mçbel hatten sie noch nicht mitnehmen kçn-nen – eine große Starthilfe für uns. Ein eigenes Bett, das Detmarund Gisela uns als ihr Hochzeitsgeschenk hatten bauen lassen,stand schon im Schlafzimmer. Als endlich unsere Kisten ange-kommen waren, konnten wir aus dem mitgebrachten Matrat-zenstoff eigene Matratzen anfertigen lassen. Da wir den uns ge-gebenen Rat: «Lasst sie gut mit Kapok füllen!», an den Herstellerweitergegeben hatten, presste er so viel Kapok hinein, wie derStoff halten wollte.
Wir erhielten eine derart schwere Doppelmatratze, dasswir sie nur mit Mühe anheben konnten. Die harten Hügel,die sich zwischen den Knçpfen erhoben, machten mir in denletzten Wochen der Schwangerschaft doch sehr zu schaffen.Aber erst nach Monaten sahen wir ein, dass unsere Erwar-tungen, die Hügel allmählich weichliegen und einebnen zukçnnen, vergeblich waren. So brachten wir die Matratzezum Hersteller zurück und baten ihn, wieder etwas Kapokherauszunehmen. Das überschüssige Material war genug füreine zwei mal einen Meter große Matratze, die auch nochreichlich gefüllt war!
— 100 —

29. Wieder lernen
Wir waren Lernende in jeder Beziehung! Ein Handwerker inDeutschland hätte uns bei einem Auftrag einen vernünftigenVorschlag gemacht. Hier tat man, was der weiße Herr, dieweiße Frau wollte. Sie «wussten ja ohnehin alles besser» – odermeinten es jedenfalls. Es war noch die Zeit, in der man zu denEuropäern aufsah, wenn auch zuweilen in einer Art Hassliebe.Die älteren Menschen schienen noch durchaus positiv auf dieZeit der holländischen Kolonialherrschaft zurückzublicken.Manch einer hatte als Gärtner oder als Kçchin oder in anderenDiensten eine sichere Einnahmequelle gehabt und war danachin Armut gesunken. Von ihrer Seite trafen uns freundliche, jamanchmal ehrerbietige Blicke.
Anders die Kinder! In den Schulen wurde die Kolonialzeit, diedurch die Revolution beendet wurde, negativ dargestellt. Da riefschon einmal ein Kind oder Jugendlicher: «Londo, Londo!», hin-ter uns her, wie Holländer im Slang genannt wurden. Aber wirk-liche Ablehnung oder gar Feindschaft begegnete uns kaum. Ander Bibelschule wurden wir von den indonesischen Lehrerkolle-gen und Studenten überaus freundlich, ja mit Liebe und einemgroßen Vertrauensvorschuss angenommen.
Zunächst war das Sprachstudium unsere Hauptaufgabe. Fürdie noch junge indonesische Sprache gab es keine Lehrbücherfür Ausländer, sie war ja noch in der Entwicklung begriffen. Aufdem Handels-Malayischen, das an den Küsten der Inseln gespro-chen wurde, aufbauend, entstand durch Anreicherung aus demJavanischen und Sanskrit ein neues handliches Idiom, das es unsDeutschen sehr leicht machte: Die Klangfarben der Vokale wa-ren identisch mit denen in unserer Sprache, eine einfache Gram-matik mit nur drei Zeiten, lateinische Schrift.
— 101 —

Dazu «erbten» wir eine fähige Lehrerin, Ibu Soeti Rahayu3,die schon vor uns Missionaren Sprachunterricht gegeben hatteund nach uns allen Neuen half. Eine gebildete, feine Christin,die wir sehr verehrten.
Allerdings musste ich nach fünf Unterrichtsstunden aufhçren.Wir mussten zu ihr nach Malang hinunterfahren. Die zwanzigKilometer waren derart mit tiefen Schlaglçchern gespickt, dasswir um unser Baby fürchten mussten. Ich war inzwischen imsiebten Monat meiner Schwangerschaft. So fuhr Volkhard alleinmit dem Unterricht fort.
Ich versuchte zu Hause aus seinen Mitschriften klug zu wer-den und dachte mir eine mir passende Methode aus, die Sprachezu erlernen. Zunächst legte ich meine deutsche Bibel fort undmachte meine Stille Zeit mit der indonesischen. Bekannte Texteerleichterten das Verstehen. Darüber hinaus nahm ich mir vor,jeden Tag drei Lieder aus dem kleinen indonesischen Gesang-heft zu übersetzen, das an der Schule in Gebrauch war. Einebrauchbare Methode, um die geistliche Sprache zu erlernen!Und drittens ging ich jeden Morgen zur Andacht der Studentenund hçrte mich ein in den Klang und die Sprachmelodie. Wçrter,die ich identifizieren konnte, wurden notiert und zu Hausenachgeschlagen, und jeden Morgen wuchs die Freude überschon bekannte Vokabeln.
Volkhard war neben dem Sprachelernen vielgefragterChauffeur der Schule, auch an Wochenenden unterwegs zuEinsätzen der Bibelschüler und in der Woche zu notwendigenBesorgungen. In der ersten Zeit fuhr er auch immer wiedernach Surabaya, um unser Gepäck aus dem Hafen zu bekom-men. Es war ein mühsames Geschäft, denn wir waren nichtbereit, Korruption zu unterstützen und Schmiergelder zu zah-len. Das hatte viele vergebliche Fahrten zur Folge, ehe es end-lich gelang.
— 102 —

Eine andere Schikane erlebten wir bei dem Vertreter des Reli-gionsministeriums, bei dem wir uns bald vorstellen mussten.Pak Rasyid war zwar selbst Christ, aber das hinderte ihn nicht,uns dreimal von Batu nach Surabaya zu zitieren und zweimalstundenlang in seinem Büro warten zu lassen, um uns danndoch unverrichteter Dinge wieder heimzuschicken.
Es waren jeweils zwei Stunden Fahrt für die neunzig Kilo-meter, morgens noch in erträglicher Hitze, dann nach Stundendes Wartens im Stehen oder auf einem unbequemen Stuhl imvollen Büro, wo die Schreibtische der Religionsbeamten der ver-schiedenen Religionen nebeneinanderstanden, bei gegen Mittagzunehmend schwül-heißer, stickiger Luft. Und ich war mitGunnar im siebten Monat. Schließlich wurde uns geraten, sofrüh loszufahren, dass wir Pak Rasyid vor den Bürostunden inseinem Zuhause anträfen. Er çffnete uns im Schlafanzug, ließuns warten, frühstückte im Nebenraum ausgiebig und hattedann endlich Zeit für uns.
Jetzt erklärte er uns auch seine Handlungsweise. Erstenswäre das die Methode der Holländer gewesen, Antragstellerwarten zu lassen und zu schikanieren, und zweitens wolle erneue Missionare prüfen, ob sie demütig seien. Wer eine solcheBehandlung nicht ertrage, der kçnne ebenso gut wieder nachHause fahren, der tauge nicht zu einem Dienst in Indonesien.Wir lernten, das zu akzeptieren, und beschlossen bei uns, denDemutsweg Jesu nachzugehen, bereit zum stellvertretendenLeiden, wo andere Weiße früher Wunden geschlagen hatten.Diese Haltung hat uns manches Herz geçffnet und Vertrauengewinnen lassen.
— 103 —

30. Gunnars Geburt
Drei Monate nach unserer Ankunft in Indonesien nahte die Zeitmeiner Niederkunft. Das Missionskrankenhaus der amerikani-schen Southern Baptists wurde uns empfohlen, und das bedeu-tete fast drei Stunden Fahrt über Gebirge und kaputte Straßen,so dass wir uns «unnçtige Wege» zu einer Voruntersuchung na-türlich gespart hatten. Im letzten Augenblick war diese Reiseaber auch nicht zu schaffen. So waren wir dankbar, dass aus-tralische WEC-Kollegen uns einluden, ein paar Tage Wartezeitbei ihnen in Kediri zu verbringen. Sie bewohnten eine alte, ge-räumige Villa neben einem islamischen Friedhof – kein anzie-hender Ort für Indonesier. Solche Häuser konnte man sehrpreiswert mieten. Und WEC-Missionare schwammen ja durch-aus nicht im Geld.
Auch wir hatten acht Tage vor der Geburt noch nichts für denKrankenhausaufenthalt zurücklegen kçnnen. Aber dann drücktemir ein WEC-Kollege 8000 Rupiah in die Hand. Das reichte fürden Aufenthalt im Krankenhaus. Der Missionsarzt selbst nahmvon Missionaren kein Geld für seine Arbeit. Nur drei Tage muss-ten wir in Kediri warten. Gunnar kam pünktlich.
Die Geburt jedoch war nicht leicht. Neunzehn Stunden inten-sivste Wehen, und es ging nicht voran. Volkhard harrte treu ne-ben mir aus und litt mit mir. Unter den Schmerzen zeigte derHeilige Geist mir Sünde. In meinem Herzen war ich stolz ge-worden, weil ich die ganze Schwangerschaft so problemlos ge-meistert hatte, einschließlich Reisedienst noch in Deutschland,Schiffsreise um die Welt und der Umstellung auf unser neuesLeben mit seinen Härten. War es nicht alles Gnade und Gottesunverdiente Güte gewesen? Worauf sollte ich da stolz sein, jamich über andere erheben, die es schwerer gehabt hatten? Ich
— 104 —

musste es bekennen, und wir nahmen zusammen Gottes Ver-gebung in Anspruch.
Nun wurde auch kein Kaiserschnitt nçtig. Die AnästhesistinDr. Kathleen Jones schlug eine Rçntgenaufnahme vor, die dasHindernis zeigte: Unser Sohn saß in mir fest, das weiche Hinter-teil statt des Kçpfchens hatte die Öffnung des Geburtswegesnicht geschafft. Aber plçtzlich kam doch Bewegung in die Sa-che. Schnell in den Kreißsaal! Man gab mir Lachgas zur Betäu-bung, und ich muss laut gejubelt haben.
Für Volkhard war das zu viel. Er hatte ja auch die vielen Stun-den kaum gegessen und getrunken. Als er zu schwanken be-gann, befahl die resolute Anästhesistin: «Auf den Boden setzen,den Kopf zwischen die Knie!» Dann wurde unter den kundigenHänden des Missionsarztes unser erstes Kind geboren, ein Sohn,Gunnar Nugroho, «Gnadengabe». Als wir nach einer Woche mitihm über das Gebirge heimfuhren, überwältigte uns tiefesGlück. Wir weinten beide Freudentränen.
31. Einüben in neue Verhältnisse
Große Überraschung beim Heimkommen! Inzwischen hattenunsere Vorgänger, deren Mçbel wir gebrauchen durften, dieseabgeholt. Unsere Teller, Tassen und Tçpfe standen auf dem Fuß-boden im Wohnzimmer. Tischchen, Korbsessel und ein paarStühle hatten unsere Mitarbeiter zusammengetragen, um unse-ren Schock zu mildern.
Zum Glück waren endlich unsere Kisten aus dem Hafen an-gelangt. Vier der grçßeren Kisten waren so gebaut, dass wir sieals Schränke verwenden konnten. Ein lieber ehemaliger Mitstu-dent in Tübingen hatte sie in der Schreinerwerkstatt seines Va-
— 105 —

ters mit aufklappbaren Türen und widerstandsfähiger Eisen-umrahmung gebaut. Einfachere Kisten stellte Volkhard hoch-kant auf und baute die Deckel als Zwischenbçden ein. BunteVorhänge waren schnell genäht und auf Draht gespannt unddienten als Sichtschutz für den Inhalt. So bekam ich Küchenmç-bel. Sie passten sehr gut zum rauen Betonfußboden. Auf eineranderen Kiste stand unser Herd: ein mit Kerosin gespeisterBlechkocher, er hatte zwei Kochstellen mit je circa sechzehnDochten. Diese zu pflegen war eine aufwendige Routine.
Dazu hatten wir meist nächtliche Gäste: Wenn ich morgensdie Küchentür çffnete, sprintete eine Schar Ratten an der Holz-wand empor und durch das breite Fenster, das nur mit weit-maschigem Zaundraht verschlossen war, ins Freie. Ich wardankbar für mein von den Großeltern geerbtes bäuerliches Blut,das mir half, mit solchen Haustieren ohne große Abscheu zu-sammenzuleben – und für Gottes wunderbaren Schutz, dasswir uns keine Krankheiten einfingen.
Wir hatten ja auch noch eine Reihe anderer nicht besondershygienischer Mitbewohner, wie Kakerlaken und tjetjaks, eineArt Eidechsen, die mit ihren Haftfüßen an Wänden und Deckenherumkrochen und sich nützlich machten, indem sie die Moski-tos dezimierten. Dazu Ameisen, ganz kleine, die man prakti-scherweise übersehen konnte, und große, wie unsere rotenWaldameisen. Die Füße des Schranks, in dem Zucker und Mar-melade aufbewahrt wurden, standen deshalb in mit Kerosingefüllten Schälchen. Aber wehe, wenn man Süßes oder andereLebensmittel auf dem Tisch stehen ließ!
Und dann gab es noch Termiten, die in Massen im Boden un-ter unserem Haus lebten. Von dort aus bemühten sie sich, unszu besuchen. Nachts bauten sie durch Ritzen im Zementfuß-boden des Flurs fingergroße Türmchen, die wir nicht übersehenund leicht zerstçren konnten. Hinterlistiger waren ihre Anstren-
— 106 —

gungen, unsere Fensterrahmen zu verzehren. Dabei ließen siedie grüne Ölfarbe unbeschädigt, so dass man von ihnen nichtsmerkte, zumal sie nachts arbeiteten. Erst wenn sie schon grç-ßere Lçcher gefressen hatten, brach die Ölfarbe ein und wir sa-hen die Bescherung.
Den grçßten Schreck jagte uns eine fast handtellergroßeSpinne ein, die sich ganz zu Anfang im Moskitonetz über unse-ren Betten eingerichtet hatte. Was tun? Sie konnte ja giftig sein.So kochten wir Wasser, gossen es in einen Eimer, den Volkhardvorsichtig unter sie hielt, und ich schlug von oben auf das Netz –da fiel sie ins heiße Wasser und gab ihren Geist auf.
Unsere Wasserleitung war sehr unzuverlässig. Oft fiel sie ganzaus, dann mussten wir uns Wasser ins Haus tragen lassen. Eingroßes gemauertes Becken im Badezimmer wurde dann gefülltund ein kleineres in der Küche. Der grçbere Schmutz setzte sicham Boden des Beckens ab. Das Trinkwasser musste abgekochtwerden. Für das tägliche Bad unseres Sçhnchens war das zuteuer und aufwendig. Mir blieb, da in der Regenzeit auch nochdas Wasser aus dem Wasserhahn braun wurde, nichts anderesübrig, als ihn in kaffeebraunem Wasser zu baden. Dass es ihmnicht geschadet hat, erstaunt mich heute noch. – «Die Hand un-seres Gottes lag auf uns und beschützte uns.»
Seit wir nach den ersten vierzehn Tagen in unser eigenesHeim gezogen waren, hatten wir eine Haushilfe. Viel lieberhätte ich ja meinen kleinen Haushalt selbst besorgt, beugtemich aber dem Rat der erfahrenen Missionarsfrauen, dass esohne sie nicht ginge. Allein das tägliche Einkaufen auf demMarkt erforderte mit dem langen Weg und dem notwendigenFeilschen mindestens zwei Stunden. Gemüse, Fisch und Fleischmussten ja täglich frisch besorgt werden.
Auch das Kochen ohne Konserven und Fertiggewürze war
— 107 —

eine Zeit raubende Angelegenheit. Ich staunte über die bis zuzwçlf Gewürze, die zu javanischen Gerichten bençtigt wurdenund täglich frisch auf einer Handreibe aus porçsem Vulkan-gestein mit viel Geduld fein gerieben wurden.
Auch die täglich notwendige Wäsche ohne Waschmaschineund Waschmittel außer Kernseife sowie das Bügeln ohne Strommit Holzkohle-Bügeleisen kosteten Stunden. In die Wohnungblies täglich Staub hinein, weil der Hitze wegen Fenster und Tü-ren meist offen standen.
Alles brauchte seine Zeit, denn: Javaner «rennen» nicht. Erstals ich Jahre später, nach einem überstandenen Herzinfarkt,langsamer gehen musste, hçrte ich lobende Zustimmung ausdem Mund meiner älteren Haushilfe: «Jetzt gehst du so, wie esuns gefällt.»
Nicht leicht zu begreifen und zu akzeptieren war auch dasStandessystem, in das wir hineinkamen. Als ich gleich bei ihremArbeitsbeginn eine freundliche Beziehung zu Mbok Sadi, mei-ner ältesten Hilfe, schaffen wollte und sie zu mir winkte, umihr die Fotos meiner Familie zu zeigen, kniete sie neben mir nie-der und war nicht zu bewegen, auf einem Stuhl neben mir zusitzen. Es fiel mir sehr schwer, mit diesem Konzept der Unter-würfigkeit umzugehen.
Es war auch unmçglich, sie an unseren Familientisch einzula-den. Nein, dann schmecke es ihnen nicht! Sie seien es gewohnt,mit den Fingern zu essen, allein für sich, dann fühlten sie sich frei.So richteten wir in jedem der Häuser, die wir nacheinander be-wohnten, immer ein Zimmerchen neben der Küche ein, in demunsere Hilfen ihre Mahlzeiten einnehmen konnten. Auch eineLiege stand darin, auf die sie sich in ihrer Pause legen konnten.
Von Anfang an legten wir Wert darauf, indonesisch zu essen.Deshalb brachte ich meinen Haushilfen keine deutschen Ge-
— 108 —

richte bei. Während Mbok Sadi wusch und das Haus putzte,schickte ich Supiah, unsere geschickte junge Kçchin, auf denMarkt und sagte ihr: «Koch, was ihr gewçhnlich esst, und kaufdafür ein.» Wenn wir mittags die Deckel von den Schüsseln nah-men, hatte ich oft das Verlangen, ein zweites Dankgebet zusprechen, so einladend und raffiniert sahen die unbekanntenGerichte aus!
Erst Jahre später wurden wir über unseren Irrtum aufgeklärt:Eine indonesische Mitarbeiterin, die als Direktorin einer Ober-schule schon in Europa gewesen war, hatte die tief sitzendeHemmung, Weiße zu korrigieren, überwunden. Durch sie er-fuhren wir, dass unsere Mahlzeiten gar nicht so indonesisch wa-ren, wie wir dachten. Supiah hatte sich bei Kçchinnen frühererholländischer Kolonialherren erkundigt, was den Weißen dennschmeckt, und hatte ihren eigenen Mix kreiert. Jedenfalls warendie Ergebnisse lecker.
Wir hatten ja auch das Vorrecht, neben dem vielfältigenAngebot indonesischer Gemüsesorten auf dem Markt Kohl,Bohnen, Erbsen und Mçhren kaufen zu kçnnen, die von denHolländern eingeführt worden waren und auf den fruchtbarenvulkanischen Hängen über uns wuchsen. Tahu und Tempe (So-ja-Produkte), getrockneter, sehr salziger Fisch, manchmal auchFleisch und Eier waren die Proteinquellen.
Reis wurde zur Grundnahrung. Dieser musste täglich sorg-fältig verlesen und gereinigt werden, sonst konnte man leichtauf Steinchen beißen. Dazu wurde er hart gekocht, um längerim Magen vorzuhalten. Volkhards Magen rebellierte anfäng-lich. Aber er war fest entschlossen, diesen Reis essen zu lernen.Wie sollten wir sonst unserem Volk nahekommen, wenn wirihre Hauptnahrung ablehnten? So nahm er monatelang Schmer-zen in Kauf, bis sein Magen sich an die neue Kost gewçhnthatte.
— 109 —

Reis am Morgen war uns dann aber doch zu viel. Man konnteweiches Weizenbrot kaufen, das aber keinen Nährwert hatte.So begann ich schon recht früh, unser eigenes Brot zu backen,was ich bis heute gerne tue. In den Dorfhütten rundherum er-klang zu jener Zeit schon um 4.30 Uhr das Stampfen der schwe-ren Holzstangen, mit denen die indonesischen Hausfrauen denReis für die erste Mahlzeit von seinen Spelzen befreiten. VieleBauern nahmen allerdings morgens nur ein Glas Kaffee mit vielZucker zu sich oder kauften am Wegrand Tape, gegorene Süß-kartoffel. Lecker!
32. Erste Schritte in Verantwortung
Der Mangel an Mitarbeitern in der schnell wachsenden Schulezog uns Neulinge schon bald in die Arbeit. Schon vor der Geburtvon Gunnar hatte meine Schwägerin Gisela mich gebeten, ihrdie Buchführung für die Finanzen der Missionare abzunehmen.Hatte ich mir nicht die erste Englandreise, auf der ich zum Glau-ben fand, mit der Buchführung für unser Bäckerei- und Kolonial-warengeschäft verdient? So war ich doch nicht ganz unerfahren– dachte ich. Und außerdem wollte ich die Aufgabe aus Dank-barkeit dem Herrn gegenüber gern übernehmen.
Doch worauf hatte ich mich da eingelassen! Wir hatten in je-ner Anfangszeit ausländische Mitarbeiter aus sechs Nationen(später wurden es zwçlf): Neuseeländer, Amerikaner, Kanadier,Engländer, Deutsche und Schweizer. Jede Nation mit ihrer eige-nen Währung, die in Rupiah umgerechnet werden musste.
Damit nicht genug: Die indonesische Währung befand sichim freien Fall. Die Inflation veränderte die Umtauschrate vonWoche zu Woche. Bald fasste kein Portemonnaie mehr die täg-
— 110 —

lich bençtigte Summe. Wir wurden alle Rupiah-Millionäre!Doch was das für mich in der Buchführung bedeutete, dazuohne Rechenmaschine, nur mit Papier und Schreibstiftausgestattet! … Ich war wohl noch zu jung für graue Haare,sonst hätte ich bestimmt welche bekommen!
Die Sprache lernen, das erste Baby, unerfahren im so anders-artigen Haushalt und daneben diese unendlichen Spalten vonZahlen – ich muss gestehen, der Monatsabschluss war mir im-mer ein Graus. Nicht selten stimmte die Bilanz nicht. Aus Man-gel an Zeit und Kräften habe ich oft aus der eigenen Taschedraufgelegt und ausgeglichen, jedoch nie genommen, wenn ichzu viel in der Kasse hatte.
Und dann kam der Hammer: Unser neuseeländisches Ehe-paar, das die Verantwortung als Hauseltern für das Studentin-nenwohnheim trug, musste aus Krankheitsgründen in die Hei-mat zurück. Nur wir konnten und mussten folglich einspringen,sechs Monate nach unserer Ankunft in Indonesien.
Zugleich musste Volkhard anfangen zu unterrichten. Er über-nahm den letzten Teil der Heilsgeschichte (Eschatologie) undden ersten Teil der Dogmatik, dazu den Studentenchor. SeineUnterrichtsstunden bereitete er mit seiner Sprachlehrerin IbuSoeti vor, die ihrerseits davon profitierte.
Ich hatte die Studentinnen im Asrama, dem Wohnheim, zubetreuen. Es waren etwa dreißig junge Frauen, die älteste sogarein wenig älter als ich. Sie kamen von Java, Mittel- und Nord-sulawesi, Südsumatra, von Ambon, Alor, Timor und Sumbawa,dazu eine Reihe Chinesinnen aus der großen chinesischen Be-vçlkerung Indonesiens, die weithin den Handel dominierte.Wie wir es im WEC-College erlebt hatten, wo die Nationalitä-ten in den Schlafräumen zwecks Charakterformung bewusst ge-mischt wurden und wo gegen alle Klüngelei die jeweiligen Na-tionalsprachen verboten waren, so handhabten wir es auch hier.
— 111 —

Doch die kulturellen Spannungen zwischen den Volksstäm-men der verschiedenen Inseln waren noch viel gravierender,vor allem zwischen Indonesiern und Chinesen. Timoresinnen(so nannten wir sie) waren gewohnt, dass alles im Haus allenHausbewohnern zur Verfügung stand, wie Eimer, Pantoffeln,Schuhe oder Seife. Chinesen dagegen waren sehr eigentums-bewusst, Konflikte somit vorprogrammiert.
Eine ältere Chinesin mit reichen Eltern hatte Mühe damit,ihre Hausaufgaben zu erfüllen. Das hatten bei ihr daheim ja nurindonesische Angestellte getan, auf die man herabsah. Da halfnur, neben ihr das Klo zu putzen oder zusammen von unseremHofhund Laddy die Läuse abzulesen: Wenn die weiße Missio-narin das tat, konnte man sich leichter zu solchen «niedrigen Ar-beiten» bequemen.
Jene verwçhnte Tochter aus reichem chinesischen Hausewurde später eine treue Mitarbeiterin. Es ging uns ja um Cha-rakterformung, nicht nur um theoretische Wissensvermittlungwie an den Universitäten. Wie dankbar wurde ich, dass ich diefünf Monate am Missionary Training College (MTC) in Glas-gow erlebt hatte!
In die seelsorgerlichen Gespräche ging ich wegen meinernoch mangelhaften Sprachkenntnisse nur mit Zittern und Za-gen. Verstand ich das Anliegen überhaupt? Und konnte ichmich ausreichend verständlich machen?
33. Erste Konfrontation mit okkulten Mächten
Total überfordert fühlten wir uns, als kurz nach der Übernahmedes Mädchen-Asramas eine Krise entstand. Gegen die Prinzi-pien der Schule hatten wir einige ungläubige Mädchen auf-
— 112 —

genommen. World Vision wollte ein Waisenheim auf der InselSumba erçffnen, hatte aber vor Ort keine passenden Kräfte ge-funden und die Schule gebeten, einige junge Frauen von dortauszubilden. Die wurden merkwürdigerweise nachts gestçrt,hçrten Schritte, oder es wurde an ihrer Bettdecke gezogen.
«Ach, Mitstudentinnen spielen euch einen Streich!», ver-suchte ich zu beruhigen.
«Nein, nein! Das sind bçse Geister, die uns belästigen – bitte,bitte nicht das Licht ausmachen!»
Schulregel war, das Licht um 22.00 Uhr zu lçschen, da derTag um 4.45 Uhr morgens begann.
«Bçse Geister! Ihr habt daheim zu viele Gruselgeschichtengehçrt!» Mein aufgeklärtes Denken wollte diese Wirklichkeitnoch nicht wahrhaben. Plçtzlich fiel eines der Mädchen im Ba-dezimmer in Trance, wiegte sich dann ohne Wachbewusstseinauf ihrem Bett sitzend hin und her.
Endlich fingen Volkhard und ich an, um Klarheit zu beten. Daerçffnete uns unser Nachbar: O ja, das Wohnheim der Studen-tinnen sei zuvor das Haus des Dorfoberhauptes gewesen. Derhabe zu seinem Schutz dort einen Geist «angepflanzt», in derNähe des Badezimmers. Als das Haus leer stand, habe er selbstdort gebadet, und der Geist habe seiner Hand die Schçpfkelleentwunden. Sogar den Namen des Geistes gab er uns weiter:Pagar (Zaun). Indonesier kçnnten in dem Gebäude nicht woh-nen, sie würden krank oder erlebten Bçses. Nun verstanden wirauch den günstigen Kaufpreis dieses Hauses!
Wie gut, dass wir schon in Deutschland von dämonischenMächten gehçrt hatten. Nein, nicht in der theologischen Vor-lesung, da wurde ja die Bibel durch das Sieb des Rationalismusvon Wundern und anderem Übernatürlichen «gereinigt». Aberein alter Evangelist hatte in Schwiegervaters Lübecker Ge-meinde den in Norddeutschland und unter vielen Flüchtlingen
— 113 —

praktizierten Okkultismus angesprochen, und viele Menschenwaren in seiner Seelsorge von dem Anspruch der finsterenMächte befreit worden.
So riefen wir Detmar zur Hilfe, und zusammen mit Pak Octa-vianus und anderen indonesischen Mitarbeitern beteten wir inder weiträumigen Küche des Asramas nahe den Badezimmernum Befreiung von diesem Geist, dessen Namen wir erfahrenhatten. Als Detmar im Namen Jesu dem Geist gebot, das Hauszu verlassen, wurde er am Hals gewürgt, und als Petrus Octavia-nus danach zu seiner nahen Wohnung ging, spürte er eine unan-genehme Präsenz, die ihm in sein Haus folgen wollte. Er wehrtesich mit dem Namen Jesu. Aber danach war – Gott sei’s ge-dankt! – Ruhe im Hause.
In manchem konnte ich von den Studenten lernen, etwawenn Rukmiati vor dem Besuchsdienst im Dorf im Gebet ver-sunken dastand und sich ihrem Herrn anbefahl. Oder von Dora,einer sehr begabten Chinesin, die zur Weihnachtszeit ein fes-selndes Schauspiel in fünf Akten schrieb. Sie war zum Beispielauch bereit, während einer Praktikumszeit, in der alle anderenihre Einsätze in Gemeinden auf Java und anderen Inseln leis-teten, allein zurückzubleiben und Tag für Tag hinter den Hand-werkern herzuputzen, die gerade das Mädel-Asrama unterVolkhards Regie umbauten.
Dora, die am Anfang zu scheu war, mir in die Augen zuschauen, weil eines ihrer Augen von Geburt an entstellt war,wuchs mir besonders ans Herz. Sie entschloss sich nach demStudium, einen begabten Klassenkameraden, einen Batak, zuheiraten, dem wir gern später die Leitung des Bibelinstitutsübergeben hätten.
Mit großem finanziellen Einsatz sandten wir ihn deshalbzur Fortbildung nach Manila auf die Philippinen. Aber nurkurz konnte er der Schule hinterher dienen. Ein unheilbares
— 114 —

Nierenleiden raffte ihn früh dahin und ließ Dora mit zweiSçhnen zurück. Welche Zeiten und Jahre des gemeinsamenHoffens und Bangens, Betens und Ringens! Die von seinerSchwester, einer Mutter von neun Kindern, gespendete Nierewurde abgestoßen. Ein so großes Opfer – vergeblich. «O Herr,warum?»
Ebenso schmerzlich war der plçtzliche Tod zweier unsererbegabtesten und hingebungsvollsten Studenten, auf die wirgroße Hoffnungen setzten: Deak Sigalingging und Petrus Aryo-so, die beide ihre junge Frau und je zwei kleine Kinder hinterlie-ßen. «Nur Du, Herr, hast die Antwort auf unsere Fragen.» –Doch die Erinnerung ist mir wieder vorausgeeilt …
34. Besuch aus Ostafrika
Im täglichen Miteinander blieben Spannungen im Wohnheimder Studentinnen nicht aus. Zu verschieden waren die Kulturenauf den einzelnen Inseln. Es gab viel Gelegenheit, Liebe ein-zuüben und Respekt vor dem Besitz und der Art des anderenzu entwickeln. Die dünnhäutigen, hochkultivierten Javanerin-nen hatten Mühe mit der derberen Ausdrucksweise der Bataks.Die Lebensweise und Gewohnheiten von Großstadtmädchenwaren vçllig anders als die von solchen, die auf dem Lande auf-gewachsen waren. Und doch wollten wir lernen, als Glaubens-geschwister zusammenzuleben.
Die indonesische Staatsphilosophie war eine erste Hilfe:«Bhineka tunggal ika» – «Einheit in Verschiedenheit». Aber imtäglichen Leben gehçrt viel Vergebungsbereitschaft dazu, undder offene Umgang miteinander, den die Bibel «Wandel imLicht» nennt (vgl. 1. Johannes 1,5–9), ist enorm wichtig.
— 115 —

Schon im ersten Jahr unseres Dienstes half uns Gott durchden Besuch eines Teams aus der ostafrikanischen Erweckungs-bewegung, diese geistliche Lebensregel besser zu verstehen.Aus Ruanda kamen unser geliebter schwarzer Bruder WilliamNagenda und Roy Hession, der englische Erweckungsprediger,nach Indonesien und brachten den Funken. Oder besser ge-sagt: Durch ihre Lehre vom Wandel im Licht initiierten sieeines der Hauptthemen der späteren indonesischen Erwe-ckung.
Auf Java und Bali hielten sie Konferenzen für Pastoren, alsÜbersetzer diente Pak Lalujan, Studienrat und daneben Lehreran der Bibelschule. Sie nannten ihn Pak Hallelujah. Er starb we-nige Jahre später mitten in seinem Unterricht bei uns und hin-terließ drei junge Kinder. Seine Witwe war eine glaubensvolleBeterin. Jeden Morgen, wenn ihre Kinder zur Schule gegangenwaren, schloss sie ihre Tür, um mit ihrem Herrn Gemeinschaftzu pflegen und ihm die persçnlichen Nçte anzubefehlen, aberauch den Lauf des Evangeliums in ihrer Umgebung und imLand.
William Nagenda und Roy Hession kamen nach Batu zu einerFreizeit für unsere Bibelschüler und Studenten der nahen Uni-versitätsstadt auf dem Gelände der Schule. Unvergesslich istmir ihr Dienst am Morgen des dritten oder vierten Tages. RoyHession sollte sprechen. Aber er zçgerte. Dann kam ein persçn-liches Bekenntnis, das ihn etwas kostete: «Bevor ich das WortGottes verkündigen kann, muss ich euch etwas bekennen. DerHeilige Geist hat mich überführt, dass ich gestern neidisch war,als mehr von euch Seelsorge bei meinem afrikanischen Brudersuchten als bei mir. Ich habe den Herrn um Vergebung bittenmüssen und will es auch euch wissen lassen. Dem Herrn seiDank, dass sein Blut mich rein wäscht!» Dann folgte eine Predigtin Klarheit und Vollmacht.
— 116 —

Schon bald musste ich vor meinen Mädels praktizieren, was ichgelernt hatte. Das Stillen von Gunnar unterbrach meine Nächteund oft auch die Mittagsruhe. Unser Tag begann früh um 4.45Uhr. Als der Wecker wieder einmal viel zu früh für mein Schlaf-bedürfnis klingelte, stand ich nur kurz auf, um Licht zu ma-chen, und legte mich wieder hin. Das Licht sollte signalisieren,dass ich mich an die Schulordnung hielt. Wir wollten Vorbildersein.
Als ich das ein paar Mal praktiziert hatte und am Samstag ander Reihe war, die Frühandacht zu leiten, ließ der Heilige Geistmir keine Ruhe: «Du warst nicht ehrlich. Bekenne dich dazu!» –«Aber Herr, dann ist meine Autorität doch futsch!» – «Meinstdu, du hättest auf diese Weise Autorität?» Es musste sein. Sto-ckend erzählte ich den Studentinnen, was ich getan hatte, undbat um Vergebung – und unsere Beziehung vertiefte sich. Ja, esbewegte mich sehr, dass auch Studentinnen, die älter waren alsich, mich voll als Hausmutter akzeptierten.
Die praktischen Arbeiten zum Instandhalten des Asramaseinzuteilen war eine meiner Aufgaben. Oft legte ich selbst mitHand an, vor allem, wenn Herkunft und Vorurteile im Wegestanden. An meine Grenzen kam ich, wenn meine Mädchenkrank wurden. Das Problem: Sie wickelten sich dann in ihreBettdecken, zogen sie auch über den Kopf und waren weder zubewegen, mich anzuschauen oder mir zu antworten, noch da-zu, aufzustehen und zum Unterricht zu gehen. Mich packte diePanik, und so bat ich Volkhard, den Schulbus zu nehmen,packte die «Kranken» hinein und fuhr zum Missionskranken-haus nach Turen, jenseits von Malang. Dr. Clark, ein alter eng-lischer Missionsarzt, der zusammen mit seiner Frau eine circavierzig Kilometer entfernte Klinik betrieb, war zwar Spezialistfür Kropfoperationen, wozu Kranke aus weitem Umkreis ihnaufsuchten, aber auch Allrounder.
— 117 —

Er hatte eine bemerkenswerte Methode, die Anamnese zumachen: In kleiner Runde saßen circa sechs bis acht Patientennebeneinander um seinen Schreibtisch, und er befragte einennach dem anderen nach seinen Beschwerden. Dann arbeitete erdiese Gruppe ab, vom Zahnziehen bis zur Einweisung in einKrankenbett.
Als ich das zweite Mal mit meinen Mädchen zu ihm kam,schaute er mich über den Rand seiner Brille hinweg an: «Doyou come again with a car full of neurotics?» –«Kommst du wie-der mit einem Wagen voller Neurotiker?»
Es war eine gute Kur für mein Überbesorgtsein! In Zukunftschaute ich meine kranken Mädchen zuerst in ähnlicher Weisean, bevor ich mir Sorgen machte, ob sie sterben würden. Ich fandheraus, sehr oft war der Grund ihrer Krankheit einfach Heimweh.
Dr. Clark und seine liebe Frau, die ihm bei Operationen assis-tierte, vom Sterilisieren seines OP-Bestecks im Reiskochtopf biszur Überwachung der Anästhesie, waren Jahre später meine Le-bensretter. Ich erlitt während eines dreimonatigen Dienstauf-enthalts von Volkhard in Deutschland eine Fehlgeburt. Dr.Clarks Bereitschaft, mir mitten in der Nacht, noch im Schlaf-anzug, die notwendigen Infusionen zu geben, bewahrten michvor dem Kollaps meines Kreislaufs.
35. Die erste indonesische Missionskonferenzin Nongkodjadjar
Ende März 1964 trafen sich zum ersten Mal indonesische Ver-treter einiger Kirchen, denen die Ausbreitung des Evangeliumsauf den Inseln Indonesiens ein Herzensanliegen war, mit derLeitung des Bibelinstituts Batu in den Bergen Ostjavas. Leslie
— 118 —

Brierly, der Beauftragte des Internationalen WEC-Büros für For-schung und Information, war unter uns.
Früher hatte Tan Ik Wan, Mitglied des Vorstands des Bibel-instituts sowie Unternehmer und Besitzer einer Lederfabrik,das Gebiet um Nongkodjadjar zum Jagen genutzt. Als er zumlebendigen Glauben an Jesus fand, bekam er ein Herz für dievernachlässigte Bergbevçlkerung, richtete eine Grund- und Mit-telschule mit den dazu gehçrenden Gebäuden ein und sorgte fürdie nçtigen Lehrer, die in Batu den evangelistischen Schliff beka-men. Auch ein kleines Freizeitzentrum war entstanden. Dortkonnte die Konferenz in aller Ruhe und Abgeschiedenheit statt-finden. Elektrizität hatte das Bergdorf noch nicht erreicht.
Aus Südsumatra war ein alter Batak-Evangelist mit der Bitteum Hilfe zu uns gekommen. Dem Führer des Serawai-Stammeswar Gott begegnet. Er hatte sich auf der Suche nach einem bes-seren Weg für sein Volk den Kommunisten geçffnet und ihreKaderschule besucht. Auf einem der Fortgeschrittenen-Kursewar gelehrt worden: «Kommunismus ist Atheismus. Es gibt kei-nen Gott.» Das konnte er nicht schlucken. Das konnte nicht derrichtige Weg für seinen Stamm sein.
Auf dem Rückweg von der Provinzhauptstadt Palembangwar er zur Weihnachtszeit in Bengkulu vorbeigekommen. Eineder wenigen christlichen Kirchen dort feierte das Fest. Vom Sin-gen der Gemeinde angezogen, trat er in die Kirchentür undhçrte von dort der Predigt zu. Was er vernahm, ließ ihn nichtmehr los, er bewegte es in seinem Herzen während seiner Fahrtsüdwärts nach Hause. Von dort schrieb er dann einen Brief: «Andas Indjil in Bengkulu». Das Wort Indjil (Evangelium) hatte erauf dem Auto der Gemeinde, das vor der Kirche geparkt war,gelesen und sich gemerkt. Und dieser Brief kam an! Er enthielteine Einladung, seinen Stamm mit dem Evangelium bekannt zumachen.
— 119 —

Pak Tobing, ein ¾ltester dieser Gemeinde, machte sich aufden Weg und fand heraus: Da waren offene Türen für das Evan-gelium, eine von Gott gewirkte Gelegenheit, die nicht unge-nutzt verstreichen durfte. Er bemühte sich bei den Kirchen derRegion um Mitarbeiter, aber niemand wollte sich in das entle-gene Gebiet aufmachen. So war er zu dieser Konferenz gekom-men, hatte die weite Reise von etwa 1500 Kilometern per Busauf sich genommen, um sein Anliegen vorzutragen: die Bitteum Mitarbeiter für die offenen Türen im Serawai-Stamm. Ne-ben Südsumatra wurden auch die wenig erreichten Gebiete inWestjava, Lombok und Sumbawa als Arbeitsziele aufs Herz ge-nommen.
Das Bibelinstitut in Batu hatte die bençtigten Mitarbeiter, dadas vierte Jahr der Ausbildung als praktisches Jahr geplant war.Es passte alles zusammen. Es wurde die Geburtsstunde der In-donesischen Missionsgemeinschaft IMG/YPPII. Gott schenkteden indonesischen Brüdern beim Wachen in der Nacht die Zu-sage aus Jesaja 45,2–3 und Jesaja 42,10:
«Ich will vor dir hergehen … ich will die ehernen Türen zer-schlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und will dirheimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damitdu erkennst, dass ich der HERR bin, der dich beim Namenruft, der Gott Israels. …
Singet dem HERRN ein neues Lied, seinen Ruhm an denEnden der Erde, die ihr auf dem Meer fahrt, und was imMeer ist, ihr Inseln und die darauf wohnen!»
Leslie Brierly, der von der internationalen Leitung des WECunter uns weilte, hatte dasselbe Wort aus Jesaja 45 auf demHerzen. So kam er als zweiter Zeuge hinzu. Alle spürten GottesGegenwart und den Wind des Aufbruchs.
— 120 —

Zur Praktikumszeit machte sich dann Pak Octavianus zusam-men mit zwei Praxisstudenten unter Begleitung von Pak Tobingauf den Weg nach Serawai. Bei diesem Einsatz kamen der Stam-mesführer und ein Imam einer Moschee, dessen HçrvermçgenGott wiederherstellte, zusammen mit etwa dreihundert Er-wachsenen zum Glauben an Jesus Christus und ließen sich tau-fen. Der Grundstein der Serawai-Kirche war gelegt.
Auch nach Westjava brachen Studenten auf, und nach Lom-bok und Sumbawa, Frauen wie Männer. Wir segelten im Winddes Heiligen Geistes. Die Betreuung der jungen Serawai-Ge-meinde ging später an die Zweigbibelschule in Tanjung Enimüber. Aus der Mitte der erweckten Jugendlichen in Serawai ka-men die ersten Studenten, um sich für ihr Volk ausbilden zulassen.
36. Ein politischer Umsturz bahnt sich an
Es war 1964. Ich wurde bald zum zweiten Mal schwanger. Da-neben fand eine beunruhigende politische Entwicklung statt.Präsident Sukarno, der Vater der Nation, wollte den aus der ehe-maligen britischen Kolonie neugegründeten Nachbarstaat Ma-laysia nicht akzeptieren und stand in einem drei Jahre dauern-den Konflikt – der «Konfrontasi» – dem jungen Land feindlichgegenüber.
Sukarno hatte sich, vom Westen verlassen, immer stärkerdem kommunistischen China geçffnet. Indonesien war unterder Inflation verarmt, es gab kaum noch etwas zu kaufen, selbstZucker war in dem Rohrzucker produzierenden Staat nichtmehr zu haben. Das Volk war unzufrieden, der richtige Bodenfür kommunistische Agitatoren.
— 121 —

Wir hatten von Anfang an gespürt, dass etwas in der Luft lag.Jetzt wurden häufig Männer und Frauen zusammengetrommeltund militärisch gedrillt. Auch unsere javanischen Angestelltenwurden dazu verpflichtet. Dann wurde marschiert, barfuß undmit Stçcken statt Gewehren über den Schultern. Aber manmerkte, dass es kein Spiel war, sondern jederzeit in bitterenErnst umschlagen konnte. Die Lautsprecher des Dorfes, ge-wçhnlich für kommunale Ankündigungen oder an Festen fürlaute Übertragungen von Wayang-Spielen genutzt, brüllten nunkommunistische Propaganda in die Welt, Stunde um Stunde, oftbis spät in die Nacht. Es wurde schwierig zu schlafen.
Ich geriet in tiefe Anfechtung. Ein Jahr zuvor waren bei denSimba-Aufständen im Kongo WEC-Missionare ermordet wor-den. Was würde mit uns geschehen? War es verantwortlich, indiese Situation hinein Kinder zu gebären? Was würde mit ihnengeschehen, wenn wir sterben würden? In meinem Herzenschrie ich meine Fragen zum Herrn. Noch einmal wurde mir,ähnlich wie damals, als ich in Glasgow um das Schriftverständ-nis rang, eine Antwort gegeben: «Sorge dich nicht um die Längeihres Lebens in dieser Welt, es sind ewige Seelen!» – Selbstwenn sie früh sterben müssten, sie würden ewig leben.
Als dann der Aufstand wirklich losbrach – der Putschversuchder Kommunisten, bei dem indonesische Generäle grausam um-gebracht wurden, und der ebenso grausame Gegenschlag derMoslems, bei dem eine halbe Million Indonesier umkamen undwir selbst täglich vom Tod bedroht waren –, hielt uns Gott inseinem Frieden, der hçher und tiefer reicht als Vernunft und Ge-fühl. Es ist mir bis heute eine wunderbare Erfahrung. «DerName des Herrn ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthinund wird beschirmt» (Sprüche 18,10).
Endlich erfuhren wir auch, wozu in Nachbars Garten, direktvor unseren Schlafzimmerfenstern, die merkwürdigen Gruben
— 122 —

ausgehoben worden waren. Das sollten unsere Gräber werden!Doch nun saß die Nachbarin, eine vom kommunistischen Ka-der, in deren Garage junge Männer Waffen gehämmert hatten,zitternd und die Rache der Moslems fürchtend in unseremHaus.
Die Kämpfe wogten noch Wochen hin und her. Welche Seitesiegen würde, war noch nicht ausgemacht. Zwar wurden in un-serem Ort immer mehr Kommunisten interniert und im Mor-gengrauen auf Lastwagen zur Exekution ins Gebirge transpor-tiert, aber in Mitteljava behielten die Kommunisten noch überlängere Zeit die Oberhand. Und zugleich ging an unserer Schuleder Unterricht unter vermehrtem Gebet in Frieden weiter.
37. Die zweite indonesische Missionskonferenz1965 in Batu
Genau in diesen turbulenten Tagen fand in Batu die zweite Mis-sionskonferenz statt, dieses Mal mit weltweiter Perspektive. Al-lerdings konnten Vertreter der verschiedenen Kirchen, denen dieAusbreitung des Evangeliums in Indonesien am Herzen lag, we-gen der unklaren Verhältnisse nur beschränkt teilnehmen. Dafürwar aber wieder Leslie Brierly in unserer Mitte. Er saß sprich-wçrtlich bei uns fest, wohnte bei uns als Familie und hatte sichwieder das wegweisende Wort für die Konferenzteilnehmervom Herrn geben lassen.
Detmar nahm auf einem Feldbett liegend teil. Wie das Sera-wai-Team war auch er gerade heimgekehrt. Während ihresevangelistischen Einsatzes auf den Inseln Timor und Rote miteinem Team von Bibelschülern und in Begleitung von Frau Octa-vianus als timoresischer Vermittlerin hatte Gott mächtig ge-
— 123 —

wirkt. Menschen waren frei geworden von Aberglauben, Feti-schen und Zauberei. Die Saat war gelegt, aus der die große Er-weckungsbewegung entstand, eine Bewegung hin zu JesusChristus, zuerst in den christlichen Gemeinden, wo Menschenbekannten: «Ich war Christ ohne Christus» – oder in ihrer Bil-dersprache: «Ich war wie eine Flasche mit Coca-Cola-Etikett,aber ohne Coca-Cola-Inhalt.»
Das Team hatte die Anfänge der Erweckung erlebt. Doch nunmusste Detmar krank heimgeflogen werden, litt während derumstürzlerischen Tage im Krankenhaus in Malang an einer bç-sen Leberentzündung mit furchtbarem Jucken, aber an dieserKonferenz mit ihrer Blickerweiterung über Indonesien hinauswar er doch, wenn auch leidend, in unserer Mitte und maßgeb-lich beteiligt. Die dreimonatige Rekonvaleszenzzeit nutzte er,um das Regelwerk für die Indonesische Missionsgemeinschaftim Entwurf niederzuschreiben.
Die Grundordnung (AD) galt nach draußen vor der Regie-rung, die Hausordnung (ART) nach innen. Leslie Brierly sorgtedurch seinen Beitrag dafür, dass nicht nur die Inselwelt Indone-siens, sondern die Kontinente der Erde in den Fokus und Blickder missionarischen Verantwortung dieses jungen Missionswer-kes kamen.
38. Jahre des Wiederaufbaus
Die tiefe Erschütterung des Volkes durch den gescheitertenPutsch und den maßlosen Gegenschlag der islamischenKräfte brachte große Veränderungen. Präsident Sukarno, derGründervater der Nation, wurde wegen seiner großen Ver-dienste um Indonesien nicht verurteilt, sondern in einer Villa
— 124 —

ehrenvoll unter Hausarrest gestellt. General Suharto, der dasGelingen des Putsches vereitelt hatte, indem er in schnellerReaktion den Flughafen und die zentrale Radiostation besetz-te, wurde sein Nachfolger. Unter seiner Präsidentschaft nahmdas total heruntergewirtschaftete Land einen rasanten Auf-stieg.
Zunächst wurde in großen Kampagnen das Volk in seinenFührungseinheiten auf die «Pancasila», die fünf Säulen (Prinzi-pien) des Staates, eingeschworen. Sukarnos Idee «Nasakom»,die Nationalismus, Religion (Agama) und Kommunismus ver-einigen wollte, hatte ausgedient, und die Staatsidee der «Panca-sila» wurde wiederbelebt. Danach verpflichtet sich jeder Indo-nesier gemäß des ersten Grundsatzes bzw. der ersten Säule, anGott zu glauben. Religion sollte als Immunisierung gegen denatheistischen Kommunismus wirken.
Der Schock des misslungenen Putschversuchs ging so tief,dass jahrelang kein Kommunist çffentliche ¾mter bekleidendurfte. Es herrschte eine regelrechte Kommunismusphobie. Je-der musste nachweisen, wir einbezogen, dass er frei von derBewegung des 30. September war. Das hieß auf Indonesisch:Bebas G-30-S. Ich fühle mich bis heute an den Tag erinnert,weil er mein Geburtstag ist und dazu noch meine Namensinitia-len trägt.
Fünf Religionen wurden staatlich anerkannt, und es warjedem Bürger freigestellt, ob er sich für den Islam, den Hin-duismus, den Buddhismus oder für die katholische oderchristliche Religion (diese Unterscheidung wurde so gemacht!)entschied. Alle diese Religionen wurden staatlich unterstützt.So mussten wir weder Grundsteuer noch Pkw-Steuer bezah-len und hatten volle Freiheit, das Evangelium zu verkündenund Gemeinden zu bauen. Das konnte nur ganz im Sinne desStaates sein.
— 125 —