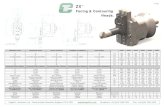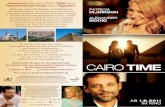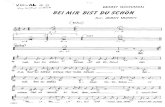9783050061900.188
-
Upload
antonio-rebelo -
Category
Documents
-
view
124 -
download
7
description
Transcript of 9783050061900.188

A N H A N G
E R L Ä U T E R U N G E N
zu Buch X I I
FGH Die Fragmente der griediisdien Historiker, hg. F. Jacoby, Ber-lin 1923-1930, Leiden 1940 ff.
HRR Historicorum Romanorum Reliquiae, ed. H. Peter, Leipzig 1906 ff.
ι Plinius hatte in den Büchern 8 - 1 1 die Tierwelt behan-delt und beginnt nun mit der Beschreibung der Pflanzen-welt, die für ihn ebenfalls nicht ohne Seele ist. Die Vorstel-lung, daß audi Pflanzen über eine Seele (griedi. psyché = Lebenshauch)in ihrer einfachsten Gestalt verfügen, ist alte Tradition der griechischen Philosophie. Schon Anaxagoras und Demokrit vertraten sie (Plutarch, quaest. phys. I p. 9 1 1 D), nach Piaton sind Pflanzen beseelte Lebewesen ohne Selbstbewegung (Tim. 77b c). Allgemeine Verbreitung fand dies durch Aristoteles, der ihnen eine »ernährende« Seele zuteilt, die in Wachstum und Fortpflanzung wirkt (de anima I I 2, 4 1 3 b 7; 4 ,4 15a 3; de gener. anim. I I 4, 740b 34fî .) . Von Einfluß war auch die Lehre von der Seelenwanderung, die auf Pythagoras (6. Jhdt. v . Chr.) fußt. Nach der einen Variante körpert sich die Seele immer nur in Men-schen ein, nach der anderen geht sie auf ihrer Wanderung nicht bloß durch Menschen, sondern auch durch die ver-schiedensten Tiere und Pflanzen hindurch; vgl. z. B. W. Stettner, Die Seelenwanderung bei Griechen und Rö-mern. Stuttgart 1934. - Es folgt der Hinweis auf das, was aus der Erde herausgegraben wird, also die Metalle, Mine-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 189
ralien, Steine etc., deren Behandlung Gegenstand der Bücher 33-37 sein wird. - Wohltaten der Erde: Plinius macht hier einige allgemeine Bemerkungen über das Leben der ersten Menschen und der Naturvölker. Ähnliches findet sich ζ. B. audi bei Hesiod, Werke und Tage 117 ff.; Lucretius, de rerum nat. V 925 ff.; Ovid, Metam. I 100ff. und Vitruvius, de architect. II 1 ff. Plinius bemerkt auch nat. hist. 16,1, wie schwer sich das Leben der Völker ge-staltet, bei denen keine Bäume vorkommen.
Marmorblöcke; vgl. Plinius, nat. hist. 36, j i , wo das Schneiden des Marmors mit Sand unter Verwendung einer »Säge« beschrieben wird, ein Verfahren, das noch heute, z. B. in Carrara, Anwendung findet. - Serer (Seres, von «hin. si - Seide) = >Seidenleute<, d. h. Chinesen; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 54 und 88. - Perlen; vgl. Plinius, nat. hist. 9, 105 f. - Das Rote Meer (Rubrum mare, griech. erythra thálatta) umfaßte im Altertum den nordwest-lichen Teil des Indischen Ozeans, das heutige Arabische Meer und das heutige Rote Meer sowie den Persischen Golf; eine Abgrenzung nach Osten ist nicht möglich. -Der Smaragd, ein leuchtend grüner Edelstein, eine Varie-tät des Berylls, wird von Plinius, nat. hist. 37, 62 ff. aus-führlich behandelt. - Wunden in den Ohren: gemeint sind die Ohrgehänge (inaures), deren Verwendung auf älteste Zeiten zurückgeht ; vgl. den ausführlichen Artikel von Ο. v. Netoliczka, RE IX Sp. 1229-1241 s. v. »inaures«; s. auch H. Fuchs.
Der Baumkult spielt in vielen Religionen eine bedeut-same Rolle. Bei den Griechen waren bestimmte Bäume nur insoweit heilig, als sie einer gewissen Gottheit geweiht waren. Die Römer hingegen verehrten auch Bäume und sogar Haine, ohne sie einer bestimmten Gottheit zuzuord-nen, z. B. die uralte Steineiche auf dem Vatikan; vgl. Plinius, nat. hist. 16, 237. Seneca, epist. ad Lucil. 41, 3
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

190 E r l ä u t e r u n g e n
erzählt von der Ergriffenheit, die die Menschen in alten Wäldern befällt und die Nähe der Gottheit ahnen läßt; vgl. auch Lucretius, de rerum nat. IV 580 ff. und Tacitus, Germ. 9. - Die dem lupiter geweihte Wintereiche (aescu-lus), wohl Quercus sessiliflora Salisb. (Fagaceae); aus ihr machte man den Eichenkranz (corona civica); vgl.Plinius, nat. hist. 1 6 , 1 1 ; für Apollo den Lorbeer, Laurus nobilis L. (Lauraceae), für Minerva den ölbaum, Olea europaea L. (Oleaceae), für Venus die Myrte, Myrtus communis L. (Myrtaceae), audi Brautmyrte genannt, für Herkules die Pappel, Populus nigra L. (Salicaceae), die Schwarzpappel, ein Lieblingsbaum des Herkules; vgl. zum Ganzen Vergil, Eel. V I I 61 f. und Phaedrus, fab. I I I 17. - Silvane, Götter des Waldes, ähnlich den Faunen, den Beschützern der Herden.
Säfte; vgl. Plinius, nat. hist. 16, 1 . - Nachtisch (mensa secunda), meist aus Obst und verschiedenen Leckerbissen bestehend.
H elico: diese Erzählung findet sich nur bei Plinius, nach L. Clerici geht sie auf Poseidonios zurück. Auf der Hochebene zwischen Rhein/Jura und Alpen einerseits, zwischen Genfer- und Bodensee andrerseits ist der kelti-sche Stamm der Helvetier erst etwa seit 80 v.Chr. bezeugt (Poseidonios F G H 87 frg. 31 f.) und wird im Zusammen-hang mit den Kimbern genannt. Daß Teile des Stammes am Kimbernzug am Ende des 2. Jhdts. v. Chr. teilgenom-men haben, wird wahrscheinlich durch die in Noricum am Kärntner Magdalensberg gefundenen Inschriften, die EL-V E T I nennen (vgl. J . Sasel, Huldigung norischer Stämme am Magdalensberg in Kärnten. Historia 16, 1967, 70 ff.) und den durch Livius, per. L X V ; Appian, Kelt. I, 3 u. a. bezeugten Sieg des helvetischen Gaues (pagus) der Tigu-riner über die Römer bei Aginnum (h. Agen, Südfrank-reidi); vgl. dazu E. Howald - E. Meyer, Die römische
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 191
Schweiz. Zürich 1940, 32 Anm. 1. Ob die Helvetier aber schon länger in dem Räume seßhaft oder erst um die Wende vom 2. zum 1. Jhdt. v. Chr. eingewandert waren, ist in der Forschung noch umstritten; vgl. E. Howald -E. Meyer, a. O. und S. 1 1 j Anm. 2, dazu u. a. auch E. Vogt im Handbuch der Schweizergeschichte I. Zürich 1972, j o f . Zur Gesellschafts- und Stammesorganisation vgl. E. Meyer im Handbuch der Schweizergeschichte 1. c. 55 ff. [H. E. Herzig, Bern], Der Versuch der Helvetier, die alte Heimat zu verlassen und in Südwestfrankreich neue Wohnsitze zu suchen, war der Anlaß für Caesars Eingreifen in Gal-lien (j8 v. Chr.) und wurde durch den römischen Sieg bei Bibracte (h. Mont-Beuvray bei Autun) vereitelt; vgl. Caesar, bell. Gall. I 2-29. - Bildhauerei (ars fabrilis): es kann auch die Arbeit eines Zimmermannes (oder eines Schmiedes) gemeint sein.
6 Platane (platanus, griech. plátanos von griech. platys -breitästig), Platanus orientalis L. (Platanaceae), ein wegen seiner schattenspendenden Blätter sehr geschätzter Baum. Der Baum war allgemein bekannt und wurde oft im Schrifttum erwähnt, aber seltsamerweise nie genauer be-schrieben; vgl. H. v. Gossen, R E X X Sp. 2337^ s. v. »Platanos« Nr. 1 und Hehn S. 294 ff. Als Quelle dieses und des folgenden Abschnittes diente für Plinius Theo-phrastos, hist, plant. IV 5, 6. Im Kräuterbuch von Loni-ceras - Uffenbach (Ulm 1679) wird die Platane zwar beschrieben und abgebildet, aber fälschlich mit dem Maß-holder oder Feldahorn, Acer campestre L. (Aceraceae), gleichgesetzt. - Insel des Diomedes: Plinius erwähnt nat. hist. 3 , 1 5 1 eine gegenüber der apulischen Küste im Adria-tischen Meer liegende Insel dieses Namens; die Insel-gruppe heißt h. Isole de Tremiti. Auf der größten Insel, h. Santo Domenico, war der Sage nach das Grab des Heros, das seine in Vögel verwandelten Gefährten be-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

192 Erläuterungen
wachten; vgl. Strabo, Geogr. VI 3, 284 und Plinius, nat. hist. 10, 126 f., sowie Vergil, Aen. X I 271 ff. und O vid, Metam. XIV 496 ff. Diomedes, der Sohn des Tydeus und der Deipyle, gehörte zur Gruppe der ältesten Heroen und wurde oft mit den verschiedensten Sagen in Verbindung gebracht. Er nahm mit 80 Schiffen aus seiner Heimat Argos am Trojanischen Krieg teil. - Moriner (von kelt. mor - Meer) = >Meerleute<, keltischer Volksstamm in der Belgica; vgl. Plinius, nat. hist. 3, 102 und 106. In der Kaiserzeit war ihr wichtigster Hafen Gesoriacum, h. Boulogne.
Dionysios (I.) d. Ältere, Tyrann von Syrakus (etwa 430-367 v.Chr.); vgl. Plinius, nat. hist. 7, 180. - Rhegion (lat. Regium), h. Reggio di Calabria; vgl. Plinius, nat. hist. 3, 43. 73. 86. Die Stadt wurde 387 v. Chr. nach elf monatiger Belagerung von Dionysios I. erobert; vgl. Diodor XIV i n . - Spanien: Diese Angabe scheint auf einen Übersetzungsfehler des Plinius zurückzugehen, der die Angabe des Theophrastos, hist, plant. IV 5, 6, daß die Platane in Italien selten ( = spania) sei, mißverstanden hat.
Die Eroberung Roms durch die Gallier erfolgte 387 v. Chr. — mit reinem Wein begießt: vgl. die über den Redner Q. Hortensius Hortalus (114-50 v. Chr.), den Widersacher Ciceros, durch Macrobius, Saturn. III 13, 3 überlieferte Anekdote: is Hortensius platanos suas vino inrigare consuevit adeo, ut in quadam actione, quam habuit cum Cicerone susceptam, precario a Tullio postu-lasset, ut locum dicendi permutaret secum: abire enim in villam necessario se velie, ut vinum platano, quam in Tusculano posuerat, ipse suffunderet (Dieser Hortensius pflegte seine Platanen mit Wein zu begießen, so daß er bei einer Gerichtsverhandlung, an der er gemeinsam mit Cicero teilnahm, von diesem bittend verlangt hatte, er
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Erläuterungen 193
möge mit ihm den Redetermin tauschen: denn er wolle dringend in sein Landhaus in Tusculum fortgehen, um einer Platane, die er dort gesetzt hatte, selbst Wein zuzu-gießen).
Die Platanen an den Wandelwegen der Akademie zu Athen waren von Kimon zwischen 466 und 461 v. Chr. wohl zusammen mit der Platanenpflanzung auf dem Marktplatz gestiftet worden; vgl. Plutarch, Kimon 13, 8. Sulla hatte sie 87 v. Chr. zur Herstellung von Kriegs-maschinen fällen lassen; vgl. Plutarch, Sulla 12, 3 und Appian, Mithr. 30. - 33 Ellen = 14,652 m; als Quelle kommt wieder Theophrastos, hist, plant. I /, 1 in Frage; vgl. auch Varrò, res rust. I 37, 5. Die betreffende Stelle bei Theophrastos lautet jedoch: »Die Platane im Lyceum an der Wasserleitung schickte, als sie nodi jung war, ihre Wurzeln wohl 33 Ellen weit, da Boden und Nahrung günstig waren« (K. Sprengel). Es liegt also eine Verwechs-lung der platonischen Akademie mit dem Lyceum (Ly-keion), der Lehr- und Wirkungsstätte des Aristoteles in Athen, vor; vgl. Münzer S. 126 Anm. 1. - Lykien, Land-schaft im südwestlichen Kleinasien. - 81 Fuß = 23,9 m. -Licinius Mucianus HRR frg. 21.
Kaiser Gains = Caligula regierte von 37-41 n. Chr. -Velitrae, h. Velletri, alte Volskerstadt in Latium am Süd-abhang der Albanerberge; vgl. Plinius, nat. hist. 3, 65. -er selbst ein Teil des Schattens war: boshafte Anspielung auf den Körperumfang des Caligula; vgl. Sueton, Cali-gula 50, ι und Münzer S. 395.
Die Platane zu Gortyna auf der Insel Kreta erwähnen auch Theophrastos, hist, plant. I 9, 5 und Varrò, res rust. I 7) 6; vgl. auch Münzer S. 20. - Die Stadt Gortyn(a) lag in der Mitte der großen südkretischen Ebene Mesará und war in römischer Zeit Hauptstadt der Doppelprovinz Creta et Cyrene; vgl. Plinius, nat. hist. 4, 59. - Von den
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

194 E r l ä u t e r u n g e n
genannten Inschriften in griechischer und lateinischer Sprache hat sich nichts erhalten; vgl. auch Münzer S. 243 Anm. 2. - Europa, die Tochter des phönikischen Königs Agenor (nach Homer, II. X I V 321 f. von dessen Sohn Phoinix), war beim Spiel am Strand von Iupiter ( = Zeus) in Gestalt eines Stieres entführt und nach Kreta gebracht worden; vgl. Ovid, Metam. I I 846-875. Dort gebar sie ihm drei Söhne, Minos, Rhadamantys und Sarpedon. Die Vereinigung Iupiters mit Europa unter der Platane wird auf zahlreichen gortynischen Münzen abgebildet und weist auf einen alten Baumkult hin. - Obwohl Plinius sagt, die Platane zeichne sich nur durch ihren Schatten aus (wiederholt nat. hist. 17, 90), gibt Dioskurides, mat. med. I 107 einige Heilmittel an, die aus diesem Baum gewon-nen werden können; vgl. A. Severyns.
12 Kaiser Claudius regierte 4 1 -54 n. Chr.; zur Quellen-frage vgl. Münzer S. 391. - M. Claudius Marcellus Aeser-ninus, wahrscheinlich der Neffe des Redners C. Asinius Pollio; vgl. Tacitus, Ann. I I I 1 1 , 2 und X I 6, 2 f. -M. Claudius Dionysius: aus der Anspielung auf seinen Reichtum läßt sich schließen, daß Dionysius sein wirk-licher Name war; durch Adoption fand er Aufnahme unter die Freigelassenen des Kaisers Claudius. - Thessa-lien, die nördlichste Landschaft Griechenlands.
13 Zwergplatane (chamaeplatanus von griech. chamai-plátanos - Platane am Boden): nach H. v. Gossen, R E X X Sp. 2338 s. v. »Platanos« Nr. 1 handelt es sich dabei um eine Ahornart, Acer monspessulanum L. (Aceraceae). - Zwerge: den Zwergwuchs von Tieren erwähnt Plinius, nat. hist. 10, 156 und 1 1 , 260, den des Weinstocks nat. hist. 17, 176. - C. Matius, vgl. auch Tacitus, Ann. X I I 60, 4. Plinius, nat. hist. 15, 49 erwähnt diesen Freund des Kaisers Augustus aus dem Ritterstande als Schöpfer neuer Apfelsorten; vgl. auch Columella, de re rust. V 10, 19 und
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 195
Apicius, de re coquin. IV 3, 4: mala Matiana. Er verfaßte auch 3 Bücher über Küche und Keller.
14 Den Kirschbaum (cerasus), Prunus avium L., die Süß-kirsche (Rosaceae), brachte zuerst L. Licinius Lucullus nach seinem Sieg über Mithridates VI. Eupator 64 v. Chr. nach Italien; vgl. zum Namen auch Servius, Georg. II 18 Cerasus civitas est Ponti, quam cum delevisset Lucullus, genus hoc pomi inde avexit et a civitate cerasium appella-vit; nam arbor cerasus, pomum cerasium dicitur (Cerasus ist eine Stadt im Pontos; nachdem Lucullus sie zerstört hatte, brachte er diese Obstart von dort weg und nannte sie nach der Stadt cerasium; denn der Baum heißt cerasus, die Frucht cerasium). Es ist nicht sicher, ob die Früchte süß oder sauer schmeckten, so daß vielleicht auch die Sauer- oder Weichselkirsche, Prunus cerasus L., in Betracht kommt; vgl. den ausführlichen Artikel von J . Olck, R E X I Sp. 509-515 s. v. »Kirschbaum« und Hehn S. 404 ff. -Der Pfirsichbaum (malus Persica), Prunus persica (L.) Barsch oder Amygdalus persica L., stammte aus China und kam über Persien (daher Persica) erst verhältnis-mäßig spät nach Rom. Neben Plinius erwähnt ihn vorerst nur Columella, de re rust. Χ 409ff. ; zum Ganzen vgl. A. Steier, R E X I X Sp. 1022-1026 s. v. »Persica (Pfir-sich)« und Hehn S. 431 ff.
15 Der assyrische Apfelbaum (malus Assyria), die Zitro-natzitrone, Citrus medica L. (Rutaceae). Zuerst wurde der Baum von Theophrastos, hist, plant. IV 4, 2 f . er-wähnt: » . . . wie denn das medische Land und Persis außer anderen auch den sogenannten medisdien und per-sischen Apfel hat« (K. Sprengel). - Erdbeerbaum, Arbutus unedo L. (Ericaceae). Theophrastos schreibt 1. c., daß das Blatt des assyr. Apfelbaums dem der Andrachne (dazu vgl. oben 13, 120), Arbutus andrachne L., gleiche. - Auch Dioskurides, mat. med. I 166 beschreibt den Baum und
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

196 E r l ä u t e r u n g e n
seine Verwendung in der Heilkunde (vgl. audi Vergil, Georg. I I 127 f). Er erwähnt dabei auch, daß man damit die Kleider vor Ungeziefer schützen könne. Zum Ganzen s. den ausführlichen Artikel von J . Olck, R E I I I Sp. 26 12 -2621 s. v. »Citrone« und Hehn S. 442 ff. - seine Frucht wird sonst nicht gegessen: Plinius, nat. hist. 15, 1 1 0 spricht vom sehr scharfen Geschmack. - zu jeder Zeit fruchttra-gend: diese Behauptung entspricht den Tatsachen; vgl. auch Plinius, nat. hist. 16 , 107 .
16 Die Heilwirkung der Zitrone behandelt Plinius, nat. hist. 23, 105; zur Fortpflanzung vgl. Theophrastos, hist, plant. IV 4, 3 und Plinius, nat. hist. 17, 64. - wie wir gesagt haben: Ppinius, nat. hist. 1 1 , 278; vgl. auch Vergil, Georg. I I 134 f.
17 Serer s. § 2. Plinius erwähnt sie nat. hist. 6, 54, ohne allerdings genauere Kenntnis über die Größe ihres Landes zu haben. Audi über die Gewinnung der Seide (wolle-tragende Bäume) hatte man nur unklare Vorstellungen; vgl. A. Herrmann, R E I IA Sp. 1678-1683 s. v. »Seres« und H. Blümner, R E I IA Sp. 1724- 1727 s. v. »Serica« ( = Seide). - Zur Größe der indischen Bäume vgl. Vergil, Georg. II 123 f. und Plinius, nat. hist. 7, 21 . - Zu den verschiedenen Arten des Ebenholzbaumes (hebenus oder ebenus, griech. ébenos vgl. ägypt. hbnj),Diospyros ebenum J . G. Koenig (Ebenaceae), s. § 20. - Vergil, Georg. I I 1 1 6 f. (sola India nigrum / fert hebenum - nur Indien trägt uns schwarzes Ebenholz) gibt als Heimat des Eben-holzes Indien an, während Herodot I I I 97 und 1 14 den Baum in Äthiopien vorkommen läßt; vgl. auch Plinius, nat. hist. 6, 197. Auch die Angaben über den Tribut der Äthiopier an den Perserkönig (hundert, bei Herodot I I I 97 zweihundert, Ebenholzstämme, zwanzig große Elefan-tenzähne u. a.) sind aus Herodot übernommen; vgl. Mün-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 197
zer S. 17 f. 82. Über weitere Ebenholzarten vgl. M. C. P. Schmidt, R E V Sp. 1893 f. s. v. »Ebenholzbaum«.
18 Herodot (geb. etwa 484 v. Chr.) wurde 444/43 v. Chr. Bürger der von Perikles neu gegründeten Kolonie Thurii (Thurioi) im Golf von Tarent, wo er wahrscheinlich audi sein Geschichtswerk verfaßte; vgl. E. Dittrich-A. Fleck-eisen. Plinius erwähnt die Stadt nur beiläufig nat. hist. 3, 97 und 6, 216. - Padtts, h. Po. Hier liegt offenbar eine Verwechslung mit dem mythischen Fluß Eridanus vor, über den nichts Genaueres bekannt ist. Nach Herodot (III 1 15) , der übrigens die Existenz wie auch Strabo (Geogr. V 1, 2 i j ) ablehnt, soll er ins Nordmeer fließen. Im Zuge ver-schiedener Lokalisierungsversuche (Rhein, Rhône) wurde er schließlich auch mit dem Po identifiziert, wahrschein-lich zuerst von Apollonios Rhod. (Argonautica IV 627), der die Rhône mit ihm zusammenfließen läßt. Polybios I I 16, 6 sagt vom Po, daß ihn »die Dichter als Eridanos feiern«; später findet sich die Übertragung häufig; vgl. Strabo 1. c.; Plinius, nat. hist. 3, 1 1 7 ff. und 37, 3 1 . Zur ganzen Frage s. H. Philipp, R E Sp. 2178 ff. s. v. »Padus«. Zur Behandlung der Quelle s. Münzer S. 340 f.
19 Die Karte Äthiopiens: Plinius berichtet nat. hist. 6, 181 von einer Expedition zwecks Erforschung Äthiopiens zur Zeit Neros (um 60 n. Chr.); Seneca, quaest. nat. V I 8, 3 f. ; zum Ganzen s. R . Hennig, Terrae incognitae. i .Bd. , 2. Aufl. Leiden 1944, S. 356-362. - Syene in Oberägypten, h. Assuan; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 183 f. j , 59. 6, 183 f . -Meroë, h. Atbar, eine Nilinsel in Äthiopien zwischen Khartum und Ed-Damer; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 178. 184. 186 .245 .6 , 183 ff. - 996000 Schritt = 1474 km. Als Distanz Meroë-Syene gibt Plinius, nat. hist. 2, 184 5000 Stadien = 925 km an; weitere Entfernungsangaben finden sich nat. hist. 6, 183. Die tatsächliche Entfernung liegt bei 800 km.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

198 E r l ä u t e r u n g e n
Pompeius d.Große (106-48 v.Chr.) beendete 66 v .Chr. den Krieg mit Mithridates VI . Eupator (etwa 132-63 v. Chr.), König von Pontos. Der Triumphzug des Pom-peius fand erst 61 v. Chr. statt; s. Münzer S. 167. -Papirius Fabianus wird von Plinius mehrfach zitiert, war aber »kein wichtiger Gewährsmann«; s. Münzer S. 391 Anm. ι . - Auch Theophrastos, hist, plant. IV 4,6 berichtet von zwei Arten des Ebenholzbaumes; »die eine liefert ein schönes Holz, die andere ein schlechtes. Seltener ist jene, diese häufig. Die schöne Farbe aber nimmt das Holz nicht erst durch Aufbewahren an, sondern es hat sie gleich von Natur. Der Baum hat einen glatten Stamm, der andere ist strauchartig, wie der Kytisos« (K. Sprengel). Ausführ-licher ist Dioskurides, mat. med. I 129: »Als das beste Ebenholz gilt das äthiopische, schwarze, adernfreie, wel-ches an Glätte dem polierten Horn gleicht und auf dem Bruche fest i s t . . . Es gibt auch eine indische Sorte, welche weiße und gelbe Adern und gleichmäßig dicht gehäufte Flecken hat; indes besser ist das erstere« (J. Berendes). -Kytisos (cytisus), der baumartige Schneckenklee, Medi-cago arborea (Leguminosae); vgl. oben 13, 130- 134 . Pli-nius erwähnt ihn nochmals nat. hist. 16, 204 als dem Ebenholz sehr ähnlich.
Diese von vielen Kommentatoren mißverstandene Stelle ist wohl identisch mit der klaren Aussage des Dioskurides, mat. med. I 129: »Wird es im frischen Zustande dem Feuer genähert, so entzündet es sich wegen des Fettgehal-tes« (J. Berendes). - Alexander d. Große s. § 25.
Der echte Feigenbaum (ficus, griech. syké, beide aus einer mediterranen Sprache), Ficus carica L. (Moraceae), ist durch seine Früchte geschätzt; der Pepulbaum der Inder, auch Bobaum genannt, Ficus religiosa L., wird durch das ungeheure Ausmaß seines Stammes und die von Plinius genannte Art der Fortpflanzung gekennzeichnet;
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 199
audi der Banyanbaum, Ficus bengalensis L. = Ficus indica L., kommt in Betracht. Ähnliche Angaben bei Theo-phrastos, hist, plant. I 7, 3 ; Diodor X V I I 90, 5 ; Strabo, Geogr. X V 1, 694; Arrian, Ind. 1 1 , 7 und Curtius I X ι , 10; vgl. auch Plinius, nat. hist. 7, 2 1 .
60 Schritte = 88,8 m. - 2 Stadien — 370 m. - Amazo-nenschild (pelta), ein kleiner halbmondförmiger Schild. -Akesines, ein Nebenfluß des Indus, einer der Ströme des Pandschab, h. Öin-ab; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 71 . 16, 162. 37, 200. - Das ganze Kapitel stammt im wesentlichen aus Theophrastos, hist, plant. IV 4, 4. Näheres im ausführ-lichen Artikel von J . Olck, R E V I Sp. 2 100-2 15 1 s. v. »Feige« und Hehn S. 95 ff.
indische Weise: es handelt sich um die Gymnosophisten oder Brahmanen, die Plinius bereits nat. hist. 7, 22 er-wähnt hatte. - pala (vgl. sanskr. tala - >Palme<), ariera (andere Lesart ariena; es besteht sicherlich eine Beziehung zum Volk der Arianer s. § 33): Hier ist ohne Zweifel die Banane, Musa paradisiaca L. (Musaceae), gemeint. Audi Theophrastos, hist, plant. IV 4, j berichtet von einem Baum, von dessen Früchten die indischen Weisen leben; von einem anderen Baum sagt er 1. c., daß »dessen Blatt an Gestalt länglich und ähnlich den Straußenfedern ist« (K. Sprengel). Wahrscheinlich hat Plinius die Bemerkun-gen des Theophrastos über beide Bäume für den Baum pala verwendet, von dessen Blatt er schreibt, es gleiche den Vogelflügeln. - Sydrakier oder Oxydrakier (sanskr. ksudraka - >die Kleinen<), ein wegen seiner Kriegstüchtig-keit oft gerühmter indischer Stamm, der im Gebiet zwi-schen den Flüssen Hydraotes, h. Ravi, und Hyphasis, h. Bias, in Arachosien, h. Ostiran und Afghanistan, lebte; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 92. Zum Ganzen s. O. Stein, R E X V I I I Sp. 2024-2032 s. v. »Oxydrakai«. - Auf seinem Indienfeldzug gelangte Alexander d. Große bis zum West-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

200 E r l ä u t e r u n g e n
ufer des Hyphasis, h. Bias. - anderer Baum: Es ist schwer zu sagen, welchen Baum Plinius hier meint. Auch Theo-phrastos spricht 1. c. von dem Verbot Alexanders, die Früchte dieses Baumes zu genießen. Man hat an den Mangobaum, Mangifera indica L. (Anacardiaceae), ge-dacht, dessen Früchte wohlschmeckend, aber gefahrlos eß-bar sind. Die Frage muß offen bleiben.
25 Makedonier: gemeint sind die sog. Alexanderhistoriker, die über den Zug nach Indien aus eigener Anschauung berichteten; vgl. H . Bretzl, Botanische Forschungen des Alexanderzuges. Leipzig 1902. - Die Pistazie (pistacia, griech. pistáke von pers. pistah), auch Terebinthe (tere-binthus, griech. términthos und terébinthos unbekannten Ursprungs), Pistacia terebinthus L. (Anacardiaceae), ist eine mediterrane Pflanze, die bis zur Baumhöhe gedeihen kann. Man hat aus ihr früher das als Heilmittel geschätzte Chios- oder Cyper-Terpentin, ein harziges, aromatisches und zähflüssiges Material, gewonnen. Einzelheiten s. H . v. Gossen, R E X X Sp. 1809-1811 s. v . »Pistazie« und A. Steier, R E V A Sp. 577-581 s. v . »Terebinthos« sowie Hehn S. 421 ff. - Audi der Mandelbaum (amygdalus), Amygdalus communis L. = Prunus dulcís (Mill.) D. Α . Webb (Rosaceae), ist für das Mittelmeergebiet charak-teristisch. - Baktrien, h. Afghanistan. - Maulbeerbaum (morus), schwarzer oder weißer Maulbeerbaum, Morus nigra oder alba L. (Moraceae). - Hagebutte (cynorrho-don), auch Hundsrose, Rosa canina L. (Rosaceae), ge-nannt. - Die von Plinius mit keinem Namen belegte Pflanze könnte vielleicht die Ramie, Boehmeria nivea (L.) Gaudich. (Urticaceae) sein. Man gewinnt aus dieser Nessel-pflanze eine Bastfaser, die sich zu Geweben weiter ver-arbeiten läßt. Zum ganzen Abschnitt vgl. Theophrastos, hist, plant. I V 4, 7 f.
26 Der indische ölbaum (oliva Indiae), auch stachelspitzi-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 201
ger ölbaum, Olea cuspidata (Oleaceae), genannt. Daß der ölbaum in Indien unfruditbar sein soll, schreibt audi Theophrastos, hist, plant. IV 4, 1 1 . - Pfeffer (piper, griech. péperi, sanskr. pippali - >Pfefferkorn<) : Plinius vermengt in diesem und dem folgenden Abschnitt Wahres und Falsches. Theophrastos, hist, plant. I X 20, 1 lieferte die erste, etwas unklare Beschreibung und unterschied zwei Arten. Plinius und Dioskurides, mat. med. I I 188 kennen drei, offenbar handelsübliche Sorten: Piper longum L., den langen Pfeffer, Piper nigrum L., den schwarzen Pfeffer, und Piper candidum, den weißen Pfeffer (Pipera-ceae). Die Ähnlichkeit mit dem Wacholder, Iuniperus communis L. (Cupressaceae), ist nur recht äußerlich. Die in Schoten stehenden Samenkörner, ähnlich wie an den Schwertbohnen (phasiolus, Dolichos melanophthalmos L.), können sich auf den in Afrika verbreiteten Mohren- oder Negerpfeffer, Xylopia aethiopica (Dun.) A. Rieh. (Anno-naceae), auch Malaguetapfeffer genannt, beziehen; vgl. zum Ganzen den ausführlichen Artikel von A. Steier, R E X I X Sp. 142 1 - 1425 s. v. »Pfeffer«.
27 bregma (bei Dioskurides, mat. med. I I 188 brasma) von sanskr. vrkna - >zerstört, zerbrodien<, ist ein tauber, d. h. leerer Samen. Der Schwarze Pfeffer, Piper nigrum L. (Piperaceae), ist eine Schlingpflanze mit immergrünen Blättern. Die noch grünen Beeren werden gesammelt, an der Sonne getrocknet, und ergeben den sog. Schwarzen Pfeffer. Aus den reifen, von den Samenschalen befreiten Früchten erhält man, ebenfalls an der Sonne getrocknet, den sog. Weißen Pfeffer. Der Lange Pfeffer, Piper longum L., hat gerippte Blätter und ist in Indien und Malaysia heimisch; seine langen Fruchtähren werden verkauft. -Die Schärfe des Pfeffers beruht auf seinem Gehalt an ätherischen ölen und vor allem an Piperin, einem stick-stoffhaltigen Alkaloid, C 1 7 H l e N O j , das sidi bei der sauren
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

202 E r l ä u t e r u n g e n
Hydrolyse in Piperidin und Piperinsäure spalten läßt. Außerdem ist im Pfefferharz noch eine bitter schmeckende Substanz enthalten.
28 Zingiber oder auch Zimpiber (griech. zingiber oder zingiberis, sanskr. singivera, malaiisch inchi-ver) = der Ingwer, Zingiber officinale Rose. (Zingiberaceae). Die Pflanze stammt aus Asien. Aus ihrem Rhizom, das, wie Plinius richtig schreibt, nicht mit der Wurzel des Pfeffers identisch ist, gewinnt man auch heute noch wertvolle Riech- und Geschmackstoffe. Hauptbestandteile sind wie-derum ätherische ö le und scharf schmeckende Stoffe,· die man früher als Gingeroi bezeichnet hat; es handelt sich aber vorwiegend um Oxyketone, wie das Zingeron und das Shogaol. Eine Beschreibung der Pflanze und ihrer Heilwirkung gibt Dioskurides, mat. med. II 189. Näheres bei R. Stadler, R E I X Sp. 1554 s. v. »Ingwer«. - Troglo-dyten = Höhlenbewohner, Volk im südlichen Ägypten. -Denar: römische Silbermünze, ungefähr der griechischen Drachme entsprechend, ursprünglich 10 (denarius), später 16 Asse = ungefähr 80 Pfennige alter Währung. -alexandriniseber Senf (sinapi) : wahrscheinlich der schwarze Senf, Brassica nigra (L.) W. D. J . Koch (Cruciferae).
29 Schärfe des Pfeffers s. § 27. - Auch Italien ... einen Pfefferbaum, größer als die Myrte: die Myrte, Myrtus communis L. (Myrtaceae), ein immergrüner Strauch mit weißen Blüten und schwarzen Beeren. Es gibt mehrere Varietäten dieser Pflanze, die sich durch Form und Größe der Blätter unterscheiden. Welchen Pfefferbaum, der der Myrte ähnlich sein soll, Plinius meint, bleibt unklar. Doch vgl. Plinius, nat. hist, i j , 1 18 , wo er schreibt, daß die Myrte ursprünglich, ehe man den Pfeffer kannte, als Ge-würz Verwendung fand. - Wacholder s. § 26.
30 karyophyllon (lat. caryophyllum, griech. karyóphyllon = >Nußblatt<, volksetymologische Umdeutung von
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 203
sanskr. katukaphala = >beißende Frucht<), wahrscheinlich der Gewürznelkenbaum, Eugenia caryophyllata, auch Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry (Myrta-ceae) genannt. Der Baum hat lederartige Blätter und weiße Blüten, die Dolden bilden. Die im Handel befind-lichen Gewürznelken sind Blütenknospen; sie enthalten ein stark riediendes ätherisches ö l , aus dem das wertvolle Nelkenöl gewonnen wird. Geruchsträger ist das Eugenol, das für die Vanillinsynthese von Bedeutung ist. Im Kräu-terbuch von Lonicerus-Uffenbach (Ulm 1679) heißt es: »Seind dem Dioscoridi unbekannt gewesen, werden Näg-lin genennet, dieweil sie eines Nagels form oder Gestalt haben / wachsen auch in India«; vgl. auch F. Orth, R E V I I Sp. 1353 f. s. v. »Gewürznelke«. - Der indische Lo-tos, Nelumbo nucífera Gärtn., hat rosafarbene Blüten und tütenförmige Blätter. - Hennastrauch (cypros), Law-sonia inermis L. (Lythraceae), s. § 109. - lykion, wahr-scheinlich eine Rhamnus-Art (Rhamnus lyciodes?). Einen ausführlichen Bericht gibt Dioskurides, mat. med. I 132: »Lykion, welches einige Pyxakantha nennen, ist ein dor-niger Strauch mit drei Ellen langen oder noch größeren Zweigen . . . Er hat eine dem Pfeffer ähnliche schwarze, bittere, harte und glatte Frucht und eine gelbliche Rinde, . . . viele, breite und holzige Wurzeln . . . Der Saft wird bereitet, indem die Wurzeln samt dem Strauche zerstoßen, hinreichend viele Tage hindurch macerirt und gekocht werden, dann nach Entfernen des Holzes die Flüssigkeit wieder bis zur Honigconsistenz eingekocht wird« (J . Be-rendes). Lonicerus-Uffenbach (Ulm 1679) nennen die Pflanze Buxdorn/Pyxacantha: »wird audi lycium ge-nennt, von der Landschaft Lycia; da er wächst.«
3i Berg Pelion, ein Berg in Thessalien; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 162. 4, 30. - Äff odili (asphodelus), Asphodelus albus Mill. (Liliaceae) galt in der Antike als Zauber-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

204 E r l ä u t e r u n g e n
blume, mit der Gift unschädlich gemacht werden konnte. -Wermut (absinthium), Artemisia absinthium L. (Compo-sitae), eine Pflanze von sehr bitterem Geschmack, der man heilkräftige Eigenschaften zuschrieb. Der sog. Absinth ist ein Destillat des Wermuts unter Zusatz anderer Pflanzen und führt bei Mißbrauch zu schweren Gesundheitsschädi-gungen. - Sumach (rhus), wahrscheinlich der Gerber-sumach, Rhus coriaria L. (Anacardiaceae), ein gerbstoff-reicher Strauch des Mittelmeergebietes. - ölschaum (amur-ca), auch ölsatz genannt, wird von Plinius, nat. hist. 15, 9 genauer beschrieben: eine bittere, wäßrige Flüssigkeit, Bestandteil der Olive. Nach Dioskurides, mat. med. I 140 ist der ölsatz der Bodensatz des ausgepreßten Olivenöls. - Als Verfälschungsmittel des lykion nennt Dioskurides, mat. med. I 132 Olivenhefe ( = ölschaum), Wermutsaft und Ochsengalle. - Die Inder: auch Dioskurides erwähnt 1. c. ein indisches lykion aus dem Strauch Lonchitis. -Buxdorn (pyxacanthus, griech. pyxákanthos) oder Buchs-dorn, Buxus sempervirens L. (Buxaceae), eine im ganzen Mittelmeerraum verbreitete strauchartige Pflanze, deren hartes Holz zu verschiedenen Schnitzereien verwendet wurde. - Chiron (Cheiron), Kentaur, Sohn des Kronos und der Philyra, berühmt wegen seiner Kenntnisse in der Heilkunst und daher Lehrer des Asklepios. - Die medi-zinische Verwendung des lykion behandelt Plinius, nat. hist. 24, 124- 127 .
32 makir (macir, griech. mákir und mákeir, Ursprung un-bekannt) ist nicht genau bestimmbar. Auch Dioskurides, mat. med. I i n nennt makir »eine aus dem Ausland bezogene Rinde, gelblich fest, im Geschmack stark adstrin-gierend« (J. Berendes). W. H. S. Jones denkt an Holar-rhena antidysenteria Wall. (Apocynoceae), eine zu den Hundsgiftgewächsen gehörende Pflanze. - Zucker (sacca-ron, griech. sákdiaron u. ä. von sanskr. sárkara - Kiesel-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Erläuterungen
steine = Körnerzucker): A. Ernout, Komm. S. 76 sieht darin den Rohrzucker, während H. Blümner, RE ΙΑ Sp. 1812-181 j s. v. »Sakdiaron« die Auffassung vertritt, daß das Sekret einer Bambusart, von den Arabern Taba-sdiir genannt, gemeint sei; audi Dioskurides, mat. med. II 104 spricht von einem »Honig des Zuckerrohres«. Luca-nus, Phars. III 237 berichtet von orientalischen Völkern, quique bibunt tenera dulcis ab harundine sucos (die Zuk-kersaft aus dünnem Rohr saugen) und auch Strabo, Geogr. X V ι , 694 erwähnt ein Rohr, das Honig gibt. Der Zucker, Sacdiarum officinarum L. (Gramineae), wurde audi als indisches Salz bezeichnet und offenbar nur als Arznei-mittel verwendet. Erst durch die Kreuzzüge wurde die Zuckerrohrpflanze weiter verbreitet und gelangte dann im 16. Jhdt. auch nach Südamerika.
Die hier genannten Pflanzen lassen sich nidit identi-fizieren; s. audi Theophrastos, hist, plant. IV 4, 12 f. -Arianer: Dieses in den östlichen Provinzen des persischen Reiches im h. Iran wohnende Volk wird von Plinius, nat. hist. 6, 92 f. und 212 erwähnt. - Die Gedrosier bewohnen den südöstlichen Teil des Hochlandes von Iran; vgl. Strabo, Geogr. X V 2, 723 und Plinius, nat. hist. 6, 78 und 212; 9, 7 erwähnt er die Gedrosier, die am Fluß Arabis, h. Habb, wohnen; s. auch nat. hist. 13, jo. 21, 62. - One-sikritos FGH 134 frg. 3. - Hyrkanien, das Land zwischen Medien, Parthien und dem Kaspischen Meer. - occhi, wahrscheinlich der Mannabaum, Alhagi maurorum Medik. (Leguminosae). Das in der Bibel (2. Mos. 6) erwähnte Manna scheint aber von einer Tamariske, Tamarix manni-fera, zu stammen. In der aus verschiedenen Pflanzen ge-wonnenen Manna befindet sich ein Zucker, Mannit ge-nannt.
Baktrien, h. Afghanistan; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 236. 4, 39. - bdellion (bdellium vgl. hebr. bdolah): man ver-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

20 6 E r l ä u t e r u n g e n
steht heute darunter ein Gummiharz, das von Bäumen aus der Familie der Burseraceen ausgeschieden wird, ζ. B. der Myrrhenstrauch Commiphora Jacq. Lonicerus-Uffenbadi (Ulm 1679) nennen das bdellium einen »Gummi von einem Baum« ohne nähere Angabe und sagen weiter »ist mit der Myrrha beinahe gleicher Gestalt und Wirkung, wird aber mit dem Gummi arabico verfälscht«. - brochon, malacha, maldakon, hadrobolon: brochon, malacha und maldakon sind wohl semitischen Ursprungs; vgl. Dios-kurides, mat. med. I 80: »Das bdellion - einige nennen es madelkon, andere bolchon — ist die Träne eines arabischen Baumes« (J. Berendes); hadróbolon (große Kugel) ist grie-chisch. - das peratische bdellion: peraticum (griech. peráti-kon) bedeutet »vom Ende der Welt«, doch scheint eine Verwechslung vorzuliegen, denn Dioskurides sagt 1. c.: »Von Petra kommt auch ein trockenes, harzähnliches, etwas schwärzliches (bdellion)« (J. Berendes). Petra wird von Plinius, nat. hist, j , 87 als Stadt in Arabien genannt; anderseits nennt er nat. hist. 5,70 einen Bezirk Peraea, der von Judaea durch den Jordan getrennt wird. Die Frage muß offen bleiben.
scordastum: ein nicht identifizierbarer Baum. Es besteht irgendein Zusammenhang zu griech. skórodon - Knob-lauch; vgl. den von Plinius, nat. hist. 3, 148 erwähnten Volksstamm der Skordisker in Pannonien.
Rotes Meer s. § 2; persisches Meer = Persischer Golf; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 108. - Bäume von merkwürdiger Besòaffenheit:V\\m\is beschreibt hier sehr genau dieMan-grovebaumgewächse (Rhizophoraceae). Unter Mangroven versteht man einen besonderen Vegetationstyp, der vor allem durch große Luftwurzeln (Polypenarme), die das Aussehen von Stützpfählen haben, charakterisiert ist. Näheres s. oben 13, 141. Die entsprechende Parallelstelle
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 207
bei Theophrastos, hist, plant. IV 7, 5 f. - Erdbeerbaum s· § 15-
38 Insel Tylos, h. Bahrain im Persischen Golf; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 148. - Lupine (lupinus) mit zahlreichen Varietäten, wie Lupinus albus L., Lupinus hirsutus L. (Leguminosae) usw. - wolletragende Bäume: gemeint ist die Baumwolle, Gossypium arboreum L. (Malvaceae), die auch heute noch in Indien kultiviert wird. Es handelt sich um einen Strauch mit roten Blüten. Bei der Reife springt die Samenkapsel auf und läßt einen wollartigen Knäuel hervortreten. Näheres s. P. Wagler, R E III Sp. 167- 173 s. v. »Baumwolle«. Die Parallelstelle s. Theophrastos, hist, plant. IV 7, 7; vgl. auch Herodot III 106, 3 und Strabo, Geogr. X V 1, 694. - Serer s. § 2 und 17. Plinius unterscheidet hier also deutlich zwischen Seide und Baum-wolle.
39 gossypinum (griech. gossypion, Ursprung unbekannt), Bezeichnung für den Baumwollbaum. - 10 000 Schritt = etwa 14,800 km. - Unter der kleineren Insel Tylos ist wohl die benachbarte Insel Arados, h. Arad, zu ver-stehen. - Iuba F G H 275 frg. 62. - cynas: wahrscheinlich eine zur Familie der Wollbaumgewächse (Bombacaceae) gehörende Pflanze, vielleicht Bombax ceiba L. - anderer Baum, dessen Blatt die Gestalt eines weißen Veilchens hat: gemeint ist wohl die auch bei Theophrastos, hist, plant. IV 7, 8 erwähnte Levkoje, Matthiola incana (L.) R. Br. (Cruciferae). Über das Veilchen spricht Plinius, nat. hist.
2 1 . 2 7 · 40 Der Inhalt dieses Abschnittes steht wieder in engem
Zusammenhang mit Theophrastos, hist, plant. IV 7, 8. Der Baum mit rosafarbener Blüte ist nicht bestimmbar.
41 Kostwurz (costus oder costum, griech. kóstos von sanskr. kustah): Man hat längere Zeit versucht, diese Pflanze mit Costus speciosus (J . G. Koenig) Sm. (Zin-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

20 8 E r l ä u t e r u n g e n
giberaceae) zu identifizieren, während man heute der Auf-fassung ist, daß es sich um Saussurea Lappa (Compositae) handelt. Theophrastos, hist, plant. I X 7, 3 erwähnt kóstos ohne genauere Beschreibung der Pflanze. Audi Dioskuri-des, mat. med. I 15 macht nur ungenaue Angaben. Er unterscheidet drei Arten, eine arabische, indische und syrische. Die eigentliche Heimat ist aber wohl, wie Plinius schreibt, Indien, während Arabien und Syrien nur Trans-portländer waren. Aus alten Kräuterbüdiern kann man entnehmen, daß der Kostos in den Offizinen meist unecht war. So heißt es z. B. bei Lonicerus-Uffenbach (Ulm 1679) »die Wurtzel, welche für den Costus gehalten wird, ist gar nicht die rechte Wurtzel . . . «. Als Costus dulcis be-zeichnet man z. B. die weiße Zimtrinde, Cortex Canellae albae. - Insel Patale im Delta des Indus, beim h. Haide-rabad; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 7 1 . 76. 80.100.
42 Norde (nardus oder nardum, griech. nardos oder nár-don von sanskr. nalada): Man verstand im Altertum darunter mehrere wohlriechende Pflanzen, besonders aus der Familie der Baldriangewächse (Valerianaceae). Die Edite Narde, deren Wurzelstoái als Droge Verwendung findet, ist Nardostachys Jatamansi D. C. Theophrastos, hist, plant. I X 7, 2 erwähnt die Pflanze nur nebenbei, während Dioskurides, mat. med. I 6 ff. ausführlicher ist. Er unterscheidet zwei Arten der Narde (indische und syrische Narde I 6), die keltische Narde (I 7) und die Bergnarde (I 8). Es beruht auf einem Irrtum, daß sich der obere Teil der Pflanze in Ähren verbreite und daß diese mit den Blättern die eigentliche Droge darstellen; vgl. den ausführlichen Artikel von A. Steier, R E X V I Sp. 1705-17 14 s. v. »Nardus«. Aus der Bezeichnung >Ähre der Narde< ( = spica nardi) leitet sich der Pflanzenname Ech-ter Speik, Valeriana celtica L., ab. - Zypergras (cyperus), wohl Cyperus rotundus L. oder Cyperus longus L. (Cy-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 209
peraceae), eine mit dem Papyrus verwandte binsenartige Pflanze; vgl. Dioskurides, mat. med. I 4 und Plinius, nat. hist 21 , 1 1 7 . Sie wurde im Altertum oft verwechselt mit dem Schwertel oder der Siegwurz (cypirus), Gladiolus se-getum L. = Gladiolus italicusMill. (Iridaceae); vgl. Theo-phrastos, hist, plant. V I I 13,1 (phásganon); Dioskurides, mat. med. IV 20 (xíphion) und Plinius, nat. hist. 2 1 , 1 1 j f. Die Stelle ist in den Handschriften hoffnungslos verwirrt (Lesarten cupressum, cupiressum, cyperos). - Ganges, der bekannte indische Strom; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 343. 6, 60. 63 ff. - ozainitis steht in Beziehung zur Stadt Ozene, h. Oudjein im Gangesbecken. Vielleicht meint Plinius eine Grasart, z. B. das Zitronellgras, Cymbopogon iwaran-cusa (Roxb.) Schult. (Gramineae).
43 falsche Ν arde (pseudonardus) : sehr wahrscheinlich der Große Speik, Lavandula spica L. = Lavandula latifolia (L. f.) Medik. (Labiatae). - Gummiharz (cummi): nicht bestimmbar (oder sollte vielleicht der Kümmel, Cuminum cyminum L. [Umbelliferae] gemeint sein?). - Silberglätte (spuma argenti): die gelbliche Form der bei der Silber-gewinnung aus Bleierzen anfallenden Bleiglätte (Lithar-gyrum), PbO; vgl. Plinius, nat. hist. 33, 106. - Spieß-glanz (stibi) = Grauspießglanz, audi Schwefelantimon, Sb2S 3, genannt; vgl. dazu auch Dioskurides, mat. med. 16.- Zypergras s. § 42.
44 hadrosphairon (großblättrig), mesosphairon (mittel-blättrig) und mikrosphairon (kleinblättrig) sind lediglich Handelsbezeichnungen; vgl. Periplus maris Erythraei 65.
4j Plinius sagt nat. hist. 13, 16, daß bereits neun Kräuter-arten aufgezählt wurden, die der indischen Narde gleichen und zur Verfälschung dienen. Folgende Pflanzen kommen in Betracht: ι . ozainitis s. § 42. 2. falsche Narde (pseudonardus) s. § 43.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

210 E r l ä u t e r u n g e n
3. syrische Ν arde (nardum Syriacum): Patrinia scabiosi-folia Fisch. (Valerianaceae); vgl. Dioskurides, mat. med-1 6 .
4. keltische Ν arde (nardum Gallicum): Valeriana celtica L. s. § 42; vgl. Dioskurides, mat. med. I 7.
j . kretische oder wilde Ν arde, auch phu genannt: viel-leicht Valeriana tuberosa L. oder Valeriana phu L.; vgl. Dioskurides, mat. med. I 10. Ihre Blätter werden mit dem Pferdeeppich (olusatrum), Smyrnium olusa-trum L. (Umbelliferae), einer bei den Römern belieb-ten Gemüsepflanze, verglichen.
6. Haselwurz (asarum) s. § 4/, fälschlich auch Waldnarde (nardum silvestre) genannt.
7. bakkaris, audi Feldnarde (nardum rusticum) genannt, näher behandelt von Plinius, nat. hist. 2 1 , 1 32 f f . ; vgl. auch Dioskurides, mat. med. I I I 44 (51).
8. >Böckchen* (hirculus), wahrscheinlich der Felsenbal-drian, Valeriana saxatilis L. (Valerianaceae).
9. Zypergras (cyperus) s. § 42. Es liegt hier wohl eine Verwechsung der ähnlich klingenden Formen cyperus und cypirus zugrunde; s. oben § 42.
Nähere Einzelheiten s. A. Steier, R E X V I Sp. 1 705- 17 14 s. v. »Nardus«. Die Wurzel des in der Heilkunde ge-brauchten Gemeinen Baldrians, Valeriana officinalis L., enthält neben ätherischen ölen, Harz, Stärke, Essig- und Ameisensäure usw. vor allem die Isovaleriansäure, (CH s ) 2 CHCH 2 COOH, die man auch heute nodi zur Syn-these einiger Präparate verwendet.
47 Haselwurz (asarum, griech. ásaron - unansehnlich; vgl. die von Plinius, nat. hist. 2 1 , 30 gegebene Namenserklä-rung »weil man sie nicht für Kränze verwendet«), Asarum europaeum L. (Aristolochiaceae). Die Pflanze, die herz-förmige Blätter aufweist, findet sich vor allem in Laub-wäldern, wo sie oft weite Strecken des Bodens am Fuße
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 211
hoher Bäume überzieht. Ihre unscheinbaren Blüten sind grünlich (nicht purpurrot). Die Pflanze strömt einen bal-samischen Geruch aus, die Wurzel hat einen pfefferartigen Geruch und scharfen Geschmack und enthält neben ätheri-schen ölen (Sesquiterpene) das Asaron, ein Oxhydrodii-nonderivat; sie wirkt brecherregend und purgierend. In seinen Angaben stimmt Plinius im wesentlichen mit Dios-kurides, mat. med. I 9 überein. - Pontos: das Schwarze Meer und die umliegenden Landschaften. - Phrygien: Landschaft in Kleinasien. - Illyricum: gebirgige Land-schaft an der Ostküste der Adria nördlich von Epirus. -Thrakien: Teil der Balkanhalbinsel, östlich von Make-donien und Epirus bis zum Schwarzen Meer.
Amomumtraube (amomum, griech. ámomon, unbekann-ten Ursprungs, vgl. die Zusammensetzungen cardamo-mum, griech. kardámomon, und cinnamomum, griech. kinnámomon) : die genaue Bestimmung dieser Pflanze be-reitet Schwierigkeiten. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Amomum cardamomum Roxb. non L. (Zingiberaceae) = Kardamome s. § 50. Die heute noch als Heilmittel und Aromastoffe verwendeten Kardamom-samen, die vorwiegend Terpenkohlenwasserstoffe enthal-ten, stammen aus der vor allem in Malabar und auf Cey-lon wachsenden Kardamompflanze, die kleine Malabar-kardamome, Elettaria cardamomum (L.) Maton = Amo-mum cardamomum L.; ferner gibt es noch die Ceylon-kardamome, Elettaria maior Sm. Während Theophrastos, hist, plant. I X 7, 2 die Amome nur kurz erwähnt, stimmt die von Dioskurides, mat. med. I 14 gegebene Beschrei-bung mit Plinius im wesentlichen überein. Näheres bei P. Wagler, R E I Sp. 1873 f. s. v. »Amomon«.
Otene: Landschaft in Armenien am Oberlauf des Euphrat und Tigris; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 42. -Medien s. § 3 j . - Pontos s. § 47. - amomis: von Dioskuri-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

212 E r l ä u t e r u n g e n
des, mat. med. I 14 ebenfalls erwähnt und als »geruchlos und ohne Frucht« bezeichnet; vielleicht identisch mit Cissus inodora (Vitaceae) oder Bryonia dioica (Cucur-bitaceae).
Die Kardamome (cardamomum, griech. kardámomon als Zusammensetzung von kárdamon - Kresse und ámo-mon) ist im wesentlichen mit der Amomumtraube s. § 48 identisch. Es gibt mehrere Amomumarten, die im Alter-tum als Gewürz- und Heilpflanzen Verwendung fanden; die von Plinius genannten vier Arten lassen sich jedoch nicht genauer bestimmen. Dioskurides, mat. med. I j be-schreibt die Pflanze nur kurz, Theophrastos, hist, plant. I X 7, 2 f. beschränkt sich auf die Angabe ihrer Herkunft, Medien bzw. Indien. - Kostwurz s. § 41 . - Medien s. § 3 5 . - Die Verwendung von Amomum in der Heilkunde und Parfümerie behandelt Plinius, nat. hist. 13, 8. 15. 16. 18; 14, 107; 15, 30; 26, 34. i o j ; zur Aromatisierung von Wein 14 , 107 .
Zimt (cinnamomum, griech. kinnámomon als Zusam-mensetzung von kinnamon vgl. hebr. qinnamon - Zimt und ámomon) s. § 85. - Arabia felix ac beata - das >glückliche< und >gesegnete< Arabien: eine im Altertum übliche und bis in die Neuzeit gebräuchliche Bezeichnung für Südarabien = Jemen. Die lateinische Bezeichnung Arabia felix kam durch ein Mißverständnis zustande: Jemen (arab. taiman) heißt >Süden< bzw. >rechts<, griech. bedeutet >rechts< = >glücklich< dexiós, das mit eudaimon >glücklich< auf Grund des Anklanges zu arab. taiman gleichgesetzt wurde; vgl. auch Plinius, nat. hist, j , 65. — Weihrauch (tus, griech. thyos - Räucherwerk), ein Gummi-harz mehrerer Boswellia-Arten (Burseraceae), z. B. Bos-wellia sacra Flückiger = Boswellia carteri Birdw., Bos-wellia papyrifera usw. - Myrrhe (murra, griech. myrra oder älter smyrna zu sem. mrr - bitter) wird aus mehreren
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n
Commiphora-Arten, ζ. Β. Commiphora abyssinica Engl, gewonnen. - Troglodyten s. § 28. - Weihrauch und Myrrhe finden audi ausführliche Behandlung bei Theo-phrastos und Dioskurides; s. §§ y 8—66.
$2 Atramiter (Atramitae): ein arabischer Volksstamm, vgl. Plinius, nat. hist. 6, 155 ; s. audi § 69. - Sabäer: dieses wegen seines Weihrauches berühmte Volk Arabiens erwähnt Plinius auch nat. hist. 6 , 154. - Sabota (Sabbàtha), h. Sabwa, Stadt in Südarabien. Plinius bemerkt nat. hist. 6, 155, daß die Stadt 60 Tempel habe. - Sariba = »Ge-heimnis', wie Plinius angibt, findet sich sonst nirgends im antiken Schrifttum. Die in älteren Plinius-Ausgaben er-folgte Gleichsetzung mit dem aus dem Alten Testament (1. Kön. 9 - 1 1 ) bekannten Saba ist nicht von der Hand zu weisen.
53 Schoinos: ein im Orient verwendetes Längenmaß, des-sen Dimension variierte; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 124 inconstantiam mensurae diversitas auctorum facit, cum Persae quoque schoenos et parasangas alii alia mensura déterminent (Die Inkonsequenz der Autoren bewirkt eine Abweichung des Maßes, da die Perser auch Schoinoi und Parasangen immer wieder nach einer anderen Maßbestim-mung berechnen). Nach Eratosthenes ist 1 Schoinos = 40 Stadien = }ooo Schritte, was 7,4 km entsprechen würde (1000 Schritte = 1 Meile = 1,48 km; 1 Stadion = 185 m). j2 Stadien = 5,92 km. 20 Schoinoi wären dann 148 km. - reich an weißem Ton (terra argillosa): auch Theophrastos, hist, plant. I X 4, 8 schreibt, daß der Weihrauchbaum »auf tonigem und scholligem Boden, wo wenig Quellwasser ist«, wachse. Tone sind wasserhaltige Tonerdesilikate mit verschiedenen Beimengungen. - na-tronhaltig (nitrosus): gemeint ist der Gehalt an Natrium-karbonat (Soda). Über die Gewinnung von >Nitrum< spricht Plinius, nat. hist. 3 1 , io6ff . und meint dabei Na-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

214 E r l ä u t e r u n g e n
trium- bzw. Kaliumkarbonat ( N a 2 C O s bzw. K 2 C O s ) , nicht aber Salpeter = Kaliumnitrat ( K N O s ) , mit dem man die Alkalikarbonate oft verwechselt hat; vgl. dazu H . Kopp.
j4 Minder (Minaei): ein Volksstamm in Südarabien, den Atramitern (s. § 52) angrenzend; vgl. Plinius, nat. hist. 6, ι j 5. Sie behaupteten, vom kretischen König Minos ab-zustammen; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 157. Sie hatten fruchtbares Land mit Wäldern von Palmen und anderen Bäumen, ferner viel Vieh; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 161; zum Ganzen s. A . Grohmann, RESuppl. V I Sp. 461-488 s. v. »Minaioi«. Über die Form des Weihrauchhandels berichtet auch Theophrastos, hist, plant. I X 4, 5.
j j . . . in Arabien Krieg geführt: wohl eine Anspielung auf den Feldzug des Präfekten von Ägypten Aelius Gal-lus nach Arabia felix in den Jahren 25/24 v. Chr.; vgl. dazu Strabo, Geogr. X V I 4, 780 und X V I I 1, 819; Cas-sius Dio L U I 29, 2 und Plinius, nat. hist. 6, 160 f. Zum Ganzen s. R. Hennig, Terrae incognitae. i . B d . , 2. Aufl . Leiden 1944, S. 301-308. - Gaius Caesar, Sohn (eigentlich Enkel und Adoptivsohn) des Augustus, unternahm eine große Orientreise, auf der er im Jahre 4 n. Chr. im Alter von 23 Jahren an den Folgen einer Verletzung starb.
56 Mastixstrauch s. § 72. - Zum Aussehen des Baumes vgl. Theophrastos, hist, plant. I X 4, 2. 7 f. - luba F G H 27J frg. 2; vgl. auch Strabo, Geogr. X V I 4, 782. - Terpentin-pistazie s. § 25. - König Antigonos: wahrscheinlich Anti-gonos II. Gonatas (319-239 v. Chr.), Sohn des Demetrios I. Poliorketes. - G. Caesar s. § 55. - pontischer Ahorn: Acer monspessulanum L. (Aceraceae). - Mandelbaum s. § 25. - Karmanien, Landschaft am Persischen Golf ; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 84. 95-98. 107-109^ 113. 149. 152. 212. - Ptolemäer: Diadochendynastie in Ägypten (323-30
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n
v. Chr.), nach Lagos, dem Vater Ptolemaios' I., auch Lagi-den genannt.
j7 Der Inhalt dieses Abschnittes stimmt mit Theophrastos, hist, plant. I X 4, 2 und 9 überein. - Sardes: alte lydische Königsstadt im westlichen Kleinasien; vgl. Plinius, nat. hist, $, 1 10 . 6, 21 j . 7, 196.
58/59 Auf gang des Hundsterns ( = Sirius): in der heißesten Zeit des Sommers, wenn die Sonne am 18. Juli in den ersten Grad des Löwen tritt; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 123. - Zur Gewinnung des Weihrauchs vgl. Theophrastos, hist, plant. I X 4, 4 f . - Alexandreia: die berühmte Stadt in Ägypten, von Alexander d.Großen 332 v.Chr. gegründet.
60 carfiathum und dathiatum: nicht näher erklärbare Be-zeichnungen für verschiedene Weihrauchsorten. - Iuba F G H 275 frg. 63. - Inseln: gemeint sind wohl die von den Arabern beherrschten Inseln Tylos (s. § 38) und Ara-dos im Persischen Golf ; vgl. Theophrastos, hist, plant. I X 4, 10.
61 Zum männlichen Weihrauch s. Dioskurides, mat. med. I 81. - Über große Stücke von Weihrauch berichtet auch Theophrastos, hist, plant. I X 4 , 1 0 .
6z >Tropfweihrauch< (griedi. stagonias - tropfend, träu-felnd), vgl. dazu Dioskurides, mat. med. I 81. - unzer-teilbarer Weihrauch (griech. átomos - unteilbar); nach Dioskurides, 1. c. wird Weihraudi auch künstlich rund gemacht, indem man ihn in würfelförmige Stücke zer-schneidet und diese in irdenen Töpfen so lange rollt, bis sie rund geworden sind. - >Erbsenweihrauch< (griedi. oro-bias von órobos - der Kichererbse ähnlich). - Manna: Auch Dioskurides, mat. med. I 83 erwähnt kurz die Manna des Weihrauchs. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls Manna genannten zuckerreichen getrock-neten Saft verschiedener Pflanzen, z. B. Tamarisken u. ä. -Das Gewicht einer Mine im griechisch-hellenistischen Be-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

ιι6 Er läuterungen
reidi schwankte zwischen 339 und 906 g; die attische Mine entsprach 436 g, in der Kaiserzeit etwa 340 g. Der römisdie Denar hatte etwa 4,55 g, so daß 28 Denare etwa 127,4 g entsprechen. - Leonides (Leonidas), Lehrer und Erzieher Alexanders d. Großen; vgl. Plutarch, Alex. 5. Von der Beute, die dieser 332 v. Chr. nach der Eroberung von Gaza gemacht hatte, »vermachte er seinem Erzieher Leo-nidas 500 Talente (etwa 131000 kg) Weihrauch und 100 Talente (etwa 2620 kg) Myrrhen zur Erinnerung an eine in der Kindheit gefaßte Hoffnung. Leonidas hatte nämlich einst bei einem Opfer den Alexander getadelt, als er mit beiden Händen Räucherwerk nahm und ins Feuer warf: >Lieber Alexander! So verschwenderisch kannst du einmal räuchern, wenn du über das Gewürzland Herr sein wirst; jetzt mußt du mit unserem Vorrate sparsam umgehen.< Bei dieser Gelegenheit schrieb ihm nun Alexander: >Wir schicken dir Weihrauch und Myrrhen im Überfluß, damit du nicht mehr gegen die Götter so karg zu sein brauchst« (J. F. Kaltwasser-H. Floerke) ; Plutarch, Alex. 25 und regum apophthegm, p. 179 EF.
Sabota s. § 52. Über den Transport und Verkauf des Weihrauchs vgl. Theophrastos, hist, plant. I X 4,6 und Periplus maris Erythraei 27. - Sabis: Theophrastos spricht 1. c. davon, daß man den Weihrauch in den Sonnentempel gebracht hat, weshalb man unter Sabis den Sonnengott Sams der Sabäer zu verstehen glaubte. Sabis kann aber auch nur soviel wie Sabwi = Gott oder Herr von Sabwa ( = Sabbatha - Sabota) bedeuten. - Gebbaniten, Volks-stamm in der Arabia felix; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 153.
Tbomna (Thumna), h. Kohlan im Wadi Baihan, Haupt-stadt der Gebbaniten, s. § 63; nach Plinius, nat.hist. 6,153 hat die Stadt 6j Tempel. - Gaza, alter Handelshafen im südlichen Iudaea ( = Palästina); vgl. Plinius, nat. hist, j , 6$ und 6$. - joo Schritte = 3607,5 km.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n " 7
6$ Ein Lastkamel wurde bei Wüstenreisen mit höchstens drei Zentnern ( = 150 kg) beladen, auf die 688 Denare ( = etwa 5J0 Goldmark) Spesen kamen; die geforderten Preise für das Pfund ( = 327,45 g) Weihrauch erscheinen daher nicht übermäßig hoch. - Zolleinnehmer (publicani) : Im römischen Reich war die Erhebung des Zolles (vectigal) an Privatunternehmer verpachtet, die diesen in den an der Reichs- oder Provinzgrenze liegenden Zollstationen ein-trieben. Aus der Zeit des Kaisers Marc Aurel ( 1 6 1 - 1 8 0 n. Chr.) ist ein Verzeichnis steuerpflichtiger Waren (species pertinentes ad vectigal) erhalten, in dem u. a. auch zahl-reiche Drogen etc. angeführt werden; s.S. i82.Dioskurides, mat. med. I 81 berichtet, daß der Weihrauch mit Fichten-harz und Gummi verfälscht werde; vgl. auch Isidorus v. Sevilla, Orig. X V I I 8,2. - den Zahn nicht eindringen lassen, d. h. wenn man ihn in den Mund nimmt, muß er beim Versuch des Zerbeißens sofort in kleine Stücke zer-bröckeln. - Man unterscheidet heute olibanum electum = von den Bäumen abgelösten Weihrauch und olibanum in sortis = unreines, vom Boden aufgelesenes Gummiharz. Im Gegensatz zur Angabe des Plinius erweicht Weihrauch beim Kauen und zerfließt fast im Munde. Sein Geschmack ist bitter aromatisch. Neuere Analysen des Weihrauchs ergaben folgende ungefähre Zusammensetzung (nach Ha-gers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis I I I S. 491) : 5-9 0/0 ätherische ö l e mit L-Pinen, Dipenten, Phellandren
und Terpenalkoholen; 60-66 °/o Harz, vorwiegend aus α-Boswelliasäure und
3 - Acetyl-ß-Boswelliasäure bestehend ; 12 % Schleim mit Galaktose und Arabinose; 8 °/o Gummi und Bitterstoffe.
Nähere Einzelheiten s. den ausführlichen Artikel von W. W. Müller, R E Suppl. X V s. v . »Weihrauch« (im Er-scheinen).
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

218 Er läuterungen
66 Theophrastos, hist, plant. I X 4, 2. - Die Myrrhe s. § 51 ; sie wird von Dioskurides, mat. med. I 77 ausführlich be-sprochen. - Sabäer s. § 52. - Troglodyten s. § 5 1 . - Zum Ganzen vgl. A. Blanchet.
67 Vgl. die Beschreibung der Myrrhe bei Theophrastos, hist, plant. IX 4, 3.7f. - Erdbeerbaum s. § 15. - ölbaum: nach Theophrastos, 1. c. ähnelt das Blatt dem Ulmenblatt. - luba FGH 275 frg. 64. - Pferdeeppich (olusatrum) s. § 45. - Wacholder s. § 26.
68/69 Plinius unterscheidet sieben verschiedene Arten der Myrrhe, während Theophrastos, hist, plant. IX 4, 10 nur von zwei Sorten spricht: »eine in natürlichen Tropfen, die andere ist künstlich geformt« (K. Sprengel) ; Dioskuri-des, mat. med. I 77 hingegen unterscheidet: »die fette der Ebene . . . , von der durch Auspressen die Stakte gewon-nen wird, eine andere die Gabirea, . . . die troglodytische, . . . die Kaukalis, . . . die Ergasime, . . . die Aminaia« (J. Berendes). Bei den zuletzt genannten handelt es sich um geringere Sorten. Vgl. die ausführliche Darstellung von A. Steier, RE X V I Sp. 1 134- 1 146 s. v. »Myrrha« Nr. 2.
Tropfmyrrhe (griech. stakté von stázein - tropfen): Steier weist Sp. 1 13 5 f. darauf hin, daß Plinius darunter nidit nur das aus Myrrhenharz gewonnene Myrrhenöl, sondern audi das für die ölgewinnung besonders wichtige Myrrhenharz verstand, das sehr reich an ätherischen ölen und an Harz ist; vgl. oben 13, 17, sowie Dioskurides, mat. med. I 73. - Gebbaniten s. § 63. - Beutel (folles): vielleicht sind auch Schläuche gemeint. - Die Myrrhe als kostbare Gabe des Morgenlandes wird in der Bibel sehr oft zusammen mit Weihrauch erwähnt. Einige Beispiele: Bal-sam und Myrrhen (1. Mose 37, 25); »nimm die besten Spezereien, die edelsten Myrrhen« (2. Mose 30, 23); Weih-rauch und Myrrhe (3. Mose 24, 7); »wie ein gerader
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 219
Rauch . . . von Myrrhen, Weihrauch« (Hohel. 3,6); »meine Hände troffen von Myrrhen« (ebda, $, j ) ; »deine Kleider sind eitel Myrrhen« (Ps. 45, 9); »und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen« (Matth. 2, 1 1 ) ; »und sie gaben ihm Myrrhen im Wein zu trinken« (Mark, i j , 23). - trog-lodytische Myrrhe: zu den Troglodyten s. § j i . 66. -tninäiscke Myrrhe: zu den Minäern s. § 54. - atramitische Myrrhe: zu den Atramitern s. § 52. - gebbanitische Myrrhe: zu denGebbaniten s. § 63. - ausaritischeMyrrhe: nach der Stadt Ausara, dem späteren Ghaytza, an der arabischen Ostküste zwischen den Vorgebirgen Syagros und Corodanum, h. Ras al-hadd; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 153, wo es allerdings >autaridae< heißt; s. auch A.Cuny. - dianitische Myrrhe: vielleicht ist die Insel Dia, h. Joboa, im Arabischen Meerbusen an der Westküste Arabiens ge-meint, die auch Strabo, Geogr. X V I 4, 777 erwähnt. -gemischte Myrrhe (collaticia) : eine Mischung verschiedener Myrrhesorten. - sambrakenische Myrrhe: nach der Insel und Stadt Sambrachate, in der Gegend des h. Luhaija an der Küste von Südwestarabien; vgl. Plinius, nat. hist. 6, i j i . - Sabäer s. § 52. - dusaritische Myrrhe: bezieht sich wahrscheinlich auf Dusares, den Stammgott der Naba-täer in Arabien, der von den Griechen mit Dionysos gleich-gesetzt und in der römischen Kaiserzeit als Sonnengott be-zeichnet wurde. - Mesalum (nach Plinius, nat. hist. 6, 158 Mésala), eine Stadt der Homeriten, h. wohl al-Assala (dialekt. m-Assala) in Abyan an der Mündung des Wadi Bana in den Indischen Ozean östl. von Aden.
70 Dioskurides, mat. med. I 77. - Tropfmyrrhe s. § 68. -erythräische Myrrhe: nach der griechischen Bezeichnung des Roten Meeres; s. § 2. - troglodytische Myrrhe s. § 68. - Räuchermyrrhe (murra odorarla): Neben der Salben-herstellung, s. oben 13, 8 ff., fand die Myrrhe audi zu Räucherzwecken Verwendung.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

220 E r l ä u t e r u n g e n
71 Auch Dioskurides schreibt 1. c., daß die Myrrhe durch »Zumisdien von Gummi, welches mit einem Aufguß von Myrrhe benetzt ist«, verfälscht wird (J . Berendes). -Mastix (mastiche von griech. masásthai — kauen) : Pistacia lentiscus L. (Anacardiaceae), ein immergrüner Strauch des Mittelmeergebietes mit einer Höhe von 2-4 Metern. Man gewinnt aus ihm ein Harz, das einen angenehmen Geruch aufweist und früher als Kaumittel zur Verbesserung des Atems verwendet wurde. Das Harz wird hauptsächlich auf der Insel Chios gewonnen. Näheres s. A. Steier, R E X I V Sp. 2168-2175 s · v · »Mastix«. - Gurkensaft: von Cucumis sativus L. (Cucurbitaceae). - Silberglätte s. § 43. - indische Myrrhe: Strabo, Geogr. X V 2, 721 berichtet, daß Alexander auf seinem Zug nach Gedrosien ( = Belud-schistan) Sträucher von Narde und Myrrhe angetroffen habe. Es handelt sich um eine Commiphora-Art, aus der auch das bdellion (bdellium § 35) gewonnen wurde. Das Echte Myrrhenharz aus Commiphora abyssinica Engl. (Burseraceae) setzt sich zusammen aus 2 8 - 3 0 % alkohol-löslichen Bestandteilen und etwa 61 °/o alkoholunlöslichen Anteilen, vorwiegend Gummi und Enzymen. Die medizi-nische Verwendung der Myrrhe bringt Plinius, nat. hist. 20, 212. 249. 251 ; 23, 108. 136. 139 u. ö.
Das bei Plinius mehrmals verwendete Wort cummi = Gummi hat natürlich mit unserem Kautschuk nichts zu tun. Man versteht unter Gummi den wasserlöslichen Teil der Gummiharze, der durch Eintrocknen der Säfte be-stimmter Pflanzenarten (z. B. der Guttiferae) gewonnen wird. Das schon im Altertum verwendete Gummi arabi-cum, gewonnen aus Sekreten verschiedener Akazienarten, ist in seinem molekularen Aufbau sehr kompliziert zu-sammengesetzt. Ein wesentlicher Baustein ist die L-Arabi-nose, eine Pentose.
72 Mastix s. § 7 1 . - laina: Welches Dorngewächs hier ge-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 221
meint ist, läßt sich nicht sagen. Die weiterhin genannte Mastixart wird auch von Theophrastos, hist, plant V I 4, 9 beschrieben und ist die Mastixdistel, Carlina gummifera (Atractylis gummifera L., Compositae), von der Plinius, nat. hist. 20, 263 nochmals spricht und die er nat. hist. 2 1 , 96 als helxine bezeichnet. Außer der schon genannten Pistacia lentiscus L. gibt es noch die Terpentinpistazie, Pistacia terebinthus L., und die Echte Pistazie, Pistacia vera L. (Anacardiaceae). Welche dritte Sorte am Pontos, dem Schwarzen Meer, Plinius meint, die mehr dem Bitu-men ( = Erdpech) gleiche, läßt sich nicht mit Sicherheit ausmachen. Das Mastixharz beschreibt Dioskurides, mat. med. I 90 ; die Zusammensetzung (nach Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis I I S. 142): 1 - 3 %> ätherische öle, 4 2 % Harzsäuren, jo%> Resene, j°/o Bitterstoffe, Verunreinigungen.
73 ládanon (oder lédanon, lat. Iadanum oder ledanum von arab. ladan): als Stammpflanzen für dieses wohlriechende Harz gelten verschiedene Zistrosenarten, vor allem Cistus creticus L., Cistus cyprius Lmk. und Cistus ladanifer L. (Cistaceae). Zuerst erwähnt bei Herodot I I I 1 1 2 , 1 , der auch die Gewinnung aus den Barten der Xitgtnböcke ver-meldet ; vgl. auch Dioskurides, mat. med. I 128 und Pli-nius, nat. hist. 26, 47 f. Es fand einst als nervenstärkendes Mittel, zur Wundheilung, gegen Haarausfall usw. breite Anwendung. - Nabatäer, ein Volksstamm im nordwest-lichen Arabien mit der Hauptstadt Petra; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 65; 6, 144. 157.
74 storbon, ein nicht näher erklärbares Wort, das offenbar die gleiche Bedeutung wie ladanon hatte; vgl. § 79 stobrum. - Schweiß (oesypum): auch Dioskurides, mat. med. II 84 nennt das Wollfett Oisypos; vgl. auch Plinius, nat. hist. 29, 35-38. - Efeu, Hederá helix L. (Araliaceae).
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

222 Er läuterungen
7j lèda, lèdanoti s. § 73. Audi Dioskurides, mat. med. I 128 sdireibt von einer anderen »Art Kistos, von einigen Ledon genannt« (J. Berendes). Zum Ganzen s. R. Stadler, RE X I I Sp. 379 f. s. v. »Ladanum«. - Schnüre: Die Er-klärung gibt Dioskurides, 1. c.: »Einige ziehen audi Schnüre über die Zweige hin, schaben das daran klebende Fett ab und kneten es« (J. Berendes).
76 Karmanien s. § 56. - Ptolemäer s. § 56. - Myrte s. § 3. 77 ölbaum: die Pflanze läßt sich nicht mit Sicherheit be-
stimmen. Dioskurides, mat. med. I 141 spricht von einer Träne des äthiopischen ölbaums, der auch wilder ölbaum genannt wird. Das Harz »heilt eingestrichen vernarbende Wunden* (J. Berendes). Auch Theophrastos, hist, plant. IV 7, 2 erwähnt einen gerinnenden Saft, aus dem ein sehr gutes blutstillendes Mittel hergestellt wird; vgl. audi Strabo, Geogr. X V I 4, 777; Plinius, nat. hist. 13, 139 und 23, 72; Celsus V 19. - enaimon (lat. enhaemon), ergänze phármakon >Blutstiller, Blutpflaster<.
78 Ü bersättigung der M enseben : Dieser Gedanke findet sich oft im antiken Schrifttum, z. B. Lucretius, de rerum nat. I I I 957 oder Plinius minor, Epist. VIII 20, 1 : » . . . weil das Verlangen nach allem, was bequem zu erreichen ist, erkaltet« (H. Kasten). - Elymäer, Bewohner der Land-schaft Elymais zwischen Babylonien und der Persis; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 111. 134 ff. 212. - bratus (vgl. griedi. bráthy von hebr. beros - Zypresse) : wohl der Sadebaum, Iuniperus sabina L. (Cupressaceae), von dem es eine Varietät, Iuniperus cupressifolia (mit Blättern wie die Zypresse) gibt. Der Sadebaum, eigentlich ein Strauch, wird von Dioskurides, mat. med. I 104 kurz beschrieben. -Kaiser Claudius FGH 276 frg. 1 = HRR frg. 3. - Die Tatsache, daß der Sadebaum giftig ist, stimmt allerdings nicht damit überein, daß die Parther ( = Perser) seine Blätter in die Getränke streuen sollen. Das Sadebaumöl
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Erläuterungen
enthält u. a. Sabinen, ein trizyklisches Terpen, ferner Sabi-nol. Plinius, nat. hist. 24, 102 spricht von zwei Arten des Baumes und behandelt die Wirkung in der Heilkunde. -Pasitigris, ein Teil des Tigris; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 129. 134. 145. - Sostra, h. Sustar, persische Stadt am Westufer des Karun. Plinius, nat. hist. 6, 136 spricht von dieser Stadt >am Berge Chasirus<. Unter diesem Berg, der hier Scanchros genannt wird, ist ein in nordwestlicher Richtung streichender Bergzug im Osten der Stadt ge-meint.
79 Karmanen s. § j 6. γ6. - stobrum, ein nicht näher be-stimmbarer Baum; vgl. auch § 74 storbon.
80 Carra (Carrhae, griech. Karrhai, hebr. Haran), Stadt in Mesopotamien (vgl. Plinius, nat. hist. 5, 86), wurde durch die Niederlage des Crassus 53 V. Chr. allgemein bekannt. - Gabba: dieser in Palästina häufige Ortsname läßt sich nicht näher bestimmen. Plinius, nat. hist. 5, 74 nennt einen Bezirk Gabe in Syrien. - Charax, alte Stadt am Persischen Golf; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 99. 124f. 138 ff. Ihr Name lebt in dem modernen Flußnamen Kerhah weiter. - Iuba FGH 275 frg. 65. - Herodot III 97, j ; vgl. Münzer S. 18 f.
81 Storax (Styrax) s. § 124. - Sabäer s. § j2. Es ist kaum anzunehmen, daß die Sabäer den Storax in Bocksfellen herbeiholen, sondern »die Notiz deutet darauf hin, daß die Araber den Handel mit Storax nach dem fernen Osten vermittelten«; vgl. A. Steier, R E IVA Sp. 64-67 s. v. »Storax (Styrax)«. Zu den Sabäern vgl. auch Strabo, Geogr. X V I 4, 778; Agathardiides, Mar. Rubr. 99 und Diodor II 49, 3. - Zum Text s. die Bemerkungen von A. Ernout, Komm. § 81, 1. - Über die Wirkung des Storax auf Schlangen vgl. Herodot III 107, 2 und Plinius, nat. hist. 10, 195.
82 Zimt und Kassia s. § 85. - Zum >glücklichen< Arabien s. § j i ; vgl. auch Plinius, nat. hist. 6, 138. Das semit.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

224 E r l ä u t e r u n g e n
Wort arab, von dem sich der Name Arabien herleitet, bedeutet »Steppe, trockene wüste Gegend<.
8j Poppaea Sabina, geb. um 3 1 η . Chr., wurde von Kaiser Nero nach seiner Scheidung von Octavia geheiratet. Sie starb an einem Fußtritt, den ihr Nero versetzte; ihr Leich-nam wurde einbalsamiert und mit ungeheurem Prunk im Mausoleum des Augustus beigesetzt; vgl. Tacitus, Ann. X V I 6, 2. - gesalzenes Schrotmehl (mola salsa): geschro-tete Körner von Dinkel oder Spelt mit beigemischtem Salz, zum Bestreuen der Opfertiere verwendet; vgl. Pli-nius, nat. hist. 1 , 1 1 ; 18, 7.
84 Perlen; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 1 1 0 ; 9, 106. - Serer s. § 2. - 100 Millionen Sesterzen: rechnet man den Sesterz zu etwa 20 Pfennig alter Währung, so entspricht dieser Betrag etwa 20 Millionen Goldmark.
8? Zimt (cinnamomum, griedi. kinnámomon vgl. hebr. qinnamon), Cinnamomum zeylanicum Breyne (Ceylon-zimtbaum), und Kas(s)ia (casia, griech. kassia vgl. chin, kei-schi), Cinnamomum Cassia Bl. = Cinnamomum aro-maticum Nees (Zimtkassie), gehören zu den Lorbeer-gewächsen (Lauraceae). Der Ceylonzimtbaum liefert sehr feinen Zimt, die Zimtkassie den weniger wertvollen, bei uns vorwiegend verwendeten rotbraunen Zimt. Beide Sor-ten sind im Schrifttum oft verwechselt worden. Dioskuri-des behandelt mat. med. I 13 den Zimt, I 12 die Kassia; Theophrastos, hist, plant. I X 5, 1 - 3 . Wichtigster Bestand-teil des Zimts und der Kassia ist ein ätherisches ö l , das vor allem Zimtaldehyd enthält. Näheres s. J.Olck, R E I I I Sp. 1637- 1651 s. v. »Casia« Nr. 1 . - Die Wunderberichte des Altertums bei Herodot I I I i i o f . ; vgl. auch Aristote-les, hist. anim. I X 13, 6 16a 6 und Aelian, de nat. anim. X V I I 21 . Auch Plinius, nat. hist. 10, 97 berichtet über den sagenhaften Zimtvogel (cinnamolgus); vgl. Aelian, de nat. anim. I I 34. - Vater Liber = Dionysos - Bakchos. -
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n « S
Phönix (griech. Phoinix): Bezeichnung für einen von den Ägyptern zu Heliopolis verehrten Vogel. Nach griechi-scher Vorstellung verbrennt er sich selbst und ersteht wie-der neu, so daß er als Symbol der Auferstehung und des ewigen Lebens gilt. - Zum Ganzen vgl. J . Hubaux und M. Leroy.
86 cinnatnomum oder cinnamum (griedi. kinnámomon oder kinnamon) s. § j i . - Troglodyten s. § 5 1 ; vgl. Pli-nius, nat. hist. 6, 168. - Zum Duft Arabiens vgl. auch Herodot I I I 1 1 3 , 1 und Diodor I I I 46, 4.
87 Südostwind (eurus = volturnus), eigentlich Ost-Süd-Ostwind; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 1 19 . 124. 126; 6, 106.
88 Nordwest(wind, argestes = corus), eigentlich West-Nord-Westwind; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 1 19 . 124- 126 ; 6, 175; 18, 338. - Gebbaniten s. § 63. - O cilia ist wahr-scheinlich mit dem von Plinius, nat. hist. 6, 104 erwähnten Ort Ocelis, einem kleinen Hafen an der arabischen Küste der Meerenge Bab el-Mandeb, identisch. Von hier soll die Fahrt nach Indien am vorteilhaftesten sein. Vgl. audi Periplus maris Erythraei 25.
89 f. Die Beschreibung des Zimtstrauches durch Plinius stimmt in großen Zügen mit der Wirklichkeit überein, vgl. Theophrastos, hist, plant. I X j , 1 - 3 : Vom Strauch schneidet man 4-5 Schößlinge von etwa 3 m Länge, die 1 - 2 Jahre alt und ungefähr 1 -2 cm dick sind. Den fein-sten Zimt erhält man von den Spitzen (s. § 91) der in der Mitte des Strauches stehenden Schößlinge. Von der abgelösten Rinde entfernt man den bitter schmeckenden Außenteil und schält den größten Teil der Mittelrinde ab. 8- 10 Halbröhren steckt man ineinander, trocknet sie nach dem Zurechtschneiden im Schatten und bringt sie so in den Handel. Der eigentliche Zimt besteht fast nur aus der etwa 0,5 mm starken Innenrinde. Die Verwen-dung von Zimt geht bis in die früheste Zeit der Mensch-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

ii6 E r l ä u t e r u n g e n
heitsgeschichte zurück: in China soll der Zimt schon 2700 v. Chr. in einem Kräuterbuch erwähnt worden sein. - Dost (origanum), vgl. Plinius, nat. hist. 8, 98; 10, 195; 19, 186; 20, 175. Er gehört zu den Lippenblütlern (Labia-tae). — Der Zimtstraudi gedeiht am besten auf sandigem Tonboden und benötigt viel Sonne und Regen. - Assabi-nus: nur von Plinius überlieferter Name einer Gottheit, die mit Iupiter gleichgesetzt wurde; vgl. audi Sabis § 63. -Der Speer diente nicht nur als Waffe, sondern auch als Zeichen der obrigkeitlichen Gewalt bei Versteigerungen und beim Gericht.
91 Dost s. § 89. - Holzzimt (griech. xylokinnámomon) : Audi Dioskurides, mat. med. I 13 berichtet von einem pseudokinnámomon, das minderwertiger und das Holz des Zimts sein soll.
92 Dioskurides, mat. med. I 12 und 13 nennt fünf Arten Kassia und sieben Arten Zimt, welche nicht näher identi-fiziert werden können. Als beste Zimtsorte bezeichnet er den Mosylon, der eine Ähnlichkeit mit der Mosylites ge-nannten Kassia aufweist.
93 Gebbaniten s. § 63. - Südwind, (auster); vgl. Plinius, nat. hist. 2, 126.
94 Kaiser Vespasianus, geb. 9 n. Chr., regierte von 69-79 n. Chr.; Plinius stand ihm und seiner Familie persönlich nahe. - Der Tempel auf dem Kapitol, der der kapitolini-schen Trias Iupiter, Iuno und Minerva geweiht war, brannte in den Wirren des Jahres 69 n. Chr. ab und wurde in den ersten Regierungsjahren des Vespasianus wieder aufgebaut. - Der Tempel der Pax, der von Kaiser Vespa-sianus im Jahre 75 n. Chr. auf dem zur Feier seines Sieges über die Juden 71 begonnenen Forum Pacis errichtet wurde, zeichnete sich durch eine ungemein prächtige Aus-stattung aus. - Bei der Wurzel des Zimtbaumes von gro-ßem Gewicht handelt es sich nach J . Berendes um die
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n Z27
Rinde von Canella alba (Canellaceae). - Nadi dem Tode des Augustus wurde ihm vom Senat ein Tempel auf dem Palatin zuerkannt, dessen Bau die Witwe Livia Augusta Drusilla (j8 v. - 29 n. Chr.) zusammen mit ihrem Sohn Tiberius übernahm.
95 f. Kassia s. § 85. Die Angaben des Plinius finden sich in ähnlicher Form bei Theophrastos, hist, plant. I X 5, 3. Dioskurides hingegen weicht in einigen Punkten ab, wenn er mat. med. I 12 z. B. sagt, daß die Kassia einen Zweig mit dicker Rinde habe (Plinius: eine dünne Haut). Die Zimtkassia hat einen höheren Wuchs und besitzt hellgrüne, lanzettliche Blätter. Wenn sie zehn Jahre alt ist, werden die Zweige geschnitten, worauf man den Baum wieder mehrere Jahre in Ruhe läßt. Die abgeblühten Blumen-kronen, die die unreifen Früchte einschließen, werden als Zimtblüten (Flores Cassiae) bezeichnet. Nicht verwechselt werden darf die Zimtkassia mit der in der modernen Botanik ebenfalls als Cassia L. bezeichneten Gewürz-rinde, eine Gattung aus der Familie der Leguminosen. Über die Herkunft der verschiedenen Zimtsorten hatte man im Altertum sehr unklare Vorstellungen; vgl. die Wundergeschichten § 85. Plinius hat dort schon betont, daß diese Fabeln dazu beigetragen haben, die Preise un-gerechtfertigt in die Höhe zu treiben.
97 lada: nur von Plinius gebrauchtes Wort, wahrscheinlich semitischen Ursprungs. - balsamartig (balsamodes) : eben-falls nur von Plinius verwendetes Wort. Dioskurides, mat. med. I 12 nennt eine dunkle und purpurfarbene, dichte, Zigir genannte Art, »die einen Rosenduft hat und am besten zum medizinischen Gebrauch sich eignet« (J.Be-rendes). Welche Zimt- oder Kassia-Art gemeint ist, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen.
98 daphnidis mit dem Beinamen isokinnamon (griedh. = dem Zimt gleich): Dioskurides, mat. med. I 12 erwähnt
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

228 E r l ä u t e r u n g e n
eine Art der Kassia, die von Kaufleuten Alexandriens als Daphnitis bezeichnet wird; es handelt sich sicher um die gleiche Pflanze. In der Botanik gibt es mehrere Arten der zu den Thymelaeaceae gehörenden Daphne. Der Sei-delbast, Daphne mezereum L., eine giftige, sehr intensiv riechende Pflanze (Bienen!), enthält die Verbindungen Mezerein, Daphnin und Umbelliferon ; vgl. dazu auch Plinius, nat. hist. 16, 136 und Columella, de re rust. I II 8, 4. - Storax s. §§ 81 und 124. - kánkamon (cancamum, griedi. kánkamon von arab. kamkam): wohl die von Dioskurides, mat. med. I 23 erwähnte Träne eines arabi-schen Baumes, die als Räuchermittel verwendet wurde. Eine genaue Identifikation ist nicht möglich; man hat u. a. an den Balsambaum, Amyris balsamifera L. (Rutaceae), gedacht. - tarum (griech. taron?): wahrscheinlich das Aloe-holz, das Dioskurides, mat. med. I 21 Agallochon (von hebr. ahaloth) nennt. Es wurde als kostbares Räucher-mittel verwendet. - Nabatäer s. § 73. - Troglodyten s- § Si·
serichatum und gabalium sind nicht näher zu bestim-mende Gewürzpflanzen, deren Bezeichnungen auf heute nicht mehr faßbare orientalische Namen zurückgehen.
myrobálanon (myrobalanum, griech. myrobálanos -Salbeneichel), der Bennußbaum, Moringa peregrina (Forsk.) Fiori = Moringa arabica (Lam.) Pers. (Moringa-ceae), aus dessen Früchten von der Größe einer Haselnuß man das für Salben verwendete Behenöl gewinnt; zu dessen Verwendung s. Dioskurides, mat. med. I 40. Es enthält u. a. Glyzeride der Behensäure C 2 1 H 4 a COOH, ist nicht trocknend und wird nicht ranzig. Unter der Be-zeichnung bálanos ( = Eichel) wird der Baum von Theo-phrastos, hist, plant. IV 2, 6 genannt. Bei Dioskurides, mat. med. IV 157 (160) heißt die Frucht Salbeneichel (bálanos myrepsiké) und der Baum ist der Tamariske
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 229
ähnlich. Plinius erwähnt das myrobálanon nochmals nat. hist. 13, 18 und 23, 98; vgl. auch Martial X I V 57:
Quod nec Virgilius nec carmine dicit Homerus, hoc ex unguento constat et ex balano.
Weder Vergil nodi Homer erwähnt es in seinem Gedichte : Bennußöl und Parfüm sind es, woraus es besteht.
(R. Helm)
Nähere Einzelheiten bei A. Steier, R E X V I Sp. 1 i n -n i 5 s.v. »Myrobalanos«. Im Kräuterbuch von Lonicerus-Uffenbach (Ulm 1679) wird von fünf Arten des myro-balanum gesprochen, die in den Apotheken verwendet werden. - Troglodyteη s. § 51. - Thebais: der Teil von Oberägypten mit der Hauptstadt Theben (Thebai); vgl. Plinius, nat. hist. 5, 49. - Sonnenwende (heliotropium, griech. heliotrópion) aus der Familie der Rauhblattge-wächse; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 109; 22, j7 .
Thebais s. § 100. - Troglodyten s. § j 1 . Petra, Hauptstadt der § 98 genannten Nabatäer, h.
bekannt durch seine Felsengräber; vgl. Plinius, nat. hist, j , 87. 89; 6, 144 fr. 212. - Die Herkunft des myrobálanon aus Indien, der Heimat der Moringa-Arten, erwähnt kein antiker Schriftsteller; es werden nur Ägypten, Äthiopien, Arabien und Syrien genannt; wahrscheinlich sind es nur Sortenbezeichnungen, die den Handelsweg erkennen las-sen, über den das myrobálanon nach Italien kam; vgl. dazu A. Steier 1. c. Neben der Verwendung des Behenöls für Salben darf auch die in der Heilkunde, bei Haut-krankheiten, Milzerkrankungen usw. nicht vergessen werden.
>Durststillende< (griech. ádipsos): die Dattelpalme, Phoenix dactylifera L. (Palmae), vielleicht auch die in Ägypten heimische Dumpalme, Hyphaene thebaica (L.) Mart. Dioskurides, mat. med. I 148 schreibt über die Frucht: »sie ist von grüner Farbe, im Geschmack ähnlich
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

230 Erläuterungen
der Quitte. Wenn man sie aber ausreifen läßt, wird es die Datte l . . . Die Datteln . . . machen . . . trunken« (J. Beren-des); bei Plinius berauscht. Vgl. die ausführlichere Be-handlung der Dattelpalme 13, 26 ff.
104 Theophrastos, hist, plant. IX 7,1 f. - Das wohlriechende Rohr: gemeint ist der Halm einer Graminee, vielleicht der von Dioskurides, mat. med. I 17 erwähnte Kalmus (cala-mus), Acorus calamus L. - Die wohlriechende Binse: Theophrastos spricht 1. c. vom Schoinos, Dioskurides, mat. med. I 16 vom Bartgras, Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng., einer Pflanze mit angenehm würzigem Geruch, ebenfalls zu den Gramineae gehörend. - ifo Stadien = 27,75 km; jo Stadien = 5,55 km. - Libanon: bewaldetes Kalksteingebirge, zwischen der Küste des Mittelmeeres und dem syrischen Graben in nordsüdlicher Richtung ver-laufend. - Antilibanon: ebenfalls von Norden nach Süden verlaufendes Gebirge in Mittelsyrien, östlich vom Liba-non; Quellgebiet des Jordan; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 77. Zum Ganzen s. A. Blanchet.
10J Theophrastos, hist, plant. IX 7, 2; Dioskurides, mat. med. I 17. - Rettich: wahrscheinlich Raphanus sativus L. (Cruciferae).
106 Dioskurides, mat. med. I 17 schreibt: »den Halm an-gefüllt mit Spinnengewebe« (J. Berendes). Es handelt sich um ein parenchymatisches Gewebe mit großen Zwischen-räumen, die tatsächlich wie das Netz einer Spinne aus-sehen. - Weitere Erwähnungen bei Plinius, nat. hist. 25, 157 (Kalmus) und 21, 120 (wohlriechende Binse). - Kam-panien, das fruchtbare Gebiet um den Golf von Neapel.
107 Gummiharz (ammoniacum oder hammoniacum, griech. ammoniakón): Ammoniakharz wird aus der Ammoniak-oder Oschakpflanze, Dorema ammoniacum D. Don. (Um-belliferae) gewonnen. Es handelt sich um eine Dolden-pflanze aus Persien, deren Milchsaft aus der Wurzel, dem
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 231
Stengel und den Früchten freiwillig austritt und an der Luft erhärtet. Die Stammpflanze der Alten war die in Afrika vorkommende Ferula tingitana L. (Umbelliferae), deren Baum von Plinius >Stirn< (métopon) genannt wird. Die beiden Arten >Brudi< (thraustón) und >gemischt< (phy-rama) werden auch von Dioskurides, mat. med. I I I 88 erwähnt. Der Baum wächst in der Nähe der Oase des Iupiter Ammon im Norden der Libyschen Wüste. Das Gummiharz enthält vorwiegend Harz, Gummi und äthe-rische ö le und wurde vor allem für Pflaster verwendet. Dioskurides, mat. med. I 71 erwähnt einen Baum, »aus dem das Galbanum fließt«, der Metopion heißt, und zählt mehrere medizinische Anwendungen auf; vgl. Plinius, nat. hist. 24, 23; 29, 40; 32, 9 1 ; 34, 1 1 5 . In älteren Kräuter-büchern wird das Gummiharz auch oft als Armoniacum (vielleicht verstümmelt aus Armeniacum) bezeichnet. Zum Ganzen vgl. P. Wagler, R E I Sp. i860 f. s. v. »Ammonia-kon«.
Mit der als Ammoniak oder Salmiakgeist bezeichneten wäßrigen Lösung des Gases N H S hat das Ammoniakharz natürlich nichts zu tun. Ein unter dem Wüstensand gefun-denes, auch als Ammoniak bezeichnetes Salz (Salmiak = Ammoniumchlorid NH4C1) beschreibt Plinius, nat. hist. 3 1 , 7 8 .
sphágnos (Moos) und bryon (Moos) : Es handelt sich um eine wohlriechende Flechte, vielleicht um das in der Par-fümerie verwendete Eichenmoos, Evernia prunastri (Liche-nes) ; auch die in heißen Ländern vorkommende Alectoris Arabum könnte man in Betracht ziehen. Dioskurides, mat. med. I 20 nennt das Bryon auch Splachnon; vgl. auch § 1 3 2 und nat. hist. 13, 8; 16, 3 3 . - Über die medizinische Verwendung des sphagnos (oder sphacus) s. Plinius, nat. hist. 24, 27. - In der modernen Botanik unterscheidet man die Flechten (Lichenes) von den Moosen (Bryophyta). -
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

232 E r l ä u t e r u n g e n
Kyrenaika, röm. Provinz in Nordafrika mit der Haupt-stadt Kyrene.
109 Hennastrauch (cyprus, griech. kfpros nach der Insel Kypros = Zypern), Lawsonia inermis L. (Lythraceae), ein in Nordafrika und Asien vorkommender Baum,· aus dessen Blüten unter Verwendung von Kalk die echte Henna zum Färben der Nägel, Haare usw. hergestellt wird. Dioskurides beschreibt den Baum mat. med. I 124, die Bereitung der Hennasalbe I 6$ und nennt als Her-kunftsland ebenfalls Askalon, h. Askalon in Palästina, und Kanopos (Kanobos), eine unterägyptische Hafenstadt an der westlichen Nilmündung. - Jujube, Ziziphus jujuba Mill. (Rhamnaceae), ein kleiner aus China stammender Baum, der seit der Römerzeit auch in Südeuropa ange-pflanzt wird und dattelähnliche, süß schmeckende, kleine Früchte liefert. - Koriander, Coriandrum sativum L. (Umbelliferae), schon im Altertum angebaute Pflanze, deren charakteristisch schmeckenden Samen man audi nodi heute in Backwaren verwendet. - Die angebliche Identität des Hennastrauches mit dem Liguster (ligustrum), viel-leicht Ligustrum vulgare L. (Oleaceae), wird von Plinius, nat. hist. 24, 74 nochmals erwähnt; über die medizinische Anwendung berichtet er nat. hist. 23, 90.
110 aspálatbos (lat. aspalathus), eine nicht mit Sicherheit zu bestimmende Pflanze. Dioskurides, mat. med. I 19 spricht von ihr als einem holzigen Strauch mit vielen Dornen, ohne allerdings anzugeben, ob er für die Anwen-dung das Holz oder die Wurzel meint. Unwahrscheinlich ist die oft vertretene Identifikation mit dem Mannabaum, Alhagi maurorum Medik. (Leguminosae), wenn es sich dabei auch um einen dornigen Strauch handelt, der vor allem in Nordostafrika vorkommt. Auch die Übersetzung »Rosenholz« deutet nur auf eine wesentliche Eigenschaft der Pflanze (vielleicht handelt es sich um eine ebenfalls
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 233
zu den Leguminosen gehörende Spartium- oder Kytisos-art). Lonicerus-Uffenbach (Ulm 1679) nennen Aspalathus >Rhodisholz< nach der Insel Rhodos, sagen aber gleich-zeitig, daß man nicht das echte Holz, sondern nur ein fremdes, unbekanntes unter diesem Namen in den Apo-theken finde. - Vor allem hat man an gewisse Ginster-arten gedacht, Genista aspalathoides Lam. oder Genista hórrida (Vahl) D C ; dazu passen gut die Beinamen >Szep-terhalter< (griech. erysiskeptron) und >Szepter< (griech. sképtron); vielleicht kommt aber auch eine Windenart, z. B. Convolvulus scoparius L. in Betracht; vgl. P. Four-nier. Die ganze Frage muß offen bleiben; vgl. P. Wagler, R E I I Sp. i 7 i o f . s. v. »Aspalathos«. - Über die Wirkung des Regenbogens, vgl. audi Plinius, nat. hist. 2, 150 ff., auf den Wohlgeruch der Pflanzen spricht Plinius noch mehrmals: nat. hist. 1 1 , 37; 17, 39; 24, 1 1 3 . - Bibergeil, ein Sekret aus in der Bauchhöhle des Bibers neben den Geschlechtsteilen liegenden Drüsen; vgl. Plinius, nat. hist. 8, 109 und Dioskurides, mat. med. II 26. Die wachsartige Masse wandte man früher in der Heilkunde mehrfach an; zur Zusammensetzung s. Hagers Handbuch der Pharma-zeutischen Praxis I I I S. 76 j .
m máron, eine ebenfalls nicht mit Sicherheit zu bestim-mende Pflanze, vielleicht das Amberkraut, Teucrium marum L. (Labiatae). Dioskurides, mat. med. I I I 42 nennt als Heimat der Pflanze die Gegend in der Nähe der klein-asiatischen Städte Magnesia und Tralles. C. Fraas, Synop-sis plantarum florae classicae, München 1845, der durch Autopsie viele im antiken Schrifttum erwähnte Pflanzen untersucht hat, identifiziert mit einer Dostart, Origanum sipyleum L. - Balsambaum, Commiphora opobalsamum (L.) Engl. (Burseraceae). Nach Theophrastos, hist plant. I X 6, ι kommt der Baum in einem Talland Syriens vor, nadi Dioskurides, mat. med. I 18 wächst er nur in Indien
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

234 Erläuterungen
in einem bestimmten Tale und in Ägypten. Die tatsädiliche Heimat des Balsambaumes liegt im Südwesten Arabiens und im gegenüber liegenden Somaliland. Der Baum wurde früher audi als Balsamodendron Gileadense Kunth. und Amyris Gileadensis L. bzw. Amyris opobalsamum L. be-zeichnet. Es handelt sich um einen in Arabien, Syrien und Ägypten einheimischen, 5-6 m hohen Strauch. Den Bal-sam gewinnt man entweder durdi Auskochen der jüngeren Zweige mit Wasser oder durch Einschnitte und freiwilliges Ausfließenlassen. Es handelt sich dabei um eine viskose, stark und angenehm riechende Masse mit bitterem Ge-schmack, vorwiegend aus ätherischen ölen, Harzen und Bitterstoffen bestehend. Dem Balsam (lat. balsamum, griech. bálsamon von hebr. basám) schreibt man schon seit ältesten Zeiten im Orient große Wunderkräfte zu, vor allem zur Behandlung der Wunden. Zum Ganzen s. P. Wagler, RE II Sp. 2836-2839 s. v. »Balsambaum«. -zwei Gärten: in Jericho und Engaddi, beide in Iudaea. -zwanzig Jucharte = j ha (1 Juchart entspricht etwa 2500 m2). - Kaiser Vespasiantts, der von 69-79 n. Chr. regierte, kämpfte, wie auch sein Sohn Titus, gegen die Juden in Iudaea; Jerusalem wurde 70 n. Chr. zerstört, vgl. Tacitus, hist. V 1 1 - 1 3 , der Krieg endete 72 n. Chr. mit der Zerstörung der Festung Masada. Der Triumph in Rom wurde schon 71 n. Chr. gefeiert; vgl. auch § 94. -Pompeius d. Große (106-48 v. Chr.) beging seinen Triumph über Mithridates VI. Eupator von Pontos 61 ν. Chr.; vgl. § 20.
i n Die Beschreibung des Balsambaumes, die Plinius hier gibt, weicht von Theophrastos und Dioskurides ab. Tat-sache ist, daß zwischen dem Balsambaum und dem Myrr-henstrauch eine Verwandtschaft besteht. - tuber (>Knolle<) : wahrscheinlich eine Art der gewöhnlichen Jujube, Zizi-phus vulgaris. Plinius erwähnt den Baum noch mehrmals;
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n
vgl. nat. hist. 15, 47; 16, 103; 17, 7 j . Vielleicht ist aber auch nur eine Sorte des Pfirsich- oder Apfelbaumes ge-meint.
113 Diese Bemerkung bezieht sich auf den Jüdischen Krieg; vgl. § i n . — zwei Ellen = 88 cm.
114 euthériston = leicht beschneidbar; trachy = rauh; eúmekes = schlank. Nach Dioskurides, mat. med. I 18 unterscheiden sich die Bäume »von einander durch Rau-heit, Größe und Schlankheit« (J. Berendes).
115 Myrte s. § 3. - Eisen: Daß man keine Werkzeuge aus Eisen verwenden darf, um beim Balsambaum Einschnitte zu machen, erwähnt auch Tacitus, Hist. V 6, ι ; vgl. auch Flavius Iosephus, Ant. lud. X I V 54. Dagegen heißt es bei Dioskurides, 1. c. ausdrücklich, daß man den Balsamsaft (opobalsamon s. § 1 16) gewinnt, »indem der Baum mit eisernen Werkzeugen angeschnitten wird« (J. Berendes). Das Verbot des Einschneidens mit einem Metallwerkzeug beruht zweifellos auf alten, abergläubischen Vorstellungen.
116 opobalsamon (lat.opobalsamum, griech. opobálsamon ->Balsamsafl<); vgl. Theophrastos, hist, plant. IV 4, 14 und I X 6, 2, sowie Dioskurides, mat. med. I 18 und Strabo, Geogr. X V I 2, 763. Zum Ganzen s. A. Steier, R E X V I I I Sp. 691-696 s. v. »Opobalsamon«. Lonicerus-Uffenbach (Ulm 1679) schreiben über das Opobalsamum: »Das Holz am Stamme, wann es mit einem Eisen berührt wird, ver-dirbt es alsbald. Darum pflegt man die Rinde mit einem Glas oder beinen Messerlin zu öffnen, aus welcher ein edler wohlriechender Saft heraus tropft und Opobalsa-mum, das ist Balsamsaft, genennet wird«.
1 17 Congius: römisches Hohlmaß von 3,28 1. Der gesamte Ertrag (sechs und einen Congius) betrug demnach etwa 231.
118 Holzbalsam (lat. xylobalsamum, griech. xylobálsamon - >Holzbalsam<) : aus den abgeschnittenen Zweigen ge-wonnener Balsam von geringerer Güte. Nach Theophra-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

i}6 E r l ä u t e r u n g e n
stos, hist, plant. I X 6, 3 sind die rutenförmigen Zweige sehr wohlriechend. Der sog. echte Balsam findet bei uns praktisch keine Verwendung mehr. An seine Stelle ist heute der Perubalsam aus Myroxylon balsamum L. (Legu-minosae) getreten. - Eroberung Iudaeas s. § i n . -800000 Sesterzen = etwa 160000 Goldmark.
119 hypéreikon (lat. hypericum), das Johanniskraut, Hype-ricum perforatum L. (Guttiferae), das auch offizinell ver-wendet wird. Dioskurides, mat. med. I 18 erwähnt eben-falls diese Verfälschung und behandelt die Pflanze etwas ausführlicher I I I 161 ( 17 1 ) ; s. auch Plinius, nat. hist. 26, 8$ ff. - Petra s. § 102.
121 Hennastrauch s. § 109. - Mastix s. § 7 1 . - Bennußbaum s. § 100. - Terpentinbaum s. § 25. - Myrte s. § 3. -Galbanum s. §§ 107 und 126. - zyprisches Wachs: wahr-scheinlich ist nicht das Wachs von der Insel Zypern (lat. Cyprus, griedi. Kypros) gemeint, sondern das des Zyper-grases (lat. cyperus, griech. kyperos oder kypeiros); vgl. § 42. Dioskurides, mat. med. I 18 erwähnt ebenfalls eine Reihe von Verfälschungsmitteln, darunter audi das Zyper-grasöl. - im Wasser untersinkt: vgl. Dioskurides, 1. c. Das spezifische Gewicht der meisten Balsame liegt zwischen 0,9 und 1 , 1 ; ζ. B. Kopaivabalsam 0,92; Perubalsam 1 , 15 , so daß die von Plinius angegebene Prüfung der Echtheit zu-treffen dürfte.
122 Gummi s. § 107. - Wachs und Harz verbrennen be-kanntlich mit stark rußender Flamme. - Honig zieht wegen seines Geruches und Gehaltes an Zucker die Flie-gen an.
123 Vgl. Dioskurides, mat. med. I 18. - metópion ( = máto-pon) s. § 107: Dioskurides, mat. med. I 71 bezeichnet so ein in Ägypten hergestelltes Salböl. - weißer Ring: diese Erscheinung läßt auf die Bildung einer Emulsion schlie-ßen. - Milch zum Gerinnen bringt: die Balsame haben
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 137
infolge ihres Gehaltes an Harz und Bitterstoffen eine Säurezahl von etwa 50-80, was dazu ausreicht, die Milch zum Gerinnen zu bringen. - Sextarius, röm. Hohlmaß, etwa 0,546 1. - joo Denare = etwa 240 Goldmark; 1000 Denare = etwa 800 Goldmark. - Holzbalsam s. § 1 18 .
124 Gabala, Stadt im nördlichen Syrien, h. Djebeleh ; vgl. Pli-nius, nat. hist. 5,79. - Marathos, einst bedeutende Stadt im nördlichen Phönikien; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 78. - Berg Kasion bei Seleukaia am Orontes in Nordsyrien, uralte Kultstätte des Zeus Kasios, h. Dschebel el-Akra (1700 m); vgl. Plinius, nat. hist. 5, 80. - Storax (Styrax) s. § 81. Bei dem auch von Dioskurides, mat. med. I 79 beschriebenen Gewächs handelt es sich um Styrax officinalis L. (Styraceae), einen strauchartigen Baum mit jährlich abfallenden Blättern und weißen Blüten (daher wohl der Vergleich bei Plinius und Dioskurides mit der Quitte). Das daraus gewonnene Harz (lat. storax oder styrax, griech. styrax als semit. Lehnwort) wurde im Altertum als Räuchermittel viel ver-wendet; vgl. ζ. B. Herodot III 107; es ist aber heute be-deutungslos geworden. Der jetzt noch in der Pharma-kopoe anzutreffende echte, flüssige Storax (Storax liqui-dus) stammt von einer anderen Pflanze, Liquidambar orientalis L. (Hamamelidaceae). - Ähnlichkeit mit einem Rohr: Plinius denkt hier wohl an Styrax calamitus. Das aus Styrax officinalis L. gewonnene Harz wurde in Schilf-und Palmblätter eingewickelt und in dieser Form gehan-delt. - Über die Verunreinigung mit Holzmehl gibt Strabo, Geogr. X I I 7, 5 70 f. eine ausführlichere Beschrei-bung, wonach ein Holzwurm aus dem Baum eine der Kleie oder den Sägespänen ähnliches Mehl auswirft, das sich an der Wurzel ansammelt und mit dem ausfließenden Harz vermengt. - Aufgang des Hundssternes (Sirius) s. § $8. - Aus Storax läßt sich ein ungesättigter, aromati-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

í38 Erläuterungen
sdier Kohlenwasserstoff, das Styrol C e H 5 - C H = C H 2 , isolieren, das heute auf synthetischem Wege zur Herstel-lung des wichtigen Kunststoffes Polystyrol in riesigen Mengen erzeugt wird.
125 Pisidien, Landschaft in Kleinasien; vgl. Plinius, nat. hist, j , 94; 6, 214. - Sidon, wichtige Seestadt in Phönikien; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 76ff.; 6, 213. - Zypern, die be-kannte Insel im östlichen Mittelmeer; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 92. 129f. ; 6, 213 f. - Kilikien, Küstenlandschaft im Südosten Kleinasiens; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 91 f. -Kreta, die bekannte Insel im Mittelmeer; vgl. Plinius, nat. hist. 4, 5 8 ff. - Amanos, ein Ausläufer des Taurus an der Grenze zwischen Syrien und Kilikien; vgl. Plinius, nat. hist, j , 80; 6, 214. - mit einer grauen Schicht über-zogen: ob es sich hier um den § 124 erwähnten Styrax calamitus handelt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Un-wahrscheinlich ist aber die Vermutung von J . Berendes, daß es der mit Sägemehl vermischte Styrax liquidus sein könnte. Es fehlt jede Nachricht, daß letzterer den Alten bekannt war; zum Ganzen vgl. A. Steier, RE IVA Sp. 64-67 s. v. »Storax«. - Pamphylien, Landschaft in Kleinasien zwischen Kilikien und Lykien; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 94. - Die medizinische Verwendung von Storax behandelt Plinius, nat. hist. 24, 24; 26, 48.
126 Galhanum: Gummiharz aus Ferula gummosa Boiss. = Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse (Umbelliferae). Das Harz wird bereits im Alten Testament (Exod. 30, 34 und Jes. Sir. 24, 21) erwähnt, spielt aber heute keine Rolle mehr. Nach Theophrastos, hist, plant. IX 7, 2 kommt die Chalbane (vgl. hebr. halban) = Galbanum von einem Gewächs in Syrien, Panakes genannt (s. unten § 127). Nach Dioskurides, mat. med. III 87 wurde die Pflanze auch Metopion genannt; s. § 107. Was man in der Antike unter Galbanum verstand, läßt sidi kaum mehr mit Sicher-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Erläuterungen
heit feststellen, da wahrscheinlich verschiedene Drogen unter diesem Namen liefen; vgl. R. Stadler, RE VII Sp. 2863-2865 s. v. »Galbanum«. Das aus Ferula gal-baniflua gewonnene Galbanum besteht nadi neueren Un-tersuchungen aus etwa 66% Harz, 19%) Gummi, 6 % ätherischen ölen und anorganischen Stoffen. - Berg Ama-nos s. § 125. - >Tropfharz< (griech. stagonitis, vgl. stago-nias § 62). - hammoniakón s. § 107. - sacopenium: viel-leicht eine andere Steckenkraut-(Ferula-)Art, z. B. der Riesenfenchel, Ferula communis L. Wahrscheinlich iden-tisch mit dem von Dioskurides, mat. med. III 85 beschrie-benen Sagapenon, dem Saft einer steckenkrautähnlichen Pflanze (Ferula persica L.?); vgl. Plinius, nat. hist. 20, 197; 19» 40· 167.
Zur Verwendung des Galbanum in der Medizin s. Pli-nius, nat. hist. 24, 21 ff. - Heilwurz (lat. panax oder panaces, griedi. pánax oder pánakes): von diesem »All-heilmittel« gibt es mehrere Arten, die von Theophrastos, hist, plant. IX 1 1 , 1 und Dioskurides, mat. med. III 48-jo beschrieben werden; s. auch Theophrastos, hist, plant. IX 7, 3 und 9, 2. Freilich stimmen nicht alle Angaben miteinander überein; s. auch Plinius, nat. hist. 25, 30-33. Das Asklepische Panakes (Dioskurides, mat. med. III 49) gehört zu den Umbelliferen, das herakleische Panakes (Ebd. III 48) ebenfalls, sowie auch das Cheironische Pana-kes (Ebd. III 50). Die zuletzt genannte Pflanze, die Gummiwurz, Opopanax chironium (L.) W. D. J . Koch (Umbelliferae), kommt vor allem im westlichen Mittel-meergebiet vor. Der eingetrocknete Milchsaft aus der Wurzel (»Opopanax«) hat einen pilzartigen Geruch und wurde früher in der Arzneikunde verwendet; vgl. Plinius, nat. hist. 20, 264; wahrscheinlich meint er diese Pflanze, obwohl mit diesem Namen auch andere Pflanzen bezeich-net wurden; vgl. H. Gossen, RE XVI I I Sp. 446-449 s. v.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

240 E r l ä u t e r u n g e n
»Panakes«. Namengebend war Panakeia, die »All-heilende«, die Tochter des Asklepios - Aesculapius. Die späteren Alchemisten nannten einige Universalmittel eben-falls Panacea, so z. B. Panacea mercurialis = Queck-silber(I)dilorid oder Kalomel, ferner Panacea salutifera = den legendären »Stein der Weisen«. Heute versteht man unter Panax meist den Ginseng, Panax ginseng C. A. Mey (Araliaceae), dessen Wurzel aus Ostasien ein-geführt wird. - Psophis, Stadt im nordwestlichen Arka-dien, h. Tripotamo; vgl. Plinius, nat. hist. 4, 20. - Ery-manthos, Fluß in Arkadien, Nebenfluß des Alpheios, h. Doana; vgl. Plinius, nat. hist. 4, 21 .
128 Steckenkraut, genannt spondylion (vgl. griech. spóndy-los - Wirbel), bei Dioskurides, mat. med. I I I 80 auch sphondylion. Wahrscheinlich der Bärenklau, Heracleum sphondylion L. (Umbelliferae), eine im Norden Italiens häufig vorkommende Pflanze; vgl. Plinius, nat. hist. 24, 25. - Sesel (sil oder seselis): Dioskurides, mat. med. I I I 56 beschreibt das Trodylion und sagt, daß es auch kretisches Seseli genannt wird; Plinius nennt nat. hist. 20, 238 den Samen des Sesels tordylon. Der Sesel, Seseli L., oder Berg-fenchel, von dem Dioskurides 1. c. 53-56 vier Arten unter-scheidet, gehört ebenfalls zu den Umbelliferen.
129 malóbathron (lat. malobathrum, griech. malóbathron von sanskr. tamalapattram - >Blatt des Tamalabaumes<, wobei die Silbe ta irrtümlich für einen griech. Artikel ge-halten wurde): Plinius und Dioskurides, mat. med. I 1 1 geben widersprechende Beschreibungen und es darf mit Sicherheit angenommen werden, daß sie die Pflanze selbst nicht gekannt haben. Im Periplus maris Erythraei 6 5 wird die etwas fabulose Herkunft der Pflanze aus dem fernen Osten erwähnt, ohne daß daraus nähere Angaben gezogen werden könnten. Lange glaubte man, daß es sich um den Kassia-Lorbeer, Laurus cassia L. handelte; auch die Zimt-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 241
kassie, Cinnamomum cassia Bl. = Cinnamomum aroma-ticum Nees (Lauraceae) wurde in Betracht gezogen; vgl. zum Ganzen A. Steier, R E X I V Sp. 818-823 s. v. »Mala-bathron« und B. Laufer, der zu dem Schluß kommt, daß es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die Patschuli-pflanze, Pogostemon patchouli Pellet. = Pogostemon cablin (Blanco) Benth. (Labiatae) handelt, aus deren Blät-tern man das wertvolle Patschuliparfüm gewinnt. Die getrockneten Blätter enthalten etwa 4-5 % eines stark riechenden ätherischen Öls (Sesquiterpene). - Linse, Ervus lens L. = Lens culinaris Medik. (Leguminosae). Hier ist aber wohl die Wasserlinse, Lemna minor L. (Lemnaceae), die in Sümpfen gedeiht, gemeint. - Safran (crocus), Cro-cus sativus L. (Iridaceae). - Narde: auch Dioskurides, mat. med. I 1 1 berichtet, daß das Malobathron wegen seines Geruches fälschlicherweise das Blatt der indischen Narde sei. - Zur medizinischen Verwendung s. Plinius, nat. hist. 23, 93.
omphákion (omphacium von griech. ómphax - unreife Weintraube, Herling) wird aus unreifen Oliven (Diosku-rides, mat. med. I 29) oder unreifen Trauben (Ebd. V 6) gewonnen. Über die Herstellung des Öles aus der Olive, Olea europaea L. (Oleaceae) spricht Plinius, nat. hist. 15, 2 und 7 ff. ausführlich; die medizinische Verwendung be-handelt er nat. hist. 23, 7 und 79. - druppa (griech. dryppa als Kurzform zu drypepés - am Baume gereift oder drypetés - vom Baume fallend) : eine halbreife Olive, von der Plinius, nat. hist. 1$ , 6 sagt: optima autem aetas ad decerpendum . . . incipiente baca nigrescere, cum vo-cant druppas, Graeci vero drypetidas (Zur Ernte ist die beste Zeit, . . . sobald die Olive schwarz zu werden be-ginnt, in welchem Zustand wir sie druppa, die Griechen aber drypetes nennen). - Aus dem psithischen Weinstock, den Plinius, nat. hist. 14, 81 und 24 mit dem in Etrurien
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

242 E r l ä u t e r u n g e n
gezogenen apiana gleichsetzt, gewinnt man in Griechen-land einen sehr starken Wein (Rosinenwein); der ami-näische Weinstock hat seinen Namen von Aminaea, einer Landschaft in Picenum (Mittelitalien); vgl. Dioskurides, mat. med. V 6.
131 Auf gang des Hundssternes s. § $8. - Kichererbse, Cicer arietinum L. (Leguminosae). - Plinius gibt hier eine etwas unklare Beschreibung der Gewinnung von omphákion, s. § 130. Deutlicher ist Dioskurides, mat. med. V 6: »Man muß den Saft aber vor dem Hundsstern auspressen [d. h. Ende Juli] und in einem roten erzenen Kessel mit Leinen bedeckt in die Sonne stellen, bis er dick wird, indem man all das Festgewordene stets mit dem Flüssigen wieder mischt, ihn aber bei Nacht aus dem Freien wegnehmen, denn die Feuchtigkeit verhindert das Consistentwerden« (J. Berendes).
132 bryon (Moos) s. § 108. Dioskurides, mat. med. I 20 berichtet, daß es sich auf Zeder-, Pappel- und Eichbäumen findet. Gemeint ist hier eine nicht näher bestimmbare wohlriechende Flechte; zur Unterscheidung von Moosen und Flechten s. § 108. Plinius nennt nat. hist. 13, 137 eine Strauchart ebenfalls bryon, woraus hervorgeht, daß mit dem Wort mehrere Pflanzen bezeichnet wurden; s. auch Plinius, nat. hist. 24, 27. - Knidos, Hafenstadt in Karten an der Südwestspitze Kleinasiens am Vorgebirge Trio-pion; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 245; 6, 214. - oinánthe (oenanthe, von griech. oinos - Wein und ánthos - Blüte = eigentl. >Weinblüte<): Nach Dioskurides, mat. med. V j heißt Oinanthe »die Frucht des wilden Weinstocks, wenn sie blüht« (J. Berendes), Plinius nennt sie die Traube des wilden Weinstocks; s. auch nat. hist. 23, 8. Als Oinanthe bezeichnet Dioskurides, mat. med. I I I 125 nodi eine an-dere Pflanze, die vielleicht mit dem Mädesüß, Filipendula vulgaris Moench = Spiraea filipendula L. (Rosaceae)
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 243
identisch ist. Im Kräuterbuch von Lonicerus-Uffenbadi (Ulm 1679) heißt Oenanthe-Filipendula Rotsteinbrech oder Erdeichel.
133 Parapotamien, Landschaft am Tigris mit der Haupt-stadt Dabitha, h. Degel; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 1 3 1 . -Antiocbeia, die Hauptstadt Syriens am Orontes, vgl. Pli-nius, nat. hist. 5, 66 und 79. - Laodikeia, hier wohl die Stadt in der Seleukis (Syrien); vgl. Plinius, nat.hist. $, 79; 6, 213 . - medische Berge: Gebiet im nordwestlichen Iran; vgl. Plinius, nat. hist, 2, 237; 6, 28. 1 14 . 214. - massaris (afrikanisches Wort?): von Plinius nochmals nat. hist. 23, 2 und 9 erwähnt. Es handelt sich ebenfalls um die Traube eines wilden Weinstocks, die als Parfüm und Arzneimittel Verwendung fand.
134 Dioskurides, mat. med. I 150 sagt: »Die Palme, welche einige Elate oder Spatha nennen, ist die Hülle der Frucht der noch blühenden Palme. Die Salbenbereiter gebraudien sie zum Verdichten der Salben« (J . Berendes). Der Berei-tung des Elateöls widmet Dioskurides, mat. med. I 54 ein besonderes Kapitel. Unter eláte versteht er zwar die Tanne, Abies alba Mill. (Pinaceae), während Plinius, nat. hist. 23, 99 sagt: palma elate sive spathe medicinae con-ferì germina, folia, corticem (Die Palme elate oder spathe liefert für Heilmittel Sprossen, Blätter und Rinde) ; spathe (spatha oder spathe vgl. griech. spáthe - Schwert). Es ist nicht möglich, aus diesen Angaben den Baum näher zu bestimmen. - Oase des Ammon s. § 107.
13 j Komakon (lat. comacum, griech. kómakon, Ursprung unbekannt): Unter den aus Arabien eingeführten Wohl-gerüchen nennt Theophrastos, hist, plant. I X 7, 2 Zimt, Kassia und Komakon, ohne allerdings eine genauere Be-schreibung der Pflanze zu geben; Dioskurides nennt sie überhaupt nicht. Ein anderes Komakon »ist eine Frucht, und wird den köstlichsten Salben beigemischt« (K. Spren-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

244 E r l ä u t e r u n g e n
gel). Vielleicht handelt es sich um den Muskatnußbaum, Myristica fragrans Houtt. (Myristicaceae) oder den Göt-terbaum, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Simarouba-ceae). Die Frage muß leider audi hier offen bleiben.
E R L Ä U T E R U N G E N
zu Buch X I I I
Salben: Das lateinische Wort unguentum bezeichnet einerseits die wohlriechende Salbe, andererseits aber auch das Salböl einschließlich der Fette, Essenzen usw. Sehr oft versteht Plinius unter unguenta das, was wir heute unter dem Sammelbegriff Parfüme zusammenfassen.
Wer sie zuerst erdacht hat: Als wahrscheinliche Erfinder der Salben gelten die Ägypter; von dort kommen die Sal-ben nach Babylon, vgl. Herodot I 195,1 , und in den ge-samten Mittelmeerraum. Die häufige Erwähnung der Sal-be bzw. des Salböls in der Bibel, z. B. 2. Mose 30,25 ; Ho-helied I 1,3. 4,10; Jes. 45, 1 ; Luc. V I I 37; Matth. X X V I 7, vgl. Messias (hebr. masiach = griech. christós) = der Ge-salbte, läßt ebenfalls auf eine alte Verwendung schließen. Bei den alten Völkern spielten Salben, Fette usw. für die Körperpflege eine wichtige Rolle; vgl. Homer, II. X I V 170; Od. I I I 466; IV 49. 252; V I 96. 220; V I I I 364f. 454; X 364. 450; X V I I 88; X I X 320. 505; X X I I I 154; X X I V 366; demnach waren sie wohl auch schon zur Zeit Trojas, um 1300 v. Chr., bekannt. - Weihrauch, vgl. oben 12, 51 bis 65. Audi die Verwendung des Weihrauchs geht bis auf die ältesten Zeiten zurück; Phöniker und Ägypter be-zogen ihn als große Kostbarkeit aus Arabien. Im jüdischen Gottesdienst wurde er bei der Zurichtung der Schaubrote
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n M J
und beim Speisopfer verwendet (3. Mose 24,7). - Zeder (cedrus) s. § 5 2 f., dort audi zur Vieldeutigkeit des Begrif-fes. - Zitrusbaum (citrus) s. § 91 ff . - Dunst (nidor): ge-meint ist der Fettdampf oder der brenzlige Fettgerudi. -Saft der Rose: Plinius meint wohl das Rosenöl und nicht das Rosenwasser. Homer, II. X X I I I 186f . erzählt, daß Aphrodite Hektors Leichnam mit ambrosischem Rosenöl gesalbt habe. Heute wird Rosenöl durch Destillation von Rosenblüten mit Wasser gewonnen, wobei man als Neben-produkt Rosenwasser erhält. In der Antike war jedoch Rosenöl ein mit Rosenessenz parfümiertes Olivenöl, über dessen Herstellung Dioskurides, mat. med. I 53 genaue Angaben macht; s. auch § 5.
Die Perser sind nicht die Erfinder der Salben (s. § 2), sondern sie haben diese bei der Eroberung Babylons ken-nengelernt und ihre Verwendung auf raffinierte Weise ausgebildet. - Salbenschrank: Diese Episode wird von Pli-nius bereits nat. hist. 7, 108 erwähnt; vgl. audi Plutarch, Alex. 26. Alexander d. Große hatte die persische Armee unter Dareios I I I . 333 v. Chr. bei Issos geschlagen; vgl. Münzer S. 143. - den Toten ... Ehre zu erweisen: schon Homer, II. X V I I I 350 erzählt, daß die Leiche des Patrok-los mit ö l gesalbt wurde (vgl. auch II. X X I V 582). Im römischen Schrifttum finden sich zahlreiche Hinweise über das Salben der Toten, z. B. Plinius minor, Epist. V 16, 7. Die leeren Salbenfläschchen wurden bei der Bestattung beigegeben.
Délos, kleine Insel der Kykladen, wo der Sage nach Apollo geboren wurde; vgl. Plinius, nat. hist. 4,66. -Mendes, Stadt im nordöstlichen Nildelta, h. et-Tmei und Teil el-Rub'; vgl. Plinius, nat. hist. 5,49. 64. Das dort her-gestellte Salböl, von Dioskurides, mat. med. I 72 Mende-sion genannt, wird von Plinius in den §§ 5,8 und 17 noch-mals erwähnt.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

246 Erläuterungen
Irissalbe (irinum): aus Iris germanica L. oder Iris flo-rentina L., audi Iris pallida Lam. (Iridaceae) kommt in Betracht. Die Wurzel von Iris florentina L. enthält das veilchenähnlich riechende Iron, ein Gemisch von Ketonen der Cyclohexanreihe; aus ihr wurden Salben und Arz-neien bereitet; vgl. Dioskurides, mat. med. I 66 und Pli-nius, nat. hist. 21, 39-42 und 22, 69. - Korinth, die durch Handel und Handwerk berühmte griechische Stadt; vgl. Plinius, nat. hist. 4,11 . - Kyzikos, Stadt an der Propontis = Marmarameer, h. Balkiz; vgl. Plinius, nat. hist. 5,142; 6,216; s. audi § 14. - Rosensalbe(rhodinum): vielleicht aus Rosa centifolia L. oder einer anderen Rosensorte (Rosaceae). Das Rosenöl enthält u. a. Rhodinol und Citronellol, bei-des ungesättigte Alkohole; der Hauptbestandteil ist je-doch das Geraniol, ebenfalls ein ungesättigter Alkohol mit zwei Doppelbindungen. Zur Herstellung des Rosenöls s. Dioskurides, mat. med. I 53. - Phaseiis, Stadt in Lykien, h. Tekir Ova; vgl. Plinius, nat. hist. 2,236; 5,96; berühmt durch ihre Blumenzucht und die Herstellung wohlriechen-der Salben; vgl. Plinius, nat. hist. 21,24. - Neapel und Capua, Städte in Kampanien; Praeneste, h. Palestrina, Stadt in Latium, berühmt durch die Schönheit ihrer Ro-sen; vgl. Plinius, nat. hist. 2 1 , 16 . 20. - Safranbalsam (cro-cinum): aus Crocus sativus L. (Iridaceae). Der färbende Bestandteil im Safran ist das Crocin, ein Di-gentiobiose-ester mit Crocetin, einer ungesättigten Dicarbonsäure, C 18H22(COOH)2. Das Safranöl enthält Pinen, Safranal und Cineol; der Bitterstoff des Safrans heißt Picrocrocin. Zur Herstellung vgl. Dioskurides, mat. med. I 64. - Soloi in Kilikien, Küstenstadt im südlidien Kleinasien, h. Me-zethi; vgl. Plinius, nat. hist. 5,92; 6,214. - Rhodos, die be-kannte Mittelmeerinsel an der Südwestspitze Kleinasiens. - Traubenbalsam (oenanthinum) : aus der oinanthe (oenan-the), der Frucht des wilden Weinstocks, s. auch Plinius,
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 247
nat. hist. 23,8 und oben 12, 132, sowie Theophrastos, de odor. 27; zur Erzeugung des Traubenbalsams s. Dioskuri-des, mat. med. I 56. - Adramytteion, Stadt in der Aeolis (Mysien) im nordwestlichen Kleinasien, h. Kemer; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 122. - Majoransalbe (amaracinum) : aus Origanum majorana L. = Majorana hortensis Moench (Labiatae), audi sampsuchinum (s. § 10) genannt; vgl. audi oben §§ 13. 14. 18, sowie Plinius, nat. hist. 21,37. 61. 163. Im Majoran sind ätherische öle , Gerb- und Bitter-stoffe, Pentosane usw., enthalten. Die ätherischen ö le be-stehen vorwiegend aus a-Terpinen, Sabinen und 1.8-Ci-neol (Eucalyptol). Die Zusammensetzung schwankt je nach dem Herkunftsland der Pflanze; zur Herstellung s. Dios-kurides, mat. med. I 5 8.-/Cos, zu den Sporaden gehörende Insel im Ägäisdien Meer; vgl. Plinius, nat. hist. 2,245; 4, 7 1 ; 5, 134; 6, 214. - Quittensalbe (melinum): aus Cy-donia oblonga Mill. = Cydonia vulgaris Delarbre (Ro-saceae), s. § 1 1 . — Hennabalsam (cyprinum): aus Lawsonia inermis L., dem Hennastrauch (cypros), s. audi oben 12, 109. Die Pflanze bringt Plinius hier mit der Insel Zypern in Verbindung; vgl. Theophrastos, de odor. 25 f. - Men-des s. § 4 und unten §§ 8. 17. - metópion s. oben 12, 107 und 123. - Eine dieser Aufzählung entsprechende Stelle findet sidi bei Athenaios, Deipnosoph. X V p. 688 EF; s. S. 180.
Phönikien, ein schmaler Landstrich Syriens am Mittel-meer. - Hennasalbe s. § 5. - Die panatbenäische Salbe wird audi bei Athenaios, Deipnosoph. X V p. 688 F er-wähnt, den Sokratessdiiiler Aischines als Erzeuger einer Salbe in Athen nennt Athenaios X I I I p. 6 1 1 F. Die Panathenaia, das »Gesamtfest der Athene«, wurden in Athen alle vier Jahre an vier Tagen im August als Volks-fest gefeiert. Auf dem Parthenonfries sehen wir die ver-schiedenen zur Ehre der Stadtgöttin veranstalteten Wett-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

248 E r l ä u t e r u n g e n
kämpfe und Opferhandlungen, vor allem aber, wie die Bevölkerung der ganzen Stadt auf die Akropolis zieht, um dem Priester der Göttin einen neuen prächtigen Man-tel (péplos) zu überreichen. - Tarsos, Hauptstadt von Kilikien, h. Tarsus Cayi; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 91 ; 6, 214. - pardalium: unbekannter Riedistoff. Wahrscheinlich besteht ein Zusammenhang des Wortes mit pardalis, dem weiblichen Panther; vgl. Plinius, nat. hist. 8, 62, sowie 2 i , 39 und 37, 190. - Narzissenbalsam (narcissinum): vielleicht aus Narcissus poeticus L. (Amaryllidaceae) ; vgl. Theophrastos, hist, plant. VI 8, 1; Dioskurides, mat. med. I 63 und I V 158 (161), sowie Plinius, nat. hist. 21, 128f . und 23, 94. Das Narzissenöl enthält u. a. Benzyl- und Zimtalkohol, Benzaldehyd, Eugenol, Benzoesäure und Benzoesäureester. In der Zwiebel der Pflanze ist die Pisci-dinsäure C u H 1 2 0 7 enthalten.
7 Das ätherische öl und die Fettsubstanz; zur Begriffsbe-stimmung: ätherische ö l e sind leichtflüchtige Bestandteile von verschiedenen Pflanzenteilen, wie Früchten, Blüten und Blättern. Meist handelt es sich um komplizierte Ge-mische aus fünfzig und mehr Komponenten. Die Bezeich-nung >öle< verdanken sie ihrer öligen Konsistenz, sie un-terscheiden sich aber von den sog. fetten ö len durch ihre Flüchtigkeit, d. h. sie verdunsten restlos, wenn man sie auf Filtrierpapier aufbringt, während die fetten ö l e einen dauernden »Fettfleck< erzeugen. Die ätherischen ö l e sind in Wasser meist sehr schlecht, in organischen Lösungsmit-teln und in Fetten hingegen sehr gut löslich. Balsame sind Gemische aus ätherischen ö len mit nichtflüchtigen Bestand-teilen, die in den sog. »Harzgängen« gewisser Pflanzen (ζ. B. Coniferen) vorkommen. Die Biosynthese der ätheri-schen ö l e in der Pflanze ist noch nicht restlos geklärt (K. Herrmann). - Plinius gibt eine im großen und ganzen richtige Beschreibung der Bestandteile einer Salbe. Heute
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 249
spridit man von einer Salbengrundlage, in die man die Riechstoffe bzw. Arzneimittel einarbeitet. Wichtig ist auch die Bemerkung, daß man Harz oder Gummi hinzufügt, um den Geruch in der Masse zu fixieren. Bei der modernen Salbenherstellung nennt man Substanzen, die diese Eigen-schaft aufweisen, Fixateure. - stymmata = Bindemittel, meist Oliven-, Nuß- oder Mandelöl. - hedysmata = flüch-tige Pflanzenöle, die den Salben den Wohlgeruch ver-leihen. - Zum Ganzen vgl. Theophrastos, de odor. 14 und 31. - Drachenblutharz (cinnabaris) : Das intensiv rot ge-färbte Harz einer Dracaena-Art, die man im Altertum meist von der Insel Sokotra im nördlichen Indischen Ozean bezog. Nicht damit zu verwechseln ist der Zinno-ber, HgS - Quecksilbersulfid ; vgl. Plinius, nat. hist. 33, I i 5 - 1 1 7 . - Schminkwurzel (anchusa), auch Ochsenzunge genannt; vgl. Theophrastos, hist, plant. V I I 8, 3 und Dioskurides, mat. med. IV 23; entweder Anchusa offici-nalis L. oder Alkanna tinctoria (L.) Tausch (Boraginaceae). Aus der Wurzel der zuletzt genannten Pflanze gewinnt man einen roten Farbstoff, das Alkannin, ein Derivat des Naphtazarins; vgl. Plinius, nat. hist. 2 1 , 85. 99; 22, 48; 27, J9; 28, i j i ; 32, 85; 37, 48. - Salz diente als Konser-vierungsmittel, da verschiedene fette ö le dazu neigen, unter dem Einfluß des Luftsauerstoffes ranzig zu werden, z. B. Oliven- und Mandelöl.
Zu den Ingredienzien der folgenden Salben vgl. die Er-läuterungen zu Buch 12 ; zu den Salben allgemein vgl. den ausführlichen Artikel von F. Hug, R E ΙΑ Sp. 185 1 - 1866 s. v. »Salben«. - bryon s. 12, 108. 132. - öl der Behennuß s. 12, 100. - Salbe von Mendes s. oben § 4. - Myrrhe s. 12, 51 . - metópion s. 12, 107. 123 ; vgl. auch Dioskuri-des, mat. med. I 7 1 . - 0 / . . . aus bitteren Mandeln; vgl. Dioskurides, mat. med. I 39. Aus den Samen des Bitter-mandelbaumes, Prunus dulcis var. amara (DC.) Buchheim
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

2 J 0 Er läuterungen
( = Prunus amygdalus var. amara (DC.) Focke), zieht man, nach Dioskurides, mit heißem Wasser das ö l aus. Das Glucosid der Bittermandeln heißt Amygdalin und zerfällt unter dem Einfluß des in den Mandeln vorhan-denen Enzyms Emulsin oder durch Behandeln mit Säure in Benzaldehyd, Cyanwasserstoff ( = Blausäure, sehr gif-tig!) und Traubenzucker und hat die Formel C e H 5 · C H O · C N - C 1 2 H 2 1 O 1 0 (Mandelnitrilgentiobiosid). Das nach der Vorschrift von Dioskurides gewonnene Bittermandelöl lag sidier nicht in reiner Form, sondern als Emulsion vor und es ist bedauerlich, daß es der Autor unterließ, nähere An-gaben über die Bereitung des eigentlichen Öles zu machen. Heute gewinnt man es durch Destillation, ein Verfahren, das den Alten zwar nicht unbekannt war, dessen tech-nische Vervollkommnung aber erst viel später stattfand. -omphákion s. 12, 130. - Kardamome s. 12, 50. - Binse s. 12, 104-106. - Kalmus s. 12, 104. - Myrrhe s. 12, 68 f. -Balsamsamen s. 12, 1 1 1 ff. - Galbanum s. 12, 126. - Ter-pentinharz s. unten § 54.
Myrtenöl s. 12 ,3 . - Kalmus s. 12 , 104. - Zypresse (cupres-sus): die Echte Zypresse, Cupressus sempervirens L. (Cu-pressaceae); vgl. Plinius, nat. hist. 16, 139- 142 . - Henna s. 12, 109. - Mastix s. 12, 7 1 . - Granatapfelschale s. unten § 1 1 2 . - Rosensalbe s. oben §§ 2.5. - omphákion s. 12, 130. - Safran s. oben § j . - Drachenblutharz s. oben § 7. - Kalmus s. 12, 104. - Binse s. 12, 104-106. - Schmink-wurzel s. oben § 7.
Safransalbe s. oben § 5 ; vgl. audi Dioskurides, mat. med. I 64. - Drachenblutharz s. oben § 7. - Schminkwurzel s. oben § 7. - Majoransalbe s. oben § j ; vgl. auch Diosku-rides, mat. med. I 58. I I I 41a (47). - omphákion s. 12, 130. - Binse s. 12, 104-106. - Mytilene, Hauptstadt der Insel Lesbos; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 245; 5, 12$. 139. -Myrte s. 12, 3. - Lorbeer s. 12, 3. - Majoransalbe, hier
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 251
von Plinius sampsuchinum genannt, aus Majorana horten-sis Moench = Origanum majorana L. (Labiatae); vgl. auch Plinius, nat. hist, i j , 29; 2 1 , 163. - Lilien: wohl aus Lilium candidum L. (Liliaceae). - Bockshorn (fenumGrae-cum), auch Griediisch-Heu genannt, Trigonella foenum-graecum L. (Leguminosae), dient audi als Futterpflanze und soll die Fettbildung fördern; s. auch § 13. - Myrrhe s. 12, 68 f . - Kassia s. 12, 85. - Narde s. 12, 42f f . - Binse s. 12, 104-106. - Zimt s. 12, 85.
1 1 Quittenapfel und -öl: Cydonia oblonga Mill. = Cydonia vulgaris Delarbre (Rosaceae), ein baumartiger Strauch mit länglichen Blättern und schwach rosafarbenen Blüten. Die Frucht hat einen angenehmen Geruch; vgl. Dioskurides, mat. med. I j j und Plinius, nat. hist. 1$ , 38; 2 1 , 38; 23, 100. - Sperlingsapfel (struthea mala): eine Art kleinerer Quitten, jedoch nicht genauer bestimmbar; vgl. Theo-phrastos, hist, plant. I I 2, $ und Plinius, nat. hist. 15, 38. - Hennaöl s. 12, 109. - Sesamöl: aus Sesamum indicum L. (Pedaliaceae), einem etwa 1 m hohen tropischen Kraut mit langgestielten Blättern. Die Samen enthalten über 5 0 % ö l ; sie wurden auch roh oder geröstet gegessen oder zu Mehl verarbeitet; vgl. zum Ganzen A. Steier, R E I IA Sp. 1849-1853 s. v. »Sesamon«. - Balsam s. 12, m ff. -Binse s. 12, 104-106. — Kassia s. 12, 85. - Stabwurz (ha-brotonum, griech. habrótonon aus habrós - weich, zart und tónos - Seil, Strick in volksetymologischer Umdeu-tung einer fremden Bezeichnung), Artemisia abrotanum L., auch Eberraute genannt (Compositae), ist strauchartig und hat kleine gelbliche Blüten. Die Blätter und Stengel-spitzen haben einen zitronenartigen Geruch und enthalten viel ätherisches ö l , sowie Bitter- und Gerbstoff; vgl. Dioskurides, mat. med. I I I 26 (29), sowie Plinius, nat. hist. 2 1 , 160; zur Herstellung des Öls vgl. Dioskurides, mat. med. I 60. Zum Ganzen s. M. C. P. Schmidt, R E V
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n
Sp. 1894 f. s. v. »Eberraute«. - Balsam aus Susa (susi-num): Dioskurides, mat. med. I 62 beschreibt ausführlich die Bereitung des susischen Salböls. Zu Susa, der alten Hauptstadt des elamitischen Reiches, wurde eine ausge-dehnte LilienkuituT betrieben, woher auch der Name (su-sinum, erg. oleum, griech. soúsinon élaion, als Ableitung von soúsos, vgl. hebr. shushan - Lilie) kommt. Es handelt sich wohl vor allem um Lilium candidum L., s. audi oben § 10. - Behenöl s. 12, 100. - Kalmus s. 12, 104. - Zimt s. 12, 51 und 85. - Safran s. oben § j . - Myrrhe s. 12, 68 f.
Henna s. 12, 109 ,-omphâkion s. 12, i^o.-Kardamome s. 12, 50. - Kalmus s. 12, 104. - aspalathos s. 12, n o und 24, m . - Stabwurz s. oben § 11. - Zypergras (cyperum, andere Lesarten cyperos, cyperon, ciperum) s. 12, 42 f. und 21, n j . 117; vgl. audi Dioskurides, mat. med. I 4. Eine genauere Bestimmung der Pflanze ist aus diesen An-gaben jedoch nicht möglich. Sie darf nicht verwechselt werden mit dem Hennastrauch (cypros), aus dessen Blü-ten das wohlriechende Zyprusöl (cyprinum s. § 5) ge-wonnen wi rd . -Myrrhe s. 12, 68 î.-Heilwurz s. 12, 127.-Sidon s. 12, 12 j . - Sesamöl s. oben § 11. - Zimt s. 12, 51 und 8 j .
telinum; nach Dioskurides, mat. med. I J7 aus telis, dem Bockshornklee oder Griechisch-Heu (s. § 10) gewonnen. Die Pflanze stammt aus Ostindien und zeichnet sich durch einen starken Geruch aus. Der Same enthält u. a. Trigo-nellin = N-Methyl-nicotinsäure C 7 H 7 N 0 2 ; vgl. auch Plinius, nat. hist. 18, 140 und 24, 184. - Zypergras s. oben § 12. - Kalmus s. 12, 104 und unten § 73. - Melilotenklee (melilotum, griech. meliloton - >Honiglotos<), eine dem Bockshornklee (s. oben) ähnliche, wohlriechende Pflanze, die den Riechstoff Cumarin enthält; vgl. Dioskurides, mat. med. I I I 41b (48). Zum Ganzen s. F. Orth, RE XI Sp. 585-591 s. v. »Klee«. - Bockshorn s. oben. - máron
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n * 53
s. 12, m . - Majoran s. oben § 5. - Menander (Menan-dros), 342/41 - 291/90 (283?) v. Chr., griedi. Lustspiel-dichter, bedeutendster Vertreter der sog. Neuen Komödie. - megalische Salbe: Ableitung von griedi. mégas - groß, daher etwa >großartig<; nach anderen ist sie nach dem Si-zilier (oder Athener) Megallos benannt; vgl. Athenaios, Deipnosoph. X V p. 690 F. - Behenöl s. 12, 100. - Kal-mus s. oben. - Binse s. 12, 104. - Holzbalsam s. 12, m und 1 1 8 ; vgl. auch Dioskurides, mat. med. I 18. - Kassia s. 12, 85. - Audi Dioskurides, mat. med. I 69 beschreibt ein harzreiches Salböl, Megalion genannt, sagt aber, es sei nun verschwunden. Durch das lange Kothen entweicht das im Harz enthaltene Terpentinöl und die anderen Ge-ruchsstoffe können dann nadi dem Erkalten ihre Wirkung entfalten.
14 malóbathron s. 1 2 , 129 ; zu dem aus der Pflanze gewonne-nen ö l s. Dioskurides, mat. med. I 76. - illyrische Schwert-lilie (iris Illyrica), gemeint ist wohl Iris florentina L. oder Iris germanica L. (Iridaceae) ; vgl. Theophrastos, hist, plant. IV j , 2; I X 7, 3 f. und de odor. 24. 28. 36. 38; Dioskuri-des, mat. med. I 1 . 66 und Plinius, nat. hist. 2 1 , 40. -Majoran s. oben § 5. - Kyzikos s. oben § 5. - omphákion s. 12, 130. - Mönchspfeffer, Vitex agnus-castus L. (Ver-benaceae), auch Keusdilammstraudi genannt, ein weiden-artiger Strauch von angenehmem Geruch; vgl. Dioskuri-des, mat. med. I 134. Er wurde in der Heilkunde mannig-fach verwendet und soll angeblich zur Abstumpfung des Geschlechtstriebes führen. - Heilwurz s. 12, 127.
15 Zimtsalbe (cinnamominum, erg. unguentum) ; vgl. Dios-kurides, mat. med. I 74. - Zimt s. 12, j 1 und 8 5 . - Behenöl s. 12, 100. - Holzbalsam s. 12, i n . 1 18 und oben § 13. -Kalmus s. 12, 104. - Binse s. 12, 104. - Samen vom Bal-sambaum s. 12, i n . - Myrrhe s. 12,68 f. - 35-300 Denare = etwa 28-240 Mark alter Währung (1 Denar entsprach
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

254 E r l ä u t e r u n g e n
in republikanischer Zeit etwa 0,80 Mark, unter Nero sank sein Wert auf etwa 0,50 Mark). - Nardensalbe (nardi-num), eine der besten und teuersten Salben; vgl. Diosku-rides, mat. med. I 75. Zur Ν arde s. 12, 42 f . Die Bezeich-nung Blattsalbe (foliatum) rührt offenbar daher, daß sie aus Nardenblättern hergestellt wurde; vgl. Martial X I 27, 9 und Iuvenal V I 46 j , wo allerdings eine trinkbare Essenz gemeint ist. Im Neuen Testament wird berichtet, daß Jesus mit Narde gesalbt wurde; s. Joh. X I I 3 Maria ergo accepit libram unguenti nardi pistici, pretiosi, et unxit pedes Jesu . . . (Da nahm Maria ein Pfund von un-gefälschter köstlicher Narde und salbete die Füße Jesu . . . M. Luther); vgl. auch Marc. X i 7 3. - omphákion s. 12, 130. - Behenöl s. 12, 100. - Binse s. 12, 104. - Kostwurz s. 12, 41 . - Amomum s. 12, 48. - Myrrhe s. 12, 68 f. -Balsam s. 12, i n .
16 neun Kräuterarten s. 12,42,bes. 12,45 f. - Kostwurz s. 12, 41 . - Amomum s. 12, 48. - Myrrhe s. 12, 68 f. -Safran s. oben § 5; vgl. auch Dioskurides, mat. med. I 25 und 64. Plinius behandelt nat. hist. 2 1 , 3 1 -34 die Pflanze ausführlicher; vgl. audi F. Orth, R E ΙΑ Sp. 1728- 173 1 s. ν. »Safran«. - Zusammenkochen der Bestandteile: Diese Bemerkung ist durchaus richtig, denn eine Salbe kann erst dann ihre volle Wirksamkeit entfalten, wenn ihre Be-standteile völlig homogen zusammengemischt sind. Allzu langes Kochen (s. § 13) kann allerdings einen Verlust an leichtflüchtigen ätherischen ölen zur Folge haben. Aus diesem Grund nahm man das Erhitzen im Wasserbad vor.
17 Myrrhe und stakté (Tropfmyrrhe) s. 12, 68 f.; vgl. auch Dioskurides, mat. med. I 73. - Hennaöl s. oben § 12. -Lilienöl s. oben § 1 1 . - mendesisches öl s. oben § 4. -Rosenöl s. oben § 5.
18 Königsbalsam s. Athenaios, Deipnosoph. X V p. 690 DE. - Parther, ein nordiranischer Volksstamm, der um 250
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n
v. Chr. unter der Dynastie der Arsakiden ein Großreich gründete. In der Kaiserzeit Hauptgegner der Römer im Osten. - Behenbalsam s. 12, 100. - Kostwurz s. 12, 41 . -Amomum s. 12, 48. - Zimt s. 12, 85. - Kardamome s. 12, 48. 50. - Nardenspitzen s. 12. 41 . - màron s. 12, m . -Myrrhe s. 12, 68 f. - Kassia s. 12, 85. - S tórax s. 12, 124. - ládanon s. 12, 73. - opobálsamon s. 12, 1 16 . - Kalmus s. 12, 104. - Binse s. 12, 104. - Syrien, Landschaft am Mit-telmeer zwischen Kilikien und Palästina; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 65 ff. - oinánthe s. 12, 132. - malóbathron s. 12, 129. - serichatum s. 12, 99. - Henna s. 12, 109. -aspálathos s. 12, 1 10 . - Heilwurz s. 12, 127. - Safran s. oben § 16. - Zypergras s. 12, 42. - Majoran s. oben § 5. -Lotos s. unten § 104 f.; hier nidit näher bestimmbar. -Nichts in dieser Hinsicht wächst: Die ausländische Her-kunft aller genannten Ingredienzien hatte schon Theo-phrastos, hist, plant. I X 7, 3 hervorgehoben. In einer weiteren, wahrscheinlich aber korrupten Textstelle (nat. hist. 2 6, 16) erwähnt Plinius nochmals das über alle Völ-ker siegreiche Italien. - illyrische Schwertlilie s. oben § 14. -gallische Ν arde s. 12, 45.
19 Diapasmen (griech. diapásmata) = wohlriechende Streu-puder. - magma (von griech. máttein - kneten) : der nach der Extraktion der Riechstoffe verbliebene Rückstand. Vielleicht meint Plinius hier eine salbenartige Masse. -tritt am stärksten hervor; vgl. Theophrastos, de odor. 17. Der gesamte Abschnitt geht auf Theophrastos zurück; vgl. de odor. 8. 14. 34. 40. 41 . - Alabaster: Man ver-steht darunter gewöhnlich einen feinkörnigen Gips, Calciumsulfat, den man im Altertum vielfach zu Urnen, Vasen usw. verarbeitet hat. Hier meint aber Plinius zwei-fellos den sog. echten orientalischen Alabaster, eine Art Kalksinter, Calciumcarbonat, der sich vom Marmor nur durch sein besonderes Gefüge unterscheidet. Er ist durch-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Er läuterungen
scheinend, zuweilen gelblich gefärbt und wurde auch als Onyx bezeichnet; vgl. Dioskurides, mat. med. ¥ 1 5 2 ( 1 5 3 ) und Plinius, nat. hist. 36, 59 (heute versteht man unter Onyx einen mikrokristallinen Quarz). Aus dem Material verfertigte man Salbengefäße, Alabastra genannt. - Riech-stoffe in öl: auch diese Bemerkung ist durchaus richtig. Zur Gewinnung der in den Pflanzen enthaltenen ätheri-schen öle , die die eigentlichen Geruchsträger sind, ver-wendet man seit langem Fette und ö l e als Extraktions-mittel (Infusionsmethode). Bei der als »Enfleurage« be-zeichneten Arbeitsweise findet eine Absorption der äthe-rischen ö le durch kaltes ö l oder Fett statt. - Mandelöl: seine Gewinnung aus bitteren Mandeln beschreibt Plinius, nat. hist. 15, 26; vgl. auch Dioskurides, mat. med. I 39. -Daß manche Parfüms durch längeres Lagern besser wer-den, ist eine alte Erfahrung der Praxis, ebenso, daß die Aufbewahrung der Materialien vor der Sonne geschützt erfolgen soll. - Die Prüfung einer Probe wird auch heute noch analog vorgenommen.
40 Denare = etwa 32 Mark alter Währung.
Das Cicero-Zitat, de orat. I I I 25,99, ist von Plinius un-genau wiedergegeben, denn es heißt im Original: » . . . ma-gis laudari quod ceram (nicht terram!) quam quod crocum olere videatur« (mehr rühmt man, was nach Wachs, als was nach Safran zu riechen scheint). Plinius, nat. hist. 17, 38 wiederholt aber dieses Zitat und verwendet auch dort das Wort >terram<; vgl. dazu Münzer S. 94f. und 243 Anm. 2. Mit Recht hat aber A. Ernout, Komm. S. 74 darauf hingewiesen, daß Theophrastos, de odor. 1 eben-falls erwähnt, daß die Erde das einzige der vier Elemente sei, das einen Geruch aufweist. - spissus = dicht, dick. Für die Anwendung spielt die Konsistenz der Salben eine wichtige Rolle.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Er läuterungen 2$ 7
22 Λ/. Salvius Otho, geb. 32 n. Chr, Freund Neros und Ge-mahl der Poppaea Sabina, die später von Nero geheiratet wurde; s. nat. hist. 12, 8 3. Römischer Kaiser vom 15. Janu-ar bis zum 16. April 69 n. Chr. Zu seiner Freundschaft mit Nero s. Tacitus, Ann. X I I I 12 und 45 f. — Kaiser Gains = Caligula, geb. 12 η. Chr., Römischer Kaiser 37-4 1 η . Chr. Suetonius, Caligula 37, ι berichtet, daß er eine neue Art des Badens unter Verwendung von Riechstoffen erfunden hat. - Sklave Neros: im »Gastmahl des Trimal-chio« erzählt Petronius, sat. 28, 2 »iam Trimalchio un-guento perfusus tergebatur . . . « (Trimalchio, von Parfum triefend, ließ sich schon abtrocknen . . . W. Ehlers). Ein weiterer Hinweis auf den Mißbrauch, den man z. Zt. des Plinius mit wohlriechenden Salben etc. trieb!
24 König Antiochos I I I . derGroße, regierte 223-187 v. Chr. Er wurde 190 v. Chr. bei Magnesia am Sipylos von den Römern geschlagen und mußte im Frieden von Apameia 188 v. Chr. Kleinasien bis zum Tauros abtreten. Beim Versuch, einen Tempelschatz in der Elymais zu rauben, wurde er 187 v. Chr. erschlagen. - P. Licinius Crassus und L. Iulius Caesar waren 89 v. Chr. Zensoren. Zum Irrtum des Plinius in der Jahreszahl (richtig nat. hist. 14, 95) s. Münzer S. 124 und 182.
2 j Vgl. Theophrastos, de odor. 32. 67. - den bitteren Ge-schmack ... innerlich genießt; vgl. dazu Marc. X V 23 »et dabant ei bibere myrrhatum vinum . . . « (und sie gaben ihm Myrrhen im Wein zu trinken . . . ) . - C. Munacius Plancus, der Bruder des L. Munacius Plancus, wurde von einem L. Plautius adoptiert und nannte sich fortan L. Plautius ( = Plotius) Plancus. Er war 43 v. Chr. Praetor, wurde aber von den Triumvirn auf die Proskiptionsliste gesetzt ( = »geächtet«). Die Geschichte von seinem Ver-steck in Salernum, h. Salerno, findet sich auch bei Valerius Maximus, Memor. V I 8, j ; vgl. Münzer S. 167 und 403.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

2j8 Er läuterungen
26 Kampanien, das fruchtbare Land in Mittelitalien mit der Hauptstadt Capua, wo man die dort reichlich vorkom-menden Rosen zu Parfüm verarbeitete. - Iudaea (Palae-stina), römische Provinz seit 72 n. Chr. - Palmen: Plinius meint hier die Dattelpalme, Phoenix dactylifera L. (Pal-mae), die von den Kanarischen Inseln über Nordafrika bis weit über Babylonien und Arabien hinaus wildwach-send vorkommt, in Griechenland und Italien jedoch nur angepflanzt anzutreffen ist. Die sog. Zwergpalme, Cha-maerops humilis L., gibt es audi wildwachsend in Italien und im Mittelmeergebiet. Theophrastos, hist, plant. I I I 3,5 berichtet: »Die Dattelpalme erregt in Babylon durch Fruchtbarkeit Verwunderung, aber in Hellas kommt die Frucht nicht zur Reife: in einigen Gegenden zeigt sich nicht einmal ein Anschein zur Frucht« (K. Sprengel). Der gleiche Autor widmet der Dattelpalme ein ganzes Kapitel, hist, plant. II 6, 1 - 1 2 , woraus ebenfalls die Bedeutung dieses Baumes in der Antike hervorgeht.
27 Der Palm wein wird auch vonHerodot I 193,4 erwähnt. Nach Plinius, nat. hist. 14, 102 und Dioskurides, mat. med. V 40 wird er durch Einweichen reifer Datteln in Wasser und nachfolgende Vergärung hergestellt; vgl. auch unten § 44. - Brot s. Theophrastos, hist, plant. I I 6, 10.
28 Theophrastos, hist, plant. I I 6,2-3. Analoge Bemerkun-gen bei Palladius, Opus agriculturae X I 12, 1 - 2 ; s. ferner auch Geoponica I I 10, 8-9 und X 4, 1 - 2 ; vgl. Plinius, nat. hist. 17, 261. Ein geflügeltes Wort der Araber besagt, daß die Palme die Krone in der Sonne und die Füße im Wasser habe. - Mist s. Theophrastos, hist, plant. I I 6, 3. - nicht höher als ein Strauch: hier ist die bereits erwähnte (§ 26) Zwergpalme gemeint; s. unten § 39.
29 Ringe der Rinde: gemeint sind die Reste der Blattstiele, die dem Stamm der Palme sein charakteristisches Aussehen verleihen. Auch heute noch werden von den Eingeborenen
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 2$ 9
die Palmen in der von Plinius beschriebenen Weise er-klommen.
30 Alles Blattwerk . . . ; vgl. Theophrastos, hist, plant. I 14, 2: »Aus den Spitzen des Stammes kommen audi die Früch-te der Dattelpalme, aber bei dieser kommen die Blätter ebenfalls und die Triebe aus dem Gipfel« (K. Sprengel). -Schreibtafel (griech. diptychon - das Doppeltgefaltete): Die doppelte, verschließbare, aus zwei durch Schnur oder Gelenk verbundenen Holztafeln bestehende Schreibtafel diente für Notizen, Briefe, Listen, Urkunden, Schularbei-ten usw. Die Innenseite hatte erhabene Ränder, zwischen denen helles Wadis (leukoma) verstrichen war, in das ge-schrieben wurde. Zur Tilgung des Textes wurde das Wachs mit dem umgedrehten Griffel (stilus) geglättet, dann konnte die Tafel neu benützt werden. Statt dessen konnte man auch mit Tinte auf das blanke Holz oder eine Gips-sdiicht schreiben. Die Entlassungsurkunden der Soldaten, die sog. »Militärdiplome«, bestanden aus zwei Bronze-tafeln, die so aufeinander gelegt waren, daß sich der rechtsverbindliche Text auf den Innenseiten befand. Sie sind mit versiegelten Schnüren verschlossen, der Text ist außen zur Vereinfachung der Kontrolle wiederholt. Prunk-Diptycha aus Elfenbein dienten zu Geschenk-zwecken. - Uber die Verwendung der Blätter der Palme spricht Plinius nochmals nat. hist. 16, 89 und sagt, daß die daraus gefertigten Taue (Stricke) besonders in der Nässe brauchbar sind.
31 Zwei Geschlechter der Palme: Theophrastos, hist, plant. II 6, 6 und I 13, 5 spridit sich recht unklar über den Be-fruchtungsvorgang aus. Die Dattelpalme gehört zu den diözischen ( = zweihäusigen) Pflanzen, was bedeutet, daß jede Pflanze entweder männliche oder weibliche Blüten, in diesem Falle Blütenstände (Rispen), aufweist. Die weiblichen Blüten entwickeln bis zu 200 Früchte je Frucht
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

26ο E r l ä u t e r u n g e n
stand, die männlichen haben ebenfalls rispige Blüten-stände mit etwa ioooo männlichen Einzelblüten. -Früchte ohne Kern s. Theophrastos, hist, plant. I I 6,6.
32 Der Dattelkern besitzt ein sehr hartes Endosperm. 33 Zypern; vgl. Theophrastos, hist, plant. I I 6, 8: »eine
andere Art wächst auf Cyprus, die ein breiteres Blatt h a t . . . sondern den Granatäpfeln ähnlich, so daß sie nicht eigentlich genossen wird, sondern man zerkaut sie und wirft sie dann aus« (K. Sprengel).
34 Iuba F G H 275 frg. 66. - Zeltaraber (Scenitae Arabes) = Beduinen; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 65. 87; 6, 143. — dahla: das Wort ist wahrscheinlich arabischen Ursprungs; ob es aber mit dem arabischen Wort daqal = Palme zu-sammenhängt, ist fraglich. Unsere deutsche Bezeichnung Dattel kommt vom griech. dáktylos, lat. dactylus - >Fin-ger<, wohl weil gewisse längliche Dattelarten einem Finger ähnelten; vgl. unten § 46. Zum Ganzen vgl. A. Steier, R E X X S p . 3 8 6 - 4 0 3 s. v . » P h o i n i x « N r . 1 .
3 5 Über die künstliche Befruchtung der Palme spricht auch Theophrastos, hist, plant. I I 8, 4 und de causis plant. I I 9, I J ; I I I 18, 1 ; vgl. auch Geoponica X 4, 5. 8. Diese Stelle ist für die Geschichte der Botanik von Wichtigkeit, wonach man also bereits in der Antike die Bedeutung des ~&\üteTiStaubes bei der Befruchtung erkannt hat, ohne aller-dings über den Vorgang selbst im klaren gewesen zu sein. Erst der Tübinger Professor Rudolf Jakob Camerarius ( 1 6 6 J - 1 7 2 1 ) hat in seiner Abhandlung vom 25. August 1694 »De sexu plantarum epistola«, herausgegeben von J . G. Gmelin 1749, die Sexualität der Pflanzen nach-gewiesen. Auch heute noch wird zwecks Ertragssteigerung eine künstliche Befruchtung durchgeführt; vgl. J . Esdorn -H. Pirson, Die Nutzpflanzen der Tropen und Subtropen. 2. Aufl., Stuttgart 1973, S. 107: »Sobald die männlichen Blüten sich öffnen, werden ihre Blütenstände abgeschnit-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Er läuterungen 261
ten und in Beuteln trocken aufbewahrt. Sie bilden in die-ser Form einen Handelsartikel, da der Pollen jahrelang keimfähig bleibt. An den zu bestäubenden weiblichen Blütenständen werden beim Aufspringen der holzigen Hüllscheiden oben die männlichen Blütenrispen ange-bracht, so daß nun die Pollen auf die weiblichen Blüten fallen können«.
3 6 Theophrastos, hist, plant II 6, 2: »Will man sie aber durdi den Stamm vermehren, so nimmt man den obersten Teil, gleichsam das Gehirn, weg, schneidet alsdann den Stamm zwei Ellen lang durch, spaltet ihn, und steckt den untern feuchten Teil« (K. Sprengel). - Das andere Ver-fahren wird Geoponica X 3, 9 erwähnt; vgl. Plinius, nat. hist. 17, 96.
37 Theophrastos, hist, plant. II 6, 3-4. - halbfuß = etwa 15 cm. Theophrastos, 1. c., sagt jedoch: »Doch läßt man einer Spanne lang von den Ruten stehen« (K. Sprengel), was etwa 20 cm entsprechen würde.
38 Theophrastos,hist, plant. I I 6,2.4.7 und de causis plant. I I I 17, 1 ; vgl. auch Geoponica X 4, 2. - >Eunuchen< (spa-dones) == Datteln ohne Kerne. Plinius nennt nat. hist. 16, 169 (vgl. auch Columella, de re rust. I I I 10. 15) das Rohr, das keinen Flaum aufweist, Eunudhenrohr; s. auch Aristo-teles frg. 267 Rose (nach Athenaios, Deipnosoph. X I V p. 652 A).
39 Die Arten; vgl. Theophrastos, hist, plant. II 6, 6. - Pli-nius verwechselt hier die Eigenschaften der Zwergpalme (s. oben § 26) mit denen der Dattelpalme. Theophrastos, hist, plant. I I 6, 1 1 sagt: »Die Zwergpalme ist eine von Dattelpalmen ganz verschiedene Gattung, wiewohl sie denselben Namen führt. Denn sie leben fort, wenn man die Krone weggenommen . . . « (K. Sprengel). Der gleiche Autor schreibt weiterhin zutreffend (hist, plant. IV 16, 1) : »Was man das Köpfen der Bäume nennt, so ist dies allein
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

262 E r l ä u t e r u n g e n
. . . der Dattelpalme . . . (verderblidi) . . . alle, wenn man die Krone weggenommen und den Gipfel ausgehauen, kommen um, und schlagen nicht wieder aus« (K. Spren-gel). Auch Xenophon, Anab. I I 3, 16 bemerkt, daß ein Palmbaum, aus dem das Mark herausgenommen wurde, gänzlich verdorrt. - Zur Verwendung als Bauholz s. Theophrastos, hist, plant. V 6, 1 und Strabo, Geogr. X V I ι , 739, als Kohle Strabo, Geogr. X V I 1, 742. - Dioskuri-des, mat. med. I 150 berichtet über die Verwendung der Blütenscheide der Palme, s. oben 12, 134. - verbrennen langsam; vgl. Theophrastos, hist, plant. V 9, 5, wo es heißt, daß das Palmholz beim Verbrennen sehr viel Rauch entwickeln würde.
40 Theophrastos, hist, plant. I I 6, 6 sagt lediglich, daß es unter den Früchten der Dattelpalme mehrere Unterschiede gäbe: »einige haben keinen Kern, andere einen weichen« (K. Sprengel). - 49 Arten: man kennt heute über 300 Kultursorten der Dattelpalme; vgl. ro-ro-ro Pflanzen-lexikon Bd. $, S. 1 189. - Zum Palmwein s. oben § 27.
41 Königsdatteln (regiae) ; vgl. Theophrastos, hist, plant. I I 6, 7. - Bagoas (pers. Bagava), Name mehrerer Eunuchen, vor allem eines persischen Hofmannes, der das Vertrauen des Artaxerxes Ochos (3y8—337 ν · Chr.) genoß. Seine Ver-worfenheit und Lasterhaftigkeit war berüchtigt und schließlich wurde er von Dareios III . , nachdem er Arta-xerxes und später dessen Sohn Arses ermordet hatte, ge-zwungen, selbst Gift zu trinken; vgl. Diodor X V I 47-51 . X V I I J , 3-6; Arrian, an. II 14. 5; Aelian, vor. hist. V I 8. Bagoas besaß zu Babylon einen berühmten Garten.
42 f . Eberdatteln (syagroi), Perlendatteln (margarides), San-dalendatteln (sandalides) : diese Bezeichnungen finden sich nur bei Plinius. Die Quelle, aus der sie Plinius entnahm, ist unbekannt. Sicherlich handelt es sich nicht um ge-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Er läuterungen
bräudiliche Namen. Während die erste Bezeichnung auf den Geschmack (Wildgeschmack; syágros eigentlich >der die Wildschweine jagt<) zurückgeht, spielen die beiden anderen auf das Aussehen der Früchte an. - Chora = Unterägypten, die Gegend von Alexandreia; vgl. Plinius, nat. hist. 6, 212. - Phönix (griech. Phoinix): Plinius bringt hier die Palme (griech. phoinix, lat. phoenix - die »Phö-nikische«, dazu als Bezeichnung der Dattel griech. phoini-kobálanos, lat. phoenicobalanus - >Phönikereichel<) mit dem gleichnamigen Wundervogel, der in Heliopolis (vgl. Herodot I I 73; Tacitus, Ann. V I 28) verehrt wurde, in Verbindung. Nach griechischer Auffassung verbrennt sich der Phönix (Lukian, Peregr. 27) und ersteht aufs neue (Ovid, Met. X V 392 ff.) und gilt als Symbol für Auf-erstehung und ewiges Leben.
44 Nußdatteln (griech. karyotai näml. phoinikes, lat. caryo-tae, von griech. káryon - Nuß; vgl. Varrò, res rust. II 1 , 27); vgl. Dioskurides, mat. med. I 148 und V 40; Strabo, Geogr. X V I I 1 , 818; Martial X I I I 27; Plinius, nat. hist. 14, 102; 23, 52. Da die Nußdatteln sehr saftreich sind, eignen sie sich sehr gut zur Weinbereitung. Nach der von Plinius gegebenen Etymologie sind die aus den Nußdat-teln gewonnenen Weine für den Kopf (griech. kára) nach-teilig; vgl. auch nat. hist. 15, 87, wo er erwähnt, daß die Nuß (caryon) wegen ihres starken Geruches den Kopf schwer macht. - Judaea = Palaestina. - Jericho, Oasen-stadt im Jordantal in der Nähe des Toten Meeres. Plinius, nat. hist, j , 70 nennt das Gebiet reich an Palmen und Quellen. - Archelais, nicht mit Sicherheit lokalisierbares Tal in der Nähe von Jericho. - Phaseiis, im Jordantal nördlich von Jericho; nicht zu verwechseln mit der gleich-namigen Stadt s. oben § 5. - Livias, im östlichen Jordan-tal, gegenüber von Jericho, ähnlich wie Phaseiis von Hero-des Antipas gegründet.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

264 E r l ä u t e r u n g e n
4 j Nikolasdatteln (griech. nikólai, lat. nicolai) : benannt nach Nikolaos von Damaskus, geb. 64 ν. Chr. (s. Athenaios, Deipnosoph. X I V p. 652 A), dem griechischen Geschichts-schreiber und Freund Herodes d. Großen, der auch bei Augustus in hohem Ansehen stand. - Länge einer Elle = etwa 45 cm; die Angabe dürfte etwas übertrieben sein, stammt aber aus Theophrastos, hist, plant. II 6, 6. - Adel-phiden (griech. adelphides) = Schwestern. - Quetschdat-teln (patetae, griech. patetai von griech. patetós - getre-ten) ; vgl. Geoponica X X 9.
46 Fingerdatteln (dactyli, griech. dáktyloi - Finger) s. oben § 34. Erste Erwähnung im antiken Schrifttum! - Die Juden, ein durch seine Verunglimpfung der Götter be-kanntes Volk: eine religionsgeschichtlich bedeutsame Be-merkung des Plinius. - chydaîoi (von griech. chydaios -gemein, minderwertig).
47 Thebais, Landschaft im oberen Teil Ägyptens mit der Hauptstadt Theben (Thebae); vgl. Plinius, nat. hist. 5, 49. - kóikes (coices, unbekannter Herkunft, vgl. cuci unten § 62); vgl. Theophrastos, hist, plant. I io, j bzw. II 6, 10. Gemeint ist die Dumpalme, Hyphaene thebaica (L.) Mart. (Palmae), von der Plinius unten § 62 noch aus-führlicher spricht; vgl. Dioskurides, mat. med. I 149 und Strabo, Geogr. X V I I 2, 824.
48 Thebais s. oben § 47. - Naschwerk (tragémata): über-zuckerte Früchte, Nachtisch, Dessert. Das aus dem Fran-zösischen entlehnte Wort Dragee geht auf griech. tragé-mata zurück. - Phönikien s. oben § 6. - Kilikien s. oben 12, 125. - Eicheln (griech. bálanoi); hier sind jedoch die Datteln gemeint; s. auch Theophrastos, hist, plant. II 6, 2. 5.
49 Elle; vgl. Theophrastos, hist, plant. I I 6, 6 und s. oben § 4 j . - Iudaea s. oben § 44. - Kyrenaika s. 12, 108. -assyrisches Seleukeia, Stadt in Mesopotamien; vgl. Plinius,
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 26J
nat. hist. 6, 1 1 7 , von anderen gleichnamigen Städten in Kilikien, am Orontes in Nordsyrien und anderswo zu unterscheiden, s. oben 12, 12j und unten § 53. - Theo-phrastos, hist, plant. II 6, 2.
jo Alexander ... Gedrosien s.oben 12,24 und 33f . , ferner Theophrastos, hist, plant. IV 4, 13 und Strabo, Geogr. X V 2, 722 f.
51 Pistazie (pistacia, griedi. pistáke von pers. pistah) : ge-meint ist die Echte Pistazie, Pistacia vera L. (Anacardia-ceae), ein oft baumartiger Strauch, der in wärmeren Län-dern kultiviert wird. Die Pistazien«»55e sind eßbar und besitzen einen angenehmen Geschmack; sie werden auch als Gewürz verwendet. Gegen Schlangenbisse empfiehlt sie ebenfalls Dioskurides, mat. med. I 177; vgl. auch Nikander, Ther. 891. Theophrastos, hist, plant. IV 4, 7 beschreibt den Baum, ohne ihn zu benennen. Die medizi-nische Verwendung erwähnt Plinius, nat. hist. 23, 150; er sagt ferner nat. hist. 15, 91 , daß die Pistazie von L. Vitellius, dem Vater des Kaisers, 3$ n. Chr. nach Italien und vom Ritter Pompeius Flaccus nach Spanien gebracht wurde. Einzelheiten über die Kultur der Pflanze bei Pal-ladius, Opus agriculturae X I 12, 3. - karische Feigen: Plinius erwähnt nat. hist. 15, 83 diese Feigen, die aus Kaunas in Karien exportiert wurden. Sie kamen zuerst am Ende der Regierung des Tiberius durch L. Vitellius (s. oben) in die Gegen von Alba. - kóttana (cottana, vgl. hebr. qaton, qetanna - klein, jung): eine Art kleiner Feigen; vgl. Martial IV 88, 6; V I I 53, 7; X I I I 28, 2, so-wie Plinius, nat. hist. 15, 83. - Zur Quelle dieses Ab-schnittes (Iuba) vgl. Münzer S. 379. - Pflaumen, die auf dem Berge Damaskus gedeihen: Die Damaszenerpflaumen waren wegen ihrer Größe und ihres guten Geschmackes besonders geschätzt; s. auch Plinius, nat. hist. 15, 43. Damaskus, die Hauptstadt von Syria Coele; s. Plinius,
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

166 E r l ä u t e r u n g e n
nat. hist. 5, 74. Auf der Reise dorthin wurde Paulus be-kehrt; vgl. Apg. 9. - myxai (myxae, als > weiche schleimige Frucht< verwandt mit lat. mucus - Rotz, Schleim) : Wahr-scheinlich handelt es sich um den von Theophrastos, hist, plant. IV 2, 10 beschriebenen Baum Kokkymelea, eine Kordie (Brustbeerbaum). Es gibt zahlreiche Arten von Cordia myxa L. (Cordia officinalis, Boraginaceae), deren Früchte als Obst gegessen oder auch getrocknet als schwarze Brustbeeren oder Sebesten gegen Husten und Heiserkeit Verwendung fanden. Das Holz des Baumes diente bei den Einheimischen zum Feuermadien durch Reiben; vgl. Pli-nius, nat. hist. 15, 43. j i . 96; 17, 75; 22, 120. Zum All-gemeinen vgl. A. Steier, R E X I X Sp. 1456-1461 s. v. »Pflaume«.
j 2 Plinius nennt hier Wacholder (iuniperus oder iunipirus) und Zeder (cedrus, griech. kédros zu hebr. qed - rauchen >Räucherholz<) zusammen. Sie gehören zur Klasse der Nadelhölzer (Coniferopsida), der Wacholder jedoch zur Familie der Zypressengewächse (Cupressaceae), die Zeder zu der der Kieferngewächse (Pinaceae). Man kennt etwa 80 Wacholderarten und Plinius meint hier wohl den ze-dernähnlichen Baumwacholder, Iuniperus oxycedrus L., mit rötlichen Beeren von etwa 1 cm Dicke oder die Varie-tät, den großfrüchtigen Wacholder, Iuniperus macrocarpa Ball, mit bläulich-roten großen Früchten. Beide Arten sind im Mittelmeergebiet zu Hause, ebenso die phönikische Zeder, Iuniperus phoenicea L., welche dunkelrote Beeren aufweist. - lykische und phönikische Art: Plinius folgt hier wiederum ziemlich genau Theophrastos, hist, plant. I I I 12, 3-4. Eine genaue Identifizierung ist kaum mög-lich, da man im Altertum unter cedrus bald den Wachol-der ( = iuniperus), bald die eigentliche Zeder verstand; vgl. Dioskurides, mat. med. I i o j . Theophrastos sagt I.e.: »Von der Zeder nehmen einige auch zwei Arten an: die
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 267
lykisdie und phoenikische . . . Aber im Blatt sind sie un-terschieden; denn die Zeder hat ein steifes, spitziges und dorniges Blatt, -welches beim Wacholder weicher i s t . . . In-dessen unterscheiden einige die beiden Zedern nicht durch besondere Namen, sondern nennen die eine Art vorzugs-weise Kedros, die andere Oxykedros« (K. Sprengel). -Lykien s. oben 12, 9. - Phönikien s. oben § 6. - Stachel-zeder (griech. oxykedros von oxys - scharf, spitz), wohl Iuniperus oxycedrus L. - Myrte s. oben 12, 3.
Î3 von der größeren Zeder zwei Arten: hier ist zunächst wohl der Steinfrüchtige Wacholder, Iuniperus drupacea Labili., gemeint, der nadeiförmige Blätter aufweist und in Griechenland und Vorderasien zu Hause ist; weiterhin Iuniperus excelsa Μ. Β., ein Baum mit dünnen Zweigen und braunen Früditen, der aus Vorderasien und dem Kau-kasus stammt. Der Same hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem der Zypresse; s. auch Dioskurides, mat. med. I 105, sowie Theophrastos, hist, plant. I I I 3, 8; 12, 3 f. - Zedern-tanne (cedrelate, griech. kedreláte, Zusammensetzung aus kédros, und eláte s. oben 12, 134): Dieses nur von Plinius verwendete Wort findet sich nochmals nat. hist. 24, 17. -Das Harz bzw. das daraus gewonnene ö l wurde zum Tränken von Holz, s. Plinius, nat. hist. 16, 197, zum Ein-balsamieren, s. nat. hist. 16, 52, und für Heilzwecke, s. nat. hist. 24, 1 7 - 19 , verwendet. - Die aus Zedern holz gefertigte Statue des Apollo Sosianus: C. Sosius, Unter-feldherr des Marcus Antonius und Quaestor um 40 v. Chr., unternahm den Neu- und Umbau des Apollotempels beim Marcellustheater in Rom und stellte dort die aus dem kilikischen Seleukeia herbeigeschaffte Statue des Gottes auf; vgl. Plinius, nat. hist. 36, 28. - Arkadien, das Mit-telland der Peloponnes. - Phrygien s. oben 12, 47. -kedrís (cedris), eigentlich die Frucht der Zedern, s. Plinius, nat. hist. 24, 20. Plinius spricht aber hier von einem
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

ι6 8 Er läuterungen
Strauch dieses Namens. Handelt es sich vielleicht um den von Theophrastos, hist, plant. I 9, 4 erwähnten Zwerg-wacholder? Der gleiche Autor sagt hist, plant. IV j , 2, daß die Zeder auch auf den thrakischen Gebirgen und in Phrygien gedeihe.
54 Terpentinbaum, auch Terebinthe oder Terpentinpistazie, Pistacia terebinthus L. (Anacardiaceae), s. oben 12, 25. Plinius folgt hier wiederum ziemlich genau Theophrastos, hist, plant. I I I 15, 3-4. Die strauchartige Pflanze, die audi Baumhöhe erreichen kann, ist diözisch ( = zweihäusig, d. h. männliche und weibliche Individuen) und hat kleine rötliche Früchte von der Größe einer Linse. Die andere Art ist vielleicht die Echte Pistazie, Pistacia vera L., s. oben § 51. Sie ist in Syrien heimisch, wurde aber auch in anderen Ländern kultiviert. Aus der Wildform der Echten Pistazie hat man durch-Okulieren ertragreichere Pflanzen gezüchtet, wobei die Terebinthe, Pistacia terebinthus L., als Unterlage diente. - Ida, ein hohes Gebirge, das sich durch die Landschaft Troas in Mysien im nordwestlichen Kleinasien erstreckt. - Damaskus s. oben § 51. - Mücken: Es handelt sich wahrscheinlich um eine Art Blattläuse (Aphididae) und zwar aus der Gattung Pemphigus, z. B. Aphis pistaciae oder Pemphigus terebinthi, die die sog. Terebinthen-Galläpfel hervorrufen; s. H. Leitner, Zoolo-gische Terminologie beim Älteren Plinius. Hildesheim 1972, S. 105. - Das wichtigste Erzeugnis des Terpentin-baumes ist das Harz, das vor allem für medizinische Zwecke Verwendung fand, s. auch oben § 8. Es kam vor allem von der Insel Chios.
j j Sumach (rhus, von griech. rhous; die heutige Bezeich-nung von hebr. sumaq - rot), der Gerbersumach, Rhus coriaria L. (Anacardiaceae) ein buschartiger Strauch von 2-3 m Höhe mit kleinen dunkelroten Früchten. Er kommt vor allem im Mittelmeergebiet vor und liefert das für die
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n
Lederindustrie (»weiße Felle«) wichtige Tannin; vgl. Theophrastos, hist, plant. I I I 18, j und Dioskurides, mat. med. I 147. Plinius kommt nat. hist. 24, 91 f ï . nochmals auf den Sumadi zu sprechen, gibt aber dort eine etwas abweichende Beschreibung und behandelt vor allem die Verwendung für Arzneimittel (zum Abführen von Band-würmern, als Adstringens usw.). Besonders der Same fand mancherlei Anwendung; die sauren Früchte nahm man als Speisezusatz an Stelle von Salz.
5 6 f. Theophrastos, hist, plant. IV 2, 1 - 2 ; s. auch Dioskuri-des, mat. med. I 181 . - Feige, gemeint ist die Sykomore oder Eselsfeige, Ficus sycomorus L. (Moraceae). Aus dem Holz dieses Baumes stellte man in Ägypten, wo das Hauptvorkommen ist, die Sarkophage her. Die Ähnlich-keit mit dem Maulbeerbaum erwähnt auch Theophrastos, 1. c. Plinius kommt nat. hist. 23, 134 nochmals darauf zurück, s. auch Theophrastos, hist, plant. I 1 , 7; IV 1, 5, sowie Diodor I 34, 8 und Strabo, Geogr. X V I I 2, 823. -mit eisernen Nägeln: dieses, audi von Theophrastos, 1. c. erwähnte Verfahren zur Beschleunigung der Reife wird auch heute noch geübt. - Das Trocknen des Holzes, das man zunächst in Teiche legt, ist richtig beschrieben: das Wasser laugt das Holz aus, das sidi erst dann zur Ver-arbeitung eignet.
j8 zyprische Feigenbäume auf Kreta; vgl. Theophrastos, hist, plant. IV 2, 3 und Dioskurides, mat. med. I 182. Es handelt sich wohl um eine Varietät, die von J . Berendes als Ficus sycomorus var. ulmifolia bezeichnet wird, sich aber sonst im Schrifttum nicht findet. - Speierling oder Sperbe, Sorbus domesticus L. (Rosaceae), ein ziemlich hoher Baum mit gelben Früchten, die die Größe einer kleinen Zwetschge haben.
59 keronia (ceraunia, von griech. kéras - Horn), der Jo-hannisbrotbaum, Ceratonia siliqua L. (Leguminosae), ein
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

270 E r l ä u t e r u n g e n
polygam-zweihäusiger Baum mit Hülsenfrudit, der aus dem Orient stammt. Theophrastos, hist, plant. I ι ι , 2 und 14, 2, sowie IV 2, 4 nennt in Keronia. - Ionier, Bewohner der Landschaft Ionien im westlichen Kleinasien. - Knidos s. oben 12, 132. - Rhodos s. oben § 5. - behaarte Blätter: Die Beschreibung ist nicht zutreffend. Die Blätter des Jo-hannisbrotbaumes sind lederartig, glänzend, oval, in der Spitze eingekerbt; s. ro-ro-ro Pflanzenlexikon, Bd. 3, S. 751 . Die Blüte ist auch nicht weiß, sondern rot. - gelb wird (flavescens) : gemeint ist wohl das Verwelken an den oberen Teilen; daher die erwogene Konjektur flaccescens. - Auf gang des Hundssternes (Sirius): Ende Juli; s. Plinius, nat. hist. 2, 107. - Arkturus, der hellste Stern im Stern-bild des Bärenhüters (Bootes). Sein Aufgang fällt auf Ende September, sein Untergang auf Ende Mai.
60 besondere Art des Pfirsichbaumes: Theophrastos, hist, plant. IV 2, j f. und Dioskurides, mat. med. I 187 nennen diesem Baum Persea und verstehen, wie man früher an-nahm, darunter den schon § j i erwähnten Brustbeer-baum, Cordia myxa L. Neuere Untersuchungen ergaben jedoch, daß unter Persea (s. unten § 63, ferner nat. hist. 15, 45) der Baum Mimusops Sdiimperi Höchst. (Sapota-ceae) zu verstehen ist; vgl. A. Steier, R E X I X Sp. 940-944 s. v. »Persea«. - Etesien (griech. »Jahreszeitenwinde«): regelmäßig wiederkehrende Winde; sie setzen Mitte Juli zur Zeit des Siriusaufgangs ein. Plinius, nat. hist. 2, 124. 127 bietet nähere Angaben.
61 Lotosbaum s. unten §§ 104. 1 10 . - hálanos s. oben 12, 100 (myrobálanon).
62 Dumpalme (cuci, vgl. coices, griech. koikes oben § 47): Die ägyptische Dumpalme, Hyphaene thebaica (L.) Mart. (Palmae) kommt in der tropischen Zone Afrikas vor und unterscheidet sich von den anderen Palmen vor allem da-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 271
durch, daß der Stamm sich in Äste verzweigt. Auch die anderen von Plinius mitgeteilten Eigenschaften des Bau-mes sind zutreffend. Theophrastos nennt hist, plant. IV 2, 7 den Baum Kukiophoron und sagt u. a., daß die Perser aus dem Holz Bettgestelle verfertigten.
63 Dornbusch: Es ist der von Theophrastos, hist, plant. IV 2,8. 9 als Akantha bezeichnete Baum; vgl. auch Herodot II 96, ι f., der auch von der Verwendung zum Bau von Schiffsrippen spricht. Er gehört zur Gattung Akazie, von der man heute über 500 Arten kennt. Am meisten ent-spricht den Angaben des Plinius der ägyptische Schoten-dorn, Acacia arabica (Lam.) Willd. = Acacia nilotica (L.) Del. (Leguminosae).Es ist das als schwarzer Dornbusch be-zeichnete Gewächs, das eine, allerdings nicht besonders gute Sorte von Gummi arabicum liefert. Die beste Quali-tät Gummi arabicum kommt von der Senegal-Akazie, Acacia Senegal (L.) Willd. = Acacia verek. Guill. et Per-rott., die ebenfalls hier in Betracht zu ziehen ist. Die wei-ße Art ist nicht mit Sicherheit zu identifizieren: man hat an Acacia farnesiana (L.) Willd. gedacht (?) oder eher noch an Acacia Seyal Del., einen Strauch mit elfenbein-weißen Dornen. Die Akazien liefern auch Gerbstoffe, die zur Lederherstellung dienen; vgl. auch Dioskurides, mat. med. I 133. Allgemeines P. Wagler, R E I Sp. 1 1 5 9 - 1 1 6 2 s. v. »Akazie«. - Theben s. oben 12, 100. - persea s. § 60. - joo Stadien = 55,$ km (1 Stadion = i 8 j m).
64 ägyptische Pflaume (prunus Aegyptia), von Theophra-stos, hist, plant. IV 2,10 Kokkymelea genannt. Wahr-scheinlich handelt es sich um die bereits § 51 erwähnte Cordia myxa L. Die gewöhnliche Pflaume, Prunus do-mestica L., oder die Haferpflaume, Prunus insititia L., können nicht in Betracht kommen, da Plinius ausdrücklich schreibt, daß der Baum seine Blätter niât verliert. Viel-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

272 E r l ä u t e r u n g e n
leicht handelt es sich um eine Chrysobalanusart? Die Fra-ge muß offen bleiben. - Mispel: Es gibt zahlreiche Arten, wobei nicht festzustellen ist, welche Plinius meint: Mespi-lus germanica L. oder Crataegus prunifolia Pers. oder den Weißdorn, Crataegus laevigata (Poir.) DC. = Crataegus oxycantha L. Weitere Erwähnungen der Pflanze von Pli-nius, nat. hist. 14 , 103; 15,84.
65 Memphis, Stadt in Mittelägypten, Residenz der ägyp-tischen Könige; vgl. Plinius, nat. hist. 5,50. - starke Bäu-me: Theophrastos, hist, plant. IV 2, 12 schreibt nur von einem Baum, den drei Menschen nicht umspannen konn-ten. Was den anderen Baum anlangt, dessen Blätter bei der Berührung abfallen, so sagt Theophrastos, hist, plant. IV 2 , 1 1 lediglich: »Wenn jemand nun die kleinern Zweige be-rührt, so sollen die Blätter, gleichsam getrocknet, zusam-menfallen; dann nach einiger Zeit sollen sie wieder auf-leben und grünen« (K. Sprengel). Es ist die bekannte Eigenschaft mancher Mimosenarten, die hier Theophrastos und Plinius wohl im Auge haben. Am bekanntesten ist heute bei uns die Schamhafte Sinnpflanze, Mimosa pudica L. (Leguminosae), die aber erst über Südamerika zu uns kam.
66 Gummi ... vom ägyptischen Schotendorn s. oben § 63 ; vgl. Dioskurides, mat. med. I 133. - Im Gummi arabicum und im Kirschgummi kommt reichlich die Pentose L-Ara-binose vor. Der komplizierte chemische Aufbau des Gummi arabicum darf heute im wesentlichen als geklärt gelten; vgl. Handbuch der Lebensmittelchemie Bd. I, S. 460 f. — Gum-mi aus dem Bitlermandelbaum, Prunus dulcís var. amara (DC.) Buchheim = Prunus amygdalus var. amara (DC.) Focke; vgl. Dioskurides, mat. med. I 176; aus dem Kirsch-baum, der Süß- oder Vogelkirsche, Prunus avium (L.) L., bzw. der Sauer- oder Weichselkirsche, Prunus cerasus L.; vgl. Dioskurides, mat. med. I 157; aus den Pflaumenbäu-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n *73
men, vielleicht der Zwetschge, Prunus domestica L. ; vgl. Dioskurides, mat. med. I 174. Plinius erwähnt nat. hist. 15,41 die ingens . . . turba prunorum (die große Schar der Pflaumen).
Von einer gummiartigen Träne des Weinstocks, den Plinius ausführlich im 14. Buch behandelt, spricht auch Dioskurides, mat. med. V 1, der sagt, daß sie gegen Stein-leiden und gewisse Hautkrankheiten wirksam sei. - Gum-mi des ölbaums vgl. oben 12,77 und Dioskurides, mat. med. I 141 . - Berg Korykos in Kilikien: Plinius erwähnt nat. hist. 5,92 eine Stadt Korykos (Corycos) mit einem Hafen und einer Höhle (vgl. Strabo, Geogr. X I V 5,670). Als - leider mißverstandene - Quelle diente hier Plinius wiederum Theophrastos, hist, plant. I I I 14, 1 , der aber sagt, daß die Ulme »in Beutelchen (Bläschen) das Gummi und eine Art Tiere, wie Mücken« trägt (K. Sprengel). Pli-nius hat das griechische Wort für Beutelchen (kórykos) mit der gleichnamigen Stadt in Kilikien verwechselt. - Als Ulme kommt vor allem die Bergulme, Ulmus glabra Huds. (Ulmaceae) in Frage. - Von einem Gummi des Wacholders spricht auch Theophrastos, hist, plant. I X 1,2. - Mücken: Auch Dioskurides, mat. med. I 1 1 2 erwähnt mückenartige Tiere. H. Leitner, Zoologische Terminologie beim älteren Plinius. Hildesheim 1972, S. i o j f . vermutet, daß hier die Ulmen-Gallenlaus, Tetraneura ulmi Deg. = Byrsocrypta ulmi gemeint sein könnte. Diese Blattlausart ruft auf der Ulme bohnengroße Gallen hervor, »die oft leichter zu er-kennen sind als ihre Erzeuger«. - sarkokólla (sarcocolla, Zusammensetzung von griech. sarx - Fleisch und kólla -Leim): von Plinius, nat. hist. 24,128 als Träne des Dorn-strauches bezeichnet. Auch Dioskurides, mat. med. I I I 89 (99) beschreibt die Mutterpflanze nicht, so daß man auf Vermutungen angewiesen ist. Es gilt als ziemlich sicher, daß es sich um eine Art Tragant, Astragalus L. (Leguminosae),
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

*74 E r l ä u t e r u n g e n
handelt. Der auch heute noch im Handel befindliche Tra-gant (zum Namen s. § 1 1 5 ) stammt vor allem von Astra-galus gummifer Labili. Die Gattung umfaßt etwa 1600 Arten und gehört zu den größten Gattungen überhaupt im Pflanzenreich. Der Tragantgummi ist weißlich, löst sich teilweise in Wasser und quillt darin gallertartig auf. Ver-wendung in der Heilkunde (für Ärzte) s. Plinius, 1. c., für die Malerei als Bindemittel, weshalb auch der weiße, farb-lose besser ist als der rote. Lonicerus-UfFenbach schreiben in ihrem >Kräuterbuch< (Ulm 1679): »Fischleim ein Gùm-mi/Sarcocolla. Gluten carnis. Dies ist ein Gummi eines dornichten Baumes. . .« . Auch diesen Autoren war der Baum offenbar nicht näher bekannt.
68 Papyrusstaude s. die folgenden §§.
69 Papier (lat. papyrus, griech. pápyros - Papyrusstaude, dann der aus ihr gewonnene Beschreibstoff, s. unten §§ 71 ff.): Die Stelle aus M. Terentius Varrò, aus der Plinius die Nachrichten über die Erfindung des Papiers entnom-men hat, ist nicht bekannt (de bibliothecis?); vgl. Münzer S. 232. Es trifft nicht zu, daß erst durch den Sieg Alexan-ders d. Großen nach der Gründung von Alexandreia (332 v. Chr.) das Papier erfunden worden ist. Papyrus als Be-schreibstoff reicht in Ägypten bis ins 4. Jts. v. Chr. zu-rück, da schon damals die Papyrusrolle als Hieroglyphe erscheint; vgl. dazu u. a. H. Hunger Bd. I S . 33; H. Bress-lau Bd. I I S. 48 i f f . mit vorwiegend älteren Literaturan-gaben. - Palmblätter; vgl. Isidor, Orig. V I 12 , 1 . - Bast; vgl. Isidor, Orig. V I 13,3. - bleierne Schriftrollen; vgl. Pausanias I X 31,4. - Leinwand; vgl. die von Livius (IV 7, 12 ; 13,7; 20,8; 23,2; X 38,6) erwähnten »Leinwand-bücher« (libri lintei). - Wachstafeln; vgl. Isidor, Orig. V I 9,1. - Schreibtafeln s. oben § 30. Zum Material (Ahorn) vgl. Plinius, nat. hist. 16,68; 33,12, s. auch Isidor, Orig.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 275
V I 8,18. - Homer, II. V I 168 f., eine berühmte Stelle, die in der Kontroverse über das Alter der griechischen Schrift eine wichtige Rolle gespielt hat. Proitos, König von Argos, schickt den Bellerophon mit »verderblichen Zeichen . . . ge-ritzt auf gefaltetem Täflein« (H. Rupé) zu seinem Schwie-gervater nach Lykien. - Ägypten: Plinius spielt hier auf Homer, Od. IV 3 54 ff. an, wonach die Insel Pharos eine Tagereise von der ägyptischen Küste entfernt war; vgl. Plinius, nat. hist. 2, 201 ; 25, 1 1 und Münzer S. 152. Das Nildelta als Heimat der Papyrustaude hatte sich angeb-lich noch gar nicht gebildet. Es umfaßt heute eine Fläche von etwa 24 000 km2 und ist in prähistorischer Zeit ent-standen. - Gau (nomós) von Sebennytos, h. Sammanud, im Nildelta; vgl. Plinius, nat. hist. 5, 49. - Gau von Sais, h. Sa el-Hagar, einer der ältesten und bekanntesten Städte Unterägyptens im westlichen Nildelta; vgl. Plinius, nat. hits. 5, 64. Zum Ganzen vgl. auch K . Dziatzko, T. Birt, K . Preisendanz und E. Pais.
Insel Pharos s. § 69. - Erfindung des Pergaments: Nach Varrò soll dieser wichtige Beschreibstoff durò den Wett-eifer der Könige Ptolemaios (V. Epiphanes, 204-181 v. Chr.) und des Attaliden Eumenes (II., geb. vor 221 , re-gierte 197-159 v. Chr.) erfunden worden sein; vgl. auch Isidor, Orig. V I 1 1 , 1 . Der Name Pergament kommt von Pergamon, h. Bergama, der Residenzstadt des von den Attaliden regierten Pergamenischen Reiches im westl. Kleinasien. Die Verwendung von Tierhäuten als Beschreib-stoff ist im Orient seit altersher bezeugt. In Pergamon dürfte die Herstellungsweise verfeinert worden sein und es ist nicht ausgeschlossen, daß das Pergament noch etwas älter ist als von Plinius angegeben. Pergament unterschei-det sich vom Leder dadurch, daß die Häute (von Kalb, Schaf, Ziege, Esel) nicht gegerbt, sondern nur in einer Kalklösung behandelt werden. Über die ältesten erhalte-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

2 76 E r l ä u t e r u n g e n
nen beschrifteten Pergamentstücke s. H. Hunger Bd. I S. 35 f·
7 1 -73 Papyrusstaude: Plinius folgt hier mit einigen Abwei-chungen seiner Quelle Theophrastos, hist, plant. IV 8,3-4; dort heißt es ζ. B.: » . . . die Wurzel ist so dick als die Handwurzel eines starken Mannes« (K. Sprengel), wäh-rend Plinius von der Dicke eines Armes spricht. Vgl. auch Strabo, Geogr. X V I I 1,799 f. u n d Dioskurides, mat. med. I 1 1 5 . Die Papyrusstaude, Cyperus papyrus L. (Cypera-ceae), wächst an sumpfigen Stellen, wird bis zu j m hoch, hat dreieckige Stengel und einen großen Blütenstand. Die Pflanze kommt im tropischen Afrika, in Syrien und in Pa-lästina wild, aus Ägypten, wo sie einst eine so wichtige Rolle spielte, ist sie heute fast verschwunden. Audi auf Sizilien gibt es einen Papyrus, Cyperus papyrus var. syra-cusanus, der aber vom afrikanischen etwas abweicht; er ist vielleicht dort von den Arabern eingeführt worden. -Thyrsosstab, ein mit Weinlaub umwundener Stab mit einem Efeubüschel oder einem Pinienzapfen an der Spitze, der im Dionysoskult eine wichtige Funktion erfüllte. -wohlriechender Kalmus s. oben 12,104. — König Anti-gonos (Monóphthalmos, etwa 382-301 v. Chr.), einer der Feldherrn Alexanders d. Großen, nach dessen Tod Herrscher von Großphrygien; er fiel 301 v. Chr. in der Schlacht von Ipsos gegen eine Koalition der anderen Dia-dochen. - Pfriemengras (spartum), Stipa tenacissima L. (Gramineae), von Plinius mehrfach erwähnt und nat. hist. 19,26ff. ausführlicher behandelt. - Parther s. oben § 18. — Über die vielseitige Verwendung der Papyrusstaude, z. B. zum Flechten von Booten usw. vgl. Plinius, nat. hist. 6,82; die Anfertigung von Segeln erwähnt schon Herodot II 96>3.
74 Leider haben wir keine Kenntnis von der Quelle des Plinius, dessen im großen und ganzen zutreffende Be-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 277
Schreibung der Papyrusherstellung von so außerordent-licher Wichtigkeit ist. Zur Literatur: W. Schubart, R E X V I I I Sp. 1 1 1 6 - 1 1 1 8 s. v. »Papyrus« und H. Hunger Bd. I S. 146 f. - Häute (philyrae): ursprünglich der Lin-denbast, den man zu Schreibblättern verwendete, später dann die einzelnen Streifen der Papyrusstaude. - Man kannte viele Papyrussorten: die beste war das hieratische (von griech. hierós - heilig) Papier, auch charta regia ge-nannt; später nach Kaiser Augustus benannt. Die nächst-beste Sorte wurde nach Livia, der Gemahlin des Augustus, bezeichnet.
75 amphitheatrisches Papier: wahrscheinlich so genannt, weil es in der Nähe des Amphitheaters zu Alexandreia hergestellt wurde. - Fannius, nicht näher bekannter Pa-pierhersteller (charta Fanniana); s. auch § 78.
76 saitisches Papier = Papier aus Sais, s. § 69. - taeneoti-sches Papier: gemeint ist wohl das Papier aus Tanis, h. San el-Hagar, einer Stadt im Nordostdelta des Nils; vgl. Plinius, nat. hist. $,49. - emporitisches Papier: ein grobes Packpapier, das von den Kaufleuten (griech. émporoi) ver-wendet wurde; s. audi § 78. Zu den verschiedenen Papier-sorten vgl. auch Isidor, Orig. VI 10, 2-5, s. dazu J . Sola; zum Ganzen vgl. R. Wünsch, R E I I I Sp. 2 185-2192 s. v. »charta«.
77 Rolle (scapus), eigentlich der Zylinder bzw. Holzstab, um den der Papyrus gewickelt wurde, dann die Papyrus-rolle als solche. - zwanzig Bogen ist nicht das Höchstaus-maß der zusammengeklebten Blätter, sondern »vermutlich ein Fabrikmaß zur Berechnung der Kosten des unbeschrie-benen Papyrus, der in Ballen verkauft wurde« (H. Hun-ger Bd. I S. 31).
78 Breite: eine Fingerbreite entspricht Vie Fuß = etwa 18,5 mm. Die Breite der Papyrusrolle lag meist bei 25 bis 30 cm, es gab aber auch Ausnahmen von 15-40 cm. Die
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

278 E r l ä u t e r u n g e n
Länge schwankte zwischen 6 - 10 m, wobei aber audi we-sentlich längere Rollen vorkamen. - dem Hammer nicht genügt: Die beiden Schichten (s. unten § 79) aus den Pa-pyrusstreifen wurden »mit einem Fauststein oder Holz-hammer so lange geklopft und gepreßt, bis sie zu einem zusammenhängenden elastischen Blatt geworden waren« (H. Hunger 1. c.). Oben § 77 schreibt Plinius aber auch von einer Presse.
79 Kaiser Claudius regierte von 41-54 n. Chr. - Bei der Papyrusrolle lagen die Horizontalfasern innen, die Verti-kalfasern außen. Geschrieben wurde in erster Linie auf der Innenseite (recto), doch audi die Außenseite (verso) wurde nicht selten beschrieben, um das kostbare Material möglichst wirtschaftlich auszunützen. Plinius d. J . be-richtet Epist. I I I 5,17, daß ihm sein Oheim 160 Hefte mit Auszügen hinterlassen habe, »und zwar zweiseitig ganz eng beschrieben« (H. Kasten). - >Kette< (statumen = Grundlage) und >Einschlag< (subtemen) : Bezeichnungen aus dem Sprachschatz der Weberei, wobei aber zu berücksichti-gen ist, daß die Papyrusstreifen rechtwinklig aufeinander gelegt, aber nicht geflochten wurden. - 1 Fuß = etwa 30 cm.
80 Großpapier (macrocollum) ; vgl. Cicero, ad Att. X I I I 25,3 und X V I 3,1. - ι Elle = etwa 45 cm. - Seiten (pa-ginae): das einzelne Papyrusblatt hieß bei den Griechen ursprünglich byblos (biblos); später wurde diese Bezeich-nung auf die ganze Rolle übertragen. Man schrieb in gleichmäßigen Spalten ( = Kolumnen, selides) auf der In-nenseite (recto s. § 79) der Rolle, wobei aber die Klebe-stellen auch oft überschrieben wurden. So erklärt sich viel-leicht der etwas unklare Satz des Plinius, daß beim Ab-reißen eines Streifens mehrere Seite beschädigt wurden. Zu den anderen Papiersorten s. § 74 ff.
81 Zahn: vielleicht aus Elfenbein oder der Hauer eines Wildschweins. - Muschel: vielleicht von der Perlmuschel,
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 279
deren Schalen eine sehr glatte Oberfläche haben. - Feuch-tigkeit s. § 77. - Hammer s. § 78 - Geruch: enthält das Papier zu viel Feuchtigkeit, so kann es unter dem Einfluß von Bakterien einen unangenehmen Geruch bekommen. Auch die linsenförmigen Flecken (sog. Stockflecken) haben die gleiche Ursache. Sie treten vor allem auf, wenn das Papier zu feucht gelagert wurde.
82 Kleister: Der Stärkekleister (aus Mehl) verdirbt be-kanntlich sehr rasch, da er für Schimmelpilze einen ge-radezu idealen Nährboden bildet. - Leim der Werkleute — Tischlerleim. - Hammer s. § 78.
83 Tiberius und Gaius Gracchus: beide Brüder bemühten sich um eine Agrarreform, kamen aber beide gewaltsam ums Leben: Tiberius Sempronius Gracchus im Jahre 132 v. Chr. durdi P. Cornelius Scipio Nasica, Gaius Sempro-nius Gracchus 122 v. Chr., als er sich von einem Sklaven töten ließ, um seinen Gegnern zuvorzukommen. - P. (CalvP)isius Sabinus Pomponius Secundus, cos. suff. 44 n. Chr., Tragödiendichter und Freund des Plinius, der ihn nat. hist. 7,39 als >Siebenmonatskind< erwähnt; s. auch nat. hist. 7,80; 14,56. - Handschriften Ciceros s. Münzer S. 94 Anm. ι .
84 M. Terentius Varrò s. § 69. - Cassius Hemina H R R frg. 37; vgl. Münzer S. 185. 187. 226. Er wird von Pli-nius noch mehrmals erwähnt, z. B. nat. hist. 18,7; 29,12; 32,20. - Cn. Terentius: Dieser als Schreiber bezeichnete Mann fand im Jahre 181 v. Chr. beim Umgraben seines Ackers auf dem laniculum ( = Höhenzug auf dem rechten Tiberufer, h. Gianicolo, wo der Sage nach eine von Ianus erbaute Burg gestanden haben soll) den Sarg des Numa Pompilius, des sagenhaften zweiten Königs von Rom. Die-se Erzählung, allerdings etwas verändert, findet sich audi bei Livius X L 29,3 ff.; Valerius Maximus, Memor. I 1 , 12 ; und Augustinus, de civit. Dei V I I 34 (nach Varrò). Die
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

28ο E r l ä u t e r u n g e n
Nachricht von der angeblichen Auffindung der Schriften geht nach Plutarch, Numa 22 auf Valerius Antias zu-rück, s. unten § 87; vgl. Münzer S. 144.
8 5 f. P. Cornelius Cethegus, Sohn des Lucius, und M. Bae-bius Tamphilus, Sohn des Quintus, waren Konsuln im Jahre 181 v. Chr. ( = im Jahre 573 der Stadt, Plinius sagt: j j j Jahre nach der Regierung Numas. Danach hätte diese i. J. 38 der Stadt ( = 716 V. Chr.) ihr Ende gefunden. Diese Daten sind fragwürdig). Man hat Numa gern mit Pythagoras (6. Jhdt. v. Chr.) in Verbindung gebracht und wollte in ihm einen Philosophenkönig sehen. Die angeb-liche Auffindung von philosophischen Schriften hätte viel-leicht eine Anerkennung der griechischen Philosophie in Rom auf Grund der Autorität Numas oder eine Reform der römischen Religion nach pythagoreischem Vorbild zum Ziele haben sollen. Gegen diese Absichten wurde aber schon sehr früh aus nationalen Ressentiments polemisiert; vgl. dazu K . Glaser, RE X V I I Sp. 1242-1252 s. v. »Nu-ma« Nr. ι . Zu den Quellen s. Münzer S. 70 und 144.
86 Wachsschnüre (candelae); auch von Livius X L 29,6 er-wähnt. - Zitrusblätter: Gemeint ist hier wohl der assyri-sche Apfelbaum, Citrus medica L., den Plinius, nat. hist. 12,1$ f. behandelt hat und dessen Blätter anscheinend eine gewisse insektizide Wirkung haben. Nicht auszu-schließen ist allerdings auch der Zitrusbaum s. § 91. -Q. Petilius Spurinus, Praetor urbanus 181 v. Chr. Die Verbrennung erfolgte wohl, weil diese philosophischen Schriften der herrschenden Religion gefährlich werden konnten; s. auch oben § 85.
87 Zensor Piso = L. Calpurnius Piso Frugi H R R frg. 11; s. Münzer S. 220 f. - C. Sempronius Tuditanus H R R frg. 3. - M. Terentius Varrò (116-27 ν · Chr.): Sein bis auf wenige Fragmente verlorenes Werk »Antiquitates rerum humanarum et divinarum« behandelte in 41 Büdiern in
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 28!
enzyklopädischer Weise Fragen der römischen Kultur-geschichte; hier frg. 3 Mirsch. - L. Valerius Antias H R R frg. 8 und 15 ; s. Münzer S. 180 Anm. 1.
88 Sibylle: Bezeichnung für eine Frau, die in ekstatischer Verzückung meist Unheil vorhersagt. Unter den drei, vier oder auch zehn Sibyllen, welche die Alten kannten, war die Sibylle von Cumae (Kyme) in Unteritalien für die Römer von besonderer Bedeutung; vgl. Plinius, nat. hist. 34,22. 29. - Tarquinius Superbus, der siebente und letzte sagenhafte König von Rom. Seine Begegnung mit der Si-bylle schildern auch A. Gellius, Noct. Att. I 19, 1 - 1 1 und Dionysios Hal. IV 62 (allerdings ist dort von neun Bü-chern die Rede, von denen sechs von der Sibylle selbst ver-brannt wurden). - Der Brand des Kapitals unter Sulla er-folgte im Jahre 83 v. Chr. Hierauf stellte man eine neue Sammlung sibyllinischer Weissagungen zusammen, die Kaiser Augustus 12 ν. Chr. in den Apollotempel auf dem Palatin bringen ließ. Sie wurden in der Kaiserzeit oft be-fragt, bis man sie auf Befehl des Feldherrn Stilicho, eines Vandalen, 408 n.Chr. vernichtete.Zum Ganzen vgl. Mün-zer S. 127. - C. Licinius Mucianus H R R frg. 22; s. Mün-zer S. 393. - Lykien s. oben 12,9. - Sarpedon, Sohn des Zeus und der Laodameia; vgl. Homer, II. VI , 198 f. An-führer der Lykier im Trojanischen Krieg, von Patroklos getötet. - Homer, Od. IV 3 j 4-4 5 7. - Ägypten s. oben § 69. - bleierne Tafeln wurden für literarische Zwecke nur sehr selten und ausnahmsweise verwendet. Kleine Blei-täfelchen wurden für »kurze Aufzeichnungen, deren län-gere Dauer gesichert werden sollte, gebraucht«, ζ. B. für Verwünschungen; vgl. Tacitus, Ann. II 69,3. Es scheint sich also um eine zur Zeit des Plinius bekannte Tatsache zu handeln; vgl. dazu K. Dziatzko, R E I I I Sp. 564 fî . s. v. »Bleitafeln«. - leinene Rollen s. oben § 69. - Homer, II. V I 168 f. - Bellerophon s. oben § 69.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n
89 Tiberius, römischer Kaiser 14-37 η. Chr. Ausgezeichneter Soldat, begabter Herrscher, jedoch am Ende seines Lebens menschenscheu und furchtsam. In seiner Finanzpolitik legte er Wert auf äußerste Sparsamkeit, auf die sich offen-bar auch der hier genannte Erlaß über die Verteilung von Papier in Zeiten des Mangels bezieht.
90 Äthiopien: Die Äthiopier, ursprünglich im Mythos ein Volk am Rande der Welt; vgl. Homer, Od. I 22, wurden später als dunkelhäutige Menschen in Afrika lokalisiert, u. a. jenseits von Ägypten. - Unter dem Leinen tragenden Baum ist hier die Baumwolle gemeint, s. oben 12,38 f.; vgl. auch Plinius, nat. hist. 6,54. - Palmen s. oben i2 ,36f . - Inseln im Umkreis Äthiopiens s. oben 12,38; vgl. auch Plinius, nat. hist. 6,198.
91 Berg Atlas: Hohe Gebirgskette, die Nordafrika (Mau-retanien) von Ost nach West durchzieht; vgl. Plinius, nat. hist. 5,5 ff., bes. 5,14: Bericht des Suetonius Paulinus, der als erster Römer 42 n. Chr. den Atlas mit einem Heer durchquerte; vgl. dazu R. Hennig, Terrae incognitae. 2. Aufl., Bd. ι , Leiden 1944, S. 344 ff. Er erzählt von Wäl-dern mit zypressenartigen Bäumen, deren stark riechende Blätter mit einer dünnen Wolle bedeckt sind, aus der man Kleider macht. Hier dürfte es sich aber wohl um einen Irr-tum handeln, denn die Wälder bildenden Bäume des At-lasgebirges sind die Zedern, Cedrus atlantica (Endl.) Ma-netti ex Carr., die Atlas- oder Silberzeder (Pinaceae). Die Zedernwälder erstrecken sich dort bis weit über 1000 m Höhe, die einzelnen Bäume werden bis zu 40 m hoch. Bei der »dünnen Wolle«, von der Plinius 1. c. spricht, kann es sich nur um eine Art Flechte handeln; die sonst blaugrünen Nadeln haben bei der Varietät glauca ein silbergraues Aussehen und können zu dem Irrtum beigetragen haben. -Land der Mauren = Mauretanien in Nordafrika; vgl. Pli-nius, nat. hist. j ,2Í f . - Zitrusbaum (citrus zu griech. ké-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Er läuterungen 283
dros s. § 52f.): gemeint ist der Sandarakbaum, Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast. = Callitris quadrivalvis Vent. = Thuja articulata Vahl (Cupressaceae). Nicht zu ver-wechseln mit Citrus medica L., der Zitronatzitrone; vgl. dazu oben § 86 und 12,15 f. - Tischmöbel; vgl. Strabo, Geogr. X V I I 3,826 und Seneca, de benef. VI I 9,2, sowie Lucan, Phars. X 144 f. und Martial X I V 89. Zum Ganzen s. J . Olck, R E III Sp. 2621-2624 s. v. »Citrus«; gr. Kruse, RE X V Sp. 937-948 s. v. »Mensa« und H. Reincke, R E Suppl. VI Sp. 497-508 s. v. »Möbel«; vgl. auch Münzer S . 3 9 i f .
92 M. Tullius Cicero, der berühmte Redner (106-43 v · Chr.). - ¡00000 Sesterzen = etwa 100000 Goldmark; vgl. Tertullian, de pallio 5,5. - C. Asinius Gallus, geb. 41 v. Chr. als ältester Sohn des C. Asinius Pollio. Von Augu-stus begünstigt (Konsul 8 v. Chr.), von Tiberius aber we-gen seiner Beziehungen zu Seianus zum Tode verurteilt, starb er 33 n. Chr. den Hungertod. Er hat sich auch als Schriftsteller und Redner betätigt. - König Iuba. (II.); der von Plinius als Quellenschriftsteller vielfach benutzte Kö-nig von Mauretanien (25 V.-23 n. Chr.). - 1200000 Se-sterzen = etwa 240000 Goldmark. - Cetheger (Cethegi): alte römische Familie, deren bekanntester Vertreter C. Cornelius Cethegus, ein Anhänger Catilinas war. Er wur-de am 5. Dezember 63 v. Chr. auf Ciceros Befehl hinge-richtet. - ι joo 000 Sesterzen = etwa 260 000 Goldmark.
93 Ptolemaios, König von Mauretanien (23-40 n. Chr.), Sohn des oben § 92 genannten Iuba und der Kleopatra Se-lene, der Tochter der Kleopatra VII . von Ägypten und des Marcus Antonius. - 41!t Fuß Durchmesser = 1,35 m; 1lt Fuß Dicke = 7,5 cm. - Nomius, ein sonst nicht weiter bekannter Freigelassener des Kaisers Tiberius. - 4 Fuß = 120 cm; 3U Zoll weniger (tribus sicilicis infra): Vi Zoll = V « Fuß = 0,625 cm> demnach 3/i Zoll = 1,875 cm.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

284 E r l ä u t e r u n g e n
Offenbar handelt es sich hier um einen runden Tisch mit einem Durchmesser von 1,18 m und einer Dicke von 28 cm - vorausgesetzt, daß die Angaben von Plinius' stimmen.
94 Kaiser Tiberius s. oben § 89. - ein Sechstel und ein Viertel Zoll mehr ais vier Fuß = etwa 1,21 m; anderthalb Zoll dick = etwa 3,7 cm. Hier ist wohl ein Tisch mit Fur-nierholz gemeint; s. auch Plinius, nat. hist. 16,231 .
9 j Daß das Holz des Zitrusbaumes den höchsten Preis hatte, berichtet Plinius, nat. hist. 37,204. - Fehler an den Bäumen; vgl. dazu Seneca, de benef. V I I 9,2. - der wilden Zypresse ähnlich: Diese Bemerkung geht wohl auf Theo-phrastos, hist, plant. V 3,7 zurück; die Ähnlichkeit besteht tatsächlich. Über die verschiedenen Formen der Zypresse berichtet Plinius, nat. hist. 16,139 ff. - Ancorarius, ein Ge-birgszug in der Provinz Mauretania Caesariensis ( = Mau-retania citerior) in der Nähe des castellum Tigavitanum; vgl. Ammianus Marcellinus X X I X 5,25.
96 getigert ... pantherartig: die Zeichnung des Tigers ist gestreift, die des Panthers gefleckt. - Augen der Pfauen-federn: Martial X I V 85 spricht von einem lectus pavoni-nus, einer Lagerstätte mit einem Muster, das den Pfauen-augen ähnlich ist.
97 getüpfelt (apiatae): wie der Eppidi, Apium graveolens L., oder die Petersilie, Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill, deren Blätter gekräuselt sind. - Met, der seinen Wein durchschimmern läßt: Der Sinn dieses Satzes ist nicht klar. Vielleicht ist die Farbe des Metes, der sich zum Wein geklärt hat, gemeint. Es gibt audi die Lesart venis statt vinis (nach Hardouin), womit dann die in den Adern (venae) hervorschimmernde Metfarbe gemeint sein könnte.
98 Muräne: Im Mittelmeer kommt die gefleckte Muräne, Muraena helena, und die einfarbige (braungefärbte) Mu-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n î8Î
raena diristini vor, an die hier Plinius offenbar gedacht hat.
Uber die verschiedenen Methoden der Holztrocknung läßt sich nur folgendes sagen: durch das Eingraben der grünen Stämme in die Erde ist wohl eine gewisse Trock-nung möglich, besonders wenn es sich um heißen Sand han-delt. Der Wachsüberzug soll offenbar gegen eine Fäulnis im Boden schützen, würde dann aber eine Trocknung un-möglich machen bzw. sehr erschweren. Eine gewisse Trock-nung durch Einlegen in Getreidehaufen ist durchaus denk-bar. Über die Austrocknung durch Lagerung in Meer-wasser s. oben § 57. - gleichsam für sie hergestellt: weil man auf diesen Tischen den Wein kredenzt.
thy on und thy a (zu griech. thyein - räuchern); vgl. Theophrastos, hist, plant. V 3,7. - Bei dem Zitat aus Ho-mer ist Plinius ein Fehler unterlaufen: Od. V 59-61 er-zählt Homer nicht von der Insel der Kirke, sondern von der der Kalypso. Vielleicht liegt auch eine Verwechslung mit Vergil, Aen. V I I 1 0 - 1 3 vor: próxima Circaeae raduntur litora terrae,
tectisque superbis urit odoratam nocturna in lumina cedrum gleich am Strande von Kirkes Land hin streifen die Schiffe
und im stolzen Palaste [Leuchten
duftendes Zedernholz aufbrennen läßt als nächtliche (J. Gölte)
Lärche, Larix decidua Mill. = Larix europaea DC. Plinius hat offenbar das homerische kédros = Zeder mit larix = Lärche übersetzt. Es muß jedoch beachtet werden, daß die Lärche sowohl im Altertum als auch heute noch in Griechenland unbekannt ist und erst im 18. Jhdt. aus den Alpen und Karpathen, wo sie heimisch ist, verpflanzt wurde. Sie wird von Plinius noch ausführlich nat. hist. 16,
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

28 6 E r l ä u t e r u n g e n
43 ff. behandelt. Allgemeines bei R. Stadler, R E X I I Sp. 422 f . s. v. »Lärdie«.
101 f . Theophrastos, hist, plant. V 3,7. Er lebte von etwa 370 bis 287 v. Chr.; s. Münzer S. 339. Weitere Erwähnungen Plinius, nat. hist. 15 , 1 ; 16,144; I9>32· - Hammontempel: das Orakel des Gottes Ammon, das Ammoneion, in der Oase Siwa in der libyschen Wüste; vgl. oben 12, 107. -Kyrenaika, s. oben 12, 108.
103 Obwohl Plinius den Baum nicht benennt, kann man mit Sicherheit sagen, daß die Zitronatzitrone, Citrus medica var. limonum (Risso) Wight et Arn. (Rutaceae) gemeint ist, die bereits oben 12,1 5 f. und 13,86 Erwähnung fand. Sie darf nicht verwechselt werden - wie das leider in der Antike öfters geschah - mit dem oben § 91 genannten Zi-trusbaum. Die wohl aus Ostindien stammende Pflanze ist der Zitrone sehr ähnlich und hat sehr große, längliche Früchte. Sie wird heute ebenfalls in den Mittelmeerlän-dern angebaut, erfordert aber ein sehr warmes Klima.
104 f. Lotosbaum (celthis): Die Bezeichnung Lotos (lat. lotus, griech. lotós und lotón vgl. hebr. lot) ist im antiken Schrifttum vieldeutig. Man versteht darunter Vertreter verschiedener Pflanzenfamilien und zwar ι . Seerosen, 2. den Judendorn und 3. den Steinklee (meli-lotus). Hier meiot Plinius offenbar den Judendorn oder die Jujube, Ziziphus jujuba Mill. bzw. die Wilde Jujube, Zizi-phus lotus (L.) Lam. (Rhamnaceae). Die Pflanze ist im Orient und in Nordafrika heimisch und ähnelt mehr einem Strauche als einem Baum. Die gelblich-roten runden Früchte dienen als Nahrungsmittel. Quelle für Plinius ist wieder-um Theophrastos, hist, plant. IV 3 , 1 -3 . Beide Autoren sind jedoch in der Beschreibung nicht korrekt und über-tragen, wohl wegen der Ähnlichkeit der Früchte, die Eigenschaften zweier anderer Bäume auf den Judendorn. Es handelt sich um den Zürgelbaum, Celtis australis L.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 287
(Ulmaceae) und die Lotus- oder Dattelpflaume, Dios-pyros lotus L. (Ebenaceae). Das nur von Plinius gebrauch-te, wohl afrikanische Wort celt(h)is, bezieht sich sicherlich auf den Zürgelbaum, dessen Früchte im Spätherbst reifen und eine violett-schwarze Färbung annehmen. Diesen Baum meint wohl auch Dioskurides, mat. med. I 1 7 1 . Die Dattelpflaume hat eine kirschenartige gelbliche Frucht, die ebenfalls genossen wird; s. Plinius, nat. hist. 16,123 f. -
Syrien: Die Große Syrte, h. Golf von Bengasi, und die Kleine Syrte, h. Golf von Gabes, zwei Buchten an der Nordküste Afrikas. - Nasamonen, ein mächtiges Volk Nordafrikas, zu den libyschen Hamiten gehörend; vgl. Plinius, nat. hist. 5,33. - Cornelius Nepos H R R frg. 20; s. Münzer S. 414 Anm. 1. - Homer, Od. I X 84 ff. berichtet von den Lotophagen, einem Märchenvolk, das sich von der »lieblichen Frucht des Lotos« genährt haben soll; vgl. Pli-nius, nat. hist. 5,28. Wer die Lotosfrucht genießt, soll »die Heimat vergessen«: sicherlich kommt hier nicht die Frucht, sondern ein aus ihr gewonnenes alkoholisches Getränk mit berauschender Wirkung in Betracht. Zum Ganzen vgl. A. Steier, R E X I I I Sp. 1 5 1 5 - 1 5 3 2 s. v. »Lotos« Nr. 2 und H. Lamer, Ebd. Sp. 1 507- 15 14 s. v. »Lotophagen«.
106 Frucht ohne Kern: gemeint ist wohl die schon oben §§ 104 f. erwähnte Wilde Jujube, Ziziphus lotus (L.) Lam., deren Früchte die Größe einer kleinen Nuß haben und einen sehr kleinen Kern besitzen. - mostähnlicher Wein; vgl. Herodot IV 177 und Polybios X I I 2,8 bei Athenaios, Deipnosoph. X I V p. 651 DE. - Cornelius Nepos H R R frg. 20. - Speltgraupen (alica): eine Art Grütze wohl aus dem Emmer, Triticum dicoccon Schrank (Gramineae) be-reitet. - Kriegsheere: Theophrastos, hist, plant. IV 3,2 er-wähnt den Makedonen Ophelias, der nach der Erobe-rung von Kyrene Statthalter der Kyrenaika wurde und mit Agathokles von Syrakus ein Bündnis gegen Karthago
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

288 E r l ä u t e r u n g e n
Schloß (309 v. Chr.). Sein Heer soll sich von dieser Frucht genährt haben. - Das Holz hat eine schwarze Farbe; vgl. Theophrastos, hist, plant. IV 3,3. Diese Bemerkung kann sich nicht auf den Zürgelbaum, sondern auf die Dattel-pflaume, Diospyros lotos L., beziehen, deren Holz grau-grünlich und sehr hart ist. Es eignet sich deshalb gut für die Herstellung von kleinen Gebrauchsgegenständen und von Musikinstrumenten (Flöten).
107 Kraut: hier ist wohl an die Futterpflanze Lotos, vor allem an verschiedene Kleearten, z. B. Melilotus albus Medik. oder Melilotus officinalis (L.) Pali., den Honig- oder Steinklee, zu denken; auch Trifolium- oder Trigonella-Arten kommen in Betracht, z. B. der Weißklee, Trifolium repens L., der Erdbeerklee, Trifolium fragiferum L., der Bisamklee, Trigonella coerulea (L.) Ser. (Leguminosae) usw. - Sumpfpflanze = die indische Lotosblume, Nelumbo nucífera Gaertn. = Nelumbo speciosum Willd. (Nym-phaeaceae), die heute aus Ägypten fast ganz verschwunden ist. Theophrastos, hist, plant. IV 8,7 f. nennt die Pflanze »ägyptische Bohne«, ebenso auch Dioskurides, mat. med. I I 128; vgl. auch Herodot II 92,2 f., Diodor I 34,6 und Plinius, nat. hist. 18 , 12 1 . Der indische Lotos zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß seine rosafarbenen Blüten und die Blätter an Stengeln aus dem Wasser emporragen. Die ägyptische Lotosblume, Nymphaea lotus L., wird von Theophrastos, hist, plant. IV 8,9-11 eingehend beschrie-ben, vgl. auch Dioskurides, mat. med. IV 1 1 2 (114). Ihre Blüte ist weiß bzw. blau bei Nymphaea caerulea Sav. Pli-nius unterscheidet nicht scharf zwischen Nelumbo und Nymphaea. Die zahlreichen bildlichen Darstellung der Lo-tospflanze in der ägyptischen Kunst beziehen sich nur auf die weiße oder blaue Lotosblume.
108 Theophrastos, hist, plant. IV 8 , 1 1 . - Es ist richtig, daß sich die Blüten der Seerose am Abend schließen und bei
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 289
Sonnenaufgang wieder öffnen. Es gibt aber audi See-rosenarten, deren Blüte sich erst am Abend öffnet und am Morgen wieder schließt, da sie zu ihrer Befruchtung die Nachtschmetterlinge benötigen. Zu dieser Art gehört die in größeren Gewächshäusern hin und wieder kultivierte Victoria regia oder amazónica (Poepp.) Sowerby (Nym-phaeaceae), die aber erst 1801 entdeckt wurde.
109 f . Beim Lotus vom Euphrat handelt es sich um die schon § 107 erwähnte Indische Lotosblume, Nelumbo nucifer Gaertn., auch »ägyptische Bohne« oder »Heiliger Lotos der Inder« genannt; vgl. Theophrastos, hist, plant. IV 8,7 f. 10 f.
m Kyrenaika s. oben 12, 108. - paliurus (nach der Stadt Paliouros auf Kreta?); vgl. Theophrastos, hist, plant. IV 3,2-4. Es handelt sich offenbar um die in den §§ 104/105 bzw. 106 erwähnten beiden Jujubearten. Man hat auch an den Christdorn, Paliurus spina-christi Mill. (Rhamnaceae) gedacht (vgl. Theophrastos, hist, plant I I I 18,3), einen in Südeuropa und Westasien vorkommenden Strauch mit trockenen Steinfrüchten und spitzen Dornen. Eine genaue Entscheidung läßt sich kaum treffen. - Garamanten: in den Oasen der östlichen Sahara wohnende Stämme, vgl. Plinius, nat. hist. $,26. 38. - Hammontempel s. oben § i o i f .
1 1 2 f. Granatapfel, Punica granatum L. (Punicaceae) hat mit dem Apfel nichts zu tun, sondern steht in naher Ver-wandtschaft zur Familie der Myrtengewächse. Der Baum wird einige Meter hoch, hat leuchtend rote Blüten und trägt Früchte von der Größe einer Orange. In ihrem In-nern befinden sich in drei Kammern zahlreiche, rosa-farbene, eßbare Samen von säuerlichem Geschmack (daher die lat. Bezeichnung malum granatum = kernreicher Ap-fel von lat. granum - Korn, Kern). Die ursprüngliche Hei-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

290 E r l ä u t e r u n g e n
mat des Granatapfelbaumes scheint Persien zu sein; seine weite Verbreitung schon im frühen Altertum ist mannig-fach bezeugt, ζ. B. Homer, Od. V I I 1 1 5 , X I 589. Es gibt mehrere Arten des Baumes: Unter <kernlos> (griech. apy-renon) ist eine Sorte zu verstehen, deren Samenkörner sehr weich waren und ebenfalls mitgegessen werden konn-ten; vgl. dazu Seneca, Epist. 85,5 und Martial X I I I 42f . Plinius spricht nat. hist. 23,106 von neun Granatapfel-sorten. Es sind dies zunächst die fünf Arten: süße, herbe, sauersüße, saure und weinartige, die gemeinsame Kerne haben. Dazu kommen die beiden Arten von Samos und Ägypten mit roter und weißer Blüte (damit ist nach A. Steier der rote bzw. weißliche flaumartige Anflug - eine Wachsschicht - der Früchte gemeint). Es folgt die bittere Art und als neunte Sorte die kernlose (s. 0.). - balaústion (balaustium): Dioskurides, mat. med. I 154 bezeichnet die »Blüte des wilden Granatbaumes« (J. Berendes) als Ba-laústion, während er mat. med. I 152 die Blüten des kulti-vierten Baumes Kytinoi nennt (analog cytinus bei Plinius, nat. hist. 23,110). Die Anwendung für Arzneien ergibt sich aus der adstringierenden Wirkung, die Dioskurides be-sonders hervorhebt; s. auch Plinius, nat. hist. 23 , 1 12 . Der in den Blüten vorhandene Farbstoff wurde zum Färben von Kleiderstoffen verwendet. In der Rinde des Stammes und in der Wurzel des Granatbaumes finden sich mehrere Alkaloide (Pseudopelletierin, Pelletierin, Isopelletierin und Methylpelletierin), die für den Warmblüter ziemlich toxisch sind. Eine Abkochung der Rinde dient seit alters-her als Mittel gegen Bandwürmer; vgl. Dioskurides, mat. med. I 153. Zum Ganzen s. A. Steier, R E X I V Sp. 928 bis 942 s. v. »Malum Punicum (Granatapfelbaum)« und Hehn S. 240 fr. - acini heißt eigentlich >Beeren<. Plinius meint jedoch die Samenkerne mit ihrer Umhüllung; vgl. A. Steier, 1. c. Sp. 934.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Er läuterungen 291
1 14 epikaktís (epicactis): Dioskurides, mat. med. IV 107 (109) erwähnt einen kleinen Strauch, Epipaktis oder E la -borine (hier fälschlich emboline); einen schwarzen und weißen Elleborus beschreibt Theophrastos, hist, plant. I X 10. Im Kräuterbuch von Lonicerus-Uffenbach (Ulm 1679) wird als Elleborus niger bzw. albus eine Schwarze bzw. Weiße »Niesswurz« genannt. Plinius kommt nat. hist. 22, j6 nochmals auf die Pflanze zurück; trotz allem ist keine sichere Bestimmung möglich. Vielleicht handelt es sich um das Bruchkraut, Hemiaria glabra L. (Caryophyllaceae). -Heidekraut (erice): wahrscheinlich die Baumheide, Erica arborea L. (Ericaceae), ein Busch von etwa 3 m Höhe. Dioskurides, mat. med. I 1 1 7 erwähnt ebenfalls, daß Laub und Blüten dieser Pflanze Schlangenbisse heilen; vgl. auch Nikander, Ther. 610; Theophrastos, hist, plant. I 14,2, sowie Plinius, nat. hist. 24,64. - gnidisches Korn (granum Cnidium), der Südliche oder Gnidium-Seidelbast, Daphne Gnidium L. (Thymelaeaceae), ein meterhoher Strauch mit roten Früchten, den sog. knidischen Körnern, die eine hef-tig abführende Wirkung haben; vgl. Theophrastos, hist, plant. IX 20,2. Dioskurides, mat. med. IV 170 (173) gibt auch die anderen Namen für den Strauch: thymélaia (öl-thymian), chamélaia (Zwergölbaum), pyrós ácbne (»Feuer-spreu«), knéstron (Plinius knêstor) und knéoron (beide Formen von griech. knáein - kitzeln, kratzen, »weil die Frucht auf der Zunge beißt«), ferner linum (Lein) »wegen der äußeren Ähnlichkeit des Strauches mit dem gesäten Lein« (J. Berendes). Das Korn wurde früher audi Coccum (Beere) gnidium genannt.
1 1 5 trágion (von griech. trágos - Bock, also >Bocksstrauch<) : Die Zuordnung dieses Strauches bereitet Schwierigkeiten. Sicherlich ist trágion identisch mit der gleichnamigen, von Dioskurides, mat. med. IV 49 genannten Pflanze, die nur auf Kreta vorkommen soll. Plinius, nat. hist. 27,141 be-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

292 E r l ä u t e r u n g e n
schreibt die Pflanze nochmals und nennt sie tragonis. Wahrscheinlich handelt es sich um den Mastixstrauch, Pista-cia lentiscus L. (Anacardiaceae); die ähnliche Terebinthe, Pistacia terebinthus L., dürfte jedoch kaum in Betracht kommen; beide Pflanzen sind reich an Gerbstoff. Die Zu-ordnung des trágion zum Bodeskraut, Hypericum hircinum L. (Guttiferae), oder gar zu einer Origanum-Art hat nur noch historisches Interesse. Von der Pflanze, die wohl einen »Bocksgeruch« ausstrahlte, hat wahrscheinlich auch die Ortschaft Tragion in Lakonien ihren Namen erhalten; vgl. Strabo, Geogr. V I I I 4,360. - Tragant (tragacanthus, griech. tragákanthos, Zusammensetzung aus tragos - Bode und ákanthos - Dornstrauch, daher etwa >Bocksdorn<, im Deutschen zu Tragant verballhornt); vgl. Theophrastos, hist, plant. I X 1 ,3; 8,2; 15,8 und Dioskurides, mat. med. I I I 20 (23). Von den heute etwa 1600 Astragalus-Arten, von denen in erster Linie Astragalus tragacantha L. und Astragalus gummifer Labili. (Leguminosae) in Betracht kommen, wird von selbst eine gummiartige Substanz aus-geschieden; vgl. oben § 67. Es handelt sich dabei um eine weißliche, in Wasser teilweise lösliche und gallertartig auf-quellende Masse, die aus einem kompliziert aufgebauten Gemisch mehrerer Polysaccharide besteht. - Meder s. 12, 133. - Achaia, griech. Küstenlandschaft in der nördlichen Peloponnes.
1 1 6 >Bock< (tragos), auch >Skorpion< genannt: eine ebenfalls nicht sicher bestimmbare Pflanze. Die Angaben bei Theo-phrastos, hist, plant. V I 1,3 und I X 13,6 führen nicht weiter; Dioskurides, mat. med. IV 51 erwähnt den Tra-gos, auch Skorpion oder Traganos genannt. J . Berendes vermutet Ephedra distaehya L. (Ephedraceae), einen etwa ι m hohen Strauch, dessen Früchte einen süßlich-sauren Geschmack haben. Plinius nennt nat. hist. 22,39 zwei Arten von Skorpionskraut, die sich aber ebenfalls nicht ge-
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 293
nauer bestimmen lassen. - Tamariske (tamarice, tamarix, griech. myrike, vgl. hebr. mor - Myrrhe zu semit. marar -bitter sein, die Nebenform >wilde brya< von bryein -sprossen, treiben, vgl. bryon - Moos) : Bei den Tamarisken handelt es sich um kleine Bäumdien, die in der Nähe von Gewässern vorkommen, insbesondere im Mittelmeer-gebiet. Es kommen vor allem in Betracht die gallische Tamariske, Tamarix gallica L., die weit verbreitet ist, und die afrikanische Tamariske, Tamarix africana L., ferner Tamarix tetranda Pall, ex M.B. Die Rinde dieser Bäum-dien ist reich an Gerbstoff (Tannin). Dioskurides, mat. med. I 1 16 : »sie trägt eine Frucht ähnlich dem Gallapfel« (J. Berendes). In Ägypten, Arabien und Persien findet sich noch die Manna-Tamariske, Tamarix mannifera Ehrbg., aus der man das Tamariskenmanna gewinnt, das mit der in der Bibel erwähnten Wunderspeise identisch sein soll. Nahe verwandt ist der Rispelstraudi, Myricaria germani-ca (L.) Desv. = Tamarix germanica L., der an das Heide-kraut erinnert; vgl. Plinius, nat. hist. 24,67. - >unglücklich< wohl deshalb, weil der Baum nicht angepflanzt wird und angeblich keine Früchte trägt.
1 1 7 ostrys, ostrya (verwandt mit griech. ósteon, lat. os -Knochen, Bein); vgl. Theophrastos, hist, plant. I I I 10,3. Es handelt sich um die Hopfenbudie, Ostrya carpinifolia Scop. (Betulaceae), deren Fruchtstände den Blütenständen des Hopfens ähnlich sind.-Linien: vgl. A. Ernout, Komm. S. 107,2. - Der Baum kommt vor allem im Mittelmeer-gebiet vor, jedoch mit Ausnahme der Iberischen Halb-insel. Das harte und widerstandsfähige Holz (Name!) des Baumes, wie auch das der Hain- oder Weißbuche, Car-pinus betulus L., wurde zur Herstellung von Werkzeugen und verschiedenen Geräten verwendet. - schwere Gebur-ten; vgl. Theophrastos, 1. c.
1 18 Lesbos, die bekannte Insel vor der Westküste Kleinasiens
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

294 E r l ä u t e r u n g e n
- >Glücksverkünder< (griech. euónymos - wohlgenannt): gemeint ist wohl das auch von Theophrastos, hist, plant. I I I 18,13 beschriebene Pfaffenhütchen, Euonymus euro-paeus L. (Celastraceae). Die Pflanze findet sich in Europa und weiten Teilen Asiens und ist vor allem durch die viereckigen Früchte bekannt, die einen weißlichen Samen bergen, der den Vögeln im Winter als Nahrung dient. Dieser Same besitzt stark abführende und brechreizerre-gende Wirkung und wird deshalb als Krankheit verkün-dend angesehen. Eine Unklarheit besteht allerdings darin, daß Plinius behauptet, er trage Schoten wie der Sesam, was nidit den Tatsachen entspricht. Der Sesam, Sesamum indicum L. (Pedaliaceae), hat eine vierkammerige Kap-selfrucht, die zahlreiche Samen enthält, aber keine Schote (siliqua). Theophrastos schreibt daher 1. c. auch richtig: »die Frucht ist an Gestalt der Schale der Sesamfrucht ähn-lich« (K. Sprengel).
Cornelius Alexander, genannt der Polyhistor, H R R 273 frg. 106; s. Münzer S. 355 Anm. 1. - Der Baum leo ( = Löwe?) ist nicht bestimmbar. - Schiff Argo: Auf ihm brachten Iason und seine Gefährten, die Argonauten, das Goldene Vlies und Medea von Kolchis nach Hause. - Mi-stel (viscum) : Die hier mitgeteilte Meinung, daß sie weder durch Wasser noch durò Feuer vernichtet werden könne, beruht nicht auf einem alten Volksglauben, sondern auf der Tatsache, daß der aus der Mistel hergestellte Vogel-leim nicht brennt, da er keine harzigen und öligen Be-standteile enthält; vgl. Plinius, nat. hist. 33,94. Es gibt zweierlei Mistelarten, die im antiken Schrifttum oft ver-wechselt werden: die weiße Mistel, Viscum album L., und die Eichenmistel, Loranthus europaeus Jacq. In beiden Fällen handelt es sich um Schmarotzerpflanzen (die mistel-tragende Eiche) aus der Familie der Loranthaceae. Zum Ganzen s. A. Steier, R E X V Sp. 2063-2074 s. v. »Mistel«.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 29$
andráchne: diese als Portulak (lat. portillaca/porcillaca) bezeichnete Gemüsepflanze, Portulaca oleracea L. (Por-tulacaceae), wird audi von Dioskurides, mat. med. I I 150 beschrieben. Eine weitere, als peplis bezeichnete Art er-wähnt Plinius, nat. hist. 20,210. - andrachle: eine dem Erdbeerbaum (s. § 1 2 1 ) ähnliche Pflanze, Arbutus an-drachne L. (Ericaceae). Es handelt sich um einen baum-artigen Strauch mit immergrünen Blättern, der in Grie-chenland und im Orient heimisch ist. Vgl. dazu Theo-phrastos, hist, plant. I I I 16,5. 3 , 1 ; IV i j , i , ferner I 9,3; I I I 3,3; I j ,2, sowie Plinius, nat. hist. 16,80; 17,234; 25, 162.
kokkygéa (coccygia, zu griech. kókkyx - Kuckuck?); vgl. Theophrastos, hist, plant. I I I 16,6. Es handelt sich um den Perückenstrauch, Cotinus coggygria Scop. = Rhus cotinus L. (Anacardiaceae), der im Mittelmeergebiet weit verbreitet ist. Seine wolligen Blütenstände (Wollbüschel, pappus = wolliger Same) haben Ähnlichkeit mit einer Pe-rücke. - aphárke (apharce, zu griech. árkys/hárkys -Netz?); vgl. Theophrastos, hist, plant. I 9,3; I I I 3,3 und 4,4; V 7,7. Gemeint ist der Erdbeerbaum, Arbutus unedo L. (Ericaceae), ein ebenfalls im Mittelmeergebiet verbrei-teter Baum von durchschnittlich 1 - 3 m Höhe, dessen klei-ne Blüten das Aussehen von Maiglöckchen haben und des-sen rote Früchte eßbar sind. Es ist nicht ganz verständlich, daß Plinius diesen Baum, den er doch sicherlich in seiner Umgebung stets vor Augen hatte, nicht genauer beschreibt und nur einiges wiedergibt, was er bei Theophrastos ge-lesen hatte.
Steckenkraut (ferula) s. unten § 123. - spätere Eintei-lung: Plinius, nat. hist. 16,179. - Holunder (sabucus), Sambucus nigra J . (Caprifoliaceae).
Steckenkraut s. auch 12,126. Die beiden Arten werden audi von Theophrastos, hist, plant. V I 2,7 f . besdirieben.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

296 E r l ä u t e r u n g e n
Nárthex (Ableitung unsicher) ist der Riesenfenchel, Ferula
communis L. (Umbelliferae), eine 3-4 m hohe Pflanze,
die vor allem in Mittel- und Süditalien vorkommt. Aus
den Stengeln hat man die Hüllen für die Papyr i herge-
stellt, aber auch Stöcke; das weiße, schwammige M a r k
diente auch als Zunder, daher die Sage, daß Prometheus
das Feuer in einem hohlen Narthexstengel v o m Himmel
zur Erde brachte (Hesiod, Erga 57; Theog. J67). Unter
narthekia ist wohl die niedriger wachsende A r t Ferula
gummosa Boiss. = Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse zu
verstehen; sie liefert das H a r z galbanum, s. oben 12,126. -
Dill (anethum, griech. ánethon), Anethum graveolens L.
(Umbelliferae).
124 thapsia (von griech. thápsinos - gelb): Die Pf lanze wird
v o n Dioskurides, mat. med. I V 154 (157) ausführlich be-
schrieben, während sie von Theophrastos, hist, plant. I X
9,1. $. 6; 8,5 und I X 20,3 nur kurz erwähnt wird. Gemeint
ist Thapsia garganica L. (Umbelliferae), eine in Südeuropa
und N o r d a f r i k a vorkommende Pflanze, deren möhren-
artige Wurzel eine stark purgierende und hautreizende
Substanz enthält. M a n hat die Pflanze, wahrscheinlich
wegen ihrer Toxiz i tät , auch als Böskraut bezeichnet. -
Fenchel, Foeniculum vulgare L. - mit roten Flecken: ignis
sacer - >heiliges Feuer<, aber auch >verfluchter Brand<. M a n
versteht darunter eine oft auch »Rose« genannte, durch
Rötung b z w . Entzündung der H a u t gekennzeichnete Er-
krankung. »Rose« heißt auch das durch Streptokokken
hervorgerufene Erysipel, das vorwiegend im Gesicht auf-
tritt. D i e Verwendung einer Wachssalbe schreibt auch
Dioskurides, 1. c. vor .
125 Eine weitere medizinische A n w e n d u n g s. Plinius, nat.
hist. 26, 23 ad lidienas et thapsiae radice utuntur trita
cum melle (gegen Flechten verwendet man auch die mit
H o n i g zerriebene W u r z e l der thapsia). - Gift gehöre
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 297
zum Handwerk: Man denkt hier an den auf Para-celsus zurückgehenden Satz: Dosis facit venenum - Die Menge macht das Gift aus, der auch heute noch in der Arz-neikunde gilt. Daß auch starke Gifte, in entsprechend niedriger Dosierung angewandt, zu Heilmitteln werden können, ist allgemein bekannt. Aus den Worten des Pli-nius (»Unverschämtheit«) spricht ein deutliches Mißtrauen gegen gewisse Ärzte seiner Zeit. - Man hat die thapsia mit dem silphion der Alten in Verbindung bringen wollen, aber wohl zu Unrecht; s. A. Steier, R E I I IA Sp. 1 0 3 - 1 1 4 s. v. »Silphion«. Das von Plinius, nat. hist. 20,104 und 22, 100-106 erwähnte silphium ist wohl eine ausgestorbene Ferula-Art.
126 Nächtliche Streifzüge des Kaisers Nero (54-68 n. Chr.); vgl. Sueton, Nero 26,2-4; Tacitus, Ann. X I I I 25, 1 -3 und Cassius Dio L X I 9,2. - Auch Dioskurides, mat. med. IV 154 (157) schreibt, daß man blutunterlaufene Stellen zu-sammen mit Weihrauch und Wachs mit der fein gestoße-nen Wurzel oder dem Saft der Thapsia vertreiben könne. - Feuer... im Steckenkraut fort glimmt s. oben § 123 (Prometheus-Sage).
127 Kaper (capparis, cappari, griech. kápparis, Herkunft unbekannt): Der Echte Kaperstrauch, Capparis spinosa L. (Capparaceae), wird auch von Dioskurides, mat. med. I I 204 beschrieben. Die Blüten dieser Pflanze sind rosaweiß. Die Blütenknospen werden gepflückt und in eine salzige Essiglösung gelegt und kommen als geschätztes Küchen-gewürz in den Handel (heute meist aus Südfrankreich). Unter dem Namen Kaper kommen auch die Blütenknos-pen anderer Pflanzen, z. B. der Kapuzinerkresse, Tro-paeolum maius L., auf den Markt. Es gibt eine Reihe von Varietäten dieser Pflanze, ohne daß es allerdings möglich wäre, sie genau zu bestimmen. Dioskurides erwähnt 1. c. ebenfalls, daß die Kaper vom Roten Meer und aus Libyen
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

298 E r l ä u t e r u n g e n
(Plinius: die afrikanische) dem Zahnfleisch schade, die marmarische (Marmarica, eine Landschaft in Afrika zwi-schen Ägypten und den Syrten, vgl. Plinius, nat. hist, 5,32. 39) Blähungen verursache und die apulische (Apulien, Landschaft in Unteritalien) Erbrechen hervorrufe; vgl. auch Plinius, nat. hist. 20,I6J. - >Hundsdorn< (griech. ky-nósbatos) und >Schlangentraube< (griech. ophiostaphylé) : Diese Bezeichnungen finden auch für andere Pflanzen Ver-wendung, so wird z. B. auch für die Hundsrose kynós-bastos verwendet; vgl. Dioskurides, mat. med. I 123.
128 Sari (saripha, griech. sári ägyptischer Herkunft; die Form saripha nur bei Plinius, sie scheint auf einem Irr-tum zu beruhen), wahrscheinlich eine Zypergrasart, Cy-perus L., die sich nicht genauer bestimmen läßt, aber in naher Verwandtschaft zur Papyrusstaude, Cyperus papy-rus L. (Cyperaceae), steht; vgl. auch Theophrastos, hist, plant. IV 8,j.
129 Dieses rätselhafte Gewächs ohne nähere Bezeichnung wurde von Sprengel nach Theophrastos, de causis plant. II 17,3 als eine Schmarotzerpflanze, Cassytha pubescens R. Br. (Lauraceae) erkannt. Es gibt mehrere Arten davon, auch in Afrika; sie haben das Aussehen von Zistrosen und ihre Blüten sind wie Knäuel angeordnet. - Der Königs-dornstrauch ist vielleicht eine Akanthusart. - Auf gang des Hundsterns (Sirius) s. 12,58. - Die Lange Mauer in Athen verband die Stadt mit dem 7 km entfernt liegenden Hafen Piräus (Peiraieús); vgl. Plinius, nat. hist. 4,24.
130 Sáonedkenklee (cytisus, griech. kytisos zu kytis/k^tos -Kästchen, Büchse?), eine etwa 1 m hohe strauchartige Kleeart, Medicago arborea L. (Leguminosae), die als Fut-ferpflanze sehr geschätzt wurde. Sie enthält getrocknet et-wa 1 j ·/« Pflanzeneiweiß und etwa 3 °/o Fette. Die Pflanze wurde schon im Altertum aus dem Orient in das Mittel-meergebiet eingeführt; vgl. Theophrastos, hist, plant. IV
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 299
4,6; I 6,1 ; V 3,i und Dioskurides, mat. med. IV m ( 1 13) , ferner Vergil, Georg. I I I 3 94; Columella, de re rust. V 12,1 und Aristoteles, hist. anim. I I I 21 , 522b 27. Zum All-gemeinen s. Hehn S. 410-416. - Amphilochos s. Ver-zeichnis der Quellenschriftsteller; vgl. Plinius, nat. hist. 18,144. - 1 Jfcbart (iugerum) = 2523,34 m2. - 2000 Se-sterzen = etwa 400 Goldmark. - Erve, die Linsenwicke, Vicia ervilia (L.) Willd. (Leguminosae), ähnlich der Sau-bohne, früher als Nahrungs- und Futtermittel sehr ge-schätzt. Bei den Ausgrabungen in Troja hat man Reste der Pflanze gefunden.
1 3 1 Amphilochos s. § 130. - Demokritos 68 Β 300,8 Diels unter den »Unechten Fragmenten«. - Aristomachos s. Ver-zeichnis der Quellenschriftsteller.
132 f. Columella, de re rust. V 12,2 ff. Dort heißt es, daß für ein Pferd fünfzehn (bei Plinius zehn), für ein Rind 20 Pfund genügen.
134 Die Angabe, daß die Zykladeninsel Kythnos die Hei-mat des Schneckenklees (kytisos) ist, scheint auf den laut-lichen Anklang zurückzugehen; dazu Servius, Georg. I I 431 . - Daß der Schneckenklee als Mittelmeerpflanze gegenüber Schnee beständig war, muß bezweifelt werden; vgl. A. Ernout, Komm. S. 1 1 3 , 2. - C. Iulius Hyginus s. Verzeichnis der Quellenschriftsteller. - Bohrwurm (cos-sus): nicht genau bestimmbare Art einer Käferlarve, die ihre Gänge in das Holz der Bäume bohrt. Die Familie der sog. Holzbohrwürmer hat den zoologischen Namen Cossidae bekommen; vgl. H. Leitner, Zoologische Ter-minologie beim älteren Plinius. Hildesheim 1972, S. 101 f.
135 Plinius wendet sich nun einigen Wasserpflanzen und zwar vor allem den Algen zu, die im Wasser der Meere Sträucher, Bäume, ja ganze Wälder bilden. Die Algen ge-hören nach den Bakterien zur niedrigsten Pflanzenabtei-lung. Sie können ein- oder mehrzellig sein und sind ohne
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

300 E r l ä u t e r u n g e n
Wurzeln und Gefäße. Ihre Färbung erhalten sie vom Chlorophyll und von Carotinoidfarbstoffen. Die Algen entstanden im Präkambrium vor etwa 2 Milliarden Jahren und haben sich an die verschiedenen Lebensbedingungen im Wasser hervorragend angepaßt. Man kennt heute etwa 20 000 Algenarten. Einige besonders wichtige Abteilungen sind die Blaualgen (Cyanophyta), Blaugrünalgen (Glauko-phyta), Schönaugen-Algen (Euglenophyta), zweigeißlige Algen (Pyrrophyta), Goldalgen (Chrysophyta), Grünalgen (Chlorophyta), Braunalgen (Phaeophyta) und Rotalgen (Rodophyta). Unter Tangen versteht man große Meeres-algen, vor allem Braunalgen, die meist in küstennahen Ge-bieten ganze >Wiesen< bilden. Sie werden audi technisch aus-genützt als Viehfutter, Düngemittel, zur Gewinnung von Jod usw. Eine genaue Unterscheidung der Algenarten gab es in der Antike nodi nicht und es ist deshalb kaum möglich, aus den meist sehr unvollständigen Angaben eine genauere Bestimmung durchzuführen. Die besten Nachrichten stam-men von Theophrastos, hist, plant. IV 6 und 7, denen Pli-nius audi hier folgt. - Rotes Meer s. 12,2. - Dem griech. phykos (von hebr. puk - Augenschminke) entspricht das lat. fucus, das allerdings vieldeutig ist, da man darunter vor allem eine Steinflechte, die den Orseillefarbstoif lie-fert, dann auch den roten Purpurfarbstofi, Schminke usw. verstand. Plinius versteht unter phykos einen Strauch, unter Algen ein krautiges Gewächs im Meer - eine Un-terscheidung, die mit der heutigen Systematik nicht paral-lel geht. - >Lauch< (griedi. práson); >Gürtel< (griech. zo-stér); vgl. Theophrastos, hist, plant. IV 6,2. Man könnte hier an den Meerlattich, Ulva lactuca L., denken. In na-her Verwandtschaft dazu stehen einige Monostroma-Ar-ten; vgl. Dioskurides, mat. med. IV 97 (99).
Theophrastos, hist, plant. IV 6,3-6. - Obwohl Plinius hier die Algen besprechen will, handelt es sidi um keinen
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

Er läuterungen 301
Tang, sondern um eine Flechte und zwar die Orseille-Flechte, Roccella tinctoria L. Aus ihr gewann man durch Extrahieren mit Wasser und Eindampfen das Orseille-Karmin, einen Farbstoff, der Wolle substantiv sehr schön rotviolett - allerdings mit sehr geringer Lichtechtheit -färbt. Der Farbton ist ähnlich dem bei der Purpurfärberei erzeugten. Orseille und der nahe verwandte Lackmus sind Farbstoffgemische, deren Grundsubstanz das Orcin, ein Methylresorzin, bildet. Der aus der Purpurschnecke ge-wonnene Purpur ist ein 6,6'-Dibromindigo, gehört also einer völlig anderen Farbstoffklasse an. - Plinius könnte vielleicht hier einige Rottangarten, etwa Rytiphlaea tinc-toria u. ä., meinen, wie sie ζ. B. auch von Dioskurides, mat. med. IV 98 (100) erwähnt werden. - Die dritte, dem Gras ähnliche Art ist vielleicht das Seegras, Zostera marina L. (Potamogetonaceae).
137 bryon (Moos); vgl. Theophrastos, hist, plant. IV 6,6. Hier ist sicherlich der bereits § 1 3 $ erwähnte Meerlattich, Ulva lactuca oder maxima L. gemeint; vgl. auch Dioskuri-des, mat. med. IV 97 (99); er wächst auf Steinen. - See-tanne und See-Eiche: es ist unmöglich, nach diesen un-genauen Angaben eine Bestimmung durchzuführen. Theo-phrastos, hist, plant. IV 6,7-9 beschreibt diese Tange et-was genauer. Sprengel hat in seinem Kommentar einige Fucus-Arten benannt, die vielleicht in Betracht kommen, nach neuerer Auffassung aber doch recht zweifelhaft er-scheinen. Richtig beobachtet ist, daß sich in den Ästen die-ser Tange Muscheln verhängen.
138 Sikyon, Stadt in der Nähe des korinthischen Meer-busens zwischen Korinth und Pallene, h. Vasilika; vgl. Plinius, nat. hist. 4,12. Die unsichere Überlieferung (Scio-nem, Sicionem) läßt audi die Möglichkeit offen, daß Skione, eine Stadt in Makedonien an der Südküste der
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

302 E r l ä u t e r u n g e n
Halbinsel Pallene gemeint sein kann; vgl. Plinius, nat. hist. 4,36. - Weinstock: vgl. Theophrastos, hist, plant. I V 6,9 ff., sicherlich eine Rotalge. Die anderen Meeresalgen lassen sich nicht bestimmen. - Säulen des Herkules = Straße von Gibraltar. - Bimsstein (pumex), ein schaumig aufgeblähtes Gefüge vulkanischer Gesteine infolge Gas-abscheidung beim Erkalten; er hat mit den ans Land ge-schwemmten Algen nichts zu tun.
139 Koptos, Hauptort eines oberägyptischen Gaues in der Thebais am Ostufer des Ni l ; vgl. Strabo, Geogr. X V I I 1,81 j und Plinius, nat. hist. $,60. - Dornstrauch: eine Aka-zienart, vielleicht der Gummiarabicumbaum, Acacia sene-gal (L.) Willd. oder Acacia nilotica (L.) Del. (Legumi-nosae). - Rotes Meer s. oben 12,2.-Lorbeer-undölbaum: wiederum sind nicht näher bestimmbare Algenarten ge-meint. - Schwämme: Bei Theophrastos, hist, plant. I V 7,2 heißt es, wenn viel Regen fällt, würden im Meere Schwäm-me wachsen, die durch die Sonne versteinert werden. Die Stelle ist nicht ganz klar. - drei Ellen = etwa 1,35 m. -Der Hundshai (canícula), Galeus galeus, gehört zur Ord-nung der echten Haie (Selachii) und bewohnt die Küsten-zonen aller Meere. Er wird bis zu 2 m lang und ist ein gefräßiger Raubfisch. Plinius beschreibt nat. hist. 9, 1 j 1 bis ι j 3 die Gefährlichkeit dieser Tiere für den Taucher.
140 nach Indien fuhren: nicht korrekt, denn die Soldaten Alexanders befuhren das Meer auf dem Rückweg von In-dien. Theophrastos, hist, plant. IV 7,3 spricht richtig von den Soldaten, die den »Seezug aus Indien auf Alexanders Befehl machten« (K. Sprengel). - Mit den Seebäumen sind wohl wieder Algen gemeint. - Bei den steinernen Pflanzen und Zwergbäumen denkt Plinius an die Korallen. Über die wahre Natur dieser Lebewesen, die dem Tierreich an-gehören, war man sich im Altertum noch nicht im klaren.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 303
Die Korallentiere, Anthozoa, sind festsitzende Polypen, die sich ein oft weit verzweigtes Skelett aus kohlensaurem Kalk aufbauen. Diese Kolonien haben sehr oft das Aus-sehen von Pflanzen, wofür sie Plinius, nat. hist. 32, 2 1 -24 auch hält. Auch hier ist es unmöglich, nähere Angaben zu madien: vielleicht denkt Plinius an die häufig vorkom-mende Edelkoralle, Corallium rubrum.
141 Theophrastos, hist, plant. IV 7,4 f. Für die Geschichte der Botanik sind die Wälder, die zum Teil von der Flut bedeckt sind, bedeutsam, weil es sich um die erste Er-wähnung der Mangrove handelt. Die Mangrovenbäume, Rhizophoraceae, kommen überall an den tropischen Kü-sten, an Fliißmündungen usw. vor. Ihre Wurzeln sind im Schlick des Meeres verankert, wobei sie, meist wegen Mangel an Sauerstoff, zusätzlich große Luftwurzeln bil-den, die diesen Wäldern ein eigenartiges Aussehen geben. Die Baumkrone ist immergrün; die Samen keimen bereits, wenn die beerenartigen Früchte nodi an der Mutterpflanze hängen. Der Keim fällt nach einiger Zeit ab, heftet sich mit der Wurzel im Boden fest und bildet einen neuen Baum (Viviparie). Es kommen vor allem Rhizophora con-iugata L. und Rhizophora mucronata Lam., sowie die Gat-tung Bruguiera in Betracht; s. audi oben 12,37 f. und 77. -Inseln: wohl die oben 12,38 ff. genannten Inseln der Bah-rain-Gruppe. - Lupinenfrucht: auch hier ist eine nähere Bestimmung nicht möglich, vielleicht handelt es sich um eine Leguminose.
142 Iuba F G H 275 frg. 67. - Inseln der Troglodyteη (»Höhlenbewohner« im Süden von Ägypten): die Inseln an der Küste Eritreas im Roten Meer, h. Dahlak. - Isis-haar: nicht näher bestimmbar, vielleicht die schwarze Edel-koralle, Euplexoura antipathes, die im Roten Meer vor-kommt und deren Skelett zu Schmuckstücken verarbeitet
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

3°4 E r l ä u t e r u n g e n
wird. Eine weiße, ebenfalls zu Schmucksachen verarbeitete Koralle, heißt Isis. - >Schönau.ge< (griech. diaríton blépha-ron, eigentlich »Augenlid der Chariten-Grazien), eine ebenfalls nicht bestimmbare Koralle, die offenbar als Amulett diente und aus der Armringe (spatalia) und Hals-bänder (monilia) verfertigt wurden; vgl. Tertullian, de cult. fem. 2, 13.
Erläuterungen zu Athenaios, Deipnosoph. X V ρ 688 D E
Im Hause des römischen Ritters P. Livius Larensis sind 30 Gäste verschiedener Berufe (Juristen, Ärzte, Dichter, Musiker, Philosophen u. a.) zu einem Gastmahl versam-melt, das sich über mehrere Tage hinzieht. In Form eines erfundenen Gespräches werden den einzelnen Teilneh-mern Ausführungen zu den verschiedensten Themen ihrer Arbeits- und Interessengebiete in den Mund gelegt - Ap-pollonios Mys, griech. Arzt des 1· Jhdts· v. Chr.; als An-hänger des Herophilos (4. Jhdt. v. Chr.), des Begründers der Anatomie als wissenschaftliche Disziplin, verfaßte er u. a eine Arzneimittellehre (perì euporíston pharmákon). - Elis, Landschaft auf der nordwestlichen Peloponnes. -Weiteres s. Erläuterungen zu 13, 4 ff.
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 305
Verzeidinis der Sachbezüge
zwischen Plinius, Theophrastos, historia plantarum, und Dioskurides, materia medica:
Buch 12
nius Theophrastos Dioskurides
« - 7 I V } , í -
9 ι 7. I -
It I 9. 5 I 107
15 I V 4, 2. j I 166
I« IV 4, j . 2 -
17-18 IV 4, 6 I 129 20 IV 4, Í I 129 21 — I 129 22-23 I 7, 3; I V 4 . 4 -
»4 IV 4, 5 -
Ί I V 4. 7· 8 -
26 IV 4, xi ; I X 20, ι II 188
»7 - II 188 28 - II 188. 189 JO-3I - ι ·31 3» — I i n ; II 104
33-34 I V 4, 12. IJ -
3 S - I 80
37 I V 7. 5· í -
38 I V 7 . 7 -
39-40 I V 7, 8 —
41 I X 7 , 3 1 1 5 4» I X 7 , 2 I «; I 7 ; I 8
43 - I 6
45-4« - I 7 ; I 9; I 10; I I I 44 47 - I 9 48-49 - I ' 4 j o I X 7. 2. 3 I 5 j i - 5 2 I X 4, 2 I 81
J3 I X 4, 2. 8 -
54 I X 4. 5 -
5« I X 4, 2. 7. 8 -
57 I X 4. 2· 9 -
58-59 I X 4. 4· 5 -
60 I X 4, 10 -
6 I I X 4, 10 I 81 62 I X 4. 10 I 81 ; I 83
«3 I X 4. 6 -
í s — I 81 6Í ix 4 .2 I 77 <7 I X 4. 3· 7 · «
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

3 o 6 E r l ä u t e r u n g e n
Plinius
68 «9-71 7* 73 74-75 7« 77 7« 85 89-90 9' 9* 96 97 98 100. 101 103 104 105-106 107 108 109 110 111 112 II4 II5-116 I 17-118 119 120—121 1*3 124-125 126 " 7 128 129 130-131 132-133 '34 135
Theophrastos
IX 4, 10
VI 4 . 9
IV 7, 2. ι
IX 5, 1-3 IX . - 3 IX J, I IX 5, 2 IX J. 3
IV 2 , «
IX 7, I . 2 IX 7, 2
IX 6, ι IX 6, ι
IX 6, 2; IV 4, 14 IX 6, 2. 4. 3
IX 7, 3. 9, 2. i j , 7. I i , ι
IX 7, »
Dioskurides
77! I 73 77 90; I j i 128
II 84 128 128 141 104 13 ; I 12
13 ' 3 12 12 12; I 21; I 23
V ι J7 148
17 II 88; I 71 20 124; I 65
I 26 II 42; I 18 18 18 18 18 18; I I I 161 18 18; I 71 79
II 87; I I I 8 j II 48-50 II 80; I I I II 29; V « 20; V 5; I I I I2J i j o ; I $4
Plinius
•3. * 4 J
Budi 13 Theophrastos Dioskurides
I 53 I 7 1 I 66
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 307
Plinius Theophrastos Dioskurides
S VI 8 , ι I 6 3 ; IV 1 5 8
8 - I 20. 7 2 . 7 1 . 39
9 - I 53 IO - I 6 4 . ; 8 ; III 4 1 a I I II 2 , 5 I 6 2 ; I 55
12 VI ι , ι I 6 5 . 6 0 . III 2 6 ; I 4 9
Π - I 1 8 . $7 . 6 9 ; III 4 1
14 IV 5 , 2 ; IX 7 , 3—4 I I . 66; I 1 3 4
IJ - I 74· 75 16 - I 2 J . ¿ 4 . 7 4
1 7 - I 7 3 1 8 IX 7. 3· 4 -
1 9 - I 3 9 ; V I J 2
16 m 3, 5 ; II 6 -
1 7 II 6. 10 V 4 0
28 II 6, 2 . 3 -
30 I 1 4 , 2 -
3 1 II 6 , ί ; I 1 3 , 5 -
3» II 6 , ι -
33 II 6, 7 . 8 -
34 II 8 , 4 -
35 II 8 , 4 -
3« II 6, 1 -
37 II «, 3· 4 -
38 II 6, 2 . 9 . 7 -
39 II 6 , 6. 11; V 6 , 1; V 9 , j I 1 5 0
4 0 II 6 , 6 _ 41 II 6, 7 -
44 - V 4 0 ; I 148
45 II 6 , 6 —
47 I io, j ; II 6, 1 0 _ 48 II 6 , 2 . 5 _ 49 II 6, 6-, II 6, 2 -
JO IV 4 . 13 -
S' IV 4 , 7 ; IV 2 , 1 0 1 1 7 7 S2 III 12, 3 . 4 I 105
53 III 3 , 8 ; . 2 , 3 . 4 ; I 9 . 4 ! IV 5 , 3 I 1 0 j 54 III i j , 3 . 4 -
55 III 1 8 , j ι 1 4 7
5«/S7 IV ι , j ; 2 , ι . 2 ; I ι , 7 I 1 8 1
S« IV 2 , 3 I 1 8 2
59 IV 2 , 4 ; I χι , 2 ; 1 4 , 2 —
60/61 IV 2 , j . S I 1 8 7
<2 IV 2 , 7 -
«3 IV 2 , 8 . 9 ι '33 <4 IV 2 , 10 -
<5 IV 2 , H . 1 2 -
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

3O8 E r l ä u t e r u n g e n
Plinius Theophrastos 66/67 -
«7 Ill 14, I ¡ IX I, 2 7' IV 8, 3. 4 7»/73 IV 8, 4 95 V3.7 101/102 V3.7 104/105 IV 3, 1-3 106 IV 3, 2. ι. 4 107/108 IV 8, 7-8. 9. IO. II 109/110 IV 8, 10. il III IV 3, 3. j (III .8, 3) " 3 -
"4 I 14, 2; IX 10; IX 20, 2 " 5 IX I, 3; 15, 8; 8, 2 116 VI ι, 3; IX 13, 6 " 7 III 10, 3 118 III 18, 13 120 III I«, 5i 3. 3i I 5. 9. 3i
IV ij, ι. 2 121 III 4,4; I«, 19.3 ; ν 7,7 " 3 VI 2, 7. 8 I24 IX 8, j; 9, 6; 20, 3 125/126 -
«7 —
128 IV 8, 2. 5 130 IV 4, <;I<, I ; V ] , I 133 -
I3J IV í, I. 2 13Í IV 6, 3-Í «37 IV Í, 6. 7. 8. 9 138 IV Í, 9. 10; IV 7, ι 13» IV 7, 1-2. 3 140 IV 7.3 •4' IV 7.4
Dioskurides I 133. 157. 174. 17Í V 1; I 112. 141; III I 1.5 I 115
I 171
IV 112; II ill IV 112
I 152. 153. 154 I 117; IV 107. 170 IV 49; III 20 IV 51; I 116
II 150
IVIJ4 IVIJ4 II 204
IV HI IV hi
IV 98 IV 97
Verzeichnis der Parallelstellen zwisdien Plinius und Solinus, Collectanea rerum memorabilium:
Budi 12 Plinius Solinus Plinius Solinus 40 52,49
14 f. 4«,4f· 16 4«, 6 20 52, J2 »3 5». 47
$1 f· 33. 5 54 33. «f· 5« 33. « J« 33. »
JÍ 51. JO 33. J 1» J*. 4« 73 »7.48
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM

E r l ä u t e r u n g e n 309
Plinius Solinus Plinius Solinus
So J3. '» u j f . 3J, j f . 86 30, 30 118 3J, 6
89 ff. 30, 30 f. Budi 13 103 3 3 « 13. 3 4*. » 104 5». S* 24 f. 4$, 1 f .
107 1 7 , 47 j i f. 31, 34 f. III ff. 3J. 5 18 >, 17
Authenticated | [email protected] Date | 8/30/13 1:13 PM