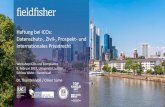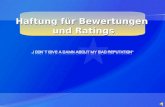Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung
Transcript of Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung

Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung
Von Professor Dr. Heike Jung, Saarbrücken
L Die FragestellungIn der Medizin liegen Risiko und Chance nahe beieinander. Risi-
ken will jeder vermeiden. Gefragt ist normalerweise das bewährteMedikament, der erfahrene Operateur, die gesicherte Heilmethode.Zugleich wollen wir am Fortschritt der Medizin partizipieren. Fort-schritt hinwiederum läßt sich nur erreichen, wenn man die eingefah-renen Gleise verläßt und bereit ist, Herkömmliches in Frage zu stel-len. Dieses erkenntnistheoretische Grundphänomen gewinnt in derMedizin an Brisanz, weil jeder einzelne von uns davon vital betroffenist. Niemand möchte an der Heilkunst Schaden nehmen. Welches Ri-siko man zu tolerieren bereit ist, hängt andererseits vom Krankheits-zustand ab. In medizinisch einfach gelagerten Fällen geht man auf„Nummer Sicher". Den ausgetretenen Pfad verläßt man schon eher,wenn „sonst" alles versagt hat.
Das Schlagwort „Außenseitermethoden" wirkt sehr treffsicher.Beim Nachfassen beschleicht uns jedoch Unsicherheit: Der Begriffimpliziert, daß jemand sich am Rande seiner Wissenschaft, wennauch noch in Tuchfühlung mit ihr, bewegt. Nur: Wer definiert, wasals Rand- oder Außenlage zu gelten hat, zumal die Erfahrung lehrt,daß die Außenseitermethode schon morgen zur Methode der Wahlwerden kann? Mehr noch: Wo verläuft die Grenze zur reinen Schar-latanerie, zu den vielen selbsterklärten Wunderheilern? Auf Anhiebist uns auch nicht viel damit gedient, wenn wir eine Erklärung ausder Sicht des begrifflichen Gegenstücks, der „Schulmedizin", versu-chen. Wir geraten nämlich bei diesem Begriff alsbald in dieselbendefinitorischen Schwierigkeiten wie bei dem Begriff des Außensei-ters1. Weder der Rückgriff auf die allgemein anerkannten Regeln
i Zu dem Begriff der Schulmedizin Siebert, Strafrechtliche Grenzen ärztlicher Thera-piefreiheit, 1983, S. 37; vgl. zu den definitorischen Schwierigkeiten auch Laufs, DieEntwicklung des Arztrechts 1983/84, NJW 1984, 1383, 1384. Cross, Allgemeine Me-thodenkritik in der Medizin, in: Deutsch u. a. (Hrsg.)r Verbindlichkeit der medizi-nisch-diagnostischen und therapeutischen Aussage, 1983, S. 49, hat zu Recht daraufaufmerksam gemacht, daß bei beiden Begriffen — bei Schulmedizin wie Außensei-
ZStW97(1985)HeftlBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

48 Heike Jung
noch der Verweis auf die in Wissenschaft und Praxis dominierendeRichtung lassen die Konturen des Begriffs der Schulmedizin klarhervortreten. Vor vergleichbaren Problemen stehen wir, wenn wirdie Abgrenzung zum „Wunderheiler" mit dem Hinweis darauf erledi-gen wollen, daß dieser sich eben keiner Methode der Heilkunst be-dient. Denn bei der Verifikation dieser im Grunde selbstverständli-chen These stoßen wir auf Grenzphänomene.
Unvermittelt stehen wir in der Auseinandersetzung um fachli-che, berufliche und ethische Standards ärztlichen Handelns. In ge-wisser Weise kann die Einstellung zu Außenseitermethoden gar alsIndikator für das Selbstverständnis ärztlichen Handelns gelten. Derverbreitete Wunsch nach allgemeiner Verbindlichkeit und der be-liebte Rückgriff auf Erprobtes konkurrieren mit Fortschrittsglaubenund der Notwendigkeit der Selbsterneuerung. Rivalitäten, Schulen-streit und missionarischer Übereifer erschweren die rationale Aus-einandersetzung. Wir bewegen uns also auf einem Felde voller Span-nungen und Dynamik. Die Orientierung wird zusätzlich erschwertdadurch, daß auf dem Feld der Heilkunst nicht nur Ärzte tätig sind.
Die Geschichte der Medizin hält uns zur Skepsis gegenüber derDogmatisierung einer einzigen Heilmethode an. Sie bestärkt uns zu-dem in der Annahme, daß auch die Medizin Erscheinungen kennt,die naturwissenschaftlich nicht oder noch nicht zu erklären sind. Ge-rade die Technisierung und Entpersönlichung der modernen Medi-zin hat den Außenseitern Zulauf gebracht. Sie kommen einer in derGesellschaft verbreiteten Grundstimmung entgegen: „... das Volkwill noch immer statt des Fachmannes, der ein Wissen hat vonKrankheiten, den »medizinischen Menschen1, der ,Macht' hat über dieKrankheit"2. Man muß sich jedoch fragen, ob eine rationale Gesund-heits- und Kriminalpolitik zulassen darf, daß Leichtgläubige und Ver-zweifelte an Gesundheit und Vermögen Schaden nehmen.
termethode — negative Konnotationen mitschwingen. Im Rahmen eines pluralisti-schen Erkenntnismodells, wie es z. B. von Kienle, Erkenntnistheoretische Grundla-gen der Verbindlichkeit nicht bewiesener oder ableitbarer medizinischer Verfah-ren, in: Deutsch, a. a. O., S. 117 ff., vertreten wird, haben sie ohnehin keine Existenz-berechtigung (vgl. a. a. O., S. 129).
2 Stefan Zweig, Die Heilung durch den Geist, 1952, S. 13. Carstensen, Das ärztlicheund juristische Ermessen als Grundlage chirurgischen Handelns, Der Chirurg 1980,414, 417, merkt zu dieser Entwicklung an: „Das menschliche Bedürfnis nach Wun-dern und Mystik stillen heute als Ersatz jene Naturheilkundigen von stark unter-schiedlichem Bildungsgrad, die sich im Besitz der letzten Wahrheiten zu befindenglauben."
ZStW 97 (1985) Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung 49
Das Recht tut sich in einer solchen Gemengelage schwer. Eskann sich aber nicht verweigern, sondern muß Bewertungen vorneh-men, Grenzen aufzeigen. Die Medizin ist schließlich nicht adressat-los; vielmehr sind immer einzelne Menschen oder aber die Gesell-schaft als ganze betroffen. Andererseits kann das Recht keine medi-zinischen Entscheidungen treffen. Es muß sich vielmehr darauf be-schränken, Außenseitermethoden an rechtlichen Vorgaben —sprich: Wertentscheidungen — zu messen. Die Maßstäbe mögen da-bei durchaus differieren, je nachdem in welchem Rechtsgebiet wiruns bewegen. Unsere Fragestellung ist von vornherein auf das Straf-recht begrenzt. Uns braucht also z. B. nicht zu kümmern, ob und un-ter welchen Voraussetzungen die Anwendung von Außenseiterme-thoden als erstattungsfähige Leistung im Sinne des Krankenversi-cherungsrechts anerkannt werden kann, inwieweit also die Solidar-gemeinschaft einzustehen hat. Es geht nur darum, wann wir demAußenseiterverhalten Sozialschädlichkeit attestieren müssen, alsodie Verletzung eines strafrechtlich geschützten Rechtsguts in Redesteht. Unsere Perspektive verengt sich damit auf die des strafrechtli-chen Schutzes des einzelnen Patienten und der Funktionstüchtigkeitder allgemeinen Gesundheitsfürsorge. Trotzdem werden wir denGrundsatzfragen nicht ausweichen können. Schon der Sprachge-brauch — man denke nur an den gewerberechtlich ausgerichtetenBegriff der „Kurierfreiheit" — erinnert uns an die vielfältigen Quer-verbindungen. Immerhin mahnt die Funktion des Strafrechts als ei-nes Mittels der Reaktion auf sozialschädliches Verhalten, das nur alsultima ratio eingesetzt werden darf, zur Zurückhaltung. Die Rolledes Schiedsrichters im Schulenstreit ist dem Strafrecht von vornher-ein versperrt3. Seine Domäne beginnt erst dort, wo durch das abwei-chende Handeln des einzelnen gesellschaftliche Grundwerte Scha-den nehmen.
//. Der Versuch einer begrifflichen AnnäherungUnsere Neigung, das Bild vom Außenseiter durch andere Bilder
zu erläutern, läßt vermuten, daß der Versuch einer präzisen Begriffs-bestimmung von vornherein zum Scheitern verurteilt sein dürfte.Zwar läßt sich feststellen, daß der Außenseiter sich nicht in der er-kenntnistheoretischen Mittellage seines wissenschaftlichen oder be-rufspraktischen Bezugsfeldes bewegt. Er kollidiert mit einem tiefempfundenen Bedürfnis nach Handlungssicherheit, d.h. also nach
3 In diesem Sinne auch Laufs (Anm. 1).
ZStW97(1985)HeftlBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

50 Heike Jung
allgemeiner Verbindlichkeit der beruflichen Standards4. Die abweh-rende Haltung, mit der man Außenseitern bisweilen begegnet,könnte sogar zu der Annahme verleiten, der Außenseiter bewegesich überhaupt nicht mehr auf dem Boden seiner Wissenschaft. Der-artige Aus- oder Abgrenzungsstrategien stellen jedoch nicht unbe-dingt einen Ausstoßungsprozeß dar, sondern sind eher Ausdruck derAngst vor dem Neuen oder auch der berechtigten Skepsis vor einerMethode, deren Wirksamkeit zweifelhaft ist. Bezeichnenderweiseschwinden diese Berührungsängste merklich, wenn man als tertiumcomparationis den Wunderheiler oder Exorzisten hinzunimmt. Zwarverweist Bethge zu Recht darauf, daß ohne irrationale Gedanken undHandlungen der Menschen die Geschichte der Wissenschaft und derMenschheit sicher anders und wahrscheinlich weniger interessantverlaufen wäre5. Die Grenze zum Humbug wird jedoch dort über-schritten, wo der rationale Bezug in der personalen, auf Heilen ange-legten Interaktion völlig verloren geht, wo irgendeine therapeuti-sche Sinnhaftigkeit des Vorgehens intersubjektiv nicht nachvollzieh-bar ist. Man griffe sicher zu kurz, wollte man die Umkehrung dieserFeststellung als Umschreibung ärztlichen Handelns schlechthin neh-men. Immerhin erlaubt sie gewisse Abschichtungen: Zum einen er-scheint es verfehlt, von ärztlichem Handeln nur dann zu sprechen,wenn es auf reproduzierbare Erfolge angelegt ist6. Zum anderen hates mit Medizin nichts mehr zu tun, wenn ein Wunderheiler demKrebskranken die Hände auflegt, weil hier nur noch mit der Katego-rie des „Glaubens" gearbeitet wird.
Auf den Rationalitätsbezug im Sinne des intersubjektiv Nach-vollziehbaren können wir bei dem Versuch, das Wesen ärztlicher Tä-tigkeit zu umschreiben, nicht verzichten. Anders gewendet. Ob vonärztlichem Handeln gesprochen werden kann, läßt sich nicht alleindaran festmachen, daß der Betreffende mit Heilungswillen gehandelt
4 Dieses Bedürfnis tritt nicht erst in unseren Tagen auf. So ruft z. B. Neurohr in sei-nem „Versuch einer einfachen und praktischen Arzneimittellehre" aus dem Jahre1811 nach der kritischen Hand, der es gelingen möge, „das überflüssige vom Not-wendigen abzusondern, und Regeln festzusetzen, wonach die weitere Kultur dieserWissenschaft sich sicherer verbreiten kann". (Zitiert nach Sewing, Fortschritt, Aner-kennung und Verbindlichkeit in der Arzneimittelforschung und Arzneitherapie, in:Deutsch [Anm. 1], S. 65, 67).
5 Bethge, Verbindlichkeit medizinisch-wissenschaftlicher Untersuchungen aus derSicht der klinischen Pharmakologie, in: Deutsch (Anm. 1), S. 95, 105.
6 Zur Problematik eines solchen Verständnisses am Beispiel der Chirurgie Winkler,Verbindlichkeit des anerkannten medizinischen Fortschritts in der Chirurgie, in:Deutsch (Anm. 1), S. 79, 82; vgl. auch Puchborn, Verbindlichkeit medizinisch-wissen-schaftlicher Aussagen in der ärztlichen Praxis, in: Deutsch (Anm. 1), S. 107, 110.
ZStW 97 (1985) Heft l
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAuthenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung 51
hat Mancher, der sich längst im Irrationalen bewegt, wird von demErfolg seiner Methode derart überzeugt sein, daß ihm Heilungswil-len nicht ohne weiteres abgesprochen werden kann. Strafrechtlichbetrachtet schimmert hier die Figur des Überzeugungstäters durch.Der Heilungswille ist also eine notwendige, aber keine hinreichendeBedingung für die Klassifikation eines Verhaltens als ärztlichesHandeln im materiellen Sinn.
Mit der Feststellung, daß der Außenseiter nicht außerhalb desärztlichen Bezugsfeldes steht, ist freilich noch nicht viel gewonnen.Wir haben ihn damit zwar aus der verhängnisvollen Umarmung mitdem Wunderheiler gelöst. Solange wir mit der Rechtsprechung dieHeilbehandlung aber als tatbestandliche Körperverletzung begrei-fen, verschafft ihm diese Einordnung jedenfalls kein strafrechtlichesHaftungsprivileg. Umgekehrt stellt sich die Frage, ob die Möglich-keit der rechtfertigenden Einwilligung in die Körperverletzung demQuacksalber zwar keinen Freibrief gibt, aber doch einen relativ gro-ßen Freiraum verschafft.
Auf der Binnenskala von Außenseitermethoden gibt es im übri-gen zahlreiche Graduierungen. Bezogen auf die Organisation des Be-rufsfeldes haben wir es zunächst mit jenen Außenseitermethoden zutun, die eigentlich nur die Speerspitze herrschender Denk- und For-schungsansätze darstellen und diese nur binnensystematisch weiter-zuentwickeln suchen. Eine ganz andere Position haben jene inne, diewider den Stachel locken. Für Ozontherapie oder Zelltherapie — umnur zwei Beispiele zu nennen — gelten im Vergleich zu einer neuenVariation der Kombination von Chemo- und Strahlentherapie beiMorbus Hotchkin insofern Besonderheiten, als bei ihnen das kon-ventionelle „Unterfutter" fehlt. Man mag darüber streiten, ob diesemGesichtspunkt qualitative Bedeutung zukommt. Nimmt man Selbst-und Fremdeinschätzung als Abgrenzungskriterien hinzu, so stehenfreilich bei unserem Thema die Dissentierer im Vordergrund undnicht jene, die nur eine neuartige Kombination einer schon bekann-ten Methode anwenden. Dessenungeachtet sind die Maßstäbe derBewertung durchaus vergleichbar. Insofern rückt auch der Heilver-such ins Bild7, dessen thematische Eigendynamik im folgenden je-doch vernachlässigt werden muß.
Der Begriff des Außenseiters setzt berufsfeldorientiert an. Diessollte uns freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß unser Bezugs-
7 Zu Recht behandelt Siebert (Anm. 1), S. 19, den Heilversuch als Unterfall des allge-meineren Problems der Methodenwahl. Vgl. im übrigen zu Heilversuch und klini-schem Experiment statt vieler Laufs, Arztrecht, 3. Aufl. 1984, S. 174 ff.
ZStW 97 (1985) Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

52 Heike Jung
punkt primär der Patient ist. Andererseits bringt der Begriff des Au-ßenseiters durchaus berufs- und gesellschaftspolitische Komponen-ten ins Spiel. Angesprochen ist damit nicht nur die Frage, ob Heilenein Vorrecht des Arztes ist. Wir werden vielmehr auch daran erin-nert, daß die Gesellschaft einem derart sensiblen Tätigkeitsfeld ge-steigerte Aufmerksamkeit widmet. Es geht dabei schließlich um denKernbereich menschlicher Existenz. Diese gesellschaftspolitischePriorität fordert die Ordnungsfunktion des Rechts heraus.
///. Die BewertungsmaßstäbeDie Auseinandersetzung um Möglichkeiten und Grenzen des
Heilberufs ist nicht erst in unseren Tagen entbrannt. Auch derKampf gegen Kurpfuscherei hat Tradition. So enthielt z. B. das „Chur-fürstlich Brandenburgische Medizinal-Edict und Ordnung" von 1685zahlreiche Behandlungsvorschriften, namentlich strenge Bestim-mungen über die Quacksalberei. Freilich war auch der Adressaten-kreis dieser Regelung relativ heterogen8. Die Professionalisierungdes Ärztestandes ging nur langsam vonstatten. Für die liberale Wirt-schafts- und Gesellschaftsordnung des 19. Jahrhunderts galt der Be-ruf des Arztes als „normales" Gewerbe-, die Ärzte unterfielen der Ge-werbeordnung des Norddeutschen Bundes von 1869. Dies impliziertedie Freiheit für jedermann, alles zu behandeln, und zwar grundsätz-lich ohne eine Erlaubnis einzuholen und ohne zuvor ein besonderesFachwissen nachweisen zu müssen9. Dieser Grundsatz der sog. Ku-rierfreiheit ist die gewerberechtliche Ausdrucksform der Zersplitte-rung der medizinischen Heilberufe und des Zögerns der Gesell-schaft, dem akademisch vorgebildeten Arzt eine Monopolstellungeinzuräumen. Dies ist sicher nicht nur eine Frage der Wirtschafts-ordnung und des Standesrechts, sondern eine gesundheitspolitischeEntscheidung, die jedermann berührt. Nun ist bekanntlich derGrundsatz der Kurierfreiheit durch das Heilpraktikergesetz von 1939beschnitten worden. Vielen ist dieser Schnitt jedoch nicht weit ge-nug gegangen. So hat der Bundesgesundheitsrat zuletzt 1983 für dieAufhebung der Kurierfreiheit votiert l°. Betrachtet man die Entwick-
8 Näher H. W. Schreiber/Rodegra, Die Entwicklung der Medizin im Einflußbereichjuristischer Kategorien, in: Jung/H. W. Schreiber (Hrsg.), Arzt und Patient zwischenTherapie und Recht, 1981, S. 27,33.
9 Zum Begriff der Kurierfreiheit Kohlhaas, Medizin und Recht, 1969, S. 99; vgl. auchBockelmann, Straf recht des Arztes, 1968, S. 14 Fn. 1.
10 Die Vollversammlung vom 12. 10.1983 hat die Frage, ob das Heilpraktikergesetz alszeitgemäße Regelung für die Heilkunde angesehen werden kann, verneint.
ZStW97(1985)Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

Außenseitennethoden und strafrechtliche Haftung 53
lung, so hat sich der Kreis derer, denen das Heilen gestattet ist, zu-nehmend verengt. Auf der anderen Seite ist Heilen nach unseremgesellschaftlichen Verständnis keine Prärogative des Arztes11. Derakademisch ausgebildete Arzt bildet sicher das Rückgrat der Ge-sundheitsvor- und -fürsorge. Rivalisierende Denkrichtungen im Ver-ständnis von Gesundheit und Krankheit und manuelle Geschicklich-keiten führen aber zwangsläufig zu einem nichtärztlichen Umfeld,das nicht pauschal kriminalisiert werden darf. Insofern erscheint es— jedenfalls unter strafrechtlichen Aspekten — problematisch, dieVornahme von Handlungen zu Heilzwecken nur dem Arzt zu erlau-ben 12. Andererseits sollte der Aktionsradius des Nichtarztes engergezogen werden. Die Folgenträchtigkeit vieler Eingriffe zwingt dazu,weit mehr medizinische Verrichtungen als bisher für Nichtärzte zutabuisieren, andere sogar nur dem Facharzt zu überantworten. DerGesetzgeber kann sicher, um mit Laufs zu reden, „unter dem Ge-sichtspunkt der Gefahrenabwehr das therapeutische Angebot be-grenzen und Zonen gesteigerter Risiken ausweisen, um sie dem Be-stimmungsrecht von Ärzten und Patienten zu entziehen"13. Eine ganzandere Frage ist es freilich, ob dies in Gestalt einer allgemeinen, dasGesundheitswesen regelnden, durch Strafbesümmungen angerei-cherten Gesetzgebung geschieht oder die strafrechtliche Figur desÜbernahmeverschuldens hierfür fruchtbar gemacht wird. Der Vor-zug des erstgenannten Ansatzes besteht darin, daß man nicht erstden Eintritt eines Schadens abwarten muß. Auf der anderen Seite be-darf eine derartige Pönalisierung im Vorfeld individueller Verletzun-gen besonderer Rechtfertigung. Hier entfaltet der Grundsatz der Ku-rierfreiheit eine wenn auch abgeschwächte Wirkung als spezifischerAusdruck der Handlungsfreiheit des Menschen, an der eine ord-nungspolitisch orientierte Strafvorschrift gemessen werden muß.
n Auch der Bundesgesundheitsrat konzediert ein subjektiv empfundenes Bedürfnisder Bevölkerung für eine nichtärztliche Ausübung der Heilkunde? vgl. III, 2 derStellungnahme.
12 Frankreich weist dagegen die Ausübung der Heilkunde ausschließlich den Ärztenzu; vgl. Art. L 372 Code de la sante publique. Gleiches gilt für Österreich; vgl. § 62öArzteG sowie § 184 öStGB. In der Schweiz ist die Rechtslage nicht einheitlich. Amgroßzügigsten in der Zulassung sog. freier Heiltätigkeit verfuhr bislang der KantonAppenzell-Außerrhoden. Auch dort sind aber Bestrebungen im Gange, die Zulas-sung sog. Naturärzte von dem Bestehen einer Prüfung abhängig zu machen,· vgl.Basler Zeitung vom 1. 11. 1984, S. 10.
13 Laufs (Anm. 1). Auch für die Bundesregierung ist durchaus offen, ob es bei den der-zeitigen Aufgabenfeldern des Heilpraktikerberufs bleiben kann? vgl. die Stellung-nahme des Parlamentarischen Staatssekretärs, Frau Krawatzki, in der Sitzung desDeutschen Bundestages vom 24. 11. 1983, BT-Prot. 10/2621 f., Anlage 14.
ZStW 97 (1985) Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

54 Heike Jung
Während der Grundsatz der Kurierfreiheit den allgemeinen be-ruflichen Handlungsspielraum des Menschen im Auge hat, zielt derGrundsatz der Behandlungsfreiheit oder Methodenfreiheit auf dasVorgehen selbst14. Ärztliches Handeln entzieht sich der Kanonisie-rung. Es wird diktiert von den Besonderheiten des Einzelfalles, vonder Notwendigkeit, der Individualität des Patienten gerecht zu wer-den. Ganz selten nur gibt es die Methode. Selbst wenn eine Methodeder Wahl existiert, ist ihr Anwendungsfeld durch persönliche Varia-blen bestimmt. Von der Methodenvielfalt gelangt das Strafrecht sehrschnell zur Anerkennung der Methodenfreiheit. Nur sie entsprichtdem Grundsatz der Autonomie des Patienten. Methodenvielfalt be-deutet freilich nicht unbedingt Gleichwertigkeit der Methoden. Viel-mehr sind die Methoden durchweg durch unterschiedliche Chancenund Risiken gekennzeichnet. Gerade hier entfaltet der Grundsatzder Autonomie des Patienten seine Wirkung. Der Patient muß infor-miert sein, dies um so mehr, je ungewöhnlicher oder neuartiger dieangewandte Methode ist. Der Patient muß abwägen und entscheidenkönnen. Wenn bei Methodenfreiheit immer die Autonomie des Pa-tienten mitgedacht wird, so stellt dies auch ein Votum gegen ärztli-chen Paternalismus dar. Gelegentlich wird dieser Paternalismus da-mit gerechtfertigt, daß der Patient zu einer kompetenten Entschei-dung nicht in der Lage sei. Gegenüber derartiger Bevormundung istschon grundsätzlich Vorsicht am Platze15. Wenn es um die Anwen-dung von Außenseitermethoden geht, ist für sie jedenfalls keinRaum. Dabei sollte nicht übersehen werden, daß der Anbindung andie Autonomie des Patienten für den Behandelnden Entlastungs-funktion zukommt. Die Bezugnahme auf den Grundsatz der Autono-mie des Patienten dürfte sich im übrigen eher als Einengung undnicht als Erweiterung des ärztlichen Handlungsspielraums auswir-ken. Genauer: Der Patient kann zwar unter zwei oder drei Behand-lungsmethoden entscheiden, er kann die Behandlung auch ablehnen.Es erscheinen jedoch Zweifel angebracht, ob die Berufung auf dieAutonomie des Patienten den medizinisch absolut sinnlosen, die kör-perliche Integrität verletzenden Eingriff zu rechtfertigen vermag.Hier bricht sich gesellschaftliches Wohlfahrtsdenken Bahn, ist dasallgemeine Spannungsverhältnis von individueller Entscheidungund sozialer Norm angesprochen. Dieses Spannungsverhältnis wird
14 Zum Unterschied von Kurier- und Behandlungsfreiheit Kohlhaas (Anm. 9); Carsten-sen(Anm. 2), S. 417.
15 Vgl. zu dieser Fragestellung allgemein Winsläde, Paternalism and Individualism inLegal and Ethical Aspects of Medicine, in: Doerr/Jakobs/Laufs (Hrsg.), Recht undEthik in der Medizin, 1982, S. 73.
ZStW97(1985)Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung 55
je nach dem betroffenen Rechtsgut unterschiedlich aufzulösen sein.Der einzelne darf über sein Vermögen ungenierter disponieren alsüber seine körperliche Integrität. Dies wirkt sich natürlich auf dieReichweite des strafrechtlichen Schutzes der körperlichen Integritäteinerseits und des Vermögens andererseits aus.
IV. Die Konsequenzen für die Ausgestaltungdes strafrechtlichen Schutzes
L Der Schutz des einzelnen Patientena) Tötungs- und Körperverletzungsdelikte
Die strafrechtliche Würdigung der Behandlung mit Außensei-termethoden wird von der bekannten Streitfrage um die Einordnungdes ärztlichen Heileingriffs überlagert16. Aber auch wenn man sichdie Auffassung der Rechtsprechung, wonach es sich bei dem Heilein-griff um eine tatbestandliche Körperverletzung handelt, nicht zuei-gen macht, kristallisieren sich einige spezifische Außenseiterpro-bleme heraus, denen man sich vom dogmatischen Ansatz unabhän-gig stellen muß. Legt man die herrschende Lehre zugrunde, wonachjedenfalls der gelungene, lege artis durchgeführte Heileingriff nichtals Körperverletzung qualifiziert werden kann, so erfolgt die Wei-chenstellung schon im Tatbestand. Folgt man der Rechtsprechung, somuß man — bei den Körperverletzungsdelikten — im wesentlichendrei hintereinandergeschaltete Prüfstellen durchlaufen, die freilichin einer gewissen Wechselbeziehung zueinander stehen: Pflichtwid-rigkeit, Einwilligung und Aufklärung sowie Sittenwidrigkeit. Dabeibaut die vorsätzliche Körperverletzung in dem Sinne auf der fahrläs-sigen auf, als der Handelnde den tatbestandsmäßigen Erfolg durcheine pflichtwidrige Handlung verwirklichen will17. Zu den Fragender Einwilligung und der Sittenwidrigkeit gelangt man nur bei denKörperverletzungs-, nicht dagegen bei den Tötungsdelikten.
aa) PflichtwidrigkeitDer Arzt ist bei der Wahl der Therapie nicht an die Methoden
der Schulmedizin gebunden18. Versuche, ihn verbindlich hierauf
16 Vgl. zum Streitstand nur den kurzen Überblick bei Otto, Grundkurs Strafrecht. Dieeinzelnen Delikte, 2. Aufl. 1984, S. 64.
i? Dies entspricht der Konzeption von Krauß, Zur strafrechtlichen Problematik der ei-genmächtigen Heilbehandlung, Festschrift für Bockelmann, 1979, S. 557,564.
18 Allgemeine Meinung, vgl. nur Bockelmann (Anm. 9), S. 87,· Siebert (Anm. 1), S. 39;Krauß, Der Kunstfehler oder zur Bedeutung juristischer Kategorien für die Bewer-tung ärztlichen Handelns, in: Jung/H. W. Schreiber (Anm. 8), S. 141,148 f.
ZStW 97 (1985) Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

56 Heike Jung
oder zumindest darauf festzulegen, daß er die mit an Sicherheit gren-zender Wahrscheinlichkeit beste oder weitaus wirksamste Methodeanzuwenden habe, sind zum Scheitern verurteilt. Das Strafrechtwürde sich sonst als Hemmnis für den medizinischen Fortschritt er-weisen. Hinzu kommt, daß eine derartige Bindung einem schemati-schen, die Individualität des Einzelfalls nicht hinreichend berück-sichtigenden Vorgehen Vorschub leisten würde19. Auch darf dasRecht im Hinblick auf die Autonomie des Patienten die Zahl der Be-handlungsvarianten nicht unvertretbar einschränken20. Man wirdden Behandelnden nicht einmal auf die weitaus wirksamste Me-thode festlegen können21. Dem Heilenden wird also ein Spielraumeröffnet. Dieser Spielraum ist jedoch nicht beliebig. Seine Grenzenwerden vielmehr durch Rationalitätskriterien, denen jeder Heilein-griff genügen muß, determiniert. Dabei kommt der Schulmedizinoder dem Stand der medizinischen Wissenschaft die Funktion einerArt Gegenkontrolle zu.
Conditio sine qua non rationalen Vorgehens ist zunächst diehinreichende Untersuchung des Patienten. Die Wahl einer bestimm-ten Methode ohne vorgängige vollständige Untersuchung ist daherper se pflichtwidrig22. Auch wer eine Behandlung übernimmt, ohnehierzu die erforderliche Sachkunde zu besitzen, läßt im Sinne einerÜbernahmefahrlässigkeit die gebotene Sorgfalt außer acht. Über-nimmt z.B. ein „Gesundbeter" ohne irgendwelche medizinischenVorkenntnisse die Behandlung eines Kranken, so liegt schon hierineine Pflichtwidrigkeit. Stellt sich erst im Laufe der Behandlung her-aus, daß der Behandelnde überfordert ist, so ist er verpflichtet, denPatienten an einen kompetenten Kollegen weiterzuüberweisen.Hierauf hat das Reichsgericht z. B. bei Behandlung einer Blinddarm-entzündung mit Naturheilmitteln abgestellt23. Es versteht sich imübrigen, daß bei der Behandlung selbst die gebotene Sorgfalt beach-tet werden muß24.
Der Plausibilitätsvorschuß des status quo wirkt sich dahin aus,daß der Handelnde nicht nur über Kompetenz, sondern auch über19 Wie hier Siebert (Anm. 1), S. 38 f.20 Ähnlich Siebert (Anm. 1), S. 39.21 Ebenso Siebert (Anm. 1), S. 53.22 Vgl. zu den Anforderungen an die Untersuchung RGSt.74, 350, 351; BGH NJW
1960, 2253, 2254.23 RGSt. 67, 12; vgl. auch RGSt. 74, 60, sowie Siebert (Anm. 1), S. 86 ff. Der Bundesge-
richtshof hat diese Linie weiterverfolgt und es z. B. als fahrlässige Tötung qualifi-ziert, daß ein Arzt seine interne Tumortherapie bei erkennbarer Erfolglosigkeit wei-ter angewandt und nicht zu einer Operation geraten hat, BGH NJW 1962, 1780.
24 Näher Siebert (Anm. 1), S. 45 ff.ZStW 97 (1985) Heft l
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAuthenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung 57
die Kompetenzkompetenz verfügen muß. Er muß also zu einem Ver-gleich der Therapiemöglichkeiten befähigt sein und einen solchenVergleich auch tatsächlich anstellen25. Je konsolidierter die Schul-medizin ist, desto stärker ist auch die Prüfungspflicht, die auf demAußenseiter lastet. Zum Schwur kommt es bei der Gabe völlig un-wirksamer Mittel. Es dürfte sich dabei freilich nur um eine kleineRestkategorie handeln, da in diesen Fällen durchweg schon ein Ver-stoß gegen die vorgenannten Pflichten vorliegen dürfte26. Man wirddie Strafbarkeit sicher nicht mit einem statistischen Wirksamkeits-nachweis koppeln können in der Form, daß der Fehlschlag eines sol-chen Wirksamkeitsnachweises zu Lasten des Außenseiters geht27.Andererseits gibt es in diesem Bereich — abgehoben von jeder Stati-stik — Evidenzerlebnisse dergestalt, daß „jeder vernünftige Menschsich an den Kopf faßt". Ein Verstoß gegen die Sorgfaltsanforderungenliegt mithin dann vor, wenn ein Heilerfolg unter jedem rationalnachvollziehbaren Gesichtspunkt ausscheidet28. Nur insoweit kanndas Strafrecht seine Toleranz in inhaltlicher Hinsicht aufgeben. An-sonsten muß sich das Strafrecht auf die Statuierung bestimmter eherformaler Sollanforderungen, Sachkunde und Vorgehensweise betref-fend, beschränken. Immerhin ist die Freiheit der Methodenwahl aufdiese Art eingebunden in einen Kanon von Sorgfaltspflichten, wel-che die Verfahrensqualität gewährleisten29.
bb) Einwilligung und AufklärungWirksam ist die Einwilligung in die Körperverletzung bekannt-
lich nur, wenn der Patient weiß, worin er einwilligt, wenn also eineangemessene Aufklärung voraufgegangen ist. Dies ist die zwangsläu-fige Konsequenz des Selbstbestimmungsrechts des Patienten. Ge-rade bei Außenseitermethoden sind an die Aufklärung besondereAnforderungen zu stellen, damit der Patient sein Selbstbestim-
25 Siehe auch Laufs (Anm. 1), S. 1385; Siebert (Anm. 1), S. 63 f.26 Dies belegt auch die in diesem Zusammenhang gerne zitierte Entscheidung BGH
LM Nr. 6 zu § 230, die u. a. die Verordnung einer Thuja-Lösung in einer absolutwirkungslosen Verdünnung an einen Krebskranken betrifft. Denn der Bundesge-richtshof ist angesichts einer Reihe anderer Sorgfaltsverstöße gar nicht zu derFrage der Unwirksamkeit des Mittels vorgedrungen.
27 Siebert (Anm. 1), S. 77 ff., hat überzeugend herausgearbeitet, daß sich auch aus denihrerseits nicht unumstrittenen Wirksamkeitsforderungen des Arzneimittelgeset-zes für die Beurteilung der Wirksamkeit einer Therapie nichts anderes ergibt.
28 Wie hier Siebert (Anm. 1), S. 81 ff.29 Laufs (Anm. 1), S. 1385; ders. (Anm. 7), S. 17.
ZStW 97 (1985) Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

58 Heike Jung
mungsrecht wirklich ausüben kann30. Dementsprechend hat dieRechtsprechung betont, daß gerade bei Operationen, die nicht ein-deutig indiziert sind und mit denen erhebliche Risiken verbundensind, die Aufklärung ausführlicher erfolgen müsse als bei Standard-behandlungen31. Insgesamt muß die Aufklärung so erfolgen, daß derPatient Wesen, Bedeutung und Tragweite des Eingriffs in seinenGrundzügen erkennen kann32. Wie ausführlich die Aufklärung seinmuß, hängt letztendlich davon ab, welche Informationen der Patientbenötigt, um sein Selbstbestimmungsrecht ausüben zu können.
Vor einer Anwendung von Außenseitermethoden müssen daherimmer auch andere mögliche Behandlungsarten dargestellt werdenbzw. die Folgen einer Nichtbehandlung aufgezeigt werden, unter an-derem, damit sich der Patient entscheiden kann, ob er lieber be-stimmte Einschränkungen auf sich nimmt, als sich einer wenig er-probten Behandlungsmethode zu unterziehen33. Auch muß der Arztdeutlich machen, daß und warum er von der Standardbehandlung ab-weichen will. Er darf keine Zweifel darüber bestehen lassen, daß dasvon ihm angewandte Verfahren eine Außenseitermethode dar-stellt34. Dies schließt eine Vorstellung der Verfahren der Schulmedi-zin ein, damit die notwendigen Fakten für die Abwägung auf demTisch liegen35. Weist der Arzt nicht darauf hin, daß er eine Außensei-termethode anwenden will, wird die Einwilligung in der Regel un-wirksam sein. Denn normalerweise erwartet der Patient, nach den„gesicherten" Erkenntnissen der Wissenschaft behandelt zu werden.Der Behandelnde kann seine Aufklärungspflicht aber auch dadurchverletzen, daß er den Patienten über die Schwere seiner Krankheitund die Ungeeignetheit homöopathischer Mittel im unklaren läßt,um ihn so davon abzuhalten, sich einer anderen Therapie zu unter-ziehen36.
Abstriche von diesen gesteigerten Anforderungen an die Auf-klärung wird man nur dann machen können, wenn in der Arztwahltt» Giesen, Wandlungen des Arzthaltungsrechts, 1983, S. 67. Für Arzt/Weber, Straf-
recht Bes. Teil, Lehrheft l, 2. Aufl. 1981, S. 120, stellen die gestiegenen Aufklärungs-erfordernisse eine verschleierte Parteinahme des Rechts gegen den Außenseiterdar.
31 BGH NJW 1981, 633.32 Auf die in den Einzelheiten kontroverse Diskussion über die Anforderungen des
Rechts an die Aufklärung des Patienten kann in diesem Zusammenhang nicht ein-gegangen werden; vgl. statt vieler Kern/Laufs, Die ärztliche Aufklärungspflicht un-ter besonderer Berücksichtigung der richterlichen Spruchpraxis, 1983.
33 Deutsch, Das Recht der klinischen Forschung, 1979, S. 49.34 Kohlhaas (Anm. 9), S. 80,· Siebert (Anm. 1), S. 126.35 Siebert (Anm. 1), S. 129; Laufs (Anm. 7), S. 124 f.36 BGH LM Nr. 6 zu § 230 StGB,· Kohlhaas (Anm. 9), S. 80.
ZStW97(1985)HeftlBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung 59
ein bewußtes Bekenntnis zur Anwendung von Außenseitermethodengesehen werden kann37. In solchen Fällen, und nur in solchen Fällen,ist auch ein wirksamer Aufklärungsverzicht vorstellbar.
Das Institut der mutmaßlichen Einwilligung wird nur in selte-nen Fällen zur Rechtfertigung einer Behandlung mit Außenseiterme-thoden herangezogen werden können. Dies käme in Betracht, wennanzunehmen ist, daß der Patient gerade die Behandlung mit der Au-ßenseitermethode gewollt hätte, z. B. wenn bekannt ist, daß er An-hänger der homöopathischen Richtung der Medizin ist, oder wennmit den Methoden der Schulmedizin keine Heilung möglich ist38. Inallen anderen Fällen verbietet die ratio des Rechtfertigungsgrundesder mutmaßlichen Einwilligung die Ajinahme, daß der Patient in dieBehandlung mit einer Außenseitermethode eingewilligt hätte.
cc) SittenwidrigkeitDie Einwilligung ist unwirksam, wenn die Tat sittenwidrig ist.
Der Begriff der Sittenwidrigkeit ist durch generalklauselartige Weitegekennzeichnet39. Die Analyse wird zusätzlich dadurch erschwert,daß gerade bei der Betrachtung medizinischer Außenseitermethodendie inneren Wechselbeziehungen zwischen Pflichtwidrigkeit, Einwil-ligung und Sittenwidrigkeit hervortreten40. Diese erklären sich dar-aus, daß die Grenzen der Therapiefreiheit auf denselben Gedankendes ordre public zurückzuführen sind, wie er in § 226 a StGB alsGrenze der Dispositionsbefugnis des Patienten zum Ausdruck ge-kommen ist. In unserem Zusammenhang gewinnt die Prüfstelle „Sit-tenwidrigkeit" besondere Bedeutung, weil sich erst hier entscheidet,ob der Wille des Patienten die Vornahme eines medizinisch sinnlo-sen Eingriffs zu rechtfertigen vermag41.
Wer Methoden der Schulmedizin anwendet, wird sich mit§ 226 a StGB kaum auseinandersetzen müssen. Bei der Anwendung37 Ähnlich Siebert (Anm. 1), S. 131.38 Sieöerf(Anm.l),S.U7.39 Vgl. den Versuch einer Konkretisierung von Roxin, Verwerflichkeit und Sittenwid-
rigkeit als unrechtsbegründende Merkmale im Straf recht, JuS 1964, 373.40 In der Argumentation von Siebert (Anm. 1), S. 79, haben sich die Ebenen prompt
ineinander verschoben. Er stützt nämlich seine These, wonach die Anwendung ei-ner absolut unwirksamen Heilmethode per se sorgfaltswidrig sei, auf § 226a StGB.
41 Auch wenn man dies, wie der Bundesgerichtshof (BGH NJW 1978, 1206 = JR 1978,518) als Frage der Beachtlichkeit der Einwilligung auf der vorgelagerten Ebene derAnforderungen an die Einwilligungserklärung behandelt, stellen sich dieselbenSachprobleme. Der Ansatz des Bundesgerichtshofes in dieser Entscheidung istgleichwohl verfehlt, weil er eine Bewertung vornimmt, die mit der Ebene „Einwilli-gung und Aufklärung" nichts mehr zu tun hat; vgl. auch Hruschka JR 1978, 519, 521;Eser, in: Schönke/Schröder, 21. Aufl. 1982, § 223 Rdn. 50.
ZStW97(1985)HeftlBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

60 Heike Jung
von Außenseitermethoden bewegt man sich schon eher in Reich-weite des Verdikts der Sittenwidrigkeit. Dabei geht es natürlichnicht an, den Grundsatz der Therapiefreiheit über §226 a StGB zukorrigieren. Wenn freilich durch die Behandlung die Menschen-würde des Patienten verletzt würde, bzw. die Behandlung einenmenschenunwürdigen körperlichen Zustand des Kranken bewirkenwürde, läge ein Verstoß gegen die guten Sitten vor.
Als Problem der Sittenwidrigkeit stellt sich aber eben auch dieFrage dar, ob der Arzt einen vom Patienten gewünschten, medizi-nisch indessen nicht indizierten Eingriff vornehmen darf. Die folgen-den drei Konstellationen mögen dies illustrieren:
1. Eine Schwangere drängt darauf, mit Kaiserschnitt entbundenzu werden, obwohl gynäkologisch hierzu keine Veranlassung be-steht. Es sei dabei unterstellt, daß der Eingriff für das Kind kein er-höhtes Risiko mit sich bringt.
2. Eine Patientin, die seit Jahren ständig unter Kopfschmerzenleidet, kommt — nachdem vielfältige andere ärztliche Bemühungenerfolglos geblieben sind — zu einem Zahnarzt mit dem Ansinnen,dieser möge ihr alle Zähne ziehen. Der Arzt versichert ihr nach meh-reren gründlichen Untersuchungen, daß für diesen Eingriff medizi-nisch keine Veranlassung bestehe, zieht ihr auf ihr Drängen dannaber doch 16 Zähne. Das Kopfweh der Patientin bessert sich nicht42.
3. Der Patient bittet den Chirurgen, ihm den Unterarm zu ampu-tieren, weil er sich einbildet, daß in seinem Handgelenk eine bösar-tige Geschwulst sitzt43.
Die Fälle sind erkennbar auf einer gleitenden Skala zur Sitten-widrigkeit und — wenn man so will — zur Pflichtwidrigkeit hin an-gesiedelt. Während wir im ersten Fall die Sittenwidrigkeit des Han-delns eindeutig verneinen und im letzten Fall eindeutig bejahenkönnen, liegt die Antwort im zweiten Fall nicht so klar zutage. Wirsind angesichts dei besonderen Belastungen des Geburtsvorgangsbereit, der Schwangeren eine relativ große Dispositionsfreiheit ein-
42 BGH NJW 1978, 1206. Der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung wegen Körper-verletzung allerdings darauf gestützt, daß keine wirksame Einwilligung vorgelegenhabe (vgl. auch Anm. 41). Der Sachverhalt wird hier im Anschluß an Hörn, Der me-dizinisch nicht indizierte, aber vom Patienten verlangte Eingriff — strafbar? —BGH NJW 1978, 1206, JuS 1979, 29, vereinfacht wiedergegeben, um die Fragestel-lung klarer herauszuarbeiten.
43 übernommen von Frühauf/Franke/Jung/Teschke, Heilversuch: Tagungsberichtüber das 2. Kolloquium des arztrechtlichen Studienkreises im Saarland, Saarländi-sches Arzteblatt 1978,535.
ZStW 97 (1985) Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung 61
zuräumen. Dies schlägt schon bei der Bewertung der Pflichtwidrig-keit durch. Andererseits sind wir nicht gewillt, medizinisch absurdeEingriffe zu tolerieren.
Der zweite Beispielsfall zeigt jedoch, daß sich das Problem nichteinfach auf die Formel bringen läßt, die Vornahme medizinisch nichtindizierter Eingriffe sei allemal sittenwidrig. Vielmehr muß bei derEntscheidung zusätzlich berücksichtigt werden, wie weit man sichvon medizinisch nachvollziehbaren Erklärungs- und Handlungsmu-stern wegbewegt, vielleicht auch, ob der Eingriff in einem anderenLegitimationszusammenhang akzeptiert würde. So liegt die beson-dere Note des „Zahnarztfalles" gerade darin, daß derartige Eingriffeangesichts der „Fokaltheorie" medizinisch nicht von vornherein ab-wegig sind und daß außerdem der Eingriff unter dem Rubrum „kos-metische Operation" allemal gerechtfertigt gewesen wäre. Geht manaber davon aus, daß das Sittenwidrigkeitsurteil eindeutig objektivier-bar sein muß, so müssen sich die verbleibenden Zweifel zugunstendes Handelnden auswirken.
b) Der Schutz des VermögensEine Patientin ist an Krebs erkrankt und von den Ärzten aufge-
geben. Ihre Mutter wendet sich an einen „Geistheiler", der in einerAnzeige damit geworben hat, daß er auch in hoffnungslosen Fällen„100 o/o" helfen könne. Der „Geistheiler" erklärt, er sei in der Lage,durch Handauflegen zu heilen, und habe schon viele solche Fälle er-folgreich behandelt. Er legt der Tochter mehrmals die Hand auf undverschreibt ihr außerdem einen Tee. Sodann meint er, die Behand-lung könne künftig im Wege der Fernheilung erfolgen. Sie solltennur beide immer zwischen 9 und 10 Uhr an ihn denken. Im Ver-trauen auf die Zusage der Heilung zahlt die Mutter die verlangten1000 DM. Ein Erfolg tritt nicht ein, obwohl Mutter und Tochter zudem vereinbarten Zeitraum intensiv an den „Geistheiler" gedacht ha-ben. Die Tochter verstirbt44. —
Verzweiflung oder Aberglaube machen den Scharlatan zumHoffnungsträger. Nur: Soll er ungestraft mit der Leichtgläubigkeitder Menschen Geschäfte machen dürfen, pointierter noch, soll derBetrugstatbestand immer dann leerlaufen, wenn Akte des Glaubensim Spiel sind? Verdient andererseits derjenige strafrechtlichenSchutz, der sich selbst bei nüchterner Betrachtung sagen muß und
44 Einem von mehreren Fällen, die einer Entscheidung des LG Saarbrücken vom11.5. 1981 — Az.: 5—4/81 — zugrunde lagen, nachgebildet.
ZStW 97 (1985) Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

62 Heike Jung
vielleicht auch sagt, daß von einem solchen Vorgehen keine Heilungzu erwarten ist? Daß dieses Geschäft mit der Hoffnung allemal unse-riös und moralisch vorwerfbar ist, steht fest. Dies allein stempelt dasVerhalten aber noch nicht zum strafbaren Betrug. Strafrechtsdogma-tisch betrachtet geht es um die Reichweite des strafrechtlichenSchutzes in Fällen bewußter Selbstschädigung.
Nun ist irgendein Mitverschulden beim Betrogenen ja regelmä-ßig festzustellen. Insofern steht unser Beispielsfall paradigmatischfür das zentrale kriminalpolitische und dogmatische Problem des Be-truges, ob und wie der Gedanke der Mitverantwortlichkeit des Op-fers für den Schutz seiner Rechtsgüter bei § 263 StGB Verwendungfindet45. In den Kategorien des Betrugstatbestandes gedacht, handeltes sich primär um eine Frage des Irrtums, wenn auch ein enger Zu-sammenhang mit dem strafrechtlichen Vermögensbegriff besteht46.
Ging es bei der Diskussion zunächst eher global um die Legiti-mation des strafrechtlichen Schutzes in Fällen bewußter Selbstschä-digung, so hat sich der Streit zunehmend auf das Verständnis des Irr-tumsbegriffs zugespitzt. Während Giehring47 meint, von Irrtumkönne erst die Rede sein, wenn der Getäuschte an die überwiegendeWahrscheinlichkeit der Angaben des Täuschenden glaube, plädierenAmelung*8, R. Hassemer^ und Schünemann50 in zum Teil unter-schiedlicher Nuancierung der Sache nach dafür, bei selbstaufhebba-ren Zweifeln den Irrtum zu verneinen. Hillenkamp hält dagegen, daßdamit im Grunde behauptet werde, es irre nicht, wer irrt51. SeinesErachtens ist die dahinterstehende Propagierung des Selbstschutzesdes Opfers als Korrektiv des Betrugstatbestandes sowohl dogmatischals auch kriminalpolitisch verfehlt.
Beide Seiten nutzen im Grunde den Irrtumsbegriff nur als In-strument, um die kriminalpolitischen Prämissen des Betrugstatbe-45 In Anlehnung an Arzt, Strafrecht, Bes. Teil, Lehrheft 3, 1978, S. 120 f.46 Vgl. zu den Wechselbeziehungen schon Ellscheid, Das Problem der bewußten
Selbstschädigung beim Betrug, GA 1971, 161; Cramer, Vermögensbegriff und Ver-mögensschaden im Straf recht, 1968, S. 203, und Schünemann, Einige vorläufige Be-merkungen zur Bedeutung des viktimologischen Ansatzes in der Strafrechtsdogma-ük, in: H. J. Schneider (Hrsg.), Das Verbrechensopfer in der Strafrechtspflege, 1982,S. 407, 415 f., der den Ausweg über die Ausweitung des Schadensbegriffs als ge-quälte Hilfskonstruktion bezeichnet.
47 Prozeßbetrug im Versäumnis- und Mahnverfahren — zugleich ein Beitrag zur Aus-legung des Irrtumsbegriffs in § 263 StGB, GA 1973, l f.
48 Amelung, Irrtum und Zweifel des Getäuschten beim Betrug, G A 1977, l ff.49 R, Hassemer, Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, 1981.50 Schünemann (Anm. 46).51 Hillenkamp, Vorsatztat und Opferverhalten, 1981, S. 139.
ZStW 97 (1985) Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung 63
Standes bloßzulegen. Mehr noch: Wenn beide Seiten zur Begrün-dung die Opferperspektive ins Spiel bringen, zeigt dies nur, daß wires mit einem der Indikatoren für das Selbstverständnis staatlichenStrafens zu tun haben. Damit erreicht die Debatte freilich einen All-gemeinheitsgrad, der Giehrings richtigen Ansatz, die subjektivenAnforderungen an den Irrtumsbegriff zu präzisieren, zu verschüttendroht.
Auf unsere Problemstellung bezogen müssen wir festhalten, daßdie innere Einstellung des Geschädigten in derartigen Fällen nichtimmer dieselbe ist. Vielfach werden die Zweifel einfach verdrängt.Bisweilen wird der Geschädigte indessen skeptisch bleiben, sich aufdie Sache aber mit der Einstellung „vielleicht ist ja doch etwas dran"einlassen. Auf dem Boden der These, wonach bei selbstaufhebbarenZweifeln ein Irrtum ausscheide, gelangt man jedenfalls dann, wenn— wie in unserem Fall — die Ausstrahlung des Geistheilers die ra-tionalen Reaktionsmuster des ohnehin in eine ausweglose Situationverstrickten Opfers lahmlegt, zur Annahme eines Irrtums. Mankönnte sich allenfalls fragen, ob die situativ bedingte Herabsetzungder Kritikschwelle, die freiwillige Gläubigkeit des Opfers, der Ver-lust der Selbstschutzmechanismen zu Lasten des Täters gehen dür-fen. In der Tat kann über die Selbstaufhebbarkeit des Irrtums nichtabstrakt, sondern nur aufgrund einer Würdigung der situativen undpersönlichen Variablen der Konstellation entschieden werden. Jegrößer dabei der rationale Bewegungsspielraum des Opfers bleibt,desto eher haben wir es mit einem „normalen" Risikogeschäft zu tun.Wer aber bewußt ein Risiko eingeht, verdient den Schutz des Be-trugstatbestandes nicht. Denn der Schutz des Betrugstatbestandesendet an der autonomen Selbstschädigung durch das Opfer.
Nur: Bei welchem Grad von Zweifel ist diese Grenze erreicht,anders gewendet, was macht den Irrtum aus? überwiegend geht mandavon aus, daß Zweifel das Vorliegen eines Irrtums überhaupt nichthinderten, wenn der Getäuschte letztlich diese Zweifel überwindeund die Fehlvorstellung für die richtige halte, denn der Zweifelnde,aber schließlich doch überzeugte, sei nicht weniger schutzwürdig alsder Leichtgläubige52. Diese Auffassung legt indessen in die Tatsache,daß der Betreffende „trotzdem" handelt, zuviel hinein: Sie postuliertdamit nicht nur ein eindeutiges Ergebnis des Abwägungsprozesses,sondern auch, daß die Handlung des Opfers dem Ergebnis dieses Ab-
52 So z.B. Otto (Anm. 16), S. 216; ausführlich zum Streitstand Samson, in: SK, §263Rdn. 52 ff.
ZStW97(1985)HeftlBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

64 Heike Jung
wägungsprozesses entspricht. Vielfach ist jedoch nicht Überzeugungdie Triebfeder des Handelnden, sondern das Opfer will nur eineChance nicht fahren lassen, die von ihm selbst als eher irreal einge-schätzt wird. Nun lassen sich die subjektiven Vorstellungen vornRealitätsgehalt einer Erklärung nicht quantifizieren. Davon beziehtdie These der herrschenden Meinung, die die tatsächlich motivie-rende Wirkung auch der bloßen Möglichkeitsvorstellung für den Irr-tum genügen läßt, ihre Überzeugungskraft53. Ihre Position erscheintfreilich insofern angreifbar, als sie letztlich aus der Tatsache der Ver-fügung auf den Irrtum schließt. Umgekehrt erscheint es verfehlt, denIrrtum nur dann auszuschließen, wenn dem Getäuschten die Wahr-heit der Erklärung gleichgültig ist54. Richtig ist freilich, daß Irrtumnicht nur eine Frage von Kenntnis oder Unkenntnis, sondern aucheine Frage von innerer Einstellung dazu ist55. Insofern kann man voneinem Irrtum im Sinne des § 263 StGB nicht sprechen, wenn der Ge-täuschte die Unwahrheit der Erklärung bewußt in Kauf nimmt. Seel-mann will nun nicht einsehen, daß derjenige schutzwürdiger sei, derinfolge extremer Leichtgläubigkeit bei im übrigen gleichen Voraus-setzungen an der Wahrheit der Behauptung nicht im geringsteinzweifelt56. Indessen erscheint eine Differenzierung zumindest danngerechtfertigt, wenn — wie in unserem Ausgangsfall — das Opfer inseiner Handlungskompetenz derart beeinträchtigt ist, daß es denMachenschaften des Täuschenden nichts entgegensetzen kann. Inso-fern darf die Korrektur des Betrugstatbestandes nicht an der extre-men Leichtgläubigkeit ansetzen57, sondern muß das Risikogeschäftunter annähernd gleichwertigen Partnern im Auge haben. Will manauch in derartigen Fällen strafrechtlichen Schutz gewähren — unddies erscheint jedenfalls in dem hier angesprochenen Bezugsrahmendurchaus erwägenswert — , so verläuft der systemadäquate Wegüber eine Ausweitung der schon existierenden Schutzvorschriftendes Heilmittelwerbegesetzes 58.53 Bezeichnenderweise. entscheidet sich Samson, in/. SK, § 2£3. Rdru. 63.,
lung von Alternativen für die herrschende Lehre.54 So aber Otto (Anm. 52).55 Dagegen freilich Giehring (Anm. 47), S. 19 ff. Giehring will allein auf das Ergebnis
des rationalen Erkenntnisaktes abstellen, bemüht aber selbst zur Abgrenzung diesubjektive Einschätzung des Wahrscheinlichkeitsgrades durch den Betroffenen(a. a. O., S. 21). Die Grenze zwischen subjektiver Einschätzung und Einstellung ist je-doch fließend.
56 Seelmann, Grundfälle zu den Straftaten gegen das Vermögen als Ganzes, JuS 198'2,268, 270.
57 Ansätze dazu bei Seelmann (Anm. 56).58 Vgl. aus der Rechtsprechung zum Heilmittelwerbegesetz nur BGH NJW 1984, 1406 ,
und BGH NJW 1984, 1407.ZStW 97 (1985) Heft l
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAuthenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung 65
2 Der Schutz der allgemeinen GesundheitsfürsorgeAn den Behandelnden werden komplexe Anforderungen ge-
stellt. Der Zugang zum Heilberuf bedarf deswegen der Reglementie-rung. Der Staat kann sich nicht mit dem Hinweis auf die Präventiv-wirkung der Körperverletzungs- und Vermögensdelikte freizeich-nen. Angesichts des hohen Ranges der Schutzgüter Leben und Ge-sundheit ist es vielmehr gerechtfertigt und notwendig, das Strafrechtschon im Vorfeld der Verletzung von Individualrechtsgütern als Mit-tel der sozialen Kontrolle einzusetzen. Wer Kurierfreiheit absolutsetzt, beschwört ein unübersehbares Gefahrenpotential herauf. DerGesetzgeber hat dies auch nicht getan. Bekanntlich stellt § 5 Heil-praktikergesetz (HPG) die Ausübung der Heilkunde ohne die nach§ l HPG erforderliche Erlaubnis unter Strafe. Die Zulassung zumHeilpraktiker stellt freilich die einzige Hürde für denjenigen dar, derdie Heilkunde ausüben möchte. Viele meinen nun, diese Hürde seizu niedrig angesetzt. Richtig ist, daß die Zulassung zum Heilprakti-ker nur daran gebunden ist, daß nicht nachweisbare oder höchst-wahrscheinliche Gefahren für die allgemeine Gesundheit entgegen-stehen59. Zwar wird dabei geprüft, ob die Ausübung der Heilkundedurch den Antragsteller eine Gefahr für die Volksgesundheit bedeu-tet, es werden aber keine medizinischen Fachkenntnisse verlangt.
Weiter ist richtig, daß das Heilpraktikergesetz selbst das Tätig-keitsfeld des Heilpraktikers nicht begrenzt. Auch wenn eine Reihevon gesetzlichen Regelungen sektorale absolute Kurierverbote fürNichtärzte statuiert60, bleibt ein Unbehagen, daß Heilpraktiker auchnicht ganz ungefährliche Therapieformen wie Akupunktur und In-jektionen aller Art vornehmen dürfen und auch vornehmen. Die Be-handlung von Patienten ausschließlich dem Arzt zuzuweisen, er-scheint zwar als gesetzgeberische Übermaßreaktion. Auf der ande-ren Seite wird der Gesetzgeber nicht umhin können, das Berufsbilddes Heilpraktikers, seine Ausbildung und seinen Tätigkeits- und
59 Grundlegend BVerfG NJW 1958, 1035.60 So z. B. die Ausübung der Zahnheilkunde (§ l ZahnheilkundeG), die Untersuchung
und Behandlung von Geschlechtskrankheiten (§ 9 GeschlechtskrankheitenG), DasVerschreiben von Betäubungsmitteln und stark wirkenden Medikamenten (§13BtMG und § 48 ArzneimittelG), das Behandeln von meldepflichtigen Erkrankungenim Sinne des § 30 BSeuchG und die Geburtshilfe (§ 4 HebammenG). Auch sonstweist das Gesetz die Vornahme bestimmter Tätigkeiten ausschließlich dem Arzt zu.Dies gilt z. B. für die Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs im Rahmen des§218 a StGB, die Blutentnahme nach §78 StPO und die Ausstellung des Toten-scheins.
ZStW97(1985)HeftlBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

66 Heike Jung
Verantwortungsbereich präziser zu umreißen61. Bei der Abgrenzungdes Tätigkeits- und Verantwortungsbereichs könnten sich als Ver-gleichsmaßstab die Grundsätze als hilfreich erweisen, die für die Un-terstützung des Arztes durch nichtärztliches Assistenzpersonal ent-wickelt worden sind. Danach sollten therapeutische Eingriffe, derentechnische Abwicklung besondere Gefahrenquellen birgt, dem Arztvorbehalten bleiben; zumindest müssen ärztliche Aufsicht und Über-wachung gewährleistet sein62.
V. SchlußbetrachtungDie Aufgabe des Rechts ist fast unlösbar: Auf der einen Seite
sollen wir den individuellen Handlungsspielraum des Arztes garan-tieren, zugleich aber auch positive Richtwerte für die Behandlungaufstellen. Es sollte deswegen nicht überraschen, daß das Strafrechtsich aus der Methodendiskussion weitgehend heraushält. Immerhinstatuiert es aber eine Reihe von Standards scheinbar formeller Na-tur, die das Risiko, das die Verfolgung einer extremen Richtung im-mer birgt, abmildern. Die Schwierigkeiten der materiellen Grenzzie-hung werden überlagert von den Beweisfragen. Insofern stoßen wirauch auf die allgemeine Problematik des medizinischen Sachverstän-digen, wobei die Auswahl des Sachverständigen angesichts des Kon-flikts „Schulmedizin contra Außenseitermethoden" besonders heikelerscheint. Unsere Fragestellung wird zusätzlich verkompliziertdurch ihren standespolitischen Einschlag.
Sicher muß angesichts der zunehmenden Komplexität undTechnisierung des medizinischen Handlungsfeldes auch der Grund-satz der Kurierfreiheit — genauer: das, was von ihm noch übrigge-blieben ist, — überdacht werden. Auf der anderen Seite müssen sichdie Ärzte mit dem Phänomen auseinandersetzen, daß just jene Tech-nisierung der Medizin zur Renaissance der Naturheilverfahren bei-getragen haben dürfte. Auch unter den Ärzten scheint insoweit einUmden.kurLgs.proTÄß eingesetzt zu kaben, was, man daran ablesenmag, daß nach einer Umfrage immerhin mehr als die Hälfte derÄrzte für Allgemeinmedizin zumindest auch Außenseitermethodenbenutzt63.
61 Der Gesetzgeber scheint sich dem auch nicht verschließen zu wollen, wie sich ausder Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs, Frau Krawatzki, ergibt(Anm. 13).
62 Vgl. dazu die Thesen des Medizinisch-Juristischen Arbeitskreises Saar zur Verant-wortlichkeit des Arztes bei Arbeitsteilung, Saarländisches Ärzteblatt 1982, 43 ff.; so-wie Hahn, Die Haftung des Arztes für nichtärztliches Personal, 1981.
63 Nachweise bei Gross (Anm. 1), S. 50.ZStW 97 (1985) Heft l
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAuthenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM

Außenseitermethoden und strafrechtliche Haftung 67
Die Konzeption des Gesetzes, die dem Heilpraktiker eine ArtAllkompetenz im medizinischen Bereich zuweist, ist sicher verfehlt.Ob man die Kurierfreiheit gänzlich aufheben soll, wird unter ande-rem von der empirischen Klärung der Frage abhängen, in welchemUmfang sich Heilpraktiker an gefahrträchtige Behandlungsformenheranwagen und welche Schäden dabei bislang aufgetreten sind.
Oberhaupt bewegen wir uns auf einem empirisch nur wenig ge-sicherten Boden. Damit holt uns aber unser Grunddilemma ein, wiewir eigentlich zwischen gefährlichen therapeutischen Irrwegen undentwicklungsträchtigen Außenseitermethoden unterscheiden sollen.
ZStW 97 (1985) Heft lBrought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated | 10.248.254.158Download Date | 9/5/14 3:59 AM