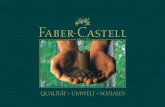Balde, Agncola und Faber, Stengel: Ingolstädter … Blaetter 2016... · Gretser, Agricola, Faber...
Transcript of Balde, Agncola und Faber, Stengel: Ingolstädter … Blaetter 2016... · Gretser, Agricola, Faber...

JAHRGANG 7 · AUSGABE NR . 62 · 2016
Balde, Agncola und Faber, Stengel: Ingolstädter Beiträge zum Jesuitentheater
Das Jesuitentheater war eine Antwort auf die Reformation
Von Gerd TrefferVom Herzog gerufen
kamen 1549 mit Petrus Cani-sius, Alphons Salmeron und Claudius Jajus die ersten (und herausragenden) Vertreter des jungen Jesuitenordens nach Ingolstadt, um eine nach dem Tod des großen Luther-gegners Professor Johann Eck entstandene „theologische Lücke“ zu schließen. Der Her-zog hatte, noch vor dem Epi-skopat, entschlossene Schrit-te unternommen, sein Land beim alten Glauben zu halten.
Den Jesuiten war von Wii-heim IV. der Bau eines eige-nen Kollegs zugesichert wor-den, der sich nach seinem Tod 1550 verzögerte, was dazu führte, dass Canisius und sei-ne Begleiter 1552 die Stadt wieder verließen. Herzog Albrecht V. führte mit Igna-tius Verhandlungen, die in eine siebzehnpünktige Ver-einbarung mündeten. 1556 entsandte der Jesuitengene-ral 18 Ordensleute, die im Juli in Ingolstadt eintrafen und eine Ordensniederlassung gründeten, die 1576 in unmit-telbarer Nachbarschaft zum Ingolstädter Münster ihren Sitz fand und 200 Jahre lang Pflanzschule des Ordens für ganz Deutschland war. Igna-tius nannte das Ingolstäd-ter Kolleg „seinen Benjamin, weil es das jüngste und letz-te war, denn er starb am 31. Juli 1556“.
Die theologische Fakul-tät erreichte nach Eck (dem streitbaren aber auch intel-lektuell brillanten Theolo-gen), nach Petrus Canisius (dem „zweiten Apostel der Deutschen“ und Verfasser des berühmten nach ihn benann-
ten und über Jahrhunder-te in Gebrauch gebliebenen Katechismus) dann mit Gre-gor von Valencia (1549-1603), der 1575 nach Ingolstadt kam, Glanz (vorweg als Merkpos-ten: der letztgenannte gro-ße Theologe lehrte bis in die Zeit in Ingolstadt, als die hier zu betrachtenden Jesuitenau-toren Agncola und Faber in Ingolstadt als Lehrer debü-tierten: Agricola 1591, Faber 1593- und Gregor von Valen-cia übergab 1592 seinen Lehr-stuhl an einen der ganz gro-ßen Jesuitenpoeten, an Jakob Gretser, hielt aber bis 1597 noch Vorlesungen).
Gregor war der glän-zendste Theologe des Jahr-hunderts nach dem Triden-tinum, und sein Ehrenname „doctor doctorunrrt zielt dar-auf, dass er einer ganzen Generation selbst hochge-lehrter Doktoren der Theo-logie als Lehrmeister dien-te. Die Ingolstädter Hohe Schule, die Bayerische Lan-desuniversität, wurde zur intellektuellen, zur geistigen Rüstkammer der Gegenre-
formation. Leopold von Ran-ke schrieb:
„Ingolstadt bekam, aber in entgegengesetztem Sinn, eine Wirksamkeit, wie sie Wittenberg und Genf gehabt‚ hatten. Das heißt: Ingolstadt war für den Katholizismus der entscheidende Verankerungs-ort und ideengeschichtlich in Europa so bedeutsam wie Wittenberg für den Protes-tantismus und Genf für den Calvinismus. Prägnanter auf den Punkt gebracht: Ohne das entschiedene Eintreten des späteren bayerischen Herzogs und Kurfürsten Maxi-milian (1573-1651) und des Habsburger Kaisers Ferdinand II. (beide an der Ingolstädter Universität mit ihrer katholi-schen Grundprägung ausge-stattet) wäre die Geschichte des Landes, des Kontinents sicher anders verlaufen.
Jesuitischem Programm entsprach die Erziehung von künftigen Fürsten zu verlässli-chen katholischen Regenten. Der spätere Kurfürst Maxi-milian II. hatte unter Leitung Gregor von Valencias in Ingol-
stadt Logik, Ethik und Mathe-matik und anschließend Jurisprudenz studiert. Seine Brüder Philipp Wilhelm und Ferdinand waren nach ihm an der Universität Ingolstadt gewesen. Der junge Habsbur-ger Erzherzog Ferdinand, der 1619 als Ferdinand II. Kaiser des Heiligen Römischen Rei-ches und ein entschiedener Vertreter der Gegenreforma-tion werden sollte, war Ingol-städter Student gewesen (vorweg: erneut als Merk-posten: die Jesuitenautoren, Gretser, Agricola, Faber hat-ten mithin unweigerlich zu
Ingolstadt die zwei zentralen Persönlichkeiten der katholi-schen Resistance persönlich erfahren, waren ihnen begeg-net, hatten mit ihnen gespro-chen, debattiert). Im folgen-den Krieg stand auf der Seite des Einen Wallenstein, auf der Seite des Anderen Til-ly, der in Ingolstadt im Haus des UniversitätsProfessors Arnold von Rath starb. 1594, nach Abschluss seines Studi-ums, schenkte der Habsbur-ger Erzherzog Ferdinand der Universität einen prunkvollen Schiffspokal, ein Meisterwerk europäischer Goldschmie-
dekunst, das sich bis heute erhalten hat.
Sich den führenden Per-sönlichkeiten eines Staates, einer Zivilisation zu nähern und ihnen mit bestechen-der Argumentation – im Sin-ne intellektueller Redlichkeit – die Debatte um Positionen abzuringen, war in damali-ger Sicht (methodisch) ein gewagtes Unterfangen Es zeichnet die Jesuiten aus, den Weg des Diskurses und der Auseinandersetzung mit „Anders-Gläubigen“, mit „Anders-Denkenden“ (mit fremden Kulturen) in ganz ernsthafter Weise (nämlich der Offenheit des Sich- Hin-einversetzens in fremde Denkstrukturen) gegangen zu sein, was eine unglaub-liche mentale Stärke und Selbstwertgefühl voraussetzt. Es waren Männer mit weit mehr als solidem wissen-schaftlich-handwerklichem Können, die die Jesuiten in die Mission sandten, (Leute, die , hätte es damals Nobel-Preise schon gegeben, derer verdächtig gewesen wären – und die tatsächlich aufgrund einer höchst intelligenten, völlig neu dafür erfundenen Missionsmethode der Akkul-turation ungeahnte Erfolge errangen wie die „Ingolstäd-ler“ Kaspar Castner, Ignaz Kögler, Anton Gogeisl, der Würzburger Kilian Stumpf. Als eindringliches Mittel zur Ver-kündung des Glaubens nutz-ten die Jesuiten auch die The-aterbühne, Ingolstadt war Zentrum des Süddeutschen Jesuitentheaters. Die Jesui-ten erfanden sozusagen das lateinisch sprachige Thea-terspielen an ihren jungen
Schulen, den „Gymnasien“, die nicht nur auf den Besuch der Universitäten vorbereiten, sondern deren erfolgreiches Absolvieren der sechsten Kasse, der Rhetorik, Voraus-setzung für die Zulassung zum Grundstudium, dem Stu-dium in der philosophischen Fakultät wurde. Das Jesuiten-theater war eine Antwort auf die Reformation. In der (intel-lektuell geprägten) Sicht der Gesellschaft Jesu war die Gegenreformation nicht, ent-gegen der so heute landläu-fig verbreiteten Meinung, die Ablehnung und Zurückwei-sung der reformatorischen Ideen (wie sie Luther in Gang gesetzt hatte), sondern die diesem Begehr auf Verände-rung entgegenzusetzenden Ideen unter Berücksichtigung ihres durchaus zu recht erho-benen Reformbedarfs. Dar-auf wollten die Autoren des Jesuitentheaters abstellen und erhoben den Anspruch, die Zweifler dem rechten (d.h. katholischen) Glauben zurückzugewinnen.
In den ersten hundert Jah-ren seit 1550 – der eigent-lichen Blütezeit des Jesu-itentheaters – lehnte es sich zunächst stark an das „Humanistendrama“ an – wurde dann bald zu einem prachtvoll ausgestattetem Bekehrungsstück. Unter den bedeutendsten Autoren im deutschen Sprachraum waren die drei großen Jakobs: Jakob Gretser, Jakob Biedermann, Jakob Balde.
Fortsetzung des Beitrags in der Juli-Ausgabe der Histo-rischen Blätter
Die historische Diskriminierung der Raucher
18. Teil: Rauchen ist unästhetisch, weshalb, ausnahmsweise, ein zumindest „geistreiches Frauenzimmer“ zu Worte kommt.Von Gerd TrefferWir leben in der Zeit, da
der Mensch nicht nur edel, hilfreich und gut sei, son-dern auch ansehnlich und schön sein soll. Es geht also um „ästhetische Gesichts-punkte“ (S. 25). Kappler hat „schon mehrere Winke gege-ben, woraus man abnehmen kann, dass die Sitte des Tabak-rauchens bei ihrer Zergliede-rung durchaus nichts schö-nes in sich enthalte“ (S. 25). Allerdings möchte er dazu lie-ber jemand anderen zu Wor-te kommen lassen, nämlich „ein geistreiches Frauenzim-mer“, das er, ganz gegen sei-ne Gewohnheit, nicht weiter benennt.
Nur als Hinweis: Einleitend hat Kappler bereits darauf ver-wiesen, dass sich die (Un-)Sit-te des Rauchens immer wei-ter ausbreite und man unter ihren Adepten „selbst einige Husaren aus dem weiblichen Geschlechte (finde), dem man gewöhnlich feineres Gefühl für das Schöne als dem männ-lichen zuschreibt“. Offenbar
hat Kappler nun eine Dame gefunden, die nicht raucht und das besondere weibliche Gefühl für das Schöne und Edle besitzt.
Die Dame fürs Schöne schreibt:
„Sehen Sie nur ein-mal unbefangen die Stel-lung eines rauchenden Herrn an, ob sie mit irgend einem Schönheitsbegrife verwebt werden kann? Wie das lan-ge steife Rohr einen scharfen Winkel mit dem es haltenden Arm bildet, wie es die Lippe auf der einen Seite herabzie-het, und durch den Mund das Hängende der trägen Nachläs-sigkeit über die ganze Physio-nomie verbreitet, um uns bei seiner gänzlichen Öffnung in der Unterredung graugelbe Ruinen voriger Zähne zu ent-blößen (s.o.: Vierzehnter und Fünfzehnter Abschnitt). Sehen Sie:
Wie streitend mit aller Eleganz, in dem Cirkel eini-ger Rauchenden die Feuch-tigkeits-Empfänger auf dem Boden stehen, und unsern
Röcken und den spielen-den Kindern verderblich sind (gemeint sind Spuck-Näpfe), wie der Kontrast ihrer schönen Formen und Lackierungen, die Auszierungen, in denen man das Ideal der Antike suchen soll, mit dem Anblick des auf-genommenen Materials strei-tet….“ (S. 25 f).
Da ist es wieder das Thema „Ekel“, den zu erregen, Kapp-ler mit sich mit allerlei unter-schiedlichen Ansätzen von unterschiedlichen Seiten her-kommend bemüht.
Zuzugeben ist, dass das „geistreiche Frauenzimmer“ sich argumentativ viel Mühe gibt (während in unserer Zeit sich die Argumentation gele-gentlich verknappt auf ein Selbstbild und den Satz: „Ich küsse keinen Aschenbecher“ – über verkürzte Argumen-tation wird am Ende dieses Abschnitts aber mit Kapp-lers eigenen Worten noch zu reden sein). Das zweite geist-reiche Zitat, das hausfraulich ansetzt, lautet: „Bemerken Sie den scharfen Geruch, der
zumal in wollenen Tuchklei-dern unserer Männer unver-tilgbar ist. Wie sie daher jedes nicht stumpf geworde-ne Riechorgan unangenehm bei der Näherung nach voll-brachter Pfeife berühren“ (S. 26). (Den Rauchern wird impli-zit ein stumpf gewordener Geruchssinn unterstellt, wobei das nicht stumpf gewordene Riechorgan per se als natür-lich höherstehend betrach-tet wird. Die folgende Passa-ge ist (für eine Frauenperson) „gewagt“, aber eben auch, gewollt, Ausweis einer stilvol-len Modernität: „Wie nur aus Schonung für sie wir unsere Wangen dem Kuss des Gatten, des Bruders oder des Gelieb-ten nicht entziehen, wenn sie aus ihren Klubbs oder sonsti-gen Sammelplätzen, wo dem Rauchgott stinkender Weih-rauch dampft, heimkommen“ (S. 26 f).
Dass in einer Vorlesung (und danach schriftlich ver-fassten Publikation) eines führenden Theologen (zumal für junge Priesterschüler) der
Kuss eines Geliebten auf-taucht, ist wohl allein der Argumentation: helfe was helfen mag geschuldet. Wei-ter heißt es nach dem Motto, Raucher sind einfältige, in sich gekehrte Tölpel, die zu geist-reicher Gesellschaft in glän-zenden Salonen nicht fähig sind. „Sehen Sie die unthätige Thätigkeit, mit der ein Mann in großer Gesellschaft der Wäch-ter seiner Pfeife wird, welcher unangenehmen Eindrücke sei-ne Züge fähig sind, wenn der ungeschickte Nachbar durch ein leidiges Ohngefähr den Mittelpunkt des Genusses, den Kopf der Pfeife abstößt, wie er gleich der Vestalinn nur kaum artikulierte Halbwörter der Unterredung schenkt, aus Furcht der Erlöschung des hei-ligen Feuers…“ (S. 27).
Kurz, aus ästhetischer Sicht, wird, in weiblicher Per-spektive, der Raucher zum sabbernden Autisten, unge-eignet für den brillanten Salon einer literarisch inte-ressierten, anspruchsvollen Dame, die ihre Beurteilung so
abschließt: „… und dann frage ich: ob irgend etwas an einem rauchenden Manne ästhetisch schön seye?“ (S. 17).
Und Kappler beschließt: „Ich habe diese Stelle umso lieber angeführet, weil sie all-gemeinen Beifall erhielt, und meine bisherigen Behaup-tungen dadurch von Neu-em bestättiget werden“ (S. 27). So einfach sind Begrün-dungen ex cathedra. Bleibt: Woher stammen die Aussa-gen des geistreichen Frauen-zimmers? Kappler hat sie dem „Journal des Luxus und der Moden“ entnommen (genau-er: der Ausgabe vom Februar 1799 S. 61 f – also brandaktu-ell in seine Schrift – von 1800 – eingearbeitet, was ein Licht auf die Lektrüe des Ingolstäd-ter Professors, aber auch auf die Verbreitung von Zeitschrif-ten und die en vogue seien-den Medien wirft.
Das „Journal des Luxus und der Moden“ war eine „Mode-Zeitschrift“. Angemessen wäre vermutlich die Charak-terisierung als Vorläufer der
Regenbogenpresse, aber mit intellektuellem und in gewis-ser Weise „erzieherischem“ Anspruch und dem Willen „die gute Gesellschaft“ zu prägen. Es gilt als erste „Illustrier-te Europas“. Es erschien (bei mehreren Titel-Änderungen) von 1786 bis 1827, herausge-geben vom Weimarer Verle-ger Friedrich Justin Bertuch in Zusammenarbeit mit dem Künstler Georg Melchior Kraus. Es befasste sich mit kulturel-len Themen von Musik zu Möblierung, Literatur und Kunst, Bäderwesen und Tech-nik, Theater und Innenarchi-tektur, Gartengestaltung und Politik. Es erschien monatlich in Form einer rund 30 Seiten umfassenden Loseblatt-Sam-mel-Zeitschrift und erreich-te rund 25.000 Leser. Es hielt Verbindung zu den europä-ischen Metropolen und war aufwendig mit Kupferstichen illustriert. Der hier angespro-chene Beitrag eines geistrei-chen Frauenzimmers rangiert unter der Rubrik „Zeitgeist“ bis Satyre.
Porträt von Georg Stengel
Die Theaterbühne (nach 1685)