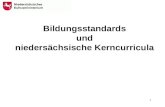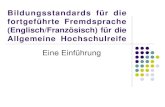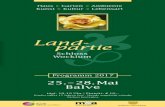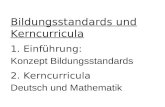Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss Bildungsstandards für das BKT...
-
Upload
hariric-raupp -
Category
Documents
-
view
112 -
download
1
Transcript of Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss Bildungsstandards für das BKT...

Bildungsstandards im Fach Deutsch für den
Mittleren Schulabschluss
Bildungsstandards für das BKT Lüdenscheid

Was sollen die Schüler können? (Beschluss der KMK vom 4.12.2003)

Was sollen die Schüler können? Auf
Kommunikation achten
Gesprächskultur pflegen
aufmerksam Zuhören
respektvolles Gesprächsverhal-ten

Was sollen die Schüler können? Sprachlich differenziert,
eigenständig, zielgerichtet, situations- und adressatenbezogen Texte verfassen
Sprachlich und stilistisch stimmig formulieren
Fehlerfrei Eigene Ideen entwickeln

Was sollen die Schüler können? Selbständig Infos aus
Texten entnehmen und mit Vorwissen verknüpfen
Lesetechniken und –strategien entwickeln
Über Texte reflektieren, diese bewerten
Orientierungswissen in Sprache und Literatur gewinnen
Wissen nutzen um Infos zu gewinnen und kritisch zu beurteilen

Was sollen die Schüler können? Texte untersuchen und
formulieren Grammatische
Erscheinungen und inhaltliche Funktion in den Blick nehmen und nutzen
Textherstellung und –überarbeitung
Grammatische Strukturen korrekt aufbauen
Wichtige Regeln der Aussprache beherrschen
Orthographie und Zeichensetzung
„Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“

Wie werden diese Standards erreicht?
Wie vermittele ich diese Standards, bzw. wie überprüfe ich, ob die
Standards von meinen Schülern erreicht worden sind?

Wie werden die Standards erreicht?
Anforderungsbereich I
Anforderungsbereich II
Anforderungsbereich III
• Kenntnisse, die für die Bearbeitung der Aufgaben notwendig sind
• Erfassen, einordnen, strukturieren und verarbeiten von Material
•Eigenständi-ge Reflexion, Entwicklung eigener Lösungs-ansätze

Wie werden die Standards erreicht?
sch rift lich m ün d lich
A u fg ab e nko n zep tion

Aufgabenkonzeption schriftlich Schwerpunkt: „Umgang mit Texten und
Medien“, „Schreiben“, „Sprache und Sprachgebrauch“
Operationen: Erfassen der Aufgabenstellung, Bearbeitung eines Textes oder Problems, Schreiben eines eigenen Textes
„Prozesscharakter“: Planung-Gliederung-Ausführung-Überarbeitung

Aufgabenkonzeption schriftlich
• Eine Problemstellung erörtern• Einen Text umformen oder weiterschreiben• Von einer Textgrundlage ausgehend,
informieren, argumentieren, erörtern• Von einer Textgrundlage ausgehend einen Text
gestalten, entwerfen• Einen Text untersuchen, analysieren,
interpretieren

Beispiel IAufgabenstellung: Entnehmen Sie den vorgelegten Texten und der Grafik die
geeigneten Informationen, Aussagen und Hinweise und schreiben Sie auf dieser Grundlage einen informierenden Artikel für eine Schülerzeitung zum Thema „Alkohol“!
Im „Ratgeber-Kasten“ der Schülerzeitung sollen den Leserinnen und Lesern drei Ratschläge zum angemessenen Umgang mit Alkohol gegeben werden. Formulieren Sie diese!
Begründen Sie die Auswahl Ihrer Ratschläge in einem gesonderten Text für die Redaktionskonferenz der Schülerzeitung!

Beispiel II
Aufgabenstellung: Fassen Sie den Inhalt der Tagebuchnotiz zusammen! Gestalten Sie auf der Grundlage des literarischen Textes
(besonders: Personen, Raum, Zeit) eine Szene, deren Dialoge und Regieanweisungen Hinweise auf die innere Verfassung der Figuren geben! Berücksichtigen Sie dabei die beiden Schlusszeilen des Tagebuchtextes!
Je nach Höhe der Anforderungen fakultativ: Begründen Sie die Wahl und die Gestaltung Ihrer Figuren!

Beispiel III
Aufgabenstellung: Erschließen Sie das Gedicht von Erich Fried, indem
Sie den inhaltlichen und formalen Aufbau beschreiben, sprachlich stilistische Merkmale berücksichtigen und die Bilder untersuchen.
Vergleichen Sie abschließend die Auffassung von Liebe in dem Gedicht von Erich Fried mit der des Gedichts von Heinrich Heine!

Beispiel IVAufgabenstellung: Untersuchen Sie den Text, indem Sie seine zentralen
Aussagen formulieren und sich mit diesen Aussagen argumentativ auseinander setzen!
Verfassen Sie abschließend einen kurzen Gegentext mit dem Titel „Loblied auf die elektronische Kommunikation“!
Variante zum zweiten Teil der Aufgabenstellung: Erörtern Sie abschließend, welche Chancen
Kommunikation mit modernen Medien beinhaltet!

Beispiel V
Aufgabenstellung: Immer weniger Jugendliche lesen regelmäßig
eine Tageszeitung. Führen Sie Gründe dafür an und erörtern Sie, welche Vorteile es haben kann, sich täglich mit diesem Medium zu befassen!

Aufgabenkonzeption mündlich

Aufgabenkonzeption mündlich

Beispiel VI
Aufgabenstellung: Die Schülerin bzw. der Schüler wählt selbstständig
ein Sachbuch aus und stellt es vor.
Aufgabenstellung: Ca. 5 Schülerinnen und Schüler wählen drei
Gedichte für die Schülerzeitung aus und begründen ihre Wahl.

Beispiel VII Arbeiten Sie das Material zum Film durch und sehen Sie sich den Film
an! Suchen Sie Ihre Interessenschwerpunkte für die Projektarbeit aus und
bereiten Sie eine gemeinsame Präsentation vor,- die etwa 30 Minuten dauert- bei der jede bzw. jeder von Ihnen beteiligt ist- die den Filminhalt wiedergibt- die sich kritisch mit dem Film auseinandersetzt- die zu einem Teilgebiet vertiefende Zusatzinformationen verarbeitet und- die eine geeignete mediale Aufbereitung enthält! Entwickeln Sie einen Zeit- und Arbeitsplan! Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit!

Situation „Deutsch“ im Berufsgrundschuljahr Schüler, die geringe sprachliche
Kompetenz in allen Bereichen mitbringen
Unklarheit darüber, was zu unterrichten ist
Unterschiede in der Leistungsbewertung

Was können Bildungsstandards bringen? Chancengleichheit für Schüler Handlungssicherheit für Lehrer Qualitätssicherung der Ausbildung
am BKT Lüdenscheid

Frage:
Wie wollen wir als Deutsch-Lehrer des BKT Lüdenscheid mit diesen Bildungsstandards umgehen?

Was können wir machen?
Einigung auf Standards, die in jedem Fall erreicht werden müssen. Eventuell damit verbunden, eine Festlegung
bestimmter Inhalte.
Durchführung zentraler Prüfungen (z.B. Modell FOS)
Einigung auf Gültigkeit der Standards.
Austausch über Inhalte, Methoden, Unterrichtsreihen und Klausuren, die Standards
gewährleisten.

Wie gehen wir vor?

Wie gehen wir vor?
„Schneeball“ Jeder erhält eine Zielmatrix und füllt sie nach
seinen Vorstellungen aus (10 min). Jeder sucht sich eine Partner. Gemeinsam einigt
man sich auf eine Matrix. (10 min) Zwei Paare (4 Personen) führen ihre Matrizen zu
einer zusammen. Übertrag auf Poster. (20 min) Jede Gruppe stellt ihre Matrix vor. (10 min)
Können wir uns auf eine Matrix, d.h. auf ein Ziel, Teilziele, Indikatoren und Maßnahmen einigen?