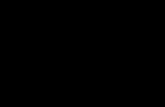Bundeszentrale für politische Bildung | Demokratie stärken ...ten instrumentalisieren diesen...
Transcript of Bundeszentrale für politische Bildung | Demokratie stärken ...ten instrumentalisieren diesen...
-
������� �� �����������
��� ���� ����
��� �������� ������������ ��� ������ �����
��� ��� ����� �� ��� ���� ����� ���� �������
� ������� �����
���������� ���� � �� ��� !�����"����
#$ %���& '( �����
��������� ���� �������������)���*� ��� ����������� !��� ������
+, %���� �-�����
)���� �� .""������ )���� �� !��������
�, ����� /���
��� 0���� ��� ��� ����� �������������� �� !�����"����
1, 2���� !����
��� �������� 3��"�� �� !����� ��� 0�����&�����
,4 ���� 3�����
������ ���� 5��� 3������� �6�%��&������ ��� !���������� ��" ���������� �����������
� ����������
-
������������ ���� �������������� ���������� �����
������ �������� ������ ��
��������
��� �������� ������� !���� !������ "����� #�����$��������������� ����� %������&��� !� ����
������
������� �����'�����( )���* ����+������
����
���,������ -�����.�� ����,���� !'��/01203 ���,���� �' )��
�������� �� ������������
��� 4������������������� #���������� /���,������ ��53�/01�2� ���,���� �' )��/6����� $1 07& �� 1� 82 ��/6�����9 $1 07& �� 1� 8� 12/( )���* �����'��+������/�''� ������*
� :������������ ��� ������%�� ;�����, �� .������/?���������������� (��� �8/71��������=���� )�������������@������� ���� #���� �� %�������� ���������������'��@
� ��������� � -�''�� '���� ��� ��� ��������' ;���� � (��� �/�3��������� 4�����,���,����/;����,���� �� )��������������
��� 4��A������������ ��� ������%�� ;�����, ��
-
Udo Steinbach
Eine neue Ordnung im Nahen Osten –Chance oder Chimäre?
Vielleicht werden Historiker eines Tages die Fragestellen, an welchem Punkt Amerika den NahenOsten verloren hat. Die Antwort könnte dann aufjene Stunde fallen, da nach der EroberungBagdads amerikanische Panzer zum Schutz desÖlministeriums auffuhren, zugleich die erstenPlünderer in das irakische Nationalmuseum ein-drangen und die Nationalbibliothek und das Minis-terium für religiöse Angelegenheiten mit seinerunschätzbaren Sammlung von Koranen in Flam-men aufgingen. Die Siegermacht richtete ihreWahrnehmung auf ihr wichtigstes Interesse amIrak: die Wiederbelebung der Ölproduktion. DerSchutz der Kunstschätze, Grundlage und Kristal-lisationspunkt des kollektiven Gedächtnisses derIraker – jenseits konfessioneller und ethnischerGegensätze – und der kulturellen Identität ebenjenes Bürgertums, das die neue Demokratie würdezu tragen haben, trat demgegenüber erst spät, zuspät in das Blickfeld.
Das hier zutage tretende Dilemma der Super-macht, das die Vorbereitungen zum Krieg bereitsüberschattet hatte, seit die amerikanische Regie-rung spätestens nach dem Terrorakt des 11. Sep-tember 2001 die Ablösung des Regimes in Bagdadzu einem essentiellen Schritt im Kampf gegen denTerrorismus gemacht hatte, wurde hier auf denPunkt gebracht. Der Aufmarsch vollzog sichunaufhaltsam. Die internationale Gemeinschaftwurde zu Statisten in einem in Washingtongeschriebenen Stück. Das gilt auch für Großbritan-nien sowie jene anderen europäischen (und nicht-europäischen) Staaten, die sich auf die Seite derUSA schlugen. Als es dem britischen Premierminis-ter bei seiner Reise nach Washington am 7. Sep-tember 2002 gelang, den amerikanischen Präsiden-ten davon zu überzeugen, der Ablösung desRegimes eine Rechtfertigung im Sinne eines durchdie Vereinten Nationen erklärten Scheiterns desAbrüstungsprozesses zu geben, konnte dies kaumjemanden darüber hinwegtäuschen, dass auch die-ser Umweg Bush nicht sein Ziel würde aus denAugen verlieren lassen. Damit wurde nicht nur dieUNO vorgeführt; wie geradezu zynisch Washing-ton sich über divergierende Einstellungen undArgumente weitester Teile der Weltöffentlichkeitund der Regierungen in der Welt hinwegzusetzenentschlossen war, zeigte der Auftritt von Außen-
minister Colin Powell am 5. Februar 2003 vor demUN-Sicherheitsrat: Die dargelegten „Beweise“ fürdie Massenvernichtungswaffen des Irak sollten alspossenhaftes Zwischenspiel im Ablauf des Dramasverstanden werden.
Selten ist ein Ereignis von weltpolitischer Bedeu-tung derart arrogant unter dem ohnmächtigenZuschauen weitester Teile der Weltöffentlichkeitin Szene gesetzt worden. Die Zerstörung der Kul-turschätze des Irak beim Einmarsch der Siegerlässt schärfer als alle bis zum Ausbruch des Krie-ges zum Ausdruck gebrachten Einwände und Pro-teste die Banalität erkennen, mit welcher amBeginn des 21. Jahrhunderts in Washington Macht-politik betrieben wird. Die nachhaltigen Auswir-kungen der Entwicklungen auf das internationaleSystem sind weitläufig diskutiert worden. EinAspekt, der hier noch einmal Beachtung verdient,ist die Frage nach den Auswirkungen auf dieBeziehungen zwischen der islamischen Welt unddem Westen. Unübersehbar bekam der „Zusam-menprall der Kulturen“, der gegen Ende der neun-ziger Jahre erst einmal ad acta gelegt zu seinschien, eine neue Aktualität. Islamistisch moti-vierte Gewalttätigkeit schien vor dem 11. Septem-ber im Abnehmen begriffen. Beobachter prognos-tizierten sogar ein Ende des gewalttätigenIslamismus und verwiesen auf einen Paradigmen-wechsel bei einem Teil der islamistischen Organi-sationen: Danach verabschiedete man sich vondem Ziel, ggf. auch mit militanten Strategien dieErrichtung einer „islamischen Ordnung“ als Vo-raussetzung politischer Legitimität durchzusetzen;vielmehr zeigte man eine Bereitschaft, in demo-kratischen Prozessen die bestehenden Ordnungenunter Anerkennung politischer und gesellschaft-licher Pluralität von innen heraus zu wandeln undislamischen Prinzipien anzunähern.
Im Zuge des Kampfes gegen den Terror in derFolge der Gewaltakte von New York undWashington hat terroristische Gewalttätigkeit dra-matisch zugenommen. Die spektakulären An-schläge auf eine Synagoge in Djerba, das amerika-nische Konsulat in Karachi, eine Touristenanlageauf Bali und ein Hotel in Mombasa verdecken diezahllosen kleineren Anschläge auf Ziele, die vonObjekten (Supermärkte, Tanker) über Einzelper-sönlichkeiten (Diplomaten, Ärzte, Ingenieure) bis
3 Aus Politik und Zeitgeschichte B 24–25 / 2003
-
zu Gruppen (Touristen) reichten. Geographischwaren sie im Raum zwischen Südostasien, demMittleren Osten und Nordafrika zu verorten. Sodiffus die Zuordnung der Ziele auch gewesen seinmag – gemeinsam waren ihre Herkunft aus oderAffiliation mit „dem Westen“ sowie eine auseinem radikalen Islamverständnis abgeleiteteRechtfertigung der terroristischen Verbrechen.
Vor diesem Hintergrund war wenig überraschend,dass das Paradigma vom „Clash of Civilisations“weithin fröhliche Urständ feiern konnte. Die an-gedeuteten Zusammenhänge aber lassen erken-nen, dass islamistisch verortete Gewalt keineswegs– und wahrscheinlich nicht einmal in erster Linie –allein aus dem Islam heraus begründet werdenkann; dass sie vielmehr zugleich als Gegengewaltverstanden werden muss. Sie wurzelt in einem dif-fusen Zorn; dieser wiederum speist sich aus demGefühl der Hilflosigkeit angesichts einer Agenda,die, nach außen als Kampf gegen den Terror pla-katiert, nach innen aber von der Mehrheit derMenschen in der islamischen Welt, die der zentraleSchauplatz dieses Kampfes ist, nicht nachvollzogenwerden kann. Irritation und Zurückweisung deramerikanischen Agenda machten sich an zahlrei-chen Punkten fest: vor allem an den Vorgängen inPalästina und dem amerikanischen Umgang mitNordkorea.
Gewiss war Saddam Hussein sowohl unter denRegierenden als auch den Regierten in der arabi-schen Welt verhasst. Die Vorgänge in Palästinaaber gingen ihnen näher als die potentielle Bedro-hung durch den irakischen Diktator. Palästinensi-sche Terrorakte und brutale israelische Unter-drückungsmaßnahmen schienen in ihrer Wahrneh-mung in abnehmend nachvollziehbarem Verhältniszueinander zu stehen. Während es wiederholtwochenlang zu keinem Terrorakt kam, gingen prä-ventive Tötungen mit zahlreichen Opfern unterUnbeteiligten, Häuserzerstörungen und andereSchikanen von Seiten Israels gegen die Palästinen-ser weiter. Warum fiel die internationale Gemein-schaft der israelischen Armee nicht in den Arm?Warum kann Israel permanent Beschlüsse derUNO ignorieren und sich weigern, Resolutionenzu implementieren, in denen die israelischeKampfführung kritisiert und die israelische Re-gierung zur Mäßigung aufgefordert wird?
Demgegenüber wurde die Befolgung der Sicher-heitsratsresolutionen gegen Saddam Hussein zueiner Frage auf Leben und Tod. Der Umgang mitder nuklearen Herausforderung durch Nordkoreaverschärfte den Vorwurf der doppelten Standardsamerikanischer Politik in einer breiten arabischenÖffentlichkeit. Der Diktator in Pjöngjang gabnicht nur zu, über Atomwaffen zu verfügen; er
drohte den USA sogar mit ihrem Einsatz. Andersaber als im Falle des Irak ließ Washington dieBereitschaft erkennen, die Krise politisch zu lösen.
Die Folge einer den Menschen in der Regionwidersprüchlich und willkürlich erscheinendenPolitik war nicht nur der Vorwurf, dass es denUSA vorrangig um die Kontrolle der Erdölressour-cen der Region gehe. Mit Blick auf die Zukunftfolgenreicher war und blieb die Perspektive einerrasch fortschreitenden Kulturalisierung des Kamp-fes gegen den Terror, in dessen Mittelpunkt dieamerikanische Regierung die Ablösung des Regi-mes stellte. Zahllose Äußerungen des amerikani-schen Präsidenten ließen eine geradezu heilsmä-ßige Verbrämung des Vorgehens gegen denirakischen Diktator erkennen: Bush kämpfte fürdas Gute und Gerechte; er wusste und weiß Gottauf seiner Seite. Dem stand das Böse in PersonSaddam Husseins gegenüber: Ungerechtigkeit undTyrannei.
Diese Wellenlänge amerikanischer Kommunika-tion in Sachen des Irak und der weltpolitischenRolle der USA insgesamt ist in der islamischenWelt weithin vermerkt worden. Noch immer erin-nerte man sich des Begriffs „Kreuzzug“, den Präsi-dent Bush unmittelbar nach dem 11. September2001 zum Programm der amerikanischen Antwortauf die Herausforderung des Terrorismus (dasWort ist danach freilich nicht mehr gefallen)gebrauchte: Die Scharfmacher unter den Islamis-ten instrumentalisieren diesen Lapsus, um demaggressiven „Kreuzzug“ gegenüber die Reaktiondes „Islams“ zu verorten: nämlich in den Koordi-naten des Dschihad, d. h. des religiös legitimiertenAbwehrkampfes gegen einen Angriff auf die isla-mische umma, die Gemeinde der Muslime. Undwann wäre – nach den Regeln der islamischenRechtsgelehrten – der Dschihad wohl gerecht-fertigter gewesen wenn nicht als Abwehr einerBedrohung der Gemeinde Allahs? So droht dasGeschehen die Beteiligten in die Falle des UsamaBin Laden tappen zu lassen. Wenn es dessenAbsicht gewesen sein sollte, die Kluft zwischen derislamischen Welt und dem Westen, namentlich sei-ner Vormacht, den USA, so weit wie möglich zuvertiefen, um die Konfrontation aufs äußerste zuradikalisieren, so ist man tatsächlich diesem Zielnäher gekommen. Am Ende steht ein perversesAufrechnen der Opfer: Die im Kampf gegen dieTaliban und später gegen das irakische Regimegetöteten unbeteiligten Afghanen und Iraker sind„collateral damages“, Randschäden in einemKampf um eine gerechte Sache. Freilich – imKampf auch der anderen Seite um die aus ihrerSicht „gerechte Sache“ sind die Toten von Djerba,Bali, Karachi oder Mombasa eben auch nur „colla-teral damages“.
4Aus Politik und Zeitgeschichte B 24– 25 / 2003
-
Die hohe Emotionalisierung der Auseinanderset-zung hat in den Tagen des Krieges gegen den Irakim April 2003 eine weitere Steigerung erfahren.Triebkraft dazu waren die neuartigen Möglichkei-ten eigenständiger Übertragung des Geschehensvor allem durch arabische Fernsehsender. Diese– neben dem militärischen Geschehen – „zweiteFront“ verbindet sich mit dem Namen „Al-Dja-zira“, dem in Qatar ansässigen Fernsehsender.Waren es noch im Zweiten Golfkrieg (1991) west-liche Sender, die mit dem Monopol ihrer Bilderauch den Bewusstseinsstand bestimmten, so sen-den die professionell gemachten arabischen Statio-nen Bilder von der Qualität, die der arabischen(und darüber hinaus der islamischen) Welt dasGeschehen deuten. Die Zerstörungen durch dieLuftangriffe, die getöteten Iraker (Zivilisten), dasLeid der auf vielfältige Weise in Not geratenenMenschen vermitteln dem Zuschauer die Gewiss-heit, dies schon einmal irgendwie erlebt zu haben.Seit zwei Jahrhunderten – so die Wahrnehmung –ist der Westen auf diese Weise aufgetreten: MitGewalt spätestens seit 1798 (Napoleonische Expe-dition) wurde Nordafrika, der Nahe und der Mitt-lere Osten ein Kernstück westlicher imperialerund kolonialer sowie später rohstoffwirtschaft-licher Interessen und Planungen. Mit der brutalenWirklichkeit kontrastierend klang die rechtferti-gende Begleitmusik des westlichen Daherkom-mens auch damals ähnlich: Stichworte waren dieErrungenschaften der Französischen Revolutionwie Konstitutionalismus, Demokratie, Freiheit,Selbstbestimmung, Menschenrechte und – in neue-rer Zeit – Entwicklung und vieles mehr. Wie sollendie Menschen angesichts dieser kollektiven histori-schen Erinnerung glauben, dass zwischen der Sire-nenmusik von heute und der politischen Wirklich-keit eine harmonischere Beziehung bestehe als inder Vergangenheit?
Es hätte nicht des amerikanischen Präsidentenbedurft, um die Menschen im Nahen Osten daranzu erinnern, dass es bessere Formen der Regierunggibt als die an der Macht befindlichen Despoten.Nahezu in allen Ländern der Region ist das Ver-langen nach Demokratie zumindest unter Teilender Eliten ausgeprägt. Ende der achtziger Jahremachte das „Szenario Bukarest“ die Runde: denDiktator aus seinem Palast holen, ihn an die Wandstellen und dann eine demokratische Regierungs-form einrichten. Und es wäre reizvoll, auszumalen,was aus dem Irak geworden wäre, hätte man demDiktator 1991 nicht die Waffen belassen, den Auf-stand der Massen brutal niederzuschlagen. Oderwelche Form der Regierung die Palästinensergewählt hätten, hätte man ihnen nach 1993 ineinem kurzen, von den Prinzipien des Rechts und
der Gerechtigkeit geleiteten Friedensprozesseinen eigenen Staat gegeben.
Besonders beeindruckende Anstrengungen, eineneigenen islamischen Weg zur Demokratie zu fin-den, werden im Iran Mohammad Khatamis unter-nommen – der Name steht für eine breite Strö-mung von Reformern, Laien wie Geistlichen. Wirdes möglich sein, aus der Sackgasse des Khomeinis-mus herauszukommen, die in eine Theokratiegeführt hat, welche den Iran lange internationalisolierte? Kann in einem gewählten Parlament, dasdie pluralistische Zusammensetzung der Gesell-schaft reflektiert, ein demokratisches Leben ent-stehen, wenn ihm nichtdemokratische religiöseInstitutionen über- und nebengeordnet sind?Angesichts solcher Spannungen wäre behutsameHilfestellung von außen willkommen – dies auchvon Seiten der USA, haben doch Umfragen erge-ben, dass eine breite Mehrheit der Iraner eine Nor-malisierung des Verhältnisses zu den USA sucht.Viele Iraner hatten gehofft, den „11. September“nutzen zu können, um den Graben zu Washingtonzu schließen. Wie ein Schock hat es vor diesemHintergrund gewirkt, dass der Iran von PräsidentBush in seiner Rede vom 29. Januar 2002 auf die„Achse des Bösen“ gesetzt wurde. Und schonsieht sich Teheran als Ziel neuer Drohungen ausWashington. Es geht um die nukleare Zukunft desLandes. Washington wirft Teheran vor, nachnuklearen Vernichtungswaffen zu streben. Dieswird spätestens ein Thema, wenn der große, beiBushir gebaute Reaktor 2004/5 fertiggestellt seinwird. Von ihm hört man aus Jerusalem, er werde„niemals ans Netz gehen“.
Die Botschaft aus dem Iran in Verbindung mit denEreignissen im Irak ist klar: Die Demokratie inder Region hätte eine Chance. Ihre Verwirkli-chung ist eine Frage der richtigen Strategie. Diesehat zwei Komponenten: die Unterstützung von aufDemokratisierung gerichteten politischen undgesellschaftlichen Kräften in den Gesellschaf-ten des Nahen Ostens selbst sowie glaubhafteAnstrengungen zur Lösung regionaler Konflikte,die in der Vergangenheit anhaltend zur Verfesti-gung undemokratischer Regime geführt haben.Erfolge bei den Bemühungen um die Errichtungeines demokratisch legitimierten Systems im Irakwerden der Beweis für die Glaubhaftigkeit desamerikanischen Präsidenten in Sachen der Demo-kratisierung der gesamten Region sein. Möglichstbald gilt es, die Macht an die Iraker selbst zu über-tragen, die die Antworten auf die weitreichendenFragen an eine künftige demokratische Ordnungim Lande selbst zu geben haben werden. Dieserichten sich auf die Neuverteilung der Macht imLichte der tatsächlichen Zahlen- und Kräftever-hältnisse der religiösen und ethnischen Gruppen
5 Aus Politik und Zeitgeschichte B 24–25 / 2003
-
im Lande sowie auf den Einfluss der islamischenReligion im künftigen gesellschaftlichen undpolitischen System. Der Versuch eines „politicalengineering“, der sich gegenwärtig abzeichnet undunter anderem darin liegen würde, amerikanischeMarionetten in Bagdad an die Macht zu bringen,wird die Situation im Lande weiter polarisierenund bei den Nachbarn die Neigung eskalierenlassen, sich einzumischen. Mehr noch als dieFrage, ob Massenvernichtungswaffen gefundenwerden – die Bedrohung durch Massenvernich-tungswaffen war der Kernpunkt der Rechtferti-gung des Krieges –, werden Erfolg oder Misserfolgbei der Entstehung eines demokratischen Systemsim Irak darüber entscheiden, ob überhaupt eineRechtfertigung für den Krieg gefunden werdenkann. Ausgehend von der Lösung der irakischenHerausforderung wird Washington dann dendemokratisierenden Kräften in anderen Teilen derRegion den Rücken stärken müssen. Das aberwürde bedeuten, von der fast bedingungslosenUnterstützung der Herrschenden in der Vergan-genheit Abstand zu nehmen. Eine Phase von Unsi-cherheit und Instabilität könnte der Preis sein, derfür glaubhafte Demokratisierung zu zahlen wäre.Nach Jahrzehnten interessengeleiteter Politik derdoppelten Standards und eines Glaubwürdigkeits-verlustes der USA in der Region aber wirdWashington um einen politischen Preis für dieRückgewinnung von Glaubwürdigkeit nicht he-rumkommen.
Wenn dies schon eine nachhaltige Abkehr von ein-gefahrenen Gleisen amerikanischer Politik imNahen Osten bedeutet, dann gilt dies nicht weni-ger für die Rolle bei der Vermittlung in regionalenKonflikten. Der Nachweis für amerikanischeGlaubwürdigkeit liegt hierbei im israelisch-palästi-nensischen Konflikt. Mit Blick auf ein Nebenein-ander zweier Staaten sind von Palästinensern undIsraelis schmerzhafte Kompromisse einzugehen.Die Palästinenser verzichten auf den Teil Palästi-nas, der seit 1948 israelisches Staatsgebiet ist; dieIsraelis geben das Land auf, das sie 1967 erobertund in nachfolgenden Jahrzehnten teilweise widerdas Völkerrecht besiedelt haben. Eine auf diesenGrundsätzen beruhende Lösung kann nur durcherheblichen Druck von außen erreicht werden.Die Politik der Bush-Administration lässt zwei-feln, ob sie das Ausmaß der Herausforderung andie amerikanische Politik erkannt hat. Monatelanghat man sich mit der Reform der palästinensischenRegierung auf einem Nebenschauplatz aufgehal-ten. Wer hätte erwarten können, dass angesichtsder anhaltenden militärischen Härte der israeli-schen Besatzung palästinensische Extremisteneinen Anreiz hätten haben können, den Terrorund bewaffneten Kampf gegen Israel einzustellen?
Der Masse der Palästinenser erscheint „Minister-präsident“ Abu Mazen als Marionette, die ausge-wählt wurde, um die israelische Regierung vonernsthaften Schritten in Richtung auf einen wah-ren Frieden zu entlasten. Die Veröffentlichung der„road map“ und ein nachhaltiges amerikanischesund internationales Engagement bei ihrer Umset-zung zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt hät-ten den Palästinensern demonstrieren können,dass die Neuordnung der Macht in Palästina mehrist als nur ein taktisches Spiel auf dem Rücken derPalästinenser; nämlich ein Teil einer Strategie, dieauf die Herstellung eines Friedens auf der Grund-lage politischer Zugeständnisse auf beiden Seitengerichtet ist.
Wenn es gelänge, im Irak die Grundlagen einerdemokratischen Ordnung zu legen und im israe-lisch-palästinensischen Verhältnis ein auf Gerech-tigkeit beruhendes Nebeneinander zu stiften,stünde der Nahe und Mittlere Osten tatsächlichvor einer tief greifenden Umgestaltung.
Doch noch einmal zurück zum bereits erwähntenStichwort „internationales Engagement“. NachLage der Dinge war es geboten, die Rolle derUSA als Akteur mit Blick auf einen neuen NahenOsten in den Vordergrund zu rücken. Die interna-tionale Gemeinschaft wird eine Führungsrolle derUSA bei der Lösung der großen Herausforderun-gen des beginnenden 21. Jahrhunderts nur akzep-tieren, wenn Washington zu einer kooperativenPolitik im Rahmen des internationalen Systemszurückkehrt. Diese Herausforderungen liegen inder Gründung pluralistisch-demokratischer Ord-nungen, die auf dem Respekt der Menschenrechteberuhen. Der Kampf gegen den Terror, der eherein temporäres Phänomen und ein Symptom welt-politischer Übergangsprozesse als eine langfristigestrukturelle Herausforderung des internationalenSystems darstellt, darf nicht dazu genutzt werden,eine dauerhafte hegemoniale Machtstellung zuerrichten und zu diesem Zweck im Nahen Ostenein auf amerikanischen Vorstellungen und Krite-rien beruhendes Verständnis von Menschenrech-ten und Demokratie zu instrumentalisieren. Es istein Irrtum, anzunehmen, die Globalisierung führezu einem uniformen Erscheinungsbild politischerSysteme und ihnen zugrunde liegender Wertvor-stellungen. Vielmehr ist kulturelle Pluralisierungallenthalben erkennbar. Vor diesem Hintergrundsind Menschenrechte und Demokratie als Ange-bote zu verstehen, die sich Menschen in nicht-westlichen Kulturen aus ihrem eigenen Erbe he-raus aneignen müssen.
Mit Blick auf eine multilaterale Willensbildungkommt den Vereinten Nationen eine hohe Be-deutung zu. Die UNO wird wesentlich den Rah-
6Aus Politik und Zeitgeschichte B 24– 25 / 2003
-
men abgeben, innerhalb dessen die Verpflichtungauf universale Standards auf der einen und dasRecht eines jeden Staates und einer jeden Ge-sellschaft auf eine eigenständige Entwicklung aufder anderen Seite zum Einklang gebracht werdenkönnen.
Washington hat im Vorfeld der Irak-Krise seineGeringschätzung der UNO unverhohlen zum Aus-druck gebracht. Dies lässt ebenso wenig Guteserwarten wie der Widerstand der USA, sich aninternationale Abkommen, die eine Abgabe natio-naler Souveränitätsrechte zugunsten supranationa-ler Zuständigkeiten bedeuten würden, zu beteili-gen. Die Frage nach der Neuordnung des Irak unddes Nahen Ostens insgesamt wird ein Nachweis fürdie Bereitschaft Washingtons sein, der UNO eineRolle innerhalb dieser sich zugleich pluralisieren-
den wie zu einer globalen Wertegemeinschaftzusammenwachsenden Welt des 21. Jahrhundertszuzugestehen. Sollte sich Washington weigern,sind neue Konflikte programmiert.
Einem Europa schließlich, das sich hoffentlichbald zu einem wirkungsvollen Akteur in der inter-nationalen Politik fortentwickelt, könnte mit Blickauf die Lösung der Krisen und auf die Wandlungs-prozesse im Nahen Osten eine wichtige Rollezukommen. Es vermag den Menschen in dieserRegion, die ihm auf so vielfältige Weise nahe ist,die Perspektive einer Partnerschaft anzubieten,die jenseits wirtschaftlicher Interessen auf dergemeinsamen Anerkennung von Freiheit und Gel-tung der Menschenrechte sowie zugleich auf demRespekt vor der Wahrung des kulturellen und reli-giösen Erbes beruht.
7 Aus Politik und Zeitgeschichte B 24–25 / 2003
-
Christian Hacke
Deutschland, Europa und der Irakkonflikt
I. Rückblick: Der Irakkonflikt imLichte des 11. September 2001
Der Angriffskrieg auf den Irak im März/April2003 durch die USA und ihre „Koalition der Willi-gen“1 markiert nach dem 11. September 2001einen weiteren Einschnitt in der Weltpolitik mitFolgen für die transatlantischen Beziehungen.Stand Europa noch im Zuge des Terrorangriffsvom 11. September geschlossen auf der Seite derUSA, so wurde die Haltung gegenüber der Irakpo-litik der Regierung von George W. Bush zumSpaltpilz für Europa, weil Washington Antiterror-bekämpfung, Bedrohung durch Schurkenstaatenund die Gefahr der Massenvernichtungswaffenargumentativ so variierte, dass weltweites Miss-trauen um sich griff. Die neue präventive Militär-strategie, das manichäische Weltbild und derschroffe Unilateralismus wirkten ebenso befremd-lich. Die USA – unterstützt von Großbritannien –erzwangen die Wiedereinsetzung der UNO-Waf-feninspekteure, was von allen Staaten des UN-Sicherheitsrates durch die Resolution 1441 unter-zeichnet wurde. Die Meinungsunterschiede tratenin der Frage des Automatismus zutage: Legiti-mierte diese Resolution bei Nichtbefolgung einenAngriff auf den Irak?
II. Der „deutsche Weg“des kategorischen Nein
War es in der Vergangenheit zu Unstimmigkeitenmit den Amerikanern gekommen, so hatteDeutschland stets subtil gehandelt und in derRegel auch erfolgreich zwischen den USA undden verschiedenen europäischen Hauptstädtenvermitteln können. Deutschlands respektablerHandlungsspielraum in Europa und im transatlan-tischen Verhältnis war nicht zuletzt im Zuge diesertransatlantischen Maklerrolle entstanden. Mit derPropagierung des „deutschen Weges“ zur amerika-nischen Irakpolitik rückte die Regierung Schröder/
Fischer von dieser Vorgehensweise ab. DieGründe für das ebenso frühzeitig wie kategorischerklärte deutsche „Nein“ zum Irakkrieg liegennicht nur in der gegensätzlichen Bewertung desIrak, sondern tiefer: Die Differenzen kündigtensich schon in den neunziger Jahren an, doch erstdie weltanschaulich-politische Machtverschiebungin Deutschland nach „links“ und die unter Bushnach „rechts“ ließen diplomatische Kompromisse,wie sie noch zwischen Clinton und Kohl wie auchSchröder möglich waren, nicht mehr zu. AmerikasAußenpolitik wurde mit dem Amtsantritt von Prä-sident Bush zunehmend militarisiert, unilateralund hegemonial ausgerichtet, während die Deut-schen und Europäer mehr die zivile, multilateraleund völkerrechtliche Dimension von Außenpolitikbevorzugen.
So überrascht es nicht, dass Europa und vor allemDeutschland die diplomatischen Aktivitäten derUSA im Vorfeld des Irakkrieges mit Unbehagenbeobachteten. Berechtigte Bedenken wurden imVorfeld des Krieges von Deutschland formuliert,allerdings in Washington überhört, nicht zuletztweil sie zu undiplomatisch und in öffentlicher Auf-dringlichkeit geäußert worden waren. Es war keinAusweis von diplomatischer Raffinesse, der ameri-kanischen Arroganz der Macht eine deutscheArroganz der Ohnmacht entgegenzustellen. Berlinbesitzt keine „weichen“ und schon gar keine „har-ten“ Machtressourcen, um ein entschlossenesAmerika von seinem Kurs abzubringen. Doch imSeptember 2002 kam es zum Eklat, als der Bun-deskanzler wahlkampfbedingt den Irakkrieg the-matisierte und den „deutschen Weg“ propagierte.2
Mit Schröders Erklärung, Deutschland werde sich– ob mit oder ohne UNO-Mandat – auf keinenFall an einem Krieg gegen den Irak beteiligen,nahm er Deutschland alle außen- und sicherheits-politischen Handlungsoptionen; von nun an warklar, dass die USA und Teile der EU nicht mehrmit Deutschland in der Irakdiplomatie rechnenkonnten.
Die Irakfrage war kompliziert, doch stellten daskategorische, frühzeitige deutsche Nein zum Krieggegen den Irak, das Ausscheren aus der militäri-
1 Vgl. Lothar Rühl, Deutschland verliert an Bedeutung fürdie USA. Washington baut eine „Koalition der Willigen“, in:Neue Zürcher Zeitung vom 1./2. 2. 2003.
2 Vgl. „Du musst das hochziehen“. In den anderthalb Jah-ren vor dem Krieg hat sich das deutsch-amerikanische Ver-hältnis radikal verändert. Eine Chronik, in: Der Spiegel,(2003) 13.
8Aus Politik und Zeitgeschichte B 24– 25 / 2003
-
schen Drohkulisse, die damit verbundene macht-politische Schwächung der UNO und ihres ange-strebten Inspektionsregimes einen tiefen Bruch inder traditionellen bundesrepublikanischen Außen-politik dar, weil „genetisch bedingter“ Multilatera-lismus aufgegeben und die Vormachtrolle derUSA in Berlin nicht mehr als Schutz, sondern alsGefahr interpretiert wurde. Deutschland gab ohneNot seine exklusive Rolle gegenüber den USAund seine Maklerrolle im Viereck Washington-London-Paris-Bonn/Berlin auf und verlor anHandlungsspielraum.
Als durch den Ultimatumsvorschlag des britischenAußenministers Jack Straw Saddam Husseingezwungen wurde, die UNO-Inspekteure wiederins Land zu lassen, wurde ohne, ja gegen Deutsch-lands Votum das richtige diplomatische Eingangs-tor betreten. Doch ging es nicht mehr allein umden Irak, sondern um die Frage, ob der Bundes-kanzler nicht grundsätzliche außenpolitische Inter-essen gefährdete, die ohne den Rückhalt der USAnicht durchgesetzt werden können. Bundeskanzlerund Außenminister hätten spätestens jetzt abwä-gen müssen, ob es weiter im Interesse Deutsch-lands lag, sich mit moralischen Appellen und unterAnklage der USA als Kriegstreiber zur Friedens-macht gegen den Krieg zu stilisieren oder ob nichtzentrale eigene Interessen, wie die Beziehungenzu den USA, einen Kurswechsel, vor allem einenanderen Umgangston nötig gemacht hätten. Dochstatt vorsichtig diplomatisch vorzugehen, um wei-tere Handlungsspielräume im Verlauf der Kriseoffen zu halten, bekräftigte der Bundeskanzler imLandtagswahlkampf in Niedersachsen im Januar2003 das kategorische Nein – ohne die Ergebnisseder Waffeninspekteure abzuwarten –: „Rechnetnicht damit, dass Deutschland einer den Krieglegitimierenden Resolution zustimmen wird“3,erklärte Bundeskanzler Schröder auf einer Wahl-kampfveranstaltung in Goslar. Damit ging er den„deutschen Weg“ konsequent weiter. Es konnteder Eindruck entstehen, dass sich Schröder undsein Außenminister Joschka Fischer weniger alsDiplomaten, sondern eher als Widersacher derUSA verstanden.4 Beide waren nicht gewillt, ihrekritischen Argumente geschickt und geschmeidigdarzulegen, wie dies Großbritannien und Frank-reich bis Januar 2003 taten, als es Frankreichgelang, die Verlängerung der Inspektionen im Irakum zwei Monate durchzusetzen. Damit konnteerneut die Kriegsgefahr gebannt und doppelterDruck ausgeübt werden: gegenüber dem Irak, aberauch gegenüber den USA.
Während Frankreich und vor allem Großbritan-nien die eigenen Interessen betonten und im Kal-kül der USA eine Rolle spielten, war Deutschlandnach Goslar für die USA kein ernst zu nehmenderPartner mehr, von Freundschaft konnte längstkeine Rede mehr sein, weil sich Deutschlandneben Frankreich zur führenden amerikakriti-schen Macht in Europa stilisierte und weiter anaußenpolitischem Handlungsspielraum verlor. Dierot-grüne Bundesregierung konnte, ja wollte sichpolitisch offensichtlich nicht mehr auf Augenhöhemit den anderen europäischen Mächten ge-schweige mit den USA bringen, wenn Außenmi-nister Fischer selbst die deutsche Rolle folgender-maßen einschränkte: „Frankreich spielt eine sehrbedeutende Rolle in der Weltpolitik. Es hat aucheine eigene Vision von seiner globalen Rolle. Eshat eine andere Geschichte als wir. Es ist ständigesSicherheitsratsmitglied, es ist Atommacht. Zudemhat es gemeinsam mit dem Vereinigten Königreicheine große Geschichte, während unser Land einegebrochene Geschichte hat. (Wir) können unserLand mit Frankreich und Großbritannien nichtgleichsetzen.“5
Wer eigene Handlungsunfähigkeit derart begrün-det, verkennt nicht nur die eigenen außenpo-litischen Möglichkeiten, sondern hat bei derFixierung auf den Nationalsozialismus andereLektionen der Zeitgeschichte übersehen: Von 1949bis 1989 entwickelten die Bundesregierungen vonAdenauer bis Kohl eine außenpolitische Struktur,die mit Blick auf Erfolg und Ansehen in der Weltihresgleichen in der deutschen Geschichte sucht.Außenpolitik war im Bewusstsein der Schreckender eigenen Geschichte vor 1945 auf Versöhnungund Ausgleich angelegt, also auch moralisch undzivilisatorisch begründet, ohne dass die politischVerantwortlichen in Bonn dies penetrant bekundethätten. Vor allem zeigte sich die Regierung Schrö-der/Fischer nicht in der Lage, den Krieg gegen denDiktator Saddam Hussein aus der eigenenGeschichte heraus, d. h. im Vergleich zu HitlersDiktatur, und unter Berücksichtigung der histori-schen Verdienste der USA als Befreier auch nurim Ansatz verstehen oder erklären zu wollen.
Zugegeben, angesichts der neuen, ja unerwartetenneoimperialen außenpolitischen Gebärden derRegierung Bush war eine angemessene, d. h. dendeutschen Interessen gemäße Reaktion aus Berlinaußerordentlich schwierig, aber der Arroganz derMacht derart mit einer gewissen Arroganz derOhnmacht zu antworten, verbesserte nichtDeutschlands Handlungsspielraum. Die Bundes-regierung Schröder/Fischer riskierte mehr, als nurin der Irakfrage zu scheitern. Sie gefährdete
3 Vgl. Schröder schließt erstmals Ja zum Irak-Krieg im Si-cherheitsrat aus, in: Die Welt vom 21. 1. 2003.4 Vgl. Christian Hacke, Selbstgefällige Chefankläger, in:Financial Times Deutschland vom 27. 1. 2003. 5 Ebd.
9 Aus Politik und Zeitgeschichte B 24–25 / 2003
-
gewachsene Bindungen: Vertrauen und Berechen-barkeit deutscher Außenpolitik vor allem im trans-atlantischen Raum schmolzen dahin. Deutschlandhatte jahrzehntelang eine für politische Balancezwischen den Polen Washington – Paris – Londonein atlantisch verankertes Europa garantiert unddabei auch ein Gegengewicht zu FrankreichsVision von einem europäischen Europa in der Tra-dition de Gaulles gebildet. Durch kraftvolle Inte-grationsentwürfe hatte die Bundesrepublik vonAdenauer bis Kohl den Grundsatz hochgehalten,dass sowohl enge Beziehungen zu den VereinigtenStaaten als auch zu Frankreich gepflegt werden,gerade in Krisen und bei Interessenverschiebun-gen. Die sanfte Hegemonie der USA wurde jahr-zehntelang von deutscher Seite als Stabilitätsfak-tor begrüßt, denn Deutschland empfand AmerikasVormacht nicht als be-, sondern als entlastend.Aber jetzt erweckte die Bundesregierung denAnschein, als ob sie die Politik der USA durch Bil-dung von Gegenkoalitionen zu unterminierensuchte. Hier liegt der revolutionäre Wechsel derdeutschen Außenpolitik begründet: Sie interpre-tierte die deutsch-amerikanischen Beziehungenkonfrontativ und gefährdete damit den Einflussdeutscher Außenpolitik.
Auch war es problematisch, dass Berlin gleichzei-tig in den antiamerikanischen Sog Frankreichsrückte. 40 Jahre nach Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrags von 1963 wurde bei denFeierlichkeiten in Paris diesem Ereignis eine neueamerikakritische Spitze gegeben, als Chirac undSchröder gemeinsame Kritik an der Irakpolitik derUSA zum Anlass nahmen, die Vision eines euro-päischen Europas in Distanz zu den USA zu ent-wickeln.
Es kam, wie es kommen musste: Die UNO-Diplo-matie der USA-Kritiker scheiterte, Washingtonsetzte seine Position wider das Völkerrecht rück-sichtslos durch. Mit dem Zusammenbruch desRegimes in Bagdad brach auch Deutschlands uner-fahrene und hilflose Irakdiplomatie zusammen.Doch die Trümmer von Deutschlands Außenpoli-tik liegen weiter verstreut: im deutsch-amerika-nischen Verhältnis, in der UNO und vor allem inEuropa.
III. Die Position der mittel- undosteuropäischen Staaten
Heute wird deutlich, dass im Zuge der Irakkrisewichtige Staaten Europas, auch viele Regierungender neuen Demokratien in Mittel- und Osteuropa,nicht gewillt sind, dem französisch-deutschen Tan-
dem zu folgen. Dies wird im Rückblick auf die mit-tel- und osteuropäische Entwicklung nach demZusammenbruch des Sowjetimperiums und nachdem Fall der Mauer erklärlich. Innenpolitischwurde das kommunistische Joch abgeschüttelt,außenpolitisch suchte man die Nähe und Unter-stützung des Westens. Der Bundesrepublik kamdabei eine besondere Bedeutung zu: Willy BrandtsOstpolitik im Zeichen von Entspannung hattenicht nur den Weg für mehr Zustimmung zur Wie-derherstellung der deutschen Einheit freigemacht,sondern war für die vom Kommunismus befreitenVölker ein Zeichen für Hoffnung auf Hilfe undKooperation. Würde das vereinte Deutschlandseine Beziehungen mit den von Moskau befreitenVölkern intensivieren oder mit dem neuen Russ-land Gemeinsamkeiten suchen? Die deutsche Ost-politik der neunziger Jahre stand im Zeichen desBemühens um beides. Moskau wurde umworben,und mit den neuen Demokratien suchte Deutsch-land Aussöhnung und Kooperation. Doch erst inder historischen Distanz wird sich zeigen, ob Ber-lin nicht zu einseitig auf Moskau setzte unddadurch die Erwartungshaltung vieler mittel- undosteuropäischer Völker enttäuscht hat.
So hätte Deutschland gegenüber den drei balti-schen Staaten aufgrund jahrhundertealter nachbar-schaftlicher Beziehungen eine Schlüsselrolle ein-nehmen können, die jedoch verpasst wurde. WeilDeutschland keine couragierte Rolle mit Blick aufdie Sicherheitsbedürfnisse der Mittel- und Osteu-ropäer einnahm, wurden im Zuge der Osterweite-rung der NATO die USA zum Fixpunkt mittel-und osteuropäischer Sicherheitsinteressen. Auchfür die geplante Aufnahme der baltischen Staatenin die EU im Zuge einer zweiten Erweiterungs-runde gilt das Prinzip: „Nato is for life, EU is for abetter life.“ Die Mittel- und Osteuropäer verfol-gen bislang eine geschickte Gleichgewichtsdiplo-matie: In der Sicherheitspolitik wird die Nähe zurNATO, insbesondere zu den USA, gesucht, wäh-rend wirtschaftspolitisch gute Beziehungen zu denEU-Staaten und besonders zu Deutschlandgepflegt werden.
Doch mit Beginn der Regierung Schröder/Fischerstieg die europapolitische Skepsis in den Haupt-städten Mittel- und Osteuropas, weil Deutschlandauf Westeuropa fixiert blieb und nur wenig Inter-esse nach Osten hin zeigte. Die USA hingegen ver-stärkten ihre Aktivitäten im Herzen Europas seitdem Amtsantritt von Präsident Bush. Kein Wun-der, dass ihm die Sympathien zuflogen, als er aufdem NATO-Gipfel in Prag im Herbst 2002 seinEintreten für die Interessen Mittel- und Osteuro-pas öffentlich bekräftigte. Eine andere „uneinge-schränkte Solidarität“ zwischen Mitteleuropäernund den USA zeigte sich auch im begeisterten
10Aus Politik und Zeitgeschichte B 24– 25 / 2003
-
Empfang für Bush in Vilnius im Anschluss an denNATO-Gipfel.
Vor diesem Hintergrund wird die Unterstützungvieler mittel- und osteuropäischer Staaten undRegierungen für die Irakpolitik des amerikani-schen Präsidenten erklärbar. Ihre Solidaritätsbe-kundungen waren auch Beweis für kluge Interes-senpolitik. Man verstand schnell, dass AmerikasEintreten für Mittel- und Osteuropa nur dann gesi-chert wird, wenn umgekehrt die mittel- und osteu-ropäischen Regierungen die Interessen der USAim Irak nicht in Frage stellen, sondern sie öffent-lich unterstützen. Konsequenterweise wurden dieinnereuropäischen Verbindungen wie z. B. dasBündnis Polens mit Deutschland und Frankreichim sog. „Weimarer Dreieck“ von der neuen Inte-ressenverknüpfung mit den USA überlagert. Soließ der polnische Ministerpräsident Leszek Millerkeinen Zweifel daran, dass Polen im Falle einerWahl zwischen Westeuropa oder amerikanischenSicherheitsgarantien im Rahmen der NATO sichfür Letztere entscheiden würde.
Millers Unterzeichnung des „Briefs der Acht“ alsSolidaritätsbekundung für die Irakpolitik der USAohne vorherige Konsultation Berlins war eineklare Absage an den deutschen Weg, der als Bruchdes transatlantischen Verhältnisses, ja als Einfluss-verlust deutscher Ostpolitik verstanden wird. Dassman zu Amerika stehen müsse, war nicht nur fürdie polnische Regierung, sondern über Partei-grenzen hinweg für die gesamte polnische poli-tische Klasse eine Selbstverständlichkeit,6 auchwenn die Mehrheit der polnischen Bevölkerung– hier ganz „europäisch“ und ungespalten – gegenden Krieg eingestellt war.7 Ebenso wie Bulgarien,wo das Parlament am 7. Februar 2003 mit breiterMehrheit – 165 Ja-Stimmen, keine Gegenstimmenund 48 Enthaltungen – auf Ersuchen der USA dieGenehmigung zur Beteiligung des Landes an einerMilitäroperation gegen den Irak erteilt hat,obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung einenMilitärschlag gegen den Irak ablehnte,8 zeigtensich auch Ungarn, Rumänien, die Slowakei undTschechien in der Irakfrage gespalten. Obwohl71 Prozent der Rumänen einen Krieg an der Seiteder USA gegen den Irak ablehnten, erklärte dierumänische Regierung ihre Bereitschaft, „jede,einschließlich militärische Unterstützung“ zu leis-
ten.9 Während rund 76 Prozent der tschechischenBevölkerung einen Militärschlag gegen den Irakohne UNO-Mandat ablehnten und sich 62 Prozentder Befragten gegen eine Stationierung amerikani-scher Truppen auf tschechischem Territorium aus-sprachen, betonte der scheidende tschechischeStaatspräsident Vaclav Havel als letzte Amtshand-lung seine Verbundenheit mit den USA auch inder Irakfrage. Im Unterschied zu Deutschlandzeigten die Regierungen in Mittel- und OsteuropaMut zur Unpopularität, sie handelten in derAußenpolitik interessenorientiert.
IV. „Alt“ gegen „Neu“: Der Irak-konflikt als Spaltpilz Europas?
Der „Brief der acht“, von den Staats- bzw. Regie-rungschefs von fünf EU-Mitgliedsländern, allenvoran Großbritanniens Premierminister TonyBlair, sowie den EU-Kandidatenländern Tsche-chien, Ungarn und Polen unterzeichnet, hatEuropa in der zentralen Frage der transatlanti-schen Solidarität vermeintlich in „alt“ und „neu“gespalten. Zum „alten“ Europa zählen nach Ver-teidigungsminister Donald Rumsfeld seit dem22. Januar 2003 Frankreich und Deutschland; ihmgegenüber steht das „neue“, mittelöstliche Europader EU-Beitrittsländer. Jenseits der Begrifflichkeit„alt“ und „neu“ sind die Interessengegensätze inEuropa offenkundig. Am Beispiel Polen undFrankreich zeigen sich diese am deutlichsten. Keinanderes europäisches Land verfügte 1989 über einso großes politisches und kulturelles Kapital inPolen wie Frankreich. Dass die französisch-polni-schen Beziehungen außerhalb des symbolischen„Weimarer Dreiecks“ heute trotzdem im Argenliegen, hat zwei Gründe: Frankreich entwickeltesich zum Opponenten der EU-Osterweiterung undwegen seiner Kritik an der NATO und den USAzum Risikofaktor aus mittel- und osteuropäischerSicht. Umgekehrt sieht Paris Polen als trojanischesPferd der Amerikaner in Europa.
Der von Warschau mit unterzeichnete „Brief deracht“ hat folglich eine antifranzösische Spitze, diedie Reaktion des französischen Präsidenten am18. Februar 2003 in Brüssel erklärt: Die „leichtfer-tigen“ und „ahnungslosen“ EU-Beitrittskandida-ten hätten „eine gute Gelegenheit zum Schwei-gen“ verpasst.10 Damit heizte er in Mittel- undOsteuropa die antifranzösische Stimmung weiteran. Frankreich versteht offensichtlich die EU-
6 Vgl. Adam Krzeminski, Sicherheit nur mit Amerika, in:Die Welt vom 12. 4. 2003.7 Vgl. dazu Erhard Cziomer, Reaktionen auf die Irak-Poli-tik der USA, in: August Pradetto (Hrsg.), Internationale Re-aktionen auf die Irak-Politik der USA, Hamburg 2003, S. 61–67.8 Vgl. Wulf Brocke/Borislaw Wankow, Bulgarien: KlaresVotum für eine Militäroperation gegen Irak, in: Welt-Report,Sonderausgabe März 2003, S. 7–9.
9 Anneli Ute Gabanyi, USA-Irak: Die Reaktion Rumä-niens, in: A. Pradetto (Hrsg.) (Anm. 7), S. 86.10 Vgl. Der Kaiser von Europa, in: Der Spiegel, (2003) 9.
11 Aus Politik und Zeitgeschichte B 24–25 / 2003
-
Erweiterung als „Gnade, die den Ländern in unse-rem Teil Europas gewährt wird, und nicht alshistorischen Prozess, der den Kontinent vereintund seine Stabilität für Generationen garan-tiert“11. Der französische Präsident sieht die ehe-maligen Ostblockstaaten heute in der gleichenLage wie Deutschland nach dem Ende des Zwei-ten Weltkriegs. Er befürchtet, dass sie sich, vor dieWahl zwischen einem Europa à la française undeinem „angelsächsischen“ Europa gestellt, fürLetzteres entscheiden. Weil Deutschland als Mak-ler zwischen angelsächsischem und französischemEuropa im Zuge der Irakkrise aus- und in dieRolle des französischen Juniorpartners zurückfiel,und damit auch seine eigenständige mittel- undosteuropäische Maklerrolle aufgab, blieb Mittel-und Osteuropäern keine andere Wahl, als dieNähe der Angelsachsen zu suchen. Auch an dieserPolarisierung zwischen altem und neuem Europaist Berlin nicht ganz schuldlos.
Außenminister Fischers Charakterisierung desdeutsch-französischen Verhältnisses gegenüber derBush-Administration als „Partnerschaft im Wider-spruch“ vermittelt den Eindruck von Ratlosigkeitangesichts der Heftigkeit, mit der Jacques Chiracauf die teileuropäische Solidaritätserklärung andie Adresse Washingtons reagierte. Doch ist jetztüber die Irakfrage hinaus in Europa ein diplomati-scher „Krieg um die Deutung Europas“12 ausge-brochen, bei dem Deutschland nicht mehr für einatlantisches Europa eintritt und folglich auch inMittel- und Osteuropa als ehemalige „Zentral-macht Europas“13 an Einfluss verliert. WeilDeutschlands Qualitäten und Fähigkeiten zumAusgleich in Europa und mit den USA gerade inKrisenzeiten vermisst werden, gerät die europä-ische Staatenfamilie außer Rand und Band. Daswurde schon deutlich, als Deutschland im Vorfelddes Krieges nicht mehr ausgleichend zwischenGroßbritannien und Frankreich wirkte und konse-quenterweise beide Staaten sich gegenseitig denWeg zu einer gemeinsamen europäischen Positionverstellten und damit auch den Bruch der gewach-senen europäischen Beziehungen innerhalb undaußerhalb der Gemeinschaftsinstitutionen riskier-ten. Tony Blair wurde noch stärker an die Seiteder USA gezwungen, während Jacques Chirac inder Tradition von Richelieu als europäischer Her-kules die antiamerikanische Keule über ganzEuropa schwang.
Ungehemmt macht sich Chirac zum Sprecher desalten Europa, um dem Unilateralismus der„Hypermacht“, so der frühere französischeAußenminister Hubert Védrine, in der UNOeinen Riegel vorzuschieben. Weil Frankreich undRussland als Schlüsselstaaten Europas „mitDeutschland als Frankreichs Anhängsel“14 Europakonfrontativ in dieser weltpolitischen Krise gegendie USA in Stellung zu bringen suchen, geht mehrals die Irakdiplomatie des Westens zu Bruch. DieVision eines „karolingischen Europas“ verdrängtdie des bewährten „atlantischen Europas“. Dochdie Atlantiker in Europas Hauptstädten revoltie-ren, und deshalb ist Europa heute gespaltenerdenn je. Die Gemeinschaftsinstitutionen versagenangesichts dieser abrupten Polarisierung nationa-ler Interessen. So könnte bald die europäischeIntegration im traditionellen Verständnis zusam-menbrechen, wenn Frankreich, Deutschland undRussland sich weiter dauerhaft zusammenfindenmit dem Ziel, die „hegemonialen USA“ einzudäm-men. Eine zunehmend amerikakritische Integra-tion wird an Gefolgschaft verlieren. Oder solltewider Erwarten die Erfahrung der Ohnmacht derEuropäer beim Irakkrieg die europäischen Sicher-heits- und Verteidigungsbemühungen dynamisie-ren?15 Zumindest war Jacques Chirac erstaunt, alser angesichts der weltweiten Opposition gegen denIrakkrieg plötzlich von einer Welle der Popularitätgetragen wurde und nicht weniger als 52 afrikani-sche Regierungen auf seinen Antikriegskurs ein-zuschwören vermochte. Dabei verfolgte „Monsi-eur Iraque“, wie Chirac in Frankreich genanntwird, wichtige Öl- und Wirtschaftsinteressen inBagdad, die durch den Krieg verloren gehen. Daauch Putin mit Saddam Hussein gemeinsameInteressen verbanden, verbündeten sich Chiracund Putin zusammen mit Deutschland als verstär-kender Achsenmacht gegen die Irakpolitik derUSA. Mit Putin rückte für Chirac sogar de GaullesVision von einem „Europa vom Atlantik bis zumUral“ in Reichweite. In diesem Sinne artikulierenfranzösische Intellektuelle wie Emmanuel Todd:„Hält man den alten Ost-West-Gegensatz für über-wunden, erscheint es als völlig natürlich und nor-mal, dass Frankreich, Deutschland und Russlandsich zusammenfinden, um die hegemonialen USAim Nahen Osten einzudämmen.“16
Doch was des einen Euphorie, ist des anderenAlptraum. Empfinden sich Frankreich, Deutsch-land und Russland im Frühjahr 2003 als Avant-11 So Stimmen aus Mittel- und Osteuropa, zit. in: Henning
Tewes, Deutschland, Polen, Amerika – und der Irak-Konflikt,in: A. Pradetto (Hrsg.) (Anm. 7), S. 11.12 Thomas Kielinger, Ein Krieg um die Deutung Europas.Die Irak-Krise treibt die nationalen Ich-AGs Frankreich undEngland zum Äußersten, in: Die Welt vom 18. 3. 2003.13 Vgl. Hans-Peter Schwarz, Die Zentralmacht Europas.Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, Berlin 1994.
14 Karl Feldmeyer, Furor im Unterhaus, in: FrankfurterAllgemeine Zeitung (FAZ) vom 19. 3. 2003.15 Vgl. Dirk Schümer, Neu-Europa. Sieger des Irak-Kriegeswird die Weltmacht der Zukunft sein, in: FAZ vom 8. 4. 2003.16 Vgl. Emmanuel Todd, Amerikas Macht wird gebrochen,in: Der Spiegel, (2003) 12.
12Aus Politik und Zeitgeschichte B 24– 25 / 2003
-
garde Europas,17 so fühlen sich insbesonderePolen, Ungarn und Tschechen an schlimme Zeitenwie 1938 erinnert. Die Polen denken an 1939, alsRussland und Deutschland sich auf den ÜberfallPolens einigten und Frankreich seine Verbündetenim Stich ließ.
Die deutschen Ideen eines Kerneuropas, ChiracsVorstellung einer groupe pionnier oder das Modellvom Gravitationszentrum von AußenministerFischer wirken heute weltfremd, denn der Irak-krieg hat Europa nachhaltig gespalten. Porzellanwird derzeit in Europa zerschlagen; es mag not-dürftig gekittet werden, aber an Glanz und Werthat es allemal verloren. Auch deshalb werden diezehn zu erwartenden neuen Mitglieder der EU derfranzösisch-deutschen Avantgarde nicht mehrfolgen, denn das Tandem Paris-Berlin wird füreine doppelte Spaltung mitverantwortlich ge-macht: für die innereuropäische und für die trans-atlantische.
V. Die Irakkrise als KatalysatorEuropas?
Europa muss sich heute auf zwei Perspektiveneinstellen: Angeführt von Großbritannien, Spa-nien und Polen wird in der einen Richtung einatlantisches und zugleich sich kraftvoll nachOsten erweiterndes Europa angestrebt, wobei dieregionale und globale Ordnungsfunktion derUSA auf ausdrückliche Zustimmung stößt. Dochangesichts der Dynamik und der wachsendenÜberlegenheit der Regierung Bush wird auch indiesem transatlantischen Verbund eine verstärkteUnipolarität sichtbar. Diese Vision einer atlan-tischen Zivilisation stützt sich auf die angelsächsi-sche „special relationship“ und auf neue Partnerwie Spanien, Italien, Polen und andere. Deutsch-land spielt hier derzeit keine Rolle mehr, allenfallsdie des Störenfrieds.
Die zweite, „karolingische“ Perspektive entwickeltsich unter der Führung Frankreichs mit deutsch-russischer Gefolgschaft, die vor allem in Washing-ton, aber auch in Mittel- und Osteuropa wie auchin Westeuropa auf Skepsis und Kritik stößt.
Beide Perspektiven, die atlantisch-kontinuierlichewie auch die neu-karolingische, prallen derzeit fastkompromisslos aufeinander, sodass der Wunsch,die Irakkrise als Katalysator für Fortschritte in der
EU zu verstehen, „wenn alle den politischen Wil-len für Reformen aufbringen“,18 derzeit als illuso-risch erscheint. Trotzdem versucht man in Paris,Berlin und im EU-Verfassungskonvent den Ein-druck zu erwecken, als ob „business as usual“möglich sei. Doch die von Paris und Berlin apo-strophierte neue Eigenständigkeit Europas beruhtweniger auf Fakten als vielmehr auf Wunschvor-stellungen. Kritik an der amerikanischen Irakpoli-tik begründet noch lange keine eigenständigeeuropäische Außen- und Sicherheitspolitik. Viel-mehr wird eine EU von 25 Mitgliedstaaten sichimmer weniger auf eine geschlossene Außen- undSicherheitspolitik einigen können, zumal in West-und Osteuropa das Unbehagen an einer Integrati-onslogik wächst, die sich lediglich gegen Amerikastellt, ohne klare eigene Perspektiven bzw. Hand-lungsfähigkeiten aufzeigen zu können. Integrationentsteht nicht allein aus Trotz.19
Dieser Eindruck kontrastiert mit der politischenDynamik, die seit Amtsantritt der Regierung Bushin die Weltpolitik eingetreten ist. Wie immer mandiese Politik bewertet, sie überrollt Europa, setztneue Kräfte frei und lässt bisher bewährte Politikals anachronistisch erscheinen. Gerade der Erwei-terungsprozess der NATO und die Partnerschafts-beziehungen mit Staaten im eurasischen Raumbelegen einen gestärkten amerikanischen Gestal-tungswillen. Amerika ist und bleibt eine europä-ische, ja mittlerweile eurasische Macht. Deshalbgibt es keine Alternative zur Rekonstruktion dertransatlantischen Beziehungen ohne Würdigungvon Amerikas ordnungspolitischer Leistungsfähig-keit. Daraus folgt: Wer in Europa für Scheidungvon den USA plädiert, gewinnt nicht an Einflussüber den amerikanischen Partner, sondern gibt ihnauf, ja macht ihn sich zum Gegner.
War die Geschichte der europäischen Integrationbisher eine Geschichte von erfolgreich bestande-nen Krisen, dann hinkte Europa außen- undsicherheitspolitisch nur deshalb voran, weil Ame-rika letztlich sicherheitspolitisch für und in EuropaOrdnung schaffte. Seit Jahrzehnten bemühen sichdie Europäer vergeblich um verbesserte euro-päische Rüstungskapazitäten, um Modernisierungder nationalen Streitkräfte sowie um eine gemein-same Außen- und Sicherheitspolitik. Was inAnlehnung oder gemäßigter Distanz zu den USA
17 Vgl. „Mehr Europa“. Der politische Kampf geht weiter:Deutsche und Franzosen wollen die Übermacht der USAnicht akzeptieren – auch nicht nach dem Irak-Krieg, in: DerSpiegel, (2003) 14.
18 Zit. in: Thomas Hanke, Hintergrund: Schnitt durch dieNabelschnur. Irak hat die EU-Außenpolitik erschüttert – jetztmüssen die Partnerländer entscheiden, ob Europa Machtpolwird oder Juniorpartner Amerikas bleibt, in: Financial TimesDeutschland vom 3. 4. 2003.19 Vgl. James Appathurai/Michael Rühle, Die Scheidungfällt aus: Ein Bruch zwischen Amerika und Europa kämebeide viel zu teuer zu stehen, in: FAZ Sonntagszeitung vom4. 5. 2003.
13 Aus Politik und Zeitgeschichte B 24–25 / 2003
-
und im Rahmen der alten, westeuropäisch ausge-richteten EU misslang, soll nun in Konfrontationzu den USA angesichts tiefer Spaltung Europasund mittel- und osteuropäischer Entfremdung zuDeutschland und Frankreich gelingen?
Deshalb erscheint die Planung gemeinsamereuropäischer Rüstungsprojekte und eine Harmo-nisierung der nationalen Verteidigungsstrukturenin den Augen der meisten EU-Mitglieder alsantiamerikanisches Komplott der „Viererban-de“,20 nicht jedoch als Ausdruck eines gemein-samen außenpolitischen Grundverständnisses derEU. Mittlerweile versucht die Regierung Schrö-der/Fischer, diesem Projekt die antiamerikanischeSpitze zu nehmen: Es soll keineswegs darumgehen, einen Gegenpol zu den Vereinigten Staatenbzw. zu den NATO-Strukturen zu bilden, so derBundeskanzler, sondern lediglich darum, Partner-schaft zwischen der EU und den USA „auf glei-cher Augenhöhe“ herzustellen. Ja, hätte die Bun-desrepublik in den vergangenen Jahren militärischkraftvoll mitgewirkt, die Bundeswehr, die NATOund die Europäische Sicherheits- und Verteidi-gungspolitik entsprechend gestärkt und amerikani-sche Vorschläge zur Reform der NATO tatkräftigunterstützt, dann hätten Schröders Worte Gewicht.Aber Bundeskanzler und Außenminister haben inihrer bisherigen Europa- und Sicherheitspolitik diemilitärischen Notwendigkeiten sträflich vernach-lässigt. Auch deshalb bleibt der Vorschlag, Frank-reich, Deutschland, Belgien und Luxemburg soll-ten den Kern einer europäischen Armee bilden,rhetorische Hülse, ja er könnte Europa spalten.Schon warnt Italien, dass es zusammen mit Spa-nien, Großbritannien und weiteren Staaten übersicherheitspolitische Alternativen nachdenkt.21
Wo ist Europa organisatorisch, integrationspoli-tisch und weltpolitisch hingeraten? Wo istDeutschland geblieben? Es wächst die bohrendeErkenntnis, dass Deutschland ein beträchtlichesMaß an Mitschuld, wenn nicht sogar Hauptschuldfür viele Fehlentwicklungen trägt. Die Bundesre-gierung hat die amerikakritische Atmosphäre inDeutschland und Europa mit verursacht. Auchdadurch werden alle entsprechenden europapoliti-schen Vorschläge, wie sie jetzt aus Berlin formu-liert werden, vergiftet.22 Was abstrakt durchaus alsüberlegenswert erscheinen mag, wirkt auf demHintergrund der vergangenen Irakkrise fragwürdig
und lädt zu Missbrauch bzw. Fehlinterpretationein. Es entsteht der Eindruck, als wollten Parisund Berlin die proamerikanischen Europäer vonLondon über Madrid und Rom bis nach Warschauabstrafen. Die Politik der Spaltung, die man derRegierung Bush unterstellt, betreibt man selbst.Wer vermag ernsthaft den Beteuerungen des Bun-deskanzlers zu glauben, die Initiative solle deneuropäischen Pfeiler der NATO stärken, wennzugleich von einem „Emanzipationsprozess nachaußen“ die Rede ist. Emanzipation als schroffeAbsage an jahrzehntelange bewährte transatlanti-sche Bündnisstrukturen und Gemeinschaftsinstitu-tionen steht in Wirklichkeit für Bruch. In Abkehrzur Praxis früherer Bundesregierungen wird atlan-tische Partnerschaft und europäische Einigungnicht mehr als Parallelunternehmen, sondern alter-nativ verstanden: Statt transatlantischer Partner-schaft wird der Scheidung das Wort geredet. Wäh-rend Tony Blair die Auffassung vertritt, „dass wireine polare Macht brauchen, die eine strategischePartnerschaft zwischen Europa und Amerika undauch andere Länder – Russland, China – um-fasst“,23 suchen Schröder und Chirac jetzt gemein-sam Europa gegen Amerika zu organisieren undweltpolitisch in Stellung zu bringen. Diese klein-europäisch-kontinentale Perspektive des deutsch-französischen Tandems ist gefährlich, denn die(außen-)politische Geschichte der BundesrepublikDeutschland der letzten fünfzig Jahre lehrt, dasssich deutsche Interessen, aber auch die der Euro-päer nicht kleineuropäisch verwirklichen lassen,sondern eher, wenn beide Seiten des Atlantiks imBewusstsein einer sie verbindenden „atlantischenZivilisation“ (Hannah Arendt) gemeinsam han-deln.24 Wenn die Westeuropäer auch oft über ame-rikanische Bevormundung klagten, realpolitischprofitierten sie von Amerika als europäischerMacht.
VI. Deutschland, Europa unddie Zukunft der transatlantischen
Beziehungen
Europa steht gegenwärtig nicht am Scheideweg,weil ein europäischer Bundesstaat um den Preisder Aufgabe von Nationalstaatlichkeit von dergroßen Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten abge-lehnt wird, sondern mit Blick auf die Frage, ob es
20 Vgl. Christian Schwennicke/Christian Wernicke, DieVierbande im Visier. Sicherheitspolitisches Treffen in Brüsselsorgt weiter für Ärger in der Europäischen Union, in: Süd-deutsche Zeitung vom 12./13. 4. 2003.21 Vgl. „So geht es nicht weiter“. Rom warnt vor einerSpaltung der EU, in: FAZ vom 28. 4. 2003.22 Vgl. Klaus-Dieter Frankenberger, Kleineuropa ist keineLösung, in: FAZ Sonntagszeitung vom 30. 3. 2003.
23 Vgl. Blair: Frankreichs Vorstellungen sind gefährlich, in:FAZ vom 29. 4. 2003.24 Vgl. Christian Hacke, Die Außenpolitik der Bundes-republik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis GerhardSchröder, Berlin 2003, S. 568 ff.
14Aus Politik und Zeitgeschichte B 24– 25 / 2003
-
ein europäisches oder in bewährter Tradition einatlantisches Europa wünscht.25 Deshalb müssendie Regierungen sich bald darüber verständigen,ob, wie und in welche Richtung transatlantischePartnerschaft zu Beginn des 21. Jahrhundertserneuert werden soll. In Berlin ringen derzeit zweiAuffassungen miteinander: Einerseits erweckt dieBundesregierung den Eindruck, als ob ihr an einerWiederherstellung der deutsch-amerikanischenBeziehungen gelegen sei. Andererseits nimmt dieBundesregierung von ihrer Kritik an der Regie-rung Bush offensichtlich wenig zurück und bleibtim politischen Windschatten Frankreichs. Auchwird zunehmender pauschaler Kritik an Amerikain Deutschland nicht genügend widersprochen.Das ist ein Zeichen dafür, dass die historischeLeistung der Vereinigten Staaten für die deutscheEntwicklung der vergangenen 50 Jahre ebenso ver-drängt wird, wie man alle denkbaren Parallelenzwischen Deutschland 1945 und Irak 2003 leugnet.1945 waren die Amerikaner willkommene Befreier,heute werden sie in Berlin als Imperialisten gese-hen. Dabei wird vergessen, dass die deutscheDemokratie mit all ihren Wurzeln ein imperialisti-scher Oktroi war und ist.26 Vorurteile erschwereneine sachliche und zukunftsorientierte Grundsatz-debatte über die deutsche Außenpolitik nach demamerikanischen Sieg im Irak, mehr Bereitschaft zurSelbstkritik in Berlin wäre wünschenswert.
Die Frage nach der völkerrechtlichen Legitimitätdes Krieges ist weniger relevant als vielmehr diepolitische Rückbesinnung auf Deutschlands Rolleals Garant transatlantischer Orientierung und aufseine ausgleichende Funktion innerhalb derEuropäischen Union.27 Europa steht nicht alter-nativ zur atlantischen Partnerschaft, sondern bleibtsein wesentlicher Bestandteil. Gegen die USA istEuropa nicht zu einen. Die Irakkrise hat gezeigt,dass derjenige Europa spaltet, der es gegen dieUSA einen will. Auch wird den Europäern ohneoder gegen die USA die dauerhafte StabilisierungOst-, Mittel- und Südosteuropas ebenso weniggelingen wie die Befriedung des Balkans in denneunziger Jahren. Ebensowenig wird ihnen dieAnbindung Russlands an die europäischen undtransatlantischen Strukturen als zentrales Zieleuropäischer Politik aus eigener Kraft gelingen.28
So liegt für Deutschland dank seiner europäischenZentrallage der Beitritt der östlichen Nachbarnzur EU und zur NATO im eigenen Interesse. Dasdeutsch-französische „Tandem“ bleibt für dieeuropäische Einigung nur dann essentiell, wenndiese Kooperation gänzlich anders als im Zeichender Irakkrise funktioniert, nämlich mit Gespür fürdie Interessen der anderen Mitgliedstaaten, insbe-sondere in Mittel- und Osteuropa, und unterAnerkennung der transatlantischen Bindungen.
Was ist Frankreich, wird zunehmend kritisch ge-fragt: „Ein Land, das nach einem Krieg, der vorfast sechzig Jahren beendet wurde und nach demes nur gnadenhalber zu einer Siegermacht erklärtwurde, immer noch weltpolitisch entscheiden soll.Ein Land, das sich damals nicht gerade heroischverteidigt hat und doch wie ein lebendiger Ana-chronismus als ständiges Mitglied im Sicherheits-rat sitzen darf.“29
Wenn Frankreich mehr außenpolitische Zurück-haltung entwickeln und seine nationalen Interes-sen stärker gemeinschaftsorientiert ausrichtenwürde, dann fiele es Deutschland leichter, zwi-schen atlantischem und europäischem Europa,zwischen großen und kleinen Mitgliedstaaten aus-zubalancieren. Vor allem darf Deutschland niewieder selbstverschuldet oder von Frankreich ani-miert in eine außenpolitische Falle laufen, sondernsollte die bewährte Maklerposition wieder ernstnehmen. Der Weg aus Isolierung und Marginalisie-rung deutscher Außenpolitik im Zuge der Veren-gung auf den „deutschen Weg“ führt deshalb vor-erst über Washington, London, Madrid undWarschau. Nur so kann wieder volle außenpoliti-sche Handlungsfähigkeit erreicht werden. Groß-britannien, Spanien und Polen sind für die USA zuzentralen Partnern eines transatlantischen Europageworden. So entstehen mit Rückendeckung derUSA vielfach neue Kraftzentren in Europa.Gerade Polen hat von seiner Solidarität mit denUSA im Zuge des Irakkrieges profitiert, weil esmit seinen Soldaten die Ölförderanlagen im Iraksichern half. Polen knüpft an traditionell engeBeziehungen zu den Angelsachsen an. Heute bil-det es mit Großbritannien die transatlantischeKlammer eines erweiterten Europa und wird ver-mutlich im Irak eine Besatzungszone zur Verwal-tung übernehmen. Polen, nicht Deutschland, ist inder Sicht der USA auf dem Weg zur ZentralmachtEuropas. Deutschland hingegen ist zum Problemgeworden.
25 Vgl. Volker Kronenberg, Europa am Scheideweg?, in:Mut, (2003) 4, S. 34–38; ihm dankt der Verfasser für weiter-führende Anregungen.26 Vgl. Thomas Schmid, Ami go home. Viele wünschenAmerika Misserfolg im Irak, in: FAZ Sonntagszeitung vom 4.5. 2003.27 Vgl. Gerd Roellecke, Durften die das? Dumme Frage:Vom Unrecht des Siegers sollten wir schweigen, in: FAZ vom12. 4. 2003.28 Vgl. Wolfgang Schäuble, Kontinuität und Wandel – dieZukunft deutscher Außenpolitik. Typoskript einer am
10. März 2003 in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stif-tung in Berlin gehaltenen Rede.29 Richard Swartz, Schwimmschule. Der Atlantik beginntin Polen, in: Süddeutsche Zeitung vom 1./2. 3. 2003.
15 Aus Politik und Zeitgeschichte B 24–25 / 2003
-
Zurzeit erscheint eine Wiederannäherung zwi-schen Washington und Berlin schwierig, solangePräsident Bush und Bundeskanzler Schröderregieren. Doch auf der Arbeitsebene der Ministe-rien könnte mehr „rhetorische Abrüstung, Zuwen-dung, neuer Dialog mit der amerikanischen Politikentwickelt“ werden.30 Vordergründig wird dieRegierung Bush auf deutsche Avancen freundlichreagieren, doch es bleibt Enttäuschung, Miss-trauen und die Einschätzung dieser Bundesre-gierung als außenpolitisch unzuverlässiges Leicht-gewicht ohne realpolitische Bodenhaftung.Umgekehrt bleibt Berlin misstrauisch gegenüberder Regierung Bush. Doch die USA brauchenDeutschland weniger, vielmehr ist Berlin auf dieUnterstützung Washingtons angewiesen. Im Übri-gen ist das selbstbewusste Verhalten der Regie-rung Bush nicht so beispiellos, wie es denAnschein hat. Im Verlauf der fünfzig Jahredeutsch-amerikanischer Beziehungen gab es hef-tige Meinungsverschiedenheiten. Im Zuge derdiversen amerikanischen Strategiewechsel vonmassiver Vergeltung zur flexible response, in derOstpolitik, während der Energiekrise der siebzigerJahre, im Zuge von Nixons Wirtschaftspolitik, beider geplanten Einführung der Neutronenwaffe, inder Nachrüstungsdebatte, bei Präsident ReagansSDI-Initiative, bei seiner Abkehr von der nuklea-ren Abschreckungstheorie, bei der Re-Ideologisie-rung der amerikanisch-sowjetischen Beziehungenund nicht zuletzt mit Blick auf den Vietnam-Kriegwaren deutsche Regierungschefs und Außen-minister wiederholt mit imperial auftretendenamerikanischen Präsidenten konfrontiert. Dochvon Konrad Adenauer bis Helmut Kohl, vonAußenminister Heinrich von Brentano bis Hans-Dietrich Genscher wurden alle Probleme profes-sionell interessenorientiert gelöst. Dabei entstandein hohes Gut an Vertrauensbildung. KonradAdenauers Rat war vor allem bei AußenministerJohn Foster Dulles gefragt. Gegenüber derRegierung Kennedy gelang es Adenauer im Zugeder Berlin-Krisen unausgegorene amerikanischeDeutschlandpläne zu verhindern. Willy BrandtsOstpolitik stieß auf Unverständnis und Kritik inWashington, wurde aber zum Vorbild für amerika-nische Entspannungspolitik.31 Ohne die Ratifizie-rung der Ostverträge wäre es nicht zum amerika-nisch-sowjetischen Gipfel im Mai 1972 gekommen.Hans-Dietrich Genscher gelang es nach schwieri-gen Verhandlungen, die Amerikaner vom Sinn derKSZE zu überzeugen. Im Frühjahr 1989 setzte ersich sogar gegen die Regierung Bush sen. durch
und verhinderte die Modernisierung der NATO-Mittelstreckenraketen in Europa, die ein proble-matisches Zeichen in den Ost-West-Beziehungengesetzt und die Vereinigung Deutschlands nichterleichtert hätte. Diese Liste deutsch-amerikani-scher Kontroversen ließe sich beliebig fortsetzen,doch sie zeigt eines: Bis 1989 besaß die Bundesre-publik provinziellen Charakter, wurde aber vonsouveränen Regierungschefs und Außenministernprofessionell geführt. Heute ist die Bundesregie-rung formal souverän, wird aber außenpolitischdilettantisch geführt.
Die Bundesregierung Schröder/Fischer hatDeutschlands Außenpolitik im Zuge der Irakfrageschwer beschädigt, denn sie konnte sich nichtdurchsetzen. Auch hat sie die Verletzung der Men-schenrechte im Irak, die Despotie, die Gefahr derMassenvernichtungswaffen und Saddam HusseinsKriegsbereitschaft geflissentlich übergangen. Ja,Bushs Forderung nach Regimewechsel wurde inBerlin kategorisch abgelehnt. Nicht „Nie wiederKrieg“, sondern „Nie wieder Diktatur und Aggres-sion“ hätte die Erkenntnis heißen müssen, die ausder Erfahrung des nationalsozialistischen Terrorsund der deutschen Entfesselung des Zweiten Welt-kriegs resultiert.32
Wer Krieg verhindern will, muss letztlich bereitsein, ihn zu führen. Darin besteht das Abschre-ckungsmoment, darauf beruht die Krisendiploma-tie der Stärke, welche die Vereinigten Staaten alsVor-, Hegemonial-, Imperial- oder als Ordnungs-macht (wie immer man sie bezeichnen mag) auchin Zukunft praktizieren werden. Die Zukunft vonEuropa und der „atlantischen Zivilisation“ sowiedie ihrer tragenden Institutionen wie UNO,NATO, WEU und OSZE und die Rolle des tra-dierten Völkerrechts sind ungewiss, doch gibt eskeinen Weg zurück in die Vorkriegsordnung. Seitdem 11. September 2001, dem Afghanistan-Kriegund dem fortgesetzten Krieg gegen den Terroris-mus und vor allem seit dem Sieg über SaddamHussein sind Macht- und Selbstbewusstsein derRegierung Bush weiter angestiegen. Ihre Bereit-schaft, international und regional noch stärker ein-zugreifen, ist entsprechend gewachsen. Auf diesemHintergrund wäre Berlin gut beraten, folgendeErkenntnis zu berücksichtigen: Wer von der ameri-kanischen Hegemonie nichts wissen will, „derkann die Hoffnung auf Weltfrieden begraben“33.
30 Vgl. Hans-Ulrich Jörges, Nicht ohne Amerika. Eine an-tizyklische Verteidigung der USA gegen Verirrungen derdeutschen Seele, in: Der Stern, Nr. 15 (2003).31 Vgl. Chr. Hacke (Anm. 24), S. 159 ff.
32 Vgl. Klaus Larres, Mutual Incomprehension: U. S.-Ger-man Value Gaps beyond Iraq, in: The Washington Quarterly,(Spring 2003), S. 23–42.33 Vgl. Karl Otto Hondrich, Auf dem Weg zu einer Welt-gewaltordnung. Der Irak-Krieg als Exempel: Ohne eine He-gemonialmacht kann es keinen Weltfrieden geben, in: NeueZürcher Zeitung vom 22./23. 3. 2003.
16Aus Politik und Zeitgeschichte B 24– 25 / 2003
-
Andrew B. Denison
Unilateral oder multilateral?Motive der amerikanischen Irakpolitik
I. Einleitung
Ein Gespenst geht um die Welt: die Furcht vor denVereinigten Staaten von Amerika als Unilateralist,Imperialist und Hegemon. Washingtons Diploma-tie war gescheitert: die UNO gelähmt, die NATOgespalten und die USA isoliert. Die Achse Paris–Berlin–Moskau strebte als selbst ernanntes Gegen-gewicht zur neuen Hypermacht den Status einerSupermacht an. Die Motive Washingtons in Bezugauf den Irak seien selbstsüchtig, kurzsichtig undvor allem gefährlich, so der Vorwurf.
Unter der Regierung von George W. Bush wurdeMultilateralismus zum Schimpfwort. Zusammen,wenn möglich, allein, wenn nötig – diese alteDevise klang plötzlich gefährlich. Eine Militarisie-rung der amerikanischen Außenpolitik war imGange mit neuer Zielrichtung: Präemption. Ame-rika allein entscheidet jetzt, wer und was eineGefahr für seine Sicherheit darstellt. Der Regime-wechsel im Irak wurde zum wichtigsten Ziel ame-rikanischer Außenpolitik. War diese Absicht wirk-lich von unilateralistischen Motiven beeinflusst?Gab es überhaupt ein Interesse an Diplomatie?Kam dem Multilateralismus in dieser Irak-Kampa-gne, in diesem neuen amerikanischen Weltkrieggegen das tödliche Triumvirat aus Terroristen,Tyrannen und Technologien der Massenvernich-tung keine Bedeutung zu? War die Blockade desSicherheitsrates ein klarer Beweis eines neuenamerikanischen Unilateralismus oder einesAbschieds von der Diplomatie?
Kein Zweifel, manches, was man im Weißen Hausfür diplomatisch wünschenswert erklärt hatte,konnte nicht realisiert werden, wie z. B. eine zweiteIrak-Resolution der UNO, eine aktivere Zusam-menarbeit mit der Türkei sowie eine friedliche Ent-waffnung des Irak. Fehlerfrei war WashingtonsDiplomatie aber auch nicht. Brüskierte Partner gabes viele. Neue Abgründe taten sich in Europa auf.Selten waren die transatlantischen Gemüter sogereizt wie in den Monaten vor Iraqi Freedom.Manche Beobachter führten dies auf einen ent-schlossenen, hartnäckigen Unilateralismus derBush-Regierung zurück. Vielleicht war es sogar einabsichtliches Scheitern der Diplomatie, um dieFesseln des Multilateralismus abzuschütteln.
Es ist aber auch eine andere Deutung möglich: Jazur Diplomatie unter neuen Vorzeichen, nein zueiner Ablehnung des Multilateralismus. Es ist aberein Multilateralismus American style, nicht Euro-pean style. Es handelt sich um einen sich weiterentwickelnden Multilateralismus, der sich auseiner alten Tradition heraus neu organisiert. Unila-teralismus scheint dagegen etwas unpräzise.1 Uni-polarismus wäre zutreffender. Amerika ist sichseiner Macht, seines Einflusses und seiner Einzig-artigkeit in der Welt des 21. Jahrhunderts bewusst.Eine multipolare Welt wünscht sich so mancher,auch selbstbewusste Amerikaner, und zwar alsKorrektiv ihrer eigenen Übermacht. Diejenigen,die von einer wünschenswerten multipolaren Ord-nung sprechen, tun sich keinen Gefallen, wennsie dies übersehen. Unipolarismus heißt nichtAbschied von der Verantwortung oder Abschiedaus einer institutionell gestützten internationalenWillensbildung. Es heißt Erkenntnis des globalenEinflusses dieses Landes und dessen multilateralis-tischer Quellen. Es gilt, dessen Konsequenzen zuerkennen: Multilateralismus American Style.
Diese politische Haltung sollte nicht verwechseltwerden mit einer bewussten Ablehnung der engenPartnerschaft mit anderen Ländern. Im Gegenteil:Amerika sucht immer nach Partnern, aber nichtunter jeder Bedingung. Die Zusammenarbeit musssich lohnen, nicht nur für die Welt, sondern auchfür Amerika. So auch im Falle des irakischenRegimewechsels: Hier zeigte sich ein starker Hangzur Zusammenarbeit, gekennzeichnet durch denStil des Präsidenten Bush, die Ereignisse des11. September 2001 sowie die unterschiedlich ent-wickelten Einflussmöglichkeiten der internatio-nalen Akteure der heutigen Welt.
II. Die weit zurückliegende Genese
Die Entscheidung, gegen den Irak Krieg zu führen,um ihn zu entwaffnen und Saddam Hussein zu ent-
Mein Dank gilt Frau Roswitha Wyrwich für ihre wertvollenRatschläge.1 Vgl. dazu Stefan Fröhlich, Zwischen Multilateralismusund Unilateralismus. Eine Konstante amerikanischer Au-ßenpolitik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), B 25/2002.
17 Aus Politik und Zeitgeschichte B 24–25 / 2003
-
machten, hat ihren Ursprung am Beginn der neun-ziger Jahre. Mit dem Krieg zur Befreiung Kuwaitsund der damaligen Frage nach der Zukunft Sad-dams begann auch die politische Willensbildungüber die Strategie seiner Entmachtung.2 Ob dieserKrieg das Etikett „gewollter“ oder „angekündig-ter“ Krieg verdient,3 soll nicht davon ablenken,wie intensiv dieser Waffengang in den letzten Jah-ren diskutiert, geplant und vorbereitet wurde –nicht nur in Washington, sondern auch in der übri-gen Welt. Ob die USA den Angriff auf den Irakletztendlich auch führen würden, konnte man biszum 20. März 2003 nicht mit Sicherheit sagen.
Der „Kampfmarsch einer Idee“,4 wie es das „TimeMagazine“ – nannte, begann bereits im August1990, als irakische Truppen in Kuwait einzogenund Washington mit Desert Shield/Desert Stormantwortete. Einzelne Beobachter behaupten sogar,es handele sich hier um einen Krieg, der 1991 mitder Befreiung Kuwaits begonnen hat und im Jahre2003 mit der Entwaffnung und Entmachtung vonSaddam Hussein zu Ende geht.5 Eine Rückblendeauf das Jahr 1990 ist auch wichtig als Vergleich.
Unter Präsident George Bush senior verlief dasDiplomatische in der Tat anders als bei George W.Bush junior. Das Vorgehen des Vaters basierte aufeiner breiten internationalen Zustimmung sowieder Legitimation durch die Vereinten Nationen.Grünes Licht aus dem UN-Sicherheitsrat halfBush senior, die notwendige Unterstützung vomUS-Kongress zu erhalten.6 Bei Bush junior war esumgekehrt: Eine von beiden Parteien unterstützteResolution des Kongresses am 2. Oktober 2002gab ihm Rückendeckung, um auch ohne UN-Zustimmung „amerikanische Streitkräfte so ein-zusetzen, wie er (es) für nötig und richtig hält . . .,um die nationale Sicherheit gegen die andauernde
Bedrohung Iraks zu schützen . . . und um dierelevante UN-Resolution durchzusetzen“7. Dieinternationale Unterstützung, die Bush juniorsuchte, bekam er aber nicht.
Es stellt sich immer wieder die Frage, warum dasWeiße Haus sich nicht schon 1991 zu einem Ein-marsch in Bagdad entschlossen hat. Was hat sichan den Rahmenbedingungen geändert? Was sinddie Gründe dafür, dass amerikanische Truppenjetzt Bagdad kontrollieren? Die Anschläge vom11. September 2001 auf das World Trade Centersowie das Pentagon scheinen das auslösendeMoment gewesen zu sein.8 Mit der Zerstörung desWorld Trade Centers schien die angloamerikani-sche Irakstrategie der Abschreckung und Eindäm-mung ein viel höheres Risiko mit sich zu bringen,auch wenn Saddam nicht unmittelbar für dieAngriffe verantwortlich gemacht werden konnte.
Zusammen mit Großbritannien und oft im Wider-spruch zu den anderen Vetomächten versuchteWashington seit 1991, für eine wirksame Eindäm-mung und Abschreckung Iraks einzutreten undsich dafür eine ausreichende diplomatische Rü-ckendeckung zu sichern.9 Mit anderen Worten:Die diplomatischen Auseinandersetzungen überden Irak fingen nicht erst nach George W. BushsRede vor der UNO am 12. September 2002 anoder mit den Anschlägen des 11. September. Sieexistierten seit August 1990, weil sich das ProblemSaddam Hussein nicht von allein lösen wollte. Mitdem 11. September veränderten sich aber die ame-rikanischen Motive. Die Argumente, die für einenKrieg sprachen, fanden größere Resonanz in deramerikanischen Öffentlichkeit.
III. Die Vielfalt der Motive
Die Interessen der amerikanischen Außenpolitikbestehen aus sicherheits- und wirtschaftspoliti-schen sowie idealistischen Motiven. Oft konkurrie-ren sie miteinander, was die inneren Spannungenund Widersprüche der amerikanischen Außenpoli-tik erklärt. Diese Interessen-Triade spielte auchbei der Entscheidung, einen Krieg gegen Irak zuführen, eine wichtige Rolle. Es handelte sich nichtum ein, sondern um viele zum Teil miteinander
2 Formal kam dieses Ziel der amerikanischen Regierungerst in einem Gesetz des US-Kongresses im September 1998deutlich zum Ausdruck, kurz bevor die Inspektoren den Irakwegen Behinderung ihrer Arbeit verlassen mussten, und dieUSA und Großbritannien im Dezember 1998 mit Desert Foxvier Tage lang die Waffenanlagen und Führungsziele des Irakzerstörten. Die Iraq Liberation Act autorisierte 97 MillionenUS-Dollar zur Unterstützung des Pentagons für dieses Ziel.3 Vgl. Hans von Sponeck/Andreas Zumach, Irak – Chronikeines gewollten Krieges. Wie die Weltöffentlichkeit manipu-liert und das Völkerrecht gebrochen wird, Köln 2003; MichaelEhrke, Erdöl und Strategie: Zur politischen Ökonomie einesangekündigten Krieges, in: Internationale Politik und Ge-sellschaft, (2003) 1.4 Michael Elliott/James Carney, First Stop, Iraq, in: TimeMagazine vom 31. 3. 2003.5 So der US Energie-Experte Danil Yergin: „Historians willlook back someday and see this not as two wars, but as theconclusion of a 13-year-long war“, zitiert nach David vonDrehle, „Bush Bets Future on Success in Iraq“, in:Washington Post vom 16. 3. 2003.6 Vgl. James A. Baker, III, The Politics of Diplomacy, NewYork 1995, S. 339.
7 Joint Resolution 46 of the U. S. Congress to authorize theuse of United States Armed Forces against Iraq vom 2. 10.2002.8 Vgl. Heinrich Kreft, Vom Kalten zum „Grauen Krieg“ –Paradigmenwechsel in der amerikanischen Außenpolitik, in:APuZ, B 25/2002.9 Vgl. Richard Butler, The Greatest Threat: Iraq, Weaponsof Mass Destruction, and the Growing Crisis of Global Secu-rity, New York 2000.
18Aus Politik und Zeitgeschichte B 24– 25 / 2003
-
konkurrierende Motive, welche die USA dazubewegten, die Auseinandersetzung mit dem Irakmilitärisch zu führen. Manche Beobachter meintenzwar, es sei verdächtig, dass Bush immer wiederdie Motive wechselte: Mal waren es die Massen-vernichtungswaffen, mal ein Verstoß gegen dieMenschenrechte, mal eine Verbindung zum Ter-rornetz der Al Qaida; letztendlich brachte man dieDemokratisierung des ganzen Nahen Ostens alsArgument vor. Beim Irak trafen viele Gründezusammen, die sich zu einer „kritischen Masse“zusammenfügten. Sie erklären, warum der Irakanders ist als die anderen Mitglieder der „Achsedes Bösen“.
Ein Motiv hätte nicht ausgereicht, um die amerika-nische Öffentlichkeit und die anderen Länder voneinem Angriff auf den Irak zu überzeugen, allezusammen aber schon. Folgende Ziele wollten dieUSA mit ihren Verbündeten erreichen: Entmach-tung und Entwaffnung, Erhaltung der territorialenIntegrität, Vermeidung eines Bürgerkriegs, Be-teiligung der lokalen Kräfte an der Macht, einepsychologische Verbesserung der Position Ameri-kas in der Region (die USA als Befreier und nichtals Besatzer) sowie die Geringhaltung der Verlusteund Kosten.10 Diese Vielfalt von Interessen, Argu-menten und Zielen prägte die Diskussion schonseit 1991. Der 11. September jedoch markierteeinen Wendepunkt und ließ den Irak in einemanderen Licht erscheinen.11
Es waren aber erst die erfolgreichen Einsätze inAfghanistan gegen Al Qaida und die Eindämmungder Konflikte zwischen Israel und den Palästinen-sern sowie zwischen Indien und Pakistan, welchedie Argumente in eine konkrete Entscheidungmünden ließen. Die endgültige Ablehnung deralten Strategie der Eindämmung und Abschre-ckung (mit Sanktionen und Inspektionen) betrafden einen Teil dieser Entscheidung, die Über-nahme einer Strategie der Entwaffnung und Ent-machtung, zur Not mit Krieg, den anderen. Ame-rika wollte sich nicht aus dem Persischen Golfzurückziehen, es wollte den Konflikt eskalieren
lassen. Die Argumente „Amerika ist schon über-fordert“, „andere Probleme haben Priorität“, diesich gegen einen Krieg richteten, wurden abge-lehnt.
Wie oben angedeutet, drehte sich die Vielfalt derMotive nicht nur um die Zukunft des Irak. Dergegenwärtige Ansatz ist mehr als nur eine neueStrategie für das alte Problem Saddam. Er ist „abattle“, so George W. Bush am 2. Mai 2003 aufdem Flugzeugträger Abraham Lincoln, also nurein Bestandteil eines neuen amerikanischen Enga-gements gegen die eigene, auch die globale Ver-wundbarkeit. Das „Time Magazine“ beschreibtdiese Motivation wie folgt: „In truth, this war isjust as much about an idea – that Iraq is but thefirst step in an American-led effort to make theworld a safer place.“12 Der 11. September verklei-nerte die Welt, weil er Amerikas Interesse amWeltgeschehen schlagartig vergrößerte.
Für Washington sind die Brutstätten des radikalenIslams jetzt zur strategischen Sorge Nummer einsgeworden. Die Quellen der terroristischen Macht,ob staatlich oder nichtstaatlich, ob finanziell oderideologisch, ob organisatorisch oder technologisch,stehen nun im amerikanischen Fadenkreuz. EinSieg gegen den Irak bietet die Gelegenheit, dieLandkarte des Nahen Ostens zu verändern.Washington behauptet, dass der Irak als überzeu-gendes Modell eines modernen arabischen Staats-gebildes dienen könnte. Al Qaida ist vielleicht diegrößte Terrorbedrohung, aber die Ursachen dieserBedrohung sind allgemeinerer Natur, und dieMotive des Irakfeldzugs sind hiermit verbunden.
Die Bush-Administration argumentierte, dass dieBeseitigung Saddams den Frieden zwischen Israe-lis und Palästinensern fördern würde. Inzwischenzeigen sich die Vorteile für den Friedensprozess,die ein sich demokratisierender Irak bringenkönnte. Saddam unterstützte die Palästinensersowohl finanziell als auch ideell. Ohne ihn könntendie Palästinenser und die Israelis kompromissbe-reiter sein.13
Eine Gallup-Umfrage zeigt die Gründe pro undkontra Irakkrieg (vgl. Tabellen 1 und 2). Von denGründen, die gegen einen Krieg sprechen, unter-stützen die Befragten nur zwei von neun mit 50Prozent oder mehr: erstens, viele unschuldige Ira-kis würden sterben; zweitens, viele amerikanischeSoldaten würden sterben. Nur 30 Prozent derAmerikaner meinten, „Hussein stellt keine . . .Bedrohung für Amerika . . . dar“, und hielten dasfür ein gutes Argument gegen den Krieg.
10 Vgl. die gründliche Behandlung der amerikanischenKriegsziele (Iraq War Plans Series) durch Stratfor, eineaußenpolitische Forschungseinrichtung in Austin, Texas(www.stratfor.biz).11 Kenneth Pollack begründet die Bedeutung des11. September folgendermaßen: „Certainly September 11changed the public mood [and] made an invasion of Iraqpossible in a way that had never been the case in the past. Youcould suggest that some people decided to hijack the 9/11 is-sue to deal with Saddam Hussein for reasons that they mayhave recognized had little to do with terrorism. But I [also]think that it is the case that there were a number of importantBush administration officials, perhaps including the presi-dent, who really do believe that Iraq was tied to the war onterrorism.“ Interview mit Kenneth Pollack vom 2. 5. 2003(www.cfr.org).
12 M. Elliott/J. Carney (Anm. 4).13 Vgl. Michael Scott Doran, Palestine, Iraq, and AmericanStrategy, in: Foreign Affairs, (Januar/Februar 2003).
19 Aus Politik und Zeitgeschichte B 24–25 / 2003
-
Diese Umfragen zeigen eine differenzierte Einstel-lung für und gegen einen Krieg. Es gibt also eineÜbereinstimmung mit der publizierten Meinungund der Argumentationslinie der Regierung Bush.Diese spiegelt einen breiten Konsens wider, derauf einen langen Prozess der politischen Willens-bildung zurückzuführen ist. Dieser Konsens warüberparteilich (obwohl Amerikaner bei innenpoli-tischen Fragen viel mehr gespalten sind). In derAußenpolitik waren zwar mehr Demokraten alsRepublikaner gegen Bushs Kriegspläne, aber vieleDemokraten, ob Wähler oder ehemalige Regie-rungsmitglieder, unterstützten eine militärischeEntscheidung gegen den Irak. Nur so erklären sichdie Umfragewerte für den Präsidenten, die überMonate bei 70 Prozent und darüber lagen.
IV. Macht und Ordnungin einer neuen Welt
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts scheint es, als obdas 20. Jahrhundert nicht das einzige amerikanische
Jahrhundert gewesen ist.14 Amerikaner sind sichihres Einflusses in der Welt bewusst und überzeugt,dass diese Macht verpflichtet. Einerseits bringtMacht Verantwortung, andererseits erzeugt sie abernicht nur Respekt, sondern auch Groll (resentment),wie Außenminister Colin Powell sagte.15
Amerikas selbstbewusster Umgang mit der eige-nen Macht ist nicht neu. Neu ist jedoch AmerikasDefinition der internationalen Ordnung. Seien esdie konstituierenden Elemente, die Bedrohungenoder die Rolle Amerikas in dieser Ordnung – dieAmerikaner sind überzeugt, dass eine Zeiten-wende ähnlich der späten vierziger Jahre imGange ist.16 Es gab das Irak-Problem zwar schonlange, aber seine Bedeutung wuchs in den neunzi-
Tabelle 1: Gründe, die für ein militärischesVorgehen gegen den Irak sprechen
(sortiert nach„guten Gründen“)