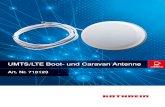Das Boot ist voll
-
Upload
dieperspektive -
Category
Documents
-
view
241 -
download
3
description
Transcript of Das Boot ist voll

kunst, kul tur & pol i t ikkunst, kul tur & pol i t ikkunst, kul tur & pol i t ik
FebruarMärz 2014
31

31
Illustratorin
der Ausgabe
Michelle MoserSeiten 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 38
2
KONTAKT verein dieperspektive, zentralstrasse 167,
8003 zürich REDAKTION simon jacoby & conradin zellweger & manuel
perriard & konstantin furrer & marius wenger
& andrea schweizer & fabienne bruttin LAYOUT isabella furler
COVER isabella furler LEKTORAT konstantin furrer DRUCK nzz AUFLAGE
4000 ARTIKEL EINSENDEN [email protected] WERBUNG
ABO [email protected] LESERBRIEFE [email protected]
THEMA DER NÄCHSTEN AUSGABE Müll / TRASH
GÖNNERKONTO pc 87-85011-6,
vermerk: gern geschehen REDAKTIONSSCHLUSS
donnerstag, 27. februar 2014, 23.55 uhr
IMPRESSUM
EDITORIAL 3
Das Duell Der linke Simon und der
rechte Peter streiten über
Ausländer. Dürfen alle kom-
men oder müssen alle raus?
Zuwanderung wieder selbstkontrollieren
Ständerat Thomas Minder
(fast-SVP) findet, das Boot sei
schon voll und alle Ausländer
sollen gehen.
Rechtspopulismus: Die Geissel Europas
Die Rechtspopulisten breiten
sich in Europa aus. Immer mehr
und immer extremer.
Kapitalisten sind nicht die einfachsten
Das Erfolgsmodell Schweiz ist
eine Lüge. Treten wir gemeinsam
nach oben!
Yassine & Riodje Ein junger Nordafrikaner
kam mit dem FCZ-Bus in die
Schweiz. Jetzt erfahren wir
seine Geschichte.
Wir Schweizerinnen& die Andern
Das Zürcher Minarett ist
kaum zu sehen. Doch Frau
Schweizer fürchtet sich vor
dem Unbekannten.
« Die Flagge der Schweiz gilt in Afrika als Symbol für Menschlichkeit »
Ein Asylsuchender erzählt
vom offenen Gefängnis Schweiz.
Ein Bericht, der unter die Haut
geht.
«Ich bin ein Mensch, kein Tier»
Die Redakteure Conradin
und Simon besuchten ein
Asylheim. Es ist wie im
Gefängnis, nur ein bisschen
anders.
Ein Boot ohne Steuermann Ein Boot namens Europa
treibt führungslos über die hohe
See. Es ist so gar nicht bereit für
die aufkommenden Stürme.
Die Überstunden werden mit der Interessantheit der Arbeit kompensiert
Schweizer Filme haben es
nicht einfach: Ständig kämpfen sie
ums Geld. Einige Filme wurden
trotzdem gut.
8
4 6
12
16
31
18
22
15
28
Das Boot ist voll 3
Inhalt. Hin
terg
run
d
Th
em
a
1942Tunnels werden zugemauert. Brücken mit Sta-cheldraht versehen. Nazisoldaten kontrollieren die Züge, welche in die Schweiz einfahren. Wie durch ein Wunder gelangt ein kleines Grüpp-chen von sechs l üchtigen Juden mithilfe eines Deutschen Deserteurs in die Schweiz. Nach an-fänglichem Wohlergehen auf einem kleinen Bauernhof wendet sich das Blatt. Die Bewohner des Dorfes sprechen hinter vorgehaltener Hand darüber, dass halt nicht alle von «diesen» in der Schweiz Platz haben. Die Bestimmungen für Flüchtlinge um in der Schweiz aufgenommen zu werden, sind hart. Die Versorgungslage der Schweiz wird von der Regierung als prekär einge-stuft. Die Flüchtlingspolitik wird stark verschärft, die Grenzen beinahe dicht gemacht. Alle sechs Flüchtlinge werden ins Gefängnis gesteckt und für die Ausschaffung vorbereitet. Den einen Be-amten zerreist es fasst das Herz, als sie die zwei Kinder, einen Jugendlichen, das Fräulein Judith Krüger, den kranken Greis Ostrowskij und den Deserteur über die Grenze nach Deutschland zu-rückschaffen müssen. Im Wissen, oder zumindest mit der Vermutung, dass deren Leben gefährdet ist. Aber Gesetz ist Gesetz. Und das steht schwarz auf weiss auf einem Papier. Wer weiss, vielleicht ist alles halb so wild. Man weiss nicht genau, was da drüben geschieht. Noch 1942 beginnen die Na-zis mit der industriellen Vernichtung von Juden. Alle sechs Ausgeschafften sterben in Konzentrati-onslagern, in Stral agern oder bereits auf der Rei-se. Die Schweizer Soldaten stopfen die Kinder an der Grenze noch mit Schokolade voll. Das Boot ist bereits voll.
- Markus Imhof (1980): Das Boot ist voll Die Flüchtlingspolitik der Schweiz während dem zweiten Weltkrieg wurde von einer unabhängi-
gen Expertenkommission in einem gut 500-seitigen Bericht dokumentiert www.uek.ch.
- Fernand Melgar (2011): Vol Special Das weitere Ergehen der porträtierten Flüchtlinge wird auf www.volspecial.ch dokumentiert.
2014Im Ausschaffungsgefängnis in Frambois, einem Vorort von Genf bei nden sich gut zwanzig Häft-linge. Die meisten stammen aus Afrika, ein paar wenige aus dem Balkan. Seit einem, seit zwei, ja seit zwanzig Jahren leben die Insassen ohne Pa-piere in der Schweiz. Verbrochen haben die meis-ten nichts, ausser die Schweiz zu betreten. Viele haben einen Arbeitsvertrag und bezahlen AHV, viele haben Frau und Kinder in der Schweiz. In der Heimat droht ihnen Folter, Verfolgung oder gar der Tod wegen Religionszugehörigkeit oder politischer Einstellung. Das ist jedoch nicht im-mer ganz klar. Vielleicht geschieht ihnen auch nichts derartiges. Man kann es nur grob abschät-zen, anhand der generellen Lage des Landes. Was man jedoch nicht abzuschätzen braucht, ist die Gesetzeslage. Auch wenn Ragip seit zwanzig Jah-ren hier Steuern und Sozialbeiträge bezahlt und sein jüngstes Kind hier geboren wurde der Koso-vo gilt wieder als sicher. Gesetz ist Gesetz. Und in der Schweiz wird das Gesetz vom Stimmbürger gemacht. Ragip hat seinen ersten Ausschaffungs-l ug verweigert. Als nächstes wird er mit einem Sonderl ug in die Heimat gebracht. Bei Sonderl ü-gen werden die Auszuschaffenden auf Bahren ge-fesselt und von der Polizei ins Flugzeug getragen. 2010 starb ein Nigerianer kurz nach der Verfrach-tung ins Flugzeug. Trotz der neuen, «humaneren» Ausschaffungsmethode kommt auch nach dieser Tragödie zu Misshandlung durch die Polizei. Die Versorgungslage der Schweiz ist heute deutlich besser als 1942. Aber Schokolade gibt es für die Ausgewiesenen mit Sicherheit nicht. Die Boote vor Europas Küste sind alle überfüllt und auch die Flugzeuge werden langsam voll. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Weder im Ausland noch in der Schweiz.
Nach den Filmen «Das Boot ist voll» und «Vol Spe-cial»
Für die RedaktionConradin Zellweger
INHALT

4
Das Duell Nr. 22
Text: * Simon Jacoby und Peter Werder
Peter Werder
Simon Jacoby
vor dem schwarzen Mann?13:10 Peter Werder: Meinen Sie den
schwarzen Mann des Kindergartenspiels, von dem wir davon rennen mussten?
13:10 SJ: Ja auch. Aber eher den, der scheinbar in Massen zu uns rennt und un-ser Boot angeblich zu sinken droht.
13:11 PW: Vom ersten hatte ich Angst, vom zweiten nicht - um Ihre Frage zu be-antworten.
13:12 SJ: Haben wir wieder mal den seltenen Fall, dass wir gleicher Meinung sind? Wollen Sie auch die Grenzen öffnen, so dass alle kommen können, die wollen?
13:13 PW: Wir sind wohl beide gegen die unschöne SVP Masseneinwanderungs-Initiative. Allerdings will ich nicht einfach die Grenzen öffnen - obwohl ich ja als Li-beraler eigentlich für offene Grenzen sein muss. Sagen wir es so: Ich will die Grenzen so offen wie möglich haben, aber so ge-schlossen wie nötig, damit unser liberales System funktioniert.
Sie werden die Grenzen wohl auf-machen - weil in Ihrer Helfersyndromwelt alle verfolgt sind.
13:17 SJ: Nein, darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, dass wir un-seren Wohlstand auf dem Buckel der an-deren erwirtschaften - wo Gewinn ist, ist auch Verlust. Zudem können wir Schwei-zer in jedes Land der Welt reisen und dort leben. Völlig nach unserem Bedürfnis. So ist es doch nur logisch, dass wir diese Pri-vilegien - Wohlstand und Mobilität - auch allen anderen ermöglichen.
13:18 PW: Woher kommt diese dümmlich abgegriffene Kommunisten-floskel eigentlich - „Wo Gewinn ist, ist auch Verlust“?
Tschuldigung. Dümmlich und Kom-munismus - das ist ein Pleonasmus.
13:20 SJ: Irgendwoher muss das Geld ja kommen, das wir hier haben. Aber wir schweifen ab...
13:21 PW: Nein. Wir schweifen nicht ab. Das ist nämlich genau der Punkt: Sie bedienen ein Weltbild, in dem das schlech-te Gewissen dominiert. Nur weil wir Ge-winn machen, heisst das nicht, dass je-mand Verlust macht. Das kann sein, muss aber nicht sein. Man kann Wert schaffen.Schon gar nicht müssen wir deswegen die Grenzen einfach öffnen.
13:21 SJ: Auf jeden Fall geht es je-nen schlecht, die unsere Sneakers nähen. Aber wir sind uns zu schade, diese in die
Schweiz zu lassen.13:22 PW: Das ist hohle Sozialroman-
tik. Sie müssen die Sneakers ja nicht kau-fen, zumal sicher irgendwelche Sneakers auch in der Schweiz hergestellt werden (ich glaube allerdings: Nicht von Ihnen). Es ist ein Dilemma, das Sie ansprechen: Kau-fen Sie Kleider aus Bangladesh, unterstüt-zen Sie vielleicht die Ausbeutung der Ar-beiterinnen und Arbeiter - kaufen Sie die Kleider nicht, entziehen Sie diesen Leuten die ökonomische Grundlage. Das hat aber nichts mit der Zuwanderung zu tun.
13:24 SJ: Im Endeffekt schon. Weil wir wollen, dass sie an unserem Wohl-stand arbeiten. Wenn sie dann aber zu uns kommen wollen, machen wir die Grenzen dicht und schreien etwas von einem vollen Boot. Das kann‘s ja nicht sein.
13:26 PW: Doch, so muss es sein. Wenn sie zu uns kommen wollen, müssen sie entweder verfolgt sein und erhalten hier temporär Zuflucht (Asylwesen, huma-nitäre Tradition). Oder sie wollen etwas zur Wirtschaft beitragen. Dann bestreiten sie ihren Lebensunterhalt und beteiligen sich an den Kosten, die unter anderem Sie ver-ursachen, wenn Sie studieren (wobei: Das Geld von der UBS wollen Sie glaub nicht, hm, komisch...).
13:28 SJ: Ou ja, genau das ist der Punkt. Es ist immer an wirtschaftliche Bedingungen geknüpft. Wir aber können verreisen, wann immer wir wollen. Es ist eine unglaubliche Arroganz und eine Dis-kriminierung der Armen, wenn wir sie an der Grenze ablehnen (oder in einen Bun-ker stecken) und die Reichen mit Hand-kuss nehmen.
13:29 PW: Können oder wollen Sie das nicht verstehen? Wenn wir reisen, sind wir Touristen und bedienen die Exportwirt-schaft des bereisten Landes. Wenn wir uns irgendwo niederlassen wollen, stellen die jeweiligen Länder Bedingungen. So müs-sen Sie zum Beispiel eine berufliche Quali-fikation nachweisen, die Sprache sprechen oder einen Job haben.
Wollen Sie denn allen Touristen den Aufenthalt in der Schweiz bezahlen? Wollen Sie die Sozialwerke noch mehr aus-bauen und Anreize schaffen, damit Ihre Sneakers-Näherin aus Bangladesh in die Schweiz kommt? Wer zahlt dann mehr Steuern - die Armen oder die Reichen der Schweiz?
13:31 SJ: Aber muss denn das so sein?
Wäre es nicht eine kulturelle Bereiche-rung, wenn wir alle syrischen Flüchtlinge, die wir beherbergen können, auch aufneh-men würden? Zudem, nicht alle Flücht-linge sind arm. Es sind auch steinreiche darunter. Und auch die, welche ihren Auf-enthalt selber bezahlen könnten, werden eingesperrt.
13:35 PW: Das Boot ist nicht voll. Aber wir müssen regeln, wer es betreten darf. Bei den syrischen Flüchtlingen wäre ich grosszügiger, da sind wir uns einig. Solan-ge sie sich an unsere Gesetze halten und zum Beispiel die Frauenrechte respektie-ren - in diesem Punkt verschliessen Sie ja gerne die Augen...
13:37 SJ: Genau, das Boot ist noch lan-ge nicht voll. Und ja, Gesetze und so. Sie meinen wohl jene Gesetze, die es erlauben,
dass friedliche Flüchtlinge in Bunker vor sich hin siechen müssen und nicht mal arbeiten DÜRFEN! Das sind nicht die Ge-setze, an die ich mich halten würde. An alle: Willkommen in der Schweiz. Unser Geld haben wir euch geklaut. Holt es euch zurück!
Das Duell: Beim Duell stehen sich in jeder Ausgabe Peter Werder und ein Mitglied der Redaktionzum aktuellen Thema der Ausgabegegenüber.
* Dr. Peter Werder ist bürgerlicher Politiker, Dozent an der
Universität Zürich und leitet die Kommunikation eines Konzerns im
Gesundheitswesen.
* Simon Jacoby, 24, Co–Chefredaktor bei dieperspektive, gönnt
sich eine gute Zeit, bevor er bei Watson beginnt. Irgendetwas
muss man ja machen.
Sie werden die Grenzen wohl aufmachen - weil in Ihrer
Helfersyndromwelt alle verfolgt sind.
An alle: Willkommen
in der Schweiz. Unser Geld haben wir
euch geklaut. Holt es euch
zurück!
HINTERGRUND Das Duell
13:09 Simon Jacoby: Lieber Herr Werder, haben Sie Angst
ANZEIGE

6
079 372 36 02
LÖSE DEINABO VIA SMS:
Text: « HOPP, Vorname, Name, Adresse, Mail »
Für jene, die kein Handy haben:www.dieperspektive.chHINTERGRUND Politkolumne
Die unkontrollierte, starke EU-Zu-wanderung beschäftigt die Bürger seit vielen Jahren. In den letzten
50 Jahren hat sich die Bevölkerung von 4 auf 8 Millionen verdoppelt und der Perso-nenverkehr in derselben Zeit vervierfacht. Die Wohnbevölkerung hat 2012 um über 84‘000 Personen zugenommen. Die Bevöl-kerungsdichte ist mit 195 Einwohnern je km2 bereits sehr hoch. Und Sekunde für Sekunde geht ein weiterer Quadratmeter Kulturland verloren.
Wie viele Bürger erträgt die kleine Schweiz? 9, 10, 12 Millionen? Oder sind die aktuellen 8 schon zu viel? Ist die aktu-elle starke Zuwanderung, welche fünfmal stärker ist als jene in die EU, wirklich ein Qualitätsmerkmal? Einen persönlichen Nutzen bringt sie dem Schweizer Bürger schlicht nicht. Das jährliche Netto-Bevöl-kerungswachstum entspricht jenem eines Kantons Schaffhausen oder einer Stadt Lu-zern – Jahr für Jahr.
Diese Fakten sollten gerade auch den ökologisch orientierten Parteien zu denken geben. Ist es doch gerade die Lin-ke, welche keine Zersiedelung und Verbe-tonierung, weniger CO
2 und weniger Ener-
gieverbrauch sowie den Atom-Ausstieg will. Und vor allem weniger Druck auf Job, Lohn und Mieten.
Als wir die Personenfreizügigkeit (PFZ) 2002 einführten, hatte uns der Bun-desrat «nur 8000 Topqualifizierte» ver-sprochen – er verschätzte sich um den Fak-tor 10. Die Zahl der Erwerbslosen hat sich seit der PFZ-Einführung von 119‘000 auf 218‘000 verdoppelt. Immer wieder wird behauptet, es kämen nur hochqualifizier-te Einwanderer. Doch weshalb ist dann je-der zweite Arbeitslose ein Ausländer?
Im Jahr 2012 holten wir 3287 Bau-leute in die Schweiz, doch wir haben bereits 12‘520 Arbeitslose aus diesem Gewerbe. Gleichzeitig wurden 5268 kauf-männische Angestellte im Ausland rekru-tiert, während hier schon 12‘371 Kaufleu-te beim RAV angemeldet waren. Anstatt in der EU zu suchen – übrigens bloss deshalb,
weil das Lohnniveau dort tiefer ist! – müs-sen wir doch wieder zuerst den eigenen Ar-beitsmarkt berücksichtigen. Und falls eine Firma einmal wirklich keinen Ingenieur in der Schweiz findet, so darf sie diesen auch mit der «Einwanderungs»-Initiative weiter-hin im Ausland suchen – sogar weltweit.
Die Schweiz war vor der PFZ kein Drittweltland. Damals mussten die Saiso-niers nach neun Monaten oder bei Arbeits-losigkeit das Land wieder verlassen. Ich habe grosse Bedenken, dass bei einer kon-junkturellen Flaute die ausländischen Ar-beitnehmer das Land eben nicht verlassen und dadurch unsere Sozialwerke in Gefahr bringen. Insbesondere, wenn man ganz nüchtern die wirtschaftliche Entwicklung der EU mit ihrer sehr hohen Arbeitslosig-keit und ihrem viel tieferen Lohnniveau betrachtet: Auch in den kommenden Jah-ren ist eine starke Migration in Richtung Schweiz zu erwarten.
Ein souveräner Staat mus s daher eine so zentrale Frage wie die Einwande-rung selbst kontrollieren.
* Thomas Minder Ständerat Schaffhausen, parteilos, Unterneh-
mer, Trybol AG
Zuwanderung wieder selbst kontrollieren
Und Sekunde
für Sekunde
geht ein wei-
terer Quadrat-
meter Kultur-
land verloren.
Text: * Thomas Minder
ABGELEHNT!Zuwanderung wieder selbst kontr
ABGELEHNT!Zuwanderung wieder selbst kontr
Das Boot ist v
ollText: *
Das Boot ist v
ollText: *
Zuwanderung wieder selbst kontr

8 9
– So klang der Schlachtruf der Schweizerischen Volkspartei für das Wahljahr 2011 und so steht es seither im Programmheft der Partei. Dabei suggeriert der Slogan dem stimmberechtigten Bürger auf subtile Weise, dass er eine Seite zu wäh-len habe: Gut oder böse, stolzer Schweizer oder Landesverräter, SVP-Wähler oder un-fähiger Rest. Willkommen in der neuen Welt der schwarz-weissen Antworten, der hetzerischen Plakate und der xenopho-ben Volksinitiativen. Willkommen in der Welt des Rechtspopulismus. Und die SVP ist mit dieser Art der Politikführung in guter Gesellschaft: In ganz Europa feiern die Rechtspopulisten massive Wahlerfolge.
In Ungarn wurde 2010 Viktor Orban zum Ministerpräsidenten gewählt und än-dert seither zusammen mit seiner Partei der rechtskonservativen Fidesz quasi nach Lust und Laune das Grundgesetz und kratzt an den demokratischen Grundwerten – zu-dem politisiert die Partei in einer unge-sunden Nähe zur rechtsextremen Jobbik – welche 2010 ebenfalls mit 16 Prozent der Stimmen in das Parlament einzog. In Schweden haben die rechtspopulistischen Sverigedemokraterna (Schweden-Demo-kraten) bei den Parlamentswahlen 2010 ebenfalls 5,7% erreicht und ihr finnisches Pendant Perussuomalaiset («Die Basis-finnen» oder «Die Wahren Finnen»; seit 2012 «Die Finnen») erreichten 2011 sogar 19,1%. In den Niederlanden erreichten Geert Wilders und seine «Partei der Frei-heit» zwar 2010 15,5% der Stimmen, in der vorgezogenen Parlamentswahl von 2012 mussten sie aber mit lediglich 10,1% der Stimmen starke Verluste hinnehmen, sie bleiben jedoch die drittstärkste Partei im Lande. In Österreich erreichte die FPÖ 20013 20.51% der Stimmen, nicht zuletzt wegen des charismatischen Aushänge-schild und Parteipräsidenten (oder auf österreichisch «Bundesparteiobmann») H.-C. Strache, welcher geschickt in die übergrossen Fussstapfen des verstorbenen Jörg Haider getreten ist und seinen Kurs des Politisierens gegen die zunehmende «Islamisierung» und «Überfremdung» fortführt. In Frankreich bröckelt die «Re-publikanische Front» langsam, welche bis anhin verhindern wollte, dass Rechtsex-treme Einsitz im Parlament nehmen, da-mit ist insbesondere der «Front National» gemeint, welcher 1972 von Jean-Marie Le Pen gegründet wurde und seit 2011 von seiner Tochter Marine Le Pen geführt wird, welche bei der Präsidentschaftswahl 2012
zwar die Stichwahl verpasste, aber mit 19,7 % dennoch ein beachtliches Ergebnis er-zielte. Aber wieso haben die europäischen Rechtspopulisten in den letzten Jahren ei-nen solchen Aufwind erfahren? Und wie lässt sich dieser Rechtspopulismus eigent-lich genauer definieren und wie grenzt man ihn von Begriffen wie dem Rechtsex-tremismus ab? Beginnen wir mit der De-finition.
Gegen alles und jedenPopulismus gibt es sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Seite. Während vor allem in Südamerika linkspopulistisch politisiert wird (unter anderen ehemals Hugo Chavez oder Fernando Lugo in Para-guay und neu Nicolas Maduro in Venezue-la) anhand von Themen wie dem Antika-pitalismus und dem Ausbau der sozialen Gerechtigkeit, ist der Rechtspopulismus eher ein Phänomen, das im Europa der späten siebziger Jahre langsam heran-wuchs. Die Gemeinsamkeiten des Populis-mus auf der linken und rechten Seite be-ziehen sich auf die Art und die Weise, wie sie mit ihrer Wählerschaft in Kontakt tre-ten. Im Vordergrund steht hauptsächlich die Maximierung des Wahlerfolges, wes-halb die inhaltliche Ausrichtung der Par-tei sich stets an der Meinung der Mehrheit orientiert und entsprechend positioniert. Der österreichische Politologe Hans-Georg Betz nennt den Populismus daher treffend «eine Strategie des politischen Marketings und eine konsequente Orientierung am Kunden, deren Erfolg immer auch von der aktuellen Problemlage abhängt.». Es werden emotionale Kampagnen geführt, man bietet stark simplifizierte Lösungen an und des Öfteren steht in der Partei eine charismatische Leitfigur an der Spitze (auf der linken Seite zum Beispiel der ver-storbene Hugo Chavez oder auf der rech-ten Seite ehemals Jean Marie Le Pen beim Front National, Christoph Blocher bei der SVP oder der verstorbene Jörg Haider bei der BZÖ und nun der bereits erwähnte H.-C. Strache bei der FPÖ). In diesem Falle sprechen wir vom Populismus als Strate-gie. Es gibt aber auch einige Politikwissen-schaftler, welche den Populismus als Ideo-logie begreifen.
Der Populismus als Ideologie baut
vor allem auf dem Dualismus zwischen dem «einfachen Volk» und der «Elite», «dem Establishment» oder einfach «denen dort oben». Die Populisten beanspruchen dabei für sich die Rolle als «Stimme des Volkes», während die anderen Parteien nur Handlanger der Eliten sind und kei-
nen Kontakt mehr zum Volk und seinen Anliegen haben. Die deutschen Politolo-gen Frölich-Steffen und Rensmann nen-nen diese dualistische Mentalität – also die Trennung von Volk und Elite – die ver-tikale Ebene. Zu dieser Ebene kommt nun bei rechtspopulistischen Parteien die hori-zontale Ebene hinzu, welche ethnonatio-nalistische und xenophobe Züge hat und sich gegen aussen richtet. Der Rechtspo-pulismus verbindet so die anti-elitäre mit einer exklusionistischen Ebene, auf wel-cher das «einfache Volk» nicht nur der Elite, sondern auch den «Eindringlingen von aussen» gegenüber steht. Dieser Um-stand tritt in Europa vor allem durch die stärker werdende Islamophobie und den offen zur Schau gestellten Rassismus zu Tage. So kann man beispielsweise in SVP-Broschüren nachlesen, die Partei sei «für die Begrenzung der Zuwanderung, damit unsere Schweiz lebenswert bleibt und wir uns nicht fremd im eigenen Land fühlen müssen.». Die BZÖ geht einen Schritt wei-ter und behauptet in ihrer Wahlbroschüre von 2012, es sei ein Faktum, «dass auch die Gefahr des Islamismus in unserer Heimat nicht mehr wegzureden ist».
Der niederländische Politologe Cas Mudde sieht in dieser Verbindung des Populismus mit rechtem Gedankengut eine natürliche Entwicklung, da der Po-pulismus eine «thin-centered ideology» sei, eine Ideologie, welche alleine nicht genügend Inhalte biete, um einen Gros-steil der Wählerschaft zu überzeugen. Der Populismus ist hierbei eher ein Behälter, ein Rahmen, den es mit Inhalten zu fül-len gilt. Der Rechtspopulismus bearbeitet vor allem die horizontale, nationalistische Ebene, weshalb oftmals versucht wird, Po-litik auf dem Buckel der Immigranten zu machen. Dabei werden auch eigentlich mi-grationsfremde Themen mit dem «Auslän-derproblem» verknüpft. Dieser Umstand nimmt zuweilen bizarre Züge an, wenn zum Beispiel der Präsident der SVP Toni Brunner in einem Interview in der Zei-tung «Der Sonntag» behauptet, ohne die Einwanderung der letzten Jahre und dem Energiebedarf dieser Immigranten könnte die Schweiz ein Atomkraftwerk abschalten (Der Sonntag vom 02.04.2011).
Es lässt sich leicht erkennen, dass der Rechtspopulismus derselben politi-schen Familie entspringt wie der Rechts-extremismus, dennoch gibt es zwei grosse Unterschiede: Erstens – und das scheint der wichtigste Unterschied – lehnen die Rechtspopulisten im Gegensatz zu den
Der Rechtspopulismus:
Die Geissel Europas
Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des
Rechtspopulismus. In Ungarn ist er bereits an der Macht und
in den Niederlanden, Belgien oder Finnland feiert er
erhebliche Achtungserfolge. Zeit, dieser politischen Ausrichtung
mehr Beachtung zu schenken.
Text: * Marco Büsch
THEMA Der Rechtspopulismus: Die Geissel Europas THEMA Der Rechtspopulismus: Die Geissel Europas
« Schweizer wählen SVP! »
Der Populismus als Ideologie
baut vor allem auf dem
Dualismus zwischen dem
«einfachen Volk» und der «Elite», «dem
Establishment».

10 11
so selbst Teil der Elite und müssen Kom-promisse eingehen, um weiter regieren zu können. So geschehen beispielsweise in Österreich, wo die rechtspopulistische FPÖ unter Jörg Haider im Jahre 2000 in die Regierung eintrat. Ein Aufschrei ging durch Europa ob der nun rechtsextre-mistischen Färbung der österreichischen Regierung und 14 EU-Staaten stellten als Massnahme ihre bilateralen Beziehungen mit Österreich ein. Erst nach dem Verfas-sen des so genannten «Weisenberichts», welcher die Vorwürfe entschärfte, Öster-reich aber weiter unter Beobachtung stell-te, wurden die Massnahmen aufgehoben. In diesem aufgeheizten Klima konnte die FPÖ ihren rechtspopulistischen Stil nicht mehr gleich weiterverfolgen wie zuvor. Jörg Haider spaltete sich mit seiner neu gegründeten Partei BZÖ ab und die FPÖ mässigte ihre Ausrichtung entsprechend. Ein Kritikpunkt an dieser Protest-These ist allerdings, dass sie die Ideologie und Programmatik der Parteien vernachlässigt beziehungsweise gesteht sie dem Protest-wähler keine eigene Meinung zu; der Pro-testwähler ist einfach mal grundsätzlich gegen die «Elite», egal welche inhaltliche Ausrichtung diese hat. Dies klingt doch sehr vereinfacht und daher stimmt die Protest-These – wenn überhaupt – nur ansatzweise in Verbindung mit anderen Thesen.
Eine weitere These ist die Moder-nisierungsthese, welche die verstärkte Individualisierung des Menschen durch die Modernisierung und Globalisierung in den Mittelpunkt stellt und den damit einhergehenden Zusammenbruch der sozialen Integration, der so genannten «Atomisierung der Gesellschaft». Den sup-portiven Ansatz, den früher beispielswei-se die Kirche ausfüllte, übernehmen nun rechtspopulistische Parteien. Sie dienen als Orientierungshilfe, indem sie einfache Verhaltensnormen anbieten. Sie sind An-laufstellen und fungieren als Stütze in ei-ner Welt, welche die Menschen vereinsamt und verwirrt zurücklässt. Ein Kritikpunkt an dieser These ist ganz klar, dass sie die positiven Aspekte der Modernisierung aussen vor lässt und sich nur auf die ne-gativen Aspekte fokussiert. Zudem geht jedes Individuum mit einer Krise verschie-den um, weshalb so eine Pauschalisierung kaum möglich ist. Im Weiteren gibt es zu dieser These kaum empirische Daten und keinen Beweis, dass «Modernisierungsver-lierer» grundsätzlich rechtspopulistisch wählen. Dennoch ist es ein interessanter Ansatz, weil rechtspopulistische Parteien
im Gegensatz zu anderen Parteien tatsäch-lich mehr auf Gemeindeebene arbeiten, mehr Feste und Anlässe organisieren und so dem geneigten Wähler das Gefühl ge-ben, nicht nur eine Partei zu sein, sondern eine Familie, in der man verstanden wird.
Ein weiterer Erklärungsansatz wäre die Realkonflikt-These, welche einen Zu-sammenhang zwischen Immigration und Wahlergebnissen von rechtspopulis-tischen Parteien postuliert. Leider wurde diese Korrelation bis jetzt in keiner Weise empirisch belegt, vielmehr gibt es starke Hinweise in der Richtung, dass ein häu-figer Kontakt mit Immigranten zu vermin-derter Xenophobie führt.
...zu Institutionen und FormelnAuf der Angebotsseite – der Seite der Par-teien oder des Systems – existieren auch verschiedenste Ansätze. Der «Political Op-portunity Structures»-Ansatz macht die Stärke einer rechtspopulistischen Partei oder ihre Möglichkeit zu wachsen davon abhängig, ob das politische System offen oder geschlossen ist, beziehungsweise, ob die bestehenden Parteien zu mächtig sind, als dass sich ein neuer Politplayer etablieren könnte. Im Weiteren ist für das Wahlsystem entscheidend, ob es ein Ma-jorz- oder ein Proporzsystem ist. In einem Proporzsystem haben kleinere Parteien durchaus Möglichkeiten ins Parlament gewählt zu werden, während es in Majorz-systemen schier unmöglich ist. Weitere wichtige Punkte sind die institutionellen Interventionsmittel (wie zum Beispiel die 5%-Sperrklausel in Deutschland, welche einen Einzug in den Bundestag erst bei 5 Prozent Wähleranteil erlaubt) oder ob das System föderalistisch aufgebaut ist. Auf Gemeindeebene lassen sich rechtspopulis-tische Parteien viel leichter etablieren als bei zentralistisch gesteuerten Staaten. Zu guter Letzt spielt es einer populistischen Partei sehr stark in die Hände, wenn in einem politischen System die direkte De-mokratie etabliert ist, weil man mit die-sem Mittel nicht auf die Teilnahme in Parlament und Regierung angewiesen ist, sondern auch so durch starke Mobilisie-rungen der Massen politische Erfolge fei-ern kann. Wenn man all diese Punkte zu-sammen nimmt, erkennt man, dass in der Schweiz ein System vorherrscht, welches für den Rechtspopulismus wie geschaf-fen ist. Es scheint demnach keine Überra-schung zu sein, dass die SVP in der Schweiz solche Erfolge feiern kann. Es bekommt ihr nicht einmal schlecht, wenn sie im Bundesrat vertreten ist, denn solange auch andere Parteien vertreten sind, kann man
die Schuld für politisches Fehlverhalten des Bundesrats stets auch auf die anderen abwälzen. So bleibt der Dualismus zwi-schen Volk und Elite trotz Sitzen in Parla-ment und Bundesrat bestehen.
Ein weiterer Erklärungsansatz auf der Angebotsseite liegt in der Programma-tik der einzelnen Parteien. Es gilt flexibel und opportunistisch zu sein. Gemäss der «winning formula» von Herbert Kitschelt ist es zudem von Vorteil, ethnozentris-tische und neoliberale Versatzstücke zu verbinden, um die Maximierung der Wäh-lerstimmen zu gewährleisten. Das klingt sehr «Reissbrett»-artig, aber viele rechtspo-pulistische Parteien in Europa bewegen sich inhaltlich in diese Richtung und ihre Erfolge sprechen für sich.
Gegen Angst und Hetze
Der Siegeszug des europäischen Rechtspo-pulismus lässt sich nicht nur an einem Faktor festmachen. Vielmehr sind es di-verse Gründe, die ein Aufsteigen dieser Ide-ologie begünstigen. Sei es das Schwächeln der Europäischen Union, welche in den Europäern die Sehnsucht nach früheren, vermeintlich besseren Tagen aufkommen lässt, sei es vielleicht wirklich die starke Einwanderung in Westeuropa, welche in den Menschen die Angst um ihren Arbeits-platz und somit um ihre Zukunft weckt. Oder aber die fortschreitende «Atomisie-rung der Gesellschaft», die Vereinsamung des Individuums, das nach Halt sucht und diesen in einer rechtspopulistischen Partei zu finden glaubt. Es scheint mannigfaltige Gründe für diesen Siegeszug zu geben und in jedem Land vollzieht er sich auf eigene Weise. Wichtig scheint nur, dass uns be-wusst ist und bleibt, dass diese Parteien Gift für Toleranz und Freiheit unter den Menschen sind und wir gut daran tun, ihre Politik nicht nur zu belächeln, son-dern uns aktiv dagegen zu wehren. Ande-renfalls hätten sie tatsächlich erreicht, was sie anstreben.
* Marco Büsch, 23, Politolgiestudent aus Zürich, Filmfan und
Hobbyrapper. marcobuesch.wordpress.com
Rechtsextremisten das politische System der Demokratie nicht ab, sondern be-nutzen es für ihre Zwecke, während die Rechtsextremisten versuchen ausserhalb des Systems zu agieren und dieses ersetzen wollen. Der zweite Unterschied betrifft die ideologische Radikalität, welche bei den Populisten nicht so stark ausgeprägt ist wie bei den Extremisten. Während die Populisten ihre Ideologie stetig der Mehr-heit im Volk anpassen, um möglichst viele Stimmen zu generieren, gehen die Extre-misten grundsätzlich keine Kompromisse ein. Der Unterschied der beiden Ideolo-gien liegt demzufolge hauptsächlich in der Wahl der Mittel. Dennoch wäre es fa-tal, den Einfluss der Rechtspopulisten auf die Extremisten klein zu reden, denn gera-de die Rechtspopulisten tragen zu einem starken Teil die Verantwortung für das rechte Klima, welches seit einigen Jahren in Europa herrscht und rechtsextremi-stische Taten von Menschen wie Anders Breivik in Norwegen oder der Zwickauer Terrorzelle in Deutschland begünstigen.
Der Begriff des Rechtspopulismus wurde nun grob definiert als eine Ideolo-gie, welche den Dualismus zwischen Volk und Elite (vertikale Ebene) und In- und Ausländer (horizontale Ebene) zum Inhalt hat und diese strategisch mit charisma-tischen Anführern, Opportunismus und anderen wirkungsvollen Mitteln umzuset-zen versucht, um möglichst viele Wähler-stimmen zu generieren. Es bleibt die Frage offen, warum der Rechtspopulismus vor allem in Europa solche Erfolge feiert.
Von Protest und Vereinsamung...Zur dieser Frage wurden einige Hypothe-sen aufgestellt. Dabei gilt es, den Rechtspo-pulismus von zwei Seiten zu betrachten: Der Nachfrage-Seite der Wähler einerseits und der Angebots-Seite der Parteien ande-rerseits. Auf der Nachfrage-Seite geht un-ter anderem die Protest-These davon aus, dass der Wähler aus Misstrauen und Pro-test gegenüber der – seiner Meinung nach – schlechten Politik von Parlament und Regierung die Rechtspopulisten wählt. Diese geben sich selbst als die einzige Alternative zur «Elite» und nehmen die Rolle als Sprachrohr des Volkes ein. Das wählertechnische Problem bei dieser anti-elitären Strategie ist, dass sie einen Gros-steil ihrer inhaltlichen Glaubwürdigkeit verliert, sobald sich bei der populistischen Partei selbst grössere Wahlerfolge einstel-len und sie einen Teil des Parlaments oder der Regierung stellen müssen. Sie werden
THEMA Der Rechtspopulismus: Die Geissel Europas THEMA Der Rechtspopulismus: Die Geissel Europas

12
Falsche Metaphern Alles scheint mit Naturkatastrophen, Wasser und Kämpfen zu tun haben, wenn es in Diskussionen um Migration geht. Dabei ist der Fokus in den allermeisten Diskussionen auf Scheinpro-bleme gerichtet. So schrieb zum Beispiel der Blick am Abend am 19.04.2011: «Tunesier sind nicht die einfachsten»
Ist das Boot voll? Glaubt man dem Präsidenten der kan-tonalen Migrationsbehörden, Heinz Brand (SVP), kann dieser Eindruck entstehen. Wegen der Flüchtlingswelle aus Nordafrika plädiert er dafür, «die Zuwanderung generell zu unterbinden Wirtschaftsflüchtlinge sind nicht die einfachsten Leute, wenn es um die Unterbringung geht», sagt Brand. Sollte der Zustrom von Migranten aus Nordafrika weiter anwachsen, werde der Bund laut Brand mit ernsthaften Platzproblemen zu kämpfen haben. Die Verwendung der Metapher des vollen Bootes macht hier inso-fern Sinn, als sie in der reaktionären, fremdenfeindlichen Schweiz eine Art Tradition hat. Bundesrat Eduard von Steiger verwendete die Aussage «Das Boot ist voll.» als Begründung zur Zurückwei-sung von Juden und Jüdinnen an Schweizer Grenzen im Zweiten Weltkrieg. In diesem Artikel des Blick am Abend wird von Stei-gers Metapher wieder aufgenommen und als Frage präsentiert. «Flüchtlingswelle» und «Zustrom» sind auch beliebte Bilder, die in Medientexten und in politischer Propaganda immer wieder vorkommen. Unzählige linguistische Untersuchungen widmen
sich solchen Metaphern, welche in Texten zur «Flüchtlingsde-batte», insbesondere in Medientexten, häufig verwendet werden. Eine weitere Untersuchung dieser Art braucht es nicht. Denn die Probleme welche in diesem Artikel des Blick am Abend unter an-derem durch die Sprache ersichtlich werden, sind politischer und nicht linguistischer Natur. Damals wie heute sollte die Frage «Ist das Boot voll?» als die falsche Frage und die Aussage «Das Boot ist voll.» als Lüge entlarvt werden. Gefragt sind Lösungen für häss-liche Zustände, welche nichts mit Platzproblemen in der Schweiz zu tun haben.
Die wahren Katastrophen – «Erfolgsmodell Schweiz»Bis zu 25 000 Bootsflüchtlinge sind seit 1990 im Mittelmeer er-trunken. Nur wenn einige hundert Flüchtlinge auf einmal ster-ben, wird darüber berichtet. Das Elend wird nicht ernst genom-men und die Zahl der Leichen selten genannt; beide aber, das Elend und die Anzahl Leichen, steigen stetig an. Verantwortlich sind hier unter anderem „Grenzschutzagenturen“ wie Frontex. Frontex ist ein Projekt der EU, an dem sich aber auch die Schweiz beteiligt.
Wie in den Deutschschweizer Medien das Problem der Un-terbringung von Asylsuchenden behandelt wird, ist zynisch. Das aufgrund einer anderen Nationalität, der Armut oder das Nicht-Besitzen von Papieren erfolgende Einsperren aberhunderter Menschen, ist eine wahre Katastrophe. Der Umstand, dass reiche Ausländer pauschal besteuert werden und eine Villa mit Seeblick
erhalten, während mittellose Flüchtlinge in Asylzentren und In-ternierungslager gesteckt, ihrer Freiheit beraubt und manchmal gewaltsam in ihr Herkunftsland geschafft werden, ist von einer Unmenschlichkeit, die eigentlich nach Widerstand schreit. Der Fokus sollte auf dem Bau von Lagern und nicht auf der Einwande-rung Ausgebeuteter liegen.
Während in der Schweiz aber Debatten darüber geführt werden, ob neue Internierungslager eher in urbaneren Gegenden oder wohl doch in den Bergen gebaut werden sollten, platzen in anderen Kontinenten Schweizer Granaten und versklaven Schwei-zer Konzerne ganze Bevölkerungsteile. Es werden Kriege von rei-chen, westlichen Nationen geführt, oft im Namen der Freiheit und des Friedens. Die Kriege werden von denselben Nationen ge-führt, welche milliardenschweren Grosskonzernen die ihr Geld mit Drecksgeschäften machen, gerne Asyl bieten. Auf gewissen Erdteilen leben Menschen in barbarischen Verhältnissen. Die Ur-sache dafür liegt nicht in schlechten Wetterverhältnissen oder unfruchtbarem Boden. Im Gegenteil: Oft sind die Länder, welche die meisten natürlichen Ressourcen haben, auch die ärmsten. Die reichsten Länder, welche oft viel weniger oder gar keine natürli-che Ressourcen haben, holen sich Rohstoffe und Profit mit Gewalt – zum Beispiel mit Mienen in Südamerika und Afrika oder durch Militärinterventionen im nahen Osten.
Natürlich gibt es Kriege und politische Verfolgung, mit de-nen der «reiche Westen» nur indirekt zu tun hat. Aber auch wenn gewisse Diktatoren nicht offiziell für die Interessen des globali-sierten Finanzkapitals und der wirtschaftlich stärksten Länder handeln, so werden ebendiese Diktatoren häufig so lange unter-stützt, bis eine Revolution bevorsteht und ein Volk, wie zum Bei-spiel das lybische, rebelliert. Dann werden Meinungen geändert, Seiten gewechselt, Kriege geführt, neue Allianzen geschlossen
und die Rohstoff-Versorgung neu gesichert. Die dreckigen Milliar-den der Diktatoren hat man nebenbei jahrzehntelang auch gerne versteckt. So viel zur Floskel «Erfolgsmodell Schweiz».
Menschen, die aufgrund solcher zerstörerischen Mechanis-men wie hier genannt, flüchten müssen, werden meist als Last und nicht als Opfer westlicher Politik, betrachtet. Eine grosse Schuld an den schlechten Lebensbedingungen und der Migration hat aber das Streben nach Profit. Das Streben nach Profit ist das oberste Gesetz der kapitalistischen Produktionsweise, in welcher wir leider leben und in welcher die wenigen Mächtigen, die vielen Abhängigen unterdrücken.
Die wahre GrenzeStatt auf die wahren Verbrecher zu zeigen, werden Flüchtlinge hierzulande in «echte Flüchtlinge» und «Wirtschaftsflüchtlinge» gespalten und sie werden als Sündenbock für verschiedenste Pro-bleme missbraucht. Parteien wie die SVP versuchen den Schweizer Arbeitenden zu vermitteln, dass ihr Problem in der bestehenden sozialen Hierarchie noch tiefer unten liegt, als sie selber stehen. Statt uns mit Ausbeutung und Klassengegensätzen zu beschäf-tigen, haben wir Debatten über Nordafrikaner und andere Aus-länder, die angeblich den Wohlstand der Schweiz bedrohen. Ei-gentlich sollte über den Rassismus gesprochen werden, der unter anderem von Multimillionären geschürt wird. Denn heute wird nach unten gespalten, statt vereint nach oben getreten.
Und hierin liegt ein weiteres Problem: Viele un-menschliche Taten, werden in einem gesetzlichen Rah-men verübt, mitgetragen von allen regierenden Parteien. Dass gewisse Dinge «illegal» (zum Beispiel keine Papiere zu haben), andere aber «legal» sind (zum Beispiel Men-schen aufgrund ihrer Nationalität und ihrem sozialen Sta-tus einzusperren), zeigt, dass die vorliegenden Probleme und Widersprüche grundsätzlichen Charakter haben und nicht kleine, unerwünschte Nebeneffekte sind. Unrecht ist zu Recht geworden und somit Widerstand zur Pflicht.
Diejenigen Kreise aber, welche die wahren Katastrophen bei der Wurzel packen wollen, haben es heute schwierig. Klar, wenn die Justizministerin, die dieses unmenschliche Asylwesen verwaltet, eine Sozialdemokratin ist, steht es schlecht um die Schweizer Lin-ke.
Die Probleme sind nicht jene, welche in den Mainstream-Medien besprochen werden und die Antworten sind tief greifende Veränderungen, nicht neue Sozialhilferegelungen für Asylsuchen-de oder kleine Reformen. Wollen wir Solidarität statt Unterdrü-ckung, müssen wir endlich die wahre Grenze sehen: Nicht jene zwischen den Nationen, sondern jene zwischen denjenigen die haben und jenen, die nicht haben. Diese Grenze zieht sich über-all dort hindurch, wo der Kapitalismus herrscht, überall dort, wo nach Profit gestrebt wird.
Zu sagen bleibt: Volle Boote gibt es, es sind jene der Flücht-linge. Eine Katastrophe gibt es auch, es ist die Ausbeutung von Mensch und Natur. Und schliesslich ist nicht jeder Kampf ein schlechter: zum Beispiel jener gegen den Rassismus und den Ka-pitalismus.
Gefragt sind Lösungen für hässliche Zustände, welche nichts
mit Platzproblemen in der Schweiz zu tun haben.
Kapitalisten
sind nicht
die einfachsten
Text: Alessandro Tiberini
THEMA Kapitalisten sind nicht die einfachsten THEMA Kapitalisten sind nicht die einfachsten 13
Volle Boote, Katastrophen und Kämpfe – worüber diskutiert und wogegen ge-kämpft werden sollte.

Illu
str
ati
on
: C
lau
dia
Nü
nli
st
14 15THEMA Illustration THEMA Den Kurs ändern
Kleine Welle schlagen in gleichmässigen Abständen gegen den massigen Körper des gespenstischen Kahns. Im glei-chen Rhythmus stechen die langen Ruder aus dem dunkeln
Bauch des Schiffs, eines nach dem anderen, ins nahezu stille Meer, die Wellenbewegung gesamthaft wiederholend zum dumpfen Takt der Trommeln.
Wenn kein Wind weht, müssen die Bootsleute rudern und in der monotonen kraftvollen Bewegung wünscht sich ein jeder von ihnen ein bisschen Rückenwind. Kein Sturm; nur eine kleine Brise würde vielleicht genügen den Kapitän umzustimmen, die Segel zu hissen angesichts des aufkommenden Helfers. Erste Vor-zeichen sprechen sein Kommen und der Ausguck spürt bereits die sanfte Bewegung in der Luft um ihn herum. Ein weiterer Stoss, eine kurze Böe und schon ruft er dem Maat auf Deck entgegen dem Kapitän die Neuigkeit zu melden. Doch der Kapitän schläft
Ein
trunken in seiner Selbstgefälligkeit. Die Moral ist müde vom vie-len Feiern und das Gewissen ruht sich aus.
Ein Deckoffizier übernimmt pragmatisch das Ruder der Situation und gibt den Befehl die Segel vorzubereiten, damit der aufkommende Wind auf Widerhall stossen kann und das Boot zu-letzt doch endlich vorwärts treibt. Die Matrosen sind bereits er-schöpft vom vielen Rudern und Unmut in den Mannschaftskajü-ten tut selten gut. Das Schiff soll ja nicht vom Kurs abkommen. Die letzten Jahre waren hart, Stürme und Krisen haben die Besatzung mitgenommen. Meuterei, das wäre das Letze was sich die höheren Kader wünschen würden. Land, endlich wieder Boden unter den Füssen zu spüren. Die Wünsche sind fern, Utopien ausgeträumt, es bleibt nur ihr Scheitern und die geistlose Leere gedankenfauler Zeiten. Wer soll der Matrosen Sold zuletzt bezahlen?
Ein Wind zieht auf, wahllos von allen Himmelrichtungen bläst er seine Söhne und Töchter voran. Und die Europa beugt sich dem Drängen und ahnt nicht den aufkommenden Sturm. Man hört den Ausguck nicht mehr rufen, so laut und kalt geht die Bise um die Schiffsmasten herum. Ein neuer Pestwind strafft die Segel und säuselt Parolen von Fleisch und Nation. Den Ausguck über Bord geworfen, haben damals seine Söhne als die Töchter ihr be-törend Lied vom fernen Land in Sicht gesungen haben.
Es weht kein wirklich neuer Wind. Doch vielerorts wird auf Gedankenfriedhöfen gerne Leichenschänderei betrieben, und so manche Zunge denkt zuweilen nekrophil. Das Tote lebt weiter in den Köpfen und seine Früchte schmecken welk wie eh und je.
„Das Boot ist voll!“, rufen sie und nur der Ausguck be-merkt, dass der Steuermann über Bord gegangen ist. Doch seine Stimme geht im Sachzwanggelaber unter, wo sich hässliche Ideen hinter Worthülsen verstecken. Wir sind vom Kurs abgekommen. Denn es gibt keine Solidarität, wenn man sie nicht lebt. Und die Antwort auf die Frage ist nicht so einfach, als dass man sie schnell schlucken könnte. Die Gründe sind perfid und stacheln in der Vergangenheit und Gegenwart. Warum sind die einen arm und andere reich? Wie könnten so viele Feuer ohne Funken brennen? Und selbst die grösste Feuersbrunst erlischt wenn man ihr keine Nahrung gibt...
Dies ist eine Warnung. Gewisse Winde nisten im Kleinen und bereiten ihre Stürme im Stillen vor. Solche Winde brauchen viele Helfershelfer und haben doch ihr Plätzchen in all unseren Köpfen. Achtet darauf was ihr denkt!
Blindes Vertrauen wird zu bohrender Skepsis, die sich bis in die Tiefen der salzigen Planken frisst. Mündig wird man nicht mit 18, sondern wenn man selber denkt, eigene Winde tanzen und die Gedanken in nie erahnten Bahnen schweifen lässt. Das Meer ist weit und der Horizont grenzenlos – wir sollten aufpassen wohin wir uns treiben lassen.
* Beat Ospelt, 21, zufriedener Student
ohneSteuermann
Boot
Text: * Beat Ospelt
THEMA IllustrIllustration

16
ANZEIGE
Riodjes Vater war anständig und ehrlich. Das heisst, gerade so un-anständig, wie es der Schutz sei-ner Familie erforderte und so un-
ehrlich gegenüber seinen Kindern, wie es die Situation in seinem Land erforderte. Zusammen mit seiner Frau hatte er für alle vier Kinder gesorgt. Riodje hatte immer ge-nug zu essen, anständige Kleider und ein Dach über dem Kopf. Im Kopf hat er das Alphabet, die mathematischen Grundope-rationen, und der ganze Rest, der ihm in der Grundschule und im staatlichen Gym-nasium vermittelt wurde. Dazu kommt ju-ristisches Fachwissen, dass er sich im Laufe seines, nicht abgeschlossenen, Studiums an der staatlichen Hochschule in Tunis an-geeignet hat. Ab und zu erhält Riodje Ge-legenheitsaufträge vom Gemüseladen in der Nachbarschaft, mehr nicht. Zuhause, nennt er die Wohnung seiner Eltern, wo er sich mit zwei Geschwistern ein Zimmer teilt. Aber viel zuhause ist er nicht. Erstens sollen seine Eltern wenigstens das Gefühl haben, er hätte was zu tun. Er selbst will das Gefühl, da gäbe es irgendwas für ihn zu tun. Aber hier gibt’s kaum was zu tun. Nicht für Riodje. Nicht für seine Freunde.
Und zweitens geht er seinem Vater sowieso lieber aus dem Weg. Obwohl ihr Verhältnis nicht schlecht ist. Vater liebt Riodje und gibt ihm, was er zum Überle-ben braucht. Rodje achtet seinen Vater und geht im ab und an zur Hand. Ihre Gespräche drehen sich ausschliesslich um Alltägliches. Keines dauert länger als we-nige Minuten. Nicht mehr. Früher gab es noch längere, doch sie liefen immer auf dasselbe hinaus. Vaters Lebensleistung; dass er alle Kinder durchbrachte, jedes gesund und munter, keines musste auch nur einmal unten durch; alles läuft darauf hinaus. Riodje schätzt, was Vater geleistet hat, aber will sich in seinem Leben nicht damit zufrieden geben. Dies würde Vater nicht verstehen, vielleicht sogar kränken, ist sich Riodje sicher. Aber Vaters Stolz ist nicht mehr als Riodjes Alltag. Und Alltäg-liches hat in Träumen nichts zu suchen. Auch nicht in Riodjes Träumen.
Riodje steht am Seitenrand eines Spielfelds einer Trainingsanlage. Nicht di-rekt am Seitenrand, sondern hinter einem Geländer, auf dem er sich abstützt. Hinter ihm die einzige Tribüne der Trainingsan-lage. Die Trainingsanlage wurde errichtet, um europäische Fussballvereine in die nur wenige Fahrtminuten entfernten Hotelan-lagen zu locken. Sie wird rund um die Uhr bewacht. Sicherheitsdienst und Überwa-chungskameras. Biegt der Mannschaftsbus des FC Zürich von der Hauptstrasse in die
Zufahrt, kommt der Mitarbeiter des Si-cherheitsdienstes aus seinem Unterstand und nickt dem Busfahrer zu. Diese rituelle Handlung wiederholt sich bei jedem Bus, denn der Sicherheitsdienst muss von den Gästen wahrgenommen werden. Dasselbe gilt für Überwachungskameras. Die ha-ben weder einen Unterstand noch Beine, sind aber gut sichtbar auf der Tribüne, in den Katakomben, wo sich die Umkleide-kabinen befinden, und bei der Einfahrt angebracht. Die Anlage liegt am Rand des Hotel-Dorfs. Wobei Dorf das falsche Wort ist, denn der Landstrich zeichnet sich da-durch aus, dass es nur privaten und keinen öffentlichen Raum gibt und dass niemand, ausser ein paar mitteleuropäischer Ruhe-ständigen, die vom Winter fliehen, dauer-haft hier leben. Auf der einen Seite wird der Ort vom Meer und auf der anderen von einer Hauptstrasse begrenzt. Auf dem Land dazwischen befinden sich die Hotelkom-plexe. Entlang der Hauptstrasse alle paar Meter eine Nebenstrasse, die zu einem Spa, Resort oder Hotel führt. Jeweils angekün-digt von einem aufwendigen Schild.
Riodje schaut dem FC Zürich beim Training zu, weil es in dieser Mannschaft einen Spieler gibt, aus dem er nicht schlau wird. Gemeint ist Yassine. Yassine, der lan-ge Bärtige. Yassine ist im selben Land wie Riodje geboren, doch im Gegensatz zu Ri-odje hat Yassine den Sprung nach Europa geschafft. Er wurde dorthin vom FC Zürich eingeladen. Einige Freunde Riodjes mach-ten sich auch auf, aber ohne Einladung.
Manche meinen Riodje, seine Freunde und Yassine, machten alle densel-ben Fehler. Sie seien halt im falschen Land geboren. Und nur Yassine konnte diesen Fehler mit seinen fussballerischen Leis-tungen wieder wettmachen. Er hat die Be-wegungsfreiheit durch den Fussball erhal-ten. Anderen wird sie in die Wiege gelegt. Und wieder andere, wie Riodje, erreichen sie wohl nie.
Mit Fussball konnte Riodje eigent-lich nicht besonders viel anfangen. Aber er schätzte schon immer die Schlichtheit, die Einfachheit. Regeln und Sinn des Spiels sind klar definiert. Sieg ist Sinn. Und der wird nur durch Tore zur Tatsache. Jede Spieler will mit seinen Bewegungen nicht mehr als den Zweck erfüllen. Entweder man will ein Tor des Gegners verhindern oder selbst ein Tor machen.
Yassine steht auf dem Platz, teil-nahmslos. Die Arme an der Hüfte abge-stützt. Das Trainingsspiel ist unterbro-chen. Der Co-Trainer spricht mit einem Aussenverteidiger. Der Aussenverteidiger gehört zur Mannschaft mit den neongel-
losigkeit dieses Spiels vor Augen. Fussball macht in der Welt einfach keinen Sinn. Er erfüllt keinen Zweck. Und Yassines Be-wegungen erfüllen ebenso keinen Zweck. Keinen Drang zum Tor. Er spielt weder besonders effektiv noch will er jemanden vorführen. Er spielt ganz einfach so, wie er es schon immer tat. Es ist Intuition, Gefühl. Im richtigen Moment stoppt Yassi-ne den Körper und den Ball, des nächsten Gegners Beine gleiten ins Leere. Yassine, längst schon wieder in vollem Lauf zieht mit dem Ball am Fuss weiter. Riodje denkt an seinen Vater, den wohl grössten Fan von Etoile Sportive du Sahel und Yassine Chik-haoui. Endlich glaubt Riodje die Liebe sei-nes Vaters zum Fussball zu verstehen. Des Vaters Leben ist aufgeräumt und von Sinn erfüllt. Alles für die Familie. Und Fussball ist Vaters Oase des Unsinns, Vaters Flucht zur Unvernunft. Hier spielt die Familie für einmal keine Rolle. Nichts unterliegt dem Diktat der Vernunft. Unsinn allez, 90 Mi-nuten. Nun liegt der Ball im aus, Yassine wurde hart aber fair gestoppt. Eine Grät-sche hat ihn von den Beinen geholt, aber
ben Überzieher. Sehr wahrscheinlich tak-tische Anweisungen. Nun entfernt der sich Co-Trainer von dem Spieler und gibt des-sen Torhüter ein Zeichen, dass Spiel wie-der aufzunehmen.
Die Spieler bewegen sich. Auch Yas-sine. Riodjes Augen folgen Yassines Schritt genau. Er wird lange nicht angespielt. Erst nach einigen Minuten bekommt er an der Aussenlinie mit dem Rücken zum gegne-rischen Tor den Ball vor die Füsse. Mit einer einzigen Berührung dreht er sich auf engstem Raum um die eigene Achse und den gegnerischen Spieler. In Riodje passiert was. Riodje fühlt, als würden die Tore verschwinden. Die Tore verschwinden und mit ihnen der Sinn des Spiels. Es ist kein Spiel mehr, kein Wettbewerb. Es ist Tanz ohne Musik. Kunst, für die man kein Wissen braucht. Es bleiben nur noch Yas-sines Bewegungen, die Geschmeidigkeit, die Leichtigkeit, die Eleganz. Es scheint als sei der Ball auf einmal ein belebtes Ob-jekt. Keine Selbstgespräche mehr, sondern Dialog. Vielleicht nicht nachvollziehbar, aber Yassines Solo führt Riodje die Sinn-
der gegnerische Verteidiger hat zuerst den Ball berührt und erst dann Yassines Knie. Das Spiel geht weiter. Yassine steht wieder auf.
Riodje verlässt seinen Stehplatz in Richtung Parkplatz. Er will weg von hier. Nach Europa. Klar manchen die von hier nach Europa wollen, geht’s viel beschis-sener. Aber Riodje will mehr, als diesen verfickten Aushilfsjob im Gemüseladen. Und mehr gibt’s hier nicht für ihn. Er ist kein Wirtschaftsflüchtling. Es gibt keine Wirtschaftsflüchtlinge. Es steckt mehr da-hinter. Auch Riodje weiss, bleibt er hier, dann geht sein verschissenes Boot irgend-wann unter. Und in Europa will er keinen fertigen Platz in irgendeinem Boot, er will sich selbst eins bauen. Das ist sein Traum. Auf dem Parkplatz der Trainingsanlage steht der Mannschaftsbus des FC Zürich.
* Lukas Posselt, 20, studiert in seiner Freizeit gerne die
kleinen Dinge des Alltags und sonst an der Universität
Zürich.
Yassine &Riodje
THEMA Yassine & Riodje
Vor drei Jahren reiste
Yassine mit seiner Mann-
schaft nach Tunesien.
Die Mannschaft brach das
Trainingslager aufgrund
Unruhen vorzeitig ab
und fl og zurück nach Zürich.
Riodje versteckte sich
im Mannschaftsbus in
einem Hohlraum. So reiste
er, versteckt in die
Schweiz, wo er ein Asylge-
such einreichte.
Der folgende Text, erzählt
die Geschichte, wie
sie nicht stattfand.
Text: * Lukas Posselt

19
In Zürich 8 steht eine Moschee – an der Forchstrasse gegenüber der Zufahrt zur Psychiatrischen Universi-tätsklinik, ehemals Klinik Burghölzli. Von der Forch her stadteinwärts ist das Minarett der Moschee erst im
letzten Augenblick zu sehen, so versteckt ist es hinter dem hö-heren Nachbargebäude. Stadtauswärts wird das Minarett kaum früher sichtbar. Von der Lenggstrasse aus guckt das Minarett nur im Winter zwischen den Ästen hervor, wenn die Bäume davor kein Laub tragen – es sei denn, man steht an der Kreuzung, um in die Forchstrasse einzubiegen. Dann sticht einem das Minarett ins Auge. Aber eigentlich geht es neben dem viel grösseren und mas-sigeren Turm der reformierten Kirche Balgrist, der lange vorher ins Blickfeld kommt, ohnehin unter. Hinter der Moschee ist ein kleines Waldstück, das die Moschee mit ihrem Minarett für die In-haber der Schrebergärten am Balgristweg verdeckt. Alles in allem ist die Mahmud-Moschee mit ihrem Minarett recht gut versteckt.
Die Moschee ist das unscheinbare Symbol eines Zwiespalts, der an Frau Schweizer nagt – kein Wunder also, dass sie Minarette nicht mag. Schliesslich macht das Minarett die Moschee erst deut-lich als Moschee erkennbar. Ansonsten wäre sie bloss ein weiss ge-strichenes Gebäude, von denen es in der Stadt wohl noch andere gibt. Zugegeben, der arabische Schriftzug wirkt verräterisch. Aber sonst?
Frau Schweizer, die etwas unterhalb am Russenweg wohnt, spaziert jeden Tag an dieser Moschee vorbei, wenn sie zur Bäcke-rei Wüst hinauf geht. Sie sieht zwar selten jemanden bei der Mo-schee, aber sie mag die Muslime trotzdem nicht. Insgeheim fürch-tet die ältere Dame um ihre Ersparnisse. Noch geht es in diesem Land gut – aber wenn die dann alle hier sind? Überdies machen gerade die Muslime einen schlechten Eindruck. Eigentlich tragen sie selbst die Schuld, dass Frau Schweizer sie nicht mag. Manche sind nicht rasiert und wirken mit ihrer eigenartigen Bekleidung ziemlich fremd, um nicht zu sagen unordentlich. Das Gesicht eines ehrlichen Mannes gehört rasiert. Das weiss Frau Schweizer seit ihrer Kindheit.
Kindheit. Auch Frau Schweizer ist mit dem Nationalmär-chen der Schweiz vertraut. Heidi: das löst bei allen Kindheits-nostalgie aus, wenn nicht gar Heimatgefühl. Zu dumm nur, dass gerade dieses Heidi, pikanterweise eine rückständige Analpha-betin, aus Armut nach Frankfurt geschickt wurde, wo es etwas hätte lernen und als Hausmädchen endlich ein wenig Geld ver-dienen können. Aber es gefiel diesem Heidi in Frankfurt partout nicht. Von Heimweh verzehrt durfte es schliesslich doch wieder in die Schweiz zurückkehren. Das war jedoch alles nötig, damit die berühmte Schweizer Krankheit – das Heimweh – als Essenz der Schweizer Volksseele entstehen konnte. (Erstmals wurde die-ses Phänomen in Basel im 17. Jahrhundert in der medizinischen Fachliteratur beschrieben.) Wie nötig wir die Ausländer haben, um unserer selbst sicher zu sein – und wie herzlich wir sie ableh-nen müssen, um nur Heimweh haben zu können. Davon sind die Heidi-Bücher ein weltberühmtes Zeugnis. Und der Grossvater, bei dem Heidi wohnte, war einer, der – fast möchte man sagen, wie es sich für einen rüstigen Schweizer gehört – in fremden Diensten gestanden hatte. In Neapel, so berichtet Johanna Spyri.
Es wäre also denkbar, dass leichte Zweifel Frau Schweizer beschleichen, wenn sie vor der Moschee steht. Am Ende sind diese Muslime gar nicht so freiwillig hier, wie es den Anscheint macht? Am Ende gefällt es denen dort besser, wo sie herkommen? Ja, wäre es denn so abwegig zu denken, dass die bärtigen Muslime, die in einem fremden Land leben, nicht dasselbe Heimweh verspürten wie Heidi damals in Frankfurt?
Angenommen, Frau Schweizer kam 1943 auf die Welt, so ist es plausibel genug, dass sie einen Vater hatte, der noch im 19. Jahrhundert geboren worden war – vielleicht 1899. Gut möglich, dass dieser Vater, der auf dem Land aufgewachsen war und kaum Bildung genossen hatte, nicht gerade reich mit Geld gesegnet war – ihm vorzuwerfen, er hätte wie der Alpöhi das Familienerbe durchgebracht, wäre böswillig. Was auch immer seine genauen Fa-milienverhältnisse gewesen sein mochten, er schlug sich so recht und schlecht durch. Vielleicht liess er einmal etwas mitgehen.
Text: * Fabian SchwitterVielleicht hatte er Hunger. Gründe für Unannehmlichkeiten gibt es zu Zeiten eines strengen moralischen Regimes genug. Er könnte also das Land verlassen haben, um einer geringen Strafe für ein Verbrechen zu entgehen, das er bei bestem Willen nicht als Verbrechen sehen konnte – eben des Hungers wegen. Wäh-rend des Ersten Weltkriegs war die Nahrung schliesslich knapp und in der Französischen Fremdenlegion dienten nach dem «Historischen Lexikon» rund 14 000 Freiwillige aus der Schweiz. Vielleicht befand sich Frau Schweizers Vater auch darunter?
Als Überlebender des Ersten Weltkriegs kehrte der Vater in die Schweiz zurück, wo es ihm wieder nicht gelang, recht Fuss zu fassen. «Shellshocked», wie die Engländer treffend sagen, war er nach dem Krieg für ein bürgerliches Leben wohl noch nicht bereit. So heuerte er als verdienter Soldat wieder bei der Legion an – immerhin Nahrung und Unterkunft. Und auch wenn er es nie ganz so wüst getrieben hatte wie Friedrich Glauser, könnte er diesen in der Legion in Marokko, als sie beide dort Anfang der zwanziger Jahre Dienst taten, getroffen haben. Das ist immer-hin eine Bekanntschaft, auf die sich Frau Schweizers Vater etwas einbilden konnte. Schliesslich erfand Glauser den berühmtesten Polizisten der Schweiz: Wachmeister Studer. Auch dafür brauch-te es offensichtlich das Ausland – Österreich, Frankreich, Ma-rokko, Belgien, Italien, wo Glauser überall lebte, bevor er nach mehreren Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken, auch im Burghölzli, am Vorabend seiner Hochzeit zusammenbrach und zwei Tage später starb.
Frau Schweizer erinnert sich noch gut an die alten Verfil-mungen mit Heinrich Gretler als Wachmeister Studer. Schwarz-weiss natürlich, nicht so wie das mit den Filmen heute. Aber was der Vater von den Muslimen erzählte. Diesen rückständigen, verlausten Marokkanern. Der Vater blieb ein Leben lang schön glatt rasiert, wie er das in der Legion gelernt hatte.
Und was hatte er sonst noch in der Legion gelernt? Frau Schweizer beschleichen wieder Zweifel an ihrem so recht schön zurechtgestutzten – glattrasierten – Bild. Sind rasende Koso-varen und dealende Nigerianer – und erst die hart arbeitenden mazedonischen Bauarbeiter – nicht weniger schlimm als Solda-ten, die irgendwo in der Welt morden, die Leute in die Flucht treiben? Diese lange Tradition eines kleinen Landes in den Ber-gen: Kriegsmaterialexport. Der erste Kommandant der Fremden-legion war ein Schweizer gewesen.
Sind Abneigungen und Vorlieben nicht recht zufällig, hängen sie vielleicht von einem rasierten Vater ab? Ob Wilhelm Tell Terrorist oder Held war, hängt vom Standpunkt ab, wenn an Max Frischs ironische Nacherzählung «Wilhelm Tell für die Schu-le» gedacht wird. Trotz ihres Durchgangsrechts durch Uri muss-ten die Habsburger den Gotthardweg befestigen und schützten. Schützten vor wem? Doch wohl vor den ansässigen Bauern, die nach einer schlechten Ernte die Speicher für den Winter füllen mussten. Und dann Krieg – Morgarten und die Entstehung eines kleinstaatlichen Mythos, Sempach und die Geburt eines natio-nalistischen Märtyrers, Marigniano und die Zementierung des Kleinstaats…
Überall Krieg und Flüchtlinge und Armut, wenn Frau Schweizer abends die Nachrichten schaut. Ströme von Men-schen ergiessen sich über die Erde. Aus Syrien, Sri Lanka, Su-dan, Somalia, Bulgarien, Irak, Nigeria, Eritrea, Rumänien, Kon-go, Kolumbien, Mali, Mexiko… Fast möchte Frau Schweizer an die Sintflut denken. Die Schweiz hat sich politisch einige Zeit recht erfolgreich verhalten, wenn auch nicht immer rühmlich. Die meisten Schweizerinnen bilden sich doch etwas darauf ein, dass Auschwitz nicht in der Schweiz liegt. Aber keiner hat allzu genau nachgefragt, als die Schweiz über Nacht zu Geld kam, das sie für die ganze Welt, für mehr oder weniger zwielichtige Ge-stalten, hortet. Frau Schweizer hätte vielleicht doch besser um einen Platz in der Arche gebetet. – Aber wenn das wirklich die Sintflut ist, desto verrückter scheint es, Mauern bauen zu wol-len, um diese Massen von der Schweiz fernzuhalten – und wenn schon, dann wäre in einem Land der Staumauern die Kraft dieser Fluten zu nutzen.
Wir Schweizerinnen
und die Andern
&THEMA Wir SchweizerInnen und die Andern THEMA Wir SchweizerInnen und die Andern18
Befragung einer Volksseele
* Fabian Schwitter (*1984) ist seit dem letzten Jahr eidgenössisch diplomierter Senfmischer. Er hat in Zürich Philosophie und Literaturwissenschaft abgeschlossen. Der Hochschulabsol-
vent verkauft hochwertigen Kaffee (www.vivicafe.ch) und ist im Kindergarten angestellt. Ansonsten publiziert er immer wieder literarische und essayistische Texte (z.B. in Lasso, Variations
oder Denkbilder) und ist Mitherausgeber der literarischen Zeitschrift delirium (www.delirium-magazin.ch)


22 23
Bevor wir das Haus überhaupt sehen können,
sehen wir nur weiss: Alles ist zugeschneit an die-
sem Nachmittag. Kurz nach Landquart montie-
ren wir die Schneeketten, damit wir wenigstens
bis ins Dorf Valzeina GR fahren können. Dort
ist dann Schluss – die Strasse gleicht einer Tief-
schneeroute, das Auto will nicht mehr weiter.
Also laufen wir. Eine halbe Stunde den Berg hi-
nauf. Das Dorf weit hinter uns – vor uns kommt
ausser Berg, Schnee und Himmel nicht mehr
viel. Dann stehen wir vor dem eingeschneiten
«Flüeli». Ein ehemaliges Ferienzentrum, in dem
seit 2007 Menschen leben, die kein Recht haben, sich in der Schweiz aufzuhalten – deinitiv abge-
wiesene Asylsuchende also. Das ist der Ort, wo sie
hingesteckt werden. Es ist wie im Gefängnis. Nur
ein bisschen anders. Sie können zwar raus, aber
da ist nichts. Ein alter Militär-Jeep steht auf dem Parkplatz, an der Haustüre warnt ein Schild vor
dem Eintreten ohne Genehmigung. Da uns der
Abteilungsleiter Georg Carl (SVP) vom bündne-
rischen Amt für «Asyl und Vollzug» eine solche
Bewilligung erteilte, betreten wir das Haus. Er
riecht nach Essen. Totenstille. Wir rufen. Wir
klopfen an Türen.
Die Beamten und das Haus
Herr Carl und sein Angestellter Herr Wüest ru-
fen uns in ihr Büro. Herr Wüest arbeitet jeden
Tag von morgens um acht bis abends um fünf im
«Flüeli» - er ist der Betreuer und Unterkunftslei-
ter. Herr Carl schaut, dass die knallharte Asylpo-
litik des Regierungsrates durchgesetzt wird. 2.7% aller Asylsuchenden in der Schweiz kommen in
den Kanton Graubünden – das sind 1196. Flücht-
linge, deren Gesuch abgelehnt wurde, haben drei
Möglichkeiten: Entweder reisen sie freiwillig aus,
sie tauchen unter, oder sie kommen ins «Flüeli».
Momentan leben acht Personen im Haus – Platz
hätten 40. Sie kriegen nichts ausser Nothilfe. Die-
se wird nicht in Geld, sondern in Sachleistungen
geleistet: Essen und Unterkunft. Das Haus besteht
aus vier Stockwerken. Unten ist das Büro, die
Küche und der Aufenthaltsraum: Ein Sessel, ein
Tisch, zwei Bänke. Sonst nichts. Im ersten, zweiten
und dritten Stock wohnen die Menschen.
Von Tamil Tigern und Buddhismus
Beim Betreten eines Zimmers schlägt uns dicke
Luft entgegen. Der 24-jährige Tibeter geht seiner
Hauptbeschäftigung nach, dem Schlafen. Über
den Besuch scheinen er und sein Zimmergenos-
se aus Sri Lanka sich trotzdem zu freuen. Obwohl
sie kaum Deutsch sprechen, sprudelt es aus den
beiden heraus, als hätten sie seit Wochen kein Ge-
spräch geführt. Nichts gibt es hier zu tun, ausser
eben Essen und Schlafen. Eigentlich möchte der
Tibeter Fussball spielen. Aber eine Fahrt mit dem
Bus nach Landquart kostet 7.50 CHF. Die Betreuer versichern uns, dass die Bewohner immer wieer
nach unten fahren. Woher die Asylanten das Geld
dafür nehmen, konnten Sie uns auch nicht sagen.
Der hagere Flüchtling aus Sri Lanka bekommt hin
und wieder Geld von Landsleuten, die er von sei-
ner Zeit vor dem Flüeli kennt. Ohne diese Hilfe
wäre er hier oben gefangen. Für grosse Sprünge
reicht es trotzdem nicht. Zweimal täglich müssen
die Bewohner bei der Anwesenheitskontrolle im
Flüeli sein.
Der Traum vom Selbstmord
Da die Insassen keine Anwesenheitsberechtigung
haben, wie Herr Carl ausführt, sollen sie auch kei-
ner Beschäftigung nachgehen dürfen. Zudem ist
es eine Strategie, jene, die nicht freiwillig gehen
wollen, zur Freiwilligkeit zu zwingen. Der gottver-
lassene Standort der Unterkunft, das Besuchsver-
bot, das Beschäftigungsverbot -hier will niemand
sein. Einheimische aus Valzeina waren früher
oft mit Spielen und Kaffee zu Besuch – Herr Carl
fand das ein Stück weit kontraproduktiv. Bei einer
scheint diese STrategie nicht so recht ziehen zu
wollen. Die 40-jährige Äthiopierin wohnt seit vier
Jahren und zwei Monaten im «Flüeli». Ihr Gesuch wurde im Jahr 2009 abgelehnt. Warum? Das weiss sie nicht. Sie habe nie Probleme gemacht. Gelo-
hen ist sie, nachdem ihr Mann bei politischen
Unruhen ermordet wurde. Träume hat sie keine
mehr. Sie will etwas Sinnvolles tun, schliesslich
sei sie ein Mensch, kein Tier. Zur Hälfte möchte
sie sterben, die andere Hälfte zwingt sie zum War-
ten. Worauf? Das weiss sie nicht. Bis es soweit ist,
schaut sie fern. Denn lesen und schreiben kann
sie nicht.
«Ich bin ein Mensch, kein Tier»
Das Haus «Flüeli» steht
irgendwo im nirgendwo.
Hoffnung, oder nur schon
Beschäftigung, gibt es nicht.
Die absurde Geschichte
des Besuches im Ausreise-
zentrum für abgewiesene
Asylanten. Eine Tragödie in
mehreren Szenen.
P R O LO G
S Z E N E 1
S Z E N E 2
S Z E N E 3
Text: * Simon Jacoby & Conradin Zellweger
Die Empörten
Termine rufen Herrn Carl nach Chur, wir müssen
gehen. Nur unter Beobachtung dürfen sich Perso-
nen mit Bewilligung im Haus bewegen. Wieder
aus dem Haus bleibt ein dumpfes Gefühl zurück.
Es ist Nachmittag und die Strassen sind immer
noch völlig zugeschneit. Am anderen Dorfende
wohnen Herr und Frau Stirnimann. Für ihr En-
gagement mit dem Verein «Valzeina Miteinan-
der» gewannen sie letztes Jahr den Paul Grünin-
ger Preis in der Höhe von 50 000 Franken. Das erste Mal ging dieser Preis in die Schweiz. Absicht
des Vereins: Das Zusammenleben der Gemeinde,
deren Bewohner bis zu einem Viertel aus illegal
anwesenden Ausländern besteht, zu erleichtern.
Zuerst war Guido Stirnimann wie die meisten ge-
gen das Zentrum. Zu abgeschieden. Wir merken
schnell, einige der Bewohner sind ihm ans Herz
gewachsen. Er kritisiert vor allem die Aufent-
haltsdauer von mehreren Jahren im Flüeli. Mit den Jahren werde man krank hier oben.
S Z E N E 4
THEMA Ich bin ein Mensch, kein Tier THEMA Ich bin ein Mensch, kein Tier

ANZEIGE
24
Vor sieben Jahren sind die ersten abgewiesenen Asylanten nach Valzeina gekommen. Ein Auf-
schrei hallte durch das Dorf und weit darüber
hinaus. Heute ist die grosse Empörung verl o-gen. Die Asylanten leben abgeschnitten von der
Aussenwelt und das über Jahre. Jene aus dem Dorf verlieren das Flüeli nicht aus den Augen.
Nachdenklich schlittern wir über die verschneite
Strasse zurück ins Tal. Wir haben eine Ahnung
davon bekommen, was es heisst, sich frei bewe-
gen zu können.
* Simon Jacoby, 24, Co–Chefredaktor bei dieperspektive, gönnt
sich eine gute Zeit, bevor er bei Watson b eginnt. Irgendetwas
muss man ja machen.
* Conradin Zellweger, 25, Co-Chefredaktor von dieperspektive,
Student in Publizistik & Kommunikationswissenschaften, will zu
diesem Text noch ein kurzes Filmchen schneiden.
E P I LO G
KarussellDas Ende kommt schneller als
man denkt
Bald schon schliesst das Karussell seine Tore.
Darum empfehlen wir wärmstens bis es Ende
März so weit ist, noch den ein oder anderen
Besuch in diesem schönen Lokal zu machen,
das uns jetzt für 15 Monate auch als Redaki on diente. Entdecke schöne Sachen im Store, be-
wundere die letzten Ausstellungen und geniess
dazu ein Kaff ee oder Bier!
Und ganz wichi g: Verpass auf keinen Fall die Closing-Party!
Geöff net: DO / FR / SA jeweils 16 - 23 h.
CLOSING-PARTY: SA, 29. MÄRZ
THEMA Ich bin ein Mensch, kein Tier

26 27
Ein Hafen ist ein Ort an einer Küste, wo Schiffe anlegen können, um be- und entladen zu werden und/oder um Schutz vor stürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischemstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchenstürmischem Wetter zu suchen
1
2
3
4
1 Cadiz Spanien
2 Stockholm, Stadsgården Schweden
3 Marseille, Vieux Port Frankreich
4 Buenos Aires, Puerto Madero Argentina
Fotografie Isabella Furler
Schutz vor stürmischem Wetter zu suchen.
THEMA Fotografie THEMA Fotografie
Quelle: Wikipedia

28
Jeden Tag können Herr & Frau Schweizer heute ins Kino gehen, um sich Filme aus aller Welt anzuschauen. Das war nicht im-mer so. Noch in den 1920er-Jahren gab es in der Schweiz eine
schwarze Liste von verbotenen Filmen, so etwa die von Charlie Chaplin. Mit dem Durchbruch des Tonfilms ab 1927 veränderten sich die Produktionsprozesse. In der Schweiz war eine einzige Ausrüstung vorhanden, die zur Herstellung der Schweizer Film-wochenschau – der Vorläufer der Tagesschau – diente. Für die aufwändige Synchronisation der Filme waren die einheimischen Filmemacher vom Ausland abhängig. Den 400 Produktionsfirmen in Deutschland und den über 250 in Frankreich standen zwei eta-blierte in der Schweiz gegenüber.
Aufnahmeleiter gesuchtErfolgreich war Lazar Wechsler, der 1924 die Praesens-
Film AG gründete. Mitten im Zweiten Weltkrieg produzierte er Spielfilme wie «Füsilier Wipf», die im Kontext der «Geistigen Lan-desverteidigung» standen. Diese politisch-kulturelle Bewegung zwischen 1930 und 1960 diente zur Abwehr von totalitären Ide-ologien. Die Techniker für diese Filme wurden oftmals über Zei-tungsinserate gesucht und lernten ihre Tätigkeit auf dem Set. Für «Füsilier Wipf» wurde ein Aufnahmeleiter rekrutiert und Hein-rich Fueter meldete sich, um seine erste Erfahrung beim Film zu machen. 1947 gründete er die bis heute erfolgreiche Condor-Film AG.
Während dem zweiten Weltkrieg wurden in der Schweiz bis zu zwölf Spielfilme pro Jahr hergestellt. Nach dem Krieg brach die Schweizer Filmproduktion jedoch ein. Ökonomische Schwie-rigkeiten, technische wie inhaltliche Schwächen und der Durch-bruch des Fernsehens waren dafür verantwortlich, dass das Publi-kum dem Kino fernblieb und immer mehr Produktionsfirmen ihren Betrieb einstellen mussten.
Die Ausstellung «Der Film» 1960 im Kunstgewerbemuseum Zürich entfachte bei Filmschaffenden wie beim Kinopublikum eine neue Begeisterung für die siebte Kunst. Es entstanden Film-clubs und die Filmarbeiterkurse an der Kunstgewerbeschule Zü-rich von 1967 bis 1969 bildeten die Talente des neuen Schweizer Films aus. Unter den Studenten war auch Markus Imhoof, der mit «Das Boot ist voll» anfangs der 80er-Jahre seinen ersten internati-onalen Erfolg feierte.
Filmemachen unter FreundenDie Jahre des Cinéma Copain, des Autorenkinos, brachen
an. Im Zentrum standen der Regisseur und seine Geschichte, die er inszenieren wollte. Gratisarbeit war eine der Voraussetzungen, damit in der Schweiz überhaupt Filme entstehen konnten. Die Regisseure behandelten die Techniker laut dem Beleuchter And-ré Pinkus öfters nach dem Credo: «Wir sind Freunde und können
Der Schweizer Film « Ein Film von ... » ist gross auf dem Film-
plakat zu lesen. Doch ein Film entsteht nicht durch eine einzelne Person, sondern dank dem Engagement einer Vielzahl von Arbeitskräften. Keiner denkt bei einer Verfolgungsjagd an die rasanten Schwenks des Kameramannes oder an die Lichttechniker, die für das romantische Licht beim Happy End zuständig sind. Eine Ode an die Arbeit auf dem Film.
umsonst füreinander arbeiten.» Viele Filmtechniker verliessen in der Folge die Branche, um ihren angestammten Berufen nachzu-gehen. Der Regisseur Kurt Früh berichtet in seinen Memoiren, wie schwierig es anfangs der siebziger Jahre war, eine professionelle Equipe zu finden. Wenn er für seine Filme ehemalige Filmtechni-ker anfragte, kam es mehrmalig vor, dass sie «alles gehen und ste-hen liessen, um wieder einmal eine Zeitlang Filmluft in die Nase zu bekommen»
Das Filmgesetz und die Filmförderung gaben dem neuen Schweizer Film professionellere Strukturen. Die Mehrheit der Pro-duktionen kam aber weiterhin mit einem tiefen Budget aus oder setzte finanzielle Beteiligungen der Equipe voraus. Aus diesen un-günstigen Bedingungen heraus formierte sich die Arbeitsgruppe der Filmtechniker, welche die Bedürfnisse der Branche erfasste und im März 1974 den Schweizer Film-Techniker Verband gründe-te. Es dauerte beinahe fünf Jahre, bis mit den Partnerverbänden und Produzenten eine Einigung gefunden wurde und die ersten Allgemeinen Anstellungsbedingungen (AAB) erschienen. Trotz di-versen Überarbeitungen blieben die Grundzüge der Bedingungen bis heute die gleichen. Über den Lohn verhandelt weiter jeder Filmtechniker selbst. Die AAB regeln derweil die Bedingungen wie Arbeitszeiten, Überstunden, Nachtzuschläge und Spesen. Da-mit wurde die Basis für Grundrechte von Filmtechnikern auf dem Set geschaffen, die in den früheren Jahren mit 70 bis 80 Arbeits-stunden die Woche die Baustellenarbeiter eines Filmes waren. Und was der Cutter Georg Janett bereits Mitte der siebziger Jahre resümierte, gilt heute fortwährend: «Die wachsende Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Filmtechnikern und Pro-duzenten lässt hoffen, dass Filme professionell hergestellt werden können, mit Technikern, die ihr Handwerk verstehen – und lieben.»
Markus Imhoof, Regisseur
1 Herr Imhoof, wie war die Stim-mung auf dem Set als Sie anfangs der 1980er-Jahre das «Das Boot ist voll» ge-dreht haben?
Als wir keine Bundessubventionen bekamen, dachten wir erst, wir könnten den Film nicht machen. Dass es doch ge-klappt hat, hat die Solidarität im Team sehr gestärkt. Trotz der düsteren Thematik des Filmes, war die Stimmung auf dem Set sehr angenehm.
2 Oft steht der Regisseur mit sei-ner Geschichte im Mittelpunkt. Welchen Stellenwert haben die Filmtechniker für Sie?
Ich will sorgfältig arbeiten können, wie wahrscheinlich alle in der Equipe. Der stärkste Hauptdarsteller nützt nichts mit einem falschen Requisit oder in einem schlechten Dekor.
3 Was ist Ihnen auf dem Set am wichtigsten?
Die Zeit. Ich kämpfe immer für mehr Zeit, um mit den Schauspielern zu proben und die Szene sorgfältig zu insze-nieren. Wenn das Licht steht, ist es für neue Ideen zu spät. Es ist aber immer schwierig den Techniker anzusagen, wie lange die Fantasie braucht, bis der geniale Einfall kommt.
Georg Janett, Cutter und Lehrer der erstenFilmarbeiterkurse
1 Herr Janett, welchen Vorteil hat die Schweizer Filmbranche?
Uns fehlt glücklicherweise ein grosses Studio, in dem Jahresanstellungen möglich wären und der Film beinahe zur Fabrikarbeit verkommen würde. Die mei-
sten arbeiten in diesem Metier, weil sie nicht in der Fabrik arbeiten wollen.
2 Was hat sich im Laufe der Zeit verändert?
Heute gibt es immer mehr Ko-Pro-duktionen. Die Filmtechniker funktionie-ren als Befehlsempfänger, die ausführen und ja nicht reinreden sollen. Ein deut-scher Regisseur sagte mir: ‹Das Problem von Schweizer Filmtechnikern sei, dass alle noch ein bisschen Regisseur sein wol-len.› Ich antworte ihm: ‹Als Regisseur wäre ich froh über so viel Engagement.›
3 Welche Bewegung gab es in Ih-rer Laufbahn?
Ich habe mein Leben lang analog gearbeitet. Darum kann ich heute meinen Beruf nicht mehr ausüben. Die Digitalisie-rung begann als ich 60 war. Ich dachte, ich hätte bis 65 noch genug zu tun. Die Ent-wicklung war viel schneller als gedacht und mit 62 hatte ich kaum noch Arbeit. Mir wiederstrebte das Digitale: Knöpfe drücken und den Rest die Maschinen ma-chen lassen – damit konnte ich mich nicht identifizieren. Ich habe alles von Hand ge-macht. Es war eine körperliche Arbeit mit dem Schleppen der Bänder und dem Bear-beiten des Tons.
Hans Läubli, Geschäftsführer von Suisseculture und im Kantonsrat Zürich
1 Herr Läubli, warum engagieren Sie sich für die Kultur?
Kultur ist eines der elementarsten Bedürfnisse einer Gesellschaft. Ohne Kul-tur kann sich eine Gesellschaft nicht entwi-ckeln. Darum ist Kultur auch ökologisch. Für mich gehört Kultur zum Lebensexilier eines Menschen.
2 Ist die Kulturförderung ein neu-artiges Phänomen?
Nein, bereits in der prähistorischen Zeit gab es offenbar Künstler, die von der Gesellschaft unterstützt worden sind. Die Menschen, welche vor über 10 000 Jahren die Höhlenmalereien anfertigten, hatten keine Zeit zu jagen und mussten von ande-ren versorgt worden sein.
3 Was erwarten Sie von den Kul-turschaffenden?
Ich erwarte von den Kulturschaf-fenden, dass sie sich selber auch einset-zen, zum Beispiel gegen die Sparpolitik. Vorbildlich sind da die Filmproduzenten, die in der Schweiz eine starke Lobbyarbeit betreiben.
André Pinkus, Beleuchter und Gründer des Film-techniker Kollektivs
1 Herr Pinkus, hatten Sie als frei-schaffender Beleuchter keine Existen-zängste?
Wenn ich früher wem erzählte, dass ich nicht genau wusste, wie es als nächstes weitergehen wird, verstand der das nicht. Ich wusste nur, dass es irgendwie gehen wird. Wenn man lange angestellt ist, und mit 50 die Stelle verliert, ist man heute halbtot und hat viel mehr Mühe wieder Fuss zu fassen.
2 Welchen Vorteil haben Schweizer Techniker gegenüber den ausländischen?
Manchmal kam es vor, dass eine Pro-duktion am Wochenende Schweizer Tech-niker holte, weil sie billiger waren. Die Techniker im Ausland haben Sonntagszu-schläge. Wir wollten am Sonntag nicht frei haben – da kann man keine Zahnbürste kaufen oder aufs Amt gehen.
3 Für was haben Sie sich in den 90er-Jahren in der Filmfachkommission stark gemacht?
Ich habe mich viel für die Weiter-bildung eingesetzt. In einer Filmschule müssten Filmtechniker den Studenten, das Praktische beibringen und Dozenten für das Theoretische zuständig sein. Das scheiterte daran, dass wir sagten, die Schu-le müsse das Geld vom Bund selber verwal-ten können. Das konnten wir nicht durch-setzen. Das Geld ging an den Kanton und er behielt das Veto-Recht für die Ausgaben.
Marc Wehrlin, ehemaliger Chef der Sektion Filmim Bundesamt für Kultur
1 Herr Werhlin, was halten Sie vom Kulturförderungssystem?
«Im Fördersystem gibt es teilweise falsche Anreize. Ein Produzent kann heute wunderbar überleben mit Fernsehaufträ-gen und ein paar ausfinanzierten Filmen. Er wird nie wahnsinnig reich, dennoch reicht es. Ich habe nie herausgefunden, wie man die Wurst genug hochbinden kann, damit sie wirklich springen müs-sen.»
2 Was war Ihr Credo in den Begut-achtungsausschüssen beim Bundesamt für Kultur?
«Ich sagte: Erstens müsst ihr nicht entscheiden, ob ihr diesen Film gleich gemacht hättet. Sondern ob das Dossier widerspiegelt, was der Filmemacher tun möchte. Zweitens müsst ihr nicht entschei-den, welchen Film IHR als nächstes sehen möchtet. Drittens müsst ihr erkennen, ob das richtige Publikum angesprochen wird. Wenn einer sagt, sein Film sei für eine Ma-tinée gedacht, ist das legitim. Es braucht in erster Linie eine Idee, wie man das Pu-blikum erreicht, dem man etwas zu sagen hat.»
3Fragen an...
29
Text: Jessica HeftiFotos: Cinémathèque suisse
Kurt Früh und Walo Lüönd auf dem Dreh von «Dällebach Kari», 1970.
THEMA Der Schweizer Film THEMA Der Schweizer Film

«Ich bin in einem kleinen Dorf in der südlichen Provinz Maradi im Niger ge-boren, einem der ärmsten afrikanischen Länder. Wir lebten in einer kleinen Well-blechhütte, wir hatten keine Elektrizität, kein fliessendes Wasser. Ich war viel draus-sen auf der Strasse, wo ich mit meinen Freunden Fussball spielte. Einen richtigen Ball hatten wir nicht, bloss Stofffetzen, die wir zu einem Ball zusammengenäht hatten. Wir spielten barfuss. In die Schu-le ging ich nie, ich lernte weder schreiben noch lesen. Meine Eltern konnten kaum genug Geld verdienen, um meine zehn Ge-schwister und mich zu ernähren. Als mein Vater starb, musste ich als Erstgeborener Verantwortung übernehmen. Ich war nun der Kopf der Familie. Manchmal arbeitete ich auf Baustellen, wo ich Sand- und Ze-mentsäcke hin und her trug.
95 Prozent der Einwohner Nigers sind Muslime. In unserem Dorf aber gab es auch eine kleine katholische Kirche. Deren Pfarrer half uns Jugendlichen, die wir wenig zu tun hatten und auf den Stras-sen herumlungerten. Er erzählte uns vom Christentum und aus der Bibel. Mit 16 Jahren konvertierte ich zum Katholizis-mus. Leider ist die religiöse Toleranz in unserem Land sehr gering. Als Christ wur-de ich verfolgt und bedroht. Deshalb, und um meiner Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen, entschloss ich mich Ende 2010, Maradi zu verlassen und mein Glück in Europa zu suchen.
«Bald hat man mich in den Bunker verlegt»Auf der Ladefläche eines Lastwagens reiste ich mit vielen anderen von Niger nach Ma-rokko. Der Pfarrer organisierte meine Aus-reise. Wie viel die Kirche den Schleppern zahlen musste, weiss ich nicht. In Marokko bestieg ich mit zwanzig, fünfundzwanzig
Anderthalb Jahre wartete Chris Musa Muhammed in der Schweiz, bis sein Asylgesuch abgelehnt
wurde. Glücklich wurde der Nigrer nur auf dem Fussballplatz. Ein Besuch im Armeebunker kurz
vor seiner Rückreise nach Afrika.
« Die Flagge der Schweiz gilt in Afrika als Symbol für Menschlichkeit »
3 Bräuchte die Schweiz mehr Pu-blikumserfolge?
«Ich bin froh über jeden Film, der viel Publikum macht. Meiner Meinung nach ist der Druck, einen erfolgreichen Film zu machen, noch immer zu klein. Wenn er im Kino läuft, ist er bereits aus-finanziert. Sobald das Geld da ist, ist es gelaufen und nur Wenige arbeiten nach dem Prinzip: ‹Jetzt ist das Geld da und jetzt möchte ich den bestmöglichen Film machen.›»
Karin Vollrath,Sachbearbeiterin Filmförderung beim Bundesamt für Kultur (BAK)
1 Frau Vollrath, was fällt Ihnen bei Ihrer Arbeit beim BAK auf?
«Manchmal mangelt es an Profes-sionalität. Nicht bei den Technikern, weil die genau wissen wie die Kamera funkti-oniert oder wie sie das Licht montieren müssen. Für die Produktion gibt erst jetzt einen Studiengang an der ZHdK mit drei Studenten pro Jahr. Und wie viele Produ-zenten gibt es in der Schweiz? Bei meiner Arbeit im BAK fällt mir auf, dass Produ-zenten teilweise wenig Ahnung haben und mehrmals anrufen, um die elementarsten Sachen zu fragen.»
2 Welche Erfahrung machten Sie an den Filmschulen?
«An den Schweizer Filmschulen
erzählte ich über die Verträge und Sozi-alleistungen. Zu Beginn interessierte es niemanden. Bei denen stand im Fokus, dass sie Regisseure werden wollten – die Verträge waren ihnen egal. Seit drei, vier Jahren scheint mir das anders, da wollen sie plötzlich wissen, was im Vertrag stehen muss, was das Arbeitsgesetz ist, und was ihre Rechte sind – auch die Regisseure.»
3 Wo sehen Sie die Zukunft in der Ausbildung?
«Ich glaube die Zeit wäre reif dafür, andere Filmberufe in der Ausbildung an-zubinden, als nur der Bachelor in Regie und das künstlerische Departement. Ich kenne drei, die an der ZHdK Produktion studierten. Sie sind realistisch und begin-nen nicht gleich mit einem grossen Spiel-film, bei dem die Chancen klein sind, son-dern mit ein paar Kurzfilmen.»
Jean-Pierre Hoby, ehemaliger Kulturdirektor der Stadt Zürich
1 Herr Hoby, wie haben Sie sich für die Filmpolitik eingesetzt?
«Ich war ein Bindeglied zwischen der Szene und der Politik. Dafür musste ich beide Seiten kennen. Dank dieser prak-tischen Arbeit kannte ich viele Filmschaf-fende und besuchte jedes Jahr die Solo-thurner Filmtagen. Der Filmkredit betrug anfangs CHF 100 000. Alles muss einmal
seinen Start nehmen. In den 1980er-Jahren wurde der Grundstein dafür gelegt. Heute ist vieles selbstverständlich, was es damals überhaupt nicht war.»
2 Wie veränderte sich die kultu-relle Wahrnehmung?
«In den achtziger Jahren wurde deutlich, dass Kultur nicht ein Luxusgut ist, dass man entweder haben konnte oder nicht. Sie gehört zum Leben. Heute ist das völlig klar: Die Kultur zeigt uns die Welt, wie sie ist, wie sie sein kann oder wie sie sein sollte.»
3 Hatten Sie nie die Bedürfnisse selber Kunst zu schaffen?
«Ich habe mich selber nie als Künst-ler verstanden. Sondern als einer, der die Kunst lieb hat und sie gerne vermittelt, der im Rahmen seiner Möglichkeit die finanzi-ellen Mittel findet und sich dafür einsetzt, überall hingeht und mit den Leuten redet. Die Gelder für Kultur fallen nicht vom Himmel, man muss sie sich erstreiten. Je bessere die Argumente sind, desto eher kommt man zu Mittel.»
*Jessica Hefti 24, plant eine Ausstellung.
«Drehbereit | Prêt à tourner» findet vom 14. bis 16. März 2014
im Folium (Sihlcity) statt und zeigt zum 40jährigen Jubiläum des
SSFV die Arbeit beim Film.
Facebook-Event: http://on.fb.me/1cELO80
30
Aufgezeichnet und übersetzt von Dennis Bühler
29 THEMA Der Schweizer Film THEMA Die Flagge der Schweiz
Auf dem Set von «Das Boot ist voll», 1981

32
anderen ein Boot. Wir trieben einige Tage auf dem Ozean. Wie lange die Überfahrt insgesamt dauerte, kann ich nicht sagen. Man verliert das Zeitgefühl, wenn man nichts anderes tun kann als warten und beten.
Wir kamen unbeschadet und von der Küstenwache ungesehen in Spanien an – wir hatten riesiges Glück. In Spanien angekommen, ging jeder sogleich seinen eigenen Weg. Ich schaffte es nach einigen Tagen nach Barcelona. Auf der Plaça de Ca-talunya, dem grossen Platz im Zentrum der Stadt, kam ich mit einer vielleicht 50-jäh-rigen Frau aus der Schweiz ins Gespräch. Sie schenkte mir 80 Franken, was für mich ein unvorstellbar hoher Betrag war. Wie 80 Millionen! Die Frau sagte mir, in der Schweiz gebe es einen geregelten Asylpro-zess. Dort hätte ich bessere Chancen als in Spanien, aufgenommen zu werden.
Mit dem Zug fuhr ich im Frühling 2011 in die Schweiz, ins Asyl-Empfangs-zentrum Vallorbe. Dort schickten sie mich ins Empfangszentrum nach Basel, danach in ein Asylheim in Winterthur-Töss. Drei Mal wöchentlich wurden wir Asylbewer-ber in einem Zimmer in der oberen Etage des Asylheims unterrichtet. Nach wenigen Monaten aber wurde ich in diesen Bunker hier im Zollikerberg verlegt, seither kann ich nicht mehr in die Schule gehen. Und so spreche ich auch nach insgesamt 18 Mona-ten in der Schweiz kein Deutsch und verst-ehe nur einige Brocken.
«Es wäre mir sofort geklaut worden»
Der Bunker unter dem Parkplatz gleich ne-ben der Forchstrasse in Küsnacht war nun für etwa ein Jahr mein Zuhause. Gemein-sam mit 17 anderen Asylbewerbern aus Afrika teilte ich mir Küche, einen Schlaf- und einen Aufenthaltsraum. Das Handy funktioniert innerhalb der dicken Bunker-mauern nicht. Esswaren konnte ich in den vier Kühlschränken, die wir haben, nicht
verstehe und wir heiraten werden. Ich bete dafür, dass mir Nigeria die Heimat wird, die die Schweiz nicht werden wollte.»
Chris Musa Muhammed lebt heute, zwölf Monate nach seiner Abreise aus der Schweiz, noch immer in Nigeria. «Es ist überhaupt nicht einfach», schrieb er nach seiner Ankunft in Lagos via E-Mail. «Ich habe keinen Rappen mehr, denn die Flug-reise von Barcelona über Dubai nach Lagos hat alles Geld verschlungen. Weil meine Verlobte nicht arbeitet, kann sie nicht für mich aufkommen. Ich weiss nicht, wie ich mein neues Leben beginnen soll.»
* Dennis Bühler (27) schreibt als Inlandredakteur für Die Süd-
ostschweiz und lebt in Chur. Als Verteidiger spielte er während
eines Jahres gemeinsam mit Stürmer Chris Musa Muhammed beim
Sportclub Zollikon in der 4. Liga.
www.dennisbuehler.com
aufbewahren. Es wäre sogleich von Mitbe-wohnern geklaut worden. Ich hatte hier tagein, tagaus nichts zu tun. Ich bewegte mich nur zwischen Bett und Wohnzim-mer, wo wir zumeist CNN schauten. Im-merhin verbesserte sich so mein Englisch.
Wenn ich mit Kollegen in die Stadt Zürich fuhr – was wir ohnehin kaum taten, weil wir uns das Ticket für die Forchbahn nur selten leisten konnten –, wurden wir andauernd von Polizisten kontrolliert. Auch wenn wir uns nicht auffällig ver-hielten. Wir hätten in der Stadt nichts zu suchen und sollten zurück in unser Asyl-heim, sagten sie uns. Zwischen einem Ge-fängnis und unserem Bunker gibt es nur einen Unterschied: Wir haben die Möglich-keit rauszugehen, wenn wir dies wollen. Da wir draussen aber nichts zu tun haben, da wir nicht arbeiten dürfen, ist der Unter-schied letztendlich gering.
Der Name und die Flagge der Schweiz sind in Afrika vielen Menschen bekannt, dort gelten sie als Symbol für Menschlichkeit. Ich aber habe in der Schweiz, abgesehen von den Erlebnissen in meinem Fussballverein, nur selten christ-liche Nächstenliebe erlebt.
«Ich hielt mich für einen Versager»
Mein grösstes Glück in den letzten anderthalb Jahren war es, beim Sportclub Zollikon Fussball spielen zu können. Ich liebte diesen Sport schon im Niger, doch ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn wäh-rend meines Asylprozesses würde ausü-ben können. Im Februar 2012 trainierte ich zum ersten Mal mit dem SC Zollikon. Nie zuvor hatte ich auf einem Kunstrasen gestanden, und doch konnte ich den Trai-ner überzeugen. Mitspieler schenkten mir meine ersten richtigen Fussballschuhe. Ich habe sie noch heute, in der Zwischen-zeit musste ich sie mit Klebestreifen zu-sammenflicken. Mein Fussballteam wurde zu meiner Schweizer Familie.
Solange mein Asylverfahren lief,
erhielt ich zwölf Franken pro Tag. Mehr als die Hälfte der 360 Franken, die ich mo-natlich erhielt, schickte ich meiner Fami-lie. Meine Mutter hat zehn Kinder zu er-nähren, meine jüngsten Geschwister sind noch sehr jung. Ich bin ja selbst erst 19 Jahre alt. Seit mein Asylbegehren abge-lehnt wurde, erhielt ich nur noch Nothil-fe. Das Geld reichte nur gerade, dass ich hier überleben konnte. Meiner Familie konnte ich kein Geld mehr schicken. Ich lag nächtelang wach, ich hielt mich für ei-nen Versager. Ich denke, dass es mir hier etwas besser geht als meinen Angehörigen im Niger. Ich habe dieses Glück nicht ver-dient. Meine Verwandten setzten so grosse Hoffnung in mich, und ich habe es nicht geschafft. Es tut so weh, dass ich mich hier nicht durchgesetzt habe.
«Ich werde mich verstecken müssen»
Nun verlasse ich die Schweiz. Hier bin ich ständig der Gefahr ausgesetzt, aus-geschafft zu werden. Die Behörden wür-den mich in den Niger ausfliegen, mein Heimatland. Dort aber würde ich aus reli-giösen Gründen verfolgt, vielleicht sogar getötet. Ich werde den Zug nach Spanien nehmen. Beim Grenzübertritt werde ich mich verstecken müssen, wenn Zöllner durch den Zug marschieren sollten. In Barcelona buche ich einen Flug nach La-gos, in die nigerianische Hauptstadt. Viele Mitglieder des Fussballvereins haben Geld gespendet, damit ich die Rückreise nach Afrika antreten kann. Und ich erhielt mein Zolliker Trikot mit der Trikotnummer 12 zur Erinnerung geschenkt. Ich bin so dank-bar. Möge Gottes Segen mit ihnen sein.
Ich bin noch nie geflogen, ich habe keine Ahnung, wie lange der Flug nach Lagos dauern wird. In Nigeria kenne ich niemanden ausser meiner Verlobten. Ich habe sie übers Internet kennengelernt, persönlich habe ich sie noch nie getroffen. Ich bete dafür, dass ich es nach Lagos schaf-fe, dass ich mich gut mit meiner Verlobten
THEMA Die Flagge der Schweiz 33
ANZEIGE

34 35
Kapitän Niveau!
wir sinken.
THEMA Witz des Tages THEMA Witz des Tages

36
37
ANZEIGE
37
«Freunde des Lichts!» Mischa beginnt seine Sätze immer so, wenn er irgendeine abgefahrene Idee hat. Und da er grundsätzlich immer ir-gendeine abgefahrene Idee hat, ruft er jedes Mal, wenn er was zu sagen hat, erstmal ein lautes «Freunde des Lichts», um unsere Aufmerksam-keit zu erhaschen. Diesmal stehen wir vor dem Alkoholregal im Super-markt und diskutieren darüber, was wir denn heute trinken sollen. Jonas hat gerade eine gefühlt halbstündige Rede darüber gehalten, warum man zuerst Gin und direkt danach eine Flasche Wachholder-schnaps trinken sollte, dass das gewisse Rezeptoren im Hirn stimu-liere, die dein Abstraktionsvermögen verstärken, das habe irgendwas mit den Synapsen oder dem Rückenmark zu tun, er sei sich da nicht mehr ganz sicher, aber er habe das auch schon ausprobiert, es sei der absolute Shit, es sei wirklich so, eine skandinavische Studie habe das bewiesen und überhaupt sei es eine Frechheit, dass sie hier, in einem so grossen Supermarkt, keinen gottverdammten Wachholderschnaps verkaufen. Ich wollte der Diskussion gerade ein Ende setzten und wie jedes Mal schlussendlich einfach Dosenbier nehmen, als Mischa mit seinem «Freunde des Lichts!» unsere Blicke auf sich zog. «Nun red schon, Alter!» schnauz ich ihn an. Die Musik hier drinnen strapazierte schon genug lang meine Nerven. «Wie lautet dein grossartiger Plan?» Theatralisch atmet Mischa tief ein und verkündet: «Fällt euch was auf, Freunde? Wir zerbrechen und jedes Wochenende darüber den Kopf, wie wir uns den Kopf zerbrechen könnten...»«Bitte weniger Wortspiele, mehr Informationen, Dude!» «Nun ja, wir diskutieren halbe Ewigkeiten, bis wir uns entscheiden, mit was wir uns heute abschiessen, kennen aber mittlerweile eh jeden Alkoholrausch in und auswendig. Das is‘ doch behindert! Und darum mein Vorschlag: Heute nüchtern bleiben. Kein Tropfen Alkohol. Wir werden l iegen, Jungs! Wir werden den Kick des Jahres haben!» Jonas und ich fangen an zu lachen. Auch das eine Standartreaktion auf Mischas Ideen. Wir könnten ihm nie offen eingestehen, dass seine Ide-en tatsächlich immer die besten Abende zur Folge hatten. Schliesslich willigen wir nach einigem Hin und Her ein. Eine Stunde später sitzen wir im Wohnzimmer von meiner WG, alle mit einem Glas Wasser in der Hand. «Ist doch scheisse, Alter.»«Jonas, glaub mir, Geduld! Es dauert ne Weile, bis das wirkt.» «Mann! Alle sind sich jetzt grade am Eintrinken und wir sitzen hier wie die grössten Verlierer und machen nichts. Was ist dein Plan? Willst du in dieser Bomben-Stimmung ausgehen oder was?» «Auf jeden Fall, Digger, warte einfach ab!»Eine weitere Stunde später packt mich Mischa plötzlich am Arm, starrt mich mit glänzenden Augen an und l üstert: «Oh, oh! Wow... Bei mir geht‘s los! Ich spür‘s. Crazy, Mann! Bei euch? Noch nichts?» «Ich spür vor allem eins, Digger: Langeweile! Komm wir gehn jetzt ein-fach! Raus hier!» Wir ziehen uns die Jacken über. Mischa beginnt un-kontrolliert den Stoff seines Mantels zu streicheln: «Scheisse, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie kuschelig Baumwolle ist?»Auch auf dem Weg zum nahegelegensten Club ist das Verhalten Mischas, sagen wir: eher seltsam. «Die Luft, Brüder, atmet diese Luft! Wie sie bis in die äussersten Win-kel des Lungenl ügels dringt! Ihr müsst euch drauf einlassen... Wenn ihr euch so weigert, isses logisch, dass ich nix spürt! Hier! Trinkt noch-mal paar Schluck Wasser!»
F r e u n d e d e s L i c h t s
Und tatsächlich: während wir gelangweilt vor uns hin trotten und Jo-nas noch sarkastisch die Frage stellt, wo sich denn genau der äusserste Winkel eines Lungenl ügels bei nde, fällt mir plötzlich auf, wie ver-dammt laut unsere Schritte sind, wie laut das Rascheln der Kleider ist, das Brummen der Autos, die Stimmen... Und als wir schliesslich vor dem Club stehen und die ganzen Leute sehen, wie sie da mit besof-fenem Blick in der Schlange tümpeln, wird mir schlagartig schlecht. «Boah, jetzt spür ich was. Aber das ist nicht geil, Dude!» keuch ich und bemerke, wie meine Beine buttrig werden. «Ich fühl mich gar nicht wohl!» Aber Mischa ist bereits wieder abgelenkt, betrachtet die Sterne und versucht, einen Baum zu umarmen. «Ich komm überhaupt nicht klar auf diesen Trip...» beichtet mir Jonas kleinlaut. «Was hat der uns fürn Scheiss gegeben?» Er beginnt unkontrolliert auf seinem Pullover-kragen rumzukauen, während mir auffällt, dass mein Rücken bereits klitschnass geschwitzt ist. Plötzlich kommt ein recht grosser, musku-löser Kerl auf uns zu, mit einem breiten Grinsen, lehnt sich vornüber in unsere Richtung und haucht mit rauer Stimme: «Brüder im Geiste, heh? Ich sehs an eurem Blick... Seid Vorsichtig, ja?» Und etwas leiser fügt er hinzu: «Habt ihr zufällig noch was übrig?»«Wie? Was meinst du? Wir haben nix genommen, wir sind scheiss nüchtern...»«Ja, ja, ja, ich weiss schon, aber...» Er kommt uns noch näher und legt seine Pranken auf unsre Schultern, wir riechen sein Billigparfüm «Habt ihr noch etwas Wasser? Nur ein, zwei Schlücke? Für einen Brudi?» Wir geben ihm unsere Wasserl asche. Es ist mir eh scheissegal geworden, was passiert. Ich will nur noch, dass dieses Gefühl aufhört, diese Leere, dieser Kotzreiz. «Freunde des Lichts!» Mischa kommt mit einem Ast in der Hand zu uns zurück. «Habt ihr schon Mal die Schönheit der Natur wahrgenommen? Ich mein: so wirklich wahrgenommen?» «Ich fühle vor allem eine gähnende Belanglosigkeit. Ein ewiges Rad ist das alles hier. Ohne Sinn. Ohne Ausbruch...» Jonas spricht mir aus der Seele. Ich habe noch nie so deutlich gefühlt, wie gefangen wir sind. In unserm Körper. Sogar in der Seele, im Geist. Alles ist ein Kreislauf, der nur durch den Tod zu durchbrechen ist. Und der Tod ist noch so weit weg. Ich habe Angst... «Hey, alles okay?» Jonas starrt mich an. Auch er hat Angst und seine Angst macht mir noch mehr Angst, denn Jonas hat nie Angst. «Du bist richtig bleich, Junge!» sagt er, während ihm selbst der Schweiss nur so runter läuft. «Wir... wir sollten uns hinset-zen.»Alle, die in der Schlange zum Club stehen, bleiben mit einem generv-ten Blick an uns hängen, verdrehen leicht die Augen, machen irgend-eine halbwitzige Bemerkung - aber wir hören nichts, nur dumpfe re-gelmässige Paukenschläge. Ich leg mich auf den Asphalt und schliesse die Augen. Der Paukenschlag dröhnt in meinem Kopf, übertönt alle Stimmen, alles Gerede, übertönt das Rufen von Jonas, dass da vorne doch gleich ne Parkbank sei, übertönt den Freudeschrei Mischas, als er wieder irgendwas krasses am Boden gefunden hat. Es gibt nur noch mich und den Paukenschlag. Und Stille.Plötzlich schreck ich auf, weil ich eine Ohrfeige bekomme. Ok, keine Ohrfeige, aber irgendwas ist passiert, damit ich aufwache. Mein Ge-sicht ist nass und Mischa steht mit einer Dose Bier über mir. Er hat sie mir ins Gesicht geleert. «Du bist weggedriftet, Bruder. Hier, trink
etwas, das bringt dich wieder runter...» Ich nehme zwei, drei grosse Schlücke. «Langsamer! In kleinen Rationen. Du bist dehydriert. Nicht zu schnell trinken...» Jonas sitzt neben mir am Boden, ebenfalls mit nassem Gesicht und einer Bierdose in der Hand. Er hat ein Stück von seinem Pullover abgebissen und zupft sich die Fusel von der Zunge. Mischa wippt nervös vom einen zum anderen Bein. Man merkt, dass er sich anstrengen muss, sich in seinem Zustand um jemanden zu kümmern. Mein Puls rast noch immer, aber ich fühle, wie das Bier zu wirken beginnt und mich erdet. Langsam realisier ich, wie er-bärmlich ich hier vor einem Club am Boden sitze, nass geschwitzt und zittrig wie ein Hund. Alle gucken. «Yalla! Weg hier!» fordere ich die beiden auf, erheb mich und will los. Ich nehme einen weiteren, grossen Schluck Bier. Und noch einen. Und noch einen. Und während ich trinke und wir den Heimweg antreten, beschleicht mich plötzlich eine fundamentale Leere. Ein schwarzes Loch: Ich will gar nicht run-ter kommen. Ich will wieder nüchtern bleiben. Das kann doch nicht schon der ganze Trip gewesen sein...Als wir zuhause ankommen, vom Bier leicht angetrunken und wie-der klar im Kopf, lassen Jonas und ich uns erschöpft auf Sofa fallen. Mischa aber bleibt stehen und guckt uns ernst an. «Freunde, könnt ihr mir hoch und heilig versprechen, dass das nicht zu Gewohnheit wird? Nüchtern sein ist gefährlicher als man denkt, ja?» Wir nicken und stimmen ihm zu, während wir uns innerlich schon auf nächste Wochenende freuen.
* Laurin Buser wohnt in Basel. Normalerweise steht er mit seinen
Texten auf der Bühne und im Studio. Er ist Slam Poet, Schauspieler und Rapper.
Wer mehr wissen will geht auf laurinbuser.ch. Für dieperspektive
schreibt er in jeder Ausgabe aus seinem Leben.
Text&Foto: * Laurin Buser
Kolumne Freunde des Lichts

Gib din Sänf däzue!Du füllst diese Zeitschrift! Bei dieperspektive hast du es in der Hand,was es zu Lesen gibt, welche Themen aufgegriffen und welche Bilder abgedruckt werden. dieperspektive ist eine lesergenerierte Zeitung. Das bedeutet, wenn dich ein Phänomen besonders beschäftigt, du über etwas Spezielles Bescheid weisst, oder einfach gerne Kurzgeschichten schreibst: Schicks uns an [email protected] - egal, wie verrückt es auch sein mag!
Wie kann ich für dieperspektive schreiben/illustrieren?Sende deinen Beitrag bis zum Redaktionsschluss an [email protected] oder lade ihn über die Webseite hoch. Als Dankeschön für eingesendete Beiträge bekommst du ein Halbjahresabonnement. Wird der Beitrag veröffentlichtbekommst du ein Jahresabonnement.Nächster Redaktionsschluss: 2. Januar, 23:55 Uhr
Zu welchen Themen kann ich schreiben?Pro Ausgabe gibt es ein Schwerpunktthema. Dein Beitrag hat erfahrungsgemäss die grössten Chancen, wenn er dieses Thema in irgendeiner Form behandelt. Es werden Jedoch auch Beiträge über andere Themenabgedruckt. Ausgewählt werden die Beiträge übrigens an der öffentlichen Redaktionssitzung. Dazu bist du herzlich eingeladen.Thema der nächsten Ausgabe: DAS BOOT IST VOLL
Wo finde ich dieperspektive regelmässig?Am einfachsten findest du dieperspektive in deinem Briefkasten. Für 30 Franken bekommst du ein Jahresabonnement. Du findest dieperspektive auch in Kaffees, Bars, Hochschulen und Läden. Die vollständige Liste findest du auf dieperspektive.ch. Jahresabonnement: SMS mit «hopp» und vollständige Adresse an 079 372 36 02.
AnlässeAls Abonnent von dieperspektive kannst du kostenlos an allen unseren Anlässen teilnehmen. Wir machen politische Diskussionen, Lesungen, Ausstellungen und vieles mehr.
OnlineIm Wilde World Web findest du uns auf: dieperspektive.ch, Facebook, Twitter, Issue
1
2
3
4
5
6
38
gib din däzuegib din däzue