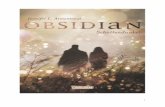Das Buch - bilder.buecher.de · Das Buch Frankreich in den Zwanzigerjahren. Simone Fleurier wächst...
Transcript of Das Buch - bilder.buecher.de · Das Buch Frankreich in den Zwanzigerjahren. Simone Fleurier wächst...
Das BuchFrankreich in den Zwanzigerjahren. Simone Fleurier wächstglücklich und behütet in der wunderschönen Provence auf.Nach dem tragischen Tod ihres Vaters schickt ihr herrischerOnkel sie nach Marseille, wo sie, gerade 14 Jahre alt, eineArbeit als Hausmagd in einer Pension annehmen muss. Dortlebt die schöne Camille Casal, eine Diva der Marseiller Va-rietébühnen. Simone ist verzaubert von ihr und der schil-lernden Theaterwelt und hat von nun an nur noch einenWunsch, auch eine berühmte Künstlerin zu werden. Sie er-trägt ein entbehrungsreiches und einsames Leben, um an ihrZiel zu kommen. Ihr Traum geht in Erfüllung, in Paris wirdsie als Sängerin und Tänzerin gefeiert, privates Glück aberbleibt ihr verwehrt. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrie-ges trifft sie eine außergewöhnliche und mutige Entschei-dung, die ihr Leben von Grund auf verändert und ihr Augenund Herz öffnet für die wahre Liebe.
Die AutorinBelinda Alexandra, Tochter einer russischen Mutter undeines australischen Vaters, lebte in vielen verschiedenen Län-dern und hat Kreatives Schreiben und Asienkunde studiert.Ihr Interesse und ihr Können setzte sie bereits in ihrem welt-weit erfolgreichen Debütroman Die weiße Gardenie, einergroßen Familiensaga, um und führt es mit diesem Buch wei-ter. Gegenwärtig lebt sie in Sydney und arbeitet an ihremdritten Roman.
Lieferbare TitelDie weiße Gardenie
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
BELINDA ALEXANDRA
Wilder LavendelRoman
Aus dem Englischen vonImke-Walsh-Araya
Die Originalausgabe WILD LAVENDER erschien 2004bei HARPER COLLINS PUBLISHERS Pty Ltd, Sydney
Umwelthinweis:Dieses Buch wurde auf chlor- undsäurefreiem Papier gedruckt.
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 04/2007Copyright © 2004 by Belinda AlexandraCopyright © 2006 der deutschen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHPrinted in Germany 2007Umschlagfotos: © Campiglio / getty images /© Martial Colomb / getty imagesUmschlaggestaltung: Nele Schütz Design, MünchenSatz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad AiblingDruck und Bindung: GGP Media GmbH, PößneckISBN: 978-3-453-40194-5
www.heyne.de
9
g 1G
Simone, der Lavendel wartet auf dich!«Tut! Tut!»Simone! Simone!«Ich weiß nicht, was mich weckte: die Hupe von Ber-
nards neuem Auto oder mein Vater, der in der Küchenach mir rief. Stirnrunzelnd hob ich den Kopf vom Kis-sen. Das ganze Zimmer roch nach versengter Baumwolle,und durch die offenen Fensterläden fiel die vor Hitze glei-ßende Morgensonne.
»Simone, der Lavendel wartet auf dich!«Die Stimme meines Vaters klang fröhlich – genau wie
Bernards Hupe. Als ich mich aufsetzte, sah ich durch dasFenster den braunen Tourenwagen mit geöffnetem Ver-deck an den Pinien vorbei über die Straße rollen. Bernardsaß mit strahlendem Lächeln am Steuer. Die Speichen derRäder passten zu dem leuchtenden Weiß seines Anzugsund seines Panama-Huts. Ob er seine Kleidung auf seineAutos abstimmte? Als im Vorjahr britische Wagen inMode gekommen waren, war er in einem schwarzen An-zug mit Melone erschienen. Er hielt im Hof neben der Gly-zinie und warf einen Blick über die Schulter. Unten auf derStraße rollte ein Leiterwagen heran. Der Kutscher hatteein dunkles Gesicht, und seine Passagiere waren tiefbraun.
Ich rollte mich aus dem Bett und suchte überall imZimmer nach meinem Arbeitskleid. Statt im Schrank zuhängen, quoll meine Kleidung aus den Schubladen derKommode oder lag unter dem Bett verstreut. Währendich mein Haar bürstete, überlegte ich, wo ich das Kleidgelassen haben mochte.
»Simone!«, rief mein Vater erneut. »Ich würde dich1922 gern noch sehen.«
»Bin schon unterwegs, Papa!«»Habe ich dich etwa geweckt, Dornröschen?«Ich lächelte, als ich ihn mir vorstellte, wie er mit einem
Becher Kaffee in der einen Hand und der Gabel mit einemStück Würstchen in der anderen am Küchentisch saß.Vermutlich hatte er den Spazierstock gegen sein Bein ge-lehnt und beobachtete mit dem gesunden Auge geduldigdie Treppe, auf der ich ja irgendwann erscheinen musste.
Das Kleid hing an der Tür, wo ich es am Vorabend ge-lassen hatte. Ich schlüpfte mit den Armen hinein, und esgelang mir, die Haken zu schließen, ohne dass sich meinlanges Haar darin verfing.
Bernards Hupe ertönte erneut. Mir kam es merkwür-dig vor, dass ihn niemand hereingebeten hatte. Als ichaus dem Fenster sah, stellte ich fest, dass nicht Bernarddie Hupe betätigte, sondern ein Junge mit runden Augen,der auf das Trittbrett geklettert war. Eine Frau mit Kopf-tuch zog ihn fort und schalt ihn, aber ihr Unmut war nurgespielt. Der Junge lächelte, und seine Mutter bedeckteseine Stirn mit Küssen. Die drei männlichen Passagiereluden Koffer und Taschen vom Leiterwagen. Der Größtevon ihnen nahm eine Gitarre herunter, deren Hals undKörper er so liebevoll hielt wie eine Mutter ihr Kind.
Onkel Gérôme, der sich seinen Arbeitshut über dasgraue Haar gezogen hatte, sprach mit dem Kutscher. Sowie sich sein Schnurrbart sträubte, ging es um Geld. Erdeutete auf den Wald, und der Fahrer zuckte die Achseln.Nach einigen Minuten des Gestikulierens nickte derFremde. Onkel Gérôme griff in die Tasche und holte ei-nen Beutel hervor, aus dem er dem anderen eine Münzenach der anderen in die Hand zählte. Zufrieden schüt-telte ihm der Kutscher die Hand und winkte den anderenzum Abschied, bevor er wieder auf seinen Wagen klet-terte und davonrollte. Onkel Gérôme holte ein Notiz-buch aus der Tasche und griff nach dem Stift hinter sei-nem Ohr, um den bezahlten Betrag fein säuberlich zuvermerken – in demselben Buch, in dem er auch die Be-träge notierte, die ihm mein Vater schuldete.
10
11
Ich küsste das Kruzifix neben der Tür und lief aus demZimmer. Erst als ich schon halb durch den Gang war, fielmir mein Glücksbringer ein. Ich eilte zurück in meinZimmer, holte das Lavendelsäckchen aus der Kommodeund ließ es in meiner Tasche verschwinden.
Mein Vater saß – Kaffeetasse und Würstchen in derHand – genau dort, wo ich es erwartet hatte. Neben ihmnippte Bernard an einem Glas Wein. Er hatte mit meinemVater im Krieg in den Schützengräben gekämpft. Die bei-den Männer, die sich unter anderen Umständen nie be-gegnet wären, waren die besten Freunde geworden. MeinVater hatte Bernard in unsere Familie aufgenommen,weil er wusste, dass sein Freund von seinen Angehörigenverstoßen worden war. Bernards blondes Haar kam mirnoch heller vor als bei seinem letzten Besuch. Er schnup-perte an seinem Wein, bevor er ihn trank, wie er an allemim Leben zuerst roch, bevor er es versuchte. Als er daserste Mal zu uns gekommen war, hatte ich ihn im Hof an-getroffen, wo er die Nase in den Wind hielt wie einHund. »Hör mal, Simone, gibt es unten am Hang bei denWacholdersträuchern einen Bach?« Er hatte Recht, ob-wohl die Wacholdersträucher von seinem Standpunktaus nicht zu sehen waren und der Bach nicht mehr als einRinnsal war.
Meine Mutter und Tante Yvette räumten geschäftig dieÜberreste des Frühstücks ab: Würstchen, Ziegenkäse, ge-kochte Eier und in Öl getränktes Brot. Tante Yvette hol-te ihre Brille aus der Schürzentasche, um zu sehen, ob esin dem Durcheinander auf dem Tisch etwas gab, das sichzu retten lohnte.
»Was ist mit mir?«, rief ich und schnappte mir einStück Brot, bevor meine Mutter den Teller abräumenkonnte. Sie lächelte mich an. Ihr schwarzes Haar trug sieauf dem Kopf zusammengesteckt. Mein Vater nannte sie»meine Señorita«, weil sie so dunkel war. Das hatte ichvon ihr geerbt. Meine Mutter war heller als die Arbeiterdraußen, aber viel dunkler als die Fleuriers, die, abgese-hen von mir, immer blond und blauäugig gewesen waren.
Mit ihren weißen Augenbrauen und der farblosen Hautstand Tante Yvette am anderen Ende der Farbskala. Diebeiden Frauen waren so unterschiedlich wie Salz undPfeffer.
Mein Vater streckte die Arme aus und spielte den Belei-digten. »Das Essen ist dir wohl wichtiger als die Männerin deinem Leben«, beschwerte er sich. Ich küsste ihn aufbeide Wangen und auf die Narbe, wo sich einst sein lin-kes Auge befunden hatte. Dann beugte ich mich vor undküsste Bernard.
»Vorsicht mit Bernards Anzug«, warnte Tante Yvette.»Kein Grund zur Vorsicht«, erwiderte Bernard. »Du
bist noch größer geworden, Simone«, meinte er, zu mirgewandt. »Wie alt bist du jetzt?«
»Nächsten Monat werde ich vierzehn.« Ich setzte michneben meinen Vater und warf mir das Haar über dieSchultern. Mutter und Tante lächelten sich an. Mein Va-ter schob mir seinen Teller zu.
»Ich habe mir heute Morgen zwei Portionen genom-men«, sagte er. »Eine für mich und eine für dich.«
Ich küsste ihn erneut.Auf dem Tisch stand eine Schale mit getrocknetem
Rosmarin, von dem ich mir auf mein Brot streute. »Wa-rum habt ihr mich nicht früher geweckt?«
Tante Yvette fuhr mir mit den Fingern über die Schul-tern. »Wir dachten, du brauchst deinen Schlaf.« IhrHandgelenk duftete nach Rosen, und ich wusste, dass sieeines der Parfüms ausprobiert hatte, die Bernard immeraus Grasse mitbrachte. Tante Yvette und Bernard verkör-perten den Einfluss der Zivilisation in unserem Leben.Obwohl Onkel Gérôme der reichste Bauer in der Gegendwar, hätten wir ohne die beiden nicht gewusst, was einBidet oder ein Croissant war.
Meine Mutter goss meinem Vater ein Glas Wein einund füllte Bernards halb volles Glas auf. Auf dem Wegzum Schrank warf sie einen Blick auf meine Espadrilles.»Bernard hat Recht«, stellte sie fest. »Du wächst soschnell! Wenn nächsten Monat der Schuhhändler
12
13
kommt, müssen wir dir richtige Stiefel kaufen. In denSchuhen fallen dir noch die Zehen ab.«
Wir lächelten beide. Im Gegensatz zu meiner Mutterbesaß ich nicht die Gabe, die Gedanken anderer zu lesen,aber wenn ich in ihr ruhiges Gesicht sah, das ebenso zu-rückhaltend wie stolz war, spürte ich stets ihre Liebe zumir, ihrem einzigen Kind.
»Nächstes Jahr wird sie mehr Schuhe haben, als siebrauchen kann«, versprach mein Vater und stieß mitBernard an.
Onkel Gérôme, der eben durch die Tür kam, hatte dieWorte meines Vaters gehört. »Nicht wenn wir nicht end-lich mit der Lavendelernte anfangen«, gab er zu beden-ken.
»Stimmt«, sagte Bernard und erhob sich. »Ich musslos. Heute Vormittag muss ich noch zwei andere Höfeaufsuchen.«
»Soll ich den Zigeunern was zu essen bringen?«, fragteich. »Vielleicht sind sie hungrig von der Reise.«
Mein Vater fuhr mir durch das Haar, das ich eben erstgebürstet hatte. »Das sind keine Zigeuner, Simone, son-dern Spanier. Und im Gegensatz zu dir sind sie Frühauf-steher. Die haben schon gegessen.«
Ich sah mich nach meiner Mutter um, die nickte. Trotz-dem ließ ich ein Stück Brot in meiner Tasche verschwin-den. Sie hatte mir nämlich verraten, dass das nach Mei-nung der Zigeuner Glück brachte.
Draußen warteten die Arbeiter mit ihren Sicheln undHarken. Tante Yvette band ihre Haube fest, rollte die Är-mel herunter und zog Handschuhe über, um sich vor derSonne zu schützen. Ihr Cockerspaniel Chocolat schlän-gelte sich durch das Gras, gefolgt von meinem getigertenKater Olly, von dem zwischen den hohen Halmen nur diegelbbraunen Ohren und der Schwanz zu sehen waren.
»Kommt her, Jungs!«, rief ich.Zwei Fellknäuel liefen auf mich zu. Olly rieb sich an
meinen Beinen. Ich hatte ihn als kleines Kätzchen aus ei-ner Vogelschlinge gerettet. Onkel Gérôme hatte mir er-
laubt, ihn zu behalten, allerdings nur unter der Voraus-setzung, dass er Mäuse fing und nicht gefüttert werdenmusste. Aber meine Eltern, meine Tante und ich gabenihm unter dem Tisch heimlich Käse und Fleisch, wenn erum unsere Füße strich. Daher war Olly rund wie eineMelone und kein großer Mäusefänger.
»Ich bin morgen zur Destillation wieder da, Pierre«,sagte Bernard zu meinem Vater. Er küsste meine Mutter,meine Tante und mich. »Viel Erfolg bei der Ernte«, sagteer, bevor er einstieg. Von meinem Onkel verabschiedeteer sich mit einem Winken, obwohl der nicht viel für un-seren Lavendelmakler übrig hatte. Kaum waren Bernardund sein Auto hinter den Mandelbäumen verschwunden,fing Onkel Gérôme an, Bernards tänzelnden Gang zuimitieren. Wir anderen ignorierten ihn. Schließlich warBernard mit meinem Vater auf dem Rücken durch Kugel-hagel und Schlamm zum Lazarett gelaufen, nachdem imSchützengraben eine Granate explodiert war, die den be-fehlshabenden Offizier getötet und im Umkreis von zehnMetern jedes Leben ausgelöscht hatte. Ohne BernardsFreundschaft mit meinem Vater hätten wir ohne einenSou dagestanden. Von Onkel Gérôme war nichts zu er-warten.
Als wir den schmalen Bach überquerten, lagen die La-vendelfelder wie ein lilafarbenes Meer vor uns. Direktvor der Ernte war die Pflanze am schönsten und roch amsüßesten. In der Sommerhitze war die schwere Essenz he-rangereift, und die Farbe war so intensiv wie nie zuvor.Aus den malvenfarbigen Zweigen des Frühlings hattensich Sträuße violetter Blüten entwickelt. Traurig dachteich daran, dass die Felder in wenigen Tagen nur noch vonStoppeln bedeckt sein würden.
Auf seinen Gehstock gestützt, wies mein Vater jedemArbeiter einen Abschnitt zu, während Onkel GérômeKarren und Maultier aufs Feld brachte. Jeder Arbeiter er-hielt von meinem Vater ein Tuch, das an den Ecken zu ei-ner Art Schürze verknotet wurde, in die die abgeschnitte-nen Stängel gesammelt wurden.
14
15
Der Junge ließ sich unter einem Baum nieder. Ich nahmOlly auf den Arm und rief Chocolat zu mir. »Willst du siestreicheln?«, fragte ich, als ich Olly neben ihm absetzte.
Er strich den beiden Tieren über den Kopf. Chocolatleckte ihm die Finger, und Olly legte sein Kinn auf seinenSchoß. Der Junge kicherte und lächelte mir zu. Ich deu-tete auf meine Brust und sagte »Simone«, aber entwederverstand er mich nicht, oder er war zu schüchtern, ummir seinen Namen zu verraten. Ich sah in seine großenAugen und beschloss, ihn Goya zu nennen, weil er mirsensibel wie ein Künstler vorkam.
Ich setzte mich neben ihn, und gemeinsam beobachte-ten wir, wie sich die Arbeiter auf den Feldern verteilten.Da ich kein Spanisch sprach und Goya daher nicht fragenkonnte, wie die Arbeiter hießen, gab ich ihnen die weni-gen spanischen Namen, die ich kannte. Den schlaksigenjungen Mann nannte ich Rafael. Er hatte ein starkesKinn, gerade Brauen und gute Zähne. Abgesehen davon,dass er gut aussah, stolzierte er herum, als wüsste er allesüber die Lavendelernte. Dennoch sah er sich insgeheimimmer wieder nach der Frau um, der ich den NamenRosa gegeben hatte, und machte ihre Bewegungen nach.Den stämmigen Mann nannte ich Fernandez. Er hätteOnkel Gérômes Zwillingsbruder sein können. BeideMänner stürzten sich auf die Lavendelsträucher wie einStier auf den Matador. Der dritte Spanier war Goyas Va-ter, ein sanfter Riese, der seines eigenen Weges ging undohne Aufhebens seine Arbeit tat. Er war der Mann, derdie Gitarre so liebevoll gehalten hatte. Ich nannte ihnJosé.
Tante Yvette kam aus dem Lavendel auf uns zu. »Wirfangen besser mit dem Kochen an«, sagte sie zu mir.
Ich stand auf und bürstete mir das Gras vom Kleid.»Meinst du, er will mitkommen?«, fragte ich und deuteteauf Goya. Chocolat hatte sich an die Schulter des Jungengeschmiegt, und Olly schlief auf seinem Schoß. Goyastarrte auf die platinfarbenen Strähnen, die unter demHut meiner Tante hervorsahen. Ich war so an ihren An-
blick gewöhnt, dass ich vergessen hatte, wie ungewöhn-lich der Anblick eines Albinos war.
»Er hält dich für eine Fee«, sagte ich.Tante Yvette lächelte Goya zu und tätschelte ihm den
Kopf. »Er scheint sich hier wohl zu fühlen, und seineMutter möchte ihn bestimmt im Auge behalten.«
Das Abendessen nahmen wir im Hof zwischen unserenbeiden Bauernhäusern ein, wo wir bis nach Einbruch derDunkelheit sitzen blieben. Die Luft war schwer vom Öldes Lavendels, das ich beim Schlucken hinten in der Keh-le schmeckte.
Meine Mutter nähte im Licht einer Sturmlaterne an ei-nem Hemd meines Vaters. Aus unerfindlichen Gründenverwendete sie bei allen Flickarbeiten roten Faden, als wä-ren die Risse Wunden im Stoff. Ihre Hände waren völligzerschnitten, aber die Erntearbeiter schenkten kleinerenVerletzungen keine Beachtung. Das ätherische Öl wirktewie ein natürliches Desinfektionsmittel. Schnittwundenheilten binnen weniger Tage.
Tante Yvette las mit mir Victor Hugos Die Elenden.Nach der Erweiterung der Eisenbahnlinie waren vieleMenschen in die Stadt abgewandert. Daraufhin war vorzwei Jahren die Dorfschule geschlossen worden, und hättesich meine Tante nicht meiner Erziehung angenommen,wäre ich vielleicht so ungebildet geblieben wie der Restmeiner Familie. Onkel Gérôme fand sich in Rechnungs-büchern und Düngeanleitungen zurecht, aber meine Mut-ter war Analphabetin, obwohl sie von Kräutern undPflanzen mehr verstand als mancher Apotheker. Nur meinVater las die Zeitung.
»›Die Betrunkenen sangen noch immer ihr Lied‹«, lasich laut vor, »›und auch das Kind unter dem Tisch sangdas seine.‹«
»Bof!«, spottete Onkel Gérôme, der mit einer Messer-klinge in seinen Zähnen herumstocherte. »Nur wer denganzen Tag auf der faulen Haut liegt, kann es sich leisten,unnütze Bücher zu lesen.«
16
17
Die Hände meiner Mutter hielten in der Bewegunginne, und unsere Blicke begegneten sich. Die Muskeln anihrem Hals spannten sich. Meine Tante und ich beugtenuns zu ihr, griffen nach dem Stoff und studierten ihn an-gelegentlich. Obwohl keine von uns Onkel Gérôme ge-wachsen war, kamen wir uns stets gegenseitig zu Hilfe,wenn er eine von uns verhöhnte. Tante Yvette konnte we-gen ihrer Haut nicht auf dem Feld arbeiten. Eine Stundein der südlichen Sonne hätte ihr Verbrennungen drittenGrades eingebracht. Sie stammte aus Sault, und die aber-gläubische Furcht vor Albinos war für mich der einzig er-kennbare Grund, warum ihre Familie diese intelligente,attraktive Frau an jemanden wie Onkel Gérôme verhei-ratet hatte. Er war nicht dumm und wusste genau, dasssie als Köchin und Haushälterin ihre Unfähigkeit, aufdem Feld zu helfen, mehr als ausglich, aber ich hatte niegehört, dass er sie dafür lobte. Ich selbst war für die Ern-tearbeit völlig ungeeignet. Mein Spitzname war »Fla-mingo«, weil meine dünnen Beine doppelt so lang warenwie mein Oberkörper. Selbst mein Vater mit seinem einenAuge und dem lahmen Bein erntete ein Feld schneller abals ich.
Aus der Scheune hörte ich Gelächter. Ich fragte mich,wieso die Spanier nach der harten Arbeit des Tages nochso munter waren. Auf der anderen Seite des Hofes er-klang Gitarrenmusik, und ich stellte mir vor, wie José mitleidenschaftlichem Blick die Saiten zupfte. Die anderenklatschten den Rhythmus und sangen klagende Lieder,die mich an Flamenco-Musik erinnerten.
Tante Yvette sah auf, wandte sich aber sogleich wiederihrem Roman zu. Onkel Gérôme griff nach einer Deckeund legte sie sich um den Kopf, um seiner MissbilligungAusdruck zu verleihen. Mein Vater starrte gedankenver-loren zum Himmel hinauf, und meine Mutter blickte un-verwandt auf ihre Handarbeit, als wäre sie taub für dieMusik. Oberhalb der Taille hielt sie sich steif wie eineStatue, aber unter dem Tisch sah ich, dass sie aus denSchuhen geschlüpft war und mit einem Fuß einen sinnli-
chen Tanzrhythmus klopfte. Das trügerische Bild rief mireinmal mehr das geheimnisvolle Wesen meiner Mutterins Gedächtnis.
Während auf dem Kaminsims Fotos von Großvaterund Großmutter Fleurier standen, war im ganzen Hauskein Bild meiner Großeltern mütterlicherseits zu entde-cken. Als ich klein war, hatte meine Mutter mir die Hüt-te am Fuß eines Hügels gezeigt, in der sie gelebt hatten.Später wurde der schlichte Stein- und Holzbau von einemWaldbrand zerstört, der, vom unbarmherzigen Mistralgepeitscht, durch die Schlucht raste. Florette, die Posthal-terin des Dorfes, erzählte mir, dass meine Großmutter fürihre Heilmittel berühmt war, sodass sich selbst die Fraudes Bürgermeisters und der alte curé an sie wandten,wenn herkömmliche Medizin und Gebete versagten. Siesagte, meine Großeltern, die damals bereits in mittlerenJahren standen, seien eines Tages mit meiner Mutter imDorf aufgetaucht. Das entzückende kleine Mädchen, dassie Marguerite nannten, war drei Jahre alt, als die Dörf-ler es zum ersten Mal zu Gesicht bekamen. Obwohl dasPaar schwor, die Kleine sei ihre leibliche Tochter, hieltenviele meine Mutter für ein ausgesetztes Zigeunerkind.
Ihre geheimnisumwitterte Herkunft und die Gerüchteum ihre Heilkünste galten im streng katholischen Haus-halt der Fleuriers, die der Heirat ihres Lieblingssohnes ih-ren Segen versagten, nicht gerade als Empfehlung. Dochselbst sie konnten nicht bestreiten, dass meine Muttermeinen Vater gesund gepflegt hatte, als ihn sämtliche Ar-meeärzte bereits aufgegeben hatten.
Die Spanier sangen noch lange, nachdem wir ins Hausgegangen waren. Ich lag wach und sah zu den Dachbal-ken hinauf, während mir der Schweiß über die Rippen-bögen lief. Das durch die Zypressen fallende Mondlichtwarf wellenförmige Schatten an die Wand. In meinerFantasie verwandelten sie sich in Tänzer, die sich zu sinn-lichen Rhythmen wiegten.
Wahrscheinlich schlief ich doch ein, denn als ich michruckartig aufsetzte, war die Musik verstummt, und Cho-
18
19
colat bellte. Ich schlüpfte aus dem Bett und sah durch dasFenster in den Hof. Eine kühle Brise war aufgekommen,und silbernes Mondlicht ergoss sich über Dächer und Ge-bäude. Verwirrt blinzelnd, entdeckte ich vor der Wandam Ende des Gartens eine Gruppe von Tänzern. Sie be-wegten sich schweigend, ohne Musik oder Gesang, mitüber den Kopf erhobenen Armen. Ihre Füße stampften zueinem unhörbaren Rhythmus. Ich spähte in die Nacht hi-naus und erkannte José, der mit Goya auf den Schulterntanzte. Die weißen Zähne des Jungen blitzten in seinemdunklen Gesicht. Meine Füße zuckten. Am liebsten wäreich nach unten gelaufen und hätte mich der Gruppe ange-schlossen. Ich griff nach dem Fensterrahmen. Woherwusste ich, dass es nicht böse Geister waren, die mich ineine tödliche Falle locken wollten? Die alten Frauen imDorf kannten viele solcher Geschichten.
Mein Herzschlag stockte.Außer Goya waren es fünf Tänzer: drei Männer und
zwei Frauen. Mir blieb der Mund offen stehen, als ichdas lange dunkle Haar und die feinen Glieder der zweitenFrau sah. Feuer loderte unter ihrer Haut, und wo ihreFüße den Boden berührten, sprühten Funken. Ihr Kleidumhüllte ihre Gestalt wie flüssige Seide. Meine Mutter.Ich öffnete den Mund, um nach ihr zu rufen, taumelteaber von Müdigkeit überwältigt zum Bett zurück.
Als ich die Augen öffnete, fiel das erste Licht des Mor-gens durch das Fenster. Meine Kehle war wie ausgedörrt.Ich presste die Handflächen gegen mein Gesicht. Ob ichnur geträumt hatte?
Ich schlüpfte in mein Kleid, ging auf Zehenspitzen dieTreppe hinunter und schlich am Zimmer meiner Elternvorbei, die beide noch schliefen. Meine Mutter hatte mirzwar nicht ihre hellseherischen Fähigkeiten vererbt, aberich besaß ihre Neugier. Ich schlich mich zu der Wand amEnde des Gartens, wo die Mandelbäume standen. Dashohe Sommergras schien unberührt. Ich suchte Bäumeund Pflanzen nach Spuren der nächtlichen Tänzer ab,fand aber keine. Keine zu Kreuzen gebundenen Zweige,
keine Knochenfragmente, keine heiligen Steine. Nichtsdeutete darauf hin, dass hier Magie am Werk gewesenwar. Ich zuckte die Achseln und wandte mich ab, als ichplötzlich aus dem Augenwinkel etwas sah. Ich streckte dieHand aus und berührte den unteren Zweig eines Baumes.Über einem der Blätter hing ein einzelner roter Faden.
Die helle Haut meiner Tante und meine langen Beine wa-ren bei der Destillation kein Hindernis. Mit vor Anstren-gung verzerrten Gesichtern zerrten mein Vater und OnkelGérôme eine dampfende Rolle zusammengepresster La-vendelstängel aus der Destillationsanlage, die meineMutter und ich sofort mit Mistgabeln zerteilten. Wirbreiteten die Stängel auf Matten aus, die wir zum Trock-nen nach draußen in die Sonne zogen.
»Wir dürfen keine Zeit verlieren«, sagte mein Vater zuuns. »Mit der neuen Presse können wir das Stroh alsBrennstoff verwenden.«
Meine Mutter und ich wendeten den geernteten Laven-del, damit er nicht anfing zu gären, während Tante Yvetteden Männern dabei half, die Destillationsanlage neu zubefüllen. Als es so weit war, sagte mein Vater, ich solle inden Behälter klettern und dort herumspringen, um denLavendel zu verdichten. Das brachte angeblich Glück.
»Viel wird es bei solch einem Fliegengewicht nicht nüt-zen«, nörgelte Onkel Gérôme, streckte aber die Armeaus, um mir hineinzuhelfen. »Vorsicht!«, warnte er. »DieSeitenwände sind glühend heiß.«
Es heißt, Lavendel hebt die Stimmung. Ich fragte mich,ob der köstliche Duft, der die Luft erfüllte, selbst OnkelGérôme milder gestimmt hatte.
Ohne mich um die Kratzer an meinen Beinen und dieHitze zu kümmern, stapfte ich auf dem Lavendel herum.Wenn Ernte und Destillation des Lavendels verliefen, wiemein Vater und Bernard es geplant hatten, würde meinVater seinen Anteil am Hof zurückkaufen können. JedesMal, wenn ich den Fuß senkte, stellte ich mir vor, dass ichihn damit seinem Traum einen Schritt näher brachte.
20
21
Nachdem mir Onkel Gérôme aus der Presse geholfenund den Deckel abgedichtet hatte, kletterte mein Vaterins untere Stockwerk hinunter, um dort das Feuer zuschüren. »Ich sehe schon an der ersten Füllung, dass dasÖl gut ist«, verkündete er bei seiner Rückkehr strahlend.
Onkel Gérôme rieb sich den Schnurrbart. »Gut odernicht, wir werden sehen, ob es sich verkauft.«
Um die Mittagszeit, nach der vierten Füllung, ordnetemein Vater eine Pause an. Wir legten uns ins feuchteStroh oder hockten uns erschöpft auf den Boden. MeineMutter tauchte Stofftücher in Wasser, die wir auf unserebrennenden Gesichter und Handflächen pressten.
Ein Auto fuhr in den Hof, und wir gingen nach drau-ßen, um Bernard zu begrüßen. Auf dem Beifahrersitz saßMonsieur Poulet, der Bürgermeister des Dorfes und Wirtdes Gasthauses. Im Fond hatten Monsieur PouletsSchwester Odile und ihr Ehemann Jules Fournier Platzgenommen.
»Bonjour, bonjour!«, rief Monsieur Poulet, als er aus-stieg. Er fuhr sich mit einem Taschentuch über das Ge-sicht. Sein schwarzer Anzug, der offiziellen Anlässen vor-behalten blieb, war ihm eine Nummer zu klein undzwickte an den Schultern, sodass er aussah wie ein Hemdauf der Wäscheleine.
Die Fourniers stiegen ebenfalls aus, und alle gingen indie Destillerie. Die Neuankömmlinge betrachteten prü-fend die Destillationsanlage, die viel größer war als dieAnlagen, die traditionell in dieser Gegend verwendetwurden. Obwohl selbst keine Bauern, waren sie daran in-teressiert, dass wir erfolgreich waren. Angesichts derstarken Landflucht im Pays de Sault hofften sie, der La-vendel würde unserem Dorf den wirtschaftlichen Auf-schwung bringen.
»Ich hole eine Flasche Wein«, sagte Tante Yvette undwandte sich dem Haus zu. Bernard wollte ihr mit denGläsern helfen. Ich sah den beiden nach, wie sie auf demWeg die Köpfe zusammensteckten. Tante Yvette lachteüber etwas, das Bernard gesagt hatte. Mein Vater hatte
mir erklärt, Bernard sei ein lieber Mensch, der sich nichtfür Frauen interessiere wie andere Männer, aber er warso nett zu Tante Yvette, dass ich mich manchmal fragte,ob er nicht in sie verliebt war. Ich warf einen Blick aufOnkel Gérôme. Der war jedoch vollauf damit beschäf-tigt, mit der neuen Anlage zu prahlen.
»Solche Destillationsanlagen werden von den großenParfümfabriken in Grasse verwendet«, erklärte er, »weilsie wesentlich effizienter arbeiten als die transportablenAnlagen, die wir bisher eingesetzt haben.«
So wie er redete, hätte man denken können, die neueAnlage wäre seine Idee gewesen. Dabei war er nur der Fi-nancier, nicht der Visionär. Da er das Geld für die teureAnlage vorgestreckt hatte, stand ihm die Hälfte des Ge-winns zu. Doch mein Vater und Bernard hatten ausge-rechnet, dass drei gute Lavendelernten in Folge ausrei-chen würden, damit sich die Investition innerhalb vonzwei Jahren amortisierte. Um seinen Anteil am Hof zu-rückzukaufen, würde mein Vater drei weitere Jahre benö-tigen.
Odile Fournier stellte sich neben mich und schnup-perte. »Das Öl riecht gut«, flüsterte sie mir zu. »Ich hof-fe, es macht uns alle reich, und dein Vater kann seineSchulden bezahlen.«
Ich nickte, erwiderte aber nichts. Die schändliche Lagemeiner Familie war mir nur allzu bewusst. Beim Tod mei-nes Großvaters war das Land zwischen beiden Brüdernaufgeteilt worden. Während mein Vater im Krieg war,lieh Onkel Gérôme meiner Mutter Geld, um den Hof amLaufen zu halten. Doch als mein Vater als Krüppel zu-rückkehrte und seine magere Kriegsrente nicht aus-reichte, um die Schulden zu begleichen, verlangte OnkelGérôme den Anteil meines Vaters am Hof. Nach der Ge-nesung meines Vaters bot mein Onkel ihm an, seinen Hofin jährlichen Raten zuzüglich Zinsen zurückzukaufen.Sein Verhalten war schändlich für einen Verwandten, wouns doch selbst die ärmsten Dörfler Körbe mit Gemüsevor die Tür gestellt hatten, solange mein Vater krank
22