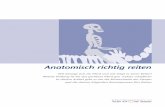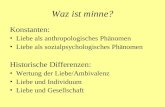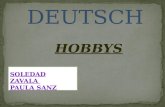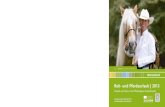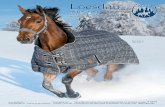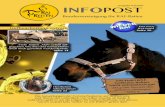Therapeutisches Reiten Das Pferd in Medizin, Pädagogik und Sport.
Die Ambivalenz Reiten
-
Upload
bergrottland -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Die Ambivalenz Reiten

Die Ambivalenz reiten
Der Konferenz – Reader 'Existenzgeld, Kontroversen und Positionen' ist erschienen.1
von Andreas Donat 09/00
"Ja, Zuckererbsen für jedermann"H.H.
'Theorielos' nannte Karl Heinz Roth das Konzept Existenzgeld (jungle world, 30.09.98) – jetzt füllen die Debattenbeiträge einen ganzen Band. Dieser versammelt nicht nur zahlreiche Beiträge, die um die Existenzgeld - Konferenz (Berlin 18. bis 21. März 1999) herum entstanden sind, sondern dokumentiert zudem Forderungspapiere von Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen (BAG–Erwerbslose, BAG-SHI). Der Band ermöglicht einen guten Überblick über die Auseinandersetzungen der letzten Zeit zum Konferenzthema. Dass auch sich kritisch zum Existenzgeld positionierende Beiträge aufgenommen wurden – wie die Herausgeber ausdrücklich betonen – ist besonders erfreulich. Gerade hier finden sich dann auch die theoretisch gehaltvolleren Beiträge. Nachgedruckte Texte von Joachim Hirsch und André Gorz sowie ein Interview mit Michael Opielka, einem der grünen Vordenker der Grundsicherung, liefern einen weiteren theoretischen Bezugsrahmen.2 Beiträge zu den Existenzgeldauseinandersetzungen aus anderen europäischen Ländern runden den Band ab.3
Mit der Existenzgelddebatte (die auch in den Publikationen Arranca!, ak oder express zu verfolgen war) wurde – erstaunlich für postmoderne Zeiten – die 'soziale Frage' von der politischen Linken wiederentdeckt.4 Deren strukturalistischer Weg zu Luhmann schien damit eine linke Abbiegespur bekommen zu haben. Die Existenzgeld-Kampagne mit ihren unterschiedlichen Politikvorstellungen ist inzwischen abgeebbt, die Auseinandersetzung darüber, was linke Politik sein könnte, geht jedoch weiter.
Der größte Teil des Bandes besteht aus Beiträgen zur Konferenz, die wohl auch die Positionen der verschiedenen Initiativen (z.B. FelS, FALZ , Blauer Montag) repräsentieren. Beiträge mit einer skeptischen bis kritischen Einstellung zur Existenzgeld–Kampagne überwiegen. Thema ist durchgängig die Frage der Abgrenzung der Existenzgeldforderung zu bürgerlichen Grundsicherungsmodellen. Diskutiert wird dabei, was die Linksradikalität der Forderung ausmache. Dies heißt zugleich zu bestimmen, was die Forderung innerhalb der Kampagne bedeutet. Den Vertretern eines - vom Selbstverständnis her - nichtreformistischen Ansatzes, die sich positiv auf die Existenzgeldforderung beziehen, ist Existenzgeld dabei nur sozialpolitisches Mittel zum Zweck. Es ist entweder:- reformistisches Projekt, das jedoch die Basis für weitere Kämpfe verbessert, oder:- Utopie – eine Art Politslogan - über die sich erfolgreich mobilisieren lässt. Erfolgreicher, so die Intention
einiger Existenzgeld-Aktivisten, als würde direkt mit dem abgefrühstückten Revolutionskram losgelegt.Wollen die einen das Existenzgeld als solches tatsächlich umsetzen und sehen dafür auch realpolitische Möglichkeiten, geht es den anderen gar nicht um eine umzusetzende Reform. In beiden Varianten wird bestenfalls nur eine Neuauflage der Verteilungsdebatte abgeliefert, womit auch die politischen Referenzpunkte abgesteckt sind.
Im Vorwort schreiben die Herausgeber: "Zwar bleibt für Theorie die Praxis das bestimmende Moment - schließlich geht es um 'das Zusammenfallen des Ändern[s] der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung [...] als revolutionäre Praxis' (MEW Bd. 3, S. 6) -, was nur bedeutet, dass sich die eine ohne die andere nicht verwirklichen kann. Gerade aus diesem Grunde erinnert uns Lenin: 'Ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Bewegung.' (LW 5, 379)" (S. 8). Wenn in der Tat Veränderung der Umstände und Selbstveränderung zusammenfallen – wie Marx hier in seiner kritischen Auseinandersetzung mit Feuerbach skizziert – wieso ist dann die Praxis das "bestimmende Moment"? Das Marx-Zitat widerspricht fundamental nicht nur der Einschätzung der Autoren, sondern auch ihrem politischen Gewährsmann Lenin: Theorie war für ihn Anleitung.
1 Krebs, Hans Peter/Harald Rein (Hg): Existenzgeld, Münster, Westfälisches Dampfboot, 2000. 255 Seiten, 34 DM2 Das Interview mit Michael Opielka gerät etwas daneben, weil es den Interviewern ganz offensichtlich an kritischer Distanz zur Existenzgeldforderung mangelt. Weder finden sich hier kritische Fragen zur Rolle der Grundsicherung im Politikverständnis der Grünen, noch die entscheidenden Fragen zu Opielkas genauer Vorstellung der 'Knackpunkte' der Existenzgeld-Forderung: Höhe, Arbeitsverpflichtung etc. In Biolekscher Manier präsentieren die Frager Opielka als Existenzgeld–Vorkämpfer.3 Über die Vorgänge und die Erfahrungen aus Frankreich, wo sich eine ganz andere Dynamik sozialer Auseinandersetzung entwickelt hat, ist jedoch leider nur wenig zu erfahren.4 Kritisch dazu: Andreas Donat: Radikale ExistenzgeldreformistInnen, in: Widersprüche Nr.73, 9/99

Der einleitende Beitrag von Herald Rein zur Geschichte der Existenzgeldforderung stellt etwas einseitig einen bestimmten Debattenstrang dar, jenen nämlich, den er als Vorläufer der 'wirklichen', linken Existenzgeldforderung begreift. Die explizit bürgerliche Grundsicherungsforderung findet hier keine Beachtung, ältere 'linke' Debatten wie die um den 'politischen Lohn' werden lediglich erwähnt. Andere Beiträge haben hier wesentlich mehr Historisches zu bieten: vor allem der von Christian Brütt (S. 51-69), der die Bürgergeld- und Grundsicherungsdebatte nochmals Revue passieren lässt, aber auch der Wildcat-Beitrag (S. 106-115), der ausführlicher auf die Debatten der 70er Jahre Bezug nimmt.Die vielzitierte Ambivalenz der Existenzgeldforderung wird von Rein als "das der Existenzgeldforderung innewohnende dialektische Verhältnis" bezeichnet. 'Dialektisch' bedeutet für Rein: "Einerseits die mögliche Entkoppelung von Arbeit und Einkommen sowie die Gleichwertigkeit von Lohn- und Haus-/Reproduktionsarbeit unter dem Blickwinkel der revolutionären Umwälzung der Gesellschaft voranzutreiben und andererseits die Forderung 'als praktische Aneignungsbewegung' zu verstehen." (S. 17). Bedeutet diese 'Dialektik' ein einerseits von realer Politik in revolutionärer Absicht – vielleicht im Sinne von Hirschs Radikalem Reformismus, auf den sich Rein bezieht (vgl. S. 26) – und selbständiger Bewegung andererseits? Das politische Dilemma ist hiermit trefflich beschrieben. Einerseits bewirkt das Existenzgeld die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen nur für die ExistenzgeldbezieherInnen und bleibt Ausdruck der Zweitklassigkeit von Nicht–Lohnarbeit. Andererseits lässt Reins Formulierung offen, wie eine "Forderung" als "Aneignungsbewegung" (zudem noch als praktische) verstanden werden kann. Gibt es nun eine Bewegung mit einer entsprechenden Forderung – was auch von allen BefürworterInnen der Existenzgeldkampagne bedauernd bestritten wird – oder wird sich hier eine Forderung ausgedacht, zu der sich dann eine Bewegung erst noch finden müsste? Und die Ambivalenz geht weiter: Die "13 Thesen gegen falsche Bescheidenheit und das Schweigen der Ausgegrenzten", die die BAG Erwerbslose 1992 verabschiedet haben, verdeutlichten "in ihrem Kern, dass unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen die Verwirklichung eines Existenzgeldes unmöglich ist". Mit ihnen werde aber zugleich gezeigt, dass "die materielle Voraussetzung für eine existentielle Absicherung für alle vorhanden ist" (S. 20). Bei so viel Ambivalenz oder auch trotz dieser sollte jedoch auch die Frage erlaubt sein: Wenn eine politische Forderung "unmöglich" zu verwirklichen, bzw. "nicht realisierbar" (S. 30) ist – was soll sie dann? Und damit sind wir an einer zentralen Stelle der Debatte.Rein wirft den KritikerInnen der Existenzgeldforderung Unwissen in Bezug auf die wirkliche Existenzgeldforderung, wie sie von den Erwerbsloseninitiativen aufgestellt wurde, vor. Diese habe nichts mit bürgerlichen Grundsicherungsmodellen zu tun.5 Er betont die wesentlichen Essentials dieser 'radikalen' Variante: "wirkliche Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum", für alle in Deutschland Lebenden ohne Zwang zur Arbeit (S. 24). Hier macht es sich der Autor zu einfach. Als realpolitische Forderung verstanden unterscheidet sich das Existenzgeld zunächst nur durch die einseitige Betonung des Rechtscharakters der Grundsicherung im Unterschied zum Pflichtcharakter und die dezidierte Ablehnung einer Anbindung dieser an eine Arbeitsverpflichtung (vgl. S. 110) sowie durch die um ein paar Mark höheren Bezüge. Wird die Forderung jedoch nur als geschickter Aufmacher einer politischen Kampagne verstanden, der den 'Massen' ein größeres Stück vom Kuchen in Aussicht stellt, geht es also nurmehr um politische Taktik, dann besteht in dieser Hinsicht kein großer Unterschied mehr zu bürgerlichen Politikmodellen überhaupt.Die von Rein aufgelisteten Kritikpunkte an der Existenzgeldforderung sind, sie sei: reformistisch, staatsorientiert, losgelöst von 'realen Kämpfen', und es mangele an einer "grundsätzlichen Kritik an der Lohnarbeit" (S. 26). Entkräftet werden sie nicht.Wo es dialektisch zugeht ist auch der Widerspruch nicht weit. Er präsentiert sich den LeserInnen als ein "genereller Widerspruch in der Begründung zum Existenzgeld" und "besteht darin, dass zwar die Unmöglichkeit der Verwirklichung der Existenzgeldforderung unter den gegebenen Verhältnissen erklärt wird, Existenzgeld als Sockelung [...] aber gleichzeitig reale Züge erhält" (S. 27). In der Tat ein Widerspruch, der entsteht, wenn versucht wird, revolutionären Inhalt in (real-)politische Formen zu packen. Diesen aufzulösen genügt vielen ein Wort (“Radikaler Reformismus”), gewürzt mit einem gutgemeinten Schuss sowohlalsauch – die Mischung muss eben stimmen. Die Existenzgeld-Rezepte der politischen Linken stellten - so Rein - einen "perspektivischen Weg hin zu einer anderen Gesellschaft [...] mit der Absicht der eigenen Überflüssigmachung" (S. 30) dar. Und Tschüss! Mit Reformismus habe das nichts zu tun, "da Existenzgeld als systemsprengende Forderung insbesondere für eine nachkapitalistische Zeit gemeint ist" (S. 27). Sprengt die Forderung dann die nachkapitalistische Gesellschaft, oder ist die befreite Gesellschaft die, in der wir uns mit Existenzgeldzahlungen zufrieden geben müssen? Hoffentlich verliert diese Linke auf ihrem perspektivischen Weg die eigene Überflüssigmachung nicht aus den Augen.
5 Martin Rheinländer zitiert in seinem Beitrag einen Genossen von FelS: "Aber wir wollen ja nicht diese Grundsicherung, wie sie in der sozialpolitischen Re-Regulierungsdiskussion zur Debatte steht! Existenzgeld ist ja etwas ganz anderes!" (S. 99)

Die Sozial-AG von FelS meint: "Revolutionäre Diskurse, die steril bleiben, weil sie niemanden mobilisieren, sind objektiv betrachtet überhaupt nicht radikal. Dann doch lieber Lenin: Mit 'Land, Frieden, Brot!' eine Gesellschaft in Bewegung bringen." Gottseidank haben wir die objektiven LeninistInnen von FelS. Ohne sie wäre uns nie in den Sinn gekommen, dass die Existenzgeldforderung "natürlich" reformistisch ist, "aber man [...] anhand ihrer die Legitimität des herrschenden Verteilungs- und Arbeitsmodells angreifen" kann (S. 39). Möglich wird dies vor allem auch durch die – leninistisch gesprochen – tolle Entwicklung der Produktivkräfte, denn: "Inzwischen ist jedoch aufgrund der technologischen Entwicklung immer weniger Arbeit nötig" (S. 39). Ein "Hoch" auf die Technik: jede Menge Kohle ohne Arbeit, sie muss nur noch umverteilt werden.Der Affekt der Existenzgeld–Kampagneros gegen die 'radikale Kritik' ist ein weiteres Kennzeichen der Debatte. Reformismus wie Antiintellektualismus beginnen dabei immer wieder mit der Denunziation radikaler Kritik als 'über allem anderen stehend' (Zelig), als 'Treffen der Evangelisten' (FelS, S. 39), 'objektiv nicht radikal' (s.o.) etc. Früher hat an solchen Stellen nie der Verweis auf die RAF gefehlt – das innerlinke 'geh' doch rüber' – Argument für realpolitische Anschlussfähigkeit.
Raul Zelig stellt sich etwas distanzierter zur Existenzgeldforderung. Er verweist in seinem Beitrag darauf, dass die "Ausgrenzung aus der Arbeitswelt" positiv gewendet und eine rückwärtsgewandte "moralische Ökonomie" als Ausweg präsentiert wird (S. 46). Von der Utopie zum romantischen Antikapitalismus ist – dies deutet Zelig damit an - der Weg nicht weit.
Christian Brütt versucht die Koordinaten der Existenzgeldforderung festzustellen und findet, dass diese sich "je nach Interesse" von einer sozialrevolutionären zu einer neoliberalen wandele (S. 51). Er bestimmt wesentliche Ausgangspunkte der Existenzgeldkampagne, indem er die Entwicklung der Sozialhilfe und das Aufkommen der Grundsicherungskonzepte in der sozialpolitischen Debatte nachzeichnet. Gerade auch die neoliberalen Grundsicherungsmodelle und deren Begründungsstrategien finden hierbei Beachtung. Brütt kritisiert die These vom 'Ende der Arbeitsgesellschaft' als eine unhinterfragte Grundannahme der Existenzgeldforderung. Sie 'vernebele' (S. 51) mehr als sie erkläre. Allein das fordistische Lohnarbeitsverhältnis 'brösele'. Vor dem Hintergrund von Brütts Überlegungen lässt sich nochmals präzisier fragen, wann und unter welchen Bedingungen sozialpolitische Forderungen bzw. die Forderung nach Existenzgeld in ihrem Charakter sozialrevolutionär oder neoliberal werden können. Eine zweite Frage, die sich hier anschließen würde, ist die nach dem fordistischen Lohnarbeitsverhältnis selbst. Wann gab es das mit Vollbeschäftigung, Sozialleistungen etc.? Ist dies nicht genauso eine Konstruktion der politischen Ökonomie (einschließlich der 'linken' politischen Ökonomie) wie die Ideologie vom Ende der Arbeitsgesellschaft? Letztere ist von ihrer Intention her reaktionär, wird jedoch unhinterfragt von Teilen der Linken übernommen.6 Obwohl Brütt die Forderung als eine thematische Klammer für linke Politik gutheißt, bleibt auch sein Blick auf das Existenzgeld skeptisch.
Hans Peter Krebs hingegen verkündet linken Populismus: "Wenn die Linke [...] eine praktische Politik etablieren will [...] muss sie einerseits an den dringendsten Bedürfnissen der breiten Bevölkerung heute ansetzen, andererseits muss sie aber auch eine Idee künftiger Gesellschaft, eine positive Utopie [...] in Umrissen zeichnen. " (S. 74). Und wenn es dann um solche Perspektiven geht: Nicht das Wort eines deutschen Kanzlers vergessen, dass es nicht genügt, den Menschen ein Leitbild zu geben, sondern dass es auch gelingen muss, ihnen darin ein Licht anzuzünden! Wie traditionalistisch sozialdemokratisch die Existenzgeldforderung daher kommen kann zeigt uns Krebs, für den Existenzgeld "in den Status eines Bürgerrechtes erhoben werden" müsse, deutlich, denn darüber hinaus geht es ihm vor allem um die Umverteilung von Arbeit und Einkommen. Produktion kann dabei aber nichts anderes mehr sein als ein Reichtum erzeugender technischer Prozess, der nur durch 'den Kapitalismus' pervertiert wird.
Frieder Dittmar fragt sich, ob die Existenzgeldforderung nur taktisch gemeint ist. Setzt sie also nur auf die Nasführung der 'Massen'? Soll sie der Wolf im Schafspelz sein? Oder "Formulieren die Linksradikalen dagegen von vornherein die Forderung wieder so um, das ihre Verwirklichung mit dem revolutionären Bruch identisch wäre". Dann – so Dittmar weiter - "besteht die Gefahr, dort weiterzumachen, wo sie gerade gescheitert sind: an der Marginalität" (S. 83). Für Dittmar selbst dagegen steht die Existenzgeldforderung für eine "Strategie" (S. 85): Wenn es denn realisiert wäre, stelle dies einen verbesserten Ausgangspunkt für eine Abschaffung des Lohnarbeitsverhältnisses dar (S. 85). Dass Krebs und Dittmar mit ihrem politizistischen Utopismus eigentlich bereits von einer völlig reformistischen Position aus argumentieren zeigt sich auch im Interview mit Opielka:
6 Ende der Arbeitsgesellschaft bedeutet dabei nicht nur das Ende von Arbeiterbewegung und Klassenkampf. Zugleich ist damit gesagt: Es die bestehende kapitalistische Gesellschaft, die so gut eingerichtet wurde, dass sie (fast) keiner Arbeit mehr bedarf (Mikroelektronik, Roboter etc.). Folglich darf aber auch niemand mehr damit rechnen, in den Kreis der Lohnarbeitenden aufgenommen zu werden. Für die Übriggebliebenen steht dann der Bereich der Bürgerarbeit offen.

Dittmar/Krebs: "Die Skepsis gegen das Existenzgeld war weit verbreitet; Reformismusvorwurf usw." Opielka: "Und was war die Alternative?" D/K: " Keine." (S. 203).
Thomas Atzert und Thomas Seibert verweisen zurecht auf die 60er und 70er Jahre, auf den Kampf um den 'politischen Lohn' (S. 87). Hier finden sich bereits viele der aktuellen Diskussionen. Leider verlassen sie diese Debatte sogleich wieder, um auf den Pfaden jener zu wandeln, die wie Toni Negri vor dem Hintergrund der publizistischen Erfolge dieser Ära agieren. Heute sei die Arbeit "immatriell" (flüchtige Schatten in elektronischen Netzen?), doch werde sie jetzt von Subjekten gemacht, deren Subjektsein werde allerdings noch unterdrückt. Erstaunlich: wurde dann auch die ArbeiterInnenbewegung bis Microsoft nur von Objekten gemacht? Dann doch lieber die als die danach. Atzert und Seibert verweisen zurecht auch auf die "Metropolenzentriertheit" der Existenzgeldforderung (S. 92). In dem Beitrag von Wildcat wird entsprechend gefragt, was damit gewonnen sei, wenn "die Spaltung [...] von der 'Nationalität' auf den 'dauerhaften Aufenthalt' verschoben" wird (S. 108).
Die Frauengruppe “Glanz der Metropole” kann die Existenzgeldforderung als realpolitische voll und ganz unterstützen (S. 105). In diesem Beitrag wird aus feministischer Sicht die Existenzgeldforderung als eigene, weitergehende Perspektive jedoch abgelehnt, gehe doch damit eine weitere Unsichtbarmachung von (Frauen-)Arbeit einher. Als Argumentationsfolie findet sich hier die im feministischen Diskurs verbreitete moralisierende Verwendung von Begriffen wie Arbeit und Wert. Dagegen könnte eingewandt werden, dass es für die Linke doch um die Emanzipation der Frau von der historisch-kulturellen Fixiertheit auf 'Hausarbeit' (als bezahlte und vertragliche Lohnarbeit oder als moderner Frohndienst in Lebensgemeinschaften) und die Aufhebung von Lohnarbeitsverhältnissen überhaupt gehen sollte und nicht um moralische Aufwertung der 'Hausarbeit' unter Beibehaltung der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Die zentrale Rolle der Lohnarbeit als Leitbild gesellschaftlicher Anerkennung wird so lediglich reproduziert.
In dem Text von Wildcat, der vollständig bereits im Wilcat–Zirkular 48/49 erschienen ist, findet sich Kritisches zur Funktion von Sozialpolitik. Klassenkampf ist etwas anderes als die Reform des Sozialstaats. Entgegen den Auffassungen aus den Reihen der Existenzgeld-Befürworter wird hier der ausgebaute Sozialstaat eher als ein "Verhinderungsmittel von Selbstbewusstsein und revolutionären Kämpfen" (S. 107) interpretiert. Die Idee, Existenzgeld als Srategie zu begreifen, um damit die 'Massen' in Bewegung zu setzen (S. 110) verweist auf die Debatte um den 'politischen Lohn', die in Italien in den 70er Jahren (u.a. von Potere Operaio) geführt und dann auch in Westdeutschland rezipiert wurde. Wildcat setzt sich nicht nur kritisch mit der Debatte um den politischen Lohn auseinander, sondern auch mit der daraus hervorgegangenen Position Toni Negris. Sie wirft der italienischen Debatte vor, dass bereits dort 'politischer Lohn' nur als Strategie im Sinne eines leninistischen Politikverständnisses verstanden werden könne. "Die Klasse führt zwar vielfältige Kämpfe, aber sie entwickelt keine eigenen Lernprozesse" (S. 111). Die Forderung des politischen Lohns gilt als ein Ausdruck für das Scheitern der betrieblichen Politik. Nach dem Rückzug aus der Fabrik deutete Negri diese Situation zusammen mit dem von ihm diagnostizierten Ende des Wertgesetzes als Ausbruch des Kommunismus. Auch so wird Klassenkampf obsolet. Beim aktuellen Abschied vom Proletariat sei es gerade – so Wildcat - die "theoretische Phrase" Postfordismus (S. 112), die als Ausgangspunkt für die Feststellung diene, dass es selbständige Kämpfe nicht mehr geben könne. Damit werde dann auch die Notwendigkeit begründet, "die atomisierten Subjekte von ober herab zu mobilisieren" (S. 112). Der "abstrakte Bezug auf das Einkommen und den Staat" verweise auf die Rolle der Linken in der Existenzgeld Kampagne: Stellvertreter und Politiker. Aber auch die eigene Option von Wildcat, das vorhandene, wenngleich verborgene Wissen des Proletariats heben zu wollen, bleibt nicht minder leninistischen Ambitionen verhaftet.
Existenzgeld - pure Illusion und Provokation in revolutionärer Absicht oder doch sozialstaatliche Realpolitik? Gegen ersteres - und damit die Anwürfe von 'staatsfixiert' bis 'reformistisch' bestätigend - steht nicht nur die taschengeldhafte Forderung von ca. 1500 DM, sondern auch die seitenlangen buchhalterischen Überlegungen, wie unser Staat das alles finanzieren könne (und siehe: er kann! Vgl. BAG-SHI: Existenzgeld für alle, S. 139-153. Unsere Forderung dagegen ist nach wie vor 5000 DM netto plus angemessene Wohnung für alle ErdenbürgerInnen – aber sofort!). Grundsicherung ist im Rahmen modernisierter Sozialpolitik realisierbar – deren aufgeblähte Variante Existenzgeld ist systematisch unter den Bedingungen kapitalistischer Gesellschaften nicht zu realisieren. Der Marktcharakter des Arbeitsmarktes würde mit dem Wegfall des Lohnabstandgebots aufgelöst. Freie Arbeit, die als Lohnarbeit verwertet werden soll, steht nicht zur Verfügung. Gleichzeitig entfällt mit dem System der Lohnarbeit die Finanzierungsgrundlage für das Existenzgeld. Verbessern sich mit modernisierter Sozialpolitik und Grundsicherung die revolutionären Perspektiven? Verschreibt sich die Linke dem Paradox, an einer bürgerlichen Reformvorstellung festzuhalten, die unter bürgerlichen Verhältnissen nicht zu realisieren ist? Glaubt sie, dass, indem durch dies Paradoxon die

Mangelhaftigkeit des Systems demonstriert werde, dies folglich zur richtigen Revolution führe? Damit wandelt sich das Paradoxon zur 'Ambivalenz'. Zwei Ansätze zeigen sich hier: - durch Sozialreform den Boden für Revolution zu verbessern, also ein altes reformistisches Argument, und
zweitens- das Utopistische und Spontanistische, es müsse nur das Unmögliche gefordert werden, um die Welt aus den
Angeln zu heben.Die Behauptung, die Existenzgeldforderung sei pure Provokation, erklärt sich inhaltlich nur darüber, dass Kampagnenpolitik gemacht werden soll. Warum sonst, wäre zu fragen, wird genau dies gefordert? Hier verbleibt die Forderung im schlechten Utopismus. Ist sie dagegen als so genannte "Strategie" gemeint, stellt sich die Frage, was sie unterscheidet von der politischen Taktik der obigen Kampagnenpolitik? Auch wenn sie im Wollen einer revolutionären Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse formuliert wird bleibt sie zunächst lediglich Reform. Nichts ist mit der bloßen Versicherung revolutionärer Absicht dieser Existenzgeld–Fraktion gewonnen. Wie sieht eine Revolution aus, für die Existenzgeld einen Schritt nach vorne bedeuten würde? Die Trennung von Lohnarbeit und Existenz setzt Lohnarbeit notwendig voraus, sie ist alles andere als eine Aufhebung der Lohnarbeit.Es steht genau zur Debatte, ob die Existenzgeldforderung mehr ist als reformistisch. Dies zu kritisieren bedeutet nicht, mögliche Vorteile eines verbesserten Sozialstandards nicht zu sehen. Aber ist der Sozialstaat das Sprungbrett zur Revolution oder eher die Fessel? Beides liegt im Bereich der Möglichkeiten. Kumulativ Sozialleistungen auszubauen, also immer mehr Sozialstaat, bis dann unmerklich der Kapitalismus transformiert ist – und die Revolution vermieden - bleibt hingegen eine Illusion der Sozialdemokratie. Die Entwicklungen der sozialen Forderungen vom 'Recht auf Arbeit' bis zu einem 'Recht auf Grundsicherung' oder 'Existenzgeld' genauer zu untersuchen wäre lohnend. Die Geschichte der 'Linken' erscheint meist nur in der kruden Ablehnung der ArbeiterInnenbewegung als arbeitsfetischisiert. Dies ist konsequent, wenn davon ausgegangen wird, dass die Arbeitsgesellschaft aufhört. Dann sind ArbeiterInnen Fossile aus vergangener Zeit ebenso wie ihre Bewegung. Kapitalismus wird zur systemischen Ökonomie. Kapitalismuskritik, wie sie mit der Kritik der politischen Ökonomie versucht wurde, wird positivistischem Modernismus geopfert. Insofern können auch die immer wieder bemühten Anschlüsse an die Marxsche Theorie nicht überzeugen. Marx bestimmt bereits den Arbeitslohn in der Höhe des (kulturellen) Existenzminimums. Ein Existenzgeld, das über diesem läge, bleibt aus dieser Perspektive systematisch unmöglich. Und gegen den politischen Utopismus – den alten wie den postmodernen - findet sich bei Marx mehr als ein Argument.Was mit der Existenzgeldforderung in der Tat in den Blick gerät sind die Grenzen der gewerkschaftlichen Strategien. Die Interessen von Erwerbslosen und LohnarbeiterInnen zu vereinen und einen Kampf nicht für sichere Arbeitsplätze, sondern gegen die Gesellschaft der Lohnarbeit zu führen liegt jenseits ihrer Bestimmung. Sicher wäre es in diesem Zusammenhang ein lohnendes Projekt, sich die Debatten der ArbeiterInnenbewegung von Rosa Luxemburg bis Potere Operaio zu vergegenwärtigen. Gegen Roths zu Beginn zitierte Einschätzung ist festzuhalten, dass jede politische Forderung ihren theoretischen Bezug hat. Über dessen derzeitige Qualität informiert der vorliegende Band. Viel eher wäre der Existenzgeld-Kampagne vorzuhalten, dass sie vor allem eines ist: praxislos. Und unter Praxis ist dabei anderes zu verstehen als in der politischen Linken, dort ist Praxis immer nur politisches Handeln.