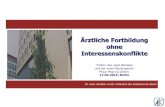Die Einwilligung des Berechtigten in eine ärztliche Behandlung
Transcript of Die Einwilligung des Berechtigten in eine ärztliche Behandlung

DOI: 10.1007/s00350-013-3528-8
Die Einwilligung des Berechtigten in eine ärztliche BehandlungDer einwilligungsunfähige (volljährige) Patient
Anna Schwedler
Die ärztliche Behandlung bedarf nach § 630 d I S. 1 BGB grundsätzlich der Einwilligung des Patienten. Ist dieser ein-willigungsunfähig, ist gemäß § 630 d I S. 2 BGB die Einwil-ligung des Berechtigten (Betreuers/Bevollmächtigte 1) not-wendig. Nach der neuen Gesetzeslage gibt es hiervon zwei Ausnahmen: Der Patient hat zuvor eine wirksame Patienten-verfügung nach § 1901 a BGB erstellt oder es liegt eine Not-lage nach § 630 d I S. 4 BGB vor. Weiterhin gibt es Fälle, in denen die Einwilligung des Berechtigten dem Gesetzgeber nicht genügt. Erforderlich ist zusätzlich die Genehmigung des Gerichts. Dies ist vor allem bei der Zwangsbehandlung gemäß § 1906 III BGB und bei dem Abbruch lebenserhalten-der Maßnahmen nach § 1904 II BGB der Fall. Der folgende Beitrag hinterfragt die inhaltliche und systematische Konse-quenz der neu geschaffenen Rechtslage.
I. Die Einwilligung des Berechtigten
Durch das Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes 2 wird das Erfordernis der Einholung einer Einwilligung in ärztli-che Maßnahmen kodifiziert 3. Bei einwilligungsunfähigen 4 Patienten ist nunmehr § 630 d I S. 2 BGB anzuwenden, nach welchem die Einwilligung des Berechtigten einzuholen ist, sofern nicht eine Patientenverfügung nach § 1901 a I S. 2 BGB die Maßnahme gestattet oder untersagt. Seit jeher war vorausgesetzt, dass die Einwilligung nur dann wirksam ist, wenn eine vorherige Aufklärung über den Eingriff und seine Folgen gegenüber dem Patienten bzw. des Berechtigten statt-gefunden hat (informed consent) 5. Daher ist es nur konse-quent, dass § 630 d II BGB nunmehr normiert, dass die Wirk-samkeit der Einwilligung des Patienten und des Berechtigten von einer Aufklärung nach den Bestimmungen des § 630 e I–IV BGB abhängt. Hinzugekommen ist allerdings § 630 e V BGB, welcher die Notwendigkeit der Aufklärung gegen-über einem einwilligungsunfähigen Patienten, soweit dies möglich ist, voraussetzt. Merkwürdig ist dabei, dass es für die Wirksamkeit der Einwilligung des gesetzlichen Vertre-ters keine Rolle spielt, ob diese Aufklärung gegenüber dem einwilligungsunfähigen Patienten stattgefunden hat. Denn § 630 d II BGB, welcher die Wirksamkeitsvoraussetzung der Einwilligung durch Verweisung auf § 630 e I–IV BGB be-nennt, verweist ausdrücklich nicht auf § 630 e V BGB. Es ist daher fraglich, welche Rechtsfolgen aus einem Verstoß gegen die Aufklärungspflicht nach § 630 e V BGB resultieren sollen, wenn dies nicht die Wirksamkeit der Einwilligung an sich betrifft. Ebenso ist unklar, welche Rechte der einwilligungs-unfähige Mensch aus § 630 e V BGB herleiten kann, ob ihm zum Beispiel ein „Vetorecht“ gegen die Entscheidung seines gesetzlichen Vertreters zugesprochen wird oder nicht 6.
II. Ausnahmen von der Einholung der Einwilligung des Berechtigten
1. Bei Vorlage einer wirksamen Patientenverfügung
Nach § 630 d I S. 2 BGB ist für den Fall, dass der Patient ein-willigungsunfähig ist, die Einwilligung des aufgeklärten
Berechtigten einzuholen, „soweit nicht eine Patientenver-fügung nach § 1901 a Abs. 1 S. 2 BGB die Maßnahme ge-stattet oder untersagt“. Damit stellt § 630 d I S. 2 BGB klar, dass die Patientenverfügung für den Arzt verbindlich ist. In der Gesetzesbegründung zu § 630 d I S. 2 BGB heißt es: „Sofern der Behandelnde keine Zweifel daran hat, dass eine wirksame Patientenverfügung vorliegt, die auf die aktuel-le Lebens- und Behandlungssituation zutrifft, wird er auf ihrer Grundlage entscheiden“ 7. Damit wurde der Streit um die Notwendigkeit einer Betreuerbestellung entschieden. Bisher war umstritten, ob die Bestellung eines Betreuers notwendig ist, wenn eine „eindeutige“ und wirksame Pa-tientenverfügung vorliegt 8. Vertreten wird dabei, dass die Mitwirkung eines Betreuers grundsätzlich notwendig sei 9. Eine alleinige Entscheidungskompetenz des Arztes sei nicht mit den Grundsätzen des Betreuungsrechtes, in welches die Patientenverfügung eingefügt wurde, vereinbar. Nach § 1901 a I BGB sei alleine die Entscheidung des Betreuers im Außenverhältnis maßgeblich 10, dem Arzt dagegen sei ein
Rechtsanwältin Dr. iur. Anna Schwedler, Wiss. Mitarb., Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Rechtswissenschaft, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt a. M., Deutschland
652 MedR (2013) 31: 652–655
1) Der Begriff des Berechtigten umfasst die Eltern, die Betreuer und die Bevollmächtigten. Da in diesem Artikel nur die Situa-tion des volljährigen Patienten dargestellt wird, bezieht sich der hier verwendete Begriff des Berechtigten nur auf die Betreuer und die Bevollmächtigten.
2) Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Pa-tienten, BGBl. I 2013, S. 277, ausführlich s. hierzu: Katzenmeier, NJW 2013, 817 ff.; Spickhoff, VersR 2013, 267 ff.; Preis/Schneider, NJZ 2013, 281 ff.; Schneider, JuS 2013, 104 ff.; Thole, MedR 2013, 145 ff.; Deutsch, NJW 2012, 2009 ff.; Thurn, MedR 2013, 153 ff.; Katzenmeier, MedR 2012, 567 ff.; Schanz/Thole, RDG 2013, 63 ff.; Kubella, Patientenrechtegesetz, 2011.
3) In Spezialgesetzen existieren bereits Vorschriften, die die Ein-willigung des Patienten vorschreiben: § 8 I Nr. 2, II TPG; § 8 b TPG; § 8 TPG; § 40 I Nr. 3 b, c AMG.
4) Die Kriterien der Einwilligungsfähigkeit bzw. Einwilligungs-unfähigkeit wurden vom Gesetzgeber abermals nicht gesetzlich geregelt. Es bleibt daher bei den von der Rechtsprechung entwi-ckelten Kriterien. S. hierzu: BGH, NJW 1958, 633 ff.
5) BGH, NJW 1958, 267; BGH, NJW 1959, 825; Laufs, in: Laufs/Kern (Hrsg.), Handbuch des Arztrechts, 4. Aufl. 2010, § 57 III, Rdnrn. 15 ff.; Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 6. Aufl. 2008, Rdnrn. 248 ff.; Katzenmeier, in: NK-BGB/Schuldrecht, 2. Aufl. 2012, § 823, Rdnr. 384; Katzenmeier, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 6. Aufl. 2009, Kap. V, Rdnrn. 5 ff.; Quaas/Zuck, Me-dizinrecht, 2. Aufl. 2008, § 13, Rdnrn. 84 ff.; Geiß/Greiner, Arzt-haftungsrecht, 6. Aufl. 2009, Kap. C, Rdnr. 2.
6) Wie dies zum Beispiel bei einsichts- und urteilsfähigen Minder-jährigen angenommen wird: BGH, NJW 2007, 217 = MedR 2008, 289.
7) BT-Dr. 17/10488, S. 23.8) Heitmann, in: NK-BGB/Familienrecht, Bd. 4, 2. Aufl. 2010, § 1901 a,
Rdnr. 26; Spickhoff, in: ders. (Hrsg.), Medizinrecht, 1. Aufl. 2011, § 1901 a BGB, Rdnr. 16; Schwedler, Ärztliche Therapiebegrenzung lebenserhaltender Maßnahmen, 2009, S. 123 ff.; Müller, in: BeckOK/BGB, § 1901 a (Bearb. 2013), Rdnr. 19; Schwab, in: MüKo/BGB, Bd. 8, 6. Aufl. 2012, § 1901 a, Rdnr. 33; Kutzer, MedR 2010, 532.
9) Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 6. Aufl. 2009, Kap. IV, Rdnr. 146; Tamm, VuR 2009, 449, 456; Müller, in: BeckOK/BGB, § 1901 a (Bearb. 2013), Rdnr. 19.
10) Boemke, NJW 2013, 1412, 1413; Jürgens, in: ders. (Hrsg.), Betreu-ungsrecht, 4. Aufl. 2010, § 1901 b, Rdnr. 1; Müller, in: BeckOK/BGB, § 1901 b (Bearb. 2013), Rdnr. 3; Diehn/Rebhan, NJW 2010, 326, 327; so wohl auch Uhlenbruck, in: Rieger/Dahm/Katzenmeier/Steinhilper (Hrsg.), HK-AKM, 4300, Rdnr. 30.

„Durchgriff“ auf die Patientenverfügung verwehrt 11. Nach dieser Ansicht wird die Patientenverfügung selbst nicht als Einwilligung angesehen, sondern die Einwilligung vom Betreuer/Bevollmächtigten anhand des in der verbindli-chen Patientenverfügung festgelegten Patientenwillens ge-troffen. Um diesen Patientenwillen herauszufinden, besteht für den Arzt und den Betreuer/Bevollmächtigten nach § 1901 b I S. 2 BGB die Pflicht, die Patientenverfügung ge-meinsam auszulegen 12. Gemäß § 1901 b II BGB sollen dabei auch nahe Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen mit einbezogen werden. Weiterhin spreche dafür, dass die Patientenverfügung in den meisten Fällen nicht eindeutig auszulegen sei und der betroffene Patient aufgrund seiner Einwilligungsunfähigkeit und seiner damit einhergehen-den Geschäftsunfähigkeit nicht mehr in der Lage sei, den Behandlungsvertrag mit dem Arzt selbständig abzuschlie-ßen 13. Dies mache eine Betreuerbestellung notwendig. Ge-nau an diesem Punkt, der Notwendigkeit, setzen andere Autoren an und rücken den Erforderlichkeitsgrundsatz des § 1896 III BGB in den Vordergrund 14. Danach darf ein Be-treuer nur für die Aufgabenkreise bestellt werden, in denen eine Betreuung notwendig ist. Dies bedeute, dass eine Be-treuerbestellung gerade nicht notwendig sei, wenn sich das ärztliche Handeln auf eine Maßnahme beziehe, die in der Patientenverfügung eindeutig genannt worden ist 15.
Die Einführung des § 630 d I S. 2 BGB zeigt, dass der Gesetzgeber der zuletzt genannten Meinung den Vorzug gibt, so dass der Streit an sich entschieden sein müsste. Durch den Verweis auf die Patientenverfügung nach § 1901 a BGB wird dem Arzt der Durchgriff auf die Pa-tientenverfügung gestattet. Auch der Hinweis in § 630 d I S. 3 BGB, dass andere Vorschriften, welche weitergehen-de Anforderungen an die Einwilligung stellen, unberührt bleiben, ändert an diesem Ergebnis nichts. § 630 d I S. 3 BGB bezieht sich nämlich gerade nicht auf die Frage, wer die Einwilligung grundsätzlich zu erteilen hat, sondern lediglich darauf, welche zusätzlichen Voraussetzungen an die Einwilligung selbst zu stellen sind. Liegt daher eine wirksame Patientenverfügung vor, ist die Bestellung eines Betreuers nicht notwendig, es sei denn der Arzt hat Zwei-fel hinsichtlich des in der Patientenverfügung geäußerten Patientenwillens.
Zuzugeben ist allerdings, dass diese Lösung auch Schwä-chen aufweist: Sicherlich kann der Arzt am besten entschei-den, ob die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation und die in der Patientenverfügung beschriebene Lebens-lage kongruent sind. Aber kann der Arzt entscheiden, ob eine Patientenverfügung wirksam ist? Diese Prüfung dürfte dem Arzt in der Regel schwer fallen. So wird sogar von Juristen nicht eindeutig beantwortet, ob eine fachärztliche Aufklärung vor Verfassen der Patientenverfügung für die Wirksamkeit erforderlich ist oder nicht 16. Richtigerweise stellt eine ärztliche Aufklärung bzw. Beratung eine Wirk-samkeitsvoraussetzung für eine Patientenverfügung dar, wenn diese eine Einwilligung in bestimmte ärztliche Maß-nahmen beinhaltet 17. Der Patient kann jedoch ausdrücklich auf die Beratung verzichten 18. Hält die Patientenverfügung dagegen den Wunsch des Patienten fest, dass bestimmte ärztliche Maßnahmen nicht durchgeführt werden sollen, bedarf es dagegen keiner ärztlichen Beratung 19.
2. Im Falle einer Notlage
Nach § 630 d I S. 4 BGB kann der Arzt in Notfällen auf die Einwilligung des Berechtigten verzichten und entspre-chend dem mutmaßlichen Willen des Patienten handeln. Es wird vertreten, dass dies mit § 1901 a II BGB unverein-bar sei, da dieser wiederum die Einwilligung des Betreuers vorschreibt 20. Allerdings galt auch schon vor der Einfügung des § 630 d I S. 4 BGB, dass der Arzt in unaufschiebba-ren Eilfällen auch ohne die Einwilligung des Betreuers/
Bevollmächtigten handeln darf bzw. muss 21. So gesehen ist die Einfügung des Satzes 4 in § 630 d BGB konsequent.
III. Gerichtliche Genehmigung der Einwilligung des Berechtigten
1. Die Einwilligung in eine stationäre Zwangsbehandlung eines nach § 1906 BGB Untergebrachten
In manchen Fällen bedarf die Einwilligung des Berechtig-ten einer richterlichen Genehmigung. Seit dem 1. 3. 2013 ist ein weiterer Paragraph, der die Einwilligung in ärztli-che Maßnahmen betrifft, eingefügt worden. Es handelt sich dabei um § 1906 III, V BGB. Danach werden die Voraus-setzungen bestimmt, nach welchen die Einwilligung des Betreuers/Bevollmächtigten in die stationäre Zwangsbe-handlung eines betreuten Patienten 22 zulässig ist 23. Hinter-grund der Einfügung ist eine Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 2011. Das BVerfG stellte fest, dass eine Zwangs-behandlung von im Maßregelvollzug Untergebrachten nicht zulässig ist, da es an einer klaren und bestimmten gesetzlichen Regelung fehlte 24. Daraufhin hat der BGH entschieden, dass es ebenfalls an einer klaren und bestimm-ten Regelung zur Zwangsbehandlung von Betreuten, die nach § 1906 I BGB untergebracht sind, fehlte 25. Zwangsbe-handlungen waren daher unzulässig. Der Gesetzgeber hat hierauf mit der Einführung des § 1906 III BGB reagiert, unter dessen Voraussetzungen die Zwangsbehandlung zu-lässig ist. Danach kann der Betreuer/Bevollmächtigte 26 in
Schwedler, Die Einwilligung des Berechtigten in eine ärztliche Behandlung MedR (2013) 31: 652–655 653
11) Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 6. Aufl. 2009, Kap. IV, Rdnr. 145.
12) Diehn/Rebhan, NJW 2010, 326, 327; Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 6. Aufl. 2009, Kap. IV, Rdnr. 146; Müller, in: BeckOK, § 1901 b (Bearb. 2013), Rdnr. 3.
13) Heitmann, in: NK-BGB/Familienrecht, Bd. 4, 2. Aufl. 2010, § 1901 a, Rdnr. 26; Müller, in: BeckOK/BGB, § 1901 (Bearb. 2013), Rdnr. 19; Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 6. Aufl. 2009, Kap. IV, Rdnr. 147; Uhlenbruck, in: Rieger/Dahm/Katzenmeier/Steinhilper (Hrsg.), HK-AKM, 4300, Rdnr. 28, spricht von einer Kontrollfunktion des Arztes.
14) Schwab, in: MüKo/BGB, Bd. 8, 6. Aufl. 2012, § 1901 a, Rdnr. 33; Heitmann, in: NK-BGB/Familienrecht, Bd. 4, 2. Aufl. 2010, § 1901 a, Rdnr. 26.
15) Schwab, in: MüKo/BGB, Bd. 8, 6. Aufl. 2012, § 1901 a, Rdnr. 33; im Ergebnis ähnlich: Putz, FPR 2012, 13; Spickhoff, in: ders. (Hrsg.), Medizinrecht, 1. Aufl. 2011, § 1901 a, Rdnr. 16; Die-derichsen, in: Palandt, BGB, 73. Aufl. 2013, § 1901 a, Rdnr. 15; Meyer=Götz, NJ 2009, 363, 365.
16) Spickhoff, VersR 2013, 267, 275; Müller, in: BeckOK/BGB, § 1901 a (Bearb. 2013), Rdnr. 13.
17) BT-Dr. 16/8442, S. 14.18) BT-Dr. 16/8442, S. 14.19) BT-Dr. 16/8442, S. 14.20) Boemke, NJW 2013, 1412, 1413.21) OLG Celle, MedR 1984, 106; Schwab, in: MüKo/BGB, Bd. 8,
6. Aufl. 2012, § 1901 a, Rdnr. 38; Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, 6. Aufl. 2008, Rdnrn. 262 ff.; Katzenmeier, in: Laufs/Katzen meier/Lipp, Arztrecht, 6. Aufl. 2009, Kap. VI, Rdnr. 114; Müller, in: BeckOK/BGB, § 1901 a (Bearb. 2013), Rdnr. 20; Beckmann, MedR 2009, 582, 583; Katzenmeier, in: Rieger/Dahm/Katzen meier/Steinhilper, HK-AKM, 1570 (Bearb. 04/2013), Rdnr. 25.
22) Der Begriff „betreuter Patient“ erfasst in diesem Kontext auch den Patienten, welcher durch einen Bevollmächtigten vertreten wird.
23) Ausführlich hierzu: Dodegge, NJW 2013, 1256 ff.; Schmidt=Recla/Diener, MedR 2013, 6 ff.; Lipp, FamRZ 2013, 913 ff.; Schmidt=Recla, FamRZ 2013, 255; Müller, ZEV 2013, 304 ff.; Moll=Vogel, FamRB 2013, 157 ff.; Müller, ZEV 2013, 304 ff.; Grengel/Roth, ZRP 2013, 12 ff.
24) BVerfG, NJW 2011, 2113 ff.25) BGH, NJW 2012, 2967 ff. = MedR 2013, 39.26) Nach § 1906 V S. 1 BGB gilt § 1906 III, IV BGB auch für den
Bevollmächtigten, wenn die schriftlich verfasste Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich erfasst.

eine Behandlung auch gegen den natürlichen Willen des betroffenen Patienten, der sich in Unterbringung befin-det, einwilligen, wenn dieser aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinde-rung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen kann. Voraussetzung ist weiterhin, dass zuvor versucht wurde, den betreuten Patienten von der Notwen-digkeit der Maßnahme zu überzeugen. Außerdem muss die ärztliche Maßnahme zum Wohl des betreuten Pati-enten erforderlich sein, um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden. Der erhebliche Schaden darf nicht durch andere zumutbare Maßnahmen abgewendet werden können, und der erwartete Nutzen der ärztlichen Zwangsbehandlung muss die Beeinträchti-gungen überwiegen (Verhältnismäßigkeit). Hinzugefügt wurde weiterhin § 1906 III a BGB, nach welchem die Ein-willigung des Betreuers/Bevollmächtigten in die Zwangs-behandlung einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung bedarf.
2. Die Einwilligung in die Aufnahme oder den Abbruch bzw. das Unterlassen einer lebenserhaltenden Maßnahme nach § 1904 II, IV BGB
Nach § 1904 II, IV BGB ist eine Genehmigung der Ein-willigung durch das Betreuungsgericht nur dann erforder-lich, wenn sich der behandelnde Arzt und der Betreuer/Bevollmächtigte nicht über den Willen des Patienten einig sind. Hinzukommen muss die begründete Gefahr, dass der betroffene Patient auf Grund der Aufnahme der medizi-nischen Behandlung oder deren Abbruch bzw. deren Un-terlassen versterben oder einen schweren Schaden erleiden kann. Diese gesetzliche Einfügung aus dem Jahre 2009 entsprach im Wesentlichen der zivilrechtlichen Rechtspre-chung 27, wird jedoch in der Literatur bis heute nicht unein-geschränkt befürwortet 28. Begründet wird dies damit, dass aufgrund der bestehenden Gefahr eines missbräuchlichen Zusammenwirkens von Seiten der Ärzte und der Betreuer/Bevollmächtigten eine Kontrolle durch das Betreuungsge-richt erfolgen sollte 29.
3. Gegenüberstellung (Wertungswiderspruch)
Die Einwilligung des Betreuers/Bevollmächtigten in eine Zwangsbehandlung nach § 1906 III BGB bedarf einer be-treuungsrechtlichen Genehmigung. Die Einwilligung des Betreuers/Bevollmächtigten, eine lebenserhaltende Maß-nahme aufgrund des (mutmaßlichen) Willens des Patienten aufzunehmen, abzubrechen oder von Anfang an zu unter-lassen, benötigt dagegen nach § 1904 IV BGB keine Ge-nehmigung, wenn sich der Arzt und der Betreuer über den Willen des Patienten einig sind. Zu bedenken ist dabei, dass der Genehmigungsvorbehalt auch für das Anbringen von Bettgittern nach § 1906 II, IV BGB gilt. Es ist sonderbar, dass der zum Tode führende Abbruch oder das Unterlassen lebenserhaltender Maßnahmen nicht genehmigungsbe-dürftig ist, dagegen eine Zwangsbehandlung oder die Fi-xierung eines Bettgitters schon. Es stellt sich daher die Fra-ge, ob der Gesetzgeber hinsichtlich der unterschiedlichen Regelungen der Genehmigungsbedürftigkeit ausreichend differenziert hat. Auf den ersten Blick scheint dies nicht der Fall zu sein, da der Gesetzgeber die unterschiedlichen Genehmigungsvorbehalte nicht selbständig begründet, sondern jeweils nur auf die einschlägige ständige Recht-sprechung verweist 30.
Die für den Gesetzgeber grundlegende Entscheidung des BGH aus dem Jahre 2003 begründet den einge-schränkten Genehmigungsvorbehalt für den Abbruch oder das Unterlassen lebenserhaltender Maßnahmen vielseitig 31. Ein Hauptargument, die Genehmigung des Betreuungsgerichtes nur in Konfliktfällen vorzuschrei-
ben, liegt darin, zu vermeiden, dass die Betreuungsge-richte generell zur Kontrolle über ärztliches Verhalten am Ende des Lebens berufen werden und dadurch mit Aufgaben konfrontiert werden, die ihnen nach ihrer Funktion im Rechtssystem nicht zukommen 32. Dage-gen setzt sich der BGH bei der Frage der Zulässigkeit einer Zwangsbehandlung des Untergebrachten im Jahre 2012 nicht mit der grundsätzlichen Genehmigungsbe-dürftigkeit auseinander, sondern setzt diese voraus und verweist dann darauf, dass es diesbezüglich an einer ver-fassungskonformen gesetzlichen Vorschrift mangele 33. In der BVerfG-Entscheidung aus dem Jahre 2011, die dem Urteil des BGH zu Grunde lag, heißt es, dass eine me-dizinische Zwangsbehandlung eines Untergebrachten in schwerwiegender Weise in dessen Grundrechte aus Art. 2 II S. 1 GG eingreife, so dass daraus eine Schutzpflicht des Staates folge 34. Dieser Schutzgedanke findet sich in dem richterlichen Genehmigungsvorbehalt wieder. Auf diese Weise sollen die Grundrechte der körperlichen Un-versehrtheit und des Selbstbestimmungsrechtes der Be-troffenen geschützt werden. Weiterhin ist auch Art. 104 II GG zu beachten. Danach ist eine Freiheitsentziehung nur zulässig, wenn ein Richter über diese entscheidet. Bei einer Zwangsmaßnahme wird es nötig sein, den Betrof-fenen körperlich so einzuschränken – zum Beispiel durch Fixierung der Arme und Hände –, dass eine Behandlung möglich ist. Dies stellt eine Freiheitsentziehung dar, die über die grundsätzliche Freiheitsentziehung nach § 1906 I BGB hinausgeht.
Richtig nachvollziehen lässt sich diese Differenzierung jedoch nur, wenn der Focus auf das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Selbstbestimmungsrecht gelegt wird. Bei einer me-dizinischen Behandlung handelt es sich um einen Ein-griff in die körperliche Unversehrtheit. Der Eingriff ist auch verfassungsrechtlich nur dann gerechtfertigt, wenn der Betroffene in die ärztliche Behandlung eingewilligt hat 35. Sobald eine Behandlung gegen den Willen des Be-troffenen durchgeführt wird, liegt neben einem unge-rechtfertigten Eingriff in die körperliche Unversehrtheit zusätzlich ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen vor 36. Aus diesem Grund ist die Zulässigkeit des Abbruchs oder des Unterlassens lebenserhaltender Maßnahmen, wodurch der Tod des Patienten eintritt, als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechtes zu verstehen. Das ärztliche/betreuungsrechtliche Handeln oder Unterlassen hat in diesen Fällen im Einklang mit dem Willen des Be-troffenen zu erfolgen. Bei der Zwangsbehandlung dage-gen handeln die Ärzte und die Betreuer gegen den Willen des Betroffenen. Deswegen ist der Richtervorbehalt bei einer Zwangsbehandlung eines Untergebrachten aufgrund des Schutzgedankens konsequent. In sich stimmig ist aber auch, dass bei einem Abbruch oder Unterlassen der lebens-
Schwedler, Die Einwilligung des Berechtigten in eine ärztliche Behandlung654 MedR (2013) 31: 652–655
27) BGHZ 154, 205 = MedR 2003, 512.28) Marschner, in: Jürgens (Hrsg.), Betreuungsrecht, 4. Aufl. 2010,
Rdnr. 13; Spickhoff, in: ders. (Hrsg.), Medizinrecht, 1. Aufl. 2011, § 1904, Rdnrn. 15 ff.
29) Spickhoff, in: ders. (Hrsg.), Medizinrecht, 1. Aufl. 2011, § 1904, Rdnrn. 15 ff.
30) BT-Dr. 17/11513, S. 7.31) BGH, NJW 2003, 1588 ff. = MedR 2003, 512 ff.32) BGH, NJW 2003, 1594 = MedR 2003, 519.33) BGH, NJW 2012, 3234 ff. 34) BVerfG, NJW 2011, 2113, 2114.35) BVerfG, NJW 1979, 1925.36) Höfling, NJW 2001, 849, 851; Kern, in: Laufs/Kern (Hrsg.), Hand-
buch des Arztes, 4. Aufl. 2010, § 50, Rdnrn. 7 ff.; Quaas/Zuck, Medizinrecht, 2. Aufl. 2008, § 2, Rdnrn. 35 ff.; Katzenmeier, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 6. Aufl. 2009, Kap. V, Rdnrn. 12 u. 73.

erhaltenden Maßnahmen ein eingeschränkter richterlicher Genehmigungsvorbehalt gilt.
IV. Fazit
Die Regelungen der richterlichen Genehmigung hinsicht-lich der Zwangsbehandlung und des Abbruches oder Un-terlassens einer lebenserhaltenden Maßnahme aufgrund des Patientenwillens sind konsequent. Die Regelungen je-doch, die die Einwilligung des Berechtigten (Betreuers/Bevollmächtigten) betreffen, sind nicht durchgehend ge-
lungen. Dies liegt bereits daran, dass es der Gesetzgeber unterlassen hat, die Kriterien für die Einwilligungsunfä-higkeit zu definieren. Die Einwilligungsunfähigkeit ist je-doch Voraus setzung dafür, dass überhaupt die Einwilligung eines Vertreters relevant wird. Scheinbar zufällig hat der Gesetzgeber dem Arzt den Durchgriff auf die Patientenver-fügung erlaubt, so dass eine Betreuerbestellung nicht mehr notwendig ist. Ob dies dem Gesetzgeber so klar war, mag dahinstehen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Regelungen den alltäglichen (ärztlichen) Umgang mit Patientenverfü-gungen verändern.
Die gesellschaftsrechtliche Beteiligung von Ärzten und ihren Verwandten an Unternehmen nichtärztlicher Leistungserbringer Julian Braun und Constanze Püschel
Im Kontext des berufs- und sozialrechtlichen Verbots der Zuweisung gegen Entgelt stellt sich die Problema-tik, ob und inwieweit sich Ärzte und ihre Verwandten an Geschäften von Heil- bzw. Hilfsmittelerbringern oder Unternehmen der Arzneimittelversorgung (z. B. Herstel-lungsbetrieben i. S. des § 13 AMG oder pharmazeutischen Unternehmen) gesellschaftsrechtlich beteiligen dürfen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Frage, ob der Arzt mit seinem Zuweisungs- oder Verordnungsverhalten Einfluss auf die Umsätze des Leistungserbringers nehmen kann und ob sich die Gewinnausschüttungen deshalb als Vorteil „für“ die Zuweisung bzw. Verordnung darstel-len. Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über die gegenwärtige berufs- und sozialrechtliche Rechtslage unter Berücksichtigung der bisher ergangenen Recht-sprechung und zeigt verbleibende rechtskonforme Gestal-tungsmöglichkeiten auf. Auf die derzeit noch ungewisse Rechtsentwicklung im Medizinstrafrecht gehen die Au-toren dabei nicht ein 1.
I. Einleitung
Die gesellschaftsrechtliche Beteiligung von Ärzten an im Gesundheitswesen tätigen Unternehmen ist schon längere Zeit Gegenstand der rechtswissenschaftlichen und rechts-politischen Diskussion 2. Mittlerweile haben sich auch ver-schiedene Gerichte mit der Frage befasst, ob und inwieweit solche Beteiligungen rechtmäßig sind 3. Im Fokus stehen vor allem unternehmerische Beteiligungen von Ärzten mit entsprechend fachlich korrespondierenden bzw. fachnahen Heil- und Hilfsmittelerbringern oder Herstellungsbetrie-ben i. S. des § 13 AMG, so z. B. die Beteiligung von Or-thopäden an Physiotherapiepraxen, Orthopädieschuhma-chergeschäften oder Sanitätshäusern, die Beteiligung von Hals-Nasen-Ohrenärzten an Hörgeräteakustikergeschäf-ten sowie die Beteiligung von Onkologen an Zytostatika-Her stel lungs betrieben. Neuerdings stellt sich in diesem
Zusammenhang zusätzlich die Frage, inwieweit es recht-lich zulässig ist, wenn nicht der Arzt selbst, sondern ein Mitglied seiner Familie oder ein naher Verwandter gesell-schaftsrechtlich an einem auf dem Gesundheitsmarkt täti-gen Unternehmen beteiligt ist.
Kern der rechtlichen Problematik ist das Spannungsver-hältnis zwischen der grundrechtlichen Freiheit, sich (auch) als Arzt an (gesundheits-)wirtschaftlich tätigen Unterneh-men zu beteiligen, einerseits und der Wahrung der ärzt-lichen Unabhängigkeit andererseits, nach der die Ärzte – zur Wahrung der Patienteninteressen – unabhängige und von monetären Interessen unbeeinflusste ärztliche Verord-nungs- und sonstige Auswahlentscheidungen zu treffen haben. Für die Bewertung der Zulässigkeit einer Beteili-gung von Ärzten an Unternehmen im Gesundheitswesen ist deshalb insbesondere das grundsätzliche Verbot der Zu-weisung gegen Entgelt relevant, das berufsrechtlich in § 31 Abs. 1 MBO-Ä sowie in den sozialrechtlichen Normen der §§ 73 Abs. 7, 128 Abs. 2, Abs. 6 SGB V geregelt ist. Gleiches gilt, wenn nicht die Ärzte selbst, sondern Familienangehö-rige oder nahe Verwandte ein Leistungserbringergeschäft betreiben oder an einem solchen Unternehmen als Gesell-schafter beteiligt sind.
Rechtsanwalt Dr. iur. Julian Braun und Rechtsanwältin Dr. iur. Constanze Püschel, DIERKS + BOHLE Rechtsanwälte, Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlin, Deutschland
1) Zwar hat der Bundestag am 27. 6. 2013 in zweiter und dritter Le-sung das Gesetz zur Förderung der Prävention – und damit §§ 70 Abs. 3, 307c SGB V n. F. – in der Form angenommen, die der Bundestagsausschuss für Gesundheit zum Beschluss empfohlen hat (vgl. BT-Dr. 17/14184). Allerdings ist fraglich, ob diese Regelun-gen im Gesetzgebungsverfahren den Bundesrat passieren, zumal dieser einen eigenen, konträren Gesetzesentwurf zur Schaffung eines neuen Straftatbestandes der Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen (§ 299 a StGB) eingebracht hat (vgl. BR-Dr. 451/13).
2) Vgl. z. B. BGH, MedR 2011, 500, 506 m. Anm. Wittmann/Schüt-ze; Ratzel, ZMGR 2012, 258; Wittmann/Koch, MedR 2011, 476; Scholz, in: Spickhoff (Hrsg.), Medizinrecht, 2011, § 31 MBO, Rdnr. 5; Lippert/Ratzel, NJW 2003, 3301, 3304; Ratzel, MedR 2002, 492, 496; Dahm, MedR 1998, 70, 73.
3) Z. B. BGH, MedR 2011, 500 ff.; OLG Köln, GRUR 2006, 600 ff.; OLG Stuttgart, MedR 2007, 543 ff.; OLG Celle, Urt. v. 29. 5. 2008 – 13 U 203/07 –; Berufsgericht für Heilberufe Köln, Urt. v. 5. 6. 2009 – 35 K 563/09.T –; Landesberufsgericht für Heil-berufe Münster, MedR 2012, 69 ff.
Braun/Püschel, Die gesellschaftsrechtliche Beteiligung von Ärzten an Unternehmen MedR (2013) 31: 655–658 655