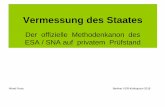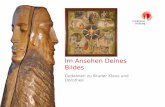Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’...
-
Upload
nicholas-hiromura -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’...
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
1/20
Iris Därmann
Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas
Hobbes’ Leviathan1
Das 1651 erstmals in London erschienene Werk Leviathan bricht mit den beiden
Haupteinsätzen des politischen Aristotelismus2. So will das „Mythologem“ des kriegerischen
Ausnahmezustandes3 den Grundsatz des Aristoteles άνθρωπος ζωον πολιτικόν φύσει έστιν
Lügen strafen, indem es die wesentlich a-soziale, wenn nicht bestialische Natur des Menschen
vor Augen führt, die ungehindert hervorbricht, sobald sich der Staat in Auflösung befindet4.
Aber auch die Onto-Teleologie der Polis, das Frühersein des Staates vor dem Einzelnen und
von Natur aus5, weicht einer neuen Technologie des Staates, bei der der Mensch zugleich als
dessen Stoff und Hersteller fungiert. Für Hobbes ist die civitas weder natur- noch auch
gottgegeben. Ihr Fehlen verweist vielmehr auf einen fundamentalen Mangel des Kosmos bzw.
der göttlichen Schöpfung, den wettzumachen der Mensch auf dem Weg der Imitation der
göttlichen Kunst (imitare creationem) genötigt ist6. Der Nullpunkt „ontologischer
Disposition“ und göttlicher Schöpfungskraft ist deckungsgleich mit der maximalen
Notwendigkeit politischer Ordnungskonstruktion7: So wie Gott die Tiere und die Menschen
geschaffen hat, so muß der Mensch nicht nur künstliche Tiere (Automaten, Maschinen),
sondern auch einen „künstlichen Menschen“ erschaffen, der als „großer Leviathan“8
1 Für Hinweise und Anregungen danke ich Hans Belting, Christoph Jamme, Günther Ortmann, Erhard Schüttpelzund Bernhard Waldenfels. Mit der Hobbesschen Bildtheorie befaßt sich auch Friedrich Balke in einemForschungsprojekt am Kulturwissenschaftlichen Forschungskolleg „Medien und kulturelle Kommunikation“ derUniversität zu Köln, dem ich für ein anregendes Gespräch über die Beziehung von Bildtheorie und Frontispizdanke.2 Wolfgang Kersting hat die signifikanten Differenzen zwischen dem politischen Aristotelismus und dem
neuzeitlichen Kontraktualismus im ersten Kapitel seines Buches Die politische Philosophie desGesellschaftsvertrages pointiert herausgestellt.3 Zu Recht betont Giorgio Agamben, daß der „Naturzustand als Herzstück des Staates überlebt“. In diesem Sinne bleibt er im „bürgerlichen Staat in Form der souveränen Entscheidung fortwährend wirksam.“ ( Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, a.a.O., S. 115 ff.)4 Freilich hatte bereits Aristoteles hervorgehoben, daß jeder, der außerhalb der politischen Gemeinschaft lebe,entweder ein Tier oder aber ein Gott sein müsse. Denn ohne Moralität sei der Mensch „das ruchloseste undroheste […] Geschöpf“ ( Politik I, 1253 a).5 Aristoteles, Politik I, 1253 a.6 Thomas Hobbes, Leviathan, or the matter, form and power of a commonwealth, ecclesiasticall and civil , edited by Michael Oakeshott, with an Introduction by Richard S. Peters, New York/London 1962, S. 19-20; dt. Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen Staates, übersetzt von JuttaSchlösser, mit einer Einführung und herausgegeben von Hermann Klenner, Darmstadt/Hamburg 1996, S. 5-7.7 Siehe dazu die Ausführungen von Hans Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit , erneuerte Ausgabe, Frankfurtam Main 1996, S. 251, der in diesem Zusammenhang von einem „Maximum an konstruktiver Potentialität“ausgeht, das jedoch m.E. seine Grenze in dem Tatbestand findet, daß der Leviathan Wolf im Staate bleibt.8 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., Introduction, S. 19; dt. Einleitung, S. 5.
1
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
2/20
wiederum die göttliche Regierung der Welt nachahmt. Hat dieser „sterbliche Gott“9 die
alleinige Aufgabe, die Bestie Mensch ins Gehege des positiven Rechts einzupferchen und mit
der Gewalt seines Schwertes einzuschüchtern, so bleibt er selbst der einzige Wolf im Staate.
Denn nur er behält bekanntlich sein indefinites ius in omnia et omnes. Auf diese Weise aber
überdauert der Naturzustand inmitten des Staates und macht damit das Ungenügen und die
Sekundarität des rechtlich-politischen Modells erst eigentlich augenfällig. Diese Insuffizienz
des Rechts weist der Möglichkeit der menschlichen „Kunst ( skill ), Staaten zu schaffen und zu
erhalten“10, unüberwindbare Grenzen an und läßt schließlich die nackte Natur(gewalt) über
die politisch-rechtliche Herstellungskunst triumphieren. Im Zuschnitt seiner Konstruktion tritt
der Leviathan als ein Zwitterwesen, als künstlicher Mensch, sterblicher Gott, Automat und
wildes Tier in Erscheinung. Es gleicht damit ohne Frage jenen unwirklichen „Phantasmen
( phantasms)“, „Ungeheuern (monsters)“ und „Götzen (idols)“, denen Hobbes in seiner wenig
beachteten Bildtheorie jede dämonologische Berechtigung auf göttliche oder staatliche
Verehrung abzusprechen sucht11. Dieser Umstand ist um so bemerkenswerter, als Hobbes
selbst der Versuchung nicht widerstehen konnte, dem „phantastischen Bewohner [seines]
Hirns“12 im berühmten Frontispiz seines Werkes eine visuelle Gestalt zu verleihen und den
künstlichen homo magnus im Rückgriff auf die mittelalterliche Publizistik auch sprachlich
immer wieder mit einem natürlichen, organischen Körper auszustatten13. Die Tendenz zur
Visualisierung und Personifizierung des Staates erfährt schließlich eine theatralische
Ausgestaltung im 26. Kapitel des zweiten Buches des Leviathan, das zugleich eine Theorie
der Person und Personifizierung entwickelt. Hobbes tut, was er sagt, und er sagt, was er tut14,
wenn er den Leviathan als Maske des Staates darstellt und den Begriff der Person historisch
auf persona und prosopon zurückführt. Mit seiner grundlegenden Unterscheidung zwischen
der natürlichen und der juristischen Person bildet das Kapitel Of Persons, Authors, and
Things Personated die Scharnierstelle zwischen der Naturzustandsskizze auf der einen Seite
9 Ebd., XVII, S. 132; dt. S. 145. Für Hobbes, so Carl Schmitt, sei „Gott vor allem Macht ( potestas).“ Eben weil„die Staatsgewalt allmächtig ist, hat sie göttlichen Charakter. Ihre Allmacht aber ist anderer als göttlicherHerkunft: sie ist Menschenwerk“; Carl Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Stuttgart 1982, S. 50 f.10 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XX, S. 158; dt. S. 177.11 Von der mythischen und dämonischen Auffassung des Leviathan legt Schmitts Studie Zeugnis ab. Nachseinem Dafürhalten „hört“ jedoch „in der Zeit von 1500 – 1600 die eigentliche Kraft des Bildes auf.“ CarlSchmitt, Der Leviathan, a.a.O., S. 39. Stattdessen wird hier Nachdruck darauf gelegt, daß Hobbes durchaus aufdie politische Wirksamkeit der dämonischen Kraft der Maske des Staates setzt.12 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XLV, S. 468; dt. S. 546.13 Vgl. dazu Tönnies und seinen Hinweis auf De Cive VI, 19. Ferdinand Tönnies, Thomas Hobbes. Leben und Lehre, Faksimile-Neudruck der 3. vermehrten Auflage, Stuttgart 1925, eingeleitet und herausgegeben von Karl-
Heinz Ilting, Stuttgart/Bad Cannstatt 1971, S. 245.14 Eine solch’ performative Lesart läßt Derrida Freuds Text Jenseits des Lustprinzips zukommen. Sie wird hierauf Hobbes’ Leviathan angewandt. Jacques Derrida, „Spéculer – ‚sur Freud’“, in: La carte postale de Socrate à Freud et au-delà, Paris 1980, S. 277-437, hier: S. 417.
2
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
3/20
und der Staatslehre auf der anderen Seite. Obgleich sich Hobbes an dieser Stelle beiläufig auf
Cicero beruft, geht es ihm jedoch gerade nicht um die in De Officiis (I, 107-125) entwickelte
Rollentheorie. Darin erörtert Cicero den Begriff der Person mit Blick auf das kathêkon unter
der Frage der verschiedenen Rollen, die diese im Leben aufgrund eigener Wahl und äußerer
Umstände zu spielen hat15. Es ist nicht dieser von der Bühne auf das Leben übertragene und
an der ethischen Frage des gelungenen Lebens orientierte Rollenbegriff, der Hobbes hier
interessieren kann, sondern die von Cicero (in De Oratore, II, 102) angesprochene
Verkörperung verschiedener Personen in einer: Unus sustineo tres personas, mei, adversarii,
et judicis. In dem Maße, in dem Hobbes’ Theorie der Person die Unfehlbarkeit des absoluten
Souveräns zementieren soll, kombiniert sein Personenbegriff daher auf der Seite der
„juristischen Person“ (des Souveräns) die theatralische Darstellung mit der Vorstellung der
Personeneinheit, während auf der Seite der „natürlichen Personen“ (der Untertanen) die
ebenfalls schauspielernden, aber rechtsfähigen Urheber zum Zuge kommen, die die juristische
Person unwiderruflich dazu autorisieren, in ihrem eigenen Namen zu denken und zu handeln.
Insofern Hobbes die persona mit dem Schauspieler identifiziert, zeigt sich – auch hier – eine
gewisse Insuffizienz des juristischen Modells in bezug auf sich selbst: So wie sich der Vertrag
ohne Schwert in den Augen von Hobbes als wirkungslos erweist, ist für ihn auch das
rechtliche Zurechnungskonstrukt der Person ohne Schauspielermaske durchaus hinfällig.
Dabei steht die theatralische persona keineswegs unverbunden neben der juristischen
Bedeutung der Person und der Herrschaft durch das Schwert, sondern erweist sich vielmehr
als deren beider Supplement im Sinne einer notwendigen Ergänzung. Der Begründer der
politischen Philosophie der Neuzeit verbindet somit in seiner Staatslehre eine „fundamentale
Tatsache des Rechts“16 und der Macht mit eine der ältesten rituellen Funktion der Person:
nämlich der des Wechsels, des Austausches, der Aneignung, der Verwandlung und
Darstellung der Person, die mit dem Anrecht auf das Tragen einer Maske einhergeht, wie
nicht zuletzt Marcel Mauss in seiner Untersuchung zum Begriff der Person und des ‚Ich’ hervorgehoben hat. So kann man bereits im Vorhinein vermuten, daß dieser Befund der
Person als Maske und die Hobbessche Bildtheorie das bewaffnete Porträt des Leviathan am
Eingang des Buches in ein anderes Licht tauchen werden.
15 Zu der auf die verlorene Schrift Peri tou kathêkontos des Stoikers Panaitios zurückgehende Rollen- bzw.vierfache Maskentheorie des Cicero siehe Manfred Fuhrmann, „Persona, ein römischer Rollenbegriff“, in: Odo
Marquard und Karlheinz Stierle (Hg.), Identität , München 1979, S. 83-106, hier: S. 99 ff.16 Marcel Mauss, „Une catégorie de l’esprit humain: La notion de personne celle de ‚moi’“ (1938), in: Sociologieet Anthropologie, a.a.O., S. 332-36, hier: S. 350; dt. „Eine Kategorie des menschlichen Geistes: Der Begriff derPerson und des ‚Ich’“, in: Soziologie und Anthropologie, a.a.O., S. 223-254, hier: S. 240.
3
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
4/20
I. Dramatis persona: Der Souverän ist ein Schauspieler
Hobbes erzählt seine Ursprungslegende von der Konstruktion des Staates in vier
aufeinanderfolgenden Etappen, die von der Skizze des kriegerischen Naturzustandes über die
Einführung der moralisch-strategischen Dimension der Naturgesetze zum
Gesellschaftsvertrag (zwischen allen minus Eins) bis hin zur Einsetzung des absoluten
Souveräns reicht. Die zirkuläre Struktur dieser Erzählung beginnt mit der virtuellen Gewalt
des Naturzustandes, um mit der souveränen Gewalt des Leviathan zu enden, der dazu
ermächtigt ist, die Polis zum oikos zu machen, indem er das Leben und Überleben seiner
Untertanen – und sonst nichts – sichert. Dabei geben sich die aufeinanderfolgenden Bereiche
der Moral, des Rechts und der souveränen Gewalt nicht nur jeweils als Lösungen der
Probleme der vorangegangenen Sphäre, sondern vor allem als Lösungen des ursprünglichen
Kriegszustandes aus. Mit der schließlichen Aufrichtung des vertraglich ungebundenen
Souveräns wird allerdings deutlich, daß nicht das menschliche Fiat des Vertrages, sondern
nur die souveräne Gewalt selbst den Krieg zu beenden verspricht, den sie jedoch bestenfalls
unendlich aufzuschieben vermag, ohne den Frieden jemals auf ewige Dauer stellen zu
können. Hobbes preist die „Macht des Souveräns über Leben und Tod“17 als ein endgültiges
Mittel zur Überwindung des Naturzustandes, wohl wissend, daß er auch innerhalb der
staatlichen Ordnung prinzipiell nicht zu verwinden ist. Er selbst spricht diesen Tatbestand
deutlich aus, wenn er mögliche Kritiker seiner Beschreibung der unveränderlich kriegerischen
Natur des Menschen mit dem Hinweis zum Schweigen bringen will, daß auch der Bürger
eines Staates nicht davon abläßt, sich auf Reisen zu bewaffnen, seine Türen vor seinen
Mitbürgern und seine Truhen vor seinen Kindern und Dienstboten zu verschließen18. Sind im
Naturzustand aufgrund der naturrechtlichen Position jedes Einzelnen Raub, Versklavung und
Tötung legitime Mittel der Selbsterhaltung, dann bleibt die Bereitschaft zur Befolgung der
beiden „Kardinaltugenden“ des Naturzustandes, nämlich „Gewalt und Betrug“19, auch im
Gesellschaftszustand ungebrochen vorhanden, der damit ohne Frage ein Zustand des Kriegesist: „Denn das Wesen des Krieges [besteht] nicht in tatsächlichen Kampfhandlungen, sondern
in der bekannten Bereitschaft dazu während der ganzen Zeit, in der es keine Garantie für das
Gegenteil gibt.“20 So ist Hobbes auch mit der Einführung der Naturgesetze weit davon
entfernt, dieses gefährliche „Leben am Rande der Schlacht“21 zu befrieden. Denn die
Naturrechte dominieren weiterhin die Naturgesetze, die lediglich in foro interno verpflichten,
17 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XXI, S. 161; dt. S. 180.18 Ebd., XIII, S. 100; dt. S. 105.19 Ebd., S. 101; dt. S. 106.20 Ebd., S. 100: dt. S. 104 f.21 “[…] and they live, as it were, in the precincts of battle continually”. Ebd., XVIII, S. 137; dt. S. 151.
4
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
5/20
ohne eine moralische Transformation der Naturzustandsbewohner zu bewirken. Aufgrund der
moralischen Resistenz der menschlichen Natur hängt die wechselseitige Einhaltung der
Naturgesetze in foro externo22 ausschließlich von jener öffentlichen Macht ab, die „alle in
Schrecken hält“23. Der Nachweis der Wirkungslosigkeit dieser strategischen und sich selbst
überlassenen Moral läßt Hobbes im folgenden in die Sphäre des (Vertrags-)Rechts
überwechseln. Die von ihm entwickelte Personentheorie ist die Geburtsstunde der
Rechtsfiktion der Urheberschaft zu „Zurechnungszwecken“24. Hobbes gibt zweifellos eine
systematisch neue Antwort auf die Frage „Was [ist] eine Person“?:
„Eine Person ist der, dessen Worte oder Handlungen man entweder als seine eigenen ansieht
oder als stellvertretend für die Worte oder Handlungen eines anderen Menschen oder
irgendeines anderen Dinges, dem sie wahrheitsgemäß (truly) oder fiktiv (by fiction),
zugeschrieben werden.“25
Gemäß diesen Verzweigungen trifft Hobbes die konsequenzenreiche Unterscheidung
zwischen den Begriffen der natürlichen und der juristischen Person. Beide sind freilich
gleichermaßen dadurch ausgezeichnet, daß sie als Schauspieler fungieren: Die natürliche
Person, insofern sie sich selbst darstellt, die juristische Person, indem sie eine andere Person
(bzw. ein anderes Ding) als sich selbst darstellt, verkörpert bzw. vertritt. Der ausdrückliche
Rückgriff auf den semantischen Gehalt des lateinischen Wortes persona bzw. des
griechischen Wortes πρόσωπον, der vom Theater über die äußere Erscheinung bis hin zur
Maske, Larve26 oder zum Visier (zur Verbergung eines Teils des Gesichtes) reicht, dient
damit keiner bloßen historischen Reminiszenz, sondern der Einbindung in die rechtliche
Sphäre, die in der Aussage gipfelt, daß „eine Person dasselbe [ist] wie ein Schauspieler“27.
Die Person ist eine Maske, und das wird sich nirgendwo deutlicher zeigen als im Porträt des
Leviathan, das die juristische Person als phantastisches Zwitterwesen darstellt, in dem sich
die Menge der natürlichen Personen vereinigt, um im Körper des Souveräns eins zu werden.
Diese Maske des Staates stellt ein apotropäisches Friedensungeheuer dar, das den Krieg im
22 Ebd., XV, S. 123; dt. S. 132.23 Ebd., XIII, S. 100; dt. 104.24 Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 1985, S. 125, S.155.25 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XVI, S. 125; dt. S. 134.26 Ebd., XVI, S. 125; dt. S. 135. Rheinfelder erinnert an die Totenmasken der römischen gentes: „ImAberglauben des römischen Volkes herrschte die Vorstellung, der Tote lebe als Maske weiter. Die leerenAugenhöhlen und der starre Gesichtsausdruck der Schauspielermasken oder der architektonischen Masken habendas tertium comparationis zwischen der Maske und dem Totenkopf abgegeben. […] Diese Anwendung desWortes für den Totengeist, das Gespenst, war wohl auch der Grund, warum dann umgekehrt das ursprünglich für
den bösen Geist gebrauchte Wort larva auch in der Bedeutung ‚Maske’ Verwendung fand“. Hans Rheinfelder, Das Wort ‚Persona’. Geschichte seiner Bedeutung mit besonderer Berücksichtigung des französischen unditalienischen Mittelalters, Halle (Saale) 1928, S. 8 f.27 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XVI, S. 125; dt. S. 135.
5
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
6/20
Schrecken nur bannen, nicht aber rechtlich abschaffen kann. Die souveräne Macht hängt an
der sichtbaren Darstellung ihrer Gewalt und nicht am Recht. Daher dominiert bereits bei der
Erörterung des Personenbegriffs der theatralische Aspekt der persona die rechtlich neue
Dimension des Urhebers, die Hobbes parallel zum Begriff des Eigentümers bestimmt:
Urheber ist derjenige, der seine Worte und Handlungen als seine eigenen anerkennt. Dabei ist
es gleichgültig, ob diese von ihm selbst oder aber ob sie durch einen anderen in seinem
Namen vollzogen worden sind. In beiden Fällen ist die natürliche Person Urheber ihrer oder
eines anderen Worte und Handlungen, sofern dieser letztere nur von ihr dazu autorisiert
worden ist, stellvertretend für sie zu sprechen und zu handeln. Wo immer eine solche
Autorisierung einer juristischen Person durch eine natürliche Person vorliegt, spricht Hobbes
von einer wahrheitsgemäßen (truly) Zuschreibung von Urheberschaft28. Neben dieser
rechtlichen Konstruktion der Person aus Zurechungszwecken, die hier freilich der legitimen
Einsetzung der „uneingeschränkten“ Handlungsmacht ihres Stellvertreters dient29, erweckt
Hobbes mit Hilfe seiner rechtlichen Stellvertreter- und theatralischen Darstellungskonzeption
zugleich den im Galaterbrief (3, 28)30 gestalteten Mythos von der Einswerdung im Leib
Christi auf seine Weise, wenn er die zuvor im Naturzustand versprengten und
radikalegoistischen Individuen im Körper des Königs zu einer einzigen Person werden läßt:
„Eine Vielzahl von Menschen wird zu einer Person, wenn sie durch einen Menschen oder eine
Person vertreten wird. [… ] Denn es ist die Einheit des Stellvertreters, nicht die Einheit der
Vertretenen, die die Person zu einer macht. Und es ist der Stellvertreter, der die Person
verkörpert, und zwar nur eine Person“31.
Als dramatis persona stellt der Leviathan die Menge der Menschen als „eine Person“ dar 32.
Hobbes’ Metaphysik der Verschmelzung einer Vielzahl feindlicher Personen zu einem
einzigen „sakralen Körper“33 und zu einer einzigen Person ist mit der Einsetzung einer
souveränen Seele verbunden, die den konkurrierenden Egoismen widerspruchslos ihren
28 Eine fiktive Urheberschaft liegt dagegen im Falle der Vertretung von leblosen Dingen vor, die selbst keineErmächtigung geben, aber dennoch durch Personen vertreten werden können (wie etwa ein Hospital durch einenVorsteher). Aus dem Kreis der natürlichen und daher Autorschaft beanspruchenden Personen schließt Hobbessowohl Kinder und Schwachsinnige als auch „Götzen“ oder „bloße Hirngespinste“ aus: „Götzen können keineUrheber sein, denn ein Götze ist nichts“. Aufgrund dieser ihrer Nichtigkeit können „falsche Götter“ ebenfalls nurfiktiv durch eine Person repräsentiert werden. Ebd., XVI, S. 127; dt. S. 136 f.29 Ebd., XVI, S. 128; dt. S. 139.30 „Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib; denn ihr seidallzumal einer in Christo Jesu.“ Vgl. dazu Ludwig Schnorr von Carolsfeld, Geschichte der juristischen Person, Neudruck der Ausgabe München 1933, Aalen 1969, S. 58.31 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XVI, S. 127; dt. 138.32 Zur Kennzeichnung der Hobbesschen Staatsphilosophie als eines allegorischen Barockstückes siehe ReinhardBrandt, „Rechtsverzicht und Herrschaft in Hobbes’ Staatsverträgen“, in: Philosophisches Jahrbuch 87 (1980), S.41-56, hier: S. 49 ff.33 Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft , Frankfurt am Main 2000, S. 341.
6
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
7/20
Willen aufnötigt und sie so überhaupt erst regierbar macht. Die Vertragsschließenden
versprechen sich daher im social contract wechselseitig, ihr absolutes Naturrecht und ihr
Recht auf Selbstregierung an eine Person abzutreten, die von jedem einzelnen dazu ermächtigt
wird, fortan stellvertretend für diesen zu urteilen, zu wollen und zu handeln. Dabei erklären
sich alle zu Urhebern „alles dessen […], was derjenige, der so ihre Person vertritt, in bezug
auf Frieden und Sicherheit“ unternimmt oder unterläßt. Es ist die bedingungslose
Unterwerfung aller unter den Willen und das Urteil des Souveräns, die für Hobbes erst die
„wirkliche Einheit von ihnen allen in ein und derselben Person“ stiftet und dabei „mehr“ ist
als nur bloße „Zustimmung oder Eintracht“34. Denn die mit dem Kapitulationsvertrag
einhergehende Autorisierung des vertragsexternen Souveräns, der selbst Inhaber seiner
Naturrechte bleibt, ist nicht nur unkündbar und irreversibel, sie versetzt den Souverän auch in
eine unteilbare, ja „absolute“ Machtposition. Keine seiner Handlungen kann Unrecht gegen
einen Untertanen sein, da er zu allem, was er tut, von jedem einzelnen autorisiert worden ist.
Den Souverän anzuklagen oder gar zu bestrafen, kann daher nur bedeuten, sich selbst
anzuklagen und zu bestrafen, was nach Hobbes ein Widersinn ist35. Die aus der Autorisierung
abgeleitete Unfehlbarkeit des Souveräns macht diese juristische Person zu einer Instanz, die
weder vertraglich gebunden noch auch den Gesetzen unterworfen ist, die sie selbst im Namen
aller erläßt36. Als „sterblicher Gott“ ist sie allenfalls gegenüber dem „unsterblichen Gott“
rechenschaftspflichtig. Die juristische Person in dem von Hobbes bezeichneten Sinne ist bar
jeder Urheberschaft und daher gerade keine rechtsfähige, zurechenbare Person, die ihr
Verhalten am λόγος oder νόμος auszurichten hätte37. Sie spricht und handelt nicht als sie
selbst, sondern mit fremder Stimme und geliehenem Willen. Insofern sie als Schauspieler und
Maske des Staates fungiert, erweist sie sich als Inbegriff der Unverbundenheit,
Unverantwortlichkeit und Willkür. So scheint die platonische Polis38 im Leviathan auf den
Kopf gestellt, die hier zum Theater der souveränen Macht wird: Nicht der Philosoph, sondern
der tragische Mime ist König.
II. Personenkult und das Recht auf Verkörperung
Der Hobbessche Staat ist eine kollektive Schöpfung, wenn nicht ein Kunstwerk, in dem der
absolute Souverän den unkontrollierbaren Überschuß seiner Macht über das Gesetz
34 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XVII, S. 13; dt. S. 145.35 Ebd., XVIII, S. 136; dt. S. 149 f.36 Ebd., XXVI, S. 19; dt. 224 f.; XXIX, S. 240; dt. S. 275.37 Der Souverän ist allerdings zugleich natürliche und juristische Person. Dabei legt er selbst durch seine Gesetzeund Urkunden fest, welche seiner Handlungen der von ihm repräsentierten Körperschaft zugehören und welcheer als seine eigenen „unbestätigten Handlungen“ (Ebd., XXII, S. 171; dt. S. 191) verstanden wissen will.38 Zum Ausschluß des Schauspielers aus der idealen Polis siehe Politeia 395 a ff.
7
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
8/20
bezeichnet. Die theatralische Zurschaustellung seiner Macht errichtet ein schreckenerregendes
Bollwerk gegen den Krieg und maskiert als Spektakel zugleich die Begründungslosigkeit der
souveränen Gesetzgebung. Aufgrund der naturrechtlichen und anthropologischen Gleichheit
aller Menschen ist jeder oder keiner zum Souverän prädestiniert. „Jeder beliebige Mensch“
kann von der Menge der Vertragsschließenden das Recht erteilt bekommen, „ihrer aller
Person zu verkörpern“39. Dieses „glanzvolle“40 Vorrecht, eine juristische Person und somit
Maske des Staates zu sein, wird durch Autorisierung verliehen, durch souveräne
Rechtsnachfolge übertragen41 und kann im Kriegsfall von einem mächtigeren Souverän
angeeignet werden42. Auch wenn Hobbes sich bemüht, der Irreversibilität der Einsetzung des
Souveräns Nachdruck und der „sterblichen Substanz“ des Souveräns durch das
Verfügungsrecht über die Nachfolge „ein künstliches ewiges Leben“ zu verleihen, so bleibt
das Recht auf Verkörperung ein durchaus schwankendes und prekäres Recht43. Anders als das
Naturrecht, gehört es nicht zur Geburtsausstattung des Menschen. Es ist gerade kein
unverbrüchliches Recht der Person und kann daher entzogen werden oder verloren gehen, wie
nicht zuletzt Hobbes’ Analyse der pathologischen Ursachen der Auflösung oder Schwächung
der souveränen Macht unterstreicht44. Wer ist der Souverän? Der Souverän ist niemand und
zugleich promiskes Wesen und Maskenträger in einem furchteinflößenden Schauspiel
staatlicher Macht.
Im Unterschied zu klassischen Rechtshistorikern, die, wie etwa Girard, bei der Untersuchung
des römischen Rechts immer schon von einem Begriff der Person im Sinne eines
rechtsfähigen Subjektes als eines „historischen Apriori“45 ausgehen46, will Marcel Mauss in
seiner Genealogie des Begriffs der Person und des ‚Ich’ die Herkunfts- und
Entstehungsgeschichte der Person in den unterschiedlichsten „Zivilisationen“ aufzeigen, um
dabei jenen interkulturellen Zwischenraum zu markieren, der die Kulturen der Person
miteinander verbindet. Für sein Verständnis der „Figur“ ( personnage) als einer vom einzelnen
für sich als Individuum, aber mehr noch für die Gemeinschaft ausgefüllten Rolle stützt sichMauss auf die von Boas und Cushing durchgeführten Ethnographien indianischer
39 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XVII, S. 134; dt. S. 146.40 Ebd., XVIII, S. 141; dt. 155.41 Ebd., Leviathan, XIX, S. 147 f.; dt. S. 164 f.42 Ebd., XXI, S. 166; dt. S. 186; XVII, S. 133; dt. S. 145 f.43 Ebd., XXI, S. 164; dt. S. 187.44 Zur „Pathologie“ der Schwächung oder Auflösung eines Gemeinwesens siehe die von Hobbes angeführten„Krankheitsfälle“ und Vergiftungen im Kapitel XXIX des Leviathan, a.a.O., S. 236 ff.; dt. S. 271 ff.; S. 241 f.;dt. S. 277 f., das nicht zuletzt vor dem Unheil der „Nachahmung der Griechen und Römer“ und vor
„Tyrannophobie oder Furcht vor starker Regierung“ warnt.45 Marcel Mauss, Essai sur le don, S. 235, Anm. 3; dt. S. 101, Anm. 28.46 Paul-Friedrich Girard, Manuel élémentaire de droit romain (1895-1897), 5. Auflage, Paris 1911, S. 239; dt.Geschichte und System des römischen Rechts, übersetzt von Robert von Mayr, Berlin 1908, S. 262.
8
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
9/20
Maskengesellschaften, vornehmlich der Kwakiutl, in Zuni und bei den Hopi. Die Person ist
hier nicht die feststehende, individuierte, singuläre, vernünftige, unteilbare und unabhängige
Substanz, als welche sie die europäische Kultur im Anschluß an die christliche Trinitätslehre
und die einschlägigen philosophischen Definitionen von Boëthius47 oder Cassiodorus
zunehmend begreifen wollte: persona – substantia rationalis individua48. Personsein meint
hier vor allem das Anrecht, im Zeremoniell eine Maske zu tragen und sich damit eine (oder
gar mehrere) „zusätzliche Persönlichkeit“ herzustellen, um eine kosmische, mythische,
spirituelle oder verstorbene Person ekstatisch zu repräsentieren49. Mauss interessiert dabei das
Zusammenspiel von Individualisierung durch das Privileg der Maske und der komplexen
Organisation der Gesellschaft, die sich durch eben diese Figuren konstituiert. Diese Masken
stellen jede für sich sowohl „die präfigurierte Totalität des Clans“ als auch die den Clan
übergreifende Gesellschaft der Ahnen, Götter und reinkarnierten Geister dar 50. Nicht selten
handelt es sich um doppelte Masken, die beim Tanz „plötzlich auseinanderklappen und ein
zweites Gesicht preisgeben, zuweilen ein drittes hinter dem zweiten, alle gleich geheimnisvoll
und streng“51. Dabei ist die Person die Figur, die sie durch ihre Maske, ihre Titel, ihre
rituellen Gewänder, ihren Rang und spezifischen „Platz“ im Zeremoniell darstellt. Das
schließt nicht zuletzt beim Potlatch die Möglichkeit eines „ungeheuren Austausches von
Rechten, Leistungen, […], Zeremonien, Privilegien“, Masken und damit die Transformation
der Person „in einem komplizierten Ballett von Ekstasen“52 mit ein. Ja mehr noch: Abgesehen
davon, daß die Person eines Anderen mit all ihren Rechten und Privilegien durch Erbschaft
übertragen werden kann, wird der soziale und „politische Status der Individuen in den
Bruderschaften und Clans sowie überhaupt jede Art von Rängen“53 nur durch Potlatch oder
Krieg erworben. Es genügt, den Träger einer Maske zu töten, um sich seine Ämter, Ahnen,
Güter, seine Person und „ihren individuellen Geist“ anzueignen54. Eben weil der
Individualisierungsgrad der Person mit dem Charakteristikum der Maske, nicht aber mit der je
besonderen, unverwechselbaren, unersetzbaren und singulären Substanz verbunden ist, ist es
47 Boëthius, Contra Eutychen et Nestorium, 5, 1-3: „naturae rationabilis individua substantia“.48 Siehe dazu die entsprechenden Zitate und instruktiven Erläuterungen bei Siegmund Schlossmann, Personaund Prosopon im Recht und im christlichen Dogma (1906), 2. unveränderte Auflage, Darmstadt 1968, S. 98 ff.,S. 111.49 Marcel Mauss, „Une catégorie de l’esprit humain: La notion de personne celle de ‚moi’”, S. 346; dt. S. 236.50 Ebd., S. 339; dt. S. 229.51Claude Lévi-Strauss, La voie des masques, Paris 1979, S. 11; dt. Der Weg der Masken, übersetzt von EvaMoldenhauer, Frankfurt am Main 2004, S. 11.52 Marcel Mauss, „Une catégorie de l’esprit humain: La notion de personne celle de ‚moi’”, a.a.O., S. 343 ; dt. S.
233.53 Marcel Mauss, Essai sur le don, a.a.O., S. 200; dt. S. 65.54 Marcel Mauss, „Une catégorie de l’esprit humain: La notion de personne celle de ‚moi’”, a.a.O., S. 342; dt. S.232.
9
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
10/20
möglich, sich die Identität einer solchen Nicht-Identität im Krieg anzueignen, die personnage
im Potlatch zu tauschen und seine alte durch eine neue zu ersetzen.
Auch der Leviathan ist nicht mehr und nicht weniger als die Person, die sie durch das Recht
auf Verkörperung und durch das Prestige ihrer Maske darstellt. Er ist die einzige Person unter
allen natürlichen Personen, die durch ihre zusätzliche juristische Person aus der Menge
herausragt und sich so von der Masse der Gleichen unterscheidet. Aufgrund ihrer Einsetzung
durch Autorisierung agiert sie in einem „rechtsfreien Raum“55, der der Ordnung der
gewaltsamen Natur und nicht der menschlichen Konstruktion angehört. Hobbes parallelisiert
die Konstitution des Staates durch Einsetzung mit der kriegerischen Aneignung, da jede
souveräne Macht dem Staatszweck der Friedenssicherung entschieden dienlicher sei als ihr
gänzliches Fehlen56. Gleichgültig, ob der Leviathan nun durch Recht oder durch nackte
Gewalt zustande gekommen ist, das „Wesen der Souveränität“, das seinerseits nichts anderes
als (die Darstellung souveräner) Gewalt ist, bleibt davon unberührt: „Ein Staat durch
Aneignung liegt vor, wenn die souveräne Macht mittels Gewalt erworben wurde.“ Dabei
erkennen die einzelnen Personen aus Todesfurcht „alle Handlungen“ dessen „als eigene an“,
der „ihr Leben und ihre Freiheit in Gewalt“ hat57. Die rechtlich-politische Person, die zu
verkörpern der Souverän bestimmt ist, kann gerade deshalb durch Institution bzw. Erbschaft
übertragen oder aber durch Gewalt angeeignet werden, weil das Personsein dieser Person von
der Unbeständigkeit und Austauschbarkeit eines Charakters bzw. einer Rolle zeugt, die nicht
unauflösbar mit der Substanz ihres Trägers als eines stark akzentuierten Ichs verwachsen ist.
Gleichzeitig aber verleiht diese personnage erst eigentlich ein Gesicht (im Sinne der persona),
das es von allen anderen abhebt und unterscheidet. Das Gesicht selbst besteht nur durch die
Maske, die es trägt.
Mauss hat verschiedene Begriffe der Person ausfindig gemacht, die sich zum Teil auseinander
entwickelt haben, aber in ihrer unterschiedlichen Bedeutung auch unverbunden nebeneinander
Bestand haben konnten. Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß mit der Erfindung der„moralischen“ oder aber „pychologischen Person“, an der das Christentum so wesentlich
Anteil hatte, weder die „rechtliche“ Person noch auch die Person im Sinne der Maske und des
Schauspielers obsolet geworden sind. Ganz im Gegenteil hat das Verständnis des
Schauspielers als derjenigen Person, die in jede Rolle zu schlüpfen und sich metamorphisch
zu verwandeln vermag, das individuelle und rechtliche Konzept der Person noch befestigen
können, und zwar als eine Instanz, die einerseits Anspruch auf individuelle Besonderheit
55 Wolfgang Kersting, Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags, a.a.O., S. 98.56 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XVIII, S. 141; dt. S. 155 f.57 Ebd., XX, S. 151; dt. S. 168.
10
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
11/20
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
12/20
der Vereinigung radikal voneinander isolierter Individuen zuständig macht, die ansonsten nur
im Kriegsfall aufeinander treffen.
III. Die Idolatrie des Leviathan: Zur Ikonologie und Ikonographie absoluter Souveränität
Wie Platon in der Politeia, so tritt auch Hobbes im vierten Teil des Leviathan in eine
Auseinandersetzung mit der Malerei und dem ontologischen Status der Bilder ein, um die
trügerische Macht der Bilder zu begrenzen und den Bildern der Macht zur Souveränität zu
verhelfen. Dabei gilt es, die wahren von den falschen Bildern zu unterscheiden. Die
Verurteilung der Trugbilderphantasmen setzt voraus, daß Hobbes ihnen die spezifische
Funktion einer furchteinflößenden Verehrung zuerkennt, die er freilich für die „wahren“
Bilder der Macht nutzbar machen will. Jeden möglichen Konflikt mit dem jüdischen bzw.
christlichen Bilderverbot meidend, entwickelt Hobbes daher in dem einschlägigen Kapitel
„Von der Dämonologie und anderen Relikten der heidnischen Religion“ eine Theorie des
Bildes, die das Sehen wirklicher Dinge von unwirklichen Phantasmen einerseits und die
legitime Verehrung von Bildnissen der souveränen und göttlichen Macht vom schädlichen
Götzendienst andererseits abzugrenzen versucht. Während die durch das Sehen entstandenen
Vorstellungen von den wirklichen Dingen selbst herrühren und damit für ihre Wahrheit
bürgen, sind hingegen die Phantasien, Phantasmen, Visionen, Traumbilder und Götzen
trügerische Produkte der Einbildungskraft, denen nichts Wirkliches und nichts Sichtbares
außerhalb des „eigenen Hirns“ entspricht60. Hobbes macht nicht zuletzt die Verbildlichung
solcher Phantasmen in Stein, Holz, Ton oder Metall und die Vorstellung ihrer unkörperlichen
Substanz, die Besitz von einem Körper ergreifen und diesen mit Besessenheit oder Wahnsinn
schlagen können, für den Glauben an die Wirklichkeit von schadenstiftenden Dämonen oder
heilbringenden Geistern verantwortlich. Seit der Antike habe dieser Glaube um sich greifen,
in seinem „ansteckenden Einfluß auch zu den Juden“61 kommen und sich schließlich selbst
innerhalb der christlichen Lehren geltend machen können. Die Furcht der Menschen vorsolchen Lebewesen „von unbekannter, das heißt von unbegrenzter Macht, ihnen Gutes zu tun
oder Schaden zuzufügen“, habe den Herrschern „heidnischer Gemeinwesen“ zu allen Zeiten
„Gelegenheit“ geboten, diese ihre Furcht „auf den öffentlichen Frieden und den dafür nötigen
Gehorsam der Untertanen auszurichten“ und sie solchermaßen zur Einhaltung der Gesetze zu
Theorien des Spätmittelalters“ bezeichnet worden sei. Ernst H. Kantorowicz, Die zwei Körper des Königs. Eine
Studie zur politischen Theologie des Mittelalters, übersetzt von Walter Theimer und Brigitte Hellmann,München 1990, S. 206-233.60 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XLV, S. 460 f.; dt. S. 536 f.61 Ebd., XLV, S. 461; dt. S. 538.
12
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
13/20
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
14/20
das Ebenbild von jenem ist69. Allerdings muß dabei jede Verwechselung des sterblichen mit
dem unsterblichen Gott ausgeschlossen werden.
Den irdischen Souverän in einem Bildnis zu verehren, soll wiederum nicht besagen, dem Bild
des Souveräns Ehrerbietung zu bezeigen, weil er dieses Bild beseelt oder bewohnt, das
nämlich wäre Götzendienst. Es bedeutet vielmehr, der Person des Souveräns selbst Ehre
anzutun, der ein solches Bild für diesen Zweck „in seiner Abwesenheit bestimmt hat.“
Herrscherbildnisse und andere Insignien wie Thron oder Krone ermöglichen somit eine
pikturale oder symbolische Politik der Vergegenwärtigung der souveränen Macht für den Fall,
daß sie nicht in personae „den Schrecken (terror ) [ihrer] Gesetze“70 zur Schau stellen und
verkörpern kann. Der Souverän verlangt seinen Untertanen nicht nur absoluten Gehorsam,
sondern auch die von ihm selbst bestimmten „Zeichen“ der „staatlichen Verehrung“ ab.
Dabei kann der „Inhaber der höchsten Gewalt nach Belieben festlegen […], was als Zeichen
der Ehre gilt.“71 Im Zuschnitt seiner Konstruktion liegt jedoch, daß der Souverän weder auf
die Hobbessche Unterscheidung zwischen Trug- und Ebenbildern noch auch auf die
Distinktion von göttlicher Verehrung und Götzendienst verpflichtet zu werden vermag. Denn
seine unkontrollierbare Macht reicht bekanntlich so weit, daß er von seinen Untertanen mit
der Gewalt seines Schwertes verlangen kann, ihn „als einen Gott“ zu ehren72.
Es liegt auf der Hand, daß Hobbes’ ikonisch-politische Theorie der Repräsentation ganz
besonders mit Blick auf das berühmte Frontispiz des Leviathan von Interesse ist. Es kann
nicht nur als der Versuch einer Visualisierung und Illustration seiner Staatslehre in Betracht
gezogen werden73, der die „Leerstelle zwischen den Wörtern des Vertrages und dem
Gesamtkörper des Staates“ mit der „’visible power’ des Bildes“ ausfüllt, um damit die
„Schwäche“ der Schrift und die rhetorische Vieldeutigkeit der Sprache zu kompensieren74.
Insofern Hobbes die Ikonographie seines Werkes selbst mit entworfen hat75, muß sie auch an
69 Hobbes betont allerdings auch, daß wir Gott „mit einem Wert, der geringer ist als unendlich, nicht ehren,sondern nur entehren“ können (ebd., S. 466; dt. S. 544).70 Ebd., XLV, S. 469; dt. S. 548.71 Ebd., The First Part, X, S. 75; dt. S. 75.72 Ebd., XLV, S. 469; dt. S. 548. Da dies jedoch aus Angst vor dem Tode geschehen und nicht mit „innerlicher“Verehrung vollzogen würde, spricht Hobbes derartige Anbetungspraktiken vom Verdikt des Götzendienstes frei.In der hier von Hobbes geltend gemachten Unterscheidungsgewalt des Leviathan über die Geltung von Wundernsowie zwischen privat und öffentlich, innerlich und äußerlich, Glaube und Bekenntnis, sieht Carl Schmitt denGrundstein für die „moderne individualistische Gedanken- und Gewissensfreiheit“ gelegt. Schmitt, Der Leviathan, a.a.O., S. 85.73 Vgl. dazu die einschlägigen Untersuchungen von Reinhard Brandt, „Das Titelblatt des Leviathan und GoyasEl Giante“, in: Udo Bermbach und Klaus-M. Kodalle (Hg.), Furcht und Freiheit. Leviathan – Diskussion 300 Jahre nach Thomas Hobbes, Opladen 1982, 202-231, hier: S. 203; sowie Horst Bredekamp, Thomas Hobbes’
visuelle Strategien. Der Leviathan: Urbild des modernen Staates. Werkillustrationen und Porträts, Berlin 1999.74 Ebd., S. 123-130.75 Reinhard Brandt hatte in seiner Studie von 1982 geltend gemacht, daß das Frontispiz von Wenceslaus Hollarangefertigt worden und unter Mitwirkung von Hobbes während seines Pariser Exils entstanden sei („Das
14
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
15/20
den Maßstäben seiner eigenen Ikonologie und Personentheorie gemessen werden, die den
Souverän als Maske und Schauspieler des Staates bestimmt76.
Das berühmte Friedensbild77, das höchstwahrscheinlich Abraham Bosse gemeinsam mit
Thomas Hobbes als sichtbare Schwelle für die Lektüre seines Werkes Leviathan geschaffen
hat, ist durch eine Rahmung der unteren Bildhälfte in zwei Sequenzen unterteilt78. Die untere
Sequenz präsentiert auf der rechten Seite insgesamt fünf Insignien der weltlichen Macht, die
thematisch dem II. Buch des Leviathan entsprechen, während die linke Seite wiederum fünf
Symbole der kirchlichen Macht aufruft, die damit auf das Thema des III. Buches verweisen.
Die beiden vertikal verlaufenden Kolumnen sind in der Bildmitte durch einen
heruntergelassenen Vorhang miteinander verbunden, auf dem Titel und Autor festgehalten
sind. Darunter informiert eine barocke Kartusche über Erscheinungsjahr, -ort und den
Verleger des Buches: „London, printed for Andrew Crooke 1651“. In der oberen Sequenz des
Kupferstiches ist dagegen – wie auf der Bühne eines barocken Theaters – das Sujet des
Werkes zur unverstellten Ansicht freigegeben79. Auch hier ist eine Dreiteilung der
Darstellung, allerdings in horizontaler Durchführung, erkennbar: Der unterste Abschnitt
dieser oberen Bildhälfte zeigt die minutiös ausgearbeitete Kulisse einer Stadt mit gotischer
Kirche, die von einer bergigen Landschaft im mittleren Teil umgeben und im Hintergrund von
Meer und Himmel eingesäumt wird. Nicht ganz auf der Mittelachse des Bildes, sondern um
ein Stück weit nach links verschoben80, kommt der gigantische Körper des Leviathan aus dem
Titelblatt des Leviathan und Goyas El Giante“, a.a.O., S. 203). Horst Bredekamp hat in seiner großangelegtenUntersuchung dagegen Abraham Bosse als Urheber des Titelblattes (Thomas Hobbes’ visuelle Strategien ,a.a.O., S. 31-52) ausfindig gemacht. Dabei soll, neben anderen Indizien wie die Umsetzung der Augenpartie, vorallem die spezielle Gestaltung der Wolken auf das Werk Bosses verweisen. Reinhard Brandt hat sich unter demEindruck der Untersuchung von Bredekamp inzwischen in diesem Punkt korrigiert: „Thomas Hobbes, DasTitelemblem des Leviathan“, in: Philosophie in Bildern, 2. Auflage, Köln 2001, S. 312-330, hier: S. 328, Anm.10.76 Weder Reinhard Brandt noch auch Horst Bredekamp haben in ihren ansonsten höchst lehr- undfacettenreichen Studien die Hobbessche Bildtheorie für die Interpretation des Titelblattes fruchtbar gemacht.77 Den Begriff des „Friedensbildes“ habe ich entlehnt von: Hasso Hofmann ( Bilder des Friedens oder dievergessene Gerechtigkeit. Drei anschauliche Kapitel der Staatsphilosophie, München 1997) bzw. den beidenHerausgebern, Thomas Kater und Albert Kümmel: Der verweigerte Friede. Der Verlust der Friedensbildlichkeitin der Moderne (Bremen 2003).78 Zu den verschiedenen Titelblättern der einzelnen Ausgaben und unterschiedlichen Versionen der Darstellungdes Leviathan siehe Horst Bredekamp, Thomas Hobbes’ visuelle Strategien.79 Carl Schmitt hat den Vorhang des Titelblattes mit Blick auf die barocke Fassade interpretiert: „Das Leben istdie Fassade vor dem Tod (Barock). Der Leviathan selbst ist eine Fassade; die Herrschaftsfassade vor der Macht; jener geheimnisvolle Vorhang auf dem Titelblatt des Leviathan; aber nicht ‚bloße’ Fassade, nicht bloßer Scheinoder Erscheinung, Prestige, Gloire, Ehre, Repräsentation, Allmacht, aber eben doch nur wieder äußerlicheAllmacht.“ Carl Schmitt, Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, herausgegeben von EberhardFreiherr von Medem, Berlin 1991, S. 39, 2.11.1947; sowie dazu Horst Bredekamp, Thomas Hobbes’ visuelleStrategien, a.a.O., S. 1580 Brandt („Das Titelemblem des Leviathan“, a.a.O., S. 323 f.) hat dieser Tatsache in seiner Konstruktionsanalysedes Bildes eine bemerkenswerte Interpretation verliehen. Durch die leichte Verrückung nach links „liegt derMittelpunkt der Gesamtkonstruktion auf seiner linken Körperhälfte, und zwar dort, wo das Herz ist. […] DasHerz ist also das Lebenszentrum des natürlichen und künstlichen Menschen, es ist der Ort der Seele und der
15
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
16/20
Meer hervor und ragt hinter dem Gebirge auf. Dieser imposante Koloss breitet seine Arme
schützend über die befriedete Landschaft aus, wobei er in seiner rechten Hand ein riesiges
Schwert und in seiner Linken einen mindestens ebenso großen Bischofsstab hält. Damit wird
nicht nur das Thema der beiden Symbolreihen der unteren Bildhälfte wiederaufgenommen,
sondern vor allen Dingen die Vereinigung der zivilen und kirchlichen Macht in der Person des
Souveräns vor Augen geführt. Die ungewöhnliche Ausgestaltung des Körpers des Königs ist
schon häufig beschrieben worden: Mit Ausnahme seiner Hände und seines gekrönten
Hauptes, die beide von – wenn auch übergroßem – menschlichem Aussehen zeugen, setzt sich
der königliche Körper aus etwa 300 Leibern zusammen, die dem Betrachter ihren Rücken und
dem Souverän ihr Gesicht zuwenden, der selbst freilich den Betrachter unverwandt anblickt81.
Die natürlichen Personen sind in der juristischen Person des Souveräns vereint, der qua
Autorisierung das Recht hat, sie zu verkörpern. Die im Körper des Königs vereinigten Leiber
erscheinen wie der Schuppenpanzer eines riesigen Fisches. Der Souverän ist ein Schauspieler
und stellt den von ihm verkörperten Staat als Seeungeheuer dar. Die Zweiteilung seiner
Darstellung82, die ihn als Seeungeheuer und homo magnus zugleich zeigt, entspricht der
Zweiteilung seiner Person und spielt auf seine Doppelexistenz als natürliche und juristische
Person an. Den Bezug zum unsterblichen und selbst undarstellbaren Gott, als dessen Ebenbild
und Repräsentant die Hobbessche Bildtheorie den Souverän ausweist, liefert das Schriftband,
das oberhalb des fürstlichen Hauptes am äußersten Bildrand entlangläuft: non est potestas
super terram quae comparetur ei (Hiob 41, 24). Der Leviathan ist das gewaltige
Seeungeheuer, das Gott (und nicht, wie hier, der Mensch, der in der Imitation der göttlichen
Schöpfungskraft als Konstrukteur des Staates auftritt) geschaffen hat, um die Zweifel Hiobs
an der göttlichen Allmacht zu zerstreuen:
„Ich will nicht schweigen von seinen Gliedern, wie groß, wie mächtig und wohlgeschaffen er
ist. Wer kann ihm den Panzer ausziehen, und wer darf es wagen, ihm zwischen die Zähne zu
greifen? Wer kann die Tore seines Rachens auftun? Um seine Zähne herum herrschtSchrecken. Stolz stehen sie wie Reihen von Schilden, geschlossen und eng aneinandergefügt.
Souveränität. Mit dieser Lehre schließt sich Hobbes der von Harvey propagierten Theorie an“ (Harvey gilt alsEntdecker des Blutkreislaufs) und erweckt damit eine alte Kontroverse zu neuem Leben, nämlich ob eher derKopf oder nicht vielmehr das Herz als Symbol des Herrschers tauge.81 Bredekamp hat sich die Mühe gemacht, die Leiber im Körper des Souveräns zu zählen. Er ist es auch, der aufdas Wechselspiel der Blicke zwischen Untertanen, Leviathan und Betrachter aufmerksam macht (Thomas Hobbes’ visuelle Strategien, a.a.O., S. 15 f.).82 Für Lévi-Strauss ist die split representation in der Maskenkunst Asiens und Amerikas Ausdruck derZweiteilung der Person, nämlich der Teilung in das natürliche Individuum und in „die soziale Persönlichkeit, die
zu verkörpern es den Auftrag hat“. Claude Lévi-Strauss, „Le dédoublement de la représentation dans les arts del’Asie et de l’Amérique“ (1944-45), in: Anthropologie structurale, Paris 1958, S. 269-294, hier: S. 285; dt. „DieZweiteilung der Darstellung in der Kunst Asiens und Amerikas“, in: Strukturale Anthropologie I , übersetzt vonHans Naumann, Frankfurt am Main 1997, S. 267-291, hier: S. 283.
16
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
17/20
[…] Aus seinen Nüstern fährt Rauch wie von einem siedenden Kessel und Binsenfeuer. Sein
Odem ist wie lichte Lohe, und aus seinem Rachen schlagen Flammen. Auf seinem Nacken
wohnt die Stärke, und vor ihm her tanzt die Angst. […] Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich
die Starken und vor Schrecken wissen sie nicht aus noch ein.“83
Im Vergleich mit der angsteinflößenden Beschreibung jenes Seetieres im Buch Hiob erscheint
die von Abraham Bosse ausgeführte Hobbessche Inszenierung des Leviathan geradezu
harmlos84. Diese – mindestens aus der Perspektive des biblischen Referenztextes –
verharmlosende Darstellung des Leviathan ist ohne Frage verwunderlich, vor allem wenn man
bedenkt, daß Furcht und Schrecken den Dreh- und Angelpunkt des Hobbesschen Staates
bilden. Haben sie doch in ihrer Eigenschaft als herrschaftskonstitutive Affekte ganz sicher den
Anlaß für die alttestamentliche Titelwahl und Namensgebung des absoluten Souveräns
geliefert.
Warum ist der Leviathan die Maske des Staates? Wie bereits gesehen, kommt dem Vertrag
und der rechtlichen Konstruktion des Leviathan gerade kein Primat zu. Der Staat ist nicht das
beherrschbare und formbare Werk, das in den Händen seiner Konstrukteure verbleibt, sondern
entzieht sich ihnen nach getaner Arbeit als Werk, um in die gewaltsame Natur des Souveräns
einzugehen. Das begrenzte und zweckmäßige Kunstwerk wird vom Ungeheuren der Gewalt
überbordet. Hobbes offenbart damit das Ungenügen des juristischen Modells für seine
Staatslehre. Es ist der rechtlich nicht konstruierbare „Schrecken einer Macht“, die mit der
Gewalt des Schwertes regiert und als letztentscheidende Instanz dieser kollektiven politischen
Schöpfung fungiert. Dabei legt Hobbes selbst Nachdruck auf die Sichtbarkeit der Gewalt: Der
Krieg eines jeden mit jedem herrscht, „wenn es keine sichtbare Gewalt (visible power ) gibt,
um sie in Schrecken zu halten (to keep them in awe) und sie durch Furcht und Strafe an die
Erfüllung ihrer Verträge und die Befolgung [der] Naturgesetze zu binden.“ 85
Die Inszenierung der souveränen Macht (auf dem Titelemblem), die für das Funktionieren der
staatlichen Ordnung konstitutiv ist, hat zweierlei zu leisten: Zum einen muß sie Todesangsteinflößen, indem sie die Aus- bzw. Darstellung des Schreckens der Gewalt durch die alles
überragende kollosale Größe der Herrscherfigur bewirkt, mit der im Vergleich alles andere
und nicht zuletzt die Untertanen selbst klein erscheinen. Sie sprengt die Größe des
83 Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, Hiob 41, 4-17, nach der Übersetzung Martin Luthers, Stuttgart
1972, S. 595.84 Für Reinhard Brandt („Thomas Hobbes, Das Titelemblem des Leviathan“, a.a.O., S. 323) sind die Bezüge zumalttestamentlichen Leviathan kaum noch erkennbar.85 Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., XVII, S. 129; dt. S. 141.
17
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
18/20
menschlichen Maßes, „steht nicht mehr in Proportion zum Menschen“86 und entzieht sich so
seinem Zugriff. Zum anderen aber muß die Inszenierung der souveränen Macht die
Maßlosigkeit der Gewalt, mit der sie regiert, und die mit der rechtspositivistischen Formel
auctoritas non veritas facit legem aufgerufene radikale Begründungslosigkeit ihrer
Gesetzgebung maskieren. Namentlich durch die Parallelisierung von Akquisitions- und
Institutionsvertrag, von gewaltsamer Aneignung und rechtlicher Einsetzung des Staates, die
gleichermaßen als legitime Möglichkeiten der Souveränitätsbestimmung ausgegeben werden,
verleiht Hobbes der Gewalt den Anschein des Rechts. Der Souverän als Schauspieler und
Maske des Staates hat seine eigene Schreckensmacht für alle sichtbar und affektiv wirksam
als ein Bollwerk gegen den Krieg zur Schau zu stellen. Zugleich aber hat er die nackte Gewalt
seiner Herrschaft unter dem Deckmantel des Rechts zu verbergen.
Die Funktion des Titelemblems läßt sich demnach nicht auf eine bildliche Darstellung der
Staatslehre beschränken, die den Augenblick der rechtlichen Staatsgründung auf Dauer
stellt87. Zum einen unterstreicht es die Notwendigkeit der Repräsentation und
Spektakularisierung „der“ Gesellschaft, indem es die Vereinigung der voneinander isolierten
Personen im Körper des Leviathan vergegenwärtigt und zur Schau stellt. Zum anderen leistet
das Frontispiz jene für die Wirksamkeit der staatlichen Ordnung konstitutive Inszenierung der
absoluten Macht, die auf der Seite der Untergebenen nach den entsprechenden Handlungen
„staatlicher Verehrung“ verlangt. Flankiert von den weltlichen und geistlichen
Herrschaftssymbolen der Macht ist das Kolossale der Figur des Souveräns, mit der dieser die
Potenz und Omnipräsenz des Staates darstellt, nicht zuletzt für den Zweck der Verehrung
gedacht. „Es ist ehrenhaft, von vielen geehrt, geliebt oder gefürchtet zu werden, weil das
Beweise von Macht sind.“ Dem Souverän gegenüber Furcht zu bezeigen und ihm Gehorsam
zu leisten, sind für Hobbes Verehrungs- und Wertschätzungsbekundungen der „natürlichen“
Art88. Darüber hinaus ist es in das freie Belieben des Souveräns gestellt, konventionelle
Zeichen seiner Verehrung festzulegen89 und durch den „Schrecken seiner Gesetze“ zu befehlen90. In seiner Ikonologie ist Hobbes darum bemüht, die politische Verehrung von
Bildnissen, Orten und Insignien der Macht von dem Verdacht des Götzendienstes und der
Idolatrie zu befreien: Gleichgültig, ob nun jemand „mit unbedecktem Haupt vor einem Mann
86 Jacques Derrida, „Le sans de la coupure pure“, in: La vérité en peinture, Paris 1978, S. 95-168, hier: S. 139 ;dt. „Das Ohne des reinen Einschnitts“, in: Die Wahrheit in der Malerei, übersetzt von Michael Wetzel, Wien1992, S. 105-176, hier: S. 148.87 So die Einschätzung von Thomas Kater, „Lorenzetti, Hobbes, Kant: Grundlegung des bilderlosen Friedens“,
in: Thomas Kater und Albert Kümmel (Hg.), Der verweigerte Friede, a.a.O., S. 53-88, hier: S. 74.88 Dieses nicht zu tun aber bedeutete, den Souverän zu entehren. Thomas Hobbes, Leviathan, a.a.O., X, S. 73 ff.89 Ebd., S. 75; dt. S. 75.90 Ebd., XLV, S. 469; dt. S. 548.
18
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
19/20
-
8/9/2019 Die Maske des Staates. Zum Begriff der Person und zur Theorie des Bildes in Thomas Hobbes’ Leviathan1
20/20
jeder
Vergegenwärtigung seiner Macht im Falle seiner Abwesenheit geschaffen worden ist95,
investiert das Frontispiz die repräsentative Macht des Bildes, um dem Souverän einen
„Zuwachs an Macht“96 und persönlicher Verehrung über seine unmittelbare Gegenwart
hinaus zu liefern. Wie nicht zuletzt Lévi-Strauss unterstreicht, bleibt jedoch die Wirkung
apotropäischen Maske unkalkulierbar, da sie den Schrecken, den sie bannt, zugleich auch
herbeirufen und ausstellen muß. Das macht ihre unvermeidbare Ambiguität aus97. Das Bildnis
und die Inszenierung der Macht müssen daher zum unberechenbaren Ursprung einer Autorität
erklärt werden, die für das Ungenügen des Rechts und die Gewaltsamkeit der Souveränität
einzustehen hat.
95 Ebd., S. 469; dt. S. 548.96Jacques Derrida, „Kraft der Trauer. Die Macht des Bildes bei Louis Marin“, übersetzt von Michael Wetzel, in:Michael Wetzel und Herta Wolf (Hg.), Der Entzug der Bilder. Visuelle Realitäten, München 1994, S. 13-35,hier: S. 18.97„Masques. A’ l’occasion de l’exposition organisée au Musée Guimet à Paris, Jean Poillon interroge ClaudeLévi-Strauss sur la nature et la signification du masque“, in: L’Œil 62 (1960), S. 29-36, hier: S. 30. Für diesenHinweis danke ich Erhard Schüttpelz, der mir zu Recht nahelegt, diese von Lévi-Strauss geltend gemachteAmbiguität auch hinsichtlich der Maske des Staates hervorzuheben.


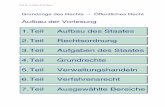


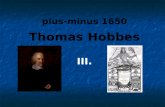

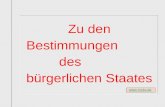





![Thomas Hobbes – ein humanistischer Aufklärer · Zeitschrift für Kultur und Weltanschauung Online-Ausgabe Berlin 2013, 6. [18.] Jg., H. 1 ISSN 2191-060X Grewel: Thomas Hobbes Text](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5e0e9a710d9b0a4fcd6bcc88/thomas-hobbes-a-ein-humanistischer-aufklrer-zeitschrift-fr-kultur-und-weltanschauung.jpg)