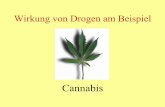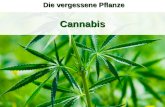Die Wirkung von Blei auf die NAD+-abhängige Malat-Dehydrogenase in Medicago sativa L. and Zebrina...
Transcript of Die Wirkung von Blei auf die NAD+-abhängige Malat-Dehydrogenase in Medicago sativa L. and Zebrina...
Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat Wien, Osterreich
Die Wirkung von Blei auf die NAD+-abhangige Malat-Dehydrogenase in Medicago sativa 1. und Zebrina pendula SCHNIZL.l)
The Effect of Lead on the NAD+-Dependent Malate Dehydrogenase in Medicago sativa L. and Zebrina pendula SCHNIZL.
RUDOLF MAIER
Mit 2 Abbildungen
Eingegangen am 10. Juni 1977· Angenommen am 2. Juli 1977
Summary
The relative activity and the pattern of the multiple forms of the NAD+-dependent malatedehydrogenase (E.C. 1.1.1.37) under lead treatment were studied at different temperatures (17°C and 32°q. For these investigations young plants of Medicago sativa and cuttings of Zebrina pendula were used.
In Medicago-roots grown in 500 ppm Pb solutions, MDH-activity decreases, and a loss of bands and a change in the pattern of multiple forms takes place. The MDH-activity and the bands' positions vary with the temperature given during the treatment. In contrast to Medicago-roots its leaves show an increase in MDH-activity at both temperatures.
In the leaves of Zebrina-cuttings cultivated at 17°C in 500 ppm Pb solutions, MDHactivity is almost quadrupled compared with the contro!' At the same time additional bands appear in the zymogram combined with positional changes.
Zebrina-cuttings grown at 32°C in 200 ppm Pb solutions show a raised MDH-activity in their leaves. The number and position of the bands remain constant, while 500 ppm Pb solutions reduce the MDH-activity to 30 % and diminish the number of bands.
Key words: malate dehydrogenase, multiple forms, lead, temperature.
1. Einleitung
Von der NAD+-abhangigen Malat-Dehydrogenase (E.C. 1.1.1.37) sind gegenwartig 4 Isoenzyme bekannt, wovon zwei im Cytoplasm a (s-MDH) auftreten und jeweils eines in den Mitochondrien (m-MDH) und in den «microbodies» lokalisiert ist (u. a. YAMAZAKI und TOLBERT) 1969; ROCHA und TING, 1970; WAINWRIGHT und TING, 1976). Die Isoenzyme der MDH zeigen einen Polymorphismus, der das Auftreten von mehr als 4 Banden in cler elektrophoretischen Darstellung erklart (z. B. WEIMBERG, 1967; HOCK, 1973; STERNBERG et aI., 1977).
1) Pub!. Nr. 4 der MAB-Projektgruppe Urbanokologie.
Z. Pjlanzenphysiol. Bd. 85. S. 319-326. 1977.
320 RUDOLF MAIER
Ein Eingriff auf die Thiol-Gruppen der MDH eine Moglichkeit der Schwer-metallwirkung - scheint bei der s-Form des Enzyms keine Auswirkung auf die Aktivitat zu haben. Dagegen reagiert die m-Form, da sie Thiol-Gruppen nahe der Bindungsseite des Co-Enzyms tragt, empfindlich auf SH-Gruppen inaktivierende Substanzen (Dbersicht bei BANASZAK und BRADSHAW, 1975).
Onter den von MATHYS (1975) untersuchten Oxidoreduktasen (Nitrat-Reduktase, Isocitrat-, Glukose-6-P- und Malat-Dehydrogenase) aus Silene cucubalus besitzt die MDH eine re1ativ hohe in vitro-Resistenz gegeniiber Schwermetallen. ERNST (1976) erwahnt ebenfalls diese Eigenschaft u. a. von der Bleiresistenz der MDH. 1m in vivo-Versuch mit 0,4 m Zn-Losung blieb die MDH sowohl in der Aktivitat (MATHYS, 1975) wie auch im e1ektrophoretischen Muster unbeeinfluBt (ERNST, 1976).
1m folgenden solI die Wirkung von Blei auf die Aktivitat und die multiplen Subformen der 16slichen Fraktion der MDH in Medicago sativa und Zebrina pendula dargestellt werden, wenn das Blei als Pb(NOsh iiber das Wurzel system appliziert wird.
2. Material und Methoden
Versuchspjlanzen und ihre Anzuchtbedingungen
Medicago sativa L. (Sorte: Elga) wurde aus Samen in Keimrollen angetrieben und anschlieBend auf gegliihten Quarzsand gebracht. Nach 2,5 Monaten in HOAGLAND-Nahrlosung wurde, nach Dbertragen der Jungpflanzen auf eine neue Quarzsandunterlage, das Blei in Form von Pb (NOsh zugesetzt und in der Folge mit aqua dest. dem Wasserbedarf der Pflanzen entsprochen. Anzuchtbedingungen: Temperatur: 22,5 DC, reI. Luftfeuchtigkeit: 80 ± 5010, Licht: 130 Wm-2, Philips HP1 400 W, 12 h. Behandlung: 500 ppm Pb in der Nitratform. Als Nitratausgleich wurde den unverbleiten Kontrollpflanzen die abgestimmte Nitratmenge in Form von NaNOs geboten. Verbleiungsdauer: 29 Tage; Temperatur: 17 DC hzw. 32 DC, ubrige Daten entsprechen den Anzuchtbedingungen.
Stecklinge von Zebrina pendula SCHNIZL. wurden in Bleilosungen (200 ppm und 500 ppm Ph) 27 Tage eingestellt und bei 17 DC bzw. 32 DC kultiviert. Die unverbleiten Kontrollpflanzen erhielten die dem Bleinitrat entsprechende Natriumnitratmenge. Die reI. Luftfeuchtigkeit betrug ± 70 %, Licht entspricht dem Versuchsansatz von Medicago.
Urn ernahrungsphysiologische Unterschiede auszuschalten, die sich bei Verwendung eincr VollnahrlOsung, die mit Blei versetzt wird, gegenuber bleifreier Nahrlosung ergeben konnte (vgl. z. B. OBERLANDER und ROTH, 1975), wurde wahrend der Verbleiung aqua dest. verwendet und diesem Blei- bzw. Natriumnitrat zugesetzt.
Enzymatische Analyse
Der Enzymrohextrakt wurde aus gleichen Mengen Frischmaterial hergestellt. Wie mehrfach in der Literatur belegt, laBt sich die Wirkung von Blei sehr friih als Beeintrachtigung von Parametern des Wasserhaushaltes nachweisen (z. B. GsCHLIFFNER, 1977; ROTHsCHEDL, 1977). 1m Wassergehalt konnte jedoch hei verbleiten und unverbleiten Pflanzen kein signifikanter Unterschied festgestellt werden (RoTHscHEDL, ALTGEYER, mundl.). Eine maximale Veranderung des mittleren Wassergehaltes von 8010 (Frischgewicht) ergab sich nach 19-tagiger Verbleiung mit 500 ppm bei 32 DC bei Zea mays (MAIER, 1977).
Urn das an den Wurzeln haftende Blei zu entfernen, was ja zur Ganze kaum moglich sein diirfte (SUCHODOLLER, 1967), wurden die Wurzeln im flieBenden Wasser 60 Minuten
Z. Pjlanzenphysiol. Bd. 85. S. 319-326. 1977.
MDH in bleibelasteten Pflanzen 321
gewaschen, nachtraglich in Titriplex II getaucht, neuerlich gewaschen und zwischen Filterpapier von Haftwasser bestmoglichst befreit. Mit einem modifizierten Puffer nach JACOBI (1974, vgl. MAIER, 1977), wurde aus frischen Blatt- bzw. Wurzelproben ein Enzym-Rohextrakt hergestellt und davon jeweils 1 ml mittels einer modifizierten FlachgelelektrophoreseApparatur (siehe FANKEL, 1973) in einem 20 010 Acrylamid-Gel aufgetrennt. Zum Nachweis der MDH-aktiven Zonen wurde das Gel in dem iiblicherweise verwendeten Reaktionsgemisch bestehend aus L-Apfelsaure, P-NAD+ (Boehringer), 3(4,5-Dimethylthiazolyl-2-2,5-diphenyl tetrazoliumbromid (MTT, Serva) und Phenazin-Methosulfat (Serva) eingelegt. Durch das Weglassen des Substrates in diesem Gemisch wurde der Test auf «nothing dehydrogenase» (SILVERSTEIN und GELLER, 1974) angestellt. Die Temperatur des Reaktionsgemisches betrug bei Medicago 25 DC, bei Zebrina 32 DC. Die Angabe der relativen Aktivitat ergibt sich aus der Summe der Peakflachen densitometrisch ausgewerteter Zymogramme (Vitatron TLD 100).
3. Ergebnisse
In vitro-Verhalten der MDH gegenuber Blei
Wie aus Angaben von ERNST (1976) zu entnehmen ist, tritt unter in-vitro-Bedingungen keine Stimulierung der MDH durch Blei auf, wie dies bisweilen an anderen Enzymen nachgewiesen wurde (HAMPP et aI., 1974).
Das Muster der multiplen Enzymformen unterliegt keinen Vedinderungen qualitativer Art (Verschiebungen in der Position, Neuauftreten oder Verschwinden von Banden), wenn dem pflanzlichen Rohextrakt (Zebrina) Bleinitrat zugesetzt wurde. Die Endkonzentration von Blei im gepufferten Extrakt betrug 100, 200 und 500 ppm bei 2 h-Einwirkdauer.
Wirkung von Blei auf die MDH in Wurzeln
Das Wurzelsystem ist unmittelbar der voUen Bleikonzentration ausgesetzt, wenn die Pflanzen in Bleilosungen eingestellt werden. Ein Ausdruck dafiir ist die in den Wurzeln von Medicago starke Reduzierung der MDH-Aktivitat bei gleichzeitig auffallenden Anderungen im Zymogramm (Abb. 1).
Die Behandlung der Pflanzen bei unterschiedlichen Temperaturen fiihrt bei den Kontrollpflanzen zu einer Abnahme der relativen Aktivitat der MDH bei einer Temperatur von 32 DC gegeniiber 17 DC. Gleichzcitig unterliegt das elektrophoretische Muster zahlen- und lagemagigen Veranderungen. Wird den Pflanzen zusatzlich Blei geboten, so fallt bei beidenTemperaturen die relative Aktivitat der MDH, bei gleichzeitiger Verschiebung des Bandenmusters im Zymogramm (Abb. 1).
Wirkung von Blei auf die MDH der Blatter
Obwohl bekannt ist, dag der iiberwiegende Anteil des die Wurzeln erreichenden Bleis in oder auf dieser akkummuliert (u. a. SUCHODOLLER, 1967), reagieren Enzyme in den Blattern empfindlich auf bleihaltige Substrate. Die Messung der Aktivitat bestimmter Enzyme wie z. B. der Peroxidase, ergaben einen Anstieg der Aktivitat in den Blattern verbleiter Pflanzen gegeniiber jener der KontroUen (ZUBER et aI.,
Z. P/lanzenphysiol. Bd. 85. S. 319-326. 1977.
322 RUDOLF MAIER
1973; FLi,iCKIGER, 1975). Jedoch hat dieses Ergebnis, sofern es iiberhaupt an einem Enzym nachgewiesen wurde, nicht uneingeschrankte Geltung. Bestimmte Faktoren (u. a. die okologischen Parameter, Bleiempfindlichkeit der Pflanzenart, Schadstoffkonzentration, Einwirkzeit, Organspezifitat: Wurzel/Blatt) modifizieren das Ergebnis, wie dies z. B. im FaIle der Esterase gezeigt werden kann (MAIER, 1977).
Genauso wie in der Wurzel reagiert auch im Blatt die MDH auf unterschiedliche Anzuchttemperaturen. Die zusatzlichen Veranderungen, die durch eine Verbleiung gegeben sind, lassen sich bei Medicago in einer Erhohung der MDH-Aktivitat nachweisen. Es kommt bei beiden Anzuchttemperaturen (17°C und 32°C) zu einer, wenn auch graduell unterschiedlichen Erhohung der Aktivitat in den verbleiten Pflanzen (Abb. 1). Bei lebrina ist ebenfalls in der verbleiten 17 °C-Serie im Vergleich zu den bleifrei gezogenen Pflanzen die Aktivitat etwa 4fach erhoht (500 ppm Pb). In der 32 °C-Serie Iafh sich dagegen die Enzymstimulierung nur bei der niedrigeren Bleistufe (200 ppm) nachweis en, wahrend bei 500 ppm pb der Aktivitatswert unter jenen der Kontrollpflanzen fallt (Einschrankung auf fast 30 Ufo, Abb. 2).
6 100 * % 80
60
40
PPM Pb
WURZEl
17'C
A______ 32'C :4 20 -----------A
~~lJ~ ~B+~8
17'C 32'C i
PPM Pb 500
Fig. 1: Medicago sativa: Relative activity of MDH in leaves and relative activity and multiple forms of MDH in roots of untreated and Pb-treated plants cultivated at different temperatures. --: 17°C, - - - -: 32°C. Reference values: activity of untreated plant organs (root or leaves) = 100 % (",-). Zymogram: +, -: anode, cathode; K: untreated roots,S: 500 ppm Pb treated. For symbols of the estimated bands' intensity see figure 2_
z. PJlanzenphysiol. Bd. 85. S. 319-326. 1977.
MDH in bleibelasteten Pflanzen 323
400 % ... 11'C
360 l1'C
320
280
240 Ji. +
200
160
120 I~ ---- , -- , ............ '"
" 32'C 80 " , , , 40 ,
'll. +
32'C 0 200 PPM Ph 500
Fig. 2: Zebrina pendula: Relative activity and multiple forms of the MDH of untreated and Pb-treated cuttings cultivated at different temperatures. left side: -- 17 °C, - - - - 32 °C; Reference values: control 17 °C or 32°C = 100 0/0. right side: zymogram, downwards 17°C, upwards 32°C; +, -: anode, cathode; K: untreated leaves, 2: 200 ppm,S: 500 ppm lead treated cuttings; estimated bands' intensity: black: very strong, crossed: strong, lined: medium strong, lined-dotted: slight, dotted: very slight.
Das Muster der multiplen Enzymformen in den unverbleiten Kontrollen von Zebrina zeigt ebenfalls Abweichungen, wenn die Pflanzen bei verschiedenen Temperaturen angezogen wurden. In den Blattern jener Pflanzen, die bei 32°C kultiviert wurden, finden sich mehr MDH-positive Zonen im Zymogramm als bei jenen der 17 °C-Serie (Abb. 2). Waren die Pflanzen verbleit, so ist im Vergleich zu den Kontroll en wiederum eine zahlen- und lagema6ige Veranderung der Banden zu beobachten. In der 17 °C-Serie nimmt bei einer Bleibelastung der Pflanze von 500 ppm die Zahl der substrataktiven Zonen deutlich zu, im kathodischen wie im anodischen Bereich des Zymogramms treten neue Banden auf (Abb. 2).
Ahnlich wie bei 17°C tritt auch bei 32°C/200 ppm Pb keine Veranderung in der Position der Banden auf. In der Intensitat ist wiederum libereinstimmend mit der 17°C-Serie eine Zunahme feststellbar, wodurch sich ja die erhohte Aktivitat ergibt. 32 °C/SOO ppm Pb haben bereits eine Abnahme der Bandenzahl zur Foige (Abb.2).
Bei allen Untersuchungen, die auf den molekularen Aufbau von Enzymen hinzielen, spielt das in vivo/in vitro-Problem mit hinein. Unter anderem kann es zu einer Veranderung des Bandenmusters kommen, wenn, wie in den vorliegenden Untersu-
Z. Pjlanzenphysiol. Bd. 85. S. 319-326. 1977.
324 RUDOLF MAIER
chung en, zur Extraktion p-Mercaptoathanol verwendet wurde. Nach HOCK (1973) kommt es dadurch zu einer Dezimierung der Bandenzahl als Folge einer Umwandlung zu einer einheitlichen MDH. Die spezifische Aktivitat der MDH wurde nach HOCK dabei nicht beeinfluik Allerdings konnte dieser Ausfall an Enzymbanden nur an noch nicht 3 Tage alten Wassermelonenkeimlingen festgestellt werden. Bei alteren Pflanzen war dies nicht der Fall und dlirfte somit flir die vorliegenden Untersuchungen keine Bedeutung haben. «Nothing dehydrogenase», die ebenfalls das Bandenmuster verandern konnte, wurde nicht beobachtet.
4. Diskussion
Die vielfach nachgewiesene Akkumulation von Blei in den Pflanzenwurzeln (SuCHODOLLER, 1967; KELLER und ZUBER, 1970; BRaYER et aI., 1972) macht wahrscheinlich, da~ die starke Reduzierung der MDH-Aktivitat in den Wurzeln auf einen direkten Einflu~ von Blei auf das Enzymmoleklil zurlickgeht. Jedoch werden auch Bleiwirkungen, die in die Synthese- bzw. Abbauwege der MDH eingreifen, sich im Aktivitatsverhalten der MDH niederschlagen.
Da ein Stimulierungseffekt durch Blei am Enzym in vitro nicht nachgewiesen ist, mu~ die in den verbleiten Pflanzen gefundene Aktivitatssteigerung der MDH in den Blattern als sekundarer Bleieffekt aufgefa~t werden. Sofern es sich urn Blatter handelt, in denen die MDH-Aktivitat liberprtift wurde, dtirfte es sich auch in jenem Fall, in dem die Aktivitat unter den «Normalwert» der unverbleiten Blatter sinkt (Abb. 2), zumindest im tiberwiegenden Ma~e urn sekundare und nicht primare Bleiwirkungen handeln. Da ja der Stoffwechsel der Wurzel in direkten Zusammenhang mit jenem des Blattes steht, drticken sich Bleischaden im Stoffwechsel der Wurzel zunachst in einer erhohten Enzymaktivitat in den Blattern aus, im fortgeschrittenen Stadium wird die Stimulierung der Blatt-MDH von einer Hemmung abgelOst. Die zusatzliche Moglichkeit von Zebrina, Blei auch tiber den "offenen" Spro~ aufzunehmen, dtirfte mit ein Grund ftir die im Vergleich zu Medicago hohere Bleiempfindlichkeit sein. Dennoch ist anzunehmen, da~ dem Blei in Blattern in Hinblick auf die Aktivitat der MDH eine untergeordnete Rolle zukommt, da sich ansonsten die urn das fast 4fach erhohte MDH-Aktivitat im Blatt von Zebrina bei einer Bleibelastung der Pflanze von 500 ppm/17 DC nicht erklaren lie~e (Abb. 2). 500 ppm/32 DC ftihren dagegen zu einer Aktivitatsabnahme unter den Wert der unverbleiten Pflanzen (Abb. 2). Einerseits konnte man diese Aktivitatseinbu~e auf einen bei hoheren Temperaturen vermehrten Transport von Blei in die Blatter erklaren, andererseits, und dies dtirfte der ausschlaggebende Grund sein, ftihren die bei hoheren Temperaturen verstarkt ablaufenden physiologischen Prozesse zu einer Beschleunigung der Schadenserweiterung. Die wei taus schwachere Stimulierung der MDH bei 200 ppm/32 DC im Vergleich zur 17 DC-Serie zeigt ja bereits die Zunahme von hemmenden Einfltissen an, die dann bei 500 ppm Pb schliemich tiberwiegen (Abb.2).
z. PJlanzenphysiol. Ed. 85. S. 319-326.1977.
MDH in bleibelasteten Pflanzen 325
Verschiebungen in der Position, wie auch die Abanderung der Bandenzahl im Zymogramm der MDH durch Blei in der pflanze konnen nur aus Veranderungen des Stoffwechsels resultieren, wie der in vitro-Versuch zeigt. Aus dem Bandenmuster ergibt sich, dag das Blei in der Pflanze zunachst keine qualitative Veranderung, im Sinne lage- und zahlenmagiger Verschiebungen auslost, dag aber in der Intensitat einzelner Banden bereits Veranderungen vorliegen, die zur Anhebung der MDH-Aktivitat ftihren. Eine weitere Verstarkung der Bleiwirkung hat eine lagemagige Verschiebung bei gleichzeitiger Vermehrung substrataktiver Zonen zur Folge, die Gesamtaktivitat steigt weiter an. Der nachste Schritt der Bleiwirkung wtirde dann die Abnahme an Banden und damit den Verlust an Aktivitat gegentiber der Kontrollpflanze bedeuten (Abb. 2).
Dank
Fiir die finanzielle Unterstiitzung bin ich der Osterr. Akademie der Wissenschaften, Abt. Urbanokologie sowie dem Magistrat der Stadt Wien zu Dank verpflichtet.
Literatur
BANASZAK, L. J. and R. A. BRADSHAW: Malate dehydrogenases. In: BOYER, P. D. (Ed.), The enzymes. Bd. XII A, 3. Auf!., 369-396. Academic press, London, 1975.
BERGMEYER, H. U.: Methoden der enzymatischen Analyse. Bd. 1, 2. Auf!., Verlag Chemie, Weinheim, 1970.
BROYER, T. c., C. M. JOHNSON, and R. E. PAULL: Some aspects of lead in plant nutrition. Plant and soil 36, 301-313 (1972).
ERNST, W.: Physiological and biochemical aspects of metal tolerance. In: MANSFIELD, T. A. (Ed.), Effects of air pollutants on plants, 115-133, Soc. f. expl. BioI. Seminar Series 1. Cambridge University Press, Cambridge, 1976.
FANKEL, R.: Fruchtproteine und ihre gelelektrophoretische Auftrennung. Diss. Univ. f. Bodenkultur Wien, 1973.
FLijCKIGER, W.: Der EinfluE aufgespriihter Bleilosungen auf physiologische Prozesse bei Ricinus communis L. Ber. Nr. 142 d. Eidg. Anstalt f. d. forst!' Versuchswesen, Birmensdorf, 1975.
GSCHLIFFNER, CH.: Die Wirkung einze1ner und kombinierter Umwe1tgifte auf die Weitungsfahigkeit und Beweglichkeit von Spaltoffnungen des Amaryllis-Typ. Diss. Univ. Wien, 1977.
HAMPP, R. und H. ZIEGLER: Der EinfluE von Bleiionen auf Enzyme der Chlorophyllbiosynthese. Z. Naturforsch. 29 c, 552-558 (1974).
HOCK, B.: Isoenzyme der Malat-Dehydrogenase aus Wasserme1onenkeimlingen: Mikroheterogenitat und deren Aufhebung bei der Samenkeimung. Planta 110, 329-344 (1973).
JACOBI, G.: Biochemische Cytologie der Pflanzenzelle. Ein Praktikum. Georg Thieme, Stuttgart, 1974.
KELLER, TH. und R. ZUBER: Ober die Bleiaufnahme und die Bleiverteilung in jungen Fichten. Forstw. Cb!. 89, 20-26 (1970).
MAIER, R.: Der EinfluE von Blei auf die Aktivitat der Esterase und ihrer multiplen Formen. Biochem. Physio!. Pflanzen 707, 171, 455-468 (1977).
MATHYS, W.: Enzymes of heavy-metal-resistant and non resistant populations of Silene cucubalus and their interaction with some heavy metals in vitro und in vivo. Physio!. Plant. 33, 161-165 (1975).
z. Pjlanzenphysiol. Bd. 85. S. 319-326. 1977.
326 RUDOLF MAIER
OBERLANDER, H. E. und K. ROTH: Die Hemmung der Nahrstoffaufnahme von Gerste durch Schwermetalle. Die Naturwissenschaften 4,184 (1975).
ROCHA, V. and 1. P. TING: Tissue distribution of microbody, mitochondrial, and soluble malate dehydrogenase isoenzymes. Plant. Physio!. 46, 754-756 (1970).
ROTHSCHEDL, R.: Wasserhaushalt, Transpiration und Austrocknungsresistenz verschiedener Ruderalpflanzen nach Einzel- und kombinierter Schadigung durch Umweltgifte. Diss. Univ. Wien, 1977.
SILVERSTEIN, E. and H. GELLER: Studies on the nature of non-specific staining in nitroblue tetrazolium detection of dehydrogenases in polyacrylamid gel electrophoresis (<<nothing dehydrogenase»). J. of Chromatogr. 101,327-337 (1974).
STERNBERG, L., 1. P. TING, and Z. HANSCOM: Polymorphism of microbody malate dehydrogenase in Opuntia basilaris. Plant. Physio!. 59, 329-330 (1977).
SUCHODOLLER, A.: Untersuchungen uber den Bleigehalt von Pflanzen in der Nahe von StraEen und uber die Aufnahme und Translokation von Blei durch Pflanzen. Ber. schweiz. bot. Ges. 77, 266-308 (1967).
WAINWRIGHT, 1. M. and 1. P. TING: Microbody malate dehydrogenase isozyme in cotyledons of Cucumis sativus L. during development. Plant. Physio!. 58, 447-452 (1976).
WEIMBERG, R.: An electrophoretic analysis of the isozymes of malate dehydrogenase in several different plants. Plant. Physio!. 43, 622-628 (1968).
YAMAZAKI, R. K. and N. E. TOLBERT: Malate dehydrogenase in leaf peroxysomes. Biochim. Biophys. Acta 178, 11-20 (1969).
ZUBER, R., P. MOERI e E. BOVAY: L'assorbimento del piombo da parte della pianta tramite la radice. Con studio particolare sull' attivita enzimatica. Parte seconda. Schweiz, Landw. Forschg. 12,291-306 (1973).
RUDOLF MAIER, Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, A-10to Wien.
Z. Pjlanzenphysiol. Bd. 85. S. 319-326.1977.