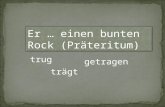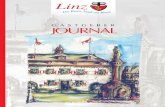FernUni Perspektive · nen und -Absolventen bei Alumni-Feiern, die von der Freundesgesell-schaft...
Transcript of FernUni Perspektive · nen und -Absolventen bei Alumni-Feiern, die von der Freundesgesell-schaft...

FernUni PerspektiveZeitung für Angehörige, Freundinnen und Freunde der FernUniversität
Sommer 2017Ausgabe60
Intelligente BürsteIn seiner Dissertation hat Dietmar Pres-
tel wichtige Grundlagen für die Entwick-
lung „intelligenter Zahnbürsten für je-
dermann“ entwickelt. Seite 11
Studium internationaleDas FernUni-interne Förderprogramm
„Innovative Lehre“ (FILeh) unterstützt
neue Ideen und innovative Konzepte fürs
Lehren und Lernen. Seite 14
Stabile HochzeitenEin Kölner Professor hat in Hagen sein
Mathematik-Studium mit einer Bache-
lorarbeit über glücksversprechende Be-
ziehungen abgeschlossen. Seite 18
Fortsetzung Seite 2
Fortsetzung Seite 17
*002
5375
08*
Editorial
002
537
508
9
9910
- 5
- 0
2 -
HZ
1
Deutschlandstipendiatinnen und Deutschlandstipendiaten
Studium und Stipendium sind roter Faden im Leben
Versammlung der Freundesgesellschaft
Eine der spannendsten Universitäten Deutschlands Die Redaktion hatte Sie gefragt, lie-be Leserinnen und Leser, welche Wünsche Sie an unsere Medien ha-ben. Wie sollte Ihrer Meinung nach die FernUni-Perspektive künftig aus-sehen? Oder möchten Sie lieber on-line darüber informiert werden, was es an der FernUniversität Neues gibt?
Ganz herzlichen Dank für Ihre groß-artige Beteiligung. Ihre fundierten Rückmeldungen sind für uns ein Schatz, den wir in den kommenden Wochen auswerten werden, um Sie dann in naher Zukunft mit einem neuen Konzept für unser Informati-onsangebot zu überraschen.
Susanne Bossemeyer, Pressesprecherin
Belastungssituation
Psychologie im Wintersemester ohne Numerus ClaususFür den hoch nachgefragten Mas-terstudiengang Psychologie wird die FernUniversität in Hagen im kommenden Wintersemester kei-nen Numerus Clausus (NC) ein-führen. Das ist das Ergebnis ei-nes Gespräches von Hochschullei-tung, Vertretern der Psychologie und dem nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerium. Es gel-ten weiterhin die bisherigen Zu-gangsvoraussetzungen. Mit Unter-stützung der Hochschulleitung und zusätzlichen befristeten Professu-
ren und Mitarbeitenden werden die psychologischen Lehrgebiete ver-suchen, die Überlast im kommen-den Semester zu bewältigen und dabei die Qualität in der Lehre si-cherzustellen.
Unstrittig ist zwischen allen Sei-ten, dass die Belastungssituation im Fach Psychologie die Grenze des Er-träglichen erreicht hat. Das gilt glei-chermaßen für die Lehrenden wie für die Studierenden. Denn auch im Fernstudium werden für das be-
rufsqualifizierende Masterstudium diagnostisch ausgerichtete Prakti-kumsplätze benötigt und Seminare in kleineren Gruppen veranstaltet werden. Nicht zuletzt sind für die empirisch ausgerichteten Master-thesen entsprechende Betreuungs-kapazitäten erforderlich. Auch die Studierenden im Studiengang spü-ren mittlerweile die Engpässe.
Nachdem ein ganzes Bündel von Maßnahmen keinen dauerhaften Erfolg gezeigt hat und Kapazitä-
Die einzig wirkliche Konstante im Leben ist die Veränderung, besagt ein Sprichwort. „Trotzdem brau-chen wir Menschen einen roten Fa-den. Für mich bilden mein Studium und mein Stipendium einen die-ser roten Fäden“, fügt Marion Nis-sen hinzu. Die 44-jährige Diplom-Betriebswirtin aus Niebüll studiert an der FernUniversität in Hagen er-folgreich Psychologie und bekommt zum dritten Mal ein Deutschlandsti-pendium aus dem Bundesförder-programm – als Anerkennung für gute Noten und gesellschaftliches Engagement. Gemeinsam mit wei-teren aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiaten kam Marion Nissen zu einem Treffen nach Hagen.
Interessante Eindrücke vermittelte eine Betriebsbesichtigung den Stipendiatinnen und Stipendiaten (hier ein Teil der Gruppe). (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
„Die FernUniversität ist eine der spannendsten Universitäten in Deutschland!“ Etwas mehr als ein Jahr nach ihrer ersten Rede bei der Gesellschaft der Freunde der Fern-Universität e.V. zog die Rektorin der Hochschule, Prof. Dr. Ada Pel-lert, eine positive persönliche Bi-lanz: „Ich fühle mich angekom-men!“ Hatte sie bei der Mitglieder-versammlung 2016 noch „eher the-oretisch“ über Lebenslanges Lernen gesprochen, kann sie jetzt sagen: „Die FernUni ist wirklich eine Uni-versität des Lebenslangen Lernens! Hier habe ich viele der Mission verpflichtete Menschen kennenge-lernt, die der FernUniversität sehr verbunden sind.“
Der Vorstand der Freundesgesellschaft besprach vor der Mitgliederversammlung die nächsten Aktivitäten. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
ten endlich sind, sollte ein Nume-rus Clausus die Zahl der Einschrei-bungen in den Masterstudiengang reduzieren. Allerdings bietet das Hochschulzulassungsgesetz, nach dem dieses Verfahren abgewickelt werden müsste, für die Besonder-heiten der FernUniversitäts-Studie-renden keinen geeigneten Rahmen. Daher ist die schnelle Einführung ei-nes NCs zum kommenden Winter-semester in einer für die FernUni-versität und ihre Studierenden an-gemessenen Form nicht möglich.
Die FernUniversität wird daher mit dem Wissenschaftsministeri-um weiter über ein für Hochschu-le und Studierende passendes NC-Verfahren verhandeln, sie plant des-sen Einführung zum Wintersemes-ter 2018/19.
Parallel dazu wird sie ihre Anstren-gungen verstärken, eine höhere Grundfinanzierung für die Hoch-schule zu erwirken, um den Lehr-körper z.B. in der Psychologie dau-erhaft aufzustocken. bos
Studiengang „EJP“
AkkreditiertDas ergänzende Fernstudium „Ers-te Juristische Prüfung“ (EJP) der FernUniversität ist jetzt akkredi-tiert. Die Erste Juristische Prüfung benötigt, wer Richterin, Richter, Staats- oder Rechtsanwältin bzw. -anwalt werden will. Bachelor-of-Laws-Studiengänge verfolgen an-dere Ziele, die Hagener Rechtwis-senschaft etwa bildet Wirtschafts-juristen aus. Der Studiengang soll ihnen die fehlenden Bestandteile vermitteln, um zur Staatsprüfung zugelassen zu werden.
Angesprochen werden auch Inter-essierte mit vergleichbarer Ausbil-dung anderer Unis. Da
Weitere Informationen: www.fernuni-hagen.de/per60-01

Seite 2 FernUni Perspektive
Campus
Freundesgesellschaft
Bewegende Themen
Fortsetzung von Seite 1
FernUni-Dialog
Verwaltung trifft WissenschaftVerwaltung trifft Wissenschaft an der FernUniversität in Hagen – in ei-ner Café-Lounge, an Themen-Stän-den und bei Kurzvorträgen in der „Speakers‘ Corner“. Der 1. Fern-Uni-Dialog kam bei Beschäftigten in Wissenschaft, Verwaltung und Technik gleichermaßen gut an. Mal für eine halbe Stunde zwischen-durch, in der Mittagspause oder gezielt bei einzelnen Kurzvorträ-gen: Bei der Premiere mit einem Mix aus Informationen, Mitmach-Angeboten und Gesprächen nutz-ten Hunderte Beschäftige das neue
Messe-Format, um Einblicke in die Aufgaben anderer Bereiche zu ge-winnen. Wie funktioniert das Fern-studium im Detail? Wie werden die richtigen „Köpfe“ gewonnen? Was macht die Studienberatung? Was gibt es bei der Veranstaltungsorga-nisation zu beachten? Gezielt nach-zufragen, Angebote auszuprobie-ren und sich auszutauschen ist eine gute Grundlage für eine immer bes-sere Zusammenarbeit in einer so großen Organisation.Die Diskussion um eine Fortsetzung des FernUni-Dialogs hat bereits begonnen. can
Prof. Stefan Smolnik hielt einen Kurzvortrag in der Speakers‘ Corner. (Fotos: FernUniversität, Pressestelle)
In ihrem ersten Jahr als Rektorin traf Ada Pellert viele typische Fern-Uni-Studierende und -Absolventin-nen und -Absolventen bei Alumni-Feiern, die von der Freundesgesell-schaft unterstützt wurden. Men-schen mit bunten Biografien, „die dazu beitragen, die FernUniversität zu etwas Besonderem zu machen“.
Den Rückblick auf die Zeit seit der letzten Versammlung begann die Rektorin mit den Zielsetzungen des neuen Rektorats. Es will die Hoch-schule als forschende Universität sichtbarer machen. Forscherinnen und Forscher sollen dafür gut unter-stützt werden. Dabei geht es aber auch darum, sie bei der Bewälti-
Jahrbuch 2016Pünktlich zur Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde der FernUniversität e.V. ist das Jahrbuch 2016 erschienen, dass sie gemein-sam mit der Hochschule herausgibt. Die Leserinnen und Leser erwar-tet ein Themenbogen aus Grundlagenforschung und Analysen aktu-eller Themen, das Neueste aus der universitären Fernlehre und von in-teressanten Menschen. www.fernuni-hagen.de/per60-02
i
Blog aus demGerichtssaalNahe der FernUniversität in Hagen wurden im Mai 2016 vier Menschen durch einen Unfall bei einem ille-galen Autorennen schwer verletzt. Am 29. Mai 2017 begann der Pro-zess vor dem Hagener Landgericht. Weitere Termine: 1., 12. und 29. Juni sowie 3. Juli. Prof. Dr. Osman Isfen, Lehrstuhl für Wirtschaftsstraf-recht und Strafprozessrecht, ist in der Verhandlung anwesend, um sie wissenschaftlich zu begleiten und Beiträge in sein Blog „Audiatur et altera pars“ einzustellen. Proe (https://isfen.fernuni-hagen.de/).
Die Sicht eines Historikers auf IS, Salafismus und Dschihadismus vermittelte Prof. Jürgen G. Nagel. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
FernUni-Rektorin Prof. Ada Pellert(Foto: FernUniversität, Pressestelle)
GdF-Vorsitzender Frank Walter
(Foto: FernUniversität, Pressestelle)
gung ihrer hohen Belastung durch Lehraufgaben zu unterstützen.
Bewegende ThemenAda Pellert: „Von Lebenslangem Lernen, von Diversität und von Di-gitalisierung versteht die FernUni-versität mehr als alle anderen. Die Vernetzung von Professorinnen und Professoren aller Fakultäten bei die-sem Forschungsschwerpunkt lässt sich gut an. Mit der Digitalisierung müssen wir uns einfach beschäfti-gen“. Zum einen in der Forschung. Zum anderen wurde die Digitale Hochschule NRW gegründet, bei der alle NRW-Hochschulen mitar-beiten. Die zentrale Frage „Was heißt Digitalisierung?“ stellt sich für die Gesellschaft, für die Hoch-
schulen und natürlich auch für die FernUniversität. Sie hat die Spre-cherfunktion für die Digitale Hoch-schule übernommen.
„Bildung und Vielfalt“ ist ein weite-res zentrales Thema, das die Fern-Universität bewegt. Pellert fragt: Welche Bildungsbiografien haben unsere Studierenden? Wie können wir ihre höchst unterschiedlichen Anforderungen besser befriedigen? Und wie unsere Lösungen zum Nut-zen aller Studierenden verwenden? Sicher ist die FernUniversität bereits sehr stark in Lehre und Studium, aber „wir können noch besser wer-den.“ Die Kehrseite: „Während an-dere Hochschulen Diversität oft als
Störung empfinden, sagen wir: ‚Das ist das moderne Leben!‘ Wir freuen uns über jeden mehr, der studiert. Aber wie können wir das ressour-cenmäßig bewältigen? Studieren-de haben nichts davon, wenn wir alle aufnehmen, sie aber nicht be-treuen können.“
Großes Interesse an Transfer„Umwelt, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit“ vereint Professoren mehrerer Fakultäten, gemeinsame Forschungsprojekte sind schon auf dem Weg: „Das könnte auch als Schnittstelle zur regionalen Wirt-schaft interessant sein“, so die Rek-torin. „Der Transfer in die regiona-le Wirtschaft ist uns wichtig!“ (sie-he Seite 10)
Gemeinsam mit Kanzlerin Regina Zdebel versucht Pellert, in der Po-litik die Besonderheiten der Fern-Universität zu verdeutlichen. Etwa, dass ihre Studierenden oft nur an Wissenserwerb und nicht an Ab-schlüssen interessiert sind. Ein Ziel, das vielen gesetzlichen Vorschrif-ten und menschlichen Denkweisen zuwiderläuft. Auf der bundespoliti-schen Ebene will die Hochschullei-tung vermitteln, dass die FernUni-versität aufgrund ihrer bundeswei-ten Wirkung einen besonderen Sta-tus hat, der „finanziell unterfüttert“ werden muss.
Steigendes InteresseProf. Pellert hat durchaus den Ein-druck, dass die Fragen, die für die FernUniversität wichtig sind, inzwi-schen auch in der Politik – insbe-sondere in NRW – und in der Hoch-schullandschaft diskutiert werden.
Auf der regionalen Seite bemerkt die Rektorin, dass sich immer mehr bewegt: „Es wird gesehen, dass es kein Gegensatz ist, eine internatio-nal anerkannte Universität zu sein, die gleichzeitig regional wirksam ist. So verstärkt die FernUni ihre Kon-takte zur regionalen Wirtschaft und ebenso zur Stadt Hagen. Nur wenn Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten, kann man etwas erreichen.“
Auf jeden Fall nimmt das Interesse an der FernUniversität immer wei-ter zu – nicht zuletzt durch das Wir-ken der Freundesgesellschaft (GdF).
Investitionen in die ZukunftAuch im Jahr 2017 fördert sie wie-der viele Projekte an der FernUni-versität. „Ein besonderes Anliegen ist – wie in den letzten Jahren – die Förderung von Studierenden und jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern“, erläuterte
ihr Vorsitzender Frank Walter. „Wir werden auch 2017 wieder zehn Deutschlandstipendien finanzieren. Die Förderung leistungsstarker Stu-dierender und Wissenschaftlerin-nen und Wissenschaftler ist eine Investition in die Zukunft“, die sich auch für Spenderinnen und Spen-der vielfältig lohnt (siehe Seiten 1 und 17). Walter bat Unternehmen wie auch Privatpersonen, die GdF hierbei zu unterstützen – durch Be-träge in beliebiger Höhe.
Fast 1.200 MitgliederDies ist umso wichtiger, als die Bei-tragseinnahmen durch eine erst-mals sinkende Mitgliederzahl zu-rückgegangen sind: „Nicht erfreu-lich, aber auch nicht richtig proble-matisch“, betonte Geschäftsführer Dr. h.c. Hans-Peter Rapp-Frick. Im-merhin hat die GdF fast 1.200 Mit-glieder, davon rund 850 Absolven-tinnen und Absolventen. Dennoch bat er darum, vor allem bei Un-
ternehmen für eine Mitgliedschaft zu werben. Im Jahr 2016 konnten zwei neue regionale Absolventen-gruppen der GdF ins Leben geru-fen werden: in der Region Hagen und in Österreich.
Wissenschaftlicher Vortrag zukomplexer ProblematikZum Abschluss hielt der FernUni-His-toriker Prof. Dr. Jürgen G. Nagel ei-nen Vortrag über „IS, Salafismus und Dschihadismus aus Sicht eines Histo-
rikers“. Deutlich wurde darin, dass es im Islam zahlreiche, oft verfein-dete Strömungen gibt, die seit dem Tod des Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert zu der heutigen, höchst komplexen Problematik geführt ha-ben. Für sie gibt es keine einfache Lösung. Auch der sich abzeichnen-de Zerfall des Territoriums des „Isla-mischen Staats“ wird nach Einschät-zung von Prof. Jürgen G. Nagel nicht das Ende der Gewalt bringen. Da

FernUni Perspektive Seite 3
Zehn Jahre BürgerUni Coesfeld
Aktuelle Fragen aus der Gesellschaft„Vital, robust, akzeptiert, mit auf-fälliger Treue zum Erfolg“ – Mit die-sen positiven Eigenschaften charak-terisierte die Soziologin Jun.-Prof. Dr. Dorett Funcke die „BürgerUni-versität Coesfeld“ auf der Feier zum zehnjährigen Jubiläum im vollbe-setzten Vortragssaal des münster-ländischen Regionalzentrums. „Die BürgerUni ist ein ,Ort der Gesellig-keit‘. Sie folgt einem Grundsatz aus der Zeit der Aufklärung: Der Redner möge allgemeinverständlich sein.“ Dieses Motto hat bis heute Gültig-keit für das Angebot der FernUni-versität in Coesfeld. Eine Zutat des Erfolgsrezepts.
Die BürgerUniversität ist ohne Per-sonen nicht denkbar: Allen voran der Coesfelder Kurt Ernsting mit sei-ner Familie und dem Unternehmen, das eine Stiftungsprofessur am Ins-titut für Soziologie der FernUniversi-tät in Hagen stiftete. Die Hochschul-leitung um den damaligen Rektor Prof. Dr.-Ing. Helmut Hoyer sowie der Soziologie-Professor Dr. Heinz Abels engagierten sich ebenso wie die Stadt Coesfeld und ihr Bürger-meister Heinz Öhmann.
Die „BürgerUniversität Coesfeld“ ist eng verknüpft mit der Stiftungs-professur, um Forschungsergebnis-se in verständlichen Vorlesungen und Seminaren zu aktuellen Frage-stellungen der Gesellschaft zu be-handeln. Die Saat des Gründungs-gedanken ging auf.
Für Themen derWissenschaft begeistern„Die BürgerUniversität ist ein Ort der Geselligkeit, der für Wissen-
schaftsthemen begeistert und dazu einlädt, über Aktuelles und Grund-sätzliches nachzudenken. Durchaus auch in Form eines kritischen En-gagements für eine demokratische Zivilgesellschaft“, ordnete Dorett Funcke ein. Die Wissenschaftlerin hat seit Oktober 2013 die Ernsting’s family-Juniorstiftungsprofessur für „Soziologie familialer Lebensfor-men, Netzwerk und Gemeinschaf-ten“ und die Betreuung der Veran-staltungsreihe inne.
Zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FernUni-versität und anderer Hochschulen haben an den bisherigen Veranstal-tungen der BürgerUniversität ihre Sicht auf die Gesellschaft vorgestellt und einen großen Stamm an inte-ressierten Bürgerinnen und Bürger weit über die Grenzen Coesfelds hi-naus gefunden.
„Es bedarf eben dieser Wissen-schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, die ein solches Konzept wie die BürgerUniversität als Auftrag be-greifen“, würdigte FernUni-Rekto-rin Prof. Dr. Ada Pellert – und nannte weitere Personen, die die Coesfel-der BürgerUni vorantreiben: Dorett Funcke sei ein „wichtiger Kristalli-sationspunkt“, Bärbel Thesing als Leiterin des Regionalzentrums die „soziale Schlagader“. „Wir freuen uns auf die nächsten 10, 20…30 Jahre BürgerUniversität Coesfeld“, schloss die Rektorin.
Festvortrag: „Digitalisierung verändert Gewohnheitsmuster“ Als Festredner des Jubiläumsabends sprach Prof. Dr. Timm Homann, geschäftsführendes Vorstandsmit-glied der Ernsting‘s family Unter-nehmensgruppe, über „Digita-le Transformation im Handel“. Für den Handel bedeute Digitalisierung „pure Verdrängung“, wies Hom-ann auf verödende Innenstädte hin. „Die Digitalisierung verändert un-sere Gewohnheitsmuster – und wir stehen noch ganz am Anfang die-ses Revolutionssturms.“ aw
www.fernuni-hagen.de/per60-03
Berufungen
DHV bestätigt GütesiegelDie FernUniversität in Hagen, die seit 2014 Inhaberin des DHV-Gütesie-gels für faire und transparente Berufungsverhandlungen ist, darf die Aus-zeichnung für weitere fünf Jahre führen. Bundesweit als vierte Universi-tät hat sie damit das nach drei Jahren anstehende Re-Audit-Verfahren er-folgreich durchlaufen.
Berufungsverhandlungen an der FernUniversität seien weiterhin von ho-her Professionalität, Gleichförmigkeit und Klarheit geprägt, hob der Deut-sche Hochschulverband (DHV) hervor. Mit der lobenswerten Implementie-rung eines elektronischen Berufungsmonitors, der u.a. auf einer nicht-öf-fentlichen Seite den Stand laufender Berufungsverfahren abbilde, habe die FernUniversität die Transparenz ihrer Verfahrensabläufe deutlich erhöht. Ebenso habe die Hochschule ihre Bemühungen intensiviert, Rufinhaberin-nen und Rufinhabern ohne Zeitverzug eine Infrastruk-tur bereitzustellen. Rundum positiv zu bewerten sei der Ausbau der Implacement-Angebote für Neuberufene, z.B. durch die Etablierung ei-nes „Begrüßungstages für Professorinnen und Professoren”. Mit der Schaffung ei-nes Familienservice-Büros seien zudem er-freuliche Fortschritte bei der Verbesserung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Be-ruf und Familie verbunden.
Viele mit der Erstverleihung des Gütesiegels ver-bundene Empfehlungen habe die FernUniversität in-zwischen umgesetzt. Punktuell sieht die Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch Verbesserungsmöglichkeiten.
„Die kritische Begleitung durch das DHV-Gütesiegel für faire und transpa-rente Berufungsverhandlungen hat sich gelohnt. Die FernUniversität pro-fitiert von der Weiterentwicklung ihrer Berufungskultur. Auch Bewerbe-rinnen und Bewerbern nehmen das Gütesiegel als einen Qualitätsausweis wahr, der für die FernUniversität spricht“, erklärte die Kanzlerin der Fern-Universität, Regina Zdebel. Proehttp://www.hochschulverband.de/cms1/guetesiegel.html
Verfolgter Wissenschaftler
„Die Türkei ist mein Land!“„Die Türkei ist nicht Erdoğans Land. Sie ist mein Land!“ Irgendwann, so ist Dr. Utku Sayin optimistisch, wird er wieder gefahrlos in seine Heimat zurückkehren können. Dem Unter-zeichner einer Petition gegen die Politik der türkischen Regierung im kurdischen Teil des Landes drohen bei einer Rückkehr in seine Heimat Inhaftierung, zwangsweise Arbeits-losigkeit und Ausreiseverbot. Am Ende seiner dreimonatigen Arbeit als Gastwissenschaftler im Lehrge-biet Bildung und Differenz von Prof. Dr. Katharina Walgenbach vermit-telte Sayin 40 Interessierten aus al-len Bereichen der FernUniversität in Hagen in einem Vortrag einen Ein-druck von der Situation türkischer Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftler, die nicht auf der Erdoğan-Linie liegen.
Der Sonderpädagoge war bis zum 18. August 2016 Assistent Profes-sor an der staatlichen Mustafa Ke-mal University (MKU), dann wur-de sein Vertrag nicht mehr erneu-ert. Wie zahlreiche andere Wissen-schaftlerinnen und Wissenschaftler hatte er zuvor die Petition „Wir werden nicht Teil des Verbrechens sein“ unterzeichnet, die zu einer „Jagd“ an allen türkischen Univer-sitäten gegen diese geführt habe. Gegen 492 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler seien diszipli-narische Ermittlungsverfahren ein-geleitet und 75 entlassen worden, 25 von sich aus ausgeschieden. 306 Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftler seien mit einem staatli-chen Einstellungsverbot für die öf-fentlichen Dienste belegt, 50 in Un-tersuchungshaft genommen und vier inhaftiert worden, so der Re-ferent. Ihm wurde ebenfalls be-scheinigt, dauerhaft disqualifiziert für den öffentlichen Dienst zu sein. Auch viele Studierende seien inhaf-tiert worden.
Sayin ist überzeugt, dass über sol-che wertvollen Einzelinitiativen hin-aus die europäischen Universitäten das zentrale staatliche Kontrollgre-mium türkischer Hochschulen YÖK dazu bewegen müssen, gesetzliche Vorschriften, akademische Rechte und wissenschaftliche Ethik zu re-spektieren: „Statt die Augen zu verschließen muss Europa mit den türkischen Wissenschaftlern solida-risch sein!“ Dennoch: „Ich bin trau-rig, aber auch zuversichtlich, dass ich von hier aus etwas bewegen kann!“ Da
Freuen sich über zehn Jahre BürgerUni: (v.li.) Prof. Timm Homann (Ernsting`s family), Stephan Casselmann, Barbara Thesing, Jun.-Prof. Dorett Funcke, Prof. Frank Hillebrandt (alle FernUniversität), Lilly Ernsting, Heinz Öhmann (Bürgermeister Coesfeld), Rektorin Prof. Ada Pellert und Stephan Ernsting. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
Nach seinem Vortrag diskutierte Utku Sayin (li.) angeregt mit dem Publikum. Mit dabei war auch Prof. Katharina Walgenbach (re.).
(Foto: FernUniversität, Pressestelle)

Best-of Social Media
FernUni in sozialen Netzwerken
Seite 4 FernUni Perspektive
Campus
Folgen Sie uns! Links auf fernuni-hagen.de
Interdisziplinäre Tagung
Rechtsquelle Wikipedia: Vom Ende der IgnoranzDarf man sein eigenes Werk bei Wi-kipedia promoten? Ein Streit un-ter Editoren über die Selbstdar-stellung eines Hochschullehrers bei Wikipedia war der Auslöser für die intensive Beschäftigung mit der umstrittenen Wissensquelle Wiki-pedia. „Dass Wikipedia nun auch als Marktplatz in der Rechtswis-senschaft genutzt wird, ist eine neue Dimension“, sagt Prof. Dr. Ka-tharina Gräfin von Schlieffen, Lei-terin des Lehrstuhls für Öffentli-ches Recht, juristische Rhetorik und Rechtsphilosophie an der FernUni-versität in Hagen.
Mit ihrer Forschungsgruppe Rechtsrhetorik initi-ierte Prof. von Schlief-
fen daher die interdiszip-
linäre Tagung „Rechts-quelle Wikipedia“. Zwei Tage
lang kamen Vertreterinnen und Ver-treter der Wissenschaft, der juris-tischen Informationssysteme und von Online-Communities nach Ha-gen, um Wikipedia als Wissens- und Rechtsquelle aus verschiede-nen Blickwinkeln zu beleuchten. „Bislang hat die Rechtswissenschaft dieses Phänomen mit all seinen Chancen und Risiken weitgehend ignoriert“, so Prof. von Schlieffen.
In der Rechtspraxis angekommen Dabei ist Wikipedia längst in der Rechtspraxis angekommen: Gerich-te setzen Fakten aus der Wikipedia
als gerichtsbekannt voraus, sie ent-nehmen dort Definitionen und so-gar Rechtsauffassungen. Jura-Stu-dierende schöpfen aus der beque-men, kostenlosen Wissensquelle. Der Profi nutzt sie eher heimlich und findet dort Passagen, die ihm zu passenden Zitaten, Fachliteratur oder dem Einstieg in fremde Fach-gebiete verhelfen.
„Jeder benutzt Wikipedia, aber kei-ner zitiert Wikipedia“, umschrieb Prof. Dr. Gabriele Zwiehoff, Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fa-kultät, in ihrer Begrüßung den Sta-
tus Quo. „Ignoranz hilft nicht wei-
ter. Man sollte Wikipedia aufge-
schlossen beobachten und reflektieren“, so die Botschaft der
Dekanin. „Das Thema wird in Zu-kunft noch wichtiger.“
Interessanter Gegenstandder FernUni-Forschung Das sah auch FernUni-Rektorin Prof. Dr. Ada Pellert so: „Wikipedia ist ein für die FernUniversität interessanter Forschungsgegenstand, weil es um Fragen der Arbeitsweise, Organisa-tion und Qualitätssicherung orts- und zeitunabhängiger Formen der Wissensvermittlung geht.“
Das komplexe Thema wirft viele Fragen auf. Wie kann man Wikipe-dia verantwortungsvoll nutzen? Ist Wikipedia eine zitierfähige Quel-le für wissenschaftliche Arbeiten? Wirken sich Recherchen und Be-lege mit Wikipedia auf den Inhalt rechtlicher Entscheidungen aus?
Haben das Recherchieren und Be-legen mit Wikipedia Auswirkun-gen auf das Recht? Welche Stan-dards sind in der Qualitätssicherung verbindlich? Ist das Phänomen Wi-kipedia bezeichnend für eine allge-meinere Veränderung in der zuneh-mend virtuelleren Rechtswelt oder legt es lediglich alte, rechtskonsti-tuierende Faktoren offen?
Über die Grenzen der unterschied-lichen Disziplinen hinweg bestand Konsens darüber, dass Wikipedia bei Laien und vielleicht auch bei Juristin-nen und Juristen den Rechtswörter-büchern den Rang ablaufen wird – und zwar bei der begrifflichen Er-stinformation, als Einstieg in die Li-teratur sowie zur Kartierung neuer Rechtsgebiete. Als Quelle für wis-senschaftliche Arbeiten wird das
Online-Lexikon unter Juristinnen und Juristen hingegen abgelehnt.
So wurde bei einer Podiumsdiskus-sion kontrovers die Frage der Au-torität und der Manipulation bei Wikipedia aufgegriffen. Der Ver-lust individueller Autorschaft und damit die Zurechenbarkeit von In-halten erscheinen als Problem. Die Ausgangsfrage, inwieweit Wikipe-dia Rechtsquelle sei, wurde diffe-renziert beantwortet. Rein juristisch
wollten die Teilnehmenden Wiki-pedia diesen Rang nicht zuspre-chen. Dagegen mochte niemand ausschließen, dass das Online-Le-xikon tatsächlich Einfluss auf das
Recht ausübt. Wikipedia sei eine Quelle für Alltagswissen und teil-weise auch bereits ein anerkanntes Nachweisinstrument – was weitere Untersuchungen erfordert.
Tagung war Auftakt fürweitere Treffen „Unsere Tagung war der Auftakt für weitere Treffen“, kündigt Prof. von Schlieffen deshalb an. Sie wird mit ihrer Forschungsgruppe Rechts-rhetorik die Wirkung von Wikipedia
als Forschungsthe-ma weiterverfol-gen. Die Erkennt-nisse werden auch in die Lehre der FernUniversität, etwa in das juris-tische Propädeuti-
kum, einfließen. „Medienkompe-tenz bei Juristinnen und Juristen ist schon zu Beginn des Fernstudi-ums ein zentrales Anliegen“, so die Rechtswissenschaftlerin. can
„Bislang hat die Rechtswissenschaft das Phänomen Wikipedia mit all seinen Chancen und Risiken
weitgehend ignoriert.“Prof. Dr. Katharina Gräfin von Schlieffen
Vom Master zur Promotion
Mit Mut und DisziplinMaster — Promotion — Habilitati-on = Professur? Die Professur muss nicht unbedingt das angestrebte Ziel einer wissenschaftlichen Karri-ere sein. Auch ein Wechsel aus der Wissenschaft in die Wirtschaft oder eine Position auf der Schnittstel-le, im Wissenschaftsmanagement verspricht berufliche Erfolge. Was wichtig ist: „Die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen, eine persönliche Standortanalyse vorzu-nehmen“, sagt die Rektorin der FernUniversität in Hagen, Prof. Dr. Ada Pellert. „Dann können wir ge-meinsam gucken, wie wir unse-re Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler effektiv unter-stützen können.“
Dazu hatte die Rektorin, die selbst zunächst eine Karriere als Wissen-schaftlerin und nun als Hochschul-managerin eingeschlagen hat, zu einem Informations- und Diskussi-
Topgeklickt auf Facebook
33.219* Kurzvideo aus dem Logistikzentrum (31. März 2017)
5.616* Doppelte Alumnifeier in Hagen (19. April 2017)
1.611 Kein Psychologie-NC zum Wintersemester (10. April 2017)
* Beitragsklicks, Gefällt-mir-Angaben, Kommentare, geteilte Inhalte und Videoaufrufe
Wörtlich:
Ergebnis Masterarbeit: check vorgestern. Letzte Prüfung: check gestern. Jetzt Masterurkunde beantragen :-)“
@a_hofmeyer hat’s geschafft: Auf Twitter feiert der Fernstudent seinen erfolgreich abgeschlossenen
Master in Wirtschaftsinformatik (6. Mai 2016).
Mitmachen bei Instagram
Lernen ist stinklangweilig? Von wegen: Der eine hat immer seinen treuen Hund an der Seite, wenn er seine Studien-briefe durchackert. Die andere motiviert sich mit Schokolinsen: Für zwei geschriebene Zeilen gibt es eine Nascherei. Die bunte Bilderwelt auf unserem Instagram-Kanal @fernunihagen lebt von genau solchen Beiträgen: Unserer Stu-dierenden zeigen uns, wie ihr Studienalltag aussieht – und wir teilen diese Bilder mit unseren Followern. Lust mit-zumachen? Einfach das eigene Bild mit #MeineFernUni taggen.
onsforum eingeladen. Das Interes-se war groß: Rund 90 Nachwuchs-wissenschaftlerinnen und -wissen-schaftler der FernUniversität – mit und ohne Promotion oder Habili-tation – informierten sich auf der Veranstaltung „Kenne deine Pers-pektiven – Karrierewege für wissen-schaftliche Beschäftigte“.
Es hilft, andere zu sehenIn einer Interviewsequenz stellte die Rektorin sogenannte Role Models vor, die jeweils ganz unterschiedli-che Richtungen eingeschlagen ha-ben. „Es hilft sehr, andere zu sehen und zu treffen. Das löst oft Impulse aus, man bekommt neue Ideen für sich selbst“, moderierte sie die Ge-spräche an. Daran schloss ein Block über konkrete Angebote der Fern-Universität für den wissenschaftli-chen Mittelbau an. aw
https://www.fernuni-hagen.de/swn/
Gut besucht war die interdisziplinäre Tagung zur Rechtsquelle Wikipedia in Hagen. Weitere Treffen sollen folgen. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
(Fo
to: T
hin
ksto
ck, i
Sto
ck)

FernUni Perspektive Seite 5
Edith-Stein-Tagung
Grundbegriffe und PhänomeneÜber 40 Forscherinnen und For-scher aus verschiedenen Ländern und Generationen haben seit Jah-ren an einem Edith-Stein-Lexikon gearbeitet, das das denkerische Erbe der Philosophin (1891–1942) und ihre philosophiegeschichtli-che wie systematisch-phänomeno-logische Bedeutung im Anschluss an die 27-bändige Edith-Stein-Ge-samtausgabe weiter erschließen soll. Seine Herausgeber sind Dr.
57. Assistententagung Öffentliches Recht
Rechtskultur begrenzt GlobalisierungDer wissenschaftliche Nachwuchs aus dem Öffentlichen Recht tagte an der FernUniversität und in Ha-gen: Drei Tage beschäftigen sich die Juristinnen und Juristen in Pa-nels und einer Podiumsdiskussi-on mit hochaktuellen Fragen zur „Rechtskultur und Globalisierung“. Mit dem Thema hatte das Organisa-tionsteam der traditionsreichen 57. Assistententagung ein hochaktuel-les gewählt.
Die sieben jungen Wissenschaft-lerinnen und Wissenschaftler der FernUniversität waren sich nach der Konferenz einig: „Globalisierung und Rechtskultur stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis. Durch die Globalisierung können sich zwar zum einen Universalwer-te aus verschiedenen Rechtskul-turen herauskristallisieren oder es kann mit der Zeit eine gemeinsa-me Rechtskultur erwachsen, wie es in den letzten 60 Jahren beispiels-weise in Europa der Fall war – und hoffentlich weiter ist.“
Zum anderen setzten nationale Rechtskulturen der Globalisierung in gewisser Weise auch Grenzen: Wenn man sich etwa vor Augen führe, was die Verfassungsidenti-tät eines Staates – also etwa einen unverrückbaren Kernbestand von Werten, Strukturen oder Institutio-nen – ausmache. „Auch der in ei-nigen Staaten derzeit gegenläufi-ge Renationalisierungstrend steht in diesem Kontext“, ergänzen die Juristinnen und Juristen.
Teilnehmende aus demdeutschsprachigem EuropaZahlreiche junge Forschende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren für drei Tage nach
iDie Referate dieser Tagung werden demnächst als Tagungsband im Nomos-Verlag erscheinen, herausgegeben von den Mitgliedern des Organisationskomitees: Dr. Sebastian Piecha, Dr. Anke Holljesiefken, Dr. Yury Safoklov, Johanna Herberg, Jens Fischer, Stefanie Haaß undDr. Stefan Kracht.
Hagen gereist, um das Tagungs-thema aus verschiedenen Perspek-tiven zu diskutieren. Zur Einstim-mung kamen auch der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kutschaty und der ehemalige Bun-desverfassungsrichter Prof. Dr. Dr. Udo di Fabio an die FernUniversi-tät. Das Organisationskomitee freu-te sich gemeinsam mit FernUni-Rek-torin Prof. Dr. Ada Pellert und der Dekanin der Rechtswissenschaftli-chen Fakultät, Prof. Dr. Gabriele Zwiehoff, über den prominenten Besuch.
Forum für junge Forschende„Es ist ein wichtiges Forum für jun-ge Forschende, die noch nicht ha-bilitiert sind. Hier können Sie sich vernetzen für den wissenschaftli-chen Austausch“, sagte Rektorin Ada Pellert zu Beginn. Sie freute sich über die Tagung, die eine wichtige Funktion für die gesamte FernUni-
versität habe: „Es ist eine Chance, unsere besondere Universität sicht-bar zu machen.“ Justizminister Kut-schaty lobte in seinem Grußwort die FernUniversität als „Erfolgsmodell“ und ordnete das Thema der Tagung aus seiner Sicht ein: „Die deutsche Rechtsordnung ist eine der besten, allerdings müssen wir verstärkt mit mehreren Rechtsordnungen klar-kommen. Es gilt, um die Rechtskul-tur zu werben.“
Die Dekanin und Hagens Bürger-meister Horst Wisotzki hatten in ihren Grußworten charmant auch auf die mitunter versteckten Rei-ze der Stadt Hagen als „unter-schätzte kleine Großstadt am Ran-de des Ruhrgebiets“ aufmerksam gemacht. Dazu passte das Angebot an Exkursionen in der Stadt, das die Konferenzleitung organisiert hatte.
Ehemaliger Verfassungsrichter: „Der Westen schwankt“Als Festredner hob der ehemalige Bundesverfassungsrichter Dr. Udo di Fabio auf „Das Recht der Welt-gesellschaft: Ambivalenzen der Glo-balisierung“ ab. Der Jurist stieg kon-kret ein: „Der Westen schwankt, seine Institutionen geraten ins Wan-ken. Es rumort derzeit so gefährlich,
dass ein neuer internationaler Kon-sens zu erwarten ist.“
In sieben Panels, die sich in den verschiedenen öffentlich-rechtli-chen Teilbereichen bewegten, ver-tieften die Teilnehmenden etwa, in welchem Verhältnis europäische Werte und nationale Identitäten stehen, wie sich die Grundfreihei-ten zu nationalen Regelungskom-petenzen verhalten oder wie weit die Regelungsspielräume des deut-
schen Verwaltungsprozessrechts in Zeiten internationaler Verflechtun-gen reichen.
Die Europäische Union:eine Wertegemeinschaft?Ein Höhepunkt der Konferenz war die Podiumsdiskussion, die sich um die Frage drehte: „Die Europäische Union: Wirtschaftsgemeinschaft, Wertegemeinschaft, Kulturgemein-schaft?“ Dort diskutierten der ehe-malige Präsident des Europäischen Parlamentes, Prof. Dr. Klaus Häns-ch, der Hamburger Europa- und Völkerrechtler Prof. Dr. Markus Kot-zur sowie der Bundestagsabgeord-nete Prof. Dr. Patrick Sensburg mit den Teilnehmenden aktuelle Fragen zum Zustand der Europäischen Uni-on. Insbesondere ging es darum, ob in aktuellen Zeiten noch eine ge-meinsame Wertegemeinschaft ein Zukunftsmodell sein kann.
Klaus Hänsch konnte einen gro-ßen Bogen von den Anfängen der EU bis heute ziehen und sich mit Reformideen der anderen Teilneh-mer, etwa einem Zweikammerpar-lament für die EU, auseinanderset-zen. Aber auch mit Mythen und Klischees wurde aufgeräumt: etwa mit der EU-Norm zur ,Gurkenkrüm-mung‘, die vor über zehn Jahren ab-geschafft wurde. aw
Marcus Knaup vom Lehrgebiet Phi-losophie II, Praktische Philosophie: Ethik, Recht, Ökonomie (Prof. Dr. Thomas Sören Hoffmann) der Fern-Universität in Hagen und Prof. Ha-rald Seubert (Staatlich anerkann-te staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel; Hochschule für Politik in München).
Bei einer Tagung am 24. und 25. November 2017 sollen an der Fern-
Universität wichtige Grundbegriffe und Phänomene Steins diskutiert und die Arbeit an dem Lexikon ab-geschlossen werden, das hier auch vorgestellt wird.
Eine Wanderausstellung aus Wien zum Leben der Philosophin, die zu den herausragenden Persönlichkei-ten des 20. Jahrhunderts zählt, wird eröffnet und bis Weihnachten 2017 in Hagen zu sehen sein. Proe
Blicke hinter Kulissen
Hagener SoziologietageSoziologie an der FernUniversität – das ist mehr als Kurse zu studieren und für Prüfungen zu lernen… Um jenseits von Studieninhalten und Formalitäten zu erfahren, was sich auf den zweiten Blick hinter den Ku-lissen der Soziologie der FernUni-versität verbirgt, lädt das Institut für Soziologie nach dem erfolgreichen Auftakt der Reihe „Hagener Sozio-logietage“ auch 2017 wieder alle an der Soziologie Interessierten für
den 5. bis 7. Oktober ein.Mit viel-fältigen Angeboten werden in ent-spannter Atmosphäre spannende Einblicke eröffnet. Einsteigerinnen und Einsteiger können erste Ein-sichten in die Bandbreite des Faches nehmen, Soziologieerfahrene sich neue Themen erschließen. Die Teil-nehmenden können die Lehrenden kennenlernen. Anmeldungen wer-den bis 20. September erbeten. Dawww.fernuni-hagen.de/per60-05
(Foto: Thinkstock, ER09)
NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (2. Reihe, re.), Ex-Bundesverfassungsrichter Prof. Udo di Fabio (4. v. li.), Bürgermeister Horst Wisotzki (oben li.), Rektorin Prof. Ada Pellert (vorne, Mitte) und Dekanin Prof. Gabriele Zwiehoff (5.v.re.) mit dem Organisationsteam (Foto: FernUniversität, Pressestelle)

Monika Weiß (Mitte) überreichte die gesammelten Interviews an den Dekan der Fakultät für Kultur und Sozialwissenschaften Prof. Frank Hillebrandt und die Archivleiterin Dr. Almut Leh. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
Seite 6 FernUni Perspektive
Philosophische Fachtagung
Die Allgegenwart des Modischen
Campus
Ist Mode ein Schlüsselphänomen der Moderne? Diese Frage trieb schon den Philosophen und Sozio-logen Georg Simmel an, der 1905 seine „Philosophie der Mode“ ver-öffentlichte. Prof. Dr. Hubertus Bu-sche, Lehrgebiet Philosophie I der FernUniversität in Hagen, widmete dieser Frage eine Tagung und stell-te fest: „In der Soziologie ist die Allgegenwart des Modischen seit-her Thema. Bislang allerdings gab es noch keine interdisziplinäre wis-senschaftliche Perspektive auf die-sen Zusammenhang.“
iDie Ergebnisse der Tagung so-wie alle Vorträge werden in ei-nem Tagungsband erscheinen.
Simmel hatte schon damals dia-gnostiziert, dass die Mode „heu-te so stark das Bewusstsein be-herrscht, dass die großen, dauern-den, unfraglichen Überzeugungen mehr und mehr an Kraft verlieren“. Die Tagung „Moden der Kleidung – Moden des Geistes?“, die Busche zusammen mit Prof. Dr. Yvonne Förster (Leuphana Universität) ver-anstaltete, untersuchte daher sys-tematisch, auf welchen Gebieten das Modische anzutreffen ist und wie weit sich ihr die Herrschaft der festen Prinzipien überhaupt entzie-hen kann.
Historischer BezugDas um 1600 auftauchende Wort „la/le mode“ bezeichnete ur-sprünglich die zeitgebundene „Art und Weise“ der Erscheinung und des Verhaltens, die zugleich „Re-gel“ oder „Maßstab“ sozialer Er-wartungen ist. Später gehörte zum Begriff auch der periodische Wech-sel solcher Erscheinungs- und Ver-haltensmuster. Im 17. und 18. Jahr-hundert wurde „Mode“ begrifflich auf künstlerische und literarische Stile sowie philosophische und re-ligiöse Strömungen ausgeweitet.
Heute dagegen ist der Begriff meist auf Bekleidung und Woh-nen beschränkt und bezeichnet das
Schnelllebige, das Temporäre. „Wir haben herausgearbeitet, was auf den verschiedenen Gebieten von den Körpermoden bis hin zur Reli-gion als Mode identifiziert werden kann – und wir wurden fündig“, bi-lanziert Busche.
Mehrere Vorträge gelangten zum Ergebnis, dass es schwierig ist, etwa in der Kunst, Philosophie und all-gemein in den Geisteswissenschaf-ten sich allem Modischen zu entzie-hen. Wo gesellschaftlich relevante Fragestellungen aufgegriffen wer-den, sind modische Themen, Voka-bulare und Autoritäten unvermeid-bar. Als Vertreter der Soziologie an der FernUniversität widmete sich Prof. Dr. Frank Hillebrandt soziolo-gischen Erklärungen für die höhe-re Geschwindigkeit von Modezyk-lenwechseln.
In den Tagungsdiskussionen wur-de immer wieder deutlich, dass ei-ner der treibenden Motoren für den raschen Wechsel von Moden die wirtschaftlichen Interessen sind. Dass sich das Karussell der Klei-dungs- und Wohnungsmoden im-mer schneller dreht, steigert Ab-satz und Gewinn. Auch in der zu-nehmend von Drittmitteln abhängi-gen wissenschaftlichen Forschung „zahlt sich das markschreierische
Ausrufen ständig neuer ,Paradig-men‘ und ,turns‘ aus“, so Busche.
Soziale BedürfnisseDie Tagung ging jedoch auch der anderen starken Antriebskraft für den ständigen Wechsel von Mo-dezyklen nach: den gesellschaft-lichen Bedürfnissen der Modeträ-ger. „Auch und vor allem spielen soziale Bedürfnisse eine Rolle: das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe und das Bedürfnis nach Abgrenzung gegenüber an-deren. Menschen möchten teils ge-wissen Statusgruppen angehören, teils sich von der Allgemeinheit ab-heben. Für beides bedienen sie sich einer bestimmten Zeichensprache“, erläutert Busche.
Die Tagung versuchte, die ,speziel-len Kleider‘ herauszufinden, mit de-nen im Sport, in der Kunst, in der Politik, in der Philosophie und so-gar in den Naturwissenschaften Ab-grenzung und Zugehörigkeit herge-stellt werden. Darüber hinaus ge-langte man zu dem Ergebnis, dass es auf allen diesen Gebieten spezifi-sche Abgrenzungen gegen das Alte gibt. Modebildend ist jeweils ein Be-wusstsein, zur Avantgarde zu zäh-len und das Neue sowie den Fort-schritt auf seiner Seite zu haben.
Reformen als politische ModenFür einen Abendvortrag gewannen Busche und Förster Jürgen Kaube, Mitherausgeber der Frankfurter All-gemeinen Zeitung. Der Journalist vertrat die These, Reformen seien die typischen Moden in der Poli-tik. Ob Rechtschreibreform, Ren-tenreform, Arbeitsmarktreform: Stets handele es sich um die ewi-ge Wiederkehr des Neuen, um die Verhältnisse zu verbessern. Das zie-he gleich die nächste Reform nach sich – die Reform der Reform. aw
Kindheit auf der Flucht
Zeitzeugeninterviews jetzt in HagenFast 50 Zeitzeugeninterviews hat das Archiv „Deutsches Gedächt-nis“ des Instituts für Geschichte und Biographie an der FernUniver-sität in Hagen vom Verein „Kriegs-kinder e.V. – Forschung, Lehre, The-rapie“ erhalten. Sie dokumentieren die Schicksale von Menschen, deren
Kindheit von ihren Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg geprägt wurden.
Am 8. Mai 1945 war es vorbei: Der Zweite Weltkrieg in Europa ende-te. Manfred Hübner (81) aus Köln
erinnert sich gut, wie er im Febru-ar 1945 vor der roten Armee aus-reißen musste: „Auf unserer Flucht war es irrsinnig kalt, es gab irrsinnig viel Schnee. Ich saß als junger Knabe auf einem Pferdewagen – hinter uns die russischen Panzer.“ Auch Mari-anne Pollich (76) aus Erkrath, die
als Vierjährige mit dem letzten Zug aus Cottbus entkam, gehen die Bil-der der Flucht nicht mehr aus dem Kopf: „Ich sehe noch die Massen draußen stehen, die es nicht in den Zug geschafft haben.“
Obwohl das Kriegsende in Deutsch-land 72 Jahre zurückliegt, ist die Problematik nach wie vor aktuell. An vielen Orten der Welt wird er-bittert gekämpft, ohne dass ein Frieden in Sicht ist – etwa in Syrien oder Afghanistan. Die Überleben-den tragen zumeist schwere Trau-mata davon.
Marianne Pollich und Manfred Hüb-ner wollten nachfolgenden Genera-tionen von ihren Kriegserlebnissen erzählen. Der Verein „Kriegskinder e.V. – Forschung, Lehre, Therapie“ hat sie und rund 50 weitere Zeit-zeuginnen und Zeitzeugen zu ih-ren Schicksalen im Zweiten Welt-krieg befragen lassen. Am 3. Mai wurde das gesammelte Material an das Institut für Geschichte und Bio-graphie der FernUniversität in Ha-gen übergeben. Dort betreuen For-scherinnen und Forscher das Archiv „Deutsches Gedächtnis“, in dem Lebensgeschichten systematisch gesammelt und der Forschung zur Verfügung gestellt werden.
Die Interviews werden nach der „Oral History“-Methode geführt: Ohne Zeitdruck erzählen die Ge-
sprächspartnerinnen und Ge-sprächspartner vor Videokamera oder Mikrofon ihre Lebensgeschich-te. Dr. Almut Leh, die das Archiv lei-tet, freut sich darüber, dass auch ex-terne Unterstützer wie der „Kriegs-kinder e.V.“ den Bestand erweitern: „Von den 3.000 Interviews, die wir derzeit archivieren, stammen zwei Drittel aus eigenen Forschungspro-jekten. 1.000 Interviews haben wir von anderen Wissenschaftlern und Forschungsinstitutionen überneh-men können. Das trägt zur thema-tischen Vielfalt unserer Bestände bei und ist für unsere Archivbesu-cher sehr interessant.“
Der Verein erhofft sich von der Übergabe, noch weitere Zeitzeugin-nen und Zeitzeugen für Interviews gewinnen zu können. „Die Zeit
Die Zeitzeugen Manfred Hübner und Marianne Pollich lernten sich an der FernUniversität kennen – und hatten sich viel zu erzählen. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
drängt, denn viele Kriegskinder von damals verbringen ihre letzten Jah-re mit uns und werden uns bald nur noch Erinnerungen an ihre Kindheit zurücklassen können“, mahnt die Vereinsvorsitzende Monika Weiß. Auch die Historikerin PD Dr. Karin Orth von der Universität Freiburg, die einen großen Teil der Zeitzeu-ginnen und Zeitzeugen befragt hat, verweist auf die Gedächtnisfunkti-on: „Für viele Interviewpartnerin-nen und -partner ist es sehr wich-tig, zu wissen, dass ihre Erinnerun-gen bewahrt werden.“
Manfred Hübner möchte zudem an junge Menschen in Europa appellie-ren, sich aktiv für den Frieden ein-zusetzen: „Das, was jetzt passiert, ist eine Frage des Engagierens oder Nicht-Engagierens.“ br
Prof. Hubertus Busche eröffnete die Tagung mit einem historischen Abriss. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
(Fo
to: T
hin
ksto
ck, m
g7)

Forschung FernUni Perspektive Seite 7
DFG-Forschungsprojekt
Die Vermessung der RegionWas stellt man sich eigentlich unter einer Landkarte vor? Aus heutiger Sicht erscheint die Antwort auf diese Frage selbstverständlich: eine sche-matische und sachliche Landschafts-darstellung, korrekt genordet und absolut maßstabsgetreu. Die mo-dernen Standards sind jedoch nicht
selbstverständlich. Um sie zu entwi-ckeln, bedurfte es zunächst der Pio-nierarbeit frühneuzeitlicher Karten-macher. Ihr Blick fiel dabei nicht sel-ten vor die eigene Haustür, auf den regionalen Raum.
Historischem Kartenmaterial, das die Region Westfalen abbildet, wen-det sich nun ein Forschungsprojekt der FernUniversität in Hagen zu. Es trägt den Titel „Chorographie zwi-schen Mimesis und Metrik: Hand-gezeichnete regionale Landkarten in Westfalen (1450-1650)“ und wird für die nächsten drei Jahre von der Deutschen Forschungsge-meinschaft (DFG) gefördert. Gelei-tet wird das Vorhaben von Prof. Dr. Felicitas Schmieder vom Lehrgebiet Geschichte und Gegenwart Alteu-ropas der FernUniversität. Die wich-tigste Grundlage für die Kartenfor-schung bilden die Bestände des Lan-desarchivs in Münster.
Handgezeichnete UnikateDie meisten der handgezeichneten Untersuchungsobjekte sind Unika-te, angefertigt für ganz bestimm-te Zwecke: Am häufigsten wurde das Kartenmaterial in juristischen, ökonomischen oder administrativen Kontexten verwendet. Doch auch repräsentative Absichten wurden verfolgt. So nutzten Herrscher die Landschaftsdarstellungen nicht nur, um sich geographische Klarheit über ihren Besitz zu verschaffen; sie woll-ten gleichermaßen ihre Macht zur Schau stellen. „Mit der Karte konn-te ein Herr zeigen: Das gehört alles mir“, erklärt Prof. Schmieder.
Trotz der vielen kriegerischen Kon-flikte in der Frühen Neuzeit spielten militärstrategische Gesichtspunkte noch keine große Rolle für die Kar-tographie. Das bekannte Bild ei-nes am Kartentisch operierenden
Heerführers wie Wallenstein sei eher ein Klischee, so die Historikerin. Im-merhin gab es einige Darstellun-gen von Städtebelagerungen, die aus der Rückschau Angriffe nacher-zählten. „Viele erste Stadtpläne sind solche Belagerungspläne“, konsta-tiert Prof. Schmieder, stellt aber zu-
gleich klar: „Der friedliche Konkur-renzkampf per Karte war wesentlich verbreiteter.“
Mittelalterliche SpurenIm Untersuchungszeitraum gab es noch keine einheitlichen Regeln für die Produktion von Karten. Kenn-zeichnend waren eher die Auslotung von Möglichkeiten und ein kreati-ver Umgang mit dem Medium. „Ich nenne das eine ‚Experimentalphase der Kartographie‘“, meint die For-scherin. Vielen Karten ist der Tra-ditionszusammenhang mit mittel-alterlichen Konventionen und Dar-stellungstechniken noch stark an-zumerken. Zum Beispiel wurden bedeutsame Landmarken – etwa eine umstrittene Mühle – ohne Rücksicht auf tatsächliche Propor-
tionen größer gemalt. „Wir kennen so etwas heute noch von Tourismus-karten“, erinnert Schmieder.
„In der Zeit stellen wir eine schritt-weise Professionalisierung fest“, führt sie weiter aus. Vermessungs-techniken im modernen Sinn kamen jedoch noch nicht zur Anwendung. „Manchmal wurden Wege abge-schritten. Man hat sich aber auch einfach auf einen Kirchturm gestellt und geschätzt“, erklärt Schmieder. Daher wurden Landschaften selten in der direkten Draufsicht, sondern zumeist aus einer schrägen „Vogel-schau“ abgebildet. „Diese Perspekti-ve erscheint zwar aus heutiger Sicht falsch, war damals jedoch sinnvoll“, urteilt Prof. Schmieder.
Entscheidend ist zudem die zusätzli-che Darstellungsdimension der Zeit, die durch Bildserien oder schrift-liche Legenden umgesetzt wurde. Schmieder: „Da steht dann etwa auf der Karte: ‚Hier ist das Loch, wo einmal der Räuber reingefallen ist.‘“ Erst im 18. Jahrhundert nimmt das Material eine moderne, uns ver-traute Gestalt an. „Dadurch wurden die Karten aber auch langweiliger“, schmunzelt die Historikerin.
Übergeordnetes ProjektDie Erkenntnisse zu westfälischen Karten sollen in ein übergeordne-tes Projekt einfließen. Deshalb ko-operiert Prof. Schmieder mit For-schenden aus Hannover und Göt-tingen. Erklärtes Ziel ist es, aus den regionalen Einzelbetrachtungen ei-nen beispielhaften Corpus deutscher Landkarten zu erstellen. Ferner ist ein crossmedialer Studienbrief zur frühneuzeitlichen Kartographie ge-plant. br
Prof. Felicitas Schmieder vor der Reproduktion einer alten Karte aus dem Jahr 1525, die das Flusssystem der Sorpe im Sauerland zeigt…(Foto: FernUniversität, Pressestelle)
...Bei näherer Betrach-tung werden die Un-terschiede zwischen
frühneuzeitlichen und modernen Karten
deutlich.(Original: Landesarchiv
Münster, Foto: FernUniversität,
Pressestelle)
Frauen in Spitzen von Großstädten
Neues GenderrankingDie Stadt Erlangen gewinnt das Genderranking deutscher Groß-städte 2017 vor den klassischen Spitzenreiterinnen Trier und Frank-furt am Main. Das Schlusslicht bildet Mülheim an der Ruhr. Dies ist das Er-gebnis des mittlerweile vierten Gen-derrankings deutscher Großstäd-te, das Prof. Dr. Lars Holtkamp, Dr. Elke Wiechmann und Monya Buß von der FernUniversität in Hagen im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung erstellt haben. Dafür hat das Team des Lehrgebiets Politikwissenschaft IV: Politik und Verwaltung 73 Groß-städte mit über 100.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern (ohne Stadtstaaten) anhand ihrer Frau-enanteile an kommunalpolitischen Führungspositionen – Ratsmit-glieder, Dezernatsleitungen, Aus-schuss- und Fraktionsvorsitze – so-wie für das Oberbürgermeisteramt verglichen. Die Daten wurden mit-tels eines Genderindex gewichtet.
Das vierte Genderranking deutscher Großstädte innerhalb von knapp zehn Jahren zeigt ein zwiespältiges Bild: Innerhalb dieses Zeitraums ist der Frauenanteil an den Oberbür-germeisterinnen und Oberbürger-meistern stark eingebrochen – von noch 17,7% 2008 auf nunmehr 8,2% 2017. Der Frauenanteil un-ter den Dezernentinnen und De-zernenten ist dagegen als einzi-ge politische Spitzenposition stark und kontinuierlich gestiegen: von 18,5 Prozent 2008 auf 29,1 Pro-zent 2017. Das wissenschaftliche FernUni-Team führt dies darauf zu-rück, dass auf diesem Feld die be-ruflichen Qualifikationen von Frau-en eine größere Rolle spielen als bei der Besetzung rein politischer Ämter. Insgesamt gilt: Frauen sind gemessen an ihrem Bevölkerungs-anteil in den kommunalpolitischen Führungsämtern deutscher Groß-städte auch 2017 unterrepräsen-tiert. Je wichtiger und mächtiger Posten sind, desto unwahrscheinli-cher werden sie von Frauen besetzt.
Ein noch stärker polarisiertes Bild er-gibt sich, wenn man die Frauenan-teile in den Stadträten nach Partei-en aufschlüsselt. Spitzenreiter sind Bündnis 90/Die Grünen mit der Er-
füllung ihrer 50-Prozent-Quote, ge-folgt von der Linken mit 44,4 Pro-zent Frauenanteil (Quote 50%) und der SPD mit 37,3 Prozent (Quote 40%). Die einer Quote verpflich-teten Parteien besetzen auch Frak-tions- und Ausschussvorsitze deut-lich stärker mit Frauen. Auf der anderen Seite unterbietet die neu hinzugekommene AfD, die nur in einigen Bundesländern in den Kom-munalparlamenten vertreten ist, mit einem Frauenanteil von 11,6% noch die FDP, die 2008 mit 24,9% das Schlusslicht gebildet hatte und seither ihren Anteil nur geringfügig steigern konnte (auf 26,4% 2017). Die CDU erreicht ihr eigenes Quo-rum von 33% (als Empfehlung) nur in 28 von 73 Großstädten.
Die Gewinnerin Erlangen gehörte schon in der ersten Studie (2008) zur Spitzentrias. Ein hoher Frauen-anteil unter den Ratsmitgliedern setzt sich auch in den weiteren politischen Spitzenpositionen fort. „Hier übererfüllen die Parteien mit verbindlicher innerparteilicher Quo-te, Grüne und SPD, ihr Soll“, erklärt Prof. Holtkamp.
Wenn die Politik den Frauenan-teil in Kommunalparlamenten und kommunalen Spitzenpositionen in vertretbarer Zeit erhöhen möchte, bleibt als Maßnahme nur die ge-
setzlich festgelegte Quote. „Ohne die Quote würde es noch 128 Jahre dauern, bis eine paritätische Beset-zung kommunaler Ratsmandate mit Frauen und Männern erreicht wäre – wenn man die Entwicklung von 2008 bis 2017 in die Zukunft fort-schreibt,“ sagt Sabine Drewes, Re-ferentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung der Heinrich-Böll-Stiftung.
Die neue Studie und ihre Vorläufe-rinnen sind zu finden unter www.boell.de. Proe
Prof. Lars Holtkamp (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
Köln hat mit Henriette Reker eine der wenigen deutschen Oberbürger-meisterinnen.
(Foto: Stadt Köln, Danny Frede)

Seite 8 FernUni Perspektive
Forschung
EU-Einfluss auf nationale Gesetzgebung
Weit entfernt von 80 ProzentWie groß ist der Einfluss der Europä-ischen Union auf die Gesetzgebung in ihren Mitgliedsstaaten und damit auf das Leben der Menschen? Nicht nur im Vereinigten Königreich war der „große Einfluss Brüssels“ ein gewichtiges Pro-Brexit-Argument. Auch in vielen anderen Mitglieds-staaten wird anhaltend Kritik am „gefühlt“ übermächtigen Einfluss der EU geäußert. Seit Jahren taucht in diesem Zusammenhang immer wieder eine Zahl auf: 80 Prozent al-ler Gesetze und Verordnungen sei-en EU-weit „europäisiert“. Mit die-ser Thematik befasst sich Prof. Dr. Annette Elisabeth Töller von der FernUniversität in Hagen seit vie-len Jahren. In einem wissenschaftli-chen Kurzgutachten hat die Leiterin des Lehrgebiets Politikfeldanalyse und Umweltpolitik für die vergan-genen Legislaturperioden des Bun-des untersucht, in welchem Aus-maß die nationale Gesetzgebung heute von der EU beeinflusst oder sogar initiiert ist.
Der Begriff „Europäisierung“ be-schreibt die Wirkungen der euro-päischen Politik auf der nationalen Ebene, etwa auf die Institutionen oder die politischen Inhalte. Nun sind Werte zur „Europäisierung“ für Wissenschaft und Politik, aber auch für Bürgerinnen und Bürger interessant, wenn es darum geht, wer überhaupt worüber entschei-
det. Töller: „Diese Zahlen werden aber auch regelmäßig politisch in-strumentalisiert, insbesondere zur Dämonisierung der EU.“ Sie hat die 16. und 17. Wahlperiode – also für den Zeitraum von 2005 bis 2013 – sowie kursorisch auch die 15. Wahl-periode untersucht.
Die Ergebnisse der FernUni-Wis-senschaftlerin sind weit weg von 80 Prozent. Und sie zeigten, dass die Europäisierungswerte zwischen den Politikfeldern stark variieren:• Die niedrigste Europäisierung
weist das Sachgebiet „soziale Si-cherung“ auf (10 Prozent).
• Mittlere Werte lassen sich bei „öf-fentlichen Finanzen und Steu-ern“ (etwa 20 Prozent europäi-sierte Gesetze), „innere Sicher-heit“, „Arbeit und Beschäfti-gung“, „Bildung und Erziehung“ sowie „Gesundheit“ ermitteln.
• Etwas darüber liegen die Sachge-biete „Medien, Kommunikation und Informationstechnologien“ sowie „Energie“.
• 50 Prozent und mehr erreichen „Verkehr“, „Wirtschaft“, „Um-welt“ und „Landwirtschaft“.
Von der Prophezeiungzur DiagnoseAuf Werte um 80 Prozent kommt man nur, wenn man versuchswei-se die europäischen Verordnun-gen hinzurechnet. Beim Sachge-
biet „Umwelt“ sind es dann 75, bei der „Landwirtschaft“ 86 Prozent.
80 Prozent: „Wie konnte eine der-art falsche Zahl eine solche Karrie-re machen?“ fragt Annette Töller. Ihren Ursprung hat diese 1988 in einer Prophezeiung des Kommissi-onspräsidenten Jacques Delors: „In zehn Jahren werden 80 Prozent der Wirtschaftsgesetzgebung, vielleicht auch der steuerlichen und sozia-len, gemeinschaftlichen Ursprungs sein“ (EG-Bulletin Nr. 2367/157 v. 6.7.1988). Die gewagte Prophezei-ung entwickelte eine bemerkens-werte Eigendynamik. 1991 bezog sich ein Beschwerdeführer gegen den Maastrichter Vertrag vor dem Bundesverfassungsgericht hierauf, und damit wurde die Prophezeiung zur Diagnose (BVerfGE 89, 155).
Im Herbst 2004 behauptete ein niederländischer Staatssekretär, 60 Prozent aller in den Niederlanden geltenden Gesetze hätten ihren Ur-sprung in Brüssel. Anfang 2007 gingen der ehemalige Bundesprä-sident Roman Herzog und Lüder Gerken in der Zeitung „Welt“ so-gar von 84 Prozent der in Deutsch-land geltenden Gesetze aus. Ihre Grundlage war eine vermeintliche Studie des Bundesministeriums für Justiz. Tatsächlich war sie eine knap-pe Antwort auf eine parlamentari-sche Anfrage (Bundestagsdrucksa-che 15/5434).
Uneinheitliche WerteTöller kam zu ganz anderen, wis-senschaftlich fundierten Ergebnis-sen. Auffallend sind zunächst die niedrigen Werte im Bereich der „so-zialen Sicherung“ (16. Wahlperi-ode: 1,75 Prozent, 17. WP: 7,14 Prozent). Für Töller keine Überra-schung: Soziale Sicherung ist nach wie vor im Wesentlichen von der nationalen Politik bestimmt. Und wenn es einen europäischen Ein-fluss gibt, etwa über die Maast-richt-Kriterien, die den finanziel-len Handlungsspielraum nationaler Regierungen einschränken, dann kann man diesen meist nicht in der Gesetzgebung nachweisen. Eher gering von Brüssel beeinflusst ist auch „öffentliche Finanzen, Steu-ern“ (in beiden Wahlperioden etwa 20 Prozent europäisierter Gesetze).
Uneinheitlich ist das Bild bei der „in-neren Sicherheit“. Liegt der Anteil der europäisierten Gesetze in der 16. WP bei knapp 30 Prozent, so sind es in der 17. – und in der zu-sätzlich untersuchten 15. WP – 17 Prozent. Hier spielen neben Richtli-nien auch Beschlüsse des Rats der Innen- und Justizminister eine Rolle, die auf nationaler Ebene umgesetzt werden (grenzüberschreitende Ter-rorismusbekämpfung, europäischer Haftbefehl, Europol). Ebenfalls im
unteren Feld und uneinheitlich stel-len sich die Werte bei „Arbeit und Beschäftigung“ dar.
Zu 20 bis 30 Prozent europäisiert ist die Gesetzgebung von „Bildung und Erziehung“ sowie „Gesund-heit“. Dabei geht es z.B. um Arznei-mittelrecht, Minimalstandards beim Gesundheitsschutz (wie Nichtrau-cherschutz) bzw. um die Anerken-nung von Berufsqualifikationen. Zwischen 30 und unter 40 Prozent europäisiert waren die Sachgebie-te „Medien, Kommunikation und Informationstechnologien“ sowie „Energie“. Hohe Werte mit etwa 50 Prozent, z.T. weiter steigend, finden sich für „Verkehr“, „Wirtschaft“, „Umwelt“ und „Landwirtschaft“. Annette Töller: „In der Umweltpo-litik gibt es keine großen nationa-len Spielräume mehr. Die Landwirt-schaftspolitik ist bereits seit den 1960er Jahren hochgradig verge-meinschaftet. Aufgrund der vielen Verordnungen, die die Marktorga-nisationen für verschiedenste Pro-dukte von Getreide über Fleisch bis zu Wein regeln, ist hier das tatsäch-liche Ausmaß der Europäisierung sogar erheblich höher, als in den erhobenen Werten deutlich wird.“
Im Sachgebiet „Verkehr“ stieg die Europäisierung in den beiden Wahl-perioden um 9 Prozentpunkte auf 51 Prozent, im Sachgebiet „Wirt-schaft“ sogar um 10 auf 57 Prozent.
Annette Töller weist darauf hin, dass die Zahlen weder eine Aussa-ge dazu erlauben, wie wichtig die europäisierten Gesetze sind noch dazu, wie intensiv und weitgehend der Einfluss war. Ob ein Gesetz nur beschlossen wurde, um eine euro-päische Richtlinie umzusetzen oder ob die Umsetzung der Richtlinie nur einen kleinen Teilaspekt des Geset-zes betrifft, lässt sich ebenso wenig sagen. Überdies wurde der Einfluss europäischer Verordnungen nicht erfasst: Sie sind nicht umsetzungs-bedürftig und wirken an der natio-nalen Gesetzgebung vorbei. Die er-hobenen Zahlen können also den tatsächlichen europäischen Einfluss immer nur unvollständig abbilden.
Und auch die darin mitschwingende Idee, dass die Mitgliedstaaten „Op-fer“ der europäischen Regelungs-bestrebungen, der „Regelungswut Brüssels“, seien, ist so nicht richtig. Töller: „Die nationalen Regierungen sind an der Entstehung dieser Rege-lungen essentiell beteiligt.
Nicht durchweg neoliberal„Die EU verfolgt aber nicht, wie häufig behauptet, ein durchweg ‚neoliberales Projekt‘“, betont Töl-ler. „Manche Kompetenzen und Maßnahmen laufen eher auf eine Schaffung von Märkten hinaus, an-dere eindeutig auf eine Korrektur von Märkten. Die Kommission wird eher als Marktverfechterin gesehen, das EU-Parlament eher als Anwalt der Umwelt und der Verbraucher.“ Beim Verbraucherschutz etwa hat die EU schon viel erreicht. Da
FernUni PerspektiveZeitung für Angehörige, Freundinnen und Freunde der FernUniversitätAuflage 80.000ISSN 1610-5494
HerausgeberDie Rektorin der FernUniversität in Hagen, Prof. Dr. Ada Pellert, und die Gesellschaft der Freunde der FernUniversität e. V.
RedaktionStabsstelle Hochschulstrategie und Kommunikation Susanne Bossemeyer (bos) (verantwortlich) Gerd Dapprich (Da)Oliver Baentsch (bae)Benedikt Reuse (br)Anja Wetter (aw)Carolin Annemüller (can)
Universitätsstr. 47, 58097 Hagen Tel. 02331 987-2422, -2413Fax 02331 987-2763E-Mail: [email protected]://www.fernuni-hagen.de
FotosGerd Dapprich, Carolin Annemüller,Anja Wetter, Benedikt Reuse, Wikimedia Com-mons, Thinkstock, Veit Mette, Jakob Studnar, Hardy Welsch, Archiv der FernUniversität
Layout und GestaltungDezernat 5.2, Gabriele Gruchot
FernUni Perspektive erscheint viermal jährlich. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 4. August 2017.
Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Impressum
Prof. AnnetteTöller (Foto: FernUniversität, Veit Mette)
(Fo
to: T
hin
ksto
ck, W
aveb
reak
med
ia L
td)

FernUni Perspektive Seite 9
„Politische Bildung und Wahlverhalten“
Rudimentäres WissenWer keine Ahnung von Politik hat, wählt eher europaskeptische Partei-en… Tatsächlich? Angesichts jüngs-ter Wahlerfolge populistischer Par-teien – wie bei der Präsidentschafts-wahl in Frankreich – scheint es
gesellschaftlicher Konsens zu sein, dass deren Wählerinnen und Wäh-ler politisch eher unwissend sind. Der Sozialwissenschaftler Dr. Mar-kus Tausendpfund von der Fern-Universität in Hagen fragte sich, ob das stimmt: Wie wirkt sich politi-sches Wissen von Bürgerinnen und Bürgern auf deren Wahlbeteiligung und Wahlentscheidung aus?
Gemeinsam mit der Politikwissen-schaftlerin Dr. Daniela Braun von der Ludwig-Maximilians-Universi-tät München untersuchte Tausend-pfund mit Daten der European Elec-tion Study 2014 das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger bei der Europawahl 2014. Mit 42,6 Prozent war die Beteiligung an der EU-Wahl 2014 die niedrigste bei Direktwah-len des Europäischen Parlaments. Gleichzeitig erreichten euroskepti-sche Parteien den höchsten Stim-menanteil seit 1979.
Wissen und wählen:Ja, aber was?„Je größer das politische Wissen, desto eher wird sich eine Person auch an einer Wahl beteiligen“, er-läutert Dr. Tausendpfund, „das ist relativ gut erforscht“. Politisch Ge-bildete beteiligen sich auch eher an EU-Wahlen, weil sie deren Be-deutung erkennen. Nur wer das entsprechende Wissen hat, kann die hochkomplexen politischen und strukturellen Zusammenhänge der EU verstehen und die Bedeutung der Brüsseler Entscheidungen für alle EU-Bürgerinnen und EU-Bür-ger einschätzen.
Falsch wäre jedoch der Schluss, „dass jemand mit viel politischem Wissen nicht euroskeptisch wählt“, haben die Wissenschaftler festge-stellt. „Wer zufrieden mit der Eu-ropäischen Union ist, tendiert selte-ner zu EU-kritischen Parteien. Wer mit der EU hadert, neigt ihnen eher zu“, sagt Tausendpfund.
Es gibt einen weiteren Grund, an-tieuropäisch zu wählen: Unzufrie-denheit mit der eigenen nationa-len Regierung: „Es kann auch um Denkzettel für nationale Eliten ge-hen“, sagt Tausendpfund.
Politisches Wissen vonForschung vernachlässigtFür den Wissenschaftler im Arbeits-bereich Quantitative Methoden in der Fakultät für Kultur- und Sozi-alwissenschaften ist die bisherige Vernachlässigung des politischen Wissens überraschend und besorg-niserregend, „weil es für die poli-tischen Einstellungen und Verhal-tensweisen der Bürgerinnen und Bürger außerordentlich bedeutend ist“, so Tausendpfund..
Die Neigung zu Protestwahlen dürf-te auf der EU-Ebene größer sein als etwa bei einer Bundestagswahl. Tausendpfund: „Die EU-Wahl wird als weniger wichtige ‚Nebenwahl‘ wahrgenommen. In Deutschland zum Beispiel liegt die Beteiligung daran mit etwa 45 Prozent auf eher schwachem Niveau.“ Das sei aller-dings fatal, weil auf der EU-Ebene immer mehr Entscheidungen fallen, die auch für die Bürgerinnen und Bürger in den Nationalstaaten wich-tig sind. „Die Bedeutung des Euro-
päischen Parlaments wächst, die Beteiligung bei seiner Wahl sinkt. Der Bundestag wird als viel wichti-ger wahrgenommen.“
EU-Wahl und BundestagswahlDie Ergebnisse für die EU-Wahl sind, so Tausendpfund, nicht ohne wei-teres auf die Bundestagswahl zu übertragen. Doch auch das bun-despolitische Wissen der Deutschen sei „überschaubar“: „In Deutsch-land und in vielen anderen Staa-ten ist es mittelmäßig bis schwach und zudem auf niedrigem Niveau weit gespreizt. Den Homo Politicus gibt es eher nicht.“ Das sei proble-matisch, weil „rudimentäres Wis-sen an der Wahlurne“ im Gegen-satz zur gesellschaftlich-politischen Erwartungshaltung stehe, sich im Sinn einer direkteren Demokratie immer stärker zu beteiligen. Da
DFG-Forschungsprojekt
Ein Beispiel für gute Wissenschaft Schnabeltiere, die Laokoon-Skulp-tur oder Rosen: In den ästhetischen Schriften großer Denker wie Les-sing, Hegel oder Kant wurde eine bunte Fülle von Beispielen herange-zogen. Denen wendet sich bald das Forschungsprojekt „Das Beispiel im Wissen der Ästhetik (1750–1850). Erforschung und Archivierung ei-ner diskursiven Praxis“ zu, das vom Lehrgebiet Neuere deutsche Litera-turwissenschaft und Medienästhe-tik der FernUniversität in Hagen be-trieben wird.
Seit 1. Mai wird das Vorhaben für drei Jahre von der Deutschen For-schungsgemeinschaft (DFG) geför-dert. Neben dem Leiter des Lehrge-biets Prof. Dr. Michael Niehaus be-treuen die Wissenschaftlichen Mit-arbeitenden Jessica Güsken, M.A., und Dr. Christian Lück das Projekt.
Beide sind in der Beispielforschung erfahren: Güsken durch die Arbeit an ihrer Dissertation, Lück, weil er seit Jahren die Datenbank „Archiv des Beispiels“ betreut, die seit 2014 im Lehrgebiet von Prof. Niehaus be-heimatet ist. Die Online-Plattform katalogisiert und beschreibt Bei-spiele aus Wissenschaftsdiskursen der Moderne und soll nun auch die Ergebnisse des neuen Projekts in sich aufnehmen.
Ausdifferenzierte AnalyseAnalysiert werden Beispiele aus äs-thetischen Schriften von 1750 bis 1850. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt. Eine Herausforderung liegt darin, dass zwischen zahlreichen Beispielarten differenziert werden muss: So dienen manche Exem-pel einfach nur der Klärung allge-meiner Begriffe oder als Gegenbe-weise. Andere hingegen haben ei-nen normativen Charakter und be-inhalten indirekte Aufforderungen an die Leserschaft.
Konträre VerwendungenAuffällig ist, dass gleiche Beispiele teils völlig konträr verwendet wur-den. „Es gibt regelrechte Beispiel-streits!“, erläutert Güsken. Die Phi-
losophen widersprachen sich auch in Fällen, die aus heutiger Sicht mar-ginal erscheinen mögen. So wurde etwa das Krokodil von verschiede-nen Autoren mit gegensätzlichen Eigenschaften assoziiert. Güsken: „Manche behaupten, es sei als am-phibisches Wesen schlicht widerlich und hässlich. Andere meinen hinge-gen, mit seinem kräftigen Körper und dem großen Maul sei das Kro-kodil vielmehr etwas Erhabenes.“
Neben Fragen nach Art und Her-kunft der Exempel werden auch quantitative Erhebungen vorge-nommen: Dokumentiert wird etwa,
inwiefern sich gewisse Beispiele im ästhetischen Diskurs ablösen, häu-fen oder verloren gehen.
Zeitschrift in PlanungMithilfe der DFG-Mittel soll eine neue wissenschaftliche Stelle im Lehrgebiet besetzt werden. Zudem ist bereits eine Fachzeitschrift mit dem Titel „z.B.“ in Planung, die über die Fortschritte des Projekts informieren soll. Zurzeit werden im Rahmen des Bachelorstudiums Kulturwissenschaften Fern-Prakti-ka angeboten, in denen Studieren-de online am „Archiv des Beispiels“ mitarbeiten können. br
Prof. Dr. Michael Niehaus (Mitte) mit Dr. Christian Lück und Jessica Güsken (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
Auch die Sixtinische Madonna von Raffael wurde in ästhetischen Schriften als Beispiel herangezogen. (Foto: Gemeinfrei, via Wikimedia Commons)
Dr. Markus Tausendpfund (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
Dr. Daniela Braun (Foto: privat)

Seite 10 FernUni Perspektive
Forschung
„Management Energieflexibler Fabriken”
Chancen der EnergiewendeDie Energiewende bietet Unter-nehmen nicht nur Risiken, sondern auch Chancen: „Energieflexible Fa-briken“ etwa können ihren Strom-verbrauch optimal an das schwan-kende Stromangebot anpassen. Vier Professoren aus drei Fakultäten der FernUniversität wollen die Wirt-schaft in der Region Hagen dabei unterstützen. Ihr interdisziplinäres Projekt „Management Energiefle-xibler Fabriken“ (MaXFab) stößt bei Unternehmen in der Region bereits auf reges Interesse. Und weil die Wissenschaftler gleichzeitig auch die industrieorientierte Forschung der Hochschule stärken wollen, un-terstützt die FernUniversität in Ha-gen ihr Vorhaben mit Mitteln ih-res Internen Forschungsförderpro-gramms 2016–2020.
Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftler der FernUniversität und Praktikerinnen und Praktiker arbei-ten beim MaXFab-Projekt gemein-sam daran, durch innovative Pla-nungssystematiken und IT-Syste-me Flexibilitätspotenziale der Un-ternehmen bestmöglich nutzen zu
können. Ziel ist, Lastverläufe opti-mal an das schwankende Strom-angebot anzupassen, um von der Entwicklung des „Strommarkts 2.0“ mit seinen wechselnden Prei-sen zu profitieren. Diese Potenziale schlummern bereits in vielen Unter-nehmen. Unerkannt und ohne enge Zusammenarbeit mit den Energie-versorgern sind sie jedoch wertlos.
Die Grundlage für angepasste Ent-scheidungsmodelle in der operati-ven Produktionsplanung will Prof. Dr. Thomas Volling (Lehrstuhl für Produktion und Logistik an der Fa-kultät Wirtschaftswissenschaft) er-arbeiten. Sein Fakultätskollege Prof. Dr. Andreas Kleine (Lehrstuhl für Quantitative Methoden und Wirt-schaftsmathematik) befasst sich mit der Formulierung und Lösung dieser Entscheidungsmodelle. Von der Fa-kultät Mathematik und Informatik ist Prof. Dr. Lars Mönch (Lehrgebiet Unternehmensweite Softwaresys-teme) am Projekt beteiligt. Er ent-wickelt Modellformulierungen und dazu passende simulationsbasierte Lösungsverfahren, die den Anfor-
derungen der Energieflexiblen Fa-brik, insbesondere im Bereich der lang- und mittelfristigen Produk-tionsplanung in der Halbleiterin-dustrie, gerecht werden. Entschei-dungsprozesse in Mensch-Maschi-ne-Schnittstellen untersucht Prof. Dr. Robert Gaschler, der in der Fa-kultät Kultur- und Sozialwissen-schaften das Lehrgebiet Allgemei-ne Psychologie: Lernen, Motivati-on, Emotion leitet.
Kooperation richtiger AnsatzZunächst diskutierte das MaXFab-Team in einem Auftaktworkshop gemeinsam mit Fachleuten aus In-dustrieunternehmen und einem Versorger aus der Hagener Regi-on Potenziale und Hemmnisse der Energieflexiblen Fabrik. Der Ener-giemanager eines mittelständi-
schen Metallverarbeitungsunter-nehmens: „Um künftig von den Entwicklungen des Strommarkts zu profitieren, ist eine engere Zusam-menarbeit der einzelnen Funktio-nen im Unternehmen notwendig – unterstützt durch angepasste Pla-nungsansätze aus der Forschung. Hierfür ist die fachübergreifende Ausrichtung von MaXFab der rich-tige Ansatz.“
In der Folge fand ein zweiter Work-shop an der FernUniversität statt, in dem der wissenschaftliche Aus-tausch innerhalb des Konsortiums und des Forschungsclusters „In-telligente Systeme zur Entschei-dungsunterstützung“ im Vorder-grund stand. Deutlich wurde: Einer-seits ist das deutsche und europä-ische Energiesystem aufgrund von
unregelmäßig anfallenden erneu-erbaren Energien und Engpässen in den Leitungsnetzwerken zuneh-mend von flexiblen Verbrauchern abhängig. Andererseits bedarf es ei-ner ganzen Reihe von Innovationen, um die Flexibilitätspotenziale der In-dustrie nutzbar zu machen.
So leistet die FernUniversität einen Beitrag dazu, den Herausforderun-gen der Energiewende gerecht zu werden und unterstützt Unterneh-men dabei, ihre Flexibilitätspoten-ziale betriebswirtschaftlich zu ver-werten. Das steht im Einklang mit der Strategie der Hochschulleitung: Im Rahmen einer strategisch an-gelegten Initiative soll der Bereich „Ressourceneffizienz und Nach-haltigkeit“ als Bestandteil des For-schungsprofils der Universität wei-ter ausgebaut werden. Dahttp://maxfab.fernuni-hagen.de/
Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften
Kinder- und Jugendbericht veröffentlichtDer 15. Kinder- und Jugendbericht „Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztags-schule und virtuellen Welten – Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsan-spruch im Jugendalter“ ist veröffentlicht worden. Erarbeitet wurde er im Auf-trag der Bundesregierung von einer unabhängigen Sachverständigenkommis-sion, zu der auch Prof. Dr. Cathleen Grunert (Allgemeine Bildungswissenschaft) gehört. www.fernuni-hagen.de/per60-10a
GastwissenschaftlerDr. Utku Sayin, (ehemaliger) Assistant Professor an der Mustafa Kemal Univer-sity, war vom 15. Januar bis 14. April Gast im Lehrgebiet Bildung und Diffe-renz (Prof. Dr. Katharina Walgenbach), um zum Thema „Inclusion and High-er Education – A Comparison between Germany and Turkey“ zu forschen. Ein gemeinsamer Artikel hierzu soll bei der Zeitschrift European Journal of Higher Education (EJHE) eingereicht werden (siehe auch Seite 3).
Habilitation Mit seiner Arbeit „Open Education – Gegenstand, Theorie und Diskurs“ und seinem Probevortrag „Bildungswissenschaft als Medienbildungswissenschaft für die Netzwerkgesellschaft“ hat sich PD Dr. Markus Deimann habilitiert und vom Fakultätsrat für Kultur- und Sozialwissenschaften die Venia Legendi für das Fach Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik erhalten.
PD Markus Deimann (Mitte) mit dem Dekan Prof. Frank Hillebrandt (li.) und Prof. Theo J. Bastiaens (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
Aus den Fakultäten
Post-Doc-WorkshopDr. Marieke van Egmond (Sozialpsychologie), Dr. Laura Froehlich (Sozialpsy-chologie) und Dr. Mathias Kauff (Psychologische Methodenlehre und Evalua-tion) organisieren den 6. Post-Doc-Workshop der Fachgruppe Sozialpsycholo-gie vom 20. bis 22. September in Hagen. www.fernuni-hagen.de/per60-10b
Vorträge• Im Auftrag des Instituts für Philosophie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn organisierte Prof. Thomas Sören Hoffmann (Philosophie II: Ethik – Recht – Ökonomie) dort eine Akademische Gedenkfeier für den Phi-losophen Josef Simon (1930–2016) mit dem Titel „Philosophie als Revolu-tionierung der Denkart. Das Werk Josef Simons im Spiegel seiner europäi-schen Rezeption“ und hielt den Einführungsvortrag.
www.fernuni-hagen.de/per60-10c• Auf Einladung des Research Institute for Culture, History and Heritage (CLUE+)
an der Freien Universität Amsterdam nahm Prof. Hoffmann am Humboldt-Kol-leg „Metaphysics of Freedom? Kant’s Concept of Cosmological Freedom in Historical and Systematic Perspective“ teil. Er sprach über das Thema „Kants theoretischer Freiheitsbegriff und die Tradition der ‚libertas spontaneitatis‘“.www.fernuni-hagen.de/per60-10d
Lexikon des QualitätsmanagementsApl. Prof. Dr. Raimund Pfundtner (FernUniversität, seit 2007 im Ruhestand) hat zusammen mit Dipl.-Soz. Hans-Dieter Zollondz und Prof. Dr. Michael Ketting die zweite, komplett überarbeitete Auflage des „Lexikons Qualitätsmanagement. Handbuch des Modernen Managements auf Basis des Qualitätsmanagements“ bei De Gruyter Oldenbourg herausgegeben. Mit Stichwortartikeln von über 100 Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft und Praxis kann die Fachenzyklopä-die als Nachschlagewerk wie als grundlegende Lektüre genutzt werden. ISBN: 978-3-486-58465-3, ISSN: 2190-2550.www.fernuni-hagen.de/per60-10e
Politisches Wissen in der GrundschuleMit 431 Kindern untersuchen Simone Abendschön (Justus-Liebig-Universität Gießen) und Markus Tausendpfund (Arbeitsstelle Quantitative Methoden) em-pirisch Niveau und Entwicklung des politischen Wissens in der Grundschule: Das politische Wissensniveau ist bereits bei jungen Kindern ungleich. Mädchen, Kin-der aus türkischen Familien sowie Kinder aus einem sozial schwächeren Umfeld haben ein geringeres politisches Wissen als Jungen, Kinder ohne Migrations-
hintergrund sowie Kinder aus höhe-ren sozioökonomischen Umfeldern.
Abendschön, Simone, und Markus Tausendpfund. 2017. Political Know-ledge of Children and the Role of So-ciostructural Factors. American Beha-vioral Scientist 61 (2): 204-221. doi: 10.1177/0002764216689122
PromotionenEllen Diehm. Schriftliche Arbeit: „Fa-miliale, gesellschaftliche und politi-sche Funktionen von Handwerkszünf-ten im spätmittelalterlichen Frankfurt am Main.“ Erst-/Zweitgutachter/-in: Prof. Dr. Felicitas Schmieder, Prof. Dr. Michael Rothmann (Gottfried Wil-helm Leibniz Universität Hannover).Tanja Katharina Hapke. Schriftliche Arbeit: „Machtanwendung in Zielver-einbarungsgesprächen zwischen Vor-gesetztem und Mitarbeiter.“ Erst-/Zweitgutachter/-in: Prof. Dr. Bern-hard Miebach (Heinrich Heine Uni-versität Düsseldorf), Prof. Dr. Uwe Vormbusch.Dr. med. Hans Ulrich Kütz. Schrift-liche Arbeit: „Inklusion der sozio-technischen Konstellation passa-ger reproduktionsmedizinisch as-sistierter Menschwerdung.“ Erst-/Zweitgutachter/-in: Prof. Dr. Frank Hillebrandt, Prof. Dr. Thomas Bedorf.Dorothee Neumaier. Schriftli-che Arbeit: „Das Lebensbornheim „Schwarzwald“ in Nordrach.“ Erst-/Zweitgutachter/-in: Prof. Dr. Arthur Schlegelmilch, Prof. Dr. Peter Brandt.
In vielen Unternehmen schlummern erhebliche Einsparpotentiale bei ihrem Energieverbrauch.(Foto: FernUniversität, Pressestelle)

FernUni Perspektive Seite 11
Dissertation
IT-gestützt die Zähne putzen„Rauf und runter“, „von vorne nach hinten“ oder „von Rot nach Weiß und dann im Kreis“… So ein-fach ist das gar nicht mit dem Zäh-neputzen. Es gibt zahlreiche un-terschiedliche Empfehlungen für die verschiedensten Techniken und Werkzeuge zur richtigen Zahnreini-gung. Welches die tatsächlich rich-tigen sind? „Das weiß heute nie-mand wirklich“, so Dr.-Ing. Dietmar Prestel. „Den meisten Menschen ist unbekannt, wie sie alle wichtigen Flächen im Mund erreichen und welche Zahnputztechniken gleich-zeitig wirksam sind und das Zahn-fleisch nicht verletzten.“ In seiner Dissertation an der FernUniversität in Hagen hat sich Dietmar Prestel mit der „Informationstechnischen Verbesserung der Zahnreinigung“ befasst und wesentliche Grundla-gen für die Entwicklung „intelli-genter Zahnbürsten für jedermann“ entwickelt. Darüber hinaus sind sei-ne Ergebnisse wichtige Grundlagen für die Erforschung der richtigen Be-wegungen für die Zahnreinigung.
Betreut wurde Dietmar Prestel bei seiner Dissertation an der FernUni-versität von Prof. Dr. Dr. Wolfgang A. Halang (bis zum 31. März 2017 Leiter des Lehrgebiets Informati-onstechnik) und an der Hochschule Kempten von Prof. Dr. Arnulf Dein-zer. An der dortigen Kemptener Fa-kultät Informatik ist Prestel als Inge-nieur tätig.
Aus dem Mund auf DisplaysDie FernUniversität und die Hoch-schule Kempten kooperieren mit den Universitäten Gießen, Kas-sel, Kiel und Marburg sowie der OTH Regensburg im interdiszipli-nären Forschungsprojekt „SMART iBrush“. Dabei geht es um die Ent-wicklung einer „intelligenten“ Zahnbürste. Zukünftig sollen Bürs-ten mit kleinen Sensoren ausge-stattet werden, die Informationen direkt aus dem Mund auf Displays – etwa von Smartphones – senden.
Die Anwenderinnen und Anwender sehen dann sofort, wo noch „Putz-bedarf“ besteht. Sie erhalten auch Hinweise darauf, welche Bewegun-gen sie dabei ausführen sollten. Für dieses große Forschungsprojekt, das am Anfang steht, hat Prestels Dissertation an der FernUniversität wichtige Grundlagen gelegt.
Ziel lässt sich erreichenIn seiner Dissertation bewies Diet-mar Prestel nicht nur, dass sich das angestrebte Ziel auch wirklich er-
Für seine Arbeit nutzte
Dietmar Prestel Prototypen von
Sensorzahn-bürsten.
(Foto: Hochschule Kempten,
Pressestelle)
Fakultät für Mathematik und Informatik
Aus den Fakultäten
DFG-VertrauensdozentinProf. Dr. Gabriele Peters (Mensch-Computer-Interaktion) bleibt bis Ende 2019 DFG-Vertrauensdozentin der FernUniversität. Insbesondere For-schende, die zum ersten Mal einen Antrag bei der Deutschen Forschungs-gemeinschaft stellen, können sich von ihr beraten lassen.
FakultätspreisDen Preis der Fakultät für Mathema-tik und Informatik für die beste wis-senschaftliche Arbeit im Jahr 2016 er-
halten in diesem Jahr zwei Wissen-schaftler.
Ausgezeichnet wird Dr. Jochen Ker-dels, Lehrgebiet Mensch-Computer-Interaktion, für seine Dissertation mit dem Thema „A Computational Model of Grid Cells based on a Recursive Gro-wing Neural Gas“. Dr. Marc Fintham-mer, ehemaliger Mitarbeiter im Lehr-gebiet Wissensbasierte Systeme, erhält den Preis für seine Dissertation mit dem Thema „Concepts and Algorithms for Computing Maximum Entropy Dis-
tributions for Knowledge Bases with Relational Probabilistic Conditionals“.
Sommerschule und IEEE-TeilnahmeFür die letzte Woche im September und die erste Woche im Oktober ist die „3rd Russian-German Summer School on High-Performance Computing“ ge-plant, dieses Jahr wieder in Tomsk. Von der FernUniversität reisen Patrick Eitschberger (Parallelität und VLSI) als Dozent und fünf Studierende dorthin. Prof. Dr. Jörg Keller wird seine Vorle-sung per Video halten.
Prof. Keller nahm vom 21. bis 25. Mai an der IEEE International Conference on Communications teil und referierte über „Tweaking Cryptographic Primiti-ves with Moderate State Space by Di-rect Manipulation“.
PromotionenTobias Augustin. Schriftliche Arbeit: „Entwicklung eines Frameworks zur Personalisierung von E-Learning-Ange-boten.“ Erst-/Zweitgutachter/-in: Prof. Dr. Gunter Schlageter, Prof. Dr.-Ing. Matthias L. Hemmje.
reichen lässt. Er zeigte auch auf, welche Vorteile solche zukünfti-gen Zahnreinigungssysteme den Benutzerinnen und Benutzern bie-ten können: Mit Visualisierungs-geräten – also Smartphones, Ta-blets oder PC – können sie ihren Mund sogar dreidimensional erkun-den. Transparente Symbole und Tex-te auf dem Display geben ihnen In-formationen dazu, ob und wo noch geputzt bzw. „nachgebessert“ wer-den muss. Dietmar Prestel: „So-gar eine manuelle Zahnbürste, die mit nur wenigen Sensoren ausge-stattet ist, kann erhebliche Vortei-le bieten.“
Ein weiteres Thema Prestels war, wie Sensor- und Videodaten spä-
ter offline weiterverarbeitet wer-den können: Für Forschungszwecke etwa werden umfangreiche Daten benötigt. Auch in der zahnmedizi-nischen Praxis werden viele Anwen-dungsmöglichkeiten gesehen.
Um für seine Arbeit Daten aus Be-schleunigungsmessungen zu ge-winnen und Bürstorte und Bürst-bewegung auf Displays darstellen zu können, nutzte Prestel Proto-typen von Sensorzahnbürsten. In sie wurden an der OTH Regens-
burg Sensoren eingebaut, die auch in Smartphones integriert sind. Die „intelligente Zahnbürste“ enthält zusätzlich einen Sensor, der den Druck misst, der beim Putzen auf die Zähne ausgeübt wird.
Die Daten werden drahtlos auf ei-nen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone übertragen. Die Be-nutzerin oder der Benutzer erhält dann eine Rückmeldung. Bereits heute können Smartphones über eine App als Spiegel – etwa fürs Schminken unterwegs – genutzt werden. Zukünftig sollen transpa-rente Putz-Hinweise auf dem Dis-play erscheinen. Prestel befasste sich damit, wie diese Rückmeldung am besten gegeben werden kann.
Er untersuchte auch, welche Bewe-gungen beim Putzen ausgeführt werden. Dafür definierte er ver-schiedene Grundbewegungen, die zukünftig für die Vermeidung von Parodontitis, Zahnfleischentzün-dung etc. empfohlen werden kön-nen. Unter anderem untersuchte er, ob jede Fläche gebürstet wurde und welche Bewegung für eine op-timale Reinigung ausgeführt wer-den muss. Und: „Kann eine Hand diese Bewerbung überhaupt aus-führen?“
Ist die Technologie einmal fertig ent-wickelt, hat sie also nicht nur hohe Praxisrelevanz für die einzelne Pati-entin und den einzelnen Patienten, sie ist zugleich ein wertvolles Ins-trument für Langzeitstudien. Zu-dem sind seine Ergebnisse auch für andere medizintechnische Produk-te einsetzbar.
Für Forschung und MassenmarktAnsätze und Lösungen für die ge-räteunterstützte Mundhygiene be-schrieb Prestel in mehreren Patent-veröffentlichungen: Das Spektrum reicht von Zahnbürsten mit minima-ler Sensorik für den Massenmarkt bis zu „Profi“-Geräten mit umfang-reicher Ausstattung.
Seine Erkenntnisse gehen jetzt in die weitere Forschung im Projekt ein: Zunächst muss ermittelt wer-den, wie in Deutschland die Zähne geputzt werden. Die meisten Deut-schen putzen sie chaotisch – eine besondere Hürde für die Informati-onstechnik. Daraus können Verbes-serungen abgeleitet werden. Fern-ziel ist die Entwicklung eines Mas-senprodukts, das sich alle Men-schen leisten können. Die ersten Feldstudien mit Hunderten Proban-den haben begonnen, dafür hat der Prototyp der Zahnbürste „wertvolle Informationen“ geliefert.
Zwei Master an der FernUniversitätVor seiner Dissertation an der Fern-Universität hatte Prestel als Ingeni-eur der Allgemeinen Elektrotech-nik mit FH-Abschluss in Hagen zwei Master-Abschlüsse parallel zu seiner Arbeit in Kempten erworben: „Die Inhalte waren genau die, die ich für meine berufliche Weiterqualifika-tion brauchte.“ Sowohl in seinem ersten Master Elektro-Informations-technik Juni 2011 mit dem Schwer-punkt Echtzeitsysteme als auch im zweiten Master in Praktischer Infor-matik September 2012.
Neben seinen technischen Aufga-ben wie IT-Infrastruktur und Labo-rausstattung begleitet der 49-Jäh-rige im Fachbereich der Hochschu-le Kempten Lehrveranstaltungen, Praktika und Übungen. Zudem setz-te er auch die benötigte technische Ausstattung auf.
Dietmar Prestel: „Hierfür brauche ich natürlich eine andere fachliche Tiefe als in der Allgemeinen Elektro-technik, in der ich ausgebildet wor-den war. Die FernUni hat sehr inte-ressante Fächerkombinationen an-geboten, die ich sofort einbringen konnte.“ Da
Informationen zum Smart-Brush-www.fernuni-hagen.de/per60-11
Marcus Frenkel. Schriftliche Arbeit: „Partitionierung von Fehlerlokalisie-rungsproblemen mit Algorithmen aus der ganzzahligen linearen Optimie-rung.“ Erst-/Zweitgutachter/-in: Prof. Dr. Friedrich Steimann, Prof. Dr. Jörg Keller.Karl Simon. Schriftliche Arbeit: „Er-schließung, Optimierung und Bewer-tung von Verwundbarkeitsanalysen mittels öffentlich zugänglicher Such-maschinen.“ Erst-/Zweitgutachter/-in: Prof. Dr. Jörg Keller, Prof. Dr. Jörg Schwenk.

Seite 12 FernUni Perspektive
Forschung
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
Neue DekaninNeue Dekanin ist seit 1. Mai die bishe-rige Prodekanin Prof. Dr. Ulrike Bau-möl (BWL, insb. Informationsmanage-ment). Sie und der bisherige Dekan Prof. Dr. Jörn Littkemann (BWL, insbes. Unternehmensrechnung und Control-ling) haben ihre Ämter getauscht.
Coaching in Organisationen – Fakten und BewertungWas ist unter Coaching zu verstehen? Lässt sich die ihm zugemessene Wirk-samkeit messen? Diesen Fragen ist der Lehrstuhl für BWL, insb. Personalfüh-rung und Organisation (Prof. Dr. Jür-gen Weibler) mit einer zusammenfüh-renden Studie grundlegender nachge-gangen und hat systematisch Studi-en mit Führungsrelevanz ausgewertet. Die Wirksamkeit des Coachings lässt sich in den untersuchten Fällen tat-sächlich empirisch belegen. Es wirkt aber nicht immer gleich stark. Ursäch-lich hierfür sind viele Faktoren. www.fernuni-hagen.de/per60-12a
Zukunftsweisender Stream der FührungsforschungDr. Sigrid Endres und Prof. Dr. Jürgen Weibler (BWL, insb. Personalführung und Organisation) haben in einem ak-tuellen Review-Artikel einen zukunfts-weisenden Stream der neueren Füh-rungsforschung analysiert und weiter-entwickelt. Basierend auf einem sys-tematischen Review und einer kritisch interpretativen Synthese zahlreicher
Aus den Fakultäten
empirischer Studien wurde schließ-lich ein innovatives Drei-Komponen-ten-Modell Relationaler Führung ge-neriert. Der Artikel wurde im Interna-tional Journal of Management Reviews (IJMR) veröffentlicht. Das IJMR zählt weltweit zu den Top 10 des Faches (Platz 5 von 120 Zeitschriften in der Kategorie „Business“ und Platz 7 von 192 in der Kategorie „Management“).
Endres, Sigrid; Weibler, Jürgen: To-wards a Three-Component Model of Relational Social Constructionist Lea-dership (RSCL): A Systematic Review and Critical Interpretive Synthesis, in International Journal of Management Reviews, 2017, 19, 214-236, DOI: 10.1111/ijmr.12095.
„Spreading the GreenAround the World”In der Umweltökonomie wird u. a. die Frage nach einem zweckmäßigen Design der Umweltpolitik behandelt. Dabei geht es z. B. darum, inwieweit verschiedene umweltpolitische Instru-mente geeignet sind, Firmen zu einem umweltfreundlichen Verhalten anzu-reizen. In jüngerer Zeit hat die Diskus-sion über die Frage größeres Gewicht erhalten, inwieweit sich umweltpoliti-sche Instrumente in ihrer Fähigkeit un-terscheiden können, eine für die Um-welt günstige Form des technischen Fortschrittes herbeizuführen. Prof. Dr. Alfred Endres und PD Dr. Bianca Runds-hagen (VWL, Wirtschaftstheorie) be-handeln diese Frage in einem aktuellen Kontext. In einem wirtschaftstheoreti-schen Modell werden internationale Verhandlungen zur Reduktion grenz-überschreitender Schadstoffe stilisiert. Dabei wird über ein System interna-tional transferierbarer Emissionsrech-te verhandelt. Die Arbeit zeigt Wege auf, wie ein Design eines solchen in-ternationalen Systems gefunden wer-den kann, das günstige Induktionswir-kungen für den umwelttechnischen
Fortschritt besitzt. Der Artikel ist in ei-ner internationalen wirtschaftswissen-schaftlichen Zeitschrift erschienen, die sich auf die Anwendung spieltheoreti-scher Methoden auf umweltpolitische Fragestellungen spezialisiert.
Alfred Endres and Bianca Rundshagen (2017), „Spreading the Green Around the World — How the Permit Alloca-tion Affects Technology Diffusion and Welfare“, Strategic Behavior and the Environment: Vol. 6 (3), S. 249-287. www.fernuni-hagen.de/per60-12b
„Grundlagen der Treibhausökonomie“Wieso ist es bisher nicht gelungen, die global ausgestoßenen Treibhaus-gasemissionen zu verringern? In ei-nem Beitrag in der Zeitschrift WiSt be-leuchtet Prof. Endres die Hintergründe aus wirtschaftstheoretischer Sicht. Die WiSt wendet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften und Prak-tikerinnen und Praktiker, die den Kon-takt zum aktuellen Forschungsgesche-hen aufrechterhalten möchten.
Alfred Endres (2017), „Grundlagen der Treibhausökonomie“, WiSt - Wirt-schaftswissenschaftliches Studium: Vol. 46 (4), S. 23-29.
Forschungsbeitrag und KonferenzvortragDas Team des Lehrstuhls für BWL, insb. Betriebliche Anwendungssys-teme, von Prof. Dr. Stefan Smolnik hat einen Artikel auf der Internatio-nalen Konferenz Wirtschaftsinforma-tik 2017 (WI 2107) präsentiert und im Tagungsband veröffentlicht. Er basiert auf der hervorragenden Bachelorarbeit des Wirtschaftswissenschaft-Studen-ten Mario Porst, der ihn auch im Rah-men des Student Track präsentiert hat:
Mario Porst, Sven Dittes, Stefan Smol-nik: Zielgruppendilemma des gleich-
zeitigen stationären und Online-Han-dels: Eine experimentelle Studie am Beispiel des Facebook-Auftritts eines Mode-Einzelhandelsunternehmens
Das Lehrstuhl-Team wurde auf der WI 2017 von Sven Dittes vertreten.
Mitausrichter und VortragenderProf. Dr. Stefan Smolnik (BWL, insb. Be-triebliche Anwendungssysteme) war auf der 50. Hawaii International Con-ference on System Sciences (HICSS-50) auf Big Island, Hawaii, USA, erneut Mitausrichter von zwei Minitracks im Track „Knowledge Innovation and En-trepreneurial Systems“.
Den Minitrack „Knowledge Manage-ment Disrupted – Understanding the Impacts of Social and Mobile Media“ richtete er zusammen mit den Profes-soren Alexander Richter (IT University Copenhagen) und Andrea Back (Uni-versität St. Gallen) aus, den Minitrack „Designing and Deploying Advanced Knowledge Systems“ gemeinsam mit den Professoren Timo Käkölä (Univer-sity of Jyväskylä), W. David Holford und Pierre Hadaya (beide Université du Québec à Montréal). Während der Konferenz moderierte Prof. Smolnik die entsprechenden Sessions. Darüber hinaus hielt er zusammen mit den Pro-fessoren Murray E. Jennex (San Diego State University) und David T. Croasdell (University of Nevada, Reno) einen ein-geladenen Vortrag zu 11 Jahren Wis-sensmanagement auf der HICSS.
Konferenz in DublinDr. Katharina Ebner und Prof. Stefan Smolnik (BWL, insb. Betriebliche An-wendungssysteme) haben jetzt an der 37. International Conference on Infor-mation Systems in Dublin, Irland, teil-genommen. Im Rahmen des Work-shops der Diffusion Interest Group In Information Technology (DIGIT) stell-ten sie das Manuskript „From Effici-
ency to Innovativeness: Post-Adopti-on IT Use Types and Related Outco-mes“ vor, das in Ko-Autorenschaft mit Prof. Geneviève Bassellier von der Mc-Gill University, Montreal, Kanada, ent-standen ist.
Vortrag• Prof. Dr. Alfred Endres (VWL, Wirt-
schaftstheorie) trägt am 21. Juni im Forschungsseminar der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissen-schaften der Universität Hamburg über „Allocation Rules in Emissions Trading – Implications for Internati-onal Environmental Negotiations“ vor. Zwei Tage später gestaltet er im Kulturzentrum Erlöserkirche in Marl die Veranstaltung „Von der Kli-maökonomie zur Rockmusik – Ein Abend mit Professor Endres“. Nach seinem wissenschaftlichen Vortrag „Wirkungsvolle Klimapolitik: War-um (zum Donnerwetter!) ist das so schwierig? – Eine umweltökonomi-sche Perspektive“ tritt er mit seinem Trio Rockato auf.
PromotionenDominik Ballreich. Schriftliche Ar-beit: „Stable and efficient cubature-based filtering in dynamical systems.” Erst-/Zweitgutachter/-in: Prof. Dr. Her-mann Singer, Prof. Dr. Wilhelm Rödder.Matthias Gröne. Schriftliche Arbeit: „Adäquanz einer periodisierten steu-erlichen Gewinnermittlung – Beurtei-lung der Begründetheit vorgebrachter Argumente und deren Analyse im Hin-blick auf die Anforderungen an die Be-steuerung.” Erst-/Zweitgutachter/-in: Prof. Dr. Stephan Meyering, Prof. Dr. Dieter Schneeloch).Thomas Hahn. Schriftliche Arbeit: „Corporate Governance in Profifuß-ballunternehmen: Eine konflikttheore-tische Analyse aus Sicht des Control-lings.” Erst-/Zweitgutachter/-in: Prof. Dr. Jörn Littkemann, Prof. Dr. Tho-mas Volling).
Hagener Forschungsdialog
Lüdenscheider Gespräche In loser Reihenfolge stellen wir die Veranstaltungsreihen im Hagener Forschungsdialogs vor.
Joachim Gauck, Hans-Dietrich Gen-scher, Wolfgang Bosbach, Peter Struck, Klaus Gysi, Ignaz Bubis, Wal-ter Momper, Marianne Birthler, Ro-land Jahn, Wolfgang Menge, Wolf-
gang Leonhard, Władysław Bar-toszewski, Jan Philipp Reemts-ma, István Sz-abó … Im Mit-
telpunkt der Lüdenscheider Gesprä-che des Instituts für Geschichte und Biographie (IfGB) der FernUniver-sität in Hagen stehen lebensge-schichtliche und biographische Per-spektiven auf Geschichte. Einerseits
sind dies (prominente) Personen, die „selbst Geschichte gemacht ha-ben“. Andererseits Menschen, die „etwas zu sagen haben“.
Ausgewählte Persönlichkeitenund SchicksaleAls Zeitzeugen treten Politikerin-nen und Politiker, Wissenschaftle-rinnen und Wissenschaftler, Bio-graphinnen und Biographen auf, aber auch Publizistinnen und Publi-zisten oder Filmemacherinnen und Filmemacher, die sich mit ausge-wählten Persönlichkeiten der Ge-schichte näher befasst bzw. die sich mit dem Schicksal bestimmter Per-sonengruppen auseinandergesetzt haben. Nicht selten handelt es sich dabei um Menschen, die ihnen per-sönliche nahestanden.
Oft werden ausgewählte histori-sche Filme gezeigt, die dann fach-kundig kommentiert und im Ple-num diskutiert werden.
Die Veranstaltungen richten sich an alle historisch und zeitgeschichtlich Interessierten. Sie können mit den Vortragenden direkt ins Gespräch kommen.
Die Lüdenscheider Gespräche sind seit 1994 eine feste Institution in der sauerländischen Stadt und weit darüber hinaus geworden. Sie fin-den in etwa einmonatigem Ab-stand statt, in der Regel im Lüden-scheider Kulturhaus. Üblicherweise werden sie aufgezeichnet. Geleitet wird die Reihe von Prof. Dr. Arthur Schlegelmilch, Geschäftsführender
Direktor des Instituts für Geschich-te und Biografie.
Die nächsten prominenten Politiker, die in den Lüdenscheider Gesprä-
chen zu Gast sind, werden die FDP-Urgesteine Dr. Burkhard Hirsch und Gerhart Baum am 22. Juni und die CDU-Politikerin Rita Süssmuth am 15. September 2017 sein. Da
Joachim Gauck, der spätere Bundespräsident, war 1995 Referent in Lüdenscheid.(Foto: FernUniversität, Archiv)
(Fo
to: F
ern
Un
iver
sitä
t, A
nd
reas
Tei
chm
ann
)

Viele Hände, eine FernUniversität: Die Hochschule stellt sich der Herausforderung Diversität neu. (Foto: Thinkstock, iStock, Rawpixel Ltd)
FernUni Perspektive Seite 13
Diversitäts-Audit
Vielfalt in der Lehre gestalten
Lehre
Die FernUniversität hat sich 2015 erfolgreich beim Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft für das Diversität-Audit „Vielfalt gestalten“ beworben. Um den Umgang mit Vielfalt im Bereich Studium und Lehre zu professionalisieren, hat die FernUniversität ein Prorektorat für Stu-dium und Diversität eingerichtet. Zudem hat sie sich in ihrem Hoch-schulentwicklungsplan 2020 Ziele und Maßnahmen im Bereich Stu-dium und Lehre gesetzt. Weitere Information: www.fernuni-hagen.de/diversitaet/
i
Ob Sportprofi, Mütter und Väter in Elternzeit oder berufstätige Stu-dierende mit Weiterbildungsinte-resse, ob Hochbegabte, Beruflich Qualifizierte oder behinderte und chronisch kran-ke Menschen: Die Studierenden der FernUniversität in Hagen zeichnen sich durch ihre Heterogenität aus. Neue Weichen für den Umgang mit Vielfalt soll jetzt das Diversity-Audit des Stifterverbands stellen. Wel-che Veränderungen erhofft sich die FernUniversität, und welchen Her-ausforderungen stellt sie sich? Ant-worten gibt Prof. Dr. Sebastian Ku-bis, Prorektor für Studium und Di-versität und Leiter des Audits.
Der Umgang mit einer heterogenen Studierendenschaft ist an der Fern-Universität nicht neu. Welche neu-en Weichen stellt das Diversity-Au-dit des Stifterverbands?
Prof. Sebastian Kubis: Die Fern-Universität beschäftigt sich seit gut 40 Jahren mit der Frage, was es be-deutet, dass wir sehr unterschiedli-che Studierende an unserer Univer-
„Wir wollen die Potenziale der Besonderheiten unserer Studierenden fruchtbar machen.“
Prof. Sebastian Kubis
Neuerscheinung
Erstes deutschsprachiges Lehrbuch zu globaler KlimapolitikDas erste Lehrbuch in deutscher Sprache über globale Klimapolitik hat der emeritierte Politologie-Pro-fessor Dr. Georg Simonis Anfang April 2017 publiziert. Von 2006 bis 2008 war der Herausgeber Profes-sor für Internationale Konflikte und Umweltpolitik an der FernUniversi-tät in Hagen. Der Band trägt den Ti-tel „Handbuch Globale Klimapoli-tik“ und erscheint beim Schöningh-Verlag in der Reihe utb (ISBN-Num-
mer: 9783825286729). In das Buch floss auch die Expertise heutiger wie früherer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FernUniversität ein. Sie alle verbindet die Lehrtätig-keit im Interdisziplinären Studien-gang Umweltwissenschaften („in-fernum“): So verfasste Dr. Daniel Otto, Wissenschaftlicher Mitarbei-ter in diesem Studium und im Lehr-gebiet Internationale Politik, einen Fachbeitrag. Als ehemalige Fern-
Uni-Lehrende sind Prof. Dr. Brigit-te Biermann, Dipl.-Wirt.-Ing. Jen-ny Tröltzsch und Sebastian Gebau-er M.A. mit eigenen Kapiteln ver-treten.
Politischer WiderstandDas Werk behandelt das Thema „Klimawandel“ aus sozial- und po-litikwissenschaftlicher Sicht. Dabei wird das stockende Fortkommen in der weltweiten Klimapolitik weni-
ger auf mangelnde Innovationskraft denn auf politischen Widerstand zurückgeführt: Akteurinnen und Akteure, die bisher von der Nutzung fossiler Energiequellen profitiert ha-ben, klammern sich an den Status Quo und arbeiten gegen Maßnah-men des globalen Klimaschutzes an. Indessen hat das 2015 getrof-fene Abkommen von Paris gezeigt, wie wichtig die Kooperation auf politischer Ebene ist, um die dro-
hende Ge-fahr eines Umwelt-kollapses zu ver-hindern. br
Prof. Sebastian Kubis (Foto: FernUniversität, Veit Mette)
sität haben. Mit dem Audit haben wir einen organisatorischen Rah-men, um uns der Herausforderung Diversität neu zu stellen. Wie kann unsere universitäre Lehre noch bes-ser werden? In einem partizipativen Prozess bringen wir Fragen der In-klusion, der Studieneingangsphase und der diversitätssensiblen Leh-
re zusammen. Sinnvoll ist auch der Austausch mit anderen Universitä-ten. So haben wir die Möglichkeit unsere Überlegungen zu spiegeln
und bekommen Impulse für die Ent-wicklung einer fernunispezifischen Diversitätsstrategie.
Welche Erwartungen verbinden Sie selbst mit dem Diversity-Audit?
Prof. Kubis: Als ich vor gut einem Jahr Prorektor geworden bin, war nicht klar, welche Kraft und Bedeu-tung das Audit mit der Zeit einneh-men würde. Ich hatte zu Beginn die Sorge, dass nach dem anstren-genden Prozess der Mitte 2015 ab-geschlossenen Hochschulentwick-lungsplanung das Audit eine Über-forderung für die Institutionen und Gremien sein könnte. Mittlerwei-le hat die inhaltliche Arbeit in den Entwicklungsfeldern Inklusion, Stu-dieneingangsphase und Lehre/Me-diendidaktik Fahrt aufgenommen. Die Ideen, die in den Hochschulent-wicklungsplan eingeflossen sind, werden weitergedacht. Daher bin ich inzwischen fest überzeugt: Die-ser Prozess ist eine große Chance für die FernUniversität.
Im Arbeitsbereich Inklusion stehen behinderte und chronisch kranke Studierende im Fokus. Wie profitie-ren auch alle anderen Studierenden von den Ideen im Audit?
Prof. Kubis: Die FernUniversität ist auch ein Raum für Studierende, die sich möglicherweise an einer Prä-senzuniversität nicht richtig aufge-hoben fühlen, zum Beispiel auf-grund von körperlichen oder psy-chischen Handicaps. Aber Diversität geht viel weiter. Wir wollen die Po-tenziale der Besonderheiten unse-rer Studierenden fruchtbar machen. Das Audit ist eine gute Möglichkeit,
Desiderate im Bereich der Inklusion anzugehen, etwa in der Barrierefrei-heit. Insbesondere im Zuge der Digi-talisierung darf die wichtige Grup-
pe der behinder-ten und chronisch kranken Studie-renden nicht ver-gessen werden. Von einer Verbes-serung des Studi-
enmaterials und des Zugangs zu den Inhalten profitieren aber auch nicht-behinderte Studierende. In den anderen Entwicklungsfeldern stehen ohnehin alle Studierenden im Fokus.
Inwiefern? Was bedeutet Diversität mit Blick auf die Studieneingangs-phase und diversitätssensible Lehre?
Prof. Kubis: Diversität bedeutet, dass wir ganz verschiedene Studie-rende mit sehr unterschiedlichen Bil-dungszielen haben. Darauf wollen wir antworten. Für die diversitäts-sensible Lehre wollen wir zu neuen Ideen kommen, wie wir eine große und heterogene Studierendenschaft mit begrenzten Ressourcen mög-lichst gut unterrichten können. Stu-dienerfolg entscheidet sich vielfach für Studierende am Anfang des Stu-diums. Ich erhoffe mir daher, dass wir zu konkreten Ideen für die Ge-staltung dieser erfolgskritischen Pha-se gelangen. Unsere Studierenden sollen sich Klarheit darüber verschaf-fen, ob sie einen Abschluss anstre-ben oder ob sie andere Bildungszie-le verfolgen. Darüber hinaus wollen wir ihnen durch Beratung, Brücken-kurse und weitere Angebote ermög-lichen, sich für ein Fernstudium fit zu machen.
Wie fügen sich die Überlegungen in den drei Entwicklungsfeldern zu-sammen?
Prof. Kubis: Indem wir zu einem gemeinsamen Verständnis darü-ber kommen, wie wir uns moder-ne Fernlehre an unserer Hochschu-le vorstellen. Das wird ein Prozess sein, der Diversität in unserer Leh-
re nicht ausschließen darf. Sicher-lich wird er aber durch die Verständi-gung auf gewisse Standards zu Ver-änderungen führen. Wir haben ja immer schon Standards an der Fern-Universität gehabt. Über Jahrzehnte war klar: Standard unserer Lehre ist der Studienbrief. Hinzu kamen etwa Einsendeaufgaben und das Angebot in den Regional- und Studienzent-ren. Wie das gemeinsame Grundver-ständnis heute aussieht – das muss man im Zuge der Digitalisierung mit ihren technischen Möglichkeiten im-mer wieder neu überlegen.
Das Audit läuft noch bis Januar 2018. Wo liegen die Grenzen des Machbaren?
Prof. Kubis: Momentan sind wir noch in der Bestandsaufnahme und ordnen, wie bereits vorhandene Ein-
zelmaßnahmen ein schlüssiges Ge-samtkonzept ergeben. Im zweiten Schritt werden wir schauen, was in unserem Angebot noch fehlt. Da wir uns Grundfragen der Lehre vorge-nommen haben, ist unser Vorhaben ehrgeizig. Die Lehre als Kernbereich der Universität ist ein Feld, in dem wir die Freiheit der Lehrenden schätzen. Es wäre vermessen anzunehmen, dass ein Maßnahmenbündel das Ge-sicht der Lehre bis Anfang 2018 ver-ändern wird. Wir erhoffen uns aber, dass am Ende des Prozesses in den drei Entwicklungsfeldern konkrete Vorhaben feststehen. Weiterverfol-gen sollten wir dann ausgewählte Maßnahmen mit Strahlkraft, Wirk-samkeit und Nachhaltigkeit. Deren Umsetzung wäre der wirkliche Dank an alle Beteiligten nach einem parti-zipativen Prozess des Nachdenkens und Überlegens. can

Seite 14 FernUni Perspektive
Lehre
Förderprogramm „Innovative Lehre“
Internationale Komponenten im FernstudiumDas interne Förderprogramm „In-novative Lehre“ (FILeh) unterstützt neue Ideen und innovative Konzep-te fürs Lehren und Lernen. Die ers-te Ausschreibungsrunde zur Interna-tionalisierung ist beendet. Das Rek-torat hat sechs Projekte aus den An-trägen ausgewählt. „Wir freuen uns, dass sich Lehrende aus allen Fakul-täten mit ihren Ideen und Konzep-ten zur Internationalisierung betei-ligt haben“, sagt Prof. Dr. Theo Bas-tiaens, Prorektor für Digitalisierung und Internationalisierung der Fern-Universität in Hagen.
Gefördert werden etwa Projekte mit einer hohen Strahlkraft für andere Fakultäten oder Projekte mit hoher mediendidaktischer Qualität. Alle Lehrangebote werden englischspra-chig sein und häufig in Kooperation mit europäischen Partneruniversitä-ten konzipiert. „Dazu zählen etwa international ausgerichtete Module oder Short Learning Programmes“, so Bastiaens.
3,5 Millionen Euro bis 2020Mit „FILeh“ unterstützt das Rektorat konkrete Maßnahmen und Projekte, die Lehrende konzipieren: insbeson-dere aktuelle Trends und innovative Ideen im Kontext von Studium und Lehre aus den Bereichen Internatio-nalisierung, Digitalisierung und Stu-dienstruktur. Bis zum Jahr 2020 ste-hen dafür insgesamt 3,5 Mio. Euro.
Ziel ist es, durch die geförderten Konzepte die Studienaktivität und
die didaktische Qualität des Ange-bots weiter zu entwickeln. Gemein-sam getragen wird „FILeh“ durch die Prorektoren Prof. Dr. Theo Bastiaens und Prof. Dr. Sebastian Kubis (Studi-um und Diversität).
Um ihrem bildungspolitischen Auf-trag gerecht zu werden, möchte die FernUniversität internationalen Akti-vitäten sichtbar machen und akzen-tuieren. Denn: Ein globalisierter Ar-beitsmarkt fordert internationalen Wissensaustausch, Kooperation und interkulturelle Kompetenz.
Ausgewählte ProjekteFakultät für Kultur- und SozialwissenschaftenEin Onlineseminar im Master-Studi-engang Governance entwickelt das
Lehrgebiet von Prof. Dr. Annette Töller: „Joint Master Online Semi-nar in Environmental Participation”. Das künftige Angebot ersetzt erst-mals die Präsenzpflicht und beschäf-tigt sich aus globaler Perspektive mit umweltpolitischen Themen. Unter-schiedliche interaktive webbasier-te Lerninstrumente bietet das Lehr-gebiet von Prof. Dr. Robert Gasch-ler zukünftig im Kurs „Cognitive Psychology with and on Multime-dia Learning“ an. Gleichzeitig wird Multimedia als Instrument zur in-ternationalen Zusammenarbeit er-probt.
Fakultät für Mathematikund InformatikDas Lehrgebiet von Prof. Dr. Jörg Keller möchte Fernstudierenden im
Rahmen des Fachpraktikums in ei-nem virtuellen Labor ermöglichen, mit Studierenden der Partneruni-versitäten zusammenzuarbeiten und Zugang zu aktuellen Tools in der IT-Sicherheit zu bekommen: „International Virtual Lab on Infor-mation Security (IVLIS)“.
Der künftige „Short Course“ aus dem Lehrgebiet von Prof. Dr. Lars Mönch wird vorwiegend in der Wirtschaftsinformatik sowie in der Informatik eingesetzt und mit Fall-studien aus der Praxis in Industrie-unternehmen und Dienstleistungs-einrichtungen kombiniert, die Stu-dierende in Foren, über Wikis und hybride Treffen gemeinsam lösen: „An Introduction to Modern Sche-duling Algorithms“.
RechtswissenschaftlicheFakultätDie Rechtswissenschaftliche Fakul-tät wird ihr bereits bestehendes Angebot von Short Learning Pro-grams evaluieren und ausbauen so-wie um ein englischsprachiges Mo-dul zum Völkerrecht für das Netz-werk „European Distance Educa-tion in Law Network (EDELNet)“ erweitern. Dabei sollen neue di-daktische Lehr- und Lernszenarien im Bereich der Rechtswissenschaf-ten erprobt werden. Die Modulent-wicklung erfolgt auch in Zusam-menarbeit mit Wissensc haftle-rinnen und Wissenschaftlern der britischen Open University. Das thematisch international ausge-legte Modul birgt grundsätzlich hohes Anknüpfungspotenzial für neue internationale Kooperatio-nen in der Lehre.
Fakultät für WirtschaftswissenschaftDas erste englischsprachige Mo-dul in der Fakultät für Wirtschafts-wissenschaft hat das Lehrgebiet von Prof. Dr. Stefan Smolnik für den Studiengang Wirtschaftsin-formatik aufgesetzt: „Entwick-lung des englischsprachigen Mo-duls ,Knowledge Management’”. Knowledge Management kann nicht mit deutschsprachiger Lite-ratur abgedeckt werden. Geplant sind internationale virtuelle Gast-vorträge und hybride Veranstaltun-gen. Die Betreuung der Studieren-den erfolgt englischsprachig. aw
Binationales Promotionsprogramm
„Meilenstein“ eröffnetDas zwischen der FernUniversität in Hagen und der King Mongkut’s Uni-versity of Technology North Bang-kok (KMUTNB) beschlossene bi-nationale Promotionsverfahren ist offiziell eröffnet worden. Dekan Prof. Dr. Jörg Desel und Prof. Dr.-Ing. habil. Herwig Unger (Lehrge-biet Kommunikationsnetze) nah-men an der Veranstaltung in Bang-kok teil. Zuvor hatte der Dekan der Faculty of Information Technolo-gy der KMUTNB, Prof. Dr. Phayung Meesad, in Deutschland die unter-
zeichnete Erweiterung des beste-henden Kooperationsvertrages mit Prof. Desel ausgetauscht.
Auf der Veranstaltung in der thailändischen Hauptstadt spra-chen neben den Hagener Wis-senschaftlern internationale Gäste aus Forschung und Politik. So wur-de das Programm unter anderem vom Kulturattaché der Deutschen Botschaft in Bangkok Jan Blezin-ger, dem Präsident der KMUTNB, Prof. Dr.-Ing. Suchart Siengchin,
und Dr. Georg Verweyen, dem Lei-ter des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Bangkok, als weiterer Meilenstein in der lang-jährigen Zusammenarbeit beider Universitäten gelobt. Bereits seit 2008 kooperieren sie bei Informa-tionstechnologien und Informatik.
Durch das neue Promotionspro-gramm sollen bürokratische Hür-den abgebaut und die Erlangung des Doktorgrades an beiden Hoch-schulen erleichtert werden. Um Promovierende künftig besser zu unterstützen, wurde in den Räu-men der Faculty of Information Technology ein spezieller Kon-taktpunkt eröffnet, der von einer KMUTNB-Mitarbeiterin, von Prof. Unger und den administrativen Einrichtungen der FernUniversität betreut wird. Drei Studierende der thailändischen Hochschule nutzten die Gelegenheit und überreichten Prof. Unger bei der Eröffnungsze-remonie ihre Einschreibungsunter-lagen für das neue Programm. br
Feierlich wurde das neue gemeinsame Promotionsprogramm der beiden Universitä-ten eröffnet. (Foto: KMUTNB)
StudiConsulting
Unternehmen beratenDer Lehrstuhl für Betriebswirt-schaftslehre, insb. Betriebswirt-schaftliche Steuerlehre (Prof. Dr. Stephan Meyering) sucht für das Projekt „StudiConsulting“ Studie-rende, die betriebswirtschaftliche Theorie in der unternehmerischen
Studierende als Autoren
Geschichte SkandinaviensIn den hohen Norden führte eine Exkursion des Lehrgebiets Neue-re Deutsche und Europäische Ge-schichte von Prof. Dr. Peter Brandt mit Studierenden der FernUniver-sität in Hagen. Den Erkenntnisge-winn ihrer Spurensuche in Bergen, Oslo und Stockholm haben Teilneh-mende in verschiedenen wissen-schaftlichen Aufsätzen festgehal-ten. Einige Beiträge wurden jetzt im Sammelband „Der skandinavische Weg in die Moderne. Beiträge zur Geschichte Norwegens und Schwe-
Praxis anwenden möchten: In einer Projektwoche vom 5. bis zum 11. Oktober in Hagen wird ein Unter-nehmen kostenlos analysiert und beraten. Die Bewerbungsfrist en-det am 2. Juli. Dawww.fernuni-hagen.de/per60-14
dens vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert“ publiziert. Letztend-lich geht es um die Frage, inwiefern so etwas wie ein „skandinavischer Weg“ in die Moderne überhaupt konstatiert werden kann.
Das Buch ist im Berliner Wissen-schafts-Verlag erschienen (ISBN: 9783830536383) und wurde von Prof. Brandt – seit 2014 im Ruhe-stand – und seinen ehemaligen Mit-arbeitenden Miriam Horn und Dr. Werner Daum herausgegeben. br
(Foto: Thinkstock, nevarpp)

Leute FernUni Perspektive Seite 15
Linda Glawe
Duale Karriere im Ballett und in der Volkswirtschaftslehre
Prof. Halang im Ruhestand
Auf dem „Zenit der Freiheit“
Als Ballett-Tänzerin im Ensemble der neuen Operette Düsseldorf führt sie das Musical „My Fair Lady“ und die Operette „Die Csárdásfürstin“ auf. In ihrem Büro auf dem Campus der FernUniversität in Hagen dreht sich das Gespräch um ostasiatische Volks-wirtschaften. Büh-nentanz und Tanz-pädagogik, Forschung und Fern-Universität: Linda Glawe (24) aus Gelsenkirchen verknüpft beides. Sie macht Karriere im Ballett und in der Wissenschaft. „Die Konkurrenz ist in beiden Bereichen sehr groß, das er-
forderliche Durchhaltevermögen ex-trem hoch“, sieht die Wissenschaftli-che Mitarbeiterin der FernUniversität in Hagen eine wesentliche Parallele. „Ich möchte in beiden Gebieten das Beste aus mir herausholen.“
Das gelingt ihr seit der Schulzeit. Mit 17 Jahren kam Linda Glawe über das Akademiestudium an die
FernUniversität. Nach dem Abitur fand sie in der Volkswirtschaftsleh-re schnell Input und Instrumente für ihr Herzensthema, das sie bis heu-te nicht loslässt: Warum sind einige
Länder so arm und andere so reich? Wachstumstheorien, Strukturwan-del und Einkommensungleichheit waren daher schon in ihrem mit Auszeichnung bestandenen Bache-lor- und Masterstudium der Wirt-schaftswissenschaft Schwerpunk-te. Parallel dazu trainierte sie in ih-rer Ausbildung zur Bühnentänzerin und Tanzpädagogin an der Berufs-fachschule für Bühnentanz in Düs-seldorf mehrere Stunden täglich. Als Ausgleich zur Universitätsarbeit tanzt und unterrichtet sie auch jetzt noch regelmäßig in der NRW-Lan-deshauptstadt. „Ohne die FernUni-versität wäre diese Zweigleisigkeit nicht möglich. Das Konzept passt für mich perfekt“, sagt Linda Glawe.
Seit vergangenem Jahr ist sie Mitar-beiterin am Lehrstuhl für Volkswirt-schaft, insb. Makroökonomie von Prof. Dr. Helmut Wagner sowie am neu gegründeten Forschungszent-rum für volkswirtschaftliche Studi-en zu Ostasien. In ihrer Promotion greift sie das Konzept der „midd-le income trap“ mit Blick auf Asi-en auf. „Es geht um die Frage, wa-rum viele Länder nach einer langen Zeit des raschen Wirtschaftswachs-tums schnell den Status eines Lan-des des mittleren Einkommens errei-
chen. Aber dann scheitern sie daran, diesen Einkommensbereich zu über-winden und zu den hochentwickel-ten Ländern aufzuschließen“, erklärt Linda Glawe. „Dieses Phänomen
wird als ‚middle-income trap‘ be-zeichnet.“ Wich-tiger Bestandteil ihres Promotions-projekts zur Prog-
nose des Wachstums der Länder des mittleren Einkommens wird die Ent-wicklung eines Wachstumsmodells der chinesischen Wirtschaft sein. „Auf dieser Basis möchte ich lang-fristige Strategien für die chinesi-sche Wirtschaft aufzeigen“, umreißt sie ihr Thema.
In ihrer knappen Freizeit hat Linda Glawe begonnen, Chinesisch zu ler-nen. „Es reizt mich, die Sprache zu können“, sagt die Wissenschaftle-rin. „Einige interessante Publikati-onen sind derzeit nur in Chinesisch erhältlich.“
International stark nachgefragte PaperGemeinsam mit ihrem Doktorvater Prof. Helmut Wagner hat sie in den vergangenen Monaten drei Artikel zu ihrem Forschungsthema verfasst, die international auf großes Interes-se gestoßen sind. Die erste Arbeit wurde vom Hausjournal der Associa-tion for Comparative Economic Stu-dies, einem renommierten amerika-nischen Fachjournal, umgehend im Dezember 2016 veröffentlicht. Das zweite Paper „China in the Middle Income Trap“ ist wie das erste derzeit ein weltweit stark nachgefragtes Pa-per auf renommierten Forschungs-
portalen. Bei einer Konferenz mit internationalen Experten im japani-schen Kobe hatte Linda Glawe im Dezember Gelegenheit, Paper und Promotion vorzustellen.
Im Mai hat sie nun beim Gründungs-workshop des „Center for East Asi-an Macroeconomic Research“ (CE-AMeS) den dritten Artikel “A Sty-lized Model of China’s Growth Since 1978“ präsentiert.
Wertvolle Erfahrungen, um Kontak-te für die weitere Wissenschaftskar-riere zu knüpfen und sich zu ver-netzen. Denn für Linda Glawe steht
„Im jeweils anderen Bereich schöpfe ich neue Kraft und Inspiration.“
Linda Glawe
längst fest, dass sie nach dem Ab-schluss ihrer Promotion weiter for-schen will.
Während sie mit 24 Jahren in der Wissenschaft noch jung ist, rückt als Tänzerin in einigen Jahren das Karri-ereende bereits näher. Dennoch will sie als freiberufliche Tänzerin weiter-hin in ausgewählten Projekten auf der Bühne stehen und als Tanzpäd-agogin in Choreografie und Nach-wuchsförderung mitwirken. Denn die Zweigleisigkeit ist für Linda Gla-we ein Geheimnis ihres Erfolgs: „Im jeweils anderen Bereich schöpfe ich neue Kraft und Inspiration.“ can
„Sie sind also auf dem ‚Zenit der Freiheit‘ angekommen!“ Dieser Er-kenntnis von Prof. Dr. Ada Pellert wollte Prof. Dr. Dr. Wolfgang A. Ha-lang keineswegs widersprechen, als die Rektorin der FernUniversität in Hagen ihm die Urkunde zur Verab-schiedung aus dem aktiven Dienst überreichte. Der Leiter des Lehrge-biets Informationstechnik in der Fa-kultät für Mathematik und Infor-matik war sich der grundsätzlichen beruflichen Freiheiten von Profes-sorinnen und Professoren immer bewusst. Und ebenso der Tatsache, dass das Fernstudiensystem der Ha-gener Universität ihren Lehrenden noch ein wenig zusätzliche Flexibi-lität gewährt.
Im Ruhestand könnte sich Prof. Ha-lang eigentlich ganz seinen Hobbys widmen. Das wird er aber nicht. Wolfgang Halang wird auch wei-
ter auf dem Campus sein, wenn auch unregelmäßig. Er ist Vorsit-zender von zwei Promotionskom-missionen und betreut selbst noch mehrere Promotionsvorhaben. Zu-dem müssen Bücher geschrieben werden. Schon kurz nach dem Be-
ginn des Ruhestandes standen ein Doktorandenseminar und eine Rei-se nach China auf dem Terminka-lender, wo sein Lehrstuhl in einer Alexander-von-Humboldt-Instituts-partnerschaft mit dem College of Science and Engineering der City
University of Hong Kong zusam-menarbeitete: „In China muss ein neuer wissenschaftlicher Kontakt gepflegt werden, zudem treffe ich fünf ‚Doktortöchter‘ wieder.“ So nennt Halang Nachwuchswissen-schaftlerinnen, die er – wie auch zahlreiche Männer – als Doktorva-ter betreut hat. Mittlerweile wurde er zum Gastprofessor an der Chi-nesisch-Deutschen Technischen Fa-kultät der Qingdao University of Sci-ence and Technology berufen.
Der Experte für IT-Sicherheit kam 1992 zur FernUniversität. Hier be-schäftigte er sich schwerpunkt-mäßig mit im Echtzeitbetrieb ar-beitenden eingebetteten Automa-tisierungssystemen, also mit Di-gitalrechnern, und entwickelte in diesem Zusammenhang großes In-teresse für sicherheitsgerichtete elektronische Systeme und für IT-
Sicherheit. Die Erfolge seiner Arbeit dokumentieren mehrere Patente.
Zu den weniger schönen Erinne-rungen gehört, dass der Fachbe-reich Elektrotechnik und Informa-tionstechnik seine Selbstständig-keit verlor und mit der Mathematik und der Informatik zu einer neuen schlagkräftigen Einheit, der Fakul-tät für Mathematik und Informa-tik, zusammengelegt werden muss-te. Letzter Dekan des Fachbereichs war Halang. Bis zu seinem Ruhe-stand war er Prodekan der Fakultät.
Halang wurde in Mathematik und in Informatik promoviert. Er arbeitete in der Industrie und war vor seinem Ruf nach Hagen Inhaber eines Lehr-stuhls für Informationstechnik an der Reichsuniversität Groningen. In Rom und Maribor war er Gastpro-fessor. Da
Beim Ballett schöpft FernUni-
Doktorandin Linda Glawe
neue Kraft für die Wissenschaft.
Foto: FUNKE Foto Services,
Kai Kitschenberg
Linda Glawe (Foto: FernUniversität, Hardy Welsch)
Prof. Wolfgang Halang (Mitte) wurde von Rektorin Prof. Ada Pellert und Dekan Prof. Jörg Desel verabschiedet. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)

Seite 16 FernUni Perspektive
Leute
Prof. Stefan Strecker
Die digitale Transformation mitgestaltenZahlreiche Beschäftigte der Fern-Universität engagieren sich in Fach- und Berufsverbänden. Prof. Stefan Strecker ist Sprecher des Fachbe-reichs Wirtschaftsinformatik der Gesellschaft für Informatik.
„Sprecher des Fachbereichs Wirt-schaftsinformatik zu sein ist eine reizvolle Aufgabe.“ Von 2016 bis 2019 vertritt Prof. Dr. Stefan Stre-cker die Mitglieder des Fachbereichs
iIm Rahmen seiner Aktivitäten für den Fachbereich Wirtschaftsinforma-tik engagiert sich Prof. Strecker als Hauptherausgeber einer wissen-schaftlichen OA-Zeitschrift zweier Fachgruppen der GI. Die Zeitschrift „Enterprise Modelling and Information Systems Architectures“ (EMI-SA) wird an der FernUniversität editiert und herausgegeben. Das Pro-jekt hat er jüngst im Rahmen des FernUni-Dialogs vorgestellt (s. S. 2).
in der Gesellschaft für Informatik (GI) und in den Gremien der Wirt-schaftsinformatik. „Das Aufgaben-spektrum als Sprecher ist vielfäl-tig“, so der Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Entwicklung von Informationssys-temen an der FernUniversität in Hagen. Jahrestagungen vorauspla-nen, internationale Kontakte pfle-
gen, verbandsübergreifende Zu-sammenarbeit und die Gründung einer neuen Fachgruppe sind nur einige Themen, die ihn in den ers-ten Monaten beschäftigt haben. Ein weiteres Aufgabenfeld hat er in den Mittelpunkt seiner Zeit als Sprecher gestellt: „Ich möchte dazu beitra-gen, besser über die Themen der Wirtschaftsinformatik zu informie-ren und moderiere dazu die Pod-cast-Gesprächsreihe ‚Perspektiven
– Gespräche zu Themen der Wirt-schaftsinformatik‘, die sich an Schü-lerinnen und Schüler, Studierende und all diejenigen richtet, die besser verstehen wollen, was Wirtschafts-informatik ist.“
Die GI ist mit rund 20.000 Mitglie-dern – unter ihnen Hagener Wissen-schaftlerinnen und Wissenschaftler
– der mitgliederstärkste Fachver-band der Informatik im deutsch-sprachigen Raum. In ihrem Fach-bereich Wirtschaftsinformatik en-gagieren sich 1.200 Mitglieder in beteiligungs- und themenoffenen Fachgruppen und Arbeitskreisen. Zahlreiche Veranstaltungen und Ak-tivitäten dieser Fachgruppen bie-ten die Chance, mitzumachen. Die digitale Transformation von Wirt-schaft und Gesellschaft bilden zen-trale Themen gegenwärtiger Dis-kussionen. Strecker: „Wirtschafts-informatikerinnen und Wirtschafts-informatiker gestalten und formen die digitale Transformation.“ Da-bei steht stets der Wirkungs- und Handlungsverbund von Menschen und Maschinen im Mittelpunkt. Mitglieder des GI-Fachbereichs sind IT-Fachleute aus Wirtschaft, Indus-trie und Verwaltung, Lehrkräfte an Schulen, Auszubildende und Stu-dierende – und Wissenschaftlerin-nen und Wissenschaftler an Fach-hochschulen und Universitäten.
WI-Gruppe fürFernUni-StudierendeProf. Strecker begleitet derzeit die Gründung einer GI-Studierenden-gruppe an der FernUniversität: „Ich bin selbst als Student Mitglied der GI geworden und versuche, Studie-rende, Promovierende und Postdocs für das Mitwirken in der GI und im Fachbereich zu begeistern. Inter-essierte FernUni-Studierende soll-
ten nicht zögern, sich in die neue Gruppe einzubringen.“ Wichtig ist ihm auch die Förderung des wissen-schaftlichen Nachwuchses der Wirt-schaftsinformatik – ob als Mentor für das Doctoral Consortium der In-ternationalen Tagung Wirtschafts-informatik oder als Diskutant auf Forschungskolloquien seiner eige-nen Forschungscommunity.
Dem Fachbereich Wirtschaftsinfor-matik der GI kommt für die deutsch-sprachige Wirtschaftsinformatik-Community eine zentrale Bedeu-tung zu: Seine Mitglieder tragen seit vielen Jahren die wissenschaft-liche Zeitschrift Wirtschaftsinforma-tik, die inzwischen in englischer Sprache unter dem Titel „Business & Information Systems Enginee-ring“ (BISE) erscheint und seit 1959 das zentrale Publikationsorgan für Wirtschaftsinformatikforschung ist. Mitglieder des Fachbereichs enga-gieren sich für wichtige Projekte wie etwa die Erarbeitung von Rah-menempfehlungen für die Gestal-
tung von Studiengängen der Wirt-schaftsinformatik, für die Organisa-tion und Veranstaltung von Tagun-gen und die Herausgabe weiterer Zeitschriften und Buchreihen. Stre-cker: „Das Engagement der Fachbe-reichsmitglieder ist beeindruckend und leistet enorm wichtige Beiträ-ge für die Community.“
Die Vielfalt seiner Aufgaben illust-riert er an Beispielen: „Gerade be-reiten wir die Gründung einer neu-en Fachgruppe ,Informationssyste-me im Gesundheitswesen’ gemein-sam mit dem Fachbereich Informatik in den Lebenswissenschaften vor.“ Die internationale Vernetzung ist ihm ebenso wichtig wie die enge Zusammenarbeit mit Gremien und Verbänden im deutschsprachigen Raum. Strecker: „Es ist notwendig, mit- und vorauszudenken, Themen und Entwicklungen im Blick zu be-halten und sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, um zu er-kennen, in welche Themen wir uns einbringen sollten.“ Da
Urs Wäfler
Interessante Erfahrungen im Hinblick auf die AbschlussarbeitDen nachfolgenden Text stellte uns Urs Wäfler zur Verfügung, der in der Schweiz lebt und Wirtschaftsinfor-matik an der FernUniversität in Ha-gen studiert.
„Seit dem Sommersemester 2012 studiere ich Wirtschaftsinformatik an der FernUniversität. Im deutsch-sprachigen Raum nehmen deren Studienangebote eine herausra-gende Stellung ein. Insofern ge-fällt mir die FernUniversität sehr gut. Falls alles nach Plan verläuft, dann kann ich das Studium der Wirtschaftsinformatik im nächsten Herbst abschliessen; es ist noch die Bakkalaureusarbeit zu schreiben.
Ich bin bei einem Besuch der Web-seite der Zeitschrift „Business & Information Systems Engineering“ (BISE) auf die 13. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik auf-merksam geworden. Die Tagung Wirtschaftsinformatik gehört ge-
wissermassen zu meinem Endspurt an der FernUniversität. Insgesamt wurden meine Erwartungen, dass es eine qualitativ hochwertige Ta-gung sein wird, nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen. Auf solchen Tagungen werden aktuel-le Forschungsergebnisse präsentiert und diskutiert. Insofern habe ich mein Wissen erweitern und vertie-fen können. Insbesondere ermög-lichten die Präsentationen einen
sehr guten Einstieg in die jeweilige Thematik, wobei ein Austausch mit den Referenten möglich war. Hier-bei sah ich, wie andere in der Wis-senschaft arbeiten und konnte mei-ne Arbeitsweise im Hinblick auf die Abschlussarbeit reflektieren.
In St. Gallen konnte man nicht an al-len Vorträgen teilnehmen, weil vie-le parallel gehalten worden sind. Nachdem ich am Sonntag an einem
Pre-Conference Workshop teilge-nommen hatte, hörte ich am Mon-tagmorgen im Audimax den Vor-trag von Thomas Saueressig, wel-cher seit dem 1. Mai 2016 der CIO der SAP SE ist. Nach der Kaffeepau-se besuchte ich die ersten zwei Ses-sionen des Tracks ‚Lern- und Wis-sensmanagement‘. Eigentlich woll-te ich auch noch an der dritten Ses-sion dieses Tracks teilnehmen. Ich entschied mich aber spontan für die
sogenannte Panel Session im Audi-max, das Thema lautete: ‚Digitale Transformation: Alter Wein in neu-en Schläuchen? Zum Verhältnis von Informationsmanagement und Di-gitalisierung.‘
Allgemein war die Tagung sehr leb-haft, initial hatte ich mein individu-elles Programm zusammengestellt. Im Verlaufe der Tagung verliess ich teilweise meine initiale Planung und besuchte eher spontan einen Vor-trag; dabei war zur Orientierung die Veranstaltungs-App eine sehr gute Unterstützung.
Ich werde die 13. Internationale Ta-gung Wirtschaftsinformatik in bes-ter Erinnerung behalten und freue mich nun auf das Thema meiner Bakkalaureusarbeit.“
Informationen zu der Tagung sind unter https://wi2017.ch/de/ zu fin-den.
Studierende und Alumni
Wissenschaftliche Tagungen sind auch für Studierende wertvoll, um neue Einblicke zu gewinnen und Kontakte zu knüpfen.(Foto: Thinkstock, kasto80)
Prof. Stefan Strecker(Foto: FernUniversität, Hardy Welsch)

Studierende und Alumni FernUni Perspektive Seite 17
Fortsetzung von Seite 1
Beim Treffen in Hagen lernten sich die Studierenden untereinander kennen, erkundeten den Campus, die Uni-Bibliothek und die Stadt bei einer Busrundfahrt zu „Hagen High-lights“. Bei einem Empfang trafen sie zudem die Förderinnen und För-derer des Deutschlandstipendiums, das zur Hälfte vom Bund und von Unternehmen oder Privatpersonen getragen wird. Während des Emp-fangs bekamen die Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Urkunden aus-gehändigt, stellvertretend für alle hielt Marion Nissen eine Rede.
Darin skizziert sie, dass das Stipen-dium entscheidend zu ihrer berufli-chen Selbstständigkeit beigetragen hat. Ihr Wunsch und Ziel war es, be-rufliche Beratung und Coaching an-zubieten. „Sie als Förderinnen und Förderer, dürfen sich als Patinnen und Paten dieser Idee verstehen, denn ohne das Stipendium hätte ich eventuell meine Vision nicht so klar formuliert und auch mein Studi-um abgebrochen. Dafür bin ich sehr dankbar!“ Marion Nissen hat an ih-rem roten Faden festgehalten.
Talente von morgenWährend der Urkundenübergabe machte Rektorin Prof. Dr. Ada Pel-lert in wenigen Sätzen deutlich,
wie groß die Vielfalt der FernUni-Studierenden hinsichtlich Alter, fa-miliärer und beruflicher Lebensum-stände, Religion und physischer Fä-higkeiten ist. Was alle eint, würdigte die Rektorin: „Sie leisten Herausra-gendes in Ausbildung, Familie und Gesellschaft und geben das Erlern-te und Ihre Lebenserfahrung durch ihr vielfältiges Engagement weiter.“
Aufgrund der Qualität der Bewer-bungen und der hohen Nachfra-ge seitens der Studierenden möch-
te die FernUni auch im Studienjahr 2017/18 wieder Deutschlandsti-pendien vergeben, kündigte Pel-lert an.
Dafür sagte die Gesellschaft der Freunde der FernUniversität (GdF) wieder ihre Unterstützung zu. GdF-Vorstandsmitglied Bernd Pederza-ni unterstrich die unterschiedlichen Motivationen, sich für das Deutsch-landstipendium einzusetzen: „Po-tenzielle Fachkräfte kennenzuler-nen, Einblicke in Forschung und
Wissenschaft zu gewinnen, das re-gionale Netzwerk zu stärken oder als Absolvent etwas an die Hoch-
schule zurückgeben. Gemeinsam wollen wir aber talentierte Studie-rende fördern und damit positi-ve gesellschaftliche Veränderungen bewirken.“
Eines der Unternehmen, die das Deutschlandstipendium an der FernUniversität fördern, lernten die Stipendiatinnen und Stipendiaten während ihres Besuchs kennen: das mittelständische Kaltwalzwerk Ris-se & Wilke aus Iserlohn, dessen Pro-dukte sich vor allem in der Auto-mobilindustrie und im Werkzeug-bau finden. Das familiengeführte Unternehmen spendet zum vier-ten Mal ein Stipendium – „aus Überzeugung“, wie Personalleite-rin Ines Wilke betonte. Sie führte die Stipendiatinnen und Stipendiaten durch die Produktion des Werkes, in dem 40 Tonnen schwere Stahl-Coils verarbeitet werden. aw
Deutschlandstipendium
„Ohne Stipendium hätte ich mein Studium abgebrochen“
Olga Permann
Psychologiestudentin coacht Soldatinnen und Soldaten
iStipendien stellen zur Verfügung: Gesellschaft der Freunde der Fern-Universität; Wilo Foundation, Dortmund; Dörken AG, Herdecke; Ris-se + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG, Iserlohn; SIHK zu Hagen; Ro-tary Club Hagen-Lenne; Hans-Rudolf Hermannsen, Hagen; Dr. Clau-dio Gruler, Schweiz; Wulf Tiedemann, Wingst; Klaus Oberliesen, Ha-gen; Sparkasse Hagen-Herdecke sowie zweckgebundene Spenden
„Entweder Du lebst deinen Traum oder du hörst auf zu jammern!“ Olga Permann hat sich entschieden: Sie lebt ihren Traum. Die Bundes-wehrsoldatin aus Flensburg studiert an der FernUniversität in Hagen seit dem Wintersemester 2015 Psycho-logie. Da sie sich für zwölf Jahre ver-pflichtet hatte, stand ihr über den Berufsförderungsdienst der Bundes-wehr (BFD) eine Aus- und Weiterbil-dung für den zivilen Arbeitsmarkt zu.
Psychologie und CoachingAuch im Fernstudium in Hagen wird sie weiterhin von der Bundeswehr gefördert. Inhaltlich schließt sie mit ihrem Psychologiestudium an die Coachausbildung an. Ihr berufli-ches Ziel ist es, ausscheidenden Sol-datinnen und Soldaten die Angst vor dem „Fall ins Unerwartete“ zu nehmen.
Denn Olga Permann kann die Zwei-fel nachvollziehen, die nach der ak-tiven Dienstzeit aufkommen. „Bei der Bundeswehr hat man einen si-cheren Arbeitsplatz. Man bekommt Anerkennung, die Uniform und der Zusammenhalt stärken. Durch die Beendigung der Dienstzeit droht dies alles wie eine ,Seifenblase‘ zu zerplatzen.“
Die 34-jährige Flensburgerin hat eine Lizenz als Personalcoach und ist als Freiberuflerin bereits erfolg-reich tätig. Durch das Studium an der FernUni erwirbt sie nun eine höhere Qualifikation, um aus dem Neben- einen Hauptjob zu machen.
Der innere Motor wird durch Interesse angetriebenFür ihr Fernstudium hat sie stets viel Unterstützung bekommen: durch Vorgesetzte und ein gutes priva-tes Netzwerk, das auch mal zur Be-treuung von Permanns achtjähriger Tochter einspringt. Außerdem hat sie diese besondere Energie. „Der innere Motor wird durch das Inter-esse am Beruf oder Studium ange-trieben. Fehlt es, stottert der Mo-tor und man sieht schnell Hinder-nisse auftauchen, die unüberwind-bar erscheinen.“
Aber finden Menschen ihre Beru-fung und passenden Aufgabe im Leben? „Leider gibt es kein Uni-versalrezept, aber ich muss meine Strategie verändern und mich viel-leicht auf meine größten Wünsche besinnen.“ Der Traumberuf aus der Kindheit vielleicht? „Warum nicht“, sagt sie. „Wer seine Nische findet, ist gut darin.“
Sie hat mit dem Fernstudium ih-ren Glückstreffer im Leben gelan-det. In ihrem BWL-Studium an der Fachhochschule fühlte sie sich „wie fremd“. Mitten in einer VWL-Vorle-sung stand sie eines Tages auf, fuhr nach Hause und recherchierte nach alternativen Studiermöglichkeiten. „Entweder tust du jetzt was für dei-nen Traum oder hörst auf zu jam-mern!“ Das war der Schlüsselsatz für den Moment.
„An Psychologie hatte ich schon im-mer Interesse, allerdings hatte ich ,nur‘ Fachabi und hab mir deshalb kaum Chancen ausgerechnet“, er-zählt die 34-Jährige. Mit 16 war sie von Russland nach Deutschland übergesiedelt, ohne Sprachkennt-nisse. Nach einer kaufmännischen Ausbildung holte sie ihr Fachabi nach, ging anschließend zur Bun-deswehr. Da war sie 22 Jahre alt.
Olga Permann wurde dort Sprach-aufklärerin und Sprachausbilderin. Später machte sie über den BFD eine Ausbildung zur Wirtschaftsfachwir-tin und erfüllte mit dem Meister-brief als Beruflich Qualifizierte die er-forderlichen Anforderungen an der FernUni. „Es war als ob ein Traum in Erfüllung geht“, schildert sie. Zum
Wintersemester 2015 startete sie in Hagen.
Persönlicher und virtueller Kontakt „Grundsätzlich fühle mich an der FernUni gut aufgehoben, manch-mal ein bisschen wie abgeschnitten. Fern bleibt eben fern…“ Im ersten Semester hatte sie über das Projekt „Study Buddy“ eine Studienpartne-rin, mit der sie telefoniert und viel
gemailt hat. „Das hat super gepasst, die Zusammenarbeit war prima.“
Im Alltag ist ihr Seminarraum eine Bibliothek oder das Wohnzimmer. Vor allem, wenn ihre Tochter in der Schule ist, lernt Olga Permann. „Ich mache mich fertig, als wollte ich das Haus verlassen – und setze mich an den Schreibtisch. Gesammelt und konzentriert.“ So folgt sie ihrem Traum vom Psychologiestudium. aw
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten trafen sich beim Empfang der Rektorin mit Sponsorinnen und Sponsoren des Deutschlandstipendiums. (Foto: FernUniversität, Pressestelle)
Studiert als beruflich Qualifizierte: Bundeswehrsoldatin Olga Permann. (Foto: FernUniversität, Jakob Studnar)

Seite 18 FernUni Perspektive Studierende und Alumni
Prof. Dr. Oliver Gürtler
VWL-Prof löst Problem „stabiler Hochzeiten“ im FernstudiumFür seine berufliche Laufbahn braucht er den Abschluss an der FernUniversität in Hagen nicht mehr, trotzdem hat Prof. Dr. Oliver Gürtler mit Ehrgeiz seinen Bache-lor-Abschluss in Mathematik abge-legt. Der 38-Jährige lehrt seit 2009 im Bereich Volkswirtschaftslehre an der Uni Köln: „In der VWL model-lieren wir wirtschaftliches Verhal-ten über mathematische Model-le, insofern lehre und forsche ich in einem recht mathematisch ge-prägten Feld.“
Nebenfach angerechnetSeine Kenntnisse waren ausrei-chend, aber nicht erschöpfend. Der Wissenschaftler kniete sich rein und las zunächst Fachbücher. Schnell merkte er: „Ohne Druck von außen
geht es nicht. Also habe ich mich zum Wintersemester 2011/12 an der FernUni in den Bachelor einge-schrieben und es möglichst vielen erzählt. Das provozierte Nachfra-gen zum Stand meines Mathe-Stu-diums.“ Ein wenig war Oliver Gürt-ler darüber entlastet, dass er sich sein VWL-Studium als Nebenfach anrechnen lassen konnte. Selbstdisziplin musste er dennoch aufbringen und vornehmlich die Wochenenden – Samstag war ein regelmäßiger Lerntag – reservie-ren. Da es seine freiwillige Ent-scheidung war, studierte er intrin-sisch motiviert und zielgerichtet. Mit seinem beruflichen Hinter-grund empfand er das Fernstudi-um als „perfekt“.
„Heimspiel“: Klausurort KölnWas Gürtler entgegen kam: Für die Klausuren musste er nicht weit rei-sen. „Da hatte ich mit Köln meistens ein Heimspiel“, lacht er während des Telefoninterviews. „Ich habe so-gar mal in einem Hörsaal geschrie-ben, in dem ich sonst Vorlesungen halte…“
Seine eigenen Studierenden hat er allerdings nicht als Kommilitonin-nen oder Kommilitonen der FernUni getroffen. Statt dessen andere inte-ressante Menschen: „Ich bin nach
wie vor beeindruckt davon, wie he-terogen die Studierendenschaft an der FernUni ist. Der eine studiert als Apotheker, der nächste als Schüler. Seminare oder Studientage waren immer spannend.“
Engagierte Bachelor-ArbeitBesonders viel Ehrgeiz investierte der professorale Student in seine Bachelor-Arbeit bei Prof. Dr. Win-fried Hochstättler aus dem Lehrge-biet Diskrete Mathematik und Opti-mierung: „Stabile Hochzeiten in po-lygynandrischen Gesellschaften“.
Ausgangspunkt der Arbeit war der Algorithmus, mit dem glücksver-sprechende Paarungen von Män-nern und Frauen berechnet werden können. „Dieses Modell wurde er-weitert und untersucht, unter wel-chen Umständen etwa eine Grup-pe von Männern einer Gruppe von Frauen sinnvoll zugeordnet werden kann“, erläutert Oliver Gürtler. Die mathematische Theorie vom lang-fristigen Beziehungsglück.
Ein weiteres Anwendungsbeispiel: Die Fußballnationalmannschaft möchte Freundschaftsspiele veran-stalten. Es gilt, innerhalb eines be-grenzten Zeitraums eine begrenz-te Anzahl von Spielen zu terminie-ren. „Es sollen für eine Mannschaft mehrere Spielpartner gefunden werden“, beschreibt Gürtler.
Wie wirkt sich das FernUni-Studium generell auf seine eigene Lehre und Forschung aus? „Ich bin in der Lehre anspruchsvoller geworden und stel-le höhere Erwartungen an Studie-rende, was Engagement und Mo-tivation betrifft. Es beeinflusst eher meine Forschung. Hier fließen ma-thematische Methoden nun stärker ein.“ aw
Julia Marre
Wenn der Theater-Vorhang fehltWer war die unbekannte Gärtnerin, die Hermann Hesses Haus kaufte? Bei ihren Recherchen für eine Reise-reportage über den Bodensee stieß Julia Marre (36) aus Kiel auf das An-wesen des Literaturnobelpreisträ-gers. Acht Jahre lang lebte Hesse hier seinen Traum von einem länd-lichen Zuhause. Sein Anwesen ver-kaufte er 1912 an eine unbekann-te Gärtnerin. Julia Marre nahm die wissenschaftliche Spur auf, die sie von ihrem früheren Wohnort am Bodensee ausgerechnet ins Stadtar-chiv ihrer Heimatstadt Hameln führ-te. Spätestens jetzt war ihr Interesse geweckt, mehr über die Hamelne-rin, die Hermann Hesses Haus kauf-te, herauszufinden.
Mit Bachelor-Arbeit For-schungslücke entdecktNicht nur im Fall der unbekannten Gärtnerin verknüpft die FernUni-Absolventin Journalismus und Wis-senschaft. Theater, Literatur, Musik, Kunst und Reisen – das ist ihre Welt. Parallel zu ihrem Beruf als Feuille-tonredakteurin studierte Julia Mar-re daher Kulturwissenschaften an der FernUniversität in Hagen. Auf das Thema ihrer Bachelor-Arbeit stieß sie bei ihren zahlreichen The-aterbesuchen. „Ich besuche berufs-bedingt viele Schauspielhäuser und bin auch privat ein großer Thea-
terfan“, berichtet Julia Marre, der das zunehmende Verschwinden des Theatervorhangs auffiel. Mit ihrer Annäherung an den Bedeu-tungswandel des Theatervorhangs an deutschen Schauspielhäusern hat sie eine Forschungslücke ent-deckt. Der deutsche Theater-Ver-lag hat ihre Bachelor-Arbeit „Wenn der Vorhang fehlt“ jetzt in der Fach-literatur-Reihe „Standorte“ veröf-fentlicht.
„Aus dem dekorativen Untertei-lungselement ist auch ein Instru-ment zur Ver- und Enthüllung ge-worden und mittlerweile eines, das dem Publikum im gegenwärtigen Theater in schier unendlichen Varia-tionen begegnet“, sagt Julia Marre. Während in einer Komödie ein Vor-hang unbedingt dazu gehöre, habe das antiillusionistische Theater die-sen komplett abgeschafft. Kommando KarottenbreiHeute, drei Jahre nach ihrem Stu-dienabschluss, arbeitet Julia Marre freiberuflich als Feuilletonredakteu-rin, Autorin und Bloggerin für ver-schiedene Verlage in Deutschland und der Schweiz. „Gedanken zwi-schen Kind und Kunst“ macht sie sich in ihrem kreativen Blog Kom-mando Karottenbrei. Als Mutter ei-ner kleinen Tochter ist sie so zeitlich
flexibel und kann Beruf und das Fa-milienleben an der Kieler Förde gut verbinden.
Diese Flexibilität, verschiedene In-teressen und Aufgaben miteinan-der zu kombinieren, hat sie auch an ihrem Fernstudium geschätzt. „Ich habe nie mit einem festen Stun-denplan gelernt“, blickt sie zurück.
„Studium und Vollzeitjob, das war nur an der FernUni möglich. Ich wollte nie aufhören zu arbeiten.“
Eine durchaus harte Zeit. Als Kultur-redakteurin der Deister- und Weser-zeitung in Hameln hatte sie unregel-mäßige Arbeitszeiten, war häufig auch abends und an den Wochen-enden beruflich unterwegs. Feste
Lerngruppen und Lernzeiten pass-ten daher nicht in ihren Alltag. Als Einzelkämpferin nutzte sie ihre in-dividuellen Freiräume zum Lernen: „Mit viel Disziplin habe ich das hin-gekriegt.“
Beratung und Betreuung online genutztGeholfen haben ihr vor allem die Unterstützungs- und Beratungsan-gebote, die sie online nutzen konn-te. Auch die Vielfalt der Prüfungs-orte kam ihr entgegen. „Von Ber-lin bis Göttingen – ich habe meine Klausuren überall in Deutschland geschrieben“, verband sie die Prü-fungen gern mit Kurztrips und Be-suchen bei Bekannten.
Mit dem Bachelor-Abschluss hat sich Julia Marre ihren Studienwunsch er-füllt, der Master kommt für sie nicht mehr in Frage. Denn momentan ist sie mit Familie und Beruf voll aus-gelastet. Das wissenschaftliche Ar-beiten aber ist ihr durch ihr Fernstu-dium ans Herz gewachsen. Mit der unbekannten Gärtnerin aus Hameln hat sie ein neues wissenschaftliches Thema entdeckt. Die Gärtnerin Cla-ra Auffermann und der Bodensee – wer war diese Frau? Diese Wissens-lücke will Julia Marre nun aufarbei-ten. Als Journalistin und als Wissen-schaftlerin. can
Julia Marre(Foto: SoulPicture)
Prof. Oliver Gürtler (Foto: Lisa Beller)
(Foto: Thinkstock, Pixelnest)

FernUni Perspektive Seite 19
Alumnifeiern in Hagen
Ansturm der Absolventinnen und AbsolventenZwei Alumni-Veranstaltungen an ei-nem Ort zu gleichen Zeit: Weil mehr als 130 erfolgreiche Studierende zu der Veranstaltung des Regionalzen-trums Hagen kommen und ihre Lie-ben mitbringen wollten, waren 340 Personen angemeldet. Kein Raum der FernUniversität in Hagen ist da-für groß genug. „Eine solche Reso-nanz haben wir noch nicht erlebt“, freute sich die Leiterin des Regional-zentrums, Svenja Gummersbach. Innerhalb kürzester Zeit wurden aus einer Feier zwei gleichzeitige Veran-staltungen. Die Gäste wurden von Rektorin Prof. Dr. Ada Pellert und Prof. Dr. Garbiele Zwiehoff, Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakul-tät, begrüßt. Anschließend hielten diese im jeweils anderen Raum eine Festansprache. Höhepunkte waren die Ehrungen.
In der Feier für die Alumnae und Alumni der Mathematik und Infor-matik, der Rechtswissenschaft und der Wirtschaftswissenschaft sprach Absolventin Michaela Thulke. Sie ist seit 2016 Masterabsolventin der Fa-kultät Wirtschaftswissenschaft, wo sie heute als Wissenschaftliche Mit-arbeiterin arbeitet. Den Weg bis zum Abschluss beschrieb sie als eine lange Autoreise. Dass diese „Fahrt“ auch beschwerlich sein und der Mo-tor versagen kann, verschwieg sie nicht: „Wenn dann ein Pannen-helfer vorbeikommt und sagt: ‚Ich glaub‘ an dich!‘ ist das unbezahl-bar. Es ist jetzt an der Zeit, diesen Pannenhelfern zu danken“, sagte sie zu den Angehörigen gewandt.“
Niklas Reusch
Zweigleisig auf der Überholspur„Ich habe mit zehnminütigen Kon-zentrationsübungen angefangen während der Bachelorarbeit, an-sonsten hatte ich aber keine beson-deren Tricks beim Lernen“, verrät Niklas Reusch. Eigentlich kaum zu glauben bei dem rasanten Tempo,
das der 19-Jährige aus Mettmann in der Nähe von Düsseldorf vorleg-te: Eben erst hatte er mit Bravour sein Abitur bestanden, kurz darauf schob er auch schon seinen Bache-lorabschluss im Fach Informatik an der FernUniversität in Hagen hin-
terher, an dem er parallel zur Schu-le gearbeitet hatte. Der junge Ab-solvent wurde während seines Fern-studiums mit Erfolg im Rahmen des Projekts „SchülerUni“ des Studien-zentrums Krefeld gefördert.
In der Schule fühlte sich Niklas Reusch einfach nicht mehr richtig ausgelastet. „Ich wollte etwas ha-ben, das mich herausfordert“, sagt er im Rückblick. Schon in der drit-ten Klasse hatte er begonnen, sich mit Programmiersprachen ausein-anderzusetzen. „Ich habe damals selbst versucht, Computerspiele zu programmieren“, erinnert sich Ni-klas Reusch. Innerhalb seiner Schu-le fand sein Wissensdrang jedoch kaum Resonanz, denn das Unter-richtsangebot deckte das Thema In-formatik nicht ab.
Der begeisterte Hobby-Program-mierer ließ sich davon nicht ent-mutigen und machte sich kurzer-
hand auf die Suche nach exter-nen Lehrangeboten. Fündig wur-de er beim Akademiestudium der FernUniversität. Er zögerte nicht und schrieb sich im Wintersemester 2013/14 für erste Informatik-Kurse ein. „Das Angebot der FernUni hat mir das Studium überhaupt erst er-möglicht“, bilanziert Niklas Reusch.
Gezielt gefördert in KrefeldKurz nach Beginn seines Studi-ums wurde der begabte Jugendli-che vom Studienzentrum Krefeld der Hochschule kontaktiert und in das Projekt „SchülerUni“ auf-genommen. Zum Wintersemester 2013/14 überführte der Jungstudie-rende sein Akademiestudium dann in einen abschlussorientierten Stu-diengang mit dem Ziel „Bachelor of Science“. Nicht zuletzt wegen der passenden Förderung durch das Studienzentrum stellte der Lernall-tag kein Problem für Niklas Reusch dar: „Ich würde die Belastung nicht
als stark einschätzen, weil mir das Thema einfach sehr viel Spaß ge-macht hat.“
Zu neuen Ufern Neben rein theoretischen Frage-stellungen hat Niklas Reusch schon ein Auge auf die Praxis geworfen: In seiner Abschlussarbeit mit dem Titel „Kontextbasiertes Messaging für Handwerkskooperation“ ent-wickelte er einen speziellen Chat, der später Bestandteil einer App für Handwerksbetriebe sein soll, die die Koordination auf Kleinbaustel-len erleichtert.
Niklas Reusch träumt davon, sich irgendwann mit einer guten Idee selbstständig zu machen. Bis dahin will er aber auf jeden Fall noch sei-nen Master in Informatik anschlie-ßen. Entweder im Ausland oder – falls er ein gutes Jobangebot erhal-ten sollte – weiterhin an der Fern-Universität. br
Bei der Feier für die Kultur- und So-zialwissenschaftlerinnen und -wis-senschaftler schilderte Meike Hä-ger, Bachelor-Absolventin Bildungs-wissenschaft, ihre „kleinen Start-schwierigkeiten“: „Als die erste Sendung Studienbriefe bei mir ein-traf, dachte ich, dass es sich um das Material der nächsten drei Semes-ter handeln würde.“ Das gesamte Studium war für sie von Höhen und Tiefen geprägt: „Aber ein Abbruch kam für mich zu keiner Zeit infra-ge. Jede bestandene Prüfung oder Hausarbeit motivierte mich weiter-zumachen.“ Zudem fühlte sie sich immer gut betreut. Vor allem der meist virtuelle Austausch mit ih-ren Mitstudierenden half ihr. Ob-wohl das Studium sehr anspruchs-voll war, studiert Meike Häger jetzt im Master Bildung und Medien. Als Studienberaterin der FernUni kann sie heute aus eigener Erfahrung Stu-dierenden besser helfen.
Dass Alumni starke Nerven brau-chen, hatte auch die Rektorin be-tont. Daher freute sie sich sehr, dass viele, die die Studierenden unter-stützt hatten, mitgekommen wa-ren. Nach den Worten von Prof. Dr. Gabriele Zwiehoff sind die Absol-ventinnen und Absolventen mit ih-rem Abschluss bestens ausgerüstet, denn sie haben Fachliches eben-so gelernt wie wissenschaftliches Arbeiten. „Das stattet Sie aus mit wichtigen Fähigkeiten: reflektie-rend und damit kritisch an Unbe-kanntes heranzutreten, urteilsfreu-dig und urteilsfähig zu agieren.“ Da
Erfolgreiche Studierende aus Kultur- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Informatik, Rechtswissenschaft…
…sowie Wirtschaftswissenschaft feierten ihre Abschlüsse in Hagen. (Fotos: FernUniversität, Pressestelle)
Niklas Reusch (3.v.li.) gratulierten Markus Prehn (Bürgerstiftung Krefeld), Gregor Micus (Beigeordneter der Stadt Krefeld), Jutta Roßbach (Leiterin des Studien-zentrums), Dieter Weckmann (Mentor im Studienzentrum) und Jochen Rausch (Bürgerstiftung). (Foto: Lothar Strücken, Presseamt Krefeld)

PanoramaSeite 20 FernUni Perspektive
Ein
e st
änd
ig a
ktu
alis
iert
e V
eran
stal
tun
gsü
ber
sich
t fi
nd
en S
ie im
Inte
rnet
au
f d
er S
eite
ww
w.f
ern
un
i-h
agen
.de.
Alle
Ver
anst
altu
ng
en s
ind
öff
entl
ich
! Die aktuelle Übersicht
• aller Veranstaltungen der FernUniversität und ihrer Regional- und Studienzentren finden Sie unter
http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/veranstaltungen/
• der Veranstaltungen von Regional- und Studienzentren in Ihrer Nähe unter http://www.fernuni-hagen.de/regionalzentren/
(bitte „in Deutschland“ bzw. „im Ausland“ anklicken)
• der Veranstaltungen im Hagener Forschungsdialog stehen unter http://www.fernuni-hagen.de/hagenerforschungsdialog
Bonn17.06.2017, 9.30 Uhr „women & work“ – Deutschlands größter Messekongress für FrauenDas Regionalzentrum Bonn ist am Messe-stand im Forum Weiterbildung W31/32 zu finden. World Conference Center Bonn/Er-weiterungsbau, Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn.
Borken27.06.2017, 18.30 UhrBerufsbegleitend studieren mit und ohne AbiturDas Regionalzentrum Coesfeld informiert. VHS, VHS Forum, Heidener Str. 88.
Braunschweig22.06.2017, 17.00 UhrBerufsbegleitend studieren mit und ohne AbiturInformationsveranstaltung des Regionalzen-trums Hannover. Agentur für Arbeit Braun-schweig-Goslar, Cyriaksring 10/BiZ-Eingang Münchenstraße, 38118 Braunschweig.
CoesfeldDie Veranstaltungen der „BürgerUniversität Coesfeld“ im Hagener Forschungsdialog fin-den im WBK – Wissen Bildung Kultur, Osterwi-cker Straße 29, 48653 Coesfeld, statt.
21.06.2017, 19.00 Uhr„Die STAR TREK-Physik. Warum dieEnterprise nur 158 Kilo wiegt undandere galaktische Erkenntnisse“Referent: Prof. Dr. Metin Tolan
12.07.2017, 19.00 Uhr„Musik und Affektivität – Über dieemotionale Wirkung von Musik“Referent: PD Dr. Christoph Seibert
20.09.2017, 19.00 Uhr„Vom Nutzen und Wert des Nichtwissens“Referent: PD Peter Wehling
Regionalzentrum Berlin
An prominenter Stelle
Das Regionalzentrum Berlin ist jetzt in dem modernen Bürogebäude in unmittelbarer Nähe zum Café Kranzler zu finden. (Foto: Andreas Nenninger)
Dinslaken22.06.2017, 19.00 UhrBerufsbegleitend studieren mit und ohne AbiturInformationsveranstaltung des IBZ Wesel. VHS, Friedrich-Ebert-Str. 84 , 46535 Dinsla-ken, Raum: R. 42.
Hagen23.06.2017Campus-Fest der FernUniversitätUniversitätsstraße, 58097 Hagen.
07.07.2017, 8.30 bis 16.00 UhrHagener AusbildungsmesseDas Regionalzentrum Hagen informiert über Studienangebote der FernUniversität, ihr-Personaldezernat über Berufsausbildungen. SIHK-Bildungszentrum, Eugen-Richter-Str. 110, 58089 Hagen, und (im selben Gebäu-de) Kreishandwerkerschaft, Handwerkerstr. 11, 58135 Hagen.
Hagener ForschungsdialogDie Veranstaltungen im Hagener Forschungs-dialog finden, sofern nichts anderes angege-ben ist, im Seminargebäude, Universitätsstr. 33, 58097 Hagen, statt.
28.06.2017, 16.00 Uhr„Die Wirkung materieller Objektivatio-nen: architektursoziologischeÜberlegungen“Vortragsreihe „Kolloquien des Instituts für Soziologie“. Referentin: PD Dr. Silke Steets.
29.06.2017 17.00 Uhr„Zukunft der Arbeit – innovativ,nachhaltig! und ohne Manager?“Vortragsreihe „Nachhaltiges Wirtschaften“. FernUniversität, TGZ-Gebäude, Raum Ellipse (EG), Universitätsstr. 11, 58097 Hagen
29.06.2017 18.30 Uhr„Affekt und Politik“Vortragsreihe „Forum Philosophicum“. Refe-rent: Prof. Dr. Jan Slaby.
12.07.2017 bis 14.07.2017„Tangibilität. Handgreifliche Beispieleästhetischen Wissens“Fachtagung. FernUniversität, AVZ-Gebäude, Kleiner Senatssaal, Raum B118, Universitäts-str. 21, 58097 Hagen, und Ruhr-Universi-tät Bochum.
13.07.2017 bis 15.07.2017Recht und Billigkeit – Zur Geschichte der Beurteilung ihres VerhältnissesInterdisziplinäre Fachtagung. Veranstalter: Prof. Dr. Hubertus Busche (FernUniversität) und Prof. Dr. Matthias Armgardt (Universi-tät Konstanz).
13.07.2017, 17.00 Uhr„Rechtssoziologie und Verfassungsge-richtskomparatistik, am Beispiel desVergleichs des U.S. Supreme Court und des Bundesverfassungsgerichts“Vortragsreihe „Europäische Verfassungswis-senschaften“. Referent: Prof. Dr. Ralf Ro-gowski.
13.09.2017 bis 16.09.2017„Die Phänomenologie und das Politische“Fachtagung. Veranstalter: Deutsche Gesell-schaft für phänomenologische Forschung und Prof. Dr. Thomas Bedorf (FernUniversität).www.fernuni-hagen.de/per60-20a
21.09.2017, 18.30 Uhr„Fichtes Theorie des Unbewussten“Vortragsreihe „Forum Philosophicum“. Refe-rentin: Prof. Petra Lohmann.
Hallenberg21.06.2017, 8.30 bis 13.00 UhrTop-Nachwuchs für Top FirmenBei der Ausbildungs-/Studienbörse für Schüle-rinnen und Schüler von Gymnasialen Oberstu-fen und Berufskollegs informiert das IBZ Bri-lon. Schützenhalle, Weiferweg, 59965 Hal-lenberg.
Heidelberg, 16.00 Uhr22.06.2017Berufsbegleitend studieren mit und ohne AbiturInformationsveranstaltung des Regionalzen-trums Karlsruhe. BIZ, Kaiserstr. 69 bis 71, 69115 Heidelberg
Karlsruhe21.06.2017, 18.00 UhrItalienische „Gastarbeiter“, Europa und der Südwesten. Aspekte frühereuropäischer Integration aus der Perspektive Baden-WürttembergsVeranstaltungsreihe „Gespräche am Tor – Karlsruher Begegnungen zu Wissenschaft, Politik und Kultur“: Vortrag von Prof. Dr. Hei-ke Knortz im Rahmen der Heimattage Karlsru-he. Regionalzentrum, Kriegsstraße 100 (Post-bankgebäude), 76133 Karlsruhe, Seminar-raum BASEL.
Krefeld03.07.2017, 17.00 UhrSchülerUni in KrefeldInfo-Vortrag für Schülerinnen und Schüler, Lehrende und Eltern. Studienzentrum, Pe-tersstr. 120, BehnischHaus, Eingang B, 47798 Krefeld.
Landau13.07.2017, 16.00 UhrBerufsbegleitend studieren mit und ohne AbiturDas Regionalzentrum Karlsruhe informiert. BIZ Landau, Johannes-Kopp-Straße 2, 76829 Landau in der Pfalz.
Lippstadt 11.07.2017, 8.00 UhrWestfälische StudienbörseDas Studienzentrum Lippstadt informiert. Campus der Hochschule Hamm-Lippstadt, Arnold Hueck-Str. 3, Lippstadt.
LüdenscheidDie Veranstaltungen der „Lüdenscheider Ge-spräche“ des Instituts für Geschichte und Biographie im Hagener Forschungsdialog fin-den im Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Str. 9, 58511 Lüdenscheid, statt.
22.06.2017, 18.00 Uhr„Der Baum und der Hirsch“: ZweiVorkämpfer für ein liberales,freiheitliches DeutschlandPodiumsdiskussion mit Dr. Burkhard Hirsch, Vizepräsident des Deutschen Bundestages
Am 22. Juni
Langer Abend der Beratung
a.D., und Gerhart Baum, Bundesminister a.D. Moderation: Prof. Dr. Ewald Grothe (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Archiv des Liberalismus, Gummersbach).
15.09.2017, 18.00 UhrRita Süssmuth – Erinnerungen für die ZukunftReferentin: Prof. Dr. Rita Süssmuth
Minden07.09.2017, 15.00 bis 18.00 UhrTag der Offenen TürISS Minden, Geschäftsstelle (1. OG), Königs-wall 99, 32423 Minden.
Nürnberg23. und 24.06.201718.00 Uhr Rhetorisches Know-howDas Regionalzentrum und das Bildungszent-rum Nürnberg kooperieren. Bildungszentrum, Seminargebäude Gewerbemuseumsplatz 2, Nürnberg. 23.06.: 18 bis 21.15 Uhr, 24.06. 9.30 bis 17 Uhr.
05.07.2017, 9.00 UhrExistenzgründung und freiberuflicheTätigkeitRegionalzentrum und Team Akademische Be-rufe der Agentur für Arbeit Nürnberg infor-mieren. Agentur für Arbeit, BIZ. Informa-tionen: [email protected].
14.07.2017, 9.00 UhrMehr Erfolg im VorstellungsgesprächRegionalzentrum und Team Akademische Be-
Nicht zu übersehen ist der neue Standort des Regionalzentrums Ber-lin der FernUniversität am weltbe-kannten „Ku’damm“: Hinter dem tra-ditionsreichen und markanten Café Kranzler erhebt sich das moderne Bürogebäude Neues Kranzler Eck, in dem die Außenstelle der Hagener Universität in der Bundeshauptstadt seit dem 1. April zu finden ist – in einem prominenten Unternehmens-umfeld am Kurfürstendamm 21/22, 10719 Berlin.
Geöffnet ist das Regionalzentrum Ber-lin der FernUniversität in Hagen mon-
tags bis freitags von 15 bis 19 Uhr so-wie dienstags, freitags und samstags von 10 bis 13 Uhr. Zu erreichen ist es per Telefon unter 030 2123 0918, per Fax unter 030 2123 0993 und per E-Mail an [email protected]. Besucherinnen und Be-suchern wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen. Da
Ausführliche Informationen des Regi-onalzentrums, etwa zu Veranstaltun-gen und Veranstaltungsorten, sind unter http://www.fernuni-hagen.de/berlin/ zu finden.
Was kann ich an der FernUniversität in Hagen studieren und wie funktioniert ein Fernstudium? Die Fragen von Stu-dieninteressierten werden am Don-nerstag, 22. Juni, beim Langen Abend der Beratung beantwortet. Von der FernUniversität beteiligen sich die Re-gionalzentren in Bonn (ab 17 Uhr), Coesfeld (ab 17 Uhr), Hagen (ab 17
Uhr), Leipzig (ab 16 Uhr), Neuss (ab 17 Uhr) und Nürnberg (ab 15 Uhr) so-wie die Studienzentren Arnsberg (ab 17 Uhr), Krefeld (ab 17 Uhr) und Rhei-ne (ab 19 Uhr). Das Regionalzentrum Frankfurt am Main nimmt mit einem Langen Tag der Beratung Teil (ab 10 Uhr). Weitere Informationen: www.fernuni-hagen.de/per60-b
rufe der Agentur für Arbeit Nürnberg infor-mieren. Agentur für Arbeit, BIZ. Weitere In-formationen: [email protected].
Offenburg06.07.2017, 16.00 UhrBerufsbegleitend studieren mit und ohne AbiturDas Regionalzentrum Karlsruhe informiert. BIZ Offenburg, Weingartenstr. 3, 77654 Of-fenburg.
Olpe20.06.2017, 19.00 UhrBerufsbegleitend studieren mit und ohne AbiturInfoveranstaltung des Regionalzentrums Ha-gen für Studieninteressierte. Olpe, WBZ, Raum +3.02 Kurfürst-Heinrich-Str. 34 57462 Olpe.
Stuttgart15.09.2017, 10.00 Uhr 15. Stuttgarter WeiterbildungstagBildungsmesse des Netzwerkes für Fortbil-dung Baden-Württemberg. Das Regionalzen-trum Stuttgart informiert. TREFFPUNKT Rote-bühlplatz, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart
Zürich01.07.2017, 13.00 Uhr, und29.07.2017, 10.00 UhrGeschäftsstelle Service Schweiz geöffnetAnnahme von Einschreibeunterlagen (Beglau-bigungen) und Einsende-/Hausarbeiten. Für Interessierte und Studierende. Schweiz, Tech-nopark, Büro Nr. 1007.
Die Mai-Sonne gab alles, die Tempera-tur war ideal und das Team der Fern-Universität in Hagen hochmotiviert: Beim Firmenlauf 2017 stimmten ein-fach alle Voraussetzungen. Die Orga-nisatorin für die Teilnahme der Hoch-schule freute sich über die vielen An-meldungen und den guten Teamgeist beim Hagener Sport-Event: „Wieder ein Erfolg für die gesunde FernUni!“ Spaß hatten die Läuferinnen und Läu-fer und die Walkerinnen und Wal-ker aber auch schon vor dem Start-schuss: „Schöne Sache, auch mal au-ßerhalb der FernUni Beschäftigte zu treffen und kennenzulernen“, findet eine Angestellte in der Verwaltung.
Bei allem Vergnügen war die Strecke durchaus anspruchsvoll: Auf rund sie-ben Kilometern Länge führte sie ein-mal rund um den Hengsteysee. Spe-zielle Chips, die an die Schnürsenkel gebunden wurden, ermöglichten eine genaue Messung der Laufzeiten. Mit-machen konnten wirklich alle Hage-ner Beschäftigten mit Lust auf Bewe-gung: „Was ich richtig cool finde ist, dass hier auch die Rollstuhlfahrer mit
dabei sind“, sagt eine Wissenschaft-liche Mitarbeiterin.
Gute VorbereitungDas Sportteam der FernUni trat ge-wohnt professionell auf: Laufschuhe, Trikots und Dehnübungen vor dem Start waren ein Muss. Gab es im Vor-feld besondere Trainingsmethoden? „Hund an die Leine und ab geht die Post!“, schmunzelt ein Wissenschaft-licher Mitarbeiter. Solchen Ehrgeiz zeigten viele Beschäftigte, betrieben gezieltes Ausdauertraining vor dem Rennen oder bereiteten sich ander-weitig vor. Ein Wissenschaftlicher Mit-arbeiter pendelt regelmäßig aus Bre-men zum Hagener Campus. Er verrät: „Ich habe mir extra die Dienstzeit so gelegt, dass ich es zum Lauf schaffe.“
Mit 73 Anmeldungen gewann das Team der FernUniversität auch dieses Jahr wieder den Pokal für die teilneh-merstärkste Gruppe. Außerdem gin-gen die dritten Plätze in der gemisch-ten Wertung „Frauen und Männer“ und der Kategorie „schnellste Frau-en“ an FernUni-Beschäftigte. br
FernUni bei Firmenlauf
Wieder mit größtem Team
Das Team der FernUniversität (Foto: FernUniversität, Pressestelle)