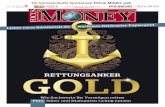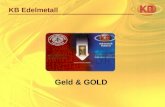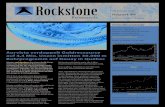Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft
-
Upload
adolf-weber -
Category
Documents
-
view
227 -
download
6
Transcript of Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft

Geld und Gold in der SowjetwirtschaftAuthor(s): Adolf WeberSource: FinanzArchiv / Public Finance Analysis, New Series, Bd. 12, H. 4 (1950/51), pp. 632-656Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KGStable URL: http://www.jstor.org/stable/40908691 .
Accessed: 12/06/2014 23:35
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Mohr Siebeck GmbH & Co. KG is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access toFinanzArchiv / Public Finance Analysis.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold*) in der Sowjetwirtschaft von
Adolf Weber
1. Abschaffung des Geldes. Daß in der kommunistischen Wirtschaft das Geld keine Möglichkeit mehr hat eine Eolie zu spielen, war nicht nur die Ansicht von Marx und E n g e 1 s , es war auch eine Grund- ansicht, von der die Bolschewisten ausgingen, als sie unter Führung Lenins die Sow jet Wirtschaft aufzubauen begannen. Damals schrieb Bucharin, wohl der hervorragendste Theoretiker, der Lenin nach seinem Siege zur Verfügung stand: „Eines ist klar, je mehr sich die Arbeiter der Produktion und der Verteilung der Produktion bemächtigen, desto geringer wird die Notwendigkeit des Geldes und schließlich wird das Geld ganz aussterben"1). Abschaffung des Geldes, also Verzicht auf ein allgemeines Tausch- und Re- chenmittel, setzt aber voraus Verzicht auf wirtschaftlich erhebliche Güter- übertragung. Dieser Verzicht kann erzwungen werden, dann hätten wir die „Zuchthauswirtschaft4 ', oder aber Verbrauchsgüter stehen in so großem Maße zur Verfügung, daß jeder nach seinen individuellen Bedürfnissen ohne Rück- sicht auf die anderen für sich so viel beanspruchen kann, wie er will. Nur im letzteren Falle kann die Freiheit der Konsumtion unter Verzicht auf einen rechtlich gesicherten Geldverkehr gewahrt bleiben. Bereits 1918 erklärte Lenin: ,,In der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft (gewöhn- lich Sozialismus genannt) bleibt das bürgerliche Eecht als Regler, als Ver- teiler der Arbeit und Konsumtionsmittel unter die Mitglieder der Gesell- schaft bestehen. Das ist aber noch nicht Kommunismus. Der enge Horizont des bürgerlichen Rechts wird erst dann überschritten sein, wenn die Gesell- schaft den Grundsatz „jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen" wahr gemacht haben wird. Die Verteilung der Konsumtions- mittel wird dann die Normierung der jedem einzelnen zukommenden Men-
*) Zur Ergänzung dienen folgende Publikationen des Verfassers: Markt- wirtschaft und Sowjet Wirtschaft, München, Richard Pflaum- Verlag, 1949, Dogma und Wirklichkeitssinn in der Sowjetwirtschaft, Sitzungsbericht der Bayeri- schen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jahr- gang 1950, Heft 1, C. H. Beck, München.
x) Bucharin, Das Programm der Kommunisten (Bolschewiki), lassen 1919, Seite 61.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft 633
gen durch die Gesellschaft unnötig machen: jeder wird frei nehmen nach seinen Bedürfnissen* n).
Derartige Zukunftshoffnungen konnten aber nicht über die Notwendig- keit hinwegtäuschen, daß sofort irgendetwas geschehen mußte, um die Dienste, die früher das Geld im bürgerlichen Sinne leistete, durch irgendetwas anderes zu ersetzen. Das war um so notwendiger, weil die Kaufkraft des Kü- bels immer mehr der völligen Entwertung entgegen eilte. Nun zeigte sich, wie recht Adolph Wagner hatte, als er den Sozialisten und Kommu- nisten vorwarf, ihre Geldpläne seien nichts als ein utopischer Gedankenwirr- warr: ,,im Problem des Geldes stecken alle großen sozialistischen Probleme, der Produktion, Verteilung, Wertbestimmung, von denen keines auch nur ausreichend gedankenmäßig geschweige denn für praktische (auch psycho- logische) Ausführbarkeit gelöst ist"2). Wie hilflos die sowjetrussische Zen- trale zunächst war, zeigt die folgende Bemerkung Lenins: „Jede Fabrik, jedes Dorf erscheint als eine produzierende-konsumierende Kommune, die das Kecht und die Verpflichtung hat, auf ihre Art (!) das Problem der Be- rechnung, der Produktion und der Verteilung der Erzeugnisse zu losen"3).
In der Industrie half man sich zeitweise mit einer Art Arbeitsgeld. Die Werktätigen waren zwangsweise in Konsumgenossenschaften zusammenge- schlossen, die zur Erleichterung des Absatzes in den Fabriken eigene Konsum- filialen eingerichtet hatten: „Die Buchhaltung dieser Genossenschaften erstreckt sich auf die Führung von Personenkonto, deren Abschluß regelrecht zum Löhnungsappell erfolgt, wobei die Sollposten zur Eintragung in das Arbeitsbuch des Konsumenten gelangen, der es seiner Fabrikleitung zwecks Erhebung des nach Abzug seiner Warenschuld verbleibenden Lohnes vor- weist. Befindet sich also der Arbeiter im Besitz irgendeiner Anweisung für den Ankauf von Lebensmitteln, Schuhen, Wäsche, Kleidern, Möbeln und dergleichen, so tritt an Zahlungsstatt ein entsprechender Eintrag unter Preis- vermerk in seinem Arbeitsbuch, während seine Arbeitsstelle die Kosten bei der Lohnauskehrung in Anschlag bringt. Auf diese Weise verschwindet das Papiergeld immer mehr aus dem Umlauf. Selbstverständlich ist ohne An- weisungen niemand bezugsberechtigt, da ja sonst die Rationierung nicht ein- gehalten werden könnte. Das erwähnte Arbeitsbuch bietet jederzeit einwand- freien Aufschluß über die Art der Buchungen, die Höhe der Löhne, sowie die progressiv sich steigernden Verpflegungs- und Ausstattungsanteile" - so be- richtete ein deutscher Kommunist auf Grund eigener Eindrücke, die er in Sowjetrußland gewonnen hatte, im März 1920 4).
Dieses komplizierte System funktionierte um so weniger, weil bald nach dem Siege des Bolschewismus in Sowjetrußland das Bankwesen gänzlich abgeschafft worden war. Man hatte an seine Stelle eine Art „zentraler Staats-
!) Lenin, Staat und Revolution, Berlin 1918, Seite 88 ff. 2) Adolph Wagner, »Sozialökonomische Theorie des Geldes und des
Geldwesens, Leipzig 1909, S. 142. 9) Lenin, Jjie nächsten Auigaoen der Sowjetmacht, deutsche Ausgabe
Berlin 1919, S. 32. 4) Eisenberger, Die Wirtschaftspolitik der russischen Kommunisten.
Arbeiterrat, 2. Jahrgang (1920) zitiert nach Arthur Wolf gang Cohn, Kann das Geld abgeschafft werden ? Jena 1920, S. 130.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

634 Adolf Weber
buchhalterei" gesetzt. Die dadurch gestellten Aufgaben wuchsen aber den Buchhaltern derart über den Kopf, daß sie sich schließlich weigerten, nach diesem System weiter zu arbeiten. Auch die Theoretiker sahen ein, daß die Kalkulation unmittelbar nach der geleisteten Arbeit schon infolge der Ver- schiedenartigkeit dieser Arbeit ein Ding der Unmöglichkeit war.
Die „Neue ökonomische Politik", die seit dem Frühjahr 1921 eine modi- fizierte Rückkehr zur Marktpreisbildung und zur kaufmännischen Geschäfts- führung ermöglichte, wies auch dem Geld- und Kreditwesen wieder einen ähnlichen Platz an, wie ihm in den kapitalistischen Ländern eingeräumt war. Im Mittelpunkt des neuorganisierten Geldwesens stand eine staatliche Zen- tralnotenbank („Gosbank"), sie gab neue Banknoten aus (ein Tscherwo- netz = 10 Vorkriegsrubeln). Diese Noten waren mit 25% durch Gold, Platin oder wertbeständige Valuta gedeckt, sogar die spätere Einlösung der Noten in Gold war im Gesetze vorgesehen1).
Der Tscherwonetz wurde aber nur für große Zahlungen insbesondere im industriellen Sektor ausgegeben, für kleinere Zahlungen namentlich im Ernährungssektor blieb vorläufig der alte Papierrubel, den man wertmäßig unter Kontrolle glaubte halten zu können, in Umlauf. Tatsächlich entwertete sich aber der Papierrubel immer mehr; in diese Inflation wurde schließlich auch der Tscherwonetz hineingezogen. Das veranlaßte die industriellen Staatstrusts vielfach zum Horten ihrer Produktion. Dies und die Entwer- tung der Rubel machte den Bauern eine lohnende Verwertung ihrer Erzeug- nisse unmöglich, was die Produktion ungünstig beeinflußte.
Eine Geldreform war unabwendbar. Sie erübrigte sich, weil schon nach wenigen Jahren die „NöP"-Periode zu Ende war -, sie stellte sich hinterher als strategischer Rückzug heraus. - Als die zentrale Planung nunmehr in Gestalt umfassender Fünf] ahr espiane wieder in ihre Rechte getreten war, erklärte die Staatsbank in ihrem Wirtschaftsbericht vom März 1930: ,,Die Methoden des kapitalistischen Geld- und Kreditverkehrs müssen als über- holt angesehen werden". Zwar wurden Geld und Kredit, Preis und Zins auch fernerhin als „Hebel" in der sowjetrussischen Wirtschaft anerkannt, aber sie hatten nunmehr einen ganz anderen Sinn als in der freien Marktwirtschaft. In der heutigen Sowjetwirtschaft hat das Geld Bedeutung 1. als Koordinierungs- mittel, 2. als Mittel zur Steigerung der Produktivität, 3. als Zuteilungsmittel.
2. Das Geld im Dienste der Koordinierung. Auch in der Sowjetwirtschaft ist die Volkswirtschaft infolge der unbedingt not- wendigen stark gegliederten Arbeitsteilung das Ineinandergreifen der Einzel- wirtschaften, deren Wollen und Können so aufeinander abgestimmt sein müssen, daß die Gesamtrechnung aufgeht. Während des Kriegskommunis- mus wurde der unumstößliche Beweis dafür erbracht, daß das unmöglich ist ohne ein Rechenmittel, durch das vergleichbare Größen zum Ausgleich gebracht werden. Die Praxis hat das bestätigt, was der Marxist Tugan- Baranowski bereits bald nach der Jahrhundertwende mit aller wünschens- werten Klarheit theoretisch ermittelt hatte: „In der kollektivistischen Wirt-
x) Vgl. H. Elster, Vom Rubel zum Tscherwonetz. Zur Geschichte der Sowjetwährung, Jena 1930.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft 635
schaft wird die Verteilung der Produkte unbedingt mit Hilfe des Geldes, wenn auch nur eines idealen Geldes bewirkt: Jede einzelne Person gibt ihr Einkommen aus, indem sie in den Grenzen des Wertes, über den sie verfügt, konsumiert; wozu wiederum ein genauer Vergleich zwischen dem Wert des zu konsumierenden Gegenstandes mit dem Gesamtwert des Einkommens der konsumierenden Person und die Verausgabung dieses letzteren Wertes zur Erwerbung der Konsumtionsgegenstände notwendig ist .... mit anderen Worten, in diesen Systemen ist das Geld als Wertmaß und Kaufmittel ein notwendiges Werkzeug der Verteilung"1).
Im Laufe der Entwicklung wurde aber auch immer deutlicher, daß dar- über hinaus der Aufbau der sozialistischen Volkswirtschaft ein Kechenmittel bedarf, damit im Sinne des Wirtschaftsprinzips mittels Zahlen, die irgendwie den Keflex von Werten darstellen, die einzelnen Leistungen so zu koordi- nieren sind, daß von einer volkswirtschaftlichen Ordnung gesprochen werden kann. Die sich vollziehenden Kechenoperationen sind rein äußerlich in der Marktwirtschaft und in der Befehlswirtschaft wenig voneinander unter- schieden ; es handelt sich hier wie dort um Tausende von einzelnen Betrieben und millionenfache Leistungen, die durch Kechenoperationen zweckmäßig kombiniert und koordiniert werden müssen. Dazu sind Operationen not- wendig, die wir als „Handel" bezeichnen.
Mit bemerkenswerter Entschiedenheit betonen die Machthaber in der Sowjetwirtschaft, daß die Funktionen des Handels auch in ihrem Wirtschafts- system ganz unentbehrlich sind. Auf dem XVII. Parteitag (1934) wandte sich Stalin mit größtem Nachdruck gegen das ,, ultralinke Geschwätz", ,,das unter einem Teil unserer Funktionäre umläuft, daß nämlich der Sowjet- handel ein überholtes Stadium sei, daß wir den direkten Produktionsaus- tausch organisieren müssen, daß das Geld bald abgeschafft werden würde, weil es zu einem bloßen Kechenschein geworden sei ... Diese Leute, die vom Marxismus ebenso weit entfernt sind wie der Himmel von der Erde, ver- stehen offenbar nicht, daß das Geld bei uns noch lange bestehen wird, bis zum Abschluß des ersten Stadiums des Kommunismus, des sozialistischen Entwicklungsstadiums*
' . Der große Unterschied zwischen der kommunistischen Befehlswirtschaft
und der freien Marktwirtschaft besteht darin, daß in der Befehlswirt- schaft der Handel auf Grundlage der Geldrechnung nur dazu dient, die Durchführung eines vorher festgelegten Planes zu kontrollieren, während in der freien Marktwirtschaft der Konsument mittels der von ihm ausgehenden Marktpreisbildung Herr ist über das volkswirtschaftliche Ge- schehen und Lassen. Indem sich der Konsument den Befehlen der Funktio- näre beugt, muß die Volkswirtschaft auf die „Produktivität der Freiheit" verzichten und damit, wie die Wirtschaftsgeschichte immer wieder gezeigt hat, auf den wichtigsten Fortschrittsfaktor.
In der freien Marktwirtschaft sorgt der am Markt sich spontan bildende Preis für jedes einzelne Gut und zwar sowohl für die fertigen Waren wie für die Produktionselemente, aus denen sie hergestellt werden, dafür, daß ö k o -
1) Tugan-Baranowski, Der moderne Sozialismus in seiner ge- schichtlichen Entwicklung, Dresden 1908, S. 15.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

636 Adolf Weber
n o m i s c h (nicht unbedingt sozial !) die bestmögliche Koordinierung aller Kräfte erfolgt. In der Befehlswirtschaft tritt an die Stelle der Markt- preisbildung eine schablonenhaft von vornherein festgelegte Preisordnung, die vielleicht äußerlich den Schein einer Koordinierung erweckt, die aber nicht eine Entfaltung der Kräfte verbürgt, von der nachhaltige Meh- rung des Sozialprodukts in Verbindung mit besserer Versorgung aller Konsumenten abhängt.
Da in der Sowjetwirtschaft das Geld und die in Geld ausgedrückten Preise nicht Mittel sind, um spontan den Gang der Produktion in Kichtung auf den bestmöglichen Erfolg zu beeinflussen, sondern lediglich um die Durchführung eines vorher aufgestellten wirtschaftlichen Gesamtplanes zu kontrollieren, muß dieses eigenartige Geld-Preissystem abgeschirmt werden gegen das ganz anders geartete Geld-Preissystem der mehr oder minder marktwirtschaftlich orientierten Länder. Das geschieht in Sowjetrußland durch das Außenhandelsmonopol. Es ist nichts anderes als die Anwendung des sowjetrussischen Geld-Preissystems auf das Gebiet der Außenhandels- beziehungen. Krassin, der Anfang der 20er Jahre Volkskommissar des Außen- handels war (später wurde er von Stalin verbannt) erklärte damals schon : ,,Ohne das Außenhandelsmonopol besitzt der Sowjetstaat weder die Mög- lichkeit, zur staatlichen Planwirtschaft überzugehen noch sie tatsächlich zu verwirklichen ; denn nur unter dem Schutz des Außenhandelsmonopols kann der Sowjetstaat ungestört den staatlichen Wirtschaftsplan verwirklichen". Das ist richtig und wurde auch in den späteren Jahren nie ernstlich bestritten ; die Folge ist aber, daß Sowjetrußland nur in bescheidenem Umfange an den Vorteilen der internationalen Arbeitsteilung teilzunehmen in der Lage ist. Daraus erklärt es sich, daß die russische Industrie überwiegend mit Selbst- kosten arbeiten kann, die im Vergleich zum Ausland enorm sind, was natur- gemäß eine wirkliche Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt außerordentlich er- schwert.
3. Das „Geld" im Dienste der Produktionsstei- gerung. Für jeden Volkswirt sollte es selbstverständlich sein, daß von einer Steigerung der volkswirtschaftlichen Produktivität nur gespro- chen werden kann, wenn die Produktionselemente vermehrt und zweck- mäßiger kombiniert werden. Aber häufig wird auch in der Sowjetwirtschaft diese volkswirtschaftliche Produktivität mit der Produktivität der einzelnen Arbeitskräfte verwechselt, also nicht Gewicht gelegt auf das zweckmäßige Ineinandergreifen und Mehrung aller Kräfte, sondern auf die isolierte Lei- stung der einzelnen Produzenten. Auch wird in Sowjetrußland, obwohl viel Gewicht auf „Produktivitätssteigerung" gelegt wird, immer wieder betont, daß Steigerung der Produktivität nicht das Zentralproblem der Fünf jahres- pläne sei. Im Jahre 1929 „entlarvte" Stalin seinen einst im höchsten An- sehen stehenden Parteigenossen Kykow als Schädling, weil er etwas derarti- ges behauptet hatte. Stalin führte aus: „Ist es richtig, daß das Wachstum der Arbeitsproduktivität die zentrale Idee des Fünf jahresplanes bildet? Nein, das ist nicht richtig. Wir brauchen kein beliebiges Wachstum der Pro- duktivität der nationalen Arbeit. Wir brauchen ein bestimmtes Wachstum der Produktivität und zwar ein Wachstum, das dem sozialistischen Sektor
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft 637
der Volkswirtschaft ein systematisches Übergewicht über den kapitalisti- schen Sektor sichert"1). Das ist eine These, die sehr wohl beachtet werden muß, wenn bisher marktwirtschaftlich aufgebaute Volkswirtschaften als Satelliten der Sow jet Wirtschaft angegliedert werden.
Grundsätzlich abgelehnt werden auch alle Kredit- und Geldmanipula- tionen, um Lücken in der Kapitalbildung auszufüllen. Die Lehren der Keyne- sianer werden von den sowjetrussischen Theoretikern scharf kritisiert2).
Das Hauptbemühen in der Sowjetwirtschaft gilt dem Herabdrücken der „Produktionskosten"; darunter sind jene Kosten zu verstehen, die im Plan als Norm angegeben sind. Unter dieser Norm zu bleiben, muß das vor- nehmste Bestreben der Betriebsleitung sein : Sparsamer Verbrauch von Roh- stoffen und Brennstoff, Steigerung der Leistung des einzelnen Arbeiters, rationelle Ausnützung der technischen Apparatur sind die wichtigsten Mög- lichkeiten, um in diesem Sinne ,, Gewinne" zu erzielen und dadurch die „Rentabilität" zu steigern. Eine Geldrechnung ist dazu unerläßlich. 1949 wurde ausdrücklich gefordert, daß die „Selbstkosten der Produktion" um mindestens 6% im Vergleich zu 1948 her abgedrückt werden müssen. Aber auch ohne derartige Direktiven geben sich die Betriebsleiter alle Mühe, die Kosten unter den Geldziffern zu halten, die im Plane vorgesehen sind. Das Selbstinteresse des Betriebes (chosrastschot) wird zu dem Zwecke geweckt und gefördert. Die Verkaufspreise sind festgelegt; gelingt es dem Betriebe, die diesem Festpreis entsprechenden Plankosten herabzudrücken, dann stehen ihm extra Einnahmen zur Verfügung, die er zur Rationalisierung des Betriebes verwenden kann. Ein Teil des Betriebsgewinnes fließt dem Direk- torenfonds zu, der nicht nur zur Erweiterung der Produktion, sondern auch für soziale Zwecke, für Erholungsheime, Sanatorien, sportliche Zwecke, aber auch für Beihilfen an besonders bewährte Arbeiter Verwendung finden kann.
x) J. Stalin, Fragen des Leninismus, Moskau 1947, S. 308. In einer neueren Arbeit von J. A. Kronrod, „Grundprobleme der marxistisch-lenini- stischen Lehre von der produktiven Arbeit" (russisch 1947, deutsche Übersetzung in Sowjetwissenschaft 1948, Heft 4) bezieht sich der Autor auf diesen „klassischen Ausspruch Stalins", nach dem man sich „notwendigerweise bei der Analyse des gesellschaftlichen Charakters der sozialistischen Arbeit zu richten hat", im übri- gen meint er: „Die sozialistische Arbeitsproduktivität äußert sich materiell in der Schaffung des sozialistischen Mehrprodukts. Die Produktion des sozialistischen Mehrprodukts bildet das spezifische Kennzeichen der produktiven Arbeit im Sozialismus" (a. a. 0. S. 27). Aber was ist sozialistisches Mehrprodukt?
2) U. a. tut dies G. A. K o s 1 o w in seinem 1946 in russischer Sprache er- schienenen Buche: „Theorie des Geldes und des Geldumlaufes"; in einer ein- gehenden Besprechung schließt sich ihm J. Kronrod an, er meint (Sowjet- wissenschaft 1949, Heft IV, S. 217 ff.). „Außerhalb der Werttheorie ist eine wis- senschaftliche Auffassung der monetären Probleme selbstverständlich vollkommen unmöglich. Aus diesem einfachen Grunde stehen die gegenwärtigen bürgerlichen Theorien auf einer niedrigeren Stufe als die Geldtheorien der Klassiker der bürger- lichen Ökonomie". Diese Stellungnahme ist um so bemerkenswerter, weil die Marxisten in den angelsächsischen Ländern K e y n e s für sich in Anspruch nehmen. So meint z. B. A. L. R o w s e in seinem Buche: Mr. Keynes and the Labour Movement (London 1936): „What could be a more brilliant example of Marxist method in historical analysis" ? Für Rowse ist Keynes Hauptwerk „an exemple of Marxist analysis far subtiler than we are accustomed to from the Marxists".
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

638 Adolf Weber
Das alles sind Mittel, um auf Grundlage der Geldrechnung die Betriebe zur höchsten Leistungsmöglichkeit anzuspornen.
Kurzfristig (derzeit höchstens für acht Monate) ist es der Staatsbank möglich, Geldklemmen, wie sie z. B. bei dem Saisoncharakter einzelner Wirt- schaftszweige, z. B. in der Zuckerindustrie unvermeidlich sind, durch „Kre- dite", d. h. durch zeitlich begrenzte Subventionen, die der Staatskasse ent- nommen werden, zu überwinden. Dadurch und durch Führung der gesamten Geldrechnung ist der Staatsbank die Möglichkeit gegeben, den Verlauf der Produktion und des Absatzes zu kontrollieren („Kontrolle durch den Kü- bel")!).
Angesichts der erörterten Sachlage haben Ausdrücke wie „Produktions- kosten", ,,Kentabilität" „Gewinne" usw. in der Sowjetwirtschaft eine ganz andere Bedeutung als in der Marktwirtschaft, obwohl in beiden Systemen mit „Geld" gerechnet wird.
Es leuchtet ein, daß bei dem geschilderten System, das alles Gewicht auf die Menge der erzeugten Produkte legt, an die Betriebsleiter immer wieder der Versuch herantritt, die Quantität auf Kosten der Qualität zu steigern; dies um so mehr, weil die Kontrolle durch die Urabstimmung der Konsumenten am freien Markte unter Ausnützung der Konkurrenzmöglich- keiten fehlt. Dieser ernstzunehmende Systemfehler ist den führenden Män- nern in der Sowjetwirtschaft wohl bekannt. Auf dem XVIII. Parteitag wurde folgender Beschluß gefaßt: „Es ist notwendig, in sämtlichen Industrie- zweigen die Qualität der Produktion mit allen Mitteln zu erhöhen. Gegen Mißwirtschaft und Produktionsverluste ist entschieden vorzugehen. Die Verbrauchsnormen für Koh-, Brenn- und Hilf sstoffe sowie Elektroenergie müssen herabgesetzt und Produktionsabfälle sowie geringwertigere Koh- stoffe weitgehend ausgenützt werden". Man merkt deutlich an der Formu- lierung des Wortlautes, wie das Bemühen um Qualitätsverbesserung einer- seits und das um Senkung der Produktionskosten andererseits miteinander im Kampfe stehen.
Die sowjetrussische Gewinn- und Verlustrechnung ist aber auch des- halb ein Zerrbild, weil die Kosten des interlokalen und des interpersonalen Güteraustausches völlig außer acht bleiben. Insbesondere kommen die Aus- gaben für den Eisenbahntransport und andere Transportmittel bei der Er- mittlung der „Selbstkosten" nicht in Betracht. Es ist infolgedessen begreif- lich, daß das für den nachhaltigen volkswirtschaftlichen Erfolg so wichtige Standortsproblem in Sowjetrußland nicht von den Volkswirten, sondern von den Geographen zum Gegenstand von Studien gemacht wird.
1) Schon in seiner im September 1917 veröffentlichten Broschüre „Die drohende Katastrophe, und wie man sie bekämpfen sollte" (Sämtliche Werke Band XXI, S. 193 ff.) legte Lenin auf die Nationalisierung der Banken deshalb so großes Gewicht, weil dadurch die Kontrolle des Geldwesens durch den Staat ohne weiteres gegeben sei: „Der Staat bekäme zum erstenmal die Möglichkeit, zunächt alle wichtigen Geldoperationen, ohne daß diese verheimlicht werden können, zu überblicken und dann zu kontrollieren, ferner das Wirtschaftsleben zu regulieren und schließlich Millionen und Milliarden für große staatliche Operationen zu erhalten . . .".
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Gelei und Gold in der Sowjetwirtschaft 639
Bei der entscheidend wichtigen Bedeutung, die in der Sowjetwirtschaft der technische Fortschritt im allgemeinen und die Entwicklung der Schwer- industrie insbesondere hat, muß dort relativ noch weit mehr Gewicht gelegt werden auf die Akkumulation von Kapital als in kapitalistischen Ländern. Da aber nach Auffassung der Bolschewiken Geld nichts anderes ist als der Keflex des Wertes von Waren, die jederzeit zu festen Preisen verkäuflich sind, sind Geldersparnisse mit Kapitalbildung identisch. Daher werden nicht nur alle möglichen Mittel angewendet, um an „Produktionskosten" zu sparen, es werden auch die Werktätigen immer wieder mit Nachdruck veranlaßt, mehr oder minder erhebliche Teile des Geldeinkommens durch Zeichnung von Anleihen der Volkswirtschaft wieder zur Verfügung zu stellen.
Auch die darauf abzielenden Überlegungen kranken an grundlegenden Fehlern. Da die Konsumenten bei der Preisbildung für die produzierten Waren sich im wesentlichen mit einer Statistenrolle begnügen müssen, andererseits aber an der Konsumfreiheit als Grundsatz festgehalten wird, können die durch Befehle der Obrigkeit festgelegten Preise unmöglich dem volkswirtschaftlichen Werte entsprechen. Dies um so weniger, als bei der Preisermittlung eine längst veraltete Schablone, nämlich die Preisliste des Jahres 1926/27 zugrunde gelegt wird. Dies ist ein Verfahren, das auch nach Ansicht sowjetrussischer Theoretiker nachgerade Widersinn geworden ist. In einem 1948 in russischer Sprache erschienenen Buch von I. Joffe, das 1950 ins Deutsche übertragen wurde1), heißt es, Seite 90: „Es muß unbe- dingt (!) berücksichtigt werden, daß auch für die im Jahre 1926/27 erzeugten Produkte die Festpreise von 1926/27 nicht den tatsächlichen Betriebsauf- wand zum Ausdruck bringen. Seit 1926/27 sind zwanzig Jahre vergangen. In diesem Zeitraum haben sich die Selbstkosten vieler Erzeugnisse infolge des technischen Fortschritts wesentlich verringert, entsprechend änderten sich auch die Lieferpreise, auf denen die geplanten Selbstkosten basieren. Aus diesem Grunde können die Festpreise von 1926/27 in einer Keine von Industriezweigen und Betrieben den Aufwand an lebendiger und vergegen- ständlichter Arbeit nicht voll zum Ausdruck bringen. Infolge der Differenz zwischen Selbstkosten und Festpreis gibt es fast in jedem Betriebe „vorteil- hafte" und „unvorteilhafte" Erzeugnisse. Liegt der Festpreis wesentlich höher als der Wert des tatsächlichen Aufwandes, so erfordert die Produk- tion einer bestimmten Menge von Erzeugnissen mehr materielle und finan- zielle Mittel und umgekehrt. - Eine der akutesten ( !) Aufgaben unserer Wirt- schaft besteht darin, die Festpreise von 1926/27 durch einen anderen Maß- stab zu ersetzen. Man kann jedoch den Vorschlägen nicht beipflichten, die an Stelle der Festpreise von 1926/27 auf die Preisbasis von 1940 oder irgend- eines anderen Jahres übergehen wollen. In diesem Falle würde die Volkswirt- schaft im Verlauf einiger Jahre auf die gleichen Mängel stoßen, die sich einige Jahre nach Einführung der Festpreise von 1926/27 herausgestellt haben".
Im Grunde genommen ist diese Äußerung, die doch offenbar die rus- sische Zensur zweimal passierte - einmal in Kußland, zum zweiten Male in der Ostzone -, eine sehr scharfe Kritik an dem gesamten System, deren Be-
x) I. Joffe, Die Planung der Industrieproduktion (russisch) 1948, ins Deutsche übertragen von Wilhelm Fickenscher, Berlin o. D.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

640 Adolf Weber
rechtigung kaum angezweifelt werden kann. Joffe meint, mit Hilfe der Statistik, die über erschöpfende Unterlagen bezüglich der Brutto- und der Warenproduktion, über die Löhne und die Zusammensetzung des mate- riellen Aufwandes aus sämtlichen Industriezweigen verfüge, könnten die vorhandenen Schwierigkeiten überwunden werden. Dagegen äußerte ich mich an anderer Stelle1): Ist dem so, dann muß man doch erstaunt fragen, warum nun schon seit mehreren Jahrzehnten ,,die akuteste Aufgabe der Sowjetwirtschaft" nicht gelöst werden konnte. Es ist eben ein Irrglaube, wenn man in der Hinsicht alle Hoffnung auf die Statistik setzt. Nicht nur kommen die durch die Statistik jeweils ermittelten Ziffern häufig zu spät heraus, um unmittelbar mit der erforderlichen Schnelligkeit verwertbar zu sein, sie können auch dem Umstand nicht Rechnung tragen, daß ein und dasselbe Wirtschaftsgut für die verschiedenen Verbraucher und deren Verbrauchszwecke in der Bedürfnisskala sehr verschieden eingestuft wird. Es genügt auch nicht, wenn die zahlenmäßige Marktforschung sich im we- sentlichen nur um die jeweiligen Interessen der Produktion bemüht. Al- fred Marshall klagte schon um die Jahrhundertwende, daß die Stati- stik „unglücklicherweise" vermeide ,,die relativen Interessengrößen der Konsumenten und Produzenten den verschiedenen Verfahrensweisen gegen- über" abzuwägen; fast stets würden die Vorteile nur von einem, nämlich von dem Produktionsstandpunkte aus betrachtet2). Diese Vernachlässigung muß sich aber in einem Wirtschaftssystem, das auf die von den Wünschen und der Kaufkraft der Konsumenten ausgehende Preisbewegung glaubt ver- zichten zu können, erst recht verhängnisvoll auswirken3).
Auch ein anderer Fehler, der mit der Ermittlung des Wertes der pro- duzierten Güter in der Sowjetwirtschaft verbunden ist, wird in der neuesten Zeit von russischen Theoretikern mehr als früher betont. Schon 1934 meinte Stalin: „Das Wertvollste, das für die Lösung der Aufgabe einer schnellen Industrialisierung gewonnen werden muß ist - Zeit". Daran anknüpfend heißt es in einer neueren sowjetrussischen Abhandlung4): „Ein Zeitgewinn
x) „Dogma und Wirklichkeitssinn in der Sowjetwirtschaft , Sitzungs- berichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse Jahrgang 1950, S. 30 f.
2) Handbuch der Volkswirtschaftslehre Band I, Deutsche Übersetzung Stuttgart und Berlin 1905, S. 469.
3) Ganz abgesehen ist bei dieser Kritik davon, daß vorerst aus der Statistik das gemacht werden müßte, was sie sein muß, um ein brauchbares Instrument für wirtschaftspolitische Maßnahmen zu werden. Über den Charakter der Statistik in der Sowjetwirtschaft seit 1929 äußert sich ein so gründlicher Kenner wie Naum Jasnyin seinem neuesten Werk: The Socialized Agriculture of the UdSSR, Stanford University Press, 1949: „Neutral" statistics, i. e. statistics of the usual type which present nothing but facts, were officially replaced by „Marxian" or „class statistics". Instead of performing the function of statistics in nontotalitarian countries, Soviet statistics have been assigned the job of aiding in the „socialist construction" a. a. 0. S. 9. Vgl. dazu die offiziöse Erklärung über die Aufgaben der Statistik in der Sowjetwirtschaft, die ich in meinem Aka- demievortrag: „Dogma und Wirklichkeitssinn in der Sowjetwirtschaft" S. 45, Anm. 1 gegeben habe.
4) D. Tschernomordik, Der Nutzeffekt der Kapitalinvestitionen und die Theorie der Reproduktion. „Sowjetwissenschaft", Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin 1949, Heft 3, S. 17.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft 641
aber erfordert Beschleunigung der Keproduktion, damit ein Minimum an gesellschaftlichen Mitteln und gesellschaftlicher Arbeit in unvollendeten Produktionen steckt, die noch keinen Nutzeffekt haben, d. h. nicht produ- zieren". Ergänzend ist hinzuzufügen, daß auch bei den Produktions- kosten mit berücksichtigt werden müßte, wie lange jeweils die Zeit ist, bis der erwartete Nutzeffekt vollkommen realisiert ist. Um zu erreichen, daß die- jenigen Anlagen, die in diesem Sinne viel Zeit erfordern, hinter denen zurück- treten, die schneller ihren Nutzeffekt verwirklichen, ist eine entsprechende Belastung mit zusätzlichen Kosten in Rechnung zu stellen. Das ist in der freien Wirtschaft Aufgabe des Zinses. Ein Zins in diesem Sinne fehlt in der Sowjetwirtschaft. Zwar taucht ein Zins in sowjetrussischen Bilanzen und Rechnungen auf, aber er dient lediglich dazu, die Verwendung im Sinne des Planes zu kontrollieren, er hat in keiner Weise die Aufgabe, Ausmaß und Richtung der Investitionen zu bestimmen.
Außer der Hilfe, die das Geld leistet bei dem Bestreben, die im Plan vorgesehenen Produktionskosten zu senken und bei der Akkumulation bietet, hat es auch noch eine eigenartige Funktion bei der Gewährung von ,, Kre- diten". Es wurde schon gesagt, daß nach Beendigung der Nöp-Periode der Kredit im Sinne der Marktwirtschaft beseitigt wurde, sowohl der Wechsel- kredit wie der Handelskredit wurden abgeschafft. Die gesamte kurzfristige Kreditgewährung wurde bei der Staatsbank konzentriert. Er sollte in „Geld" gewährt werden, aber planmäßig der Ware folgen von den Rohstoffen bis zu den Stellen, die unmittelbar den Konsumenten bedienten. Es stellte sich jedoch bald heraus, daß dadurch einer Kreditinflation Vorschub geleistet wurde. Der Geldumlauf verdoppelte sich in kurzer Zeit; die Festpreise verbargen die tatsächlich vorhandene Inflation. Wir hatten es also mit einem Tatbe- stand zu tun, den wir auf Grund unserer deutschen Erfahrungen „verdeckte" oder „preisgestoppte" Inflation nennen, mit den bekannten Erscheinungen eines rasch zunehmenden Überhanges der Kaufmöglichkeit. Eine Reform sorgte dafür, daß scharf unterschieden wurde zwischen den wirklich nötigen Umlaufsmitteln und zusätzlichen Kaufmöglichkeiten. Kredite durften in der Folge nur gewährt werden, wenn die der Staatsbank vorgelegten Rechnungen der Betriebe mit dem Akzept des Käufers versehen waren.
Auf diese Weise benutzte die Staatsbank nicht nur die von ihr zur Ver- fügung gestellten Zahlungsmittel zur Festigung der Zahlungsdisziplin; es konnte zugleich auch der Kredit als Hebel benutzt werden, um die „Renta- bilität" zu verbessern und das Tempo der sozialistischen Akkumulation zu steigern. Nicht unwichtig war ferner, daß die Konzentration des kurzfristigen Kredits bei der Staatsbank es auch möglich machte, die staatlichen und ge- nossenschaftlichen Organisationen zu begünstigen und auf diese Weise die kollektivistischen Organisationen zu stärken. Die Kontrollfunktion der Staatsbank wird dadurch wesentlich verstärkt, daß die Warenverrechnung zwischen den Wirtschaftsorganen durch bargeldlose Zahlungen erfolgt, da- bei hat die Bank nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zu prüfen, ob Quan- tität und Qualität der Waren einerseits, die Preise andererseits den im Plan vorgesehenen Bedingungen entsprechen1). Die Erfahrungen haben aber ge- zeigt, daß auch die hier angedeuteten Reformen, die mit einer Organisierung
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

642 Adolf Weber
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs verbunden waren, und die ohne Zweifel insbesondere durch die bereits erwähnte Kontrolle durch den Rubel einen wesentlichen Fortschritt bedeuteten gegenüber dem Gesetz vom 30. 1. 1930, eine inflationistische Bewegung der Zahlungsmittel nicht zu verhindern ver- mochte. Unter der Hand verwandelten sich die kollektivistischen Zuteilungs- mittel zu einem Zahlungsmittel ganz im kapitalistischen Sinne.
4. Das Geld als Zuweisungsmittel. Daß es den Sowjets bald nach dem Siege des Bolschewismus ernst war mit der „Abschaffung des Geldes" als Zahlungsmittel, geht aus dem Beschluß hervor, der auf dem Par- teitag 1919 gefaßt wurde. Es hieß darin: ,,Die Kommunistische Partei Ruß- lands stützt sich auf die Verstaatlichung der Banken und erstrebt die Durch- führung einer Reihe von Maßnahmen, die das Gebiet der geldlosen Verrech- nung erweitern und die Abschaffung des Geldes vorbereiten: obligatorische Aufbewahrung der Gelder in der Volksbank, Einführung von Budgetbüchern, Ersatz des Geldes durch Schecks, kurzfristige Gutscheine für den Empfang von Produkten usw.". Die Formulierung zeigt schon, wie unsicher man sich fühlte hinsichtlich des Weges, der zur Abschaffung des Geldes führen sollte. Wie bestimmt klingt dem gegenüber beispielsweise das, was August Bebel forderte: „Irgendein Zertifikat, ein bedrucktes Stück Papier, Gold oder Blech, bescheinigt die geleistete Arbeitszeit und setzt den Inhaber in die Lage, diese Zeichen gegen Bedürfnisgegenstände der verschiedensten Art auszutauschen. Findet er, daß seine Bedürfnisse geringer sind als was er für seine Leistung erhält, so arbeitet er entsprechend kürzere Zeit . . ."2). Bebel fand das alles einfach, „leicht zu berechnen".
1) „Die rationelle Organisation des Kreditwesens und das richtige Manö- vrieren mit den Geldreserven sind von ernster Bedeutung für die Entwicklung der Volkswirtschaft. Die Maßnahmen der Partei zur Lösung dieses Problems be- wegen sich in zwei Richtungen: Konzentration aller kurzfristigen Kredite über die Staatsbank und Organisierung des bargeldlosen Verkehrs im vergesellschafte- ten Sektor." J. Stalin, Fragen des Leninismus (10. Ausgabe) Moskau 1938.
2) August Bebel, Die Jbrau und der Sozialismus, öU. Auiiage Stutt- gart 1910, S. 403. Bebel stützt sich dabei auf die Darlegungen Friedrich Engels in seiner Schrift: ,, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissen- schaft", Stuttgart 1878. Im Gegensatz zu Lenin und Stalin verkennt Bebel die Bedeutung des Kapitals für eine sozialistisch-kommunistische Wirtschaftsord- nung. Er glaubte, daß mit Abschaffung des Geldes auch das Kapital beseitigt sei. Gegen Eugen Richter, den Führer der Freisinnigen polemisierend, meinte er: ,,Herr Richter ist in den Kapitalbegriff so verrannt, daß er sich eine Welt ohne „Kapital" nicht zu denken vermag. Wir möchten wissen, wie das Mitglied einer sozialistischen Gesellschaft sein Arbeitszertifikat ,, sparen" oder gar an andere verleihen und ,,Zins" dabei herausschlagen kann, wo alle anderen ebenfalls besitzen, was der andere ausbietet und -von dem er 1 e b t. A. a. O. S. 404, Anm. 1. Damit vergleiche man das was Lenin in seinem berühmten Brief an den kommunistischen Gewerkschaftskongreß vom 18. 9. 1922 („Lenins letztes Ver- mächtnis an die Sowjetgewerkschaften") sagte: Er hob die große Bedeutung des Produktionselements Kapital hervor und fuhr dann fort: „In den kapitalistischen Ländern wird dieses Grundkapital in der Regel vermittelst Anleihen zur Ver- fügung gestellt. Uns will man keine Anleihe geben, ehe wir nicht das Eigentum der Kapitalisten und der Grundbesitzer wiederhergestellt haben. Dies aber können wir nicht und werden wir nicht tun. So bleibt ein außerordentlich schwerer und langer Weg: Nach und nach Ersparnisse zu machen, die Steuern zu erhöhen . . .".
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjet wir tschaft 643
Es wurde schon festgestellt, daß die Wirklichkeit der Ausführung der- artiger Projekte unüberwindliche Schwierigkeiten entgegensetzte. Man mußte schon, namentlich beim Entgelt der persönlichen Leistungen zum Bargeld zurückkehren. Aber dieses Geld als Zuteilungsmittel ist doch, sollte doch jedenfalls etwas anderes sein als Geldzahlungen in den kapitalistischen Ländern. Als auf dem XI V. Parteitag (1925) der Trotzkist Sokolnikow meinte, es bestehe kein prinzipieller Unterschied zwischen dem Sowjetgeld und dem kapitalistischen Geld und daß das sowjetische Währungssystem von „Grund- sätzen der kapitalistischen Wirtschaft" durchdrungen sei, erhob Stalin hef- tigen Widerspruch, die Funktion und die Bestimmung des Währungssystems hätten sich unter den Verhältnisseu der Diktatur des Proletariats prinzipiell und grundlegend zugunsten des Sozialismus und zuungunsten des Kapitals verändert. Das Geld drücke in der UdSSK die sozialistischen Produktions- verhältnisse aus. Daraus müßte mindestens der Schluß gezogen werden, daß inflationistischer Mißbrauch des Geldes unter allen Umständen ausgeschlos- sen bliebe. Das war aber keineswegs der Fall. Immer wieder zeigte sich, daß die russischen Machthaber ebensowenig wie die kapitalistischen Länder der Versuchung widerstehen konnten, wenn die Notlage es erforderte, sich durch Geldschöpfung über die jeweiligen Schwierigkeiten hinweg zu verhelfen. Obwohl jede Kreditschöpfung durch private Kreditinstitute ausgeschlossen war und immer wieder von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde durch große ,, freiwillige" Anleihen zu hoch gewordene Geldeinkommen für die Allgemeinheit nutzbar zu machen, mußten dennoch von Zeit zu Zeit be- sondere Maßnahmen getroffen werden, um Herr zu werden über den Geld- überhang.
Besonders bemerkenswert war in der Hinsicht die Kriegsfinanzierung. N. Wosnessenko berichtet darüber in seinem aufschlußreichen, mit dem Stalinpreis ausgezeichneten Buche: ,,Die Kriegswirtschaft der Sowjetunion während des vaterländischen Krieges"1). Er stellt fest, daß während des Krieges feste staatliche Einzelhandelspreise für Nahrungsmittel und vor- dringliche Gebrauchsgegenstände ebenso beibehalten wurden wie stabile Lieferpreise für Produktionsmittel und Kriegsmaterial bei beträchtlicher Senkung der „Selbstkosten". Gleichzeitig nahmen die kurzfristigen Kredit- operationen der Staatsbank ab. Durch Zeichnung von Kriegsanleihen und durch andere Formen „freiwilliger" Leistungen wurden während der Kriegs- wirtschaft der gewaltige Betrag von 94,5 Milliarden Eubeln „abgeschöpft" und der Staatskasse zugeführt. Dennoch muß Wosnessenko zugeben, „daß in der Periode der sowjetischen Kriegswirtschaft mehr Geld im Umlauf war als die Nachkriegswirtschaft benötigte. Das führte im gewissen Umfange zu einem Sinken der Kaufkraft des Kubeis" (a. a. 0. Seite 86). Der Geldüber- hang machte eine Kationierung unumgänglich. Die dann übrigbleibende Kaufmöglichkeit floß zu einem nicht geringen Teile an die der staatlichen Kontrolle nicht unterliegenden Kolchosmärkte. An diesen Märkten konnten die Bauern den Überschuß ihrer Produktion, der nicht der staatlichen Zwangs-
x) Moskau 1947; ins Deutsche übertragen von Wilhelm Ficken- scher, Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin o. D.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

644 Adolf Weber
ablief erung unterlag, freihändig verkaufen, was zu erheblich gestiegenen Preisen an diesen Märkten und damit zu wesentlich höheren Einnahmen der Landbevölkerung führte. Während des Krieges vermieden es die staatlichen Behörden einzugreifen, sie errichteten sogar eigene Staatsläden und Gast- wirtschaften, um auf diese Weise der Staatskasse Anteil zu verschaffen an den inflationistisch gestiegenen Marktpreisen1).
Man wollte dem gesteigerten Geldeinkommen nicht jeden Anreiz neh- men, sich dafür auch etwas mehr an Gütern kaufen zu können. Damit war aber eine Umschichtung der Einkommensverhältnisse verbunden, die auf längere Sicht in der normalen Friedenswirtschaft nicht unbedenklich war. Die Bauern horteten die ihnen zufließenden höheren Geldeinkommen, sie trugen sie weder zur Sparkasse noch beteiligten sie sich in dem erforderlichen Maße an den aufgelegten Anleihen. Die ihnen zur freien Verfügung bleiben- den Barreserven lähmten aber den Arbeitseif er der gerade auf dem Lande dringend notwendig ist, um die landwirtschaftlichen Erzeugnisse so zu steigern, daß für den Export wesentlich mehr als bis dahin zur Verfügung stand. Auch ist die Sowjetwirtschaft auf längere Sicht immer wieder ge- zwungen, einen starken Druck auf das Eealeinkommen der bäuerlichen Bevölkerung auszuüben, um die großen Investitionsmittel für die Industrie zu gewinnen2).
Daher wurde im Dezember 1947 eine „Währungsreform" durchgeführt, die aber in Wirklichkeit etwas ganz anderes war als Neuordnung des Geldes
1) S. N. Prokopovicz äußert sich in seiner Schrift: Der vierte Fünf- jahresplan der Sowjetunion 1946-1 950 -, Zürich und Wien 1948, über die Folgen des freien Marktpreises an den Kolchosmärkten so: ,,Dank diesen überaus hohen Kolchosmarktpreisen mußten die Kollektivbauern in den durch die deutsche Invasion nicht berührten Teilen Rußlands, die Überschüsse an landwirtschaft- lichen Produkten zum Verkauf besaßen, von deren Absatz enorme Mengen Geld aufspeichern. Die städtische Einwohnerschaft und die Industriearbeiterschaft mußten nicht nur alles was sie sich verdienten, sondern auch ihr ganzes Hab und Gut und ihre gesamten Ersparnisse aufzehren. So erwuchs in Sowjetrußland aus den übermäßigen Kolchosmarktpreisen ein sehr ernstes soziales Problem: die Bauern bereicherten sich, die Arbeiter aber verarmten. Ein anderes Ergebnis dieses schwunghaften Kolchoshandels waren die sehr beträchtlichen Mengen der im Laufe der vier Kriegsjahre von der Regierung emittierten Geldzeichen, Ent- wertung des Rubels und große Inflation" (a.a.O. S. 113). Es wird berichtet, daß am Ende des Krieges „Geld" in 1847 Abarten in der Sowjetunion im Umlauf war.
2) „Ständig befand sich die sowjetrussiscñe Jrlanwirtscnatt in der pemlicnen Notwendigkeit, durch hinreichende Konsumeinschränkung einer vorwiegend bäuerlichen Bevölkerung die Industrialisierung zu finanzieren, ohne es dahin kommen zu lassen, daß entweder die Bauern sich weigerten, Lebensmittel für die Industriearbeiter zu erzeugen, oder die Industriearbeiter es ablehnten, für einen Lohn, der eine geringe und unangemessene Kaufkraft besaß, an den Maschinen zu stehen." H. H. C a r r , Sowjetrußland und der Westen, Köln 1948, S. 48. - Es liegt auf der Hand, daß in der Friedenswirtschaft der geringste Widerstand bei der Landwirtschaft zu erwarten ist, was auch ganz im Sinne der Lenin- Stalin - sehen Theorie liegt. Die Bauern, oder, wie man wohl zutreffender gesagt hat, die „Kolchosknechte" sind in ihrem Bewußtsein noch nicht sozialistisch. In einem 1948 von der Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Buch „Über die sozialistische Sowjetgesellschaft" heißt es: „Und auch heute noch sind die Überbleibsel des Alten im Bewußtsein der Kollektivbauern zählebig . . .". Über- setzung der „Neuen Welt" 1949, S. 44.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft 645
in den kapitalistischen Ländern. Der Hauptzweck war die eben geschilderte Umschichtung der Einkommen wieder rückgängig zu machen, und die länd- liche Bevölkerung wieder zu zwingen ihre Einkommen aus dem Einsatz ihrer Arbeitskraft zu erzielen. Die Reform lief darauf hinaus, den Bauern 90% der erübrigten Geldbeträge wieder abzunehmen.
Der Erfolg dieser „Geldreform" war auch in der Sowjetunion um- stritten. Jedenfalls folgten der Reform vom Dezember 1947 in kurzem Ab- stand noch weitere Reformen, deren jede mit beträchtlichen Preissenkungen verbunden war. In einer amtlichen Verlautbarung vom 28. 2. 1950 - auf die wegen ihrer besonderen Wichtigkeit noch zurückzukommen ist - hieß es: ,,Die im Dezember 1947 durchgeführte Währungsreform in der UdSSR liquidierte die Folge des zweiten Weltkrieges auf dem Gebiete des Geldum- laufes und stellte den vollwertigen Sowjetrubel wieder her. Die gleichzeitig mit der Währungsreform verwirklichte Aufhebung des Kartensystems und die bedeutende Preissenkung für Massenbedarfsartikel, die innerhalb 1947 bis 1950 dreimal durchgeführt wurde, führten zu einer noch größeren Festi- gung des Rubels, zur Hebung seiner Kaufkraft und zur Hebung seines Kur- ses im Verhältnis zu den ausländischen Währungen." In den dieser Verlaut- barung beigefügten offiziellen Erläuterungen wurde ausgerechnet, daß der Gesamtgewinn der Bevölkerung durch die neue Preisermäßigung, die im Jahre 1950 angeordnet wurde, mindestens 110 Milliarden Rubel betrage. Diese,, Berechnung" zeigt schon, daß die Aktion sehr starken propagandisti- schen Charakter trägt ; wobei niemand daran Anstoß nahm, daß die wieder- holten plötzlichen sehr erheblichen Änderungen der Kaufkraft des Geldes doch verdeutlichten, wie wenig das sowjetrussische Geld seinem eigentlichen Sinn gerecht wurde, nämlich die planmäßig genau berechneten und festge- legten „sozialistischen Produktionsverhältnisse" auszudrücken. Es war charakteristisch, daß der Reform vom Dezember 1947 wenige Monate vorher eine starke Steigerung der Festpreise für die wichtigsten Lebensmittel und Verbrauchsgegenstände vorangegangen war, so daß es bei der Währungs- reform nicht schwer sein konnte einen Teil dieser Preiserhöhungen rück- gängig zu machen, um so von einer allgemeinen Preissenkung sprechen zu können.
Wenn später, gewissermaßen über Nacht, echte Preissenkungen in ver- hältnismäßig großem Umfange durchgeführt wurden, wenn auch nicht in dem angegebenen phantastischen Ausmaß, so muß man fragen, wie das in einer geplanten Wirtschaft, in der das Geld lediglich Zuteilungsmittel von Werten, die durch das Geld repräsentiert werden, sein soll, möglich ist. Es ist selbstverständlich, daß durch eine Änderung in der Geldordnung nicht unmittelbar neue zusätzliche Werte gewissermaßen aus dem Boden ge- stampft werden können. Das, was an der einen Stelle mehr gegeben wird, muß im planwirtschaftlichen System an anderen Stellen genommen werden. Das ist in der Sowjetwirtschaft ohne Zweifel möglich. Auf folgenden Wegen ist, abgesehen von außergewöhnlich guten Ernten, jedenfalls eine momen- tane Besserstellung der Konsumenten denkbar :
1) Erhöhung der Norm für Arbeitsleistungen, dadurch kann an Löhnen, aber auch an Prämien für übernormale Leistungen gespart werden.
Finanzarchiv. N. F. 12. Heft 4 42
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

646 Adolf Weber
2) Änderung in der Abgabepflicht der Kolchosbauern, sei es, daß die dem Staat zu leistenden Naturalabgaben erhöht werden oder sei es, daß direkt oder indirekt die dafür gewährten Entgelte vermindert werden.
3) Beseitigung oder Kürzung der Subventionen, die einzelnen Industrie- zweigen oder Betrieben in Form von „Krediten" gewährt werden.
4) Erzwungene Mehrbelastung der Satelliten mit Einschluß der Ostzone; es wird behauptet, daß die Satellitenstaaten gezwungen seien für ihre Ex- porte an die Sowjetunion Preise zu berechnen, die bis zu 50% unter den Weltmarktpreisen lägen.
5) Minderung der Akkumulationsraten; da der Prozentsatz des natio- nalen Arbeitsertrages, der für Kapitalbildung in Anspruch genommen wird in der Sowjetwirtschaft ungewöhnlich hoch ist, kann auf diese Weise am leichtesten eine rasche Besserstellung der Konsumenten erreicht werden, freilich auf Kosten des zukünftigen Ertrages und damit der zukünftigen Kealeinkommen.
6) Minderung der nationalen Eeserven. Es kommen zwei Arten von Eeserven in Betracht: a) Keserven im Hinblick auf mögliche kriegerische Verwicklungen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Sowjetrußland, das selbst in der nächst absehbaren Zeit keinen unmittelbaren Angriffskrieg führen kann und will und auch damit rechnen darf, daß ein Präventivkrieg so lange verhindert wird, als die UN ein maßgebender Faktor der internatio- nalen Politik bleibt, diese Eeserven vermindert, b) Sowjetrußland bedarf in besonderem Maße für seine laufende Wirtschaftsführung Eeserven: Die Gefahr der Mißernten ist infolge der klimatischen Verhältnisse unverhältnis- mäßig groß, ihre Überwindung durch Nutzbarmachung der internationalen Arbeitsteilung aber relativ gering. Dazu komm aber noch eine ganz andere Art von Eeserven: ,, Die Übererfüllung wie auch die Nichterfüllung der Pro- duktionspläne machen bei der engen wechselseitigen Verflochtenheit der einzelnen Industriezweige, wie auch der Volkswirtschaft im ganzen, gleich- falls große staatliche Materialreserven erforderlich. Durch Zuteilung staat- licher Eeserven wird es möglich, sowohl die Betriebe und Industriezweige zu unterstützen die den Plan übererfüllen, als auch die rückständigen Be- triebe und Industriezweige an die Planerfüllung heranzuziehen"1). Begreif- lich, daß Stalin in einem Vortrag, den er einige Zeit vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges hielt, erklärte: ,,Wir können nicht ohne Eeserven leben und arbeiten". Dennoch kann es sehr wohl möglich sein, diese Eeserven vor- übergehend in Anspruch zu nehmen zwecks Besserstellung der Konsumenten.
Immer wird es sich aber bei Heranziehung der hier genannten Eeserven mehr oder minder nur um eine augenblickliche Erleichterung handeln auf Kosten nachhaltiger Steigerung und Sicherung der volkswirtschaftlichen Produktivität. Auch die erzwungene Steigerung der Norm für die Arbeits- leistung ist doch ein Bogen, der schließlich nicht nur überspannt werden kann, sondern überspannt werden muß. Es bleibt auf alle Fälle äußerst be- achtenswert, daß trotz gewaltiger Anspannung der menschlichen Arbeits- kraft, trotz größter Fortschritte in der Technisierung, trotz redlichen Be-
!) Joffe, a.a.O. S. 27.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft 647
mühens aus begangenen Fehlern zu lernen und trotz wiederholter Geld- reformen mit erheblichen Preissenkungen, die Preise der Konsum- wie auch der Produktionsgüter regelmäßig immer noch sehr beträchtlich hoher sind, als die am Weltmarkt geforderten Preise.
Von besonderem Interesse ist die letzte Geldreform, die auf dem schon erwähnten Erlaß vom 28.2. 1950 beruht, weil mit ihr die „Überführung des Kurses des Kubeis auf Goldbasis und die Erhöhung des Wertes des Rubels im Verhältnis zu den ausländischen Währungen" verbunden ist. Für die große Wichtigkeit dieses Erlasses legt schon die Tatsache Zeugnis ab, daß er sowohl von dem Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR Josef Stalin, wie von dem Sekretär des Zentralkomitees der kommunistischen Partei der Sowjetunion, Georgiy Malenkow unterzeichnet ist. „Während", so heißt es in dem Erlaß, ,,in den westlichen Ländern weiterhin die Entwertung der Währungen anhält, was bereits zu einer Abwertung der europäischen Wäh- rungen und zu einer wesentlichen Senkung der Kaufkraft des Dollars geführt hat, erhöhte sich die Kaufkraft des Rubels über seinen offiziellen Kurs so, daß es die Sowjetregierung für nötig hielt, den offiziellen Kurs des Rubels zu erhöhen und die Berechnung des Kurses des Rubels nicht auf der Basis des Dollars zu führen, wie dies im Juli 1937 festgelegt wurde, sondern auf einer stabileren, auf einer Goldbasis entsprechend dem Goldinhalt des Ru- bels".
Um diese Umstellung des Rubels auf die Goldbasis richtig würdigen zu können, sind zunächst einige Ausführungen über Goldproduktion und Gold Vorräte in der Sowjetunion vonnÖten.
5. Goldproduktion und Goldvorräte in der Sow- j etwirtschaft. Im 19. Jahrhundert stand Rußland eine Zeitlang - in den Jahren 1841-1850 - unter den golderzeugenden Ländern an erster Stelle. Die Goldgewinnung stieg als Ende der 70er Jahre die Staatswerke in Privat- eigentum übergeführt wurden. 1913 entlfielen von der Gesamtgewinnung 25% auf den Ural, 10% auf Westsibirien, 65% auf Ostsibirien und das Amur- gebiet; 85% der Vorkommen lieferten Seifen-, 15% Berggold1). 1913 gab die damals zuverlässige russische Statistik die Goldgewinnung mit 49 253 kg an. Sie sank nach dem Zusammenbruch bis auf 1343 kg im Jahre 1921. Von 1922 ab hob sich die Goldgewinnung verhältnismäßig rasch, 1924 wurden bereits 21 565 kg produziert, mit relativ kleinen Schwankungen stieg dann die Pro- duktion von Jahr zu Jahr. Für das Jahr 1933 meldete die sowjetrussische Statistik 81 946 kg als Jahresproduktion. Um dieses Ergebnis zu erzielen, wurde jedes erdenkliche Mittel angewandt: ,, Außer ausländischen Sachver- ständigen, hunderten von Geologen, tausenden von Goldsuchern, wurden im Seifenbetrieb und im Goldbergbau 500 000 bis 600 000 Wäscher, Berg- und Hüttenleute angesetzt. Zur Verstärkung des Arbeitseifers wurde während der Nöp-Periode unter teilweiser Aufhebung des Staatsmonopols die Goldgewin- nung auf eigene Rechnung gestattet". (Quiring, a. a. 0.) Englisches, ameri- kanisches, japanisches Kapital wurde herangezogen. Die englische Lena Goldfields ltd. investierte allein 25 Millionen Rubel, sie wandte alle modernen
*) Heinrich Quiring, Geschichte des Goldes, Stuttgart 1948, S. 279. 42*
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

648 Adolf Weber
Methoden an, setzte insbesondere große Bagger ein, die zwecks Ausbeutung der Lena Goldseifen bis 5,3 Meter erfaßten. Unter äußerster Anspannung ge- lang es, die Goldausbeute bis zu der Kekordziffer 181 000 kg im Jahre 1935 zu steigern. Sehr stark fördernd wirkte naturgemäß die infolge der Weltwirt- schaftskrisis und der Abwertung des Pfund Sterlings und des Dollars stark gestiegenen Goldpreise: Die Vereinigten Staaten steigerten von 1932-1935 den Preis der Unze (31,103 gr.) Feingold von 20,6 auf 35 Dollar. Aber von 1935 ab sank die Goldgewinnung in Rußland von Jahr zu Jahr, obwohl nun- mehr bereits mehr und mehr Zwangsarbeit in klimatisch wenig zugänglichen Gebieten angewandt wurde. Die Ziffern nach 1935 lauten: 1936: 160889, 1937: 154536, 1938: 152600, 1939: 140000, 1940: 120000. Von 1940 ab wurde die sowjetrussische Goldproduktion hinter einem undurchdringlichen Vorhang verborgen, den zu lüften unter schwerste Strafe gestellt wurde.
Wenn man erwägt, daß in den 30er Jahren das äußerste getan wurde, um soviel Gold wie nur möglich zu gewinnen, und daß sich damals schon ein rasch abnehmender Ertrag bemerkbar machte, so können die phantastischen Zahlen, die von nicht amtlicher russischer Seite über die Jahresgewinnung während des zweiten Weltkrieges veröffentlicht wurden - sie bezifferten die Jahresgewinnung auf das dreifache von 1940 - mit aller Bestimmtheit als unglaubwürdig bezeichnet werden. Die Geheimnistuerei verbirgt keineswegs einen für die Weltwirtschaft bedrohlichen Goldreichtum, der sich vielleicht einmal plötzlich in katastrophaler Weise geltend machen könnte, eher ist das Gegenteil anzunehmen, daß man eine verhältnismäßig große Goldgewinnung im Interesse des russischen Kredits vortäuschen möchte.
Verbergen will man aber offenbar auch die brutalen Abbaumethoden, die insbesondere im äußersten Norden Sibiriens in dem berüchtigten Bezirk Kolyma Anwendung finden. Das Gebiet wird vom Volksmund als das „Land des weißen Todes" bezeichnet. Dalystroy lautet der offizielle Name für dieses Territorium, dessen gesamte Verwaltung der geheimen Staatspolizei untersteht, an Ort und Stelle wird sie ausgeübt durch einen mit diktatorischen Vollmachten ausgestatte- ten hohen Beamten. Ende 1947 brachte die „Züricher Weltwoche" über Daly- stroy einen Bericht in dem es hieß: „Die Leitung von Dalystroy ist einer jener Posten, auf denen in totalitären Staaten ein verdächtig gewordener hoher politi- scher Funktionär sein ramponiertes Prestige wieder herstellen kann, indem er durch blinden Gehorsam nach oben und drakonischer Strenge nach unten seine Treue zum herrschenden System beweist". Mehrere Jahre später im Juli 1950 brachte „Die Neue Zeitung" einen Bericht unter der Überschrift „Jenseits der Grenzen des alten Sibiriens" in dem über Kolyma folgendes zu lesen war: „Das Ergebnis ist, daß von den Tausenden, die die Lastautos im Jahr die pfeilgerade Kolyma Chaussee entlang in die Taiga gebracht haben, nur wenige zurückkom- men. Magadan, die Hauptstadt, kennt diese Rückkehrer. Auch sie fahren in Last- autos. Nur daß jetzt neben den abgezehrten Gesichtern ein Wald von Stöcken und Krücken aus dem Wagen ragt - es sind die „nicht mehr Verwendungs- fähigen", die Kolyma zurückschickt, damit sie nicht unnötig das von dort hier- her geholte Brot essen. Erschauernd flüstern die Zurückbleibenden „Kolyma hat- das Fleisch gefressen, jetzt spukt es die Knochen aus".
Wie die russische Goldproduktion wird auch der russische Goldvorrat wahrscheinlich erheblich überschätzt. Es ist unvermeidlich, daß die Sowjet- russen fortlaufend beträchtliche Teile ihrer Goldvorräte für den Export ver- wenden. Als die BIZ 1938 mitteilte, daß die russischen Schätzungen für die Golderzeugung auf 5 Millionen Unzen lauteten, bemerkte sie dazu, daß die
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft 649
russischen Schätzungen mit Vorsicht aufzunehmen seien. Aber selbst wenn die für 1937 angenommene Ziffer von 5 Millionen nicht zu hoch sei, müsse doch angenommen werden, daß die russische Goldausfuhr nach London selbst in dem Rekord jähr dem Werte nach höher gewesen sei als die Produktion; die Gesamtmenge der russischen Goldgewinnung habe 1937 einem Wert von 175 Millionen Dollar entsprochen, dem stehe eine russische Goldausfuhr nach London von 200 Millionen Dollar in demselben Jahre gegenüber.
Es ist kein Grund dafür vorhanden, daß seitdem das Bedürfnis der Sow- jetwirtschaft Gold zu exportieren, zwecks Bezahlung dringend benötigter Auslandswaren und Auslandsleistungen zurückgegangen ist. Die fortschrei- tende Industrialisierung steigerte die Abhängigkeit vom Ausland; die welt- politischen Machenschaften erforderten erhöhte Aufwendungen z. B. für die 5. Kolonnen und die Vorbereitung von Aufständen. Die Möglichkeiten, den Weltmarkt dementsprechend mit Waren zu beliefern, nehmen indessen ab. Schon vor dem zweiten Weltkrieg ging der Anteil Rußlands am Welthandel ständig zurück: er betrug 1934: 1,46%, 1935: 1,35%, 1936: 1,27%, 1937: 1,12%, 1938: 1,11%. Während sich im Jahre 1930 der Wert des russischen Exports noch auf 4539 Millionen Rubel belief, sank er seitdem von Jahr zu Jahr bis auf 1233 Millionen Rubel im Jahre 1938.
Liegen die Dinge aber so, dann wäre es schwer zu begreifen, wenn Sow- jetrußland große Goldvorräte aufspeicherte, um später einmal irgendeinen geheimnisvollen Nutzen daraus zu ziehen. Zwar hob sich der mengenmäßige Umsatz des sowjetischen Außenhandels nach amtlichen russischen Mittei- lungen 1949 auf das doppelte der Vorkriegszeit ; das war aber nur die Folge davon, daß die Satellitenstaaten in immer engere wirtschaftspolitische Ab- hängigkeit von der Sowjetwirtschaft gebracht wurden. Der Anteil des Han- dels mit diesen Ländern betrug 1949 ungefähr 2/3 des gesamten sowjetischen Außenhandels; er hatte steigende Tendenz, während der Außenhandel der Sowjetunion mit den nicht kommunistischen Ländern stark sinkende Ten- denz aufwies1). Die Satellitenstaaten einschließlich der Sowjetunion können aber der Sowjetwirtschaft nur einen sehr bescheidenen Teil dessen liefern, was sie im Interesse eines gesunden volkswirtschaftlichen Aufstieges am Welt- markt kaufen müßten. Es mußte daher etwas geschehen, um Sowjetrußland wesentlich mehr den Nutzen einer internationalen Arbeitsteilung zugute kommen zu lassen als bisher. Das war wohl einer der Hauptgründe die Anlaß gaben, den „Goldstandard des Rubels" zu proklamieren.
6. Rückkehr zum Goldstandard? Die erstaunlich ge- ringe Goldgewinnung während der Zeit des Kriegskommunismus läßt schon vermuten, daß damals der volkswirtschaftliche Wert des Goldes äußerst ge- ring eingeschätzt wurde. Wozu sollte auch Gold Verwendung finden! Das Geld wollte man abschaffen; ein Export erübrigte sich; da die Autarkie Trumpf war; Ausgaben für teuren Schmuck kamen kaum in Betracht, weil damals alle Bemühungen darauf hinausliefen, die Einkommen zu nivel- lieren. Das änderte sich ,,mit der neuen ökonomischen Politik". Nicht nur legte man nunmehr Gewicht auf die Golddeckung der Noten, sondern man
x) Dogma und Wirklichkeitssinn in der Sowjetwirtschaft, München 1949, S.28.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

650 AdolfWeber
erkannte auch, wie wichtig Gold ist als Weltgeld zum Ausgleich der Zah- lungsbilanz und zur Bezahlung dringend notwendiger Waren und Leistungen des Auslandes. Zwar wurde später die Golddeckung der Banknoten wieder aufgegeben, an die Stelle trat die „solide materielle Sicherung der Waren, die zu festen Preisen verkauft wurden". Indessen schenkte man den Gold- reserven im Interesse der internationalen Zahlungsbilanz auch im Rahmen der Fünf jähr es-Pläne Beachtung. Kennzeichnend ist die folgende Äußerung Stalins, die er 1933 über die Sicherung der Stabilität der Sowjetwährung machte: „Wodurch wird die Stabilität der Sowjetvaluta gesichert, wenn wir den organisierten Markt im Auge haben, dem im Warenumsatz des Landes entscheidende Bedeutung zukommt, und nicht den unorganisierten Markt, der nur untergeordnete Bedeutung hat. Natürlich nicht allein (!) durch Gold- reserven. Die Stabilität der Sowjetvaluta wird vor allem durch die gewaltige Menge von Waren in den Händen des Staates, die zu festen Preisen umgesetzt werden, gesichert. Wer von den Ökonomen kann bestreiten, daß eine solche Sicherung, die nur in der Sowjetunion vorhanden ist, eine realere Sicherung der Stabilität der Valuta darstellt als jede beliebige Goldreserve"1) ? Daraus ergibt sich, daß während der Zeit der Fünf jahrespläne Goldreserven immer- hin als eine zusätzliche Sicherung der Sowjetvaluta in Betracht kamen. Zur Zeit der Vorbereitung auf den Krieg, während des Krieges und auch nach dem Kriege, trat diese Sicherungsfunktion zunächst stark zurück hinter der Be- deutung des Goldvorrats im Dienste der naturalen Reservepolitik, auf deren besondere Wichtigkeit oben bereits hingewiesen wurde.
Auf Grund der Verordnung vom 28. 2. 1950 ist anzunehmen, daß nun- mehr dem Golde wieder erhöhte Bedeutung für die Stabilisierung der Wäh- rung beigemessen werden soll. In der Verfügung heißt es:
„Der Ministerrat der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken beschloß: 1. Ab 1. März 1950 die Festlegung des Kurses des Rubels im Verhältnis zu
den ausländischen Währungen auf Grund des Dollars einzustellen und sie auf eine stabilere, auf eine Goldbasis entsprechend dem Goldinhalt des Rubels zu über- führen.
2. Den Goldinhalt des Rubels auf 0,222168 g reinen Goldes festzulegen. 3. Ab 1. März 1950 den Kaufpreis der Staatsbank der UdSSR für Gold auf
4 Rubel 45 Kopeken für ein Gramm reinen Goldes festzulegen. 4. Den Kurs des Rubels im Verhältnis zu den ausländischen Währungen ab
1. März 1950 - ausgehend von dem in Punkt 2 festgelegten Goldinhalt des Rubels - zu bestimmen:
4 Rubel für einen amerikanischen Dollar statt des bestehenden von 5 Rubel 30 Kopeken;
5. Die Staatsbank der UdSSR zu beauftragen, dementsprechend den Kurs des Rubels im Verhältnis zu den anderen ausländischen Währungen abzuändern. Im Falle weiterer Änderungen des Goldinhalts der ausländischen Währungen oder Änderungen ihrer Kurse, hat die Staatsbank der UdSSR den Kurs des Rubels im Verhältnis zu den ausländischen Währungen festzulegen".
Die unter russischem Einfluß stehende Halbmonatsschrift „Neues Deutschland" begrüßte diese Geldreform folgendermaßen: „Diese Maß- nahme der Sowjetunion ist als ein Ereignis von Weltbedeutung anzusehen. Sie zeigt deutlich, daß die Zeit endgültig vorbei ist, in der die kapitalistischen
x) J. Stalin, Fragen des Leninismus, Moskau Ausgabe 1947, S. 473.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft 651
Weltmächte mit ihren Währungen im Welthandel den Ausschlag gaben. Die verschiedenartige Entwicklung in der Welt, die stürmische Aufwärts- entwicklung in der Sowjetunion und dem von ihr geführten großen Lager des Fortschritts und des Friedens mit seiner gesunden Wirtschaft auf der einen Seite und die von Kriegen geschüttelte kapitalistische Welt auf der anderen Seite, die verzweifelt kämpft, um den unvermeidlichen Untergang noch etwas hinauszuschieben, hat zu der neuen Bewertung des Verhältnisses von Rubel zu Dollar geführt. Diese verschiedenartige Entwicklung hat den Dollar als Wertmesser im Weltmaßstab unbrauchbar gemacht" (3. März 1950).
Die gegnerische Presse war allzu leicht bei der Hand, um die neue geld- politische Lage in Sowjetrußland mit Worten wie ,, Bluff" und „Taschen- spielertrick" abzutun. Es ist weder klug noch richtig, daß man umfassende Transaktionen der hier erörterten Art, die unmittelbar oder mittelbar das Wirtschaftsleben von 700 Millionen Menschen berühren, ohne irgendwelche Sachkenntnis mit Roßtäuscher-Kniffen auf eine Stufe stellt.
Sicher ist freilich, daß keine Rede davon sein kann, Rußland sei nunmehr wieder zum „Goldstandard" zurückgekehrt, wenn das Wort den Sinn haben soll, der ihm in der Marktwirtschaft beigelegt wird. Das wäre erst dann der Fall, wenn die Preise sich am freien Markt nach dem Goldpreis richteten und die- ser sich am freien Geldmarkt bildete, oder doch wenigstens einheitlich für alle am Weltmarkt teilnehmenden Volkswirtschaften einheitlich festgelegt würde. Faktisch wird aber der Goldpreis, wie alle anderen Preise in Rußland, vom Staat festgesetzt. Diese Festsetzung war bisher völlig willkürlich. Seit dem Juli 1937 wurde in Rußland der Wert des Dollars mit 5 Rubel 30 Kopeken bestimmt und daran änderte sich auch nichts als im Dezember 1947 inner- wirtschaftlich eine Reduzierung der Kaufkraft im Verhältnis 10 : 1 ange- ordnet wurde. Selbstverständlich kann auch der Rubel nicht beliebig in Gold eingetauscht werden und im Gegensatz zu den kapitalistischen Län- dern wird schon seit zwei Jahrzehnten darauf verzichtet, durch Veröffent- lichung der Geschäftsgebahrung und der Deckungsverhältnisse Einblick in die Art und Weise der Sicherung der Noten zu gewähren. Die offizielle No- tierung des Rubelkurses in Moskau hat eigentlich nur praktische Bedeutung für die dort tätigen Diplomaten, derentwegen glaubte man auch bei der letzten Reform gewisse Übergangserleichterungen vornehmen zu müssen.
Bemerkenswert ist aber immerhin, daß der sowjetische Goldpreis dem internationalen Goldpreis von 35 Dollar, wie er vom internationalen Wäh- rungsfonds festgelegt wurde, angepaßt worden ist, obwohl die Sowjetunion dem internationalen Währungsfonds nicht angehört. Es gibt Sachkundige, die darin einen Beweis sehen wollen, daß Sowjetrußland trotz allem Ein- gliederung in den internationalen Geld- und Goldmechanismus anstrebt. Als vor dem zweiten Weltkrieg Rückkehr der Weltwirtschaft zur internationalen Goldwährung erörtert wurde, trat Varga, damals noch unbestritten die erste russische Autorität auf dem Gebiete der volkswirtschaftlichen Theorie, leb- haft für die Goldwährung ein. Freilich dachte er allem Anschein nach nicht im mindesten daran, daraus auch für die russische Volkswirtschaft die not- wendigen Konsequenzen zu ziehen, also Rückkehr zur Marktpreisbildung ins Auge zu fassen. Ihm lag offenbar daran, für das russische Gold einen mög-
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

652 Adolf Weber
liehst gesicherten Markt zu gewinnen. Angesichts des sehr geringen Anteils Rußlands am Welthandel, muß ihm natürlich sehr viel daran liegen, für sein Gold als Exportware einen zuverlässigen Markt zu haben. Aus dieser Erwägung heraus sind die, namentlich von amerikanischen Sachverständi- gen, immer wieder in Umlauf gesetzten Gerüchte, Rußland treibe eine Dum- ping-Aktion mit dem Ziel, durch eine Überflutung der Welt mit Gold den Goldpreis zu drücken, wenig wahrscheinlich. Sowjetrußland würde sich da- durch jedenfalls auf längere Sicht ins eigene Fleisch schneiden. Das schließt aber nicht aus, daß vorübergehend Rußland gezwungen ist, im Interesse seiner Volkswirtschaft, vielleicht auch im Interesse der zu seinen Gunsten in der Welt arbeitenden 5. Kolonnen, zeitweise so viel Gold zu exportieren, daß dadurch zeitweise ein Preisrückgang am freien Goldmarkt herbeige- führt wird.
Geht man der Sache auf den Grund, so wird man wohl folgende Haupt- gründe für den Ersatz des Dollars durch Gold in Sowjetrußland feststellen dürfen :
1) Die äußerlich stark betonte geborgte Währungsbasis war zum minde- sten ein politisch nicht unbedenklicher Schönheitsfehler. Es mußte insbe- sondere auf die Ostasiaten einen fatalen Eindruck machen, daß die Russen den Kampf gegen den Dollarimperialismus proklamierten, aber gleichzeitig diesem Dollar in ihrem Geldsystem einen zentralen Platz einräumten.
2) Da die Sowjetrussen gemäß ihrer grundlegenden Theorie davon über- zeugt sein müssen, daß die kapitalistischen Länder, allen voran die Vereinig- ten Staaten, einer schweren Wirtschaftskrisis entgegeneilen, konnten sie sich nicht darauf verlassen, im Dollar eine geeignete Grundlage zu sehen für ihre internationalen Transaktionen.
3) Die Russen können damit rechnen, daß die neue Geste in der Welt als ein Zeichen der Stärke gedeutet wird, als Anfang einer neuen weltwirt- schaftlichen Betätigung von grundsätzlicher Bedeutung. Die Züricher Zei- tung „Die Tat" brachte bald nach Bekanntwerden des Beschlusses der Sow- jetregierung vom 28. Februar eine Erläuterung durch einen „guten Kenner der russischen Verhältnisse". Darin hieß es : „Die russische oder Rubelblock- währung wird nunmehr den Dollar- und den anderen Hartwährungsgeldern gegenüber den Beweis zu erbringen haben, daß sie nicht fiktiv ist, einen ein- deutigen Wertmaßstab darstellt und die Bedingungen erfüllt, welche an eine internationale Anerkennung einer Währung gestellt werden, ihre Verwend- barkeit beim Ausgleich der Handelsbilanz und anderen internationalen Transaktionen, die Gewißheit für den Ausländer, daß er gegen den Rubel ohne weiteres Waren und Dienste erhalten kann, sowjetrussische Geldzeichen ein- und ausgeführt werden können" (10. März 1950). Die Redaktion setzte hinter diese offenbar als Möglichkeit hingestellte Erwartung, die unter den heutigen Umständen ohne jeden Zweifel richtige Bemerkung: „Dieser Beweis wird nicht erbracht werden können"; aber die Tatsache, daß ein Sachkenner, der außerhalb des unmittelbaren sowjetrussischen Einflusses steht, immerhin von einer solchen Möglichkeit glaubt sprechen zu können, mag ein Beweis dafür sein, daß die neueste Währungsaktion das weltwirtschaftliche Prestige der Sowjetunion bis auf weiteres wohl zu steigern in der Lage ist.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft 653
4) Sowjetrußland muß versuchen, gegenüber den Zusammenschlußbe- strebungen der Westmächte ein Gegengewicht zu schaffen. Zu dem Zwecke wurde der „Rat für gegenseitige wirtschaftliche Hilfe" (Molotowblock) ge- bildet, dem Anfang Oktober 1950 auch die „deutsche demokratische Repu- blik" beitrat. Dieser Block muß aus dem primitiven bilateralen Warenaus- tausch herauskommen. Will man aber der Multilateralität innerhalb der sowjetrussischen Einflußsphäre den Weg bahnen, dann ist dazu eine einheit- liche Währungsgrundlage unerläßlich. Daß sie nicht durch Anlehnung an die Währung eines der kapitalistischen Länder gebunden werden kann, liegt auf der Hand, daher die neu geschaffene Geldeinheit als gemeinsame Verrech- nungsbasis.
5) Eine Aufwärtsbewertung des Rubels um % bedeutet, daß diejenigen Staaten, die ihre Wirtschaftsabkommen mit Rußland auf der Dollarbasis abgeschlossen haben (das sind alle Satellitenstaaten mit Ausnahme der Tschechoslowakei, die auf Grund der Tschechenkrone verrechnet), um ein Drittel mehr Waren an die Sowjetunion bzw. die Sowjetunion um ein Drittel weniger Waren liefern müssen, um die vereinbarten Wirtschaftsabkommen zu erfüllen. Das fällt um so mehr ins Gewicht, weil durchweg ein nicht unerheblicher Aktivsaldo zugunsten der Satellitenstaaten vorhanden ist. Da die nach dem Kriege sehnlichst erwarteten großen Auslandskredite aus- geblieben sind, andererseits aber die Abschnürung von dem weltwirtschaft- lichen Austausch sich immer mehr als schlimmer Nachteil bemerkbar macht, wird diese Erleichterung in den sowjetrussischen Zahlungsverpflichtungen sicherlich höchst willkommen sein, wenn sie natürlich auch nur einen vor- übergehenden Charakter haben kann.
7. Prinzipienfestigkeit und wirtschaftlich e V e r - nunft. In seiner Autobiographie1) wirft Trotzki seinem Gegner Stalin „Unwissenheit, äußerste Enge des politischen Horizontes und außerordent- liche moralische Plumpheit und Skrupellosigkeit" vor, aber er muß doch wiederholt zugeben, daß er über einen hervorragenden „praktischen Ver- stand" verfüge, der allerdings zu „dreiviertel aus Schlauheit" bestehe. Und bei einer Gegenüberstellung der Charaktere Stalins und Trotzkis rühmt Ludwig von Mises den common sense von Stalin, zwar sei er ein begeisterter Verteidiger des Kommunismus, stehe aber bei weitem nicht so unter dem Einfluß der marxistischen Lehre wieTrotzky: „Trotzky was wrong in accu- sing Stalin of strangling the communist movement outside of Russia. What Stalin really did was to apply other means for the attainment of ends which are common to him and all other Marxians"2). Das sind richtige und sehr wichtige Feststellungen. Stalin ist fanatischer Anhänger der kommunisti- schen Idee, ihretwegen will er die Welt erobern; sein Dogma ist der histo- rische und dialektische Materialismus, sowie er ihn interpretiert. Dem Dogma opfert er die individuelle Freiheit und die mit dieser eng zusammen- hängende Koordinierung und Entfaltung der ökonomischen Kräfte auf Grundlage der Marktpreisbildung, ebenso wie die Vorteile einer mit der
1)Leo Trotzki, Mein Leben. Versuch einer Autobiographie, Berlin 1930, S. 464.
2) Ludwig von Mises, Planned Chaos, New York 1947, S. 58.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

654 Adolf Weber
Marktpreisbildung verbundenen internationalen Arbeitsteilung. Es gehört zu seiner Weltanschauung, daß er an den Triumph der Technik und der die Technik bedienenden Menschen glaubt, daher verlangt er äußersten Einsatz der kapitalistischen Akkumulation zwecks Förderung der Schwerindustrie, die zugleich Grundlage für die militärische Machtentfaltung ist.
Wie sehr sich auch kluge Leute, die den russischen Kommunismus an Ort und Stelle jahrelang beobachten konnten, täuschen ließen, bekundet Joseph E. D a v i e s , der durch den Optimismus, mit dem er die sowjetrussische Ent- wicklung betrachtete, so verhängnisvoll auf seinen intimen Freund Roosevelt einwirkte. Von 1937 bis 1938 war er Botschafter der Vereinigten Staaten in Moskau, in seinem weitverbreiteten Buche, zeitweise war es der bestseller in den Vereinig- ten Staaten „Mission to Moscow" 1. Auflage 1941 schreibt er: ,,The Soviet state can reconcile the Christian religion with is basic purpose .... The ultimate pur- pose of the Soviet state is to promote the brotherhood of man" *). In Wirklichkeit standen sich und werden sich in aller Zukunft Christentum und Bolschewismus gegenüberstehen wie Wasser und Feuer. Weit besser als Da vies hat ein anderer Botschafter die Größe der bolschewistischen Gefahr erkannt: der französische Botschafter Jean Her bette, der in den Jahren 1927 bis 1931 die französische Republik in Moskau vertrat, schrieb in einem amtlichen Bericht: „Im Grunde genommen sind die russischen Kommunisten in ihren Beziehungen zu den aus- ländischen Regierungen nicht „gegen eine" sondern „gegen alle". Eine absurde Politik wird man vielleicht sagen, aber man muß sich doch die Mühe machen, ihren Umfang zu untersuchen, wenn man ihre Auswirkungen verhindern will. Doch nur unter einer Bedingung kann man sie verstehen: wenn man daran denkt, daß für die russischen Kommunisten von heute die Weltrevolution nicht ein ge- wissermaßen mystischer Traum, sondern ein bald erreichbares Ziel ist und daß sie, während sie mit Hilfe aller politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, diesem Ziel systematisch zustreben, unauf- hörlich die ganze Welt im Sinne haben und sich auf ihre Art den deutschen Wahl- spruch zu eigen machen: „Mein Feld ist die Welt". In einem anderen Bericht meint Her bette: „Keine revolutionäre Partei ist schneller dabei als die kommu- nistische, sich unterwürfig zu gebaren, sich systematisch „in die Erde" zu ver- kriechen, sobald sie sich einer klarsehenden und starken Regierung gegenüber sieht. Wenn die russischen Kommunisten etwas wagen, so nur, weil sie mit der Unachtsamkeit, der Nachsicht und Uneinigkeit der fremden Regierungen rech- nen. Man wird gut tun, sich danach zu richten, ehe die von Moskau geleiteten und bezahlten kommunistischen Umtriebe den Brand in Gegenden unserer Erde entfacht haben, die man vor einem sozialen Umsturz am sichersten glaubte" 2).
In dem durch das Dogma gezogenen engen Rahmen duldet Stalin nicht nur Kritik sondern er fordert sie. Auch hat er selbst den Mut Wege zu gehen, die vordem als Verrat am Parteiprogramm erschienen wären. Anläßlich eines Empfanges von Eisenbahnern im Kreml erklärte Stalin im Jahre 1935: „In der Kritik und Selbstkritik liegt der Schlüssel zur Überwindung und Besei- tigung der Mängel unserer sozialistischen Ordnung, hierin liegt das Geheim- nis unseres Fortschritts"3). Schon vorher hatte Stalin einen sehr starken Beweis dafür erbracht, daß er, falls es ihm notwendig erscheint, sich stark
!) Pocket-book-Ausgabe New York 1943, S. 471. 2) Die Entstehung des Krieges von 1939. Geheimdokumente aus europä-
ischen Archiven, herausgegeben von der Archiv- Kommission des Auswärtigen Amtes Berlin 1943, S. 134 bzw. S. 146.
3) Prawda 2. Jahrgang 1935 zitiert nach M. A. Leonow, Kritik und Selbstkritik, eine dialektische Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung der Sowjet- Gesellschaft. Deutsche Übersetzung, Berlin o. D.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Geld und Gold in der Sowjet wir tschaft 655
genug fühlt, neue Wege zu gehen. In der Eede, die er am 23. 6. 1931 hielt und die mit Recht die „Magna Charta" für das neuzeitliche russische Wirt- schaftssystem genannt wird, wandte er sich gegen die Nivellierungstheorie, die bis dahin herrschend war. Den Glauben, daß der Sozialismus die Gleich- macherei, die Gleichstellung, die Nivellierung der Bedürfnisse und persön- lichen Lebensweise der Mitglieder fördere, bezeichnet er als „reaktionären, kleinbürgerlichen Unsinn". Gleichzeitig forderte er hinsichtlich des Arbeits- entgelts rücksichtslose Anwendung des Leistungs- und des Knappheits- prinzips, im Betrieb forderte er die „Ein-Mann-Führung" und die bisherigen Bemühungen führender Parteigenossen, zwischen technischer Intelligenz und der Arbeiterschaft einen Gegensatz zu konstruieren, stießen auf seinen härtesten Widerstand. Kein geringerer als Gustav Cassei, ein über- zeugter Vertreter einer freien Marktwirtschaft, hielt mit seiner Anerkennung dieser Grundauffassung nicht zurück „sie begründet die Überlegenheit einer Wirtschaft, die die Arbeit nach ihrem Wert bezahlt gegenüber einer Wirt- schaft, die die Einkommensausgleichung an erster Stelle auf ihr Programm setzt"1). Freilich blieb der sozialökonomische Gesamteffekt all dieser Be- strebungen auf lange Sicht äußerst gering, weil alle Kennzeichen des Sy- stems erhalten blieben. Der Verzicht auf die Produktivität der Freiheit, die Überschätzung und falsche Einordnung der technischen Apparatur, die un- genügende Ausnützung der internationalen Arbeitsteilung und - was am schlimmsten war - es gelang nicht, an die Stelle der Marktpreisbildung ein brauchbares Orientierungsmittel für die bestmögliche Gestaltung des Ineinandergreifens der Betriebe und der einzelnen Vorrichtungen zu schaf- fen. Das Ergebnis blieb im Grunde genommen immer dasselbe. In der Fach- zeitschrift der schwedischen Bauarbeiter zog ein Delegationsmitglied, das kürzlich (1950) Rußland besucht hatte, folgendes Fazit seiner Eindrücke: „Pompöser Repräsentationsaufwand kann die graue Armut des Volkes nicht verdecken. Der Lebensstandard der breiten Masse ist mit dem westlichen Standard überhaupt nicht zu vergleichen."
Täuscht nicht alles, stehen wir jetzt wiederum vor einer Neuorientierung der russischen Wirtschaftsmethoden, selbstverständlich bei starrem Fest- halten an den „Prinzipien". Harry Schwarz, ein guter Kenner der Sowjetwirtschaft, berichtet in der New York Times (24. 9. 1950): „Wie das Bulletin der Sowjetischen Akademie der Wissenschaft enthüllt, werden die Preise der Sowjetindustrie jetzt nach Prinzipien bestimmt, die den Geschäftsme- thoden der kapitalistischen Länder entsprechen. Der Preisansatz sowjetischer Betriebe muß jetzt hoch genug sein, um außer der Deckung der Gestehungs- kosten noch Gewinn zu ermöglichen. Außerdem muß das Verhältnis von Angebot und Nachfrage berücksichtigt werden, so daß z. B. durch hohe Preise für knappe Bedarfsartikel gleichzeitig eine Erhöhung der Produktion und eine Beschränkung des Konsums bewirkt wird. Die Preise werden jedoch noch immer durch Planstellen anstatt durch freie Marktkonkurrenz bestimmt. Nach diesen Grundsätzen ist 1949/50 die Revision der sowjetischen Groß- handelspreise durchgeführt worden. Das Hauptziel besteht in der Vermei-
1) Vgl. mein Buch: Marktwirtschaft und Sowjetwirtschaft. S. 300.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

656 Adolf Weber, Geld und Gold in der Sowjetwirtschaft
dung von Verlusten, die weitere Subventionen erfordern würden. Die Fest- setzung der Preise in Hinsicht auf Kostendeckung wird jedoch dadurch er- schwert, daß Betriebe gleicher Branchen überaus verschiedene Gestehungs- kosten aufweisen, worauf auch das sowjetische Wirtschaftsinstitut verweist."
Daraus erscheint sich zu ergeben, daß die in den vorangegangenen Ab- schnitten erwähnten Versuche zu einer theoretischen Neuorientierung ebenso wie die wirtschaftspolitischen Beschlüsse der letzten Jahre in einen größeren Zusammenhang gebracht werden müssen mit dem Ziel, der volkswirtschaft- lichen Vernunft mehr Kaum zu geben als bisher. Das würde den Bolsche- wismus, der selbstverständlich seinem Ziele treu bleibt, noch gefährlicher machen als er bisher schon war; doppelt gefährlich, wenn die wirtschaft- liche Vernunft in den kapitalistischen Ländern immer wieder durch wahl- taktische Rücksichtnahmen und durch Machtkämpfe zwischen den Sozial- partnern in den Hintergrund gedrängt wird. Nachdem sich die Vereinten Nationen der Überlegenheit ihrer defensiven Kraft bewußt geworden sind und dementsprechend handeln, liegt die Gefahr nicht mehr auf militäri- schem, sondern auf wirtschaftlichem Gebiet. Die Gefahr wird bedrohlich gesteigert durch die drückenden militärischen Ausgaben und durch die von den 5. Kolonnen geschürten politischen und sozialen Unruhen überall in der Welt. Sie können dann zur Katastrophe für den Westen werden, wenn zunehmender volks- und weltwirtschaftlicher Unvernunft in den kapitalisti- schen Ländern wachsende relative wirtschaftliche Vernunft in der Sowjet- wirtschaft entgegengesetzt würde, obwohl durch die Erfahrung bestätigt worden ist und auch weiterhin bestätigt wird, daß auf lange Sicht die Markt- preisbildung, die nicht mit freier Marktwirtschaft identisch ist, unumgäng- lich ist, wenn nachhaltige Sicherung und Steigerung des realen Arbeits- einkommens, das einzig mögliche Ziel einer den neuzeitlichen Ideen Rechnung tragenden Volkswirtschaft, angestrebt wird.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Thu, 12 Jun 2014 23:35:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions