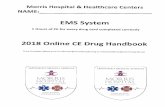Healthcare Check-Up: Die grosse Baustelle
-
Upload
kpmg-switzerland -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
description
Transcript of Healthcare Check-Up: Die grosse Baustelle

HEALTHCARE CHECK-UPMagazin für den Healthcare Sector / Ausgabe Nr. 5 / Februar 2014
Roadmap to «Spital 2022» – Rückblick auf den Healthcare Event 2013
Fokus: Bau, Betrieb und Bewertung von Spitalimmobilien
Sicher in die vernetzte Zukunft
Leistungsangebot: Von der Strategie zur Abbildung im Reporting
«Spital 2022»
Die grosse Baustelle

Healthcare Check-up / Februar 2014
Differenzierung der Leistung
Vernetzung der Anbieter
Interaktion Kunde und
Leistungserbringer
Transparenz bezüglich Kosten
und Qualität
Bau und Betrieb von Spitälern
Bewertung von Spitalimmobilien
Sicher in die vernetzte Zukunft – Bedeutung einer effektiven IT-Strategie
Leistungsangebot: Von der Strategie zur Abbildung im Reporting
Roadmap to «Spital 2022»
Roadmap to «Spital 2022» – Rückblick auf den Healthcare Event 2013
2 | Roadmap

Februar 2014 / Healthcare Check-up
Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Im Dezember 2013 haben wir unseren 4. KPMG Healthcare Event in Zürich durchgeführt. Unter dem Motto Roadmap to «Spital 2022» haben diverse Vertreter der Gesundheitspolitik, Leistungserbringer und Beratung über aktuelle Herausforderungen im Gesundheitswesen diskutiert. Schwerpunktthema war in diesem Jahr die Spitalfinanzierung. Diese Thematik wurde zum einen aus der Sicht des Finanzieres präsentiert und zum anderen wurde auf die damit zusammenhängenden Herausforderungen und Chancen für Kantone und Spitäler eingegangen.
Neben der Spitalfinanzierung bilden zwei weitere Artikel einen weiteren Schwerpunkt dieses Magazins: die Immobilien. Es werden Eckpunkte zum Bau und Betrieb von Spitälern diskutiert, sowie mögliche innovative Betriebskonzepte skizziert. Zudem werden unterschiedliche Ansätze zur Bewertung von Spitalimmobilien erläutert und der erforderliche Miteinbezug der Tragbarkeit aufgezeigt.
In diesem Heft finden Sie zudem, wie eine umfassende ITStrategie hilft, zeitgerecht neue Möglichkeiten der IT in der Organisation und den
Abläufen zu verankern, wie aufgrund der Nutzung von Systemdaten das Leistungsangebot beurteilt werden kann und Entschei
dungen zur zukünftigen Positionierung getroffen werden können, was der neuste Gesundheitsbericht der OECD in Bezug auf die Schweiz aussagt.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und freuen uns, wenn Sie aus dieser Publikation Ideen und Impulse für Ihre Arbeit in Ihren Alltag mitnehmen können.
Michael HerzogAndré Zemp
| 3
Schweiz
Roadmap to «Spital 2022» – Heraus forderungen im aktuellen Spannungsfeld
S. 4 – 5
Bau und Betrieb von Spitälern S. 6 – 7
Bewertung von Spitalimmobilien S. 8 – 9
Sicher in die vernetzte Zukunft – Bedeutung einer effektiven ITStrategie
S. 10 – 11
Leistungsangebot: Von der Strategie zur Abbildung im Reporting
S. 12 – 13
Deutschland
Der EPatient: Was kommt da auf das Gesundheitswesen zu?
S. 14 – 15
International
Gesundheit auf einen Blick – die Schweiz im OECDGesundheitsbericht 2013
S. 16 – 18
Das Krankenversicherungssystem von Abu Dhabi S. 19 – 21
Inhaltsverzeichnis
Michael Herzog André Zemp Sektorleiter Healthcare Leiter Advisory HealthcareLeiter Audit Healthcare

Healthcare Check-up / Februar 20144 | Roadmap to «Spital 2022»
Roadmap to «Spital 2022» – Heraus forderungen im aktuellen Spannungsfeld
Am vierten Healthcare Event von KPMG diskutierten Experten und Vertreter aus dem Gesundheitswesen anhand der Roadmap «Spital 2022» über die zukünftigen Herausforde rungen und mögliche Lösungsansätze im Schweizer Gesundheitsmarkt. Zu den Teilnehmern zählten Direktoren, Finanzverantwortliche und Projektleiter von Schweizer Spitälern sowie Vertreter von Behörden. Die Referate wurden von Vertretern der Credit Suisse und der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich sowie von HealthcareSpezialisten der KPMG gehalten. Aktuelle Fragestellungen betrafen unter anderem die Finanzierung von Bauprojekten, eine klare Unternehmensstrategie, eine sichere ITInfrastruktur und realistische Businesspläne.
InfrastrukturGemäss einer Studie der Credit Suisse sind im Gesundheitswesen Bauprojekte in der Höhe von knapp 9 Milliarden Franken absehbar. Viele Spitäler müssen sich folglich früher oder später mit dieser Thematik auseinandersetzen. Eine frühzeitige Planung und Ausarbeitung sind zentrale Bestandteile für eine erfolgreiche Realisierung, da solche Projekte sehr zeitintensiv sind. Insbesondere die Regelung der Finanzierung bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Mit dem Bau einer neuen Infrastruktur sind allerdings noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Anhand eines Beispiels der Universitätsklinik Charité in Berlin zeigt Ulrich Prien, Leiter Real Estate bei KPMG, dass neue Konzepte im Unterhalt und Betrieb gros ses Potenzial besitzen. Die Charité ist eine Kooperation mit Unternehmen aus der Privatwirtschaft eingegangen
und hat mit diesen zusammen ein Joint Venture gegründet, welches für den gesamten Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften verantwortlich ist. Dieses neue Unternehmen generiert heute mit 2’700 Angestellten einen Umsatz von 130 Millionen Euro. Die Umsetzung eines solchen Projekts wäre auch in der Schweiz denkbar.
Finanzierung durch BankenDie Finanzierung von Projekten im Gesundheitswesen stellt für Vertreter aus der Finanzbranche ein grosses Potenzial dar, beinhaltet aber auch Risiken, da bisher nur eine sehr begrenzte Erfahrung vorhanden ist. Anne Cheseaux (Credit Suisse, heute pro ressource) führte aus, dass zwischen Spitälern und Kapitalgebern in einem iterativen Prozess eine Lösung angestrebt wird. Von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Finanzierung sind insbesondere eine klare Unternehmensstrategie, eine Reduktion der Investitionsliste auf das Notwendigste und realistische Annahmen im Businessplan. In diesem Zusammenhang wird deutlich: Sowohl die Finanzbranche als auch die Spitäler betreten bei einer Finanzierung Neuland. Wie sich dies in Zukunft entwickeln wird, dürfte äusserst spannend bleiben.
Die Rolle des RegulatorsIn der Folge erläuterte Hansjörg Lehmann (Leiter Gesundheitsversorgung, Gesundheitsdirektion Kanton Zürich) die Finanzierung aus Sicht des Regulators. Seit 2012 werden Betriebs und Investitionsentscheidungen nicht mehr unabhängig von der Erlössituation durch die Fallpauschalen gefällt. Um eine Benachteiligung einzelner Spitäler
zu verhindern, wurden erhaltene Investitionsbeiträge gemäss dem Restwert der Immobilien in Darlehen umgewandelt. Dies könnte nun Spitäler in Bedrängnis bringen, welche einen solchen Ausbau (kurz vor der Umstellung der Spitalfinanzierung) nicht primär aufgrund von KostenNutzenÜberlegungen getätigt haben. In Zukunft besteht für den Kanton aber immer noch die Möglichkeit der Vergabe von Darlehen für Bauprojekte, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind.
IT-StrategieDer technologische und kulturelle Wandel macht auch vor dem Gesundheitswesen nicht Halt. Vernetzung, mobile Medien oder Cyberkriminalität sind aktuelle oder zukünftige Herausforderungen, mit welchen sich auch Spitäler auseinandersetzen müssen. An Beispielen wie der Einführung von eHealth, mit welcher Patienten einen direkten Einblick in die eigenen medizi
Bereits zum vierten Mal fand im November 2013 der KPMG Healthcare Event in Zürich statt. Unter dem Motto Roadmap to «Spital 2022» wurden Referate zu den Themen Immobilien, Finanzierung, ITStrategie und Leistungsangebot gehalten und Entwicklungsschritte für die Zukunft diskutiert. Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, dass diese Fragestellungen im heutigen Spannungsfeld für viele Institutionen von grosser Bedeutung sind.

Februar 2014 / Healthcare Check-up Roadmap to «Spital 2022» | 5
nischen Daten erhalten, dem Einsatz von mobilen Diagnosegeräten zur Selbstanalyse oder der Verwendung von CloudLösungen zeigt Robert Hegyi (Senior Manager IT Advisory KPMG) mögliche Entwicklungen im Bereich IT auf. Diese Themen werden in Zukunft einen wesentlichen Einfluss auf die ITStrategie von Spitälern haben.
Ausbau LeistungsangebotAnhand eines fiktiven Beispiels des Spitals «Züribiet» zeigten André Zemp (Leiter Healthcare Advisory KPMG) und Roland Kolb (Geschäftsführer TIP GROUP® Schweiz) das optimale Vorgehen beim Ausbau des Leistungsangebots eines Spitals auf. Zentrale Elemente in einem solchen Prozess sind eine kritisch vertiefte Marktanalyse und die Erstellung einer SWOTAnalyse. Gemäss den Erfahr ungen von André Zemp budgetieren Spitäler vielfach eine Steigerung der Fallzahlen, obwohl diese Annahme oftmals zu
wenig fundiert ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Einbezug von medizinischen Leistungserbringern. Durch die Integration während des gesamten Prozesses steigt das betriebswirtschaftliche Verständnis, und die Verpflichtung der involvierten Personen wird greifbar. Roland Kolb zeigte auf, wie wichtig in der Folge vor allem ein regelmässiges Controlling ist: Nur auf diese Weise kann eruiert werden, ob der Ausbau des Angebots ein wirklicher Erfolg war und einen positiven Beitrag ans Betriebsergebnis leistet.
Chancen und RisikenAbschliessend kann festgehalten werden, dass die aktuellen Veränderungen für das Spital im heutigen Spannungsfeld eine anspruchsvolle Herausforderung darstellen. Diese Veränderungen beinhalten aber nicht nur Risiken, sondern bieten den Spitälern auch eine Vielzahl an Entwicklungsmöglichkeiten.
Matthias ZannantonioConsultantAdvisory HealthcareKPMG AG Zürich T: +41 58 249 29 18E: [email protected]

Healthcare Check-up / Februar 20146 | Spitalimmobilien
Bau und Betrieb von Spitälern
Die Umstellung von einer objektorientierten Defizitdeckung auf ein subjektorientiertes Preissystem schlägt sich sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in den Bilanzen der Spitäler nieder. Allfällige Verluste oder Investitionen werden nicht mehr durch die öffentliche Hand gedeckt, sondern müssen über die Geschäftstätigkeit finanziert werden. Das Betriebsergebnis wird dabei stark durch den Leistungsauftrag und die bestehende Infrastruktur beeinflusst. Ein Betrieb mit einem hohen Anteil an Neubauten ist wettbewerbsfähiger als ein Spital mit renovationsbedürftiger Substanz.
Ein gesundes Eigenkapital als BasisUm dem zukünftigen Investitionsbedarf gerecht zu werden, müssen die Spitäler in der Lage sein, über Gewinne Rücklagen im Eigenkapital zu bilden. Dabei kommt der Höhe der Fallpauschale und damit auch dem Verhandlungserfolg für die Finanzierung der Anlagenutzungs
kosten (ANK) eine wesentliche Bedeutung zu. Im Allgemeinen liegt der Eigenkapitalanteil als Basis für die Erneuerung der Spitalinfrastruktur zu tief. Weiter wird eine allfällige Verwendung des ANKAnteils zur Deckung operativer Verluste nicht verhindert. Als Konsequenz können in der Zeit bis zur notwendigen Ersatzinvestition zu wenig Rücklagen gebildet werden. Dies ist insbesondere deshalb von Relevanz, da Finanzierungspartner, d.h. Banken und andere institutionelle Investoren, auf eine gesunde Bilanz mit einem Eigenkapitalanteil von mindestens 30% achten.
Eine Analyse von Spitälern im Kanton Zürich zeigt eine EBITMarge von 0.7% bis 7.3% und Eigenkapitalquoten von 6% bis 43% für das Jahr 2012. Alle betrachteten Spitäler weisen ein positives EBITDA aus und können somit Abschreibungen für zukünftige Investitionen bilden. Nach Abzug der Zinsverbindlichkeiten auf das Fremdkapital kann
der übrig bleibende Betrag zur Stärkung der Eigenkapitalbasis genutzt werden. Trotz dieses relativ positiven Ergebnisses bleibt die Frage offen, ob die Gewinne sowie die Frist zur Äufnung der Mittel vor dem Hintergrund des baulichen Zustandes ausreichend sind.
Finanzierungskonditionen werden nebst der Bilanzstärke und der generellen Tragbarkeit auch durch zusätzliche Sicherheiten (Bürgschaften, Garantien, Landwerte), die Laufzeit des Kredites und den Amortisationsplan bestimmt. Je nach Ausgangslage kann sich ohne vorausschauende Planung eine schwierige Pattsituation in Bezug auf die Erneuerung der Infrastruktur ergeben.
Planung und BauVor diesem Hintergrund ist eine iterative Finanzplanung auf Basis des Leistungsauftrages und des Geschäftsmodells notwendig. Ein langfristig
Seit der Einführung von Swiss DRG müssen Bau und Betrieb durch die Spitäler selbständig finanziert werden. Um dem zukünftigen Investitionsbedarf gerecht zu werden, werden die Spitäler zusätzliches Eigenkapital bilden müssen. Dies zwingt zu einem effizienten Betrieb und kostenorientierten Planungs und Bauprozessen.
Klassischer Ansatz
Erneuerungsbedarf zur Erbringung des Leistungsauftrages
Definition Raumbedarf Planungskredit Architekturwettbewerb GU / TUAusschreibung Investitionsantrag Staatliche Finanzierung
Die Zukunft
Geschäftsmodell > Definition Leistungsauftrag Businessplan / Finanzierungskonzept Planung = «Design to Cost» Betreibermodell Integrale Ausschreibung Eigen und / oder private Finanzierung
Fazit: Teilprojekt Finanzierung Konditionen (Höhe Verzinsung Eigenkapital / Fremdkapital) der Anlagen Sicherheiten (z.B. Eigenkapitalbasis, Garantien, Bürgschaften, Landwerte) Laufzeiten / Amortisation Tragbarkeit / Zinsdeckungsgrad
Spitalplanung = «Design to Cost»

Februar 2014 / Healthcare Check-up Spitalimmobilien | 7
angelegter Businessplan und ein Finanzierungskonzept zur Realisierung notwendiger Infrastrukturanlagen bilden dabei die Basis und bestimmen das betrieblich maximal mögliche Investitionsvolumen. Dabei gilt der Grundsatz «Design to Cost», d.h., realisiert werden kann nur, was man sich aufgrund der Geschäftstätigkeit auch nachhaltig leisten kann. Bauliche Leistungen werden auf dieser Basis integral, d.h. mit einem funktionalen Leistungsbeschrieb, Kosten und Terminvorgaben, ausgeschrieben, eingekauft und während der Ausführung überwacht.
Im Rahmen einer solchen Submission können auch zusätzlich betriebliche In frastrukturleistungen im Facility Management integriert und / oder Finanzierungsofferten eingeholt werden. Der bisherige Ansatz eines Architekturwettbewerbes ohne klare Kosten und Terminvorgaben lässt sich je nach Ausgangslage nicht finanzieren. Durch die frühzeitige Einbindung von Finanzierungsexperten lassen sich zudem schwerwiegende Planungsfehler vermeiden.
Facility ManagementFacilityManagementLeistungen werden heute aufgrund ihrer zentralen Rolle im täglichen Ablauf praktisch ausnahmslos durch die Spitalbetriebe selbst erbracht. Obwohl das Interesse von Drittanbietern an einem Markteintritt gross wäre, wurden bisher kaum entsprechende Ausschreibungen durchgeführt. Dabei besteht ein erhebliches Potenzial, die Effizienz zu steigern und Synergien zu nutzen.
Exemplarisch ist dabei das Joint Venture der Universitätskliniken der Charité in Berlin mit verschiedenen FacilityManagementDienstleistern (FM AG). In den ersten 5 Jahren seit der Gründung der CFM Facility Management GmbH im Jahr 2006, welche sämtliche Leistungen von der Sterilisation bis zu den Waren und Logistikprozessen und dem ITSupport erbringt, konnten total rund 150 Millionen Euro eingespart werden1. Wie erfolgversprechend ein solches Kooperationsmodell ist, zeigt auch die seit einem Jahr bestehende «Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH». Sie hat die beabsichtigte Effizienzsteigerung übertroffen und die Kosten für Laborleistungen für Charité und Vivantes im Vorjahresvergleich bereits um 1 Million Euro gesenkt.
Idee: «Swiss Medical Excellence»–GesellschaftIn der Schweiz liessen sich durch vermehrte Zusammenarbeit und Koordination von Supportprozessen ebenfalls wesentliche Effizienzsteigerungen erzielen. Dabei liegt der erste Schritt immer beim Auftraggeber, welcher alleine oder gemeinsam mit Partnerbetrieben die Möglichkeit eines Joint Ventures aktiv prüft. Im Falle der Charité wurde auf dieser Basis die CFM GmbH mit heute rund 2’700 Mitarbeitern gegründet, wobei 51% der Anteile von der Charité gehalten werden. Auf diese Weise können die Mission und der Leistungsauftrag nachhaltig gesichert und umgesetzt werden. Alle FMLeistungen werden als Auftrag formuliert und periodisch ausgeschrieben,
so dass ein klarer Anreiz für den Aufbau von Business Excellence besteht.
Ein analoges Modell könnte durch den Zusammenschluss ähnlicher Betriebe in einer Einkaufsgemeinschaft und einem Joint Venture von entsprechend spezialisierten FMDienstleistern entstehen. Eine solche «Swiss Medical Excellence»Gesellschaft könnte im Spitalwesen wichtige Funktionen übernehmen und entsprechendes Knowhow bündeln. Die CFM GmbH hat zum Beispiel auch ein eigenes Team von Architekten und Ingenieuren für Infrastrukturaufgaben und koordiniert Aufgaben in der Forschung und Lehre.
AusblickSwiss DRG führt zu neuen Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur, welche es durch ein Umdenken in Bezug auf bisherige Planungs und Betriebsprozesse zu meistern gilt. In Bezug auf den Bau und den Betrieb gelten neu die folgenden Grundsätze: Jede Planung beginnt mit deren Finanzierung.
Gemeinsam lassen sich Synergiepotenziale realisieren.
Finanziert werden nachhaltige positive Ergebnisse, nicht die bauliche Substanz.
51% des Kapitals 49% des Kapitals
HC-Verband
Swiss Medical Excellence AG
Ein Modell für die Schweiz?
Joint Venture
Spital X Spital Y Spital Z FM AG A FM AG B FM AG C
1 www.cfmcharite.de
Ulrich PrienPartner, Head Real EstateKPMG AG Zürich T: +41 58 249 62 72E: [email protected]

Healthcare Check-up / Februar 20148 | Spitalimmobilien
Bewertung von Spitalimmobilien
REKOLE® / VKLDie Bewertung von Spitalimmobilien wird über REKOLE® und VKL geregelt. Die Bewertungen erfolgen ausschliesslich auf der Basis der Kosten (REKOLE®: Gebäudeversicherungswert / VKL: Anschaffungskosten). Die so ermittelten Werte widerspiegeln jedoch nicht in jedem Fall den Marktwert der Immobilie. Diese Thematik ist dann aktuell, wenn zum Beispiel für einen Um oder Neubau eine Finanzie
rung gesucht werden muss. Finanzinstitute verlangen in solchen Fällen eine Marktwertbeurteilung auf der Basis der Ertragskraft des Spitalbetriebes und nicht eine Bewertung in Anlehnung an die Baukosten.
MarktansatzDie Bewertung eines Spitals nach einer ertragsorientierten Bewertungsmethode (Ertrags, Bar oder DCFWert1) unterscheidet sich nicht
wesentlich von der Bewertung einer Wohn oder Geschäftsimmobilie. Die grösste Herausforderung ergibt sich in der Bemessung oder Einschätzung des Ertrages, der operativen Kosten und des resultierenden Cashflows. Während sich bei einer Wohn oder Geschäftsimmobilie der Ertrag aus der Drittvermietung ergibt, werden Spitäler meist eigen genutzt und es fliessen keine Mieterträge. Somit stellt sich für den Bewertungsexperten die Aufgabe, die massgebenden Marktmieten zu schätzen, welche bei einer (theoretischen) Vermietung der Flächen durch eine Immobiliengesellschaft an den Nutzer verlangt werden könnten. Aber genau dies stellt die grosse Herausforderung dar. Vergleichsmieten für Büros, Lager, Personalzimmer oder Restaurants sind meist bekannt, nicht jedoch für spitalspezifische Nutzflächen wie Operationssäle und Patientenzimmer. Hier fehlen, als Folge der fast ausschliesslichen Eigennutzungen, entsprechende Vergleichsmieten. Aufgrund dieser Tatsache hat der Marktansatz – zumindest vorläufig noch – ebenfalls seine Grenzen.
KostenansatzFür die Herleitung einer tragbaren Marktmiete werden Kostenmieten genommen, welche mit Vorteil nach Nutzer oder Hauptnutzung (z.B. Lager, Nebennutzflächen, Empfang, Büro, Restaurant, Behandlungsräume, Patientenzimmer, Operationsräume, IPS, Radiologie etc.) separat veranschlagt werden. Die eigentliche Herausforderung stellt sich in der
Wie die Anlagekosten bewertet werden müssen, bestimmen REKOLE® und VKL. Diese Bilanzwerte können jedoch nicht für eine Finanzierung verwendet werden, da Finanzinstitute eine marktorientierte Bewertung verlangen, welche auf dem Ertrag und nicht auf den Anlagekosten basiert. Im Hinblick auf den enormen Investitionsbedarf der Spitäler von rund 20 Milliarden Franken werden Marktwertbeurteilungen in Zukunft einen immer wichtigeren Stellenwert einnehmen.
1 DiscountetCashflowWert

Februar 2014 / Healthcare Check-up Spitalimmobilien | 9
Kostenberechnung, weil meist nur die Gesamtbaukosten, nicht jedoch die Kosten pro Nutzung bekannt sind. Im Weiteren gilt es, zwischen Mieter und Eigentümerausbauten zu unterscheiden, denn nur die vom Eigentümer finanzierten Baukosten sind in der Kostenmiete zu berücksichtigen. Eine ebenfalls nicht einfache Aufgabe, denn aufgrund der Eigennutzung fehlt diese Unterscheidung oft. Hier spielen Erfahrungswerte eine entscheidende Rolle.
In einem ersten Schritt werden die Baukosten pro Nutzer oder Hauptnutzung ermittelt. Diese Baukosten sollten sich an die effektiven Gebäudeneubaukosten anlehnen. Von diesen Neubaukosten wird eine Amortisation als Basis für die Kostenmiete berechnet. Also derjenige Betrag, der jährlich wiederkehrend zurückgelegt werden müsste, um die entsprechenden Baukosten in der jeweiligen Amortisationszeit zu finanzieren. Für die Berechnung der Kostenmiete müssen zwei Annahmen getroffen werden: Lebensdauer (Amortisationszeit) und Zinssatz. Hier besteht die Möglichkeit, dass die Abschreibungsdauer und die Verwendung des Zinssatzes in Anlehnung an REKOLE® vorgenommen werden, d.h., dass die Baukosten im Verhältnis 65% (Anlagekategorie A1An mit einer Abschreibungsdauer von 33 1/3 Jahren) zu 35% (Anlagekategorie C1 mit einer Abschreibungsdauer von 20 Jahren) aufgeteilt sowie jeweils mit einer Verzinsung von 3.7% kalkuliert werden.
Der Nachteil dieser Berechnung ist jedoch, dass die Kostenmieten in der Regel höher ausfallen, als wenn die Abschreibung auf mehr als nur zwei Baukostenpositionen mit entsprechend unterschiedlichen Lebensdauern und einem marktorientierten Zinssatz berechnet werden.
Wenn die Kostenmiete bestimmt ist, darf die Finanzierung bzw. die Verzinsung des Landwertes nicht vergessen werden. Die Verzinsung des Landwertes geschieht ebenfalls mit Vorteil in Anlehnung an VKL mit 3.7%.
Die nächste Herausforderung stellt sich in der Bestimmung des massgebenden Landwertes. Oft ist dieser nicht bekannt oder der bilanzierte Landwert widerspiegelt nicht jenen Wert, welcher im Markt erzielt werden könnte. In diesem Fall muss dieser auf der Basis von Vergleichswerten bestimmt werden, welche bei Parzellen in der öffentlichen Bauzone oft nicht vorliegen. Alternativ kann der Landwert mit Hilfe einer Rückwärtsrechnung aus den Gebäudeneubaukosten (Marktwert minus Gebäudeneubaukosten = Landwert) hergeleitet werden.
TragbarkeitEine Kostenmiete hat den grossen Vorteil, dass die effektiven Baukosten als Basis genommen und somit finanziert werden. Weil sich die Kostenmiete direkt an die Baukosten anlehnt, ergeben hohe Baukosten eine entsprechend hohe Kosten
miete. Es fehlt somit eine marktorientierte Betrachtung.
Die auf die beschriebene Weise kalkulierte Kostenmiete muss darum in jedem Fall ins Verhältnis zum Ertrag gesetzt werden, so dass deren Tragbarkeit geprüft werden kann. Dies kann mit Hilfe einer vereinfachten Kontrollrechnung erfolgen, indem die Kostenmiete ins Verhältnis zum Umsatz oder Gewinn gesetzt wird. Die Kostenmiete muss jedoch in jedem Fall nachhaltig durch den Cashflow gedeckt sein.
ZukunftViele Spitäler stehen vor wichtigen Investitionsentscheidungen. Eine Marktwertbeurteilung wird in Zukunft daher einen immer höheren Stellenwert einnehmen und ist eine wichtige Grundlage für die Gespräche mit den Finanzierungspartnern. Nebst reinen Finanzierungsfragen können auf Basis einer Mietwertbestimmung auch strukturelle Fragen (Immobiliengesellschaft / Betriebsgesellschaft mit Eigenmietmodellen) mit dem Ziel einer erhöhten Führungseffizienz geklärt werden. VKL und REKOLE® basieren im Falle eines Mietverhältnisses auf der verrechneten Miete als Grundlage für die Herleitung der Anlagenutzungskosten (VKL Art. 8, Abs. 2).
Beat OchsnerSenior ManagerHead Valuation Real EstateKPMG AG Zürich T: +41 58 249 29 40E: [email protected]

Healthcare Check-up / Februar 201410 | Vernetzte Zukunft
Sicher in die vernetzte Zukunft – Bedeutung einer effektiven IT-Strategie
Heutige Vernetzung mit geringem NutzenWir kennen heute eine Vielzahl unterschiedlicher Vernetzungsformen, die uns das Leben erleichtern sollen. Mit eHealth wird eine vollständige Integration aller Beteiligten – vom Lieferanten über die Ärzte und den Versicherer bis zum Konsumenten – in die internen Prozesse angestrebt. So existieren bereits heute Spitalverbunde, Kooperationen mit vor und nachgelagerten Leistungserbringern, Zuweiser und Patientenportale, Einkaufsgemeinschaften und OnlinePlattformen zur Kommunikation zwischen Arzt und Patient.
In Zukunft werden alle Beteiligten im Gesundheitswesen miteinander vernetzt sein. Es entstehen dadurch ungeahnte Chancen für künftige Unternehmensmodelle und Prozesse. Diese Vernetzungsformen scheinen auf den ersten Blick mehrheitlich Vorteile zu bieten (Mehrwert für Kunden, Firmen und Mitarbeiter). Der Nutzen, vor allem im Bereich der Geschäftsprozesse, hält sich aufgrund fehlender Integration von Prozessschritten heute noch stark in Grenzen. Eine solche Vernetzung birgt jedoch auch erhebliche Risiken. So wird vielerorts die Informationssicherheit vernachlässigt, unerkannte Datenlecks und «Backdoors» werden nicht erkannt. Aktuelle Studien zeigen, dass jeder dritte Schweizer ernsthaft besorgt ist, dass seine Daten in fremde Hände gelangen. Ebenso stellen nicht geklärte Fragen der Zusammenarbeit, wie beispielsweise hinsichtlich des Datenschutzes, und die zunehmende Komplexität der ITInfrastrukturen Herausforderungen dar, die künftig gemeistert werden müssen.
Die grösste Herausforderung ist und bleibt jedoch die Integration und Vernetzung der Geschäftsprozesse.
Reduktion von Kommunikationsfeh-lern als prioritäre HerausforderungDie aktuellen Anforderungen an Ärzte, Spitäler, Kostenträger und Patienten liegen in den Bereichen der Reduktion von Kommunikationsfehlern auf allen Stufen, der schnelleren Informationsweitergabe intern und extern, der Vereinfachung der Administration und im Zugriff auf aktuelle Daten. So ist es nicht weiter erstaunlich, wenn die gesellschaftlichen Veränderungen auch einen erheblichen Einfluss auf die bestehende Vernetzung haben werden.
Technologische Entwicklung: Vision oder schon Realität?Der technologische Wandel in den letzten Jahren wird einem erst verdeutlicht, wenn man auf ältere Bilder von Spitälern schaut. Auf allen Ebenen haben inzwischen technische Mittel Einzug gehalten und vereinfachen die täglichen Arbeitsabläufe.
Futuristisch anmutende Neuerungen wie dreidimensionale Drucker oder interaktive Linsen lassen nur erahnen, welche technischen Möglichkeiten in Zukunft auf uns zukommen und welche Auswirkungen diese auf die Arbeitsprozesse haben werden.
Permanente Auseinandersetzung zwischen technischen Möglich-keiten und SicherheitsbedenkenBriefe und Faxe verlieren täglich an Bedeutung, und SocialMediaKomponenten sind allgegenwärtig. Nicht
selten werden Informationen aus SocialMediaAnwendungen auf dem Markt angeboten und verkauft. Bereits ein Siebtel der Weltbevölkerung ist in einem oder mehreren sozialen Netzwerken aktiv und es ist eine rasante Zunahme von Apps auch im Gesundheitswesen zu verzeichnen. Einige der heutigen Patienten und Zuweiserportale sind bereits mit Facebook verbunden.
In gewissen Ländern, wie den USA und Brasilien, werden Gesundheitstipps so bereits regelmässig ausgetauscht und dadurch auch persönliche Informationen preisgegeben. Der Verzicht auf Privatsphäre wird dabei aber bewusst in Kauf genommen.
In Brasilien ist sogar ein klarer Kulturwandel im Umgang mit mobilen Lösungen erkennbar: Die persönliche Gesundheitssituation wird regelmässig gemessen, um Diagnoseinformationen zu erhalten. Aktuell wird sogar daran gearbeitet, dass die persönlichen Daten an eine Gesundheitsplattform übermittelt werden und im Gegenzug Energiemodelle, Schlafhinweise und Ernährungstipps zurückgemeldet werden. Bei Abweichungen wird ein sofortiger Alarm an den Träger des Geräts transferiert (Health Living). Eine Verschmelzung mit eHealth ist nur eine Frage der Zeit, was zur totalen Vernetzung von Spital, Praxis und Patient führen wird.
Cyberkriminalität und die Rolle staatlicher InstitutionenAufgeschreckt durch die aktuellen Machenschaften, die SnowdenAffäre sowie die intransparente Rolle von
Wo führen Facebook, Apps und mobile Geräte in Zukunft hin? Wird das Gesundheitswesen ebenso wie andere Branchen der totalen Vernetzung ausgeliefert sein, und werden Datenschutz und Informationssicherheit überhaupt noch gewährleistet werden können? Welchen Einfluss haben die aktuellen Trends auf Ihre Geschäftsprozesse und letztendlich auf die ITStrategie?

Februar 2014 / Healthcare Check-up Vernetzte Zukunft | 11
Geheim und Nachrichtendiensten werden sowohl Private als auch Unternehmen stark verunsichert und manch einer fragt sich, wie sicher seine persönlichen Daten, vor allem auch im Gesundheitsbereich, sind.
Mit der zunehmenden Angreifbarkeit von Infrastrukturen und ITLösungen steigt aber auch die Sensibilität der Menschen und nicht jedermann ist bereit, seine persönlichsten Daten preiszugeben.
Die totale Vernetzung als Konsequenz der EvolutionDurch die immer grösser werdende Vernetzung werden sich im Gesundheitswesen die Landesgrenzen öffnen. In Grossbritannien führen die starke Verschmelzung von mobilen Lösungen mit SocialMediaKomponenten und der rasant wachsende Markt bereits heute zum starken Vormarsch von Telehealth (remote Diagnose, remote Intervention).
Im amerikanischen Gesundheitsmarkt sind hingegen vollintegrierte modulare Applikationslösungen aus einer Hand, hochautomatisierte Schnittstellen und
papierlose Prozesse auf dem Vormarsch.
Big Data: Umgang mit riesigen DatenmengenDie exponentielle Zunahme der Daten in verschiedenen Formen (Bilder, Berichte, Forschungsergebnisse, Untersuchungen) sowie die vielfältigen Informationen aus allen möglichen Systemen stellen uns vor bisher unbekannte Herausforderungen.
Zukunftsforscher prophezeien, dass in Zukunft die Daten die heutige Rolle des Öls als umkämpftes Gut übernehmen werden. Gerade im HealthcareBereich werden gewaltige Daten und Bildmengen verarbeitet, um den Hunger des globalen GesundheitsNetzwerks zu stillen. Ein professionelles Datenmanagement ist daher unerlässlich.
Nachhaltiger Unternehmenserfolg durch aktuelle IT-Strategien Auch wenn die treibenden Kräfte des Internets und der Vernetzung von der Informatik / TechnologieEbene aus kommen, müssen in einem ersten Schritt die neuen Geschäftsmodelle auf der Führungsebene in einer
Geschäftsstrategie verankert werden. Dies bedingt ein radikales Umdenken und das Definieren neuer Angebote, Märkte und Produkte. Das Unternehmen rüstet sich damit für die künftigen Trends und Veränderungen. Sämtliche Prozesse im Gesundheitswesen werden sich vermehrt auf den Patienten als Kunden sowie auf die neuen Technologien ausrichten. Vollständig ITunterstützte Geschäftsprozesse werden entstehen und die traditionellen Abläufe der Medizin beeinflussen. Für den wirtschaftlichen Erfolg des Gesundheitswesens ist der effiziente Einsatz der eigenen Ressourcen von zentraler Bedeutung. Entsprechend sind ITInvestitionen und die Organisation an einer dem Bedarf angepassten ITStrategie auszurichten.
FazitDie gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen zeigen deutlich, dass eine auf die Zukunft ausgerichtete IT einen unerlässlichen Faktor darstellt, um unser Gesundheitswesen effektiver, effizienter, transparenter und nachhaltig zu gestalten, Ausgaben zu optimieren und die Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt zu stellen.
Philip FerberSenior ManagerCIO AdvisoryKPMG AG ZürichT: +41 58 249 41 96E: [email protected]

Healthcare Check-up / Februar 201412 | Leistungsangebot
Leistungsangebot: Von der Strategie zur Abbildung im Reporting
Was sind die zentralen Herausforderungen?Der Businessplan hat sich als zentrales Element sowohl zur Spitalfinanzierung als auch zur Langfristplanung im Unternehmen etabliert. Banken legen bei der Kreditvergabe Wert auf eine starke Eigenkapitalbasis und eine realitätsnahe Bewertung des künftigen Geschäftsganges. Als Mindestanforderung fordern Banken deshalb eine solide Strategie und einen Businessplan über mehrere Jahre, der verschiedene Szenarien aufzeigt.
In der Gesundheitsbranche herrscht Optimismus. Es wird Wachstum prognostiziert und alle Spitäler wollen daran
Das Gesundheitswesen ist für Banken Neuland. Zur eigenen Absicherung und zur Finanzierung von Spitalbauten ist daher ein solider Businessplan gefragt. Doch welche Bestandteile muss dieser enthalten und wer ist an diesem Strategiepapier beteiligt? Wer das betriebswirtschaftliche Verständnis und das Commitment zum eigenen Unternehmen fördern will, muss die Leistungserbringer in den Strategieprozess einbinden. Für die fachspezifische Leistungsentwicklung braucht es valide eigene Zahlen und Kenntnisse des Marktumfeldes.
1 Average Length of Stay (mittlere Aufenthaltsdauer)2 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken)
Stärken Versierte, initiative Ärzteschaft Effiziente Prozessabläufe im OP Hoher Anteil zusatzversicherter Patienten
Schwächen Wenige externe Zuweiser Zahlreiche Abstimmungsprobleme im medizintechnischpflegerischen Bereich
Zu viele Lieferanten als Folge der Einkaufspolitik, im Benchmark zu teure Implantate
Chancen Hohes Bevölkerungswachstum im Einzugsgebiet
Zunehmender Bedarf an Revisionseingriffen
Neue Kooperationsmöglichkeiten mit Reha XY
Zusätzliche Gewinnung von Belegärzten
Risiken Mitbewerber baut neue Infrastruktur
Aktive Abwerbung von Ärzten Mangelndes Anreizsystem für Ärzte (hohe Abgaben im Zusatzversicherungsbereich)
Beispiel einer SWOT-Analyse
IST 2012 PLAN 2013 PLAN 2014 PLAN 2015 PLAN 2016 PLAN 2015Anzahl Fälle 805.00 835.00 855.00 885.00 905.00 925.00CMI 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03CM 829.15 860.05 880.65 911.55 932.15 952.75Baserate 9’460.00 9’460.00 9’460.00 9’460.00 9’460.00 9’460.00Erlös -7’843’759.00 -8’136’073.00 -8’330’949.00 -8’623’263.00 -8’818’139.00 -9’013’015
EK Implantate 1’168’860.00 1’212’420.00 1’241’460.00 1’285’020.00 1’314’060.00 1’343’100.00EK Medikamente 400’890.00 415’830.00 425’790.00 440’730.00 450’690.00 460’650.00EK Material 314’755.00 326’485.00 334’305.00 346’035.00 353’855.00 361’675.00EM med. Fremdleistungen 762’335.00 790’745.00 809’685.00 838’095.00 857’035.00 875’975.00DB I -5’196’919.00 -5’390’593.00 -5’519’709.00 -5’713’383.00 -5’842’499.00 -5’971’615.00./. Verrechnungen LE KST 1’804’810.00 1’872’070.00 1’916’910.00 1’984’170.00 2’029’010.00 2’073’850.00DB II -3’392’109.00 -3’518’523.00 -3’602’799.00 -3’729’213.00 -3’813’489.00 -3’897’765.00./. Umlagen DL KST 624’680.00 647’960.00 663’480.00 686’760.00 702’280.00 717’800.00DB III -2’767’429.00 2’870’563.00 -2’939’319 -3’042’453.00 -3’111’209.00 -3’179’965.00./. ANK Anlagenutzung 2’537’360.00 2’631’920.00 2’694’960.00 2’789’520.00 2’852’560.00 2’915’600.00Ergebnis -230’069.00 -238’643.00 -244’359.00 -252’933.00 -258’649.00 -264’365.00
Beispiel: Plan-DeckungsbeitragsrechnungCube: HCC_TIP.KTR_MCO aufbereitet am: 10.03.2011
teilhaben. Oftmals fehlen aber Antworten auf die Frage, in welchen Fachbereichen das Unternehmen Wachstum anstreben will. Um diese Frage beantworten zu können, ist es unumgänglich, die Fachbereichsverantwortlichen in den Strategiebildungsprozess einzubinden. Ein Businessplan stiftet dann Mehrwert, wenn er Aussagen über die zukünftige Entwicklung der medizinischen Fachgebiete zulässt.
Welche Datenanalysen sind für einen Businessplan hilfreich?Grundlage für jeden Businessplan sind valide Daten. Das Controlling unterstützt dabei die Fachbereichsverantwortlichen mit der Bereitstellung der notwendigen

Februar 2014 / Healthcare Check-up Leistungsangebot | 13
und Risiken sind vertrauensfördernd für Entscheider und Finanzierer.
Ein fachspezifischer Businessplan umfasst im Kern die gleichen Themen wie ein bereichsübergreifender Businessplan. Es ist aber darauf zu achten, dass sämtliche Aspekte auf den medizinischen Fachbereich Bezug nehmen. Untenstehend eine Auflistung der wichtigsten Inhalte eines Businessplans am Beispiel der Orthopädie: Management Summary Ausgangslage Gesundheitsmarkt Orthopädie – Demografische Entwicklung, Hospitalisationsrate, Bedarf (Basis Spitalplanung und eigene Beobachtungen)
Mitbewerber – Marktanteile, Strategien, Spezialisierungen
Eigenes Leistungsangebot Orthopädie heute – Eigene Daten (Fälle, Marktanteile, DRGs, CM, CMI, ALOS, Fallkosten, Inlier / Outlier, Spezialitäten, VVGAnteil etc.), Kooperationen, Spezialisierungen
SWOTAnalyse Strategie – z.B. Aufbau OsteoporoseZentrum, Kooperation / Vernetzung mit Rehabilitationskliniken, Zuweiserstrategie
Investitionen Ressourcen – Personalbedarf, OPKapazitäten
Ergebnisberechnungen – Szenarien Meilensteine
Die Ergebnisberechnungen in Form verschiedener Szenarien (z.B. Real Case, Best Case und Worst Case Szenario) kann beispielsweise in Form einer PlanDeckungsbeitragsrechnung über mehrere Jahre dargestellt werden (vgl. Abbildung unten).
Damit der Businessplan nicht zum Papiertiger wird, ist die PlanDeckungsbeitragsrechnung als Instrument für das strategische und operative Controlling zu verwenden. Die PlanDeckungsbeitragsrechnung schafft die nötige Grundlage für die Ergebnisanalyse in einem bestimmten Fachbereich. Mit Hilfe eines jährlichen SollIstVergleich können Ergebnisabweichungen analysiert und daraus Massnahmen abgeleitet werden.
Welcher Nutzen ergibt sich daraus?Es ist keine Frage, das Gesundheitswesen ist ein Wachstumsmarkt mit Chancen und Risiken. Damit ein in diesem Markt operierendes Unternehmen von diesem Wachstum profitieren kann, ist eine gezielte und fachspezifische Auseinandersetzung mit der eigenen Organisation und mit dem Markt unumgänglich. Die SWOTAnalyse bietet hier einen strukturierten Ansatz. Voraussetzung für die Durchführung einer SWOTAnalyse ist die rasche Verfügbarkeit von Daten in der gewünschten Qualität.
Der Einbezug der Leistungserbringer, d.h. des medizinischen Personals, erhöht das betriebswirtschaftliche Verständnis und das Commitment der Beteiligten. Nur so können fundierte Aussagen auf Fachbereichsebene gemacht und Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden, die es erlauben, den Erfolg in einem bestimmten Fachbereich zu messen.
IST 2015 PLAN 2015 Abweichung % Abweichung absAnzahl Fälle 903.00 885.00 2.03 18.00CMI 1.03 1.03 1.03 1.03CM 930.09 911.55 2.09 18.54Baserate 9’460.00 9’460.00 9’460.00 9’460.00Erlös -8’798651.00 -8’623263.00 2.03 175’388.00
EK Implantate 1’195’376.00 1’285’020.00 6.98 89’644EK Medikamente 465’083.00 44’730.00 5.53 24’353EK Material 313’830.00 346’035.00 9.31 32’205.00EM med. Fremdleistungen 849’354.00 838’095.00 1.34 11’259.00DB I -5’975’008.00 -5’713’383.00 4.58 261’625.00./. Verrechnungen LE KST 2’035’093.00 1’984’170.00 2.57 50’923DB II -3’939’915.00 -3’729’213.00 5.65 210’702.00./. Umlagen DL KST 693’038.00 686’760.00 0.91 6’278.00DB III -3’246’877 -3’042’453.00 6.72 204’424.00./. ANK Anlagenutzung 2’854’703.00 2’789’520.00 2.34 65’183.00Ergebnis -392’174.00 -252’933.00 55.05 139’241.00
Beispiel: Kostenträger inkl. Vorschau DRG 13OZ / Fachgebiet OrthopädieCube: HCC_TIP.KTR_MCO aufbereitet am: 10.03.2011
André ZempLeiter Advisory Healthcare KPMG AG Zürich T: +41 58 249 28 98E: [email protected]
Daten. Der erste Schritt kann in der Durchführung einer PortfolioAnalyse in den relevanten Fachgebieten, z.B. Orthopädie, bestehen. Die Portfolio Analyse zeigt die fallzahlmässig wichtigsten DRGs, die in einem bestimmten Betrachtungszeitraum im Spital behandelt wurden. Die Analyse der Herkunft der Patienten lässt Rückschlüsse über das Einzugsgebiet des Spitals und die Bedeutung des Spitals für die Region zu. Diese Daten werden auch zum gezielten Zuweisermanagement herangezogen. Aus der Auswertung von Inlier und Outlier sowie der ALOS1 Analyse können Rückschlüsse auf die Prozesseffizienz gezogen werden. Das OPControlling unterstützt diese Analyse zusätzlich, z.B. mit Auswertungen der SchnittNahtZeit.
Die beispielhaft aufgelisteten Bestandteile der Datenanalyse auf Fachgebietsebene bilden die Basis für die Durchführung einer SWOT2 Analyse (vgl. Abbildung links). Die SWOTAnalyse ist integraler Bestandteil eines Businessplans, weil sie aus der gezielten Auseinandersetzung mit dem eigenen Unternehmen und den aktuellen Ent wicklungen im Markt hervorgeht. Die SWOTAnalyse soll keine Pauschalaussagen enthalten, sondern fundierte Inhalte, die sich aus der Datenanalyse ableiten und mit Zahlenmaterial untermauern lassen. Die kritische Auseinandersetzung sowohl mit seinen Stärken und Schwächen als auch den Chancen

Healthcare Check-up / Februar 201414 | Erfahrungen aus Deutschland
Der E-Patient: Was kommt da auf das Gesundheitswesen zu?
Die Arzt-Patienten-Kommunikation wird immer wichtiger. Das Informationsverhalten der Patientinnen und Patienten ändert sich rasant. Schon jetzt ist bei Personen der Altersgruppe 18 bis 39 Jahre das Internet die zweithäufigste Informationsquelle. Begriffe wie «EPatient» oder «Patient 2.0» machen die Runde.2 Allerdings: Auch der geschulte Blick ins Internet kann ein fundiertes Medizinstudium und die lange medizinische Praxis des Arztes nicht ersetzen.
Der EPatient tritt Ärzten und Krankenhäusern deutlich anders gegenüber als ein schlecht oder gar nicht informierter Patient. Die Frage ist daher nicht, ob ein solcher Patient wirklich ausreichend und richtig informiert ist. Entscheidend ist vielmehr, wie der Arzt beziehungsweise das Personal der Gesundheitseinrichtung mit diesem Patienten umgeht. Anstatt das (Halb)Wissen des Patienten zu ignorieren und ihm damit zu verstehen zu geben, dass sein Wissen nicht wert sei, vom Arzt überhaupt berücksichtigt zu werden, scheint es zielführender, den Patienten dabei zu unterstützen, sich in der Vielfältigkeit der Onlineinformationen unterschiedlicher Qualität zurechtzufinden.
Die ärztliche Ausbildung beschäftigt sich bis heute zu wenig mit Kommuni
kation. Nur allmählich wird in Lehre und Praxis akzeptiert, dass Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil der ärztlichen Qualifikation ist, ja in Zukunft sogar ein entscheidender Erfolgsfaktor sein wird. Immerhin: Die Approbationsordnung erhebt die ärztliche Gesprächs führung erstmals im Jahr 2012 zum Gegenstand der ärztlichen Ausbildung.
Zunehmend wichtiger wird es, mit dem Patienten dauerhaft zu kommunizieren. Daher empfiehlt es sich in vielen Fällen, auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus die Beziehung zum Patienten aufrechtzuerhalten. Eine solche ganzheitliche Kommunikation muss natürlich im Vergütungssystem der niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser eine adäquate Berücksichtigung finden. Dies ist derzeit nicht der Fall: Im ambulanten Bereich wird das Patientengespräch verhältnismässig gering vergütet und im stationären Bereich erfolgt bislang gar keine separate Vergütung.
Der E-Patient kennt seine Rechte und setzt sie durch Der EPatient wird seine Rechte kennen und konsequent durchsetzen. Dafür sorgen allein schon die zahlreich vorhandenen und nach Betätigung suchenden Fachanwälte für Medizinrecht.
Derzeit wird in Deutschland erstmalig ein zusammenhängendes Patientenrecht geschaffen. Dieses hinkt zwar noch immer den allgemeinen Erwartungen hinterher. Aber ein Anfang ist gemacht. Sowohl für niedergelassene als auch Krankenhausärzte wird es immer wichtiger, rechtssicher zu behandeln. Für sie wird es beispielsweise zunehmend erforderlich, Behandlungsabläufe so zu dokumentieren, dass im Fall von Schadenersatzklagen ein lückenloser Nachweis vorhanden ist. Die meisten Arztprozesse scheitern vor Gericht aufgrund unzureichender Dokumentationen.
Ebenfalls essenziell: Im Fall einer Fehlbehandlung sollten der Arzt und das Krankenhaus die richtige Form der Kommunikation zum betroffenen Patienten finden. So kann zum einen unter Umständen auf dem Vergleichswege einem langwierigen und teuren Gerichtsverfahren vorgebeugt werden und zum anderen ein potenzieller Reputationsverlust vermieden werden.
Wie schnell kommt der E-Patient? Durch das Internet und andere moderne Medien gibt es für die meisten Menschen die Möglichkeit, preiswert und schnell mehr und bessere Informationen zu bekommen. Hierdurch ergibt sich ein rasanter Schub hin zum mündigen Patienten. Gleichzeitig gibt es aber auch viele hemmende Faktoren.
Eine gute Kommunikation zwischen Arzt und Patient kann wesentlich zum Behandlungserfolg beitragen. In der Alltagspraxis bestehen hier allerdings noch erhebliche Defizite. So erachteten in einer Studie der Akademie für Technikfolgenabschätzung in BadenWürttemberg aus dem Jahr 2001 beispielsweise 93 Prozent der befragten Patientinnen und Patienten eine umfassende und verständliche Information seitens des Arztes als sehr wichtig. Gleichzeitig entsprachen ihrer Einschätzung nach jedoch nur knapp 30 Prozent der Ärzte adäquat diesem Wunsch.1
1 Winand Gellner, Michael Schmöller (Hg.), Neue Patienten – Neue Ärzte?, Nomos Verlagsgesellschaft 20082 Gesundheitsberichterstattung – GBE kompakt, April 2011

Februar 2014 / Healthcare Check-up Erfahrungen aus Deutschland | 15
Prof. Dr. Volker PenterLeiter Healthcare DeutschlandKPMG AG, Berlin T: +49 30 20684740E: [email protected]
nehmen kann. Der Prozess könnte allerdings auch kurzfristig durch bestimmte Faktoren beschleunigt werden. Beispiele sind:
Beschleunigende Faktoren 1. Ein oder mehrere grosse Gesund
heitsdienstleister (zum Beispiel grosse flächendeckend agierende Krankenhausketten, Krankenversicherungen) erkennen den EPatienten als einen Wettbewerbsvorteil und informieren ihre Patienten besonders gut. Andere Patienten könnten dann auch so gut informiert sein wollen.
2. Es entwickelt sich eine einheitliche Informationsplattform auf der Grundlage einer privaten Idee und Initiative – so eine Art Facebook für das Gesundheitswesen.
3. Ausländische Investoren erkennen die Chancen einer neuen Kommunikationskultur im deutschen Gesundheitswesen und bringen innovative Ideen nach Deutschland.
4. Die Politik erkennt das Thema in seiner wahren Bedeutung und greift regulierend ein.
Die Zukunft des mündigen Patienten hat begonnen. Dies sollten wir alle erkennen. Im Vorteil sind diejenigen, die heute bereits danach handeln.
Hemmende Faktoren 1. Nach wie vor sind die Akteure des
deutschen Gesundheitswesens zu wenig von sich aus an einem mündigen Patienten interessiert. Man reagiert, propagiert, aber kaum einer treibt den Prozess des mündigen Patienten konsequent voran.
2. Vor allem ältere Patientinnen und Patienten werden sich mit den modernen Medien nicht in vollem Umfang auseinandersetzen. Für viele von ihnen sind Ärzte noch immer die «Halbgötter in Weiss».
3. Viele Patienten beschäftigen sich nicht wirklich aktiv mit ihrer Gesundheit, sondern folgen – wenn überhaupt – den Anweisungen der Ärzte. Patienten sind häufig nicht bereit, wirklich Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen.
4. Und nicht zu vergessen: Es gibt Krankheiten, die Menschen so weit beeinträchtigen, dass sie – wenn von der Krankheit betroffen – nur noch eine eingeschränkte oder gar keine aktive Rolle einnehmen können.
Daher wird man davon ausgehen können, dass es den EPatienten zwar zunehmend geben wird, dies aber auch einen längeren Zeitraum in Anspruch

Healthcare Check-up / Februar 201416 | OECD-Gesundheitsbericht
Gesundheit auf einen Blick – die Schweiz im OECD-Gesundheitsbericht 2013
Abnahme der Anzahl Betten Die Anzahl Spitalbetten pro 1‘000 Einwohner hat sich im OECDDurchschnitt seit dem Jahr 2000 von 5.6 auf 5.0 reduziert. Als Ursache für diese Entwicklung wird der medizinische Fortschritt gesehen, der es möglich macht, mehr Menschen ambulant statt stationär zu behandeln. Etwa 70% der Betten in den OECDLändern sind Akut spitalbetten.
Die Schweiz liegt mit etwas weniger als 5 Spitalbetten pro 1‘000 Einwohner ähnlich wie die Niederlande im Mittelfeld. Während sich dort die Anzahl Betten zwischen 2000 und 2011 kaum verändert hat, wurde die Anzahl Spitalbetten in der Schweiz um 2 Betten pro 1’000 Einwohner reduziert. Unser Nachbarland Deutschland hingegen, dessen Gesundheitssystem seit Einführung der DRGs verstärkt mit demjenigen der Schweiz verglichen wird,
liegt 2011 mit 9 (statt 8 im Jahr 2000) Betten deutlich über dem Durchschnitt.
Reduktion der mittleren Aufent-haltsdauer im Spital In einigen Ländern hat sich auch die ALOS1 reduziert. Im Durchschnitt liegt diese nicht mehr bei 9.2 Tagen, sondern gemäss den Zahlen von 2011 bei 8 Tagen. Nicht nur die Schweiz, sondern auch Japan und Grossbritannien zählten lange zu den Ländern mit vergleichsweise langen Aufenthaltsdauern im Spital. Auch 2011 lag die ALOS aller Fälle in Schweizer Spitälern mit ca. 9 Tagen am oberen Ende der Skala. Interessant ist zudem eine differenziertere Betrachtung: Bei Geburten liegt die Schweiz 0.9 Tage über, bei Myokardinfarkten hingegen 0.2 Tage unter dem Durchschnitt. Seit 2000 ist die ALOS in Schweizer Spitälern um vier Tage gesunken.
Einfluss der Fallpauschalen - systeme (DRGs)Die Tendenz der sinkenden ALOS lässt sich unter anderem auf den Wechsel zu DRGSystemen oder ähnlichen Finanzierungssystemen in einer zunehmenden Anzahl Länder wie die Schweiz, Deutschland, Polen und Frankreich zurückführen. Fallpauschalen setzen einen klaren Anreiz zur Reduktion der Aufenthaltsdauer, um damit die Fallkosten zu reduzieren. In der Schweiz wurden die Swiss DRGs erst per Januar 2012 eingeführt.
Mengenausweitung?!Ein weiterer und gefürchteter Effekt von Fallpauschalen ist die Mengenausweitung. Interessanterweise werden teure Operationen, die einen hohen Anteil am Kostenwachstum haben, wie etwa der Einsatz künstlicher Hüft oder Kniegelenke, in den DRGLändern Deutschland und Schweiz doppelt so häufig durchgeführt wie im OECDDurchschnitt. Die Schweiz ist Spitzenreiter mit 306 Hüftrevisionen pro 100‘000 Einwohner. Deutschland folgt mit 286, während der Durchschnittswert 2011 bei 160 liegt. Auch in Frankreich und den Niederlanden wurden fast 60 bzw. 70 mehr Hüftrevisionen als im OECDDurchschnitt durchgeführt.
Der neuste OECDGesundheitsbericht «Health at a Glance 2013» bietet einen Einblick in die Entwicklungen und Einflüsse im Gesundheitswesen der OECDStaaten. Die Schweiz schneidet im Bereich Qualität überdurchschnittlich gut ab. Im Bereich der Gesundheitsausgaben zeigt sich hingegen, dass diese Qualität ihren Preis hat. Der Bericht macht ausserdem auf den besorgniserregenden Mangel an Allgemeinärzten in fast allen OECDLändern aufmerksam.
1 Average Length of Stay (mittlere Aufenthaltsdauer)

Februar 2014 / Healthcare Check-up OECD-Gesundheitsbericht | 17
Ärztliche GrundversorgungEin Aspekt der OECDQualitätsmessungen fokussiert auf die ärztliche Grundversorgung, z.B. durch niedergelassene Haus und Fachärzte, die unter anderem chronisch Erkrankte dauerhaft betreuen und entscheiden, wann eine Spitalbehandlung notwendig ist. Die Qualität der Grundversorgung ist ein wichtiger Pfeiler in Gesundheitssystemen, da er die hohen Kosten, welche die stationären Aufenthalte verursachen, abfangen kann. Die Schweiz liegt z.B. mit dem Anteil Spitaleintritte von Asthma und Diabetes Erkrankten – zwei der häufigsten chronischen Erkrankungen – weit unter dem OECDDurchschnitt, was auf eine gute ambulante Betreuung hinweist.
Lebenserwartung und GesundheitszustandDieses gute Ergebnis ist auch im Zusammenhang mit einer hierzulande sehr hohen Lebenserwartung und einem guten Gesundheitszustand der Bevölkerung (gemäss Selbsteinschätzung von 81.3%) zu sehen. In der Schweiz liegt die Lebenserwartung bei 82.8 Jahren. Somit können die Schweizer – rein statistisch – mehr als 2 Jahre älter werden, als die Einwohner aller anderen OECDLänder. Insgesamt ist die Lebenserwartung in allen Mitgliedsstaaten in den vergangenen Dekaden gestiegen.
Zufriedenheit mit der ambulanten Versorgung Die Messung der Patientenzufriedenheit hat seit Mitte der 90er Jahre in fast allen OECDLändern an Bedeutung gewonnen. In der Schweiz ist diese Bestandteil der jährlichen nationalen Qualitätsmessungen durch den ANQ2.
In den OECDMessungen liegt die Schweiz 2010 in drei von vier abgebildeten Zufriedenheitskriterien unter den Top 4: Verständlichkeit des Arztes, Möglichkeiten, Fragen zu stellen oder Bedenken zu deponieren, und Involvieren des Patienten bei Entscheidungen.
Seit der Einführung der DRGs kann in der Schweiz nochmals eine verstärkte Verschiebung von medizinischen Leistungen aus dem stationären in den vorgelagerten ambulanten Bereich beob
achtet werden. Die Qualität und die Sicherung der ambulanten Versorgung haben somit weiter an Bedeutung gewonnen.
Komplikationsraten bei operativen EingriffenKomplikationsraten im OP sind ein wichtiger Indikator für Qualität und Patientensicherheit. Die OECDStudie vergleicht unter anderen das Auftreten postoperativer Lungenembolien oder Venenthrombosen. Die Schweiz schneidet mit 500 Komplikationsfällen auf 100‘000 Spitalaustritte, d.h. 0.5%, überdurchschnittlich gut ab.
Geringeres Wachstum der GesundheitsausgabenSeit 2008 ist die jährliche Wachstumsrate der Gesundheitsausgaben pro Kopf in fast allen OECDLändern von 4.1% auf 0.2% im Durchschnitt gesunken. Hintergrund ist die Wirtschaftskrise, die sich in stark betroffenen Ländern wie Griechenland und Island besonders deutlich auf die Gesundheitsausgaben ausgewirkt hat: Um 11% sind die Gesundheitsausgaben in Griechenland und um 6% in Island zwischen 2009 und 2011 gekürzt worden. In der Schweiz zeichnet sich dieser Trend nicht ab; zwischen 2000 und 2009 sowie 2009 und 2011 haben sich die jährlichen Wachstumsraten kaum verändert (0.5%).
Schweizer Qualität hat ihren PreisBetrachtet man die Gesundheitsausgaben pro Kopf, sind nur die Gesundheitssysteme der USA und Norwegens teurer als jenes der Schweiz. Somit gab die Schweiz 2011 mit 5’643 USDollar pro Kopf etwa ein Drittel mehr aus für Gesundheitsleistungen als der OECDDurchschnitt, aber immer noch ein Drittel weniger als die USA. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt die Schweiz – seit 2003 fast unverändert – mit 11.0% auf Platz sechs im OECDRanking. Der Durchschnitt liegt jedoch bei 9.3%. In der Schweiz ist gleichzeitig auch das Einkommensniveau gestiegen, so dass die hohen Ausgaben finanziert werden können.
Bricht man die durchschnittlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf herunter, wird ein Schweizer Einwohner durchschnittlich mit 470 USDollar
2 Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken
«Health at a Glance»Der aktuelle Bericht der OECD zur Gesundheit in den 34 Mitgliedsstaaten bezieht sich auf die OECDStatistiken 2013, die hauptsächlich auf nationalen Daten beruhen. Im Wesentlichen werden die Entwicklungen zwischen den Jahren 2000 und 2011 verglichen.

Healthcare Check-up / Februar 201418 | OECD-Gesundheitsbericht
(d.h. ca. 430 Franken) Prämien resp. Steuerzahlungen monatlich belastet.
Zugang zur GesundheitsversorgungDie obligatorische Krankenversicherung in der Schweiz garantiert strukturell einen Zugang für jedermann zur medizinischen Grundversorgung. Dies allein ist jedoch noch kein ausreichender Indikator für den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Der Umfang der Zuzahlung zur Krankenversicherung bietet weiteren Aufschluss. Stützt sich ein Gesundheitssystem verstärkt auf eine «outofpocket» Finanzierung, verlagern sich die Kosten tendenziell zu jenen, welche die Leistungen verstärkt in Anspruch nehmen.
Hohe Zuzahlungen zur Kranken-versicherung in der Schweiz Im OECDMittel wendet ein Privathaushalt etwa 3.0% des Einkommens für Zuzahlungen für medizinische Versorgung auf. In der Schweiz sind es 3.8%. Die Kostenaufteilung gibt weitere interessante Hinweise: Lediglich in Belgien werden mehr Zuzahlungen für Spitalaufenthalte getätigt. In der Schweiz fliessen mehr als die Hälfte der Zuzahlungen in Spitalbehandlungen und weitere fast 30.0% in Zahnbehandlungen, die von der Grundversicherung nicht abgedeckt werden.
Zunahme der älteren BevölkerungBis zum Jahr 2050 wird in der OECD bei der Bevölkerung älter als 65 ein
Wachstum von 27.0% erwartet. Bei der Bevölkerung älter als 80 liegt die durchschnittliche Wachstumsprognose bei 10.0% und in der Schweiz sogar bei 12.0%. In der Schweiz nehmen mehr als ein Fünftel der 65+ Bevölkerung, bereits Langzeitpflege in Anspruch (20.3%) – davon nur etwa 5.0% zu Hause (z.B. durch die Spitex). Damit sind in der Schweiz fast doppelt so viele ältere Menschen als im OECDDurchschnitt (12.7%) pflegebedürftig.
Zunahme der DemenzerkrankungenDie Anzahl Demenzerkrankungen steigt nicht nur in der OECD, sondern weltweit. Die WHO3 prognostiziert eine Verdoppelung der Erkrankungen bis 2030 und eine Verdreifachung bis 2050. In der Schweiz sind bereits ca.6.5% der Bevölkerung 60+ betroffen.
Steigender Bedarf an PflegefachkräftenGleichzeitig wird bis im Jahr 2050 in der OECD eine Verdoppelung des Bedarfs an Fachkräften für Langzeitpflege erwartet. Diese Entwicklung wird unter anderem durch die Abnahme von Pflege durch Familienmitglieder getriggert – bei einem gleichzeitigen Wachstum der alternden Bevölkerung.
Ärztemangel in der OECDDie Anzahl Ärzte gemessen an der Bevölkerung (pro 1‘000 Einwohner) variiert innerhalb der OECD sehr stark. Die Schweiz und Deutschland liegen mit
3.8 Ärzten pro 1‘000 Einwohner im oberen Drittel – das sind in der Schweiz etwa 30‘400 Ärzte. Mehr als ein Drittel dieser Ärzte ist jedoch bereits 55 Jahre alt, was künftig einen enormen Ärztemangel auslösen wird. Dieser wird vor allem die Hausarztmedizin betreffen, denn diese ist mit weniger als einem Drittel aller Ärzte im OECDDurchschnitt bereits heute unterproportional vertreten.
FazitDer Schweiz wird im aktuellen Gesundheitsbericht der OECD eine gute bis sehr gute Prozess und Strukturqualität bescheinigt. Auch hinsichtlich Patientensicherheit liegt die Schweiz deutlich über dem OECDDurchschnitt. Gleichzeitig wird erneut bestätigt, dass sich die Schweiz eines der weltweit teuersten Gesundheitssysteme leistet und auch leisten will. Die Schweizer Bevölkerung bescheinigt sich selbst einen guten Gesundheitszustand und hat die höchste Lebenserwartung in der OECD. Dies trägt jedoch auch zum Effekt der demografischen Entwicklung bei: Der Anteil der älteren Bevölkerung steigt stetig. Gleichzeitig werden künftig nicht nur verstärkt Ärzte, sondern auch Pflegekräfte gesucht. Diese Herausforderungen gilt es anzugehen, um mit vereinten Kräften aller Anspruchsgruppen und neuen innovativen Ansätzen die qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung zu sichern.
3 World Health Organization
Marc Dominic Widmer Senior ManagerAudit Healthcare KPMG AG Zürich T: +41 58 249 41 24E: [email protected]
Julia FinkenConsultantAdvisory HealthcareKPMG AG ZürichT: +41 58 249 35 62E: [email protected]

Februar 2014 / Healthcare Check-up Internationales | 19
Das Krankenversicherungssystem von Abu Dhabi
Autoren: Mehmet Sait Gunes, Munich Health Daman Holding Ltd., München, und Anja Helbig,National Health Insurance Company – Daman, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Abu Dhabi ist eines von sieben Emiraten, welche sich 1971 als Föderation zusammengeschlossen haben und seitdem auch als die Vereinigten Arabischen Emirate (kurz: VAE) bekannt sind. Die Staatsform der VAE wird vom Auswärtigen Amt Deutschlands als «patriarchalisches Präsidialsystem mit traditionellen Konsultationsmechanismen» definiert. Jedes einzelne Emirat hat eine lokale Regierung und bestimmte Mitglieder der lokalen Regierung übernehmen gleichzeitig eine Rolle innerhalb des Staatsapparates.
Die VAE, deren Gesamtfläche ungefähr der von Österreich entspricht, liegen an der Küste des Persischen Golfes. Sie zählen Katar, Saudi Arabien und Oman zu ihren unmittelbaren Nachbarn. Das Land verfügt mit seinen 7,9 Millionen Einwohnern über die siebtgrössten Ölvorkommen der Welt und ist eine der am weitesten
entwickelten Volkswirtschaften im Nahen Osten. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf für 2012 wird vom Internationalen Währungsfonds (IWF) auf circa 51’000 Euro geschätzt (Deutschland circa 32.500 Euro).
Die VAE sind in den letzten Jahren vor allem durch ihr zweitgrösstes Emirat Dubai bekannt geworden. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die VAE ihren Wohlstand vor allem dem grössten Emirat, Abu Dhabi, zu verdanken haben.
Historische Entwicklung Bis in die Sechzigerjahre hinein gab es im Land nur einfache Bauten, teilweise ohne Elektrizität und Kanalisation. Dementsprechend war auch der Stand der medizinischen Versorgung. Der Beginn der Erdölförderung und die damit einhergehende Prosperität verbunden mit neuen Herausforderungen, änderte dies gravierend.
Die Gründung des föderalen Gesundheitsministeriums in den Siebzigerjahren gab dem Gesundheitswesen einen deutlichen Impuls, die Qualität der Krankenversorgung stieg kontinuierlich. Über mehrere Jahre stellte die Regierung für alle Einwohner gegen eine geringe Jahresgebühr sogenannte Gesundheitskarten aus und übernahm die vollen Behandlungskosten in staatlichen Krankenhäusern. 2001 wurde die «General Authority for Health Services» in Abu Dhabi gegründet, welche durch Reformen im Jahr 2007 in die «Health Authority Abu Dhabi» (HAAD) und die «Abu Dhabi Health Services Company» (SEHA1) aufgeteilt wurde.
Während HAAD als Regulator agiert, leitet SEHA öffentliche medizinische Einrichtungen. Heute ist SEHA mit 13 Krankenhäusern und 40 Einrichtungen für ambulante Behandlungen der grösste öffentliche Dienstleister im Gesundheitswesen. Darüber hinaus
Wenn Dubai in der Region ein Vorreiter für wirtschaftlichen Aufschwung ist, so ist es Abu Dhabi in Sachen Krankenversicherung. Verglichen mit den anderen Emiraten ist die Qualität, Effizienz sowie die flächendeckende Absicherung der Bevölkerung einzigartig. Die Unterschiede sind insbesondere auf die politische Autonomie in jedem Emirat zurückzuführen. Vor allem die unterschiedlichen Auffassungen zur Ausstattung und Implementierung auf Landesebene haben bisher die Einführung eines einheitlichen Krankenversicherungssystems verhindert.
1 «Seha» ist das arabische Wort für Gesundheit.
Indikatoren des Gesundheitswesens in den Vereinigten Arabischen Emiraten Quelle: angelehnt an HAAD, Health Statistics 2011; WHO, NHA, 2010
VAE Schweiz Abu Dhabi
Gesamtgesundheitsausgaben pro Kopf (in USDollar) 1’544 6’944 n / a
Lebenserwartung bei Geburt (Männer/Frauen) 77 / 79 80 / 84 75 / 77
Bevölkerungswachstum 1999 bis 2009 (in Prozent) 4,1 0,6 5,5
Säuglingssterblichkeitsquote (pro 1.000 Einwohner) 7,0 4,0 6,4
Anzahl stationäre Betten (pro 1.000 Einwohner) 1,9 5,3 2,5
Anzahl Ärzte (pro 10.000 Einwohner) 19,3 40,7 20,4
Anzahl Krankenschwestern (pro 10.000 Einwohner) 40,9 159,6 43,6

Healthcare Check-up / Februar 201420 | Internationales
hat SEHA Partnerschaften mit internationalen Anbietern wie John Hopkins oder Cleveland Clinic. Die grösste private Krankenhauskette ist Al Noor. Das Gesundheitsministerium in seiner heutigen Form existiert lediglich auf föderaler Ebene; seine Befugnisse in den jeweiligen Emiraten sind begrenzt. Die regulative Steuerung wird primär von HAAD übernommen. Neben der Implementierung von regulatorischen Standards verfolgt HAAD eine konstante Verbesserung des Gesundheitssystems in Bereichen wie Effizienz und Qualität.
So erlaubt zum Beispiel HAAD den Versicherern, direkt mit den Dienstleistern zu verhandeln. Darüber hinaus wurden sogenannte «Standard Provider Contracts» eingeführt, in denen Kosten
sätze für medizinische Leistungen fest definiert sind. Versicherung und Dienstleister, beispielsweise ein Krankenhaus, können lediglich über sogenannte Multiplier2 verhandeln.
Die Tabelle auf Seite 19 veranschaulicht wichtige Indikatoren des Gesundheitswesens, wie zum Beispiel die Lebenserwartung, die der in Deutschland nahekommt. Die Säuglingssterblichkeitsrate ist ebenfalls im internationalen Vergleich gering.
Laut HAAD sind in Abu Dhabi derzeit insgesamt 4’900 Ärzte, 10’504 Pflegekräfte und 5’222 sonstiges Personal aus dem Gesundheitsbereich (inklusive Apotheker) in 34 Krankenhäusern (3’659 Betten), 759 Kliniken und 427 Apotheken tätig.
Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung Im Jahr 2005 wurde gesetzlich vorgeschrieben, dass jeder Arbeitgeber seine ausländischen Arbeitskräfte («Expats») versichern muss. Drei Jahre später wurde das sogenannte Thiqa3Programm ins Leben gerufen, indem sich alle Staatsbürger der VAE («Nationals») registrieren müssen, wenn sie kostenlose ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen möchten.
Mit der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung verfolgte man zunächst drei Ziele: erstens, jedem Einwohner von Abu Dhabi medizinische Versorgung zu gewähren, zweitens, die Qualität des Gesundheitswesens zu verbessern, und drittens,
2 Ein Multiplier ist ein Faktor zwischen 1 und 3, der mit dem Kostensatz multipliziert werden kann.3 «Thiqa» ist das arabische Wort für Vertrauen.
Abbildung 8Darstellung des Krankenversicherungssystems von Abu Dhabi anhand der drei Produktsparten von DamanQuelle: HAAD Health Statistics 2011, Munich Health Daman Holding-Analyse
1 ist grösser als die Einwohnerzahl in Abu Dhabi zurückzuführen, die in anderen Emiraten leben.
KostenträgerArbeitgeber
Versicherungsbeiträge
Enhanced 1,1 Millionen Mitglieder
Alle Expats
Thiqa 0,7 Millionen Mitglieder
Staatsbürger der VAE
Basic 1,3 Millionen Mitglieder
Expat Monatsgehalt < 5.000 AED
Privat
Health Authority – Abu Dhabi Insurance Authority
Öffentlich (SEHA)
Anbieter im Ausland
Finanzministerium Kosten und Admingebühren
Subvention, wenn technischer Prämienanteil nicht ausreicht
Kosten des Dienstleisters werden durch die Versicherung beglichen.
Kosten des Dienstleisters werden durch die Regierung beglichen.
Mitgliedschaft
MarktanteilVersicherungs- gesellschaft 1
Versicherungträger
Dienstleister
Regulatoren
31,8 %
7,0 %
14,4 %
46,8 %
Admin- gebühren
Daman
Al Dhafra
ADNIC
Sonstige (35 Versicherer)
Daman (Third Party
Administrator)
Daman
100 %

Februar 2014 / Healthcare Check-up Internationales | 21
National Health InsuranceCompany – DamanDaman5 wurde 2006 als rein staatliches Unternehmen mit der Münchener RückversicherungsGesellschaft als strategischem Partner und Rückversicherer gegründet. 2008 wurde das Unternehmen in ein Joint Venture umgewandelt: 80 Prozent der Anteile hält die Regierung und 20 Prozent die Münchener Rück. Daman war die erste spezialisierte Krankenversicherung in den VAE und steigerte innerhalb von sechs Jahren seine Mitgliederzahl auf mittlerweile 2,3 Millionen. Heute
beschäftigt Daman über 1’500 Mitarbeiter und darf sich als wesentlicher Bestandteil des Gesundheitswesens in Abu Dhabi bezeichnen. Daman bietet drei Produktsparten: den «Basic»Plan, die «Enhanced» Produkte und den «Thiqa»Plan. Der «Basic»Plan und die «Enhanced» Produkte sind auf die Bedürfnisse der «Expats» zugeschnitten, während der «Thiqa»Plan ausschliesslich für die «Nationals» vorgesehen ist. Die Abbildung auf Seite 20 veranschaulicht die Unterschiede im Detail und gibt Aufschluss über den generellen Aufbau des Systems.
mittelfristig staatliche Subventionen zu reduzieren. Notwendig wurden diese Massnahmen vor allem durch die sich verändernden demografischen Verhältnisse und durch die steigende Anzahl chronischer Krankheiten im Land. Von rund 2,4 Millionen in Abu Dhabi lebenden Menschen sind ungefähr 20 Prozent «Nationals» und 80 Prozent «Expats» aus der ganzen Welt und aus jeder Gesellschaftsschicht. Die Mehrheit der Ausländer kommt vorwiegend aus Indien, Bangladesch, Pakistan und den Philippinen, gefolgt von arabischen Staaten, Afrika, dem angelsächsischen Sprachraum sowie Europa. Während der Grossteil der «Expats» zwischen 20 und 30 Jahre alt ist, ist der grösste Teil der «Nationals» noch jünger, und zwar unter 15 Jahren.
Ausgehend von der Fragestellung, welches Krankenversicherungssystem diese heterogene Bevölkerung am besten bedienen kann und gleichzeitig am effizientesten finanziert werden kann, wurde die National Health Insurance Company – Daman gegründet. (Abbildung Seite 20)
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Kosten der Krankenversicherung seiner ausländischen Arbeitnehmer und deren Familien zu übernehmen. Der Nachweis einer Krankenversicherung ist Voraussetzung für die Erteilung der Arbeits und Aufenthaltserlaubnis.
Ein monatlicher Verdienst unter 5’000 Dirham der Vereinten Arabischen Emirate (AED) (1’028 Euro) berechtigt zum «Basic» Plan bei Daman und kostet 600 AED (123 Euro) pro Jahr. Reicht hier der technische Prämienanteil nicht für die Deckung der medizinischen Kosten aus, werden diese von der Regierung subventioniert. Es dürfen auch andere Versicherer die Einkommensgruppe unter 5’000 AED mit der gleichen Prämie versichern, jedoch erhalten diese im Gegensatz zu Daman keine Subventionen von der Regierung.
Für alle anderen bieten Daman und mittlerweile 38 Wettbewerber Krankenversicherungsprodukte mit unter
schiedlichsten Leistungen im sogenannten «Enhanced»Segment an. Gemäss HAAD lag 2011 die durchschnittliche Prämie aller Versicherungsgesellschaften und produkte in diesem Segment pro Jahr bei 3’019 AED (620 Euro) je Versicherten. Beim «Thiqa»Plan übernimmt die Regierung für ihre Staatsbürger, unabhängig davon, ob sie erwerbstätig sind oder nicht, fast alle Behandlungskosten innerhalb und – im Notfall – auch ausserhalb der VAE. Daman agiert dabei als sogenannter «Third Party Administrator» (TPA) und betreut die Versicherten im Auftrag der Regierung. Das «Thiqa»Programm ist im weltweiten Vergleich eines der besten und umfassendsten Gesundheitsprogramme. Allerdings steigen auch hier die Kosten jährlich aufgrund von Inflation im Gesundheitswesen und steigender Inanspruchnahme der Leistungen.
Fazit Abu Dhabi hat mit Daman innerhalb weniger Jahre erfolgreich ein Krankenversicherungssystem implementiert, das heute allen seinen Einwohnern medizinische Versorgung in unterschiedlicher Ausprägung bietet. Die Regierung hat rechtzeitig und als erste in der Region den Handlungsbedarf erkannt und eine Vorreiterrolle übernommen.
Das starke Wirtschaftswachstum und der damit verbundene Reichtum des
Landes haben auch ihre Schattenseiten. Wohlstandskrankheiten wie Übergewicht und Diabetes prägen das Krankheitsbild der ganzen Nation. Daman versucht dem entgegenzuwirken mit seinen sogenannten «Disease Management Programmen». Die Teilnehmer dieser Programme werden motiviert, ungesunde Lebensgewohnheiten langfristig umzustellen. Darüber hinaus hat Abu Dhabi zusammen mit HAAD das «Weqaya»4Programm eingeführt, das alle Staatsbürger zu regelmässigen Vorsorgeuntersuchungen verpflichtet. Die Regierung hat grosses Interesse daran, das Gesundheitswesen weiter zu verbessern. Die bisherigen Ergebnisse, die Vision und die konsequente Umsetzung deuten auf ein Gelingen der ambitionierten Pläne hin.
4 «Weqaya» ist das arabische Wort für Prävention.5 «Daman» ist das arabische Wort für Versicherung.

Impressum
HerausgeberKPMG AGBadenerstrasse 172Postfach 1872CH-8026 Zürich
RedaktionMichael HerzogSektorleiter Healthcare Leiter Audit Healthcare T: +41 58 249 40 68 E: [email protected]
André Zemp Leiter Advisory Healthcare T: +41 58 249 28 98 E: [email protected]
Pierre-Henri Pingeon Leiter Healthcare Romandie T: +41 22 704 16 85 E: [email protected]
Marc Dominic WidmerSenior ManagerExecutive Healthcare T: +41 58 249 41 24 E: [email protected]
kpmg.ch
Bestellungen/Abbestellungen/Anschriftenänderungen für die Printausgabe Healthcare Check-up
Mirjam SchluchterT: +41 58 249 41 04 E: [email protected]/check-up
Weitere Informationenkpmg.ch/healthcare
Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine zukünftige Sachlage widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und eine professionelle Beratung als Entscheidungs oder Handlungsgrundlage dienen.
© 2014 KPMG Holding AG/SA, a Swiss corporation, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved. Printed in Switzerland. The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International.