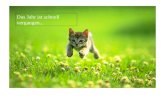Hockenholz, F. Physiotherapie bei Schmerzen · Vorwort Mehr als zwei Jahre sind seit dem Zeitpunkt...
-
Upload
nguyenquynh -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Hockenholz, F. Physiotherapie bei Schmerzen · Vorwort Mehr als zwei Jahre sind seit dem Zeitpunkt...
Hockenholz, F.Physiotherapie bei Schmerzen
by naturmed FachbuchvertriebAidenbachstr. 78, 81379 München
Tel.: + 49 89 7499-156, Fax: + 49 89 7499-157Email: [email protected], Web: http://www.naturmed.de
zum Bestellen hier klicken
VorwortMehr als zwei Jahre sind seit dem Zeitpunkt vergangen,an dem es klar wurde, dass wir diese Publikation begin-nen durften. Es ist ein unglaubliches Gefühl, kurz vor derFertigstellung zu stehen, die vielen Eindrücke zu ver-arbeiten und zu erkennen, wie viel Arbeit in einer solchenVeröffentlichung steckt - sowohl von den Autoren, alsauch von Verlagsseite. Doch wie entstand nun diesesBuch?
Chronischen Schmerzen lassen sich im therapeutischenAlltag leider als alltäglich beschreiben. Recht früh stelltesich bei mir die Unzufriedenheit ein, wenn Patientennach einer Behandlung zunächst eine Verbesserung derSymptomatik beschrieben, diese jedoch nur von kurzerDauer war. Da sich gerade bei chronifizierten Schmerz-erkrankungen auf der lokalen Ebene, also an der Stelledes Schmerzes, häufig kein verhältnismäßiger Auslöserfür die Beschwerden finden ließ, versuchte ich weitereEinflussfaktoren zu benennen, die sich auf das jeweiligeschmerzende Körperareal auswirken können.
Mit der Zeit entstand eine ganze Sammlung: es kannnatürlich eine lokale Ursache geben, aber auch Einflüsseaus dem faszialen System, vegetativ-viszerale Einflüsse,energetische Fehlfunktionen, sowie neurologische Ursa-chen können den Schmerz und die Schmerzwahrneh-mung beeinflussen.
Um diese ganzen Informationen in der Befunderhe-bung und der anschließenden Behandlung strukturierenzu können, entstand das in diesem Buch beschriebeneEbenenmodell. Seit Jahren findet es eine erfolgreiche An-wendung in der Behandlung von Schmerzpatienten undentwickelt sich unter Berücksichtigung aktueller For-
schungsergebnisse und den persönlichen Erfahrungenkontinuierlich weiter.
Das zugrundeliegende Behandlungskonzept nun in Zu-sammenarbeit mit dem Thieme Verlag vorstellen zu dür-fen, freut uns sehr. Meine Mitarbeiter und ich möchtenuns an dieser Stelle bei dem gesamten Team des ThiemeVerlages bedanken. Insbesondere sind an dieser StelleFrau Grünewald und Frau Bussas zu nennen, die uns inder gesamten Erstellungsphase mit ihrer unglaublichenErfahrung, Geduld und Ruhe zur Seite standen. Weiterhinwurde auf beeindruckende Weise deutlich, wie viele flei-ßige Hände und Köpfe im Hintergrund an einem solchenWerk mitwirken – auch diesen möchten wir ganz herz-lich für die tolle Unterstützung und Umsetzung der Ideendanken.
All dies wäre jedoch ebenfalls nicht ohne die Mitarbeitder weiteren Autoren möglich gewesen; sie haben vielgeleistet und trotz der täglichen Arbeit am Patienten, imUnterricht oder im Büro immer wieder an dem Manu-skript gearbeitet.
Mein letzter Dank gilt den vielen Schülern und Fortbil-dungsteilnehmern, die ihrerseits auch immer wieder neueImpulse einbringen – seien sie inhaltlicher oder didakti-scher Natur. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der kontinu-ierlichen Weiterentwicklung des Konzeptes – und ohnesie wäre auch dieses Buch vermutlich nicht entstanden.
Ich hoffe, das Werk spricht die Leser an und gibt neueIdeen und Informationen über die Hintergründe der Be-handlung.
Florian Hockenholz Berlin, im Mai 2016
5
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
Inhaltsverzeichnis1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1 Aktueller Stand und Ausblick in derSchmerztherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2 Schmerztherapie immultiprofessionellen Kontext . . . . . . . . . 14
1.2.1 Multiprofessionalität, Multidisziplinarität,Interdisziplinarität –was ist was?. . . . . . . . 15
1.2.2 Nichtmedikamentöse Schmerztherapie. . . 151.2.3 Biopsychosozialer Kontext und
Wahrnehmung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3 Schmerzformen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.3.1 Differenzierung akuter und chronischerSchmerzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.3.2 Psychologische Aspekte des Schmerzes . . . 251.3.3 Sympathische Schmerzaktivierung bzw.
-aufrechterhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261.3.4 Endokrine Beteiligung bei der
Schmerzwahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . 271.3.5 Beteiligung des Immunsystems. . . . . . . . . . 271.3.6 Phantomschmerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4 Placeboeffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4.1 Forschungsgeschichte und ersteDefinitionsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4.2 Wirkungsweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.4.3 Placebo und Schmerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.4.4 Der Experte als Placebo . . . . . . . . . . . . . . . . 311.4.5 Nocebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5 Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5.1 Nonverbale Kommunikation . . . . . . . . . . . . 34
1.5.2 Kommunikationsquadrat nach Schulz vonThun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.5.3 Die fünf Axiome von Paul Watzlawick . . . . 381.5.4 Gestörte Kommunikation. . . . . . . . . . . . . . . 401.5.5 Hilfreiche Kommunikationsstrategien im
therapeutischen Kontext . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.6 Besonderheiten der Kommunikationmit Schmerzpatienten. . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.6.1 Wechselwirkung von Schmerzen mitemotionalem Empfinden . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.6.2 Auswirkungen von Schmerzen auf dieKommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.6.3 Kommunikationsmöglichkeiten zuraktiven Interaktionsgestaltung . . . . . . . . . . 45
1.6.4 Umfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.7 Empathie und ihre Gefahren . . . . . . . . . . 51
1.7.1 Definitionsversuche außerhalb destherapeutischen Kontextes . . . . . . . . . . . . . 51
1.7.2 Empathie bei Patienten mit (chronischen)Schmerzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.7.3 Grenzen der Empathie . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.8 Grundlagen der medikamentösenTherapie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.8.1 Einleitung: Nozizeptoren . . . . . . . . . . . . . . . 551.8.2 Analgetika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561.8.3 Koanalgetika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581.8.4 Indikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581.8.5 Konsequenzen für die physiotherapeu-
tische Behandlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2 Grundlegende Untersuchungs- und Behandlungstechniken in derSchmerztherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.2 Differenzierung von Dysfunktionenund Läsionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.2.1 Dysfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612.2.2 Läsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.3 Mikromechanische Mobilisation . . . . . . 62
2.4 Muskel-Energie-Techniken. . . . . . . . . . . . 63
6
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
3 Ebenenmodell in der Schmerztherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.2 Lokale Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3 Fasziale Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.4 Segmentale Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.5 Vegetative Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.6 Viszerale Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.7 Energetische Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.8 Psycho-emotionale Ebene . . . . . . . . . . . . 68
4 Lokale Ebene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2 Untersuchung und Behandlung auflokaler Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2.1 Fuß. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694.2.2 Knie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.2.3 Hüfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.2.4 Becken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.2.5 Schulter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964.2.6 Ellenbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024.2.7 Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5 Fasziale Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.1.1 Geschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095.1.2 Grundlagen der embryologischen
Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095.1.3 Grundgewebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.2 Bindegewebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.2.1 Bestandteile des Bindegewebes . . . . . . . . . 1185.2.2 Bindegewebsarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1335.2.3 Organisation und Prozesse im
Bindegewebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.2.4 Pathologien des Bindegewebes . . . . . . . . . . 1455.2.5 Stress – Wirkung auf den Organismus . . . . 1555.2.6 Anatomie der Faszien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565.2.7 Aufgaben und Funktion der Faszien . . . . . . 2065.2.8 Narben aus faszialer Sicht . . . . . . . . . . . . . . 212
5.3 Untersuchung und Behandlung auffaszialer Ebene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
5.3.1 Die fünf osteopathischen Prinzipien. . . . . . 2135.3.2 Untersuchung des faszialen Systems . . . . . 2145.3.3 Behandlung des faszialen Systems . . . . . . . 219
6 Segmentale Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
6.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
6.2 Grundlagen der Embryologie . . . . . . . . . 230
6.3 Zentrales Nervensystem . . . . . . . . . . . . . . 231
6.3.1 Anatomie des Rückenmarks. . . . . . . . . . . . . 232
6.4 Peripheres Nervensystem . . . . . . . . . . . . 234
6.4.1 Hirnnerven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2356.4.2 Spinalnerven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
6.4.3 Unterschied zwischen peripherer undradikulärer Innervation . . . . . . . . . . . . . . . . 252
6.4.4 Nervengeflechte – Plexusbildung . . . . . . . . 254
6.5 Untersuchung und Behandlung aufsegmentaler Ebene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
6.5.1 Diskusläsionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2956.5.2 Lendenwirbelsäule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2966.5.3 Brustwirbelsäule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2996.5.4 Halswirbelsäule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Inhaltsverzeichnis
7
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
7 Vegetative Ebene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
7.1 Vegetatives Nervensystem . . . . . . . . . . . 308
7.2 Zentrale Regulation von Sympathikusund Parasympathikus . . . . . . . . . . . . . . . . 308
7.2.1 Prä- und postganglionäre Transmitter . . . . 309
7.3 Anatomie und Physiologie desSympathikus und Parasympathikusin Bezug auf Schmerztherapie . . . . . . . . 310
7.3.1 Sympathikus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3107.3.2 Parasympathikus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
7.4 Untersuchung und Behandlung aufvegetativer Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
7.4.1 Untersuchungsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . 3267.4.2 Behandlungsmöglichkeiten in Bezug auf
das sympathische Nervensystem . . . . . . . . 328
7.5 Narben aus vegetativer Sicht . . . . . . . . . 328
7.5.1 Pathophysiologie der Narbenentstehung. . 3297.5.2 Behandlung vegetativ gestörter Narben . . 330
8 Viszerale Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
8.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
8.2 Untersuchung und Behandlung derOrganzonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
8.2.1 Dorsale Organzonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3318.2.2 Ventrale Organzonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3328.2.3 Neurolymphatische Reflexzonen nach
Chapman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3338.2.4 Kopforgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3348.2.5 Herz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358.2.6 Lunge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3378.2.7 Ösophagus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
8.2.8 Magen und Duodenum. . . . . . . . . . . . . . . . . 3408.2.9 Dünndarm (Jejunum, Ileum) . . . . . . . . . . . . 3428.2.10 Leber und Gallenblase . . . . . . . . . . . . . . . . . 3448.2.11 Pankreas und Milz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3468.2.12 Caecum, Appendix, Colon ascendens und
transversum (Dickdarm 1) . . . . . . . . . . . . . . 3478.2.13 Colon descendens, Sigma und Rektum
(Dickdarm 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3498.2.14 Niere, Ureter und Blase. . . . . . . . . . . . . . . . . 3518.2.15 Organe des kleinen Beckens . . . . . . . . . . . . 3538.2.16 Weitere Organzonen der dorsalen
Bindegewebszonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
9 Energetische Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
9.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
9.2 Indikationsliste der WHO fürAkupunktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
9.3 Faszienlinien undAkupunkturmeridiane. . . . . . . . . . . . . . . . 358
9.3.1 Anatomische und physiologischeBeobachtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
9.3.2 Wirkung von Akupunkturnadelung . . . . . . 358
9.4 Physiologie der Energetik . . . . . . . . . . . . 359
9.4.1 Die Lehre vom Qi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3599.4.2 Yin und Yang – die gegensätzliche
Wirkung des Qi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3609.4.3 Die vier Wechselbeziehungen des Qi bzw.
von Yin und Yang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3609.4.4 Mögliche energetische Zustände . . . . . . . . 360
9.5 Anatomie des energetischen Systems –die Meridiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
9.5.1 Meridiane des kleinen Körperkreislaufs . . 3619.5.2 Körpermeridiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3639.5.3 Zusammenfassung aller Meridianpunkte . 372
9.6 Untersuchung und Behandlung derMeridiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
9.6.1 Untersuchung der peripheren Meridiane . 3749.6.2 Behandlung des großen Energiekreislaufs. 374
9.7 Energetische Behandlung von Narben . 377
9.7.1 Behandlung einer vollen Narbe. . . . . . . . . . 3779.7.2 Behandlung einer leeren Narbe. . . . . . . . . . 3779.7.3 Behandlung von gemischten Narben . . . . . 3789.7.4 Behandlung von rezidivierenden
Störungen einer Narbe . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Inhaltsverzeichnis
8
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
10 Psycho-emotionale Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
10.1 Limbisches System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
10.1.1 Äußerer Bogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37910.1.2 Innerer Bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38010.1.3 Weitere Strukturen des limbischen
Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38110.1.4 Hirnkerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
10.2 Psycho-emotional bedingte Funktions-störungen der vegetativ-viszeralenReflexbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
10.2.1 Indikationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38310.2.2 Wahl des Regulationssystems . . . . . . . . . . . 38310.2.3 Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38410.2.4 Untersuchung und Behandlung. . . . . . . . . . 38410.2.5 Bezug von Emotion zu Organ . . . . . . . . . . . 38510.2.6 Trauma, Stress und Schmerzen . . . . . . . . . . 388
11 Erweiterte Ebenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
11.1 Hormonelle Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
11.1.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39511.1.2 Grundlagen Nervensystem –
vegetative Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39611.1.3 Grundlagen endokrines System –
humorale Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39611.1.4 Organe des humoralen Systems . . . . . . . . . 40111.1.5 Grundlagen des Immunsystems –
immunologische Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . 412
11.1.6 Zirkadiane Rhythmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41411.1.7 Interaktionen zwischen den einzelnen
Ebenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
11.2 Fußreflexzonen als therapeutischesMittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
11.3 Ohrreflexzonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
12 Standardisierte Befunderhebung und Dokumentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
12.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
12.2 System der ICF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
12.2.1 Körperstruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
12.2.2 Körperfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42312.2.3 Aktivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42412.2.4 Teilhabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42412.2.5 Umweltfaktoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
13 Umsetzung des Ebenenmodells – Praxisbeispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
13.1 Fuß am Beispiel der Achillodynie . . . . . . 426
13.1.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42613.1.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42713.1.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42813.1.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 429
13.2 Knie am Beispiel eines unspezifischenSchmerzsyndroms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
13.2.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43113.2.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43113.2.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43313.2.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 433
13.3 Hüfte am Beispiel einerHüft-Totalendoprothese . . . . . . . . . . . . . . 435
13.3.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43513.3.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
13.3.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43713.3.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 437
13.4 Becken am Beispiel vonISG-Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
13.4.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43913.4.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44013.4.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44113.4.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 442
13.5 Diskus am Beispiel eines LWS-Prolaps . 443
13.5.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44313.5.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44413.5.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44513.5.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 447
Inhaltsverzeichnis
9
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
13.6 Brustwirbelsäule am Beispiel einesunspezifischen BWS-Syndroms mitInterkostalneuralgie . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
13.6.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44913.6.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45013.6.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45113.6.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 452
13.7 Halswirbelsäule am Beispiel einesunspezifischen HWS-Syndroms . . . . . . . 453
13.7.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45413.7.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45413.7.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45513.7.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 456
13.8 Kopf am Beispiel eines Bruxismus . . . . . 457
13.8.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45713.8.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45713.8.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45913.8.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 460
13.9 Schulter am Beispiel einesImpingementsyndroms(subakromiales Engpasssyndrom) . . . . . 461
13.9.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
13.9.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46213.9.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46413.9.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 465
13.10 Ellenbogen am Beispiel einerEpicondylitis medialis . . . . . . . . . . . . . . . . 466
13.10.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46613.10.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46813.10.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46913.10.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 470
13.11 Hand am Beispiel eines komplexenregionalen Schmerzsyndroms (CRPS) . . 471
13.11.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47113.11.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47313.11.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47413.11.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 475
13.12 Viszerale Problematik am Beispieleines Reizdarmsyndroms . . . . . . . . . . . . . 477
13.12.1 Ebenenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47813.12.2 Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47913.12.3 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48113.12.4 Dokumentation nach ICF . . . . . . . . . . . . . . . 481
14 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
14.1 Bücher/Zeitschriften/Sonstige . . . . . . . . 483 14.2 Internetquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Inhaltsverzeichnis
10
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
3 Ebenenmodell in der Schmerztherapie
3.1 EinführungDie Befunderhebung bei chronifizierten Schmerzpatien-ten stellt sich oft als schwierig heraus. Neben einer in derRegel sehr langen Krankheitsgeschichte mit mehreren Di-agnosen, wechselndem Krankheitsverlauf und vielen un-terschiedlichen absolvierten Therapiemaßnahmen wei-sen Patienten meistens zudem auf mehr als nur einenschmerzhaften Körperbereich hin. Außerdem wechseltder Bereich, in dem die Patienten ihren Hauptschmerzangeben, oft von Behandlung zu Behandlung.
Bei dem Beispiel des Fibromyalgiesyndroms tritt häufigdas Problem auf, dass zwar ein lokaler Schmerz vorhan-den ist, während der Untersuchung aber kein lokalerSchmerzauslöser festzustellen ist.
Auch beim komplexen regionalen Schmerzsyndrom(CRPS, Complex Regional Pain Syndrome) sind sehr deut-lich feststellbare Symptome zu finden. Einzig und alleinüber die lokalen Auslöser lässt sich die Gesamtsympto-matik aber häufig nicht erklären.
Bei vielen weiteren chronifizierten Schmerzpatientenstehen Schmerzpunkte und lokale Ursachen oft in keinemlogischen Zusammenhang.
Aufgrund dieser komplexen Merkmale besteht bei derUntersuchung und Behandlung chronifizierter Schmerz-patienten das Risiko, dass der Therapeut den Überblickverliert. Es besteht dann die Gefahr, dass die Auswahl derBehandlungstechniken eher auf die Symptome zielt unddie Suche bzw. Behandlung (wenn möglich) der ursächli-chen Dysfunktionen in den Hintergrund gerät.
Vom Moment des ersten Patientenkontaktes an ist esdaher für den gesamten Behandlungsverlauf unabding-bar, einer festen Struktur zu folgen.
Das Ebenenmodell zeigt uns die einzelnen Ebenen, andenen sich der Therapeut in der Untersuchung und Be-handlung orientieren kann (▶Abb. 3.1).
Je nach Ausbildung des Therapeuten kann das Modellbeliebig erweitert werden – im Einzelfall kann eine Er-weiterung sinnvoll sein, für eine strukturierte Unter-suchung und Behandlung eines Schmerzpatienten rei-chen diese Ebenen aber in den meisten Fällen aus.
Alle Ebenen müssen in die Untersuchung mit einbezo-gen werden, um anschließend die Faktoren nennen zukönnen, die den Schmerz auslösen. Wenn dies nicht zumErfolg führt, können noch weitere Ebenen hinzugezogenwerden.
Die Untersuchung wird, wie in dem Schema dargestellt,von oben nach unten durchgeführt. Erst nach dem Ge-samtbefund aller Ebenen kann der weitere Behandlungs-verlauf fortgesetzt werden.
Während bei akuten Prozessen die schmerzauslösendeStruktur hauptsächlich auf der lokalen Ebene zu findenist, ist bei Chronifizierungen das Problem meistens aufmehrere Ebenen verteilt. Die Gesamtsumme aller Dys-
funktionen und Läsionen ist hier der „Verursacher“ desSchmerzes.
3.2 Lokale EbeneDie lokale Ebene beschreibt den schmerzhaften Bereich.Hierbei liegen Schmerzpunkt und schmerzverursachendeStruktur häufig direkt übereinander. Meistens lässt sichschon in der Anamnese ein direktes Trauma feststellen.Wenige Tage nach dem Trauma ist aber selten nur nochdiese eine Ebene betroffen. Wenn eine Ursache für dieSchmerzsymptomatik ausschließlich in der lokalen Ebeneliegt, muss diese für den Schmerz verantwortliche Struk-tur bei der Funktionsuntersuchung klar differenziert wer-den können. Viele Schmerzsyndrome erwecken den Ein-druck, ihre Ursache in der lokalen Ebene zu haben. Häufigist bei länger andauernden Schmerzsyndromen eine Ver-teilung der Ursachen auf mehrere Ebenen zu finden. Ausdiesem Grund ist eine sorgfältige Untersuchung der loka-len Ebene sehr wichtig, um eine Verteilung der Ursachenauf mehrere Ebenen zu erkennen oder auszuschließen.Bei einer rein lokalen Ursache hat dies auch eine rein lo-kale Behandlung zur Folge. Bei Ursachen auf mehr alseiner Ebene muss weiter untersucht werden, damit sämt-liche auslösenden Faktoren erkannt und behandelt wer-den können.
3.3 Fasziale EbeneDie fasziale Ebene beschreibt eine unterschiedliche Lagevon Schmerzpunkt und schmerzauslösender Struktur.Eine Narbe im Bereich der Schulter kann zu einer Erhö-hung des Faszientonus des Arms und somit zu Schmerzenoder einer gestörten lymphatischen Resorption führen.
Faszien haben sehr viele Aufgaben, unter anderem aufden Körper einwirkende Kräfte aufzunehmen und aufden gesamten Körper zu verteilen. Dies hat zur Folge,dass aus einer drohenden großen Dysfunktion/Läsion für
lokale Ebene
ener
getis
che
Eben
e
psyc
hoem
otio
nale
Ebe
ne
fasziale Ebene
segmentale Ebene
vegetative Ebene
viszerale Ebene
??? Ebene
Abb. 3.1 Das Ebenenmodell in der Schmerzphysiotherapie.
Ebenenmodell in der Schmerztherapie
66
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
den Körper an der Stelle der einwirkenden Kraft mehrerekleine Dysfunktionen und auch Läsionen über den Körperverteilt entstehen.
Wenn eine Dysfunktion im Sprunggelenk besteht, kannsich durch einen Faszienzug die Hauptsymptomatik übermehrere Stationen bis zum Kiefergelenk ausbreiten. DerPatient kann dann seinen Hauptschmerz am Kiefergelenkangeben, d. h. das Sprunggelenk macht zu diesem Zeit-punkt keine oder kaum Probleme. Die Kiefergelenks-beschwerden können dann ursächlich nur durch eine Be-handlung des Sprunggelenks behandelt werden. Eine lo-kale Behandlung des Kiefergelenks hätte in diesem Fallnur einen kurzfristigen Erfolg, da die Dysfunktion überden Faszienzug vom Sprunggelenk erneut ausgelöst wer-den würde.
3.4 Segmentale EbeneDie segmentale Ebene beschreibt den Weg von der Ner-venwurzel über den Plexus bis hin zum peripheren Nerv.Diagnostisch muss zwischen einem Problem der Nerven-wurzel, des Plexus und des peripheren Nervs unterschie-den werden. Bei Funktionsstörungen des Segmentes tre-ten die Symptome in den „Tomen“ des jeweiligen Spinal-nervs auf:● Myotom (Muskel)● Dermatom (Haut)● Sklerotom (Knochen)● Enterotom/Viszerotom (Organ)● Neurotom (Nervalsegment)
Dysfunktionen des Plexus oder des peripheren Nervskönnen sich motorisch wie sensibel im Versorgungsgebietdes peripheren Nervs zeigen.
3.5 Vegetative EbeneAuf der vegetativen Ebene sitzen die Steuerungseinheitendes Sympathikus und Parasympathikus. Durch eine vege-tative Fehlregulation kann eine Schmerzsymptomatik imKörper entstehen oder verstärkt werden. Während derSympathikus algetische und vegetativ-reflektorische Zei-chen auslöst, ist der Parasympathikus nur für algetischeZeichen zuständig. Je nach Störung kann es zu negativenBeeinflussungen der Durchblutung, der Kapselspannung,der Organfunktionen und vielen weiteren Symptomenkommen. Es können sympathische oder parasympathi-sche Fehlregulationen auftreten. Eine genaue Unter-suchung der Ursache ist auch hier entscheidend.
Jede Schmerzsymptomatik hat auch immer eine vege-tative Komponente.
3.6 Viszerale EbeneAuch viszerale Dysfunktionen können periphereSchmerzsyndrome auslösen. Am bekanntesten dürfteeine Dysfunktion des Herzens sein (z. B. Angina pectoris).Hierbei verspürt die Person unter anderem ein unange-nehmes „Schmerzsyndrom“ der linken Rumpfhälfte unddes linken Arms. Auch die stechenden Schulterschmerzenauf der rechten Seite bei einer Gallenkolik sind relativ be-kannt. Nicht alle Dysfunktionen/Läsionen innerer Organelösen solche massiven Schmerzen mit weiteren beglei-tenden Symptomen aus. Funktionsstörungen im kleinenBecken zeigen häufig Symptome an den Füßen und Un-terschenkeln.
Auch Schmerzen geringerer Intensität können durchinnere Organe ausgelöst werden. Durch die vegetativeVersorgung der Organe breiten sich Probleme über dasgesamte System aus. Über die vegetative Verschaltungkann jedes Organ periphere Schmerzen verursachen.
Diagnostisch können beispielsweise die Bindegewebs-zonen genutzt werden. Eine weiterführende, ausführlicheDiagnostik der betroffenen Organe durch einen Arzt istauf jeden Fall zu empfehlen, denn anhand einer Bindege-webszone lässt sich nicht zwischen Dysfunktion und Lä-sion unterscheiden.
Die Organe sind, genau wie alle anderen Strukturendes Körpers, in das fasziale System mit eingebunden. Hie-rüber kann etwa das Kolon die Bewegung der Halswirbel-säule einschränken, wodurch Schmerzen im Bereich derHalswirbelsäule ausgelöst werden können.
3.7 Energetische EbeneDie energetische Ebene verläuft parallel zu allen anderenEbenen. Das wird auch dadurch verständlich, dass in derchinesischen Medizin vom „kleinen“ lokalen Problem bishin zum generalisierten „großen“ Problem immer eineenergetische Behandlung stattfindet.
Man darf bei dieser Ebene jedoch nicht vergessen, dassdie energetische Behandlung keine einzelne Technik ist,sondern eine eigene, stark philosophisch geprägte Medi-zin, deren Studium einige Jahre dauert. Daher verwendetman nur einzelne, sehr kleine Bausteine der energeti-schen Behandlung in der Therapie als Ergänzung zur„westlichen Medizin“. Die Anwendung der Energetikmacht daher auch nur in Kombination mit dem gesamtenEbenensystem Sinn. Ein Schmerzsyndrom nur nach denRegeln der Energetik zu behandeln, ist für die meistenTherapeuten mit westlich geprägter therapeutischer Aus-bildung nur schwer möglich.
3.7 Energetische Ebene
67
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
3.8 Psycho-emotionale EbeneAuch die psycho-emotionale Ebene verläuft parallel zuden anderen Ebenen, weil sich Organismus und Psycheimmer direkt gegenseitig beeinflussen. Schmerzerlebenund -verarbeitung erfolgen auf der Grundlage physiologi-scher Verarbeitungsmechanismen, aber unterliegen inhohem Maße auch Lernprozessen, wobei dem limbischenSystem eine besondere Bedeutung zukommt.
Diese Lernprozesse verändern das gesamte Erleben undLeben des Patienten. Bei Personen mit starker Chronifi-zierung dreht sich ein Großteil des Lebens um das ThemaSchmerz.
Ein direktes Eingehen auf die Psyche (als ursächlichesProblem) ist für Physiotherapeuten nicht ratsam undauch nicht Bestandteil des Berufes. Aber auch diese Ebenelässt sich durchaus aus physiotherapeutischer Perspekti-ve beeinflussen. Aufklärung, Entspannung und vor allemeine schmerzfreie Therapie beeinflussen das Lernverhal-ten des Patienten in Bezug auf den Schmerz positiv.
Ebenenmodell in der Schmerztherapie
68
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
4 Lokale Ebene
4.1 EinführungChronische Schmerzerkrankungen weisen meist eineKombination aus einer lokalen Dysfunktion/Läsion undweiteren Dysfunktionen oder Läsionen auf den weiterenEbenen auf. Je weiter ein Krankheitsprozess fortgeschrit-ten ist, desto mehr sind die weiteren Ebenen betroffen.
Der Diagnostik der lokalen Ebene kommt eine besonde-re Bedeutung zu: Eine Behandlung der lokalen Ebenenverspricht nur anhaltenden Erfolg, wenn auf dieser derSchmerzauslöser klar definiert und positiv beeinflusstwerden kann. In einigen Fällen kann durch eine Unter-suchung der lokalen Ebene diese aber auch als Schmerz-auslöser ausgeschlossen werden. Sollte kein lokaler Aus-löser diagnostiziert werden, kann die folgende Unter-suchung und Behandlung auch ausschließlich auf denweiteren Ebenen erfolgen.
4.2 Untersuchung undBehandlung auf lokaler Ebene4.2.1 FußDer Fuß bzw. die Fußwurzelknochen spielen eine wichti-ge Rolle. Neben der Bedeutung für die Statik entspringenam Fuß alle Faszienketten und einige der Meridiane. Dys-funktionen der Gelenke können die Spannung in den Fas-zienketten erhöhen und so auch ein ganzes Stück ober-halb des Fußes Schmerzen auslösen oder verstärken. Invielen Fällen führt die Mobilisation der Gelenke innerhalbweniger Sekunden zu einer Abnahme der Spannung ineiner Faszienkette. Daher ist es bei vielen faszialen Dys-funktionen hilfreich, zuerst den Fuß zu untersuchen unddie entsprechenden Dysfunktionen zu behandeln.
Untersuchung der Ossa metatarsalia I–V
Untersuchung des Os metatarsale I▶ ASTE Patient. Rückenlage.
▶ ASTE Therapeut. Sitz auf der Bank, umgreift den Fußdes Patienten.
▶ Ausführung. Die kraniale Hand des Therapeuten fi-xiert das Os cuneiforme I, die kaudale Hand umgreift dasOs metatarsale I von dorsal und plantar.
Der Therapeut testet die Beweglichkeit nach dorsal undplantar unter leichter Vorspannung und beurteilt das Be-wegungsausmaß des Os metatarsale I gegenüber dem Oscuneiforme I (▶Abb. 4.1 und ▶Abb. 4.2).
Untersuchung des Os metatarsale II▶ ASTE Patient. Rückenlage.
▶ ASTE Therapeut. Sitz auf der Bank, umgreift den Fußdes Patienten.
Abb. 4.1 Untersuchung des Os metatarsale I.
Abb. 4.2 Schematische Darstellung der Untersuchung des Osmetatarsale I.
4.2 Untersuchung und Behandlung auf lokaler Ebene
69
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
▶ Ausführung. Die kraniale Hand des Therapeuten fi-xiert das Os cuneiforme II, die kaudale Hand umgreift dasOs metatarsale II von dorsal und plantar.
Der Therapeut testet die Beweglichkeit nach dorsal undplantar unter leichter Vorspannung und beurteilt das Be-wegungsausmaß des Os metatarsale II gegenüber dem Oscuneiforme II (▶Abb. 4.3 und ▶Abb. 4.4).
Untersuchung des Os metatarsale III▶ ASTE Patient. Rückenlage.
▶ ASTE Therapeut. Sitz auf der Bank, umgreift den Fußdes Patienten.
▶ Ausführung. Die kraniale Hand des Therapeuten fi-xiert das Os cuneiforme III, die kaudale Hand umgreiftdas Os metatarsale III von dorsal und plantar.
Der Therapeut testet die Beweglichkeit nach dorsal undplantar unter leichter Vorspannung und beurteilt das Be-wegungsausmaß des Os metatarsale III gegenüber demOs cuneiforme III (▶Abb. 4.5 und ▶Abb. 4.6).
Abb. 4.3 Untersuchung des Os metatarsale II. Abb. 4.5 Untersuchung des Os metatarsale III.
Abb. 4.4 Schematische Darstellung der Untersuchung des Osmetatarsale II.
Abb. 4.6 Schematische Darstellung der Untersuchung des Osmetatarsale III.
Lokale Ebene
70
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
Untersuchung des Os metatarsale IV▶ ASTE Patient. Rückenlage.
▶ ASTE Therapeut. Sitz auf der Bank, umgreift den Fußdes Patienten.
▶ Ausführung. Der Therapeut fixiert mit der kranialenHand das Os cuboideum.
Die kaudale Hand umgreift das Os metatarsale IV undtestet unter leichter Vorspannung die Beweglichkeit nachplantar und dorsal (▶Abb. 4.7 und ▶Abb. 4.8).
Untersuchung des Os metatarsale V▶ ASTE Patient. Rückenlage.
▶ ASTE Therapeut. Sitz auf der Bank, umgreift den Fußdes Patienten.
▶ Ausführung. Der Therapeut fixiert mit der kranialenHand das Os cuboideum.
Die kaudale Hand umgreift das Os metatarsale V undtestet unter leichter Vorspannung die Beweglichkeit nachplantar und dorsal (▶Abb. 4.9 und ▶Abb. 4.10).
Abb. 4.7 Untersuchung des Os metatarsale IV. Abb. 4.9 Untersuchung des Os metatarsale V.
Abb. 4.8 Schematische Darstellung der Untersuchung des Osmetatarsale IV.
Abb. 4.10 Schematische Darstellung der Untersuchung des Osmetatarsale V.
4.2 Untersuchung und Behandlung auf lokaler Ebene
71
aus: Hockenholz, Physiotherapie bei Schmerzen (ISBN 9783131985019) © 2016 Georg Thieme Verlag KG
















![Literaturverzeichnis - latex-kurs.de · style=apa]{biblatex} ng{german}{german-apa} atur.bib} p}{1em}... \begin{document}..... \printbibliography. er](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5dd09776d6be591ccb61bc68/literaturverzeichnis-latex-kursde-styleapabiblatex-nggermangerman-apa.jpg)