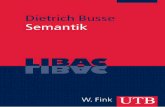Implikaturen
description
Transcript of Implikaturen

Implikaturen
Kapitelinhalt:
Konversationsmaximen Konversationelle Implikaturen Eigenschaften konversationeller Implikaturen Implikaturtypen Folgen von Grice' Implikaturtheorie Implikaturen zwischen Semantik und Pragmatik Übungen
Konversationsmaximen
A: Wie findest du meinen neuen Mantel? B: Er ist rosa!
Was können wir an der Reaktion von B feststellen? Erst einmal wurde die Frage von A nicht direkt beantwortet. War B somit unkooperativ oder können wir doch etwas aus seiner Antwort entnehmen? Die einfache Antwort hierzu lautet: Ja, wir können und machen so etwas sehr oft und wie selbstverständlich. Wahrscheinlich so oft, dass wir schon gar nicht merken, dass das, was wir in Antworten hineinlesen, eigentlich gar nicht direkt ausgesagt wurde. Wir könnten vermuten, dass B den Mantel nicht gut findet, weil er die Farbe rosa nicht mag. Wir schließen also etwas aus Äußerungen, die unsere Schlussfolgerung gar nicht direkt enthalten.
Es kann also vorkommen, dass der Hörer keine oder eine nicht vom Sprecher intendierte Schlussfolgerung macht. Denn bevor man etwas aus dem Gesagten schließen kann, laufen viele Prozesse ab, bei denen wir unter anderem unser Hintergrundwissen aktivieren. Weicht es von dem des Sprechers ab, kann es zu falschen Schlüssen kommen. Wenn B z.B. die Farbe rosa mag, entfällt unsere Schlussfolgerung, denn dann findet er den Mantel gut, gerade weil er rosa ist. Auch hier ist der Kontext von großer Bedeutung, denn nur wenn man ihn kennt, kann man überhaupt Schlussfolgerungen ziehen. Mit all diesen Aspekten und dem Phänomen der Schlussfolgerung hat sich Paul Grice beschäftigt. Er geht davon aus, dass man sich in der Kommunikation immer kooperativ verhält. Daher entwickelte er ein Kooperationsprinzip, dass folgendes besagt:
Gestalte deinen Gesprächsbeitrag so, wie es die anerkannte Zielsetzung oder Richtung des Gesprächs, an dem du beteiligt bist, zum betreffenden Zeitpunkt erfordert

Für Grice ist die Kommunikation also eine Art rationalen Verhaltens. Und Grundlage der rationalen Kommunikation ist das Kooperationsprinzip. Er formuliert vier Kooperationsmaximen, die ebenfalls dem kooperativen Sprachgebrauch zugrunde liegen und bei deren Einhaltung man ein effizientes und rationales Gespräch führen kann. Grice schlägt folgende Maximen vor:
Maxime der Qualität1) Sage nichts, von dessen Wahrheit du nicht
überzeugt bist2) Sage nichts, wofür du keine hinreichenden
Beweise hastMaxime der Quantität
1) Mache deinen Gesprächsbeitrag so informativ wie nötig
2) Mache deinen Gesprächsbeitrag nicht informativer als nötigMaxime der Relation
Mache deinen Gesprächsbeitrag relevantMaxime der Modalität
1) Vermeide Unklarheit im Ausdruck2) Vermeide Mehrdeutigkeiten
3) Fasse dich kurz4) Beachte die richtige Reihenfolge
Grice war sich natürlich bewusst, dass diese Maximen nicht immer befolgt werden. Aber er stellte klar, dass wenn man sie nicht beachtet, man wenigstens dem Kooperationsprinzip folgt, so dass man aufgrund der Tatsache, dass der Gesprächsteilnehmer kooperativ ist, etwas erschließen kann. Auch im folgenden Beispiel kann man erkennen, dass die Maxime nicht beachtet wird:
Die Kundin fragt den Detektiv: Sagen Sie es mir, geht mein Mann mir fremd? und der Detektiv antwortet: Nun ja, er besucht Frau Lewinsky oft.
Man muss vom Gesagten, also von dem konventionellen Gehalt oder der wörtlichen Bedeutung der sprachlichen Ausdrücke und der zusätzlichen Bedeutung, die nicht darin enthalten ist, unterscheiden. Diese zusätzliche Bedeutung, die wir vom Gesagten und auf Grundlage des Kooperationsprinzips erschließen, heißt konversationelle Implikatur. Das Gesagte enthält die Information, dass ihr Mann Frau
Implikatur
Den Begriff Implikatur entwickelte Grice zur Abgrenzung von der Implikation, der semantischen Folgerung, die allein aus dem semantischen Gehalt entsteht.

Lewinsky oft besucht. Aus dem Kontext, also einer Gesprächssituation zwischen Kundin und Detektiv, der den Ehemann observieren sollte, kann man die Implikatur ableiten, dass der Ehemann seine Gattin mit Frau Lewinsky betrügt.
Konversationelle Implikaturen
Implikaturen können durch Befolgung, Missachtung und Widerstreit der Maximen entstehen.
Implikaturen, die bei Befolgung der Maximen entstehen, werden Standardimplikaturen genannt. Schauen wir uns einige Beispiele an, bei denen die Standardimplikatur kursiv ist:
Maxime der QualitätMax hat zwei Schwestern. → Ich glaube das und
habe ausreichend Beweise dafürHat Max einen Bruder? → Ich weiß nicht, ob es so
ist und will wissen ob es so istMaxime der Quantität
Max hat drei Kinder. → Max hat nur drei Kinder Einige Fahrtickets werden teurer. → Nicht alle
Fahrtickets werden teurerMax behauptet, dass er einen Bruder hat. → Ich weiß nicht, ob Max einen Bruder hat oder nicht
Maxime der RelationA: Mir ist das Benzin ausgegangen. B: Um die Ecke
ist eine Tankstelle. → Die Tankstelle ist offen A: Weißt du, wie spät es ist? B: Nun ja, der
Milchmann war schon da. → Es ist schon nach 10 Uhr
Maxime der ModalitätMax trank einen Tee und ging ins Bett. → Max
trank zuerst einen Tee und ging danach ins Bett
Um die Maxime der Qualität zu beachten, muss man Evidenz für seine Äußerung haben. Bei der Beachtung der Maxime der Quantität wählt man immer den treffendsten Ausdruck. Sagt man also explizit, ich glaube, deutet das immer an, dass man keine Evidenz hat. Wir werden auf solche Implikaturen noch näher eingehen. Die Maxime der Relation wird auch Maxime der Relevanz genannt. Wenn man davon ausgeht, dass die Äußerung des Gesprächsteilnehmers relevant ist, muss man sie so interpretieren, dass

die Frage beantwortet wird. B muss also annehmen, dass A nicht die genaue Uhrzeit weiß, dass aber aus seiner Antwort eine ungefähre Uhrzeit abgeleitet werden kann. Insofern ist B kooperativ. Die wichtigste Untermaxime der Modalität, die Beachtung der Reihenfolge, verhindert obskure Äußerungen wie *Der Cowboy ritt davon und sprang aufs Pferd.
Bei der Missachtung oder Ausbeutung der Maximen bleibt das Kooperationsprinzip trotzdem erhalten. Das heißt, auch wenn der Sprecher offensichtlich gegen eine Maxime verstößt, unterstellt der Hörer ihm, er sei kooperativ und sucht nach einer geeigneten Implikatur. Schauen wir uns einige Beispiele der Missachtung an:
Maxime der QualitätKönigin Victoria war aus Stahl → Sie war gefühlskalt.
A: Ich habe jetzt einen Doktortitel. B: Oh ja, und ich bin der Kaiser von China! → B glaubt A nicht
(Kontext: Max tanzt nackt auf dem Tisch) Max ist wohl ein bisschen betrunken → Max ist stark betrunken
Oder wolltest du jetzt den Müll runterbringen? → Du willst sicherlich nicht den Müll runterbringen
Maxime der QuantitätKrieg ist Krieg. → da passieren nun mal schreckliche Dinge
(Kontext: gegen Ende der Vorlesung) A: Wie spät ist es? B: Es ist 11:44 und 45 Sekunden!→ Juchu, gleich ist Schluss
Maxime der RelationA: Hast du schon gehört, was Max... B: Oh ja, wirklich schönes
Wetter heute. → Pass auf, Max steht hinter dir! A: Wollen wir noch Playstation spielen? B: Was machen denn deine
Hausaufgaben? → Mach erst die Hausaufgaben!Maxime der Modalität
Die Sängerin brachte eine Reihe von Tönen hervor, die der Arie aus Rigoletto verdächtig nahe kamen → Die Sängerin hat nicht so gut
gesungen
Wie wir gesehen haben, gehen viele Stilmittel wie Metaphern, Ironie, Über- und Untertreibung und rhetorische Fragen aus der Ausbeutung der Maximen hervor. Die Metapher können wir erschließen, weil wir wissen, dass die Königin offensichtlich nicht über die definitorischen Eigenschaften von Stahl verfügt, sondern eher einige beiläufige wie Härte, Unbiegsamkeit oder Beständigkeit. Die Missachtung der Maxime der Relation ist laut Grice nicht häufig. Wenn sie oft missachtet würde, empfänden wir die Gespräche nicht als kohärent, sondern als völlig zusammenhanglos.
Ein Widerstreit zweier Maximen lässt sich folgendermaßen erklären:

A: Wann kommt der Film?B: Irgendwann nächste Woche. B implikiert, dass er es nicht weiß.
A hat eine Informationsfrage geäußert und geht davon aus, dass B informativ antwortet. A ist aber klar, dass B keine Information gegeben hat. B verletzt also die Maxime der Quantität, denn seine Äußerung war uninformativ, um die Maxime der Qualität einzuhalten.
Auch die Maximen sind Grundlage, ob sie eingehalten werden oder nicht. Darüber hinaus muss man den Kontext kennen, sowie bestimmte Hintergrundinformationen. All das muss sowohl vom Sprecher, als auch vom Angesprochenen wechselseitig gewusst werden, sonst können Fehlinterpretationen wie folgende passieren:
Auf die Frage, was ihm denn an seinem neuen Auto, dem McLaren MP4-22, am besten gefalle, sagte Fernando Alonso vergangene Woche 'die Farbe' und, das Auto sei noch nicht annähernd soweit, dass es in Australien siegfähig sei. Diese Aussage brachte dem Spanier einige Kritik ein, der jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur EFE seinen Kommentar relativierte. So, wie es dargestellt worden sei, sei es völlig falsch interpretiert worden und hätte ihn 'ziemlich unprofessionell' aussehen lassen, erklärte Alonso. 'Es wurde so dargestellt, als hätte ich etwas Schlimmes gesagt.'
Oder folgendes Beispiel: John Kerrys Äußerung über US-Soldaten im Irak:
Wer hart studiert, seine Hausaufgaben macht und versucht, clever zu sein, kann es zu etwas bringen. Wenn nicht, dann endet man im Irak.
Später versuchte er, die daraus entstehende Implikatur zu relativieren: Er bedauerte seine Wortwahl, die falsch interpretiert worden sei, und entschuldigte sich bei all jenen, die sich dadurch beleidigt gefühlt haben.
Man kann Implikaturen gezielt nutzen, um gewisse Dinge anzudeuten, die man nicht direkt sagen möchte. Dabei muss aber auch die Möglichkeit der Fehlinterpretation berücksichtigt werden.
Eigenschaften konversationeller Implikaturen
Nun wissen wir, wie Implikaturen entstehen können. Doch welche Eigenschaften zeichnen sie aus und wie kann man sie dadurch von anderen Implikaturen und ähnlichen Phänomenen unterscheiden? Im Unterschied zu z.B. Implikationen werden Implikaturen aus Äußerungen und nicht aus Sätzen abgeleitet. Wie wir anhand des Schemas zur Erschließung konversationeller Implikaturen bereits gesehen haben, sind sie berechenbar, also aufgrund des Kooperationsprinzips und der Maximen erschließbar. Die meisten pragmatischen Inferenzenaufhebbar. Das bedeutet, dass man mögliche Implikaturen annullieren. Es kann sein, dass eine Implikatur aufgrund des

Kontexts aufgehoben wird, man kann sie aber auch explizit annullieren, was bei Implikationen unmöglich ist.
Stellen wir uns folgenden Satz vor:Anne hat drei Kinder. Daraus folgt die Implikation: Anne hat zwei Kinder. Und aufgrund der Maxime der Quantität wird implikatiert: Anne hat nicht mehr als drei Kinder
Man kann die Implikatur nun folgendermaßen explizit aufheben: Anne hat drei Kinder, wenn nicht mehr. Indem man die Implikatur in einem Wenn-Satz anfügt, hat man sie suspendiert, d.h. der Sprecher macht seine Unsicherheit bezüglicher der Implikatur deutlich. Bei der Implikation ist das nicht möglich: *Anna hat drei Kinder, wenn nicht zwei. Implikaturen kann man auch ohne Widerspruch offen annullieren. Der Sprecher nimmt damit die Implikatur explizit zurück, wie Anne hat drei Kinder, ja sogar vier., was bei Implikationen nicht möglich ist: *Anne hat drei Kinder, ja sogar zwei
Weiterhin sind Implikaturen nicht-abtrennbar. Sie beruhen also nicht auf der sprachlichen Form, sondern auf dem semantischen Gehalt der Äußerung. Betrachten wir dazu folgendes Beispiel:
Ein Kapitän und sein Maat verstehen sich nicht gut. Der Maat ist ein schwerer Säufer, und der Kapitän versucht, ihn so rasch wie möglich loszuwerden. Als der Maat wieder einmal sternhagelvoll ist, schreibt der Kapitän in sein Logbuch: 'Heute, 23. März, der Maat ist betrunken'. Während seiner nächsten Wache liest der Maat diese Eintragung. Er überlegt, was er dagegen tun kann, ohne sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Er macht folgende Eintragung in das Logbuch: 'Heute, 26. März, der Kapitän ist nicht betrunken.'
Der Maat hat gegen die Maxime der Relation verstoßen. Da man aber annehmen kann, dass er das Kooperationsprinzip beachtet und man weiß, dass in Logbüchern wichtige Ereignisse dokumentiert werden, implikatiert er konversationell, dass der Kapitän normalerweise betrunken ist. Hätte der Maat statt: Der Kapitän ist nicht betrunken - Der Kapitän ist nüchtern geschrieben, hätte er also die sprachliche Form geändert, hätte sich die Implikatur nicht geändert.
Konversationelle Implikaturen sind nicht-konventionell, sie sind also nicht Teil der konventionellen Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken. Implikaturen haben die wörtliche Bedeutung der Äußerung als Grundlage, d.h. man muss die Bedeutung kennen, bevor man eine Implikatur ableiten kann. Insofern können sie nicht Teil der Bedeutung sein. Wären sie Teil der Bedeutung, könnte man sie auch nicht tilgen. Ein Ausdruck mit nur einer Bedeutung kann in verschiedenen Kontexten verschiedene Implikaturen erzeugen. Das haben wir bereits bei dem Beispiel Königin Victoria war aus Stahl gesehen, das je nach Situation bedeuten kann, dass sie standhaft und unerschütterlich, oder auch gefühlskalt war. Wie bereits angedeutet wurde, sind Implikaturen kontextabhängig. Stellen wir uns vor, eine Familie will in den Zoo gehen. Für Kinder unter 14 Jahren gilt dort ein ermäßigter Eintrittspreis. Die Kartenverkäuferin fragt nun, wie alt das Kind ist, und die Mutter sagt: Es ist elf Jahre alt. Die Implikatur Es

ist nicht zwölf Jahre alt muss nicht abgeleitet werden, da in diesem Kontext nur wichtig ist, dass für das Kind der ermäßigte Preis gezahlt werden kann. Außerdem sind Implikaturen verstärkbar, ohne dass redundante Aussagen entstehen: Viele Kinder gehen gern in den Zoo, aber nicht alle. Bei Implikationen funktioniert dieser Test nicht: *Viele Kinder gehen gern in den Zoo, aber nicht einige. Vermutlich sind Implikaturen auch universal, entstehen also sprachübergreifend so.
Implikaturtypen
Wir haben konversationelle Implikaturen bereits ausführlich kennengelernt. Man kann sie dahingehend unterscheiden, ob die Maximen, beachtet oder missachtet werden. Sie lassen sich aber auch in Bezug auf den Kontext unterscheiden in generelle (oder generalisierte) und partikuläre ( oder partikularisierte) Implikaturen. Generelle Implikaturen entstehen, ohne dass ein besonderer Kontext nötig ist. Äußert man also: Die meisten Kinder mögen Zuckerwatte. so entsteht immer die Implikatur: Nicht alle Kinder mögen Zuckerwatte. Das lässt sich mit einer sprachlichen Skala erklären, die aus einer Menge kontrastierender Ausdrücke derselben grammatischen Kategorie besteht, die hinsichtlich ihrer Informativität geordnet sind. Beispiele solcher Skalen wären:
<n, ... 3, 2, 1><immer, oft, manchmal><heiß, warm><lieben, mögen>
Diese Skala für unseren Beispielsatz wäre <alle, die meisten, viele, einige, wenige>. Wählt der Sprecher nun einen Ausdruck auf dieser Skala, implikatiert er aufgrund der Maxime der Quantität, dass der stärkere Ausdruck aus der Skala nicht gilt. Solche Implikaturen werden auch skalare Implikaturen genannt. Weil sie auf der Maxime der Quantität beruhen, werden sie auch generelle Quantitätsimplikaturen genannt, wie auch die folgenden, klausalen Implikaturen. Sie werden erzeugt, wenn ein Sprecher einen Ausdruck wählt, der nicht auf die Wahrheit des eingebetteten Satzes festlegt, statt einen möglichen, stärkeren Ausdruck, der darauf festlegt, implikatiert er, dass er nicht in der Lage ist, eine stärkere Aussage zu machen. Sagt man also: Ich glaube, dass es morgen regnen wird. statt Ich weiß, dass es morgen regnen wird. implikatiert man, dass es möglich ist, dass es morgen nicht regnen wird. Auch die Äußerung Wenn ich im Lotto gewonnen habe, bin ich reich. erzeugt eine klausale Implikatur, was bei der Äußerung Da ich im Lotto gewonnen habe, bin ich reich. nicht der Fall ist, da sie den stärkeren Ausdruck enthält.
Im Gegensatz zu den generellen entstehen partikuläre Implikaturen nur bei bestimmten Kontexten. Die Äußerung Der Hund sieht sehr zufrieden aus. implikatiert Vielleicht hat der Hund den Braten gefressen. nur dann, wenn es in einer bestimmten Situation geäußert wird: A: Was ist mit dem Braten passiert? B: Der Hund
oben

sieht sehr zufrieden aus. Während die meisten generalisierten Implikaturen Standardimplikaturen sind, entstehen partikuläre überwiegend bei der Ausbeutung der Maximen. Bei Befolgung der Maxime der Relation werden allerdings auch partikuläre Implikaturen erzeugt, da Äußerungen nur in Bezug auf den jeweiligen Kontext relevant sein können.
Alle bisherigen Implikaturen basierten auf dem Kooperationsprinzip und den Maximen. Das ist bei den konventionellen Implikaturen nicht der Fall, denn diese werden per Konvention mit bestimmten lexikalischen Einheiten oder Ausdrücken verbunden. Betrachten wir die beiden Äußerungen: Du bist der Ministerpräsident. und Sie sind der Ministerpräsident. Es werden zwei unterschiedliche sozialdeiktische Ausdrücke verwendet, um die soziale Beziehung und den gesellschaftlichen Status zwischen den Gesprächsteilnehmern auszudrücken. Die Implikatur, dass der Angesprochene sich auf einer gesellschaftlich anderen Stufe befindet, wird allein durch diesen sozialdeiktischen Ausdruck generiert. Die Äußerung Nur Linguisten beschäftigen sich mit diesen Themen. implikatiert konventionell Niemand sonst beschäftigt sich mit diesen Themen. durch den konventionellen Gehalt des Ausdrucks nur. Diese Implikaturen haben andere Eigenschaften als die konversationellen. Sie sind, da sie ja nicht auf Maximen beruhen, sondern durch Konventionen vorgegeben sind, nicht berechenbar. Sie sind nicht-tilgbar, da sie nicht auf aufhebbaren Annahmen über die Art des Kontextes beruhen. Da sie von bestimmten Ausdrücken erzeugt werden, sind sie abtrennbar (Vgl. du/Sie).
In dieser Übersicht sind die wichtigsten Implikaturtypen noch einmal zusammengefasst:
Folgen von Grice' Implikaturtheorie
Die Theorie von Grice löste viele Diskussionen aus. Grice selbst betonte, dass es sich beispielsweise bei den Maximen nur um Vorschläge handelt. Er deutet unter anderem an, die Maxime der Qualität als grundlegender anzusehen, da die anderen Maximen nur zur Anwendung kommen, wenn man davon ausgeht, dass die Maxime der Qualität beachtet wird. Auch wenn seine Theorie ein Klassiker ist, wurden daran viele Veränderungen vorgenommen. Diese waren mehr oder weniger tiefgreifend, so dass sich zwei Richtungen durchgesetzt haben: die Neogrice'sche Betrachtungsweise, bei der die Maximen etwas anders anordnet und reduziert werden, so dass aber immer
oben

noch eine Ähnlichkeit zu Grice Theorie erkennbar ist, im Gegensatz zur Relevanztheorie, die die Annahmen von Grice völlig revidieren. Sie unterstellen der Konversation nur ein Relevanzprinzip, doch unter Relevanz wird hier ein allgemeines kognitives Prinzip der Informationsverarbeitung verstanden. Der Kontext entscheidet über die Relevanz einer Äußerung. Je mehr man also über den Kontext schon erschließen kann, umso relevanter ist die Äußerung und umso weniger bedarf es eines kognitiven Aufwandes bei dem Hörer. Um die Kommunikation zu optimieren, muss der Sprecher daher den im jeweiligen Kontext relevantesten Satz äußern. Die Neogrice'sche Theorie geht anders vor. Da die natürliche Sprache sich nach dem Prinzip der geringsten Anstrengung richtet, gehen sie von einer Hörer- und einer Sprecherökonomie aus. Hörerökonomie wird erreicht, wenn man sich an das Quantitätsprinzip hält: Mache deinen Beitrag hinreichend für das Verständnis des Hörers, sage so viel du sagen kannst. Sprecherökonomie wird durch die Forderung des Relevanzprinzips Mache deinen Beitrag notwendig für das Verständnis des Hörers, sage so viel du sagen mußt (um noch verstanden zu werden). gewährleistet. Durch das Q-Prinzip wird erreicht, dass nicht mehr Informationen gegeben werden. Die Aussage p implikatiert also höchstens p. Durch das R-Prinzip entstehen Implikaturen, die mehr Informationen geben, so dass die Aussage p mehr implikatiert als p. Der Sprecher sagt also nur das Notwendigste und der Hörer folgert daraus weitere Informationen.
Implikatur zwischen Semantik und Pragmatik
Implikaturen sind Schlussfolgerungen, die wir auf Grundlage von Äußerungen ziehen. Doch sie sind keinesfalls direkter Bestandteil unserer Aussagen. Sie werden also nie allein durch den semantischen Gehalt des Satzes erklärt werden können. Von daher haben Implikaturen einen festen Platz innerhalb der Pragmatik. Man kann sogar soweit gehen und behaupten, die Rolle der Pragmatik ist bei der Bestimmung eines Satzes bzw. dessen Proposition ist viel größer als angenommen. Betrachten wir den Satz: Harald drückte auf den Knopf und der Fernseher ging an. Wahrscheinlich würde jeder, der diesen Satz liest, annehmen, es handelt sich um einen Knopf auf der Fernbedienung. Innerhalb der Semantik kann man von mehreren Bedeutungen von Knopf ausgehen, z.B. einen Knopf an Kleidungsstücken, ein Knopf an einem Gerät etc. doch welche Bedeutung grundlegend ist, kann allein durch den Kontext bestimmt werden. Auch die Schlussfolgerung, dass der Fernseher aufgrund des Knopfdrucks anging, ist rein pragmatisch. Wie wir sehen, kann eine sehr enge Verbindung zwischen Semantik und Pragmatik bestehen.
oben