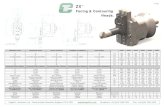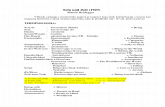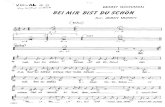Analyzing Free-Improvised Music: Four Improvisations by Trombonist Ben Gerstein
INFORM_07
-
Upload
art-media-edition-verlag-freiburg -
Category
Documents
-
view
218 -
download
4
description
Transcript of INFORM_07

DESIGN > ANGEWANDTE KUNST > FORMGESTALTUNG
MINIMALISMUS
02– 04 |2008
NR. 7 AUSGABE OST- & WESTSCHWEIZ > ELSASS > SÜDDEUTSCHLAND


ED
ITO
RIA
L
Weil weniger mehr ist
Zur Fastenzeit, liebe Leserinnen und Leser, widmet sichInform einer Stilrichtung in Design, Kunst und Architek-tur, die sich durch maximales Weglassen alles Überflüssi-gen definiert: dem Minimalimus.
Das Bedürfnis, Ballast abzuwerfen, um zum Wesentlichenvorzudringen kann sich auf Körperfett – aber genausoauch auf unnötigen Wohn-Nippes beziehen. Das aus sol-chen Gefühlslagen resultierende und in unseren Breitenoft mit dem Frühjahrsputz einhergehende „Große Symbo -lische Wegwerfen“ befreit uns vom Rauschen der Dingeund danach lässt sich plötzlich störungsfreier denken.
Und erst nach diesem befreienden Akt kann das erneuteSchlemmen und Hinzufügen eigentlich überflüssiger Din-ge in die einmal geleerten Räume regelrecht zelebriertwerden. Dann wirkt der simple Zierrat wie die erste Mahl-zeit nach einer Mayr-Kasteiung: so bedeutend.
Dass die in unserem Kulturkreis selbstverständliche Kon-notation von Entsagung und dem Begriff des „Wesentli-chen“ kulturhistorisch bedingt ist, wird die Ihnen vorlie-gende Inform-Ausgabe nicht vorenthalten. Ob Askeseoder Opulenz – alles hat seine Zeit.
Angenehme Lektüre wünschenRegina Claus und Björn Barg
04 ESSAYMinimalismus Eine Annäherung
08 THEMAMinimalismus Wenn weniger dran ist, muss mehr drin sein
13 ARTEFAKTGut gefunden
14 PERSONAIm Gespräch mit Christoph Dietlicher Neue Werkstatt Winterthur
19 TEXTNeu erschienene Bücher
20 EXPOMax Bill Retrospektive zum 100. Geburtstag des „Konkreten“
22 INSTITUTIONHochschule für Gestaltung Ulm Ein Rückblick
24 PORTRAITWir sind Originale Seipp Wohnen in Waldshut
27 SCHMUCKTENDENZEN ZÜRICHStefan Wettstein
29 LICHTBLICKJunges Lichtdesign
31 TIPPSEmpfehlenswert
35 AGENDATermine von Februar bis April
39 Impressum
INH
ALT
03

Minimal Music oder auch Minimal Art sind eingeführte Stil-richtungen. Dagegen Minimal Design?… Unbekannt. Das kommt nicht von ungefähr. Im deutschen Sprachraum istder Gestus des Konzentrierten und Reduzierten, mit anderenWorten des Minimalistischen dem Design nämlich gewisser-maßen inhärent. Das rührt daher, dass dieser Begriff, der sichhierzulande erst in den Achtzigerjahren für das allgemeinere„Gestaltung“ einbürgerte, quasi gleichbedeutend ist mit In-dustriedesign, das bald nach seiner Entstehung strikten Vor-gaben (Form, Produktion, Kostenstruktur) unterworfen wur-de. Ist Industriedesign also gewissermaßen „von Natur aus“minimalistisch? Das nun auch wieder nicht. Nicht zuletzt dassogenannte postmoderne Design der Achtzigerjahre hat zuzeigen versucht, dass es auch anders geht. Durch Einführungeines Anarchie-Momentes (Formen, Farben, Materialien) he-belte es das Technoide, Rationale und Reduzierte aus, das fürdie klassische Moderne kennzeichnend ist.
Minimalismus ungleich Funktionalismus > Zugleich seihier ins Gedächtnis gerufen, dass nicht jeder Minimalismusauch funktionalistisch ist. Es gibt einen Minimalismus, der ei-ner Geste der Kontemplation und Innerlichkeit entspringt,und nicht – bei allem Respekt dafür – den Ingenieurswissen-schaften (Form folgt Funktion) oder konstruktiver Logik (mo-dulare Systeme). In Europa wäre hier die Jahrhunderte alteKultur mönchischen Lebens zu nennen, etwa der Benedikti-ner, Zisterzienser oder Trappisten, bei denen äußerste mate-rielle Anspruchslosigkeit zum spirituellen Programm gehört.Bis heute beeindruckt die karge Ausgestaltung ihrer Kirche-ninnenräume oder des klösterlichen Refektoriums (Speise-saal). Man mag hier auch an die keramischen Arbeiten einesTheodor Bogler denken, in denen frappierend gegensätzlicheEinflüsse konvergieren: Im Ersten Weltkrieg hochdekorierterSoldat, als Schüler von Johannes Itten und Lyonel Feiningeram Bauhaus hochsensibler Künstler-Handwerker und ab 1927bis zu seinem Lebensende Benediktinermönch, schuf Boglerspät im Leben in der Klostertöpferei Maria Laach vulkanasche-farbene Tonbecher, deren vergeistigte Schlichtheit eine Annä-herung an die Metaphysik zu vollziehen scheint.
Im protestantischen Milieu waren es die freikirchlichenShaker, die Ende des 18. Jahrhunderts von England nachNordamerika auswanderten und als geschickte Tischler undDrechsler ihre eigenen Möbel schufen. Deren kunstvoll-schmucklose Zweckmäßigkeit rief Befremden bei den Zeitge-nossen und Bewunderung bei zahlreichen Vertretern der Mo-derne hervor. Als sie auf der Weltausstellung in Philadelphia1876 die Kaffeehaus-Stühle von Michael Thonet, das ersteSerienmöbel der Welt, kennen lernten, begannen auch sieMöbel im Bugholzverfahren herzustellen.
Richte Dich zweckmäßig ein > Nach der noch handwerk-lich orientierten Arts and Crafts-Bewegung und manchen Ju-gendstil-Entwürfen gehören die „Maschinenmöbel“ des Ar-chitekten Richard Riemerschmid von 1906 zu den ersten Ent-würfen, die konsequent aus dem Geist der Fabrikproduktionentwickelt wurden: Rationell zu fabrizieren, platzsparend zuverschicken und leicht zu montieren, waren sie auch für Ar-beiter und kleine Angestellte erschwinglich. Besonders enga-giert trat Karl Schmidt, Gründer der Deutschen Werkstättenbei Dresden, wo die Maschinenmöbel produziert wurden, fürden „Aufbruch zum Neuen Wohnen“ ein – sekundiert durchden ihm befreundeten Verleger Ferdinand Avenarius. Bereits1900 hatte dieser in seiner Zeitschrift „Kunstwart“ katego-risch gefordert: „Richte Dich zweckmäßig ein“, aber auch:„fürchte Dich nicht vor der Form“. Gemeint war natürlich dieneue Form, die als gute Form – moralisch wie ästhetisch – ei-ne verschlankte sein sollte und auf den damals üblichen „an-gepappten“ Zierrat verzichten.
Der 1907 gegründete Deutsche Werkbund, ein Zusam men -schluss von Künstlern und Unternehmern, die sich der „Ver edelung der gewerblichen Arbeit“ verschrieben hatten,nahm diesen Auftrag auf und popularisierte ihn wirkmächtigdurch Ausstellungen, Publikationstätigkeit und gezielte Ko-operationen. Von der Staatlichen Kunsthochschule Bauhaus
> MINIMALISMUS | Eine AnnäherungE
SS
AY
04
Teekanne mit Tütengriff, von Theodor Bogler, 1923; Klassik Stiftung Weimar; Foto: Kloster
Maria Laach; Japan und der Westen, Kunstmuseum Wolfsburg
Bugholzstuhl S14 von Thonet;
Entwurf: Michael Thonet,1859

(1919-1933) wurde diese Erziehung zur Sachlichkeit empha-tisch fortgeführt und später für Industrie-Entwürfe radikali-siert in die Formel „Form folgt Funktion“ gegossen. Wennauch in dieser Atmosphäre genialische Entwürfe entstandenwie zum Beispiel Freischwinger-Stühle, mochten manche Re-former der ersten Stunde wie Schmidt oder Riemerschmiddiesem Geist nicht mehr folgen, indem sie mit dem Lebens-philosophen Ludwig Klages (Klages-Rede „Mensch und Er-de“, Hoher Meißner 1913) darin die Entmachtung des Orga-nischen (Natur) durch das Mechanische (Maschine) heraufzie-hen sahen.
Weniger ist mehr > Konträr zum „Frankfurter Küchen-stuhl“, einem bemerkenswert nutzungsgerechten anonymenDesign aus den Dreißigerjahren, der als „Olympiastuhl“ (Fa.Bomben stabil) 1936 ein Bestseller wurde und bis Ende derAchtziger fester Bestandteil der Hinterzimmer von Post, Bahnund anderen deutschen Ämtern war, zeichnet sich der „UlmerHocker“ durch eine auf die Spitze getriebene Abstraktion aus,bei der die Bedürfnisse des Be-Sitzers zurückstehen müssen.Modern und schön ist, wenn es wehtut. Ein Geist, den die Ul-mer Hochschule für Gestaltung (1953– 1968) als Erbin desBauhaus am Reißbrett konsequent entwickelte. War der Funk-tionalismus des Bauhaus vielfach noch überraschend und nierecht ein Massenphänomen, gelang es dem nunmehr weiterentfleischten und zugleich demokratisch überhöhten Minima-lismus Ulmer Prägung, dem bundesrepublikanischen AlltagSchritt für Schritt seinen Stempel aufzuprägen. FortschrittlicheKonsumenten demonstrierten jetzt mit Eiermann-Sofa undBraun-Rasierer ihren Abschied von der als restaurativ empfun-denen Adenauer-Ära. Man denke auch an die im modernenWohnzimmer oft freigestellte Phonoanlage SK4 von Braun,auch bekannt als „Schneewittchensarg“. Einbalsamierte Mo-derne und also das Ende der Designgeschichte? Pop und Post-moderne haben sich betont anti-minimalistisch gegen diesenPurismus aufgelehnt und neue Denk- und Spielräume ge-schaffen. Eine überzeugende eigene Haltung im Sinne vonKlages haben sie nicht entwickeln können.
Gutes Design ist so wenig Design wie möglich > Seit denNeunzigerjahren wird Design wieder „weniger“, um mit Die-ter Rams' berühmtem Diktum zu sprechen. Eine neue Gene-ration, darunter der Brite Jasper Morrison und der zwischenOberursel, London und New York pendelnde Philipp Mainzervon e15 könnte man als Vertreter einer zweiten „geläuter-ten“ Moderne bezeichnen. Sie setzen undogmatisch auf In-telligenz und Substanz und neuerdings auch Nachhaltigkeit.Werthaltigkeit spielt wieder eine große Rolle. Aber mankommt mit weniger Chrom und Stahlrohr aus und traut auchNaturmaterialien die Fähigkeit zu, zeitgemäß zu sein. Überseinen Cork Chair sagt Jasper Morrison: „Ich suche nach ei-ner Form, die dem Material entspricht und gleichzeitig einGeheimnis daraus macht, wo und warum der Stuhl entstan-den ist.“ >>>
S533R von Thonet;
Entwurf: Mies van der Rohe, 1927
Ulmer Hocker, Sgabillo von Zanotta;
Entwurf: Max Bill 1950 /54
Frankfurter Stuhl, Magazin Stuttgart;
Entwurf: Anonym, um 1930
05

Abb. oben / links: Cork Chair von Jasper Morrison;
Vitra Edition 2007
Abb. unten: Chair von Naoto Fokasawa;
Vitra Edition 2007
06

Abb. oben / links: Hocker Modell Backenzahn von e 15; Entwurf: Philipp Mainzer
Naoto Fukasawa gelingt mit seinen Entwürfen eine formalähnlich überzeugende, dabei zugleich verrätselte Rhetorik.Auf den Spuren buddhistischer Tradition arbeitet er im Hin-tergrund an seinem Projekt without thought, das davon aus-geht, dass Menschen auch unbewusst mit ihrer Umwelt kom-munizieren. Eine sehr asiatische Herangehensweise, etwas zuentwerfen, was in der Umwelt „aufgehen“ soll.
Bis zum Ideal der „erfüllten Leere“ des traditionellen Japan,das aus dem Geist der Zen Objekte ihre „minimalistische“Gestalt verleiht, ist es da kein großer Schritt. Teeschalen undWassergefäße, Masken, Zeichnungen oder auch Samurai-schwerter waren bis zum 27. Januar in der Ausstellung„Japan und der Westen“ im Kunstmuseum Wolfsburg zusehen, wo sie Kunstwerken westlicher freier Künstler ge-genübergestellt waren, die damit auf japanische Impressio-nen reagierten. Minimalismus hat verschiedene Gesichter,modern ist er nicht unbedingt.
Nike Breyer
07

THE
MA
08
Gebrauchsgegenstände von Jasper Morrison oder Naoto Fukasawa werden neuerdings „supernormal“ genannt. Sievermeiden Schnickschnack, sind angeblich super, weil sieden Alltagsbedürfnissen und dem Verhalten der Menschenoptimal entgegenkommen wollen, ohne sich selbst als Stil-träger aufzudrängen. Die Muji-Welle kommt bestimmt. Wa-rum bezeichnet man diese Produkte nicht mehr als „mini-malistisch“? Das normale Design hat fünfundzwanzig Knöp-fe und elektrisiert die eifrigen Leser mit Bedienungsanleitun-gen, das supernormale hat drei und macht den Super nor -malen superzufrieden, das minimalistische hat irgendwo ei-nen, den man unter Umständen nicht finden kann. Andersals ein funktionalistischer Gegenstand verbirgt es verschämtseine Mechanismen unter einer opaken Oberfläche, der klei-ne freche Fetisch.
Der Minimalismus hat eine widerspruchsvolle Geschichte undist mitnichten mini oder etwa bescheiden. Schließlich leitet ersich von einem nicht mehr steigerungsfähigen Adjektiv ab,ein Superlativ, der ohne „normal“ auskommen will. Schlag-zeilen, die den Minimalismus feiern, raten etwa so zum Mö-belkauf: „Schlicht und zeitlos statt bunt und überladen“. Wiekommt man auf die Idee, das Schlichte, respektive Puristi-sche, sei zeitloser als das Überladene? Man glaubt immer
noch an einen Kern der Dinge. An das Wesen von irgendwas,das sich enthüllt, wenn man „Überflüssiges“ entfernt. EinGedanke, der mindestens bis Platon zurückreicht und sich inder gestalterischen Moderne als Reduktion bemerkbar mach-te, bei der Funktion dann aber fündig geworden zu seinschien. Das less is more, was oft als Überschrift für den Mini-malismus herhalten muss, stammt von einem Modernen,vom Architekten Mies van der Rohe, der ein Gebäude häute-te, um das Skelett sichtbar zu machen. Während das bei ei-nem Postmodernen wie Robert Venturi nur Gähnen auslöste,– less is bore – war es den europäischen Architekten derAchtzigerjahre nicht less genug. Sie suchten nach der Seeleder Architektur, die sie in Raum, Licht und Material vermute-ten und versteckten alle Funktionen. Der minimalistische Ar-chitekt reinigt die Bauten von den komplizierten Kinkerlitz-chen der Postmoderne und des Dekonstruktivismus. Die Mis-sion des Minimalisten ist es, dem Menschen einen ruhigenOrt zu geben, an dem er sich von überfüllten U-Bahnen, ent-fremdeten Arbeitsverhältnissen und chaotischen Beziehun-gen erholen kann, also vom Leben, um sich auf seine eigeneExistenz zu besinnen. Die Berufung auf die Bauweise derShaker, der Zisterzienser und des Zen ist nicht zufällig. Auchwenn Schwimmbad, Wohnung oder Museum dransteht, sindes Kirchen, die zur Besinnung einladen.
> Minimalismus | Wenn weniger dran ist, muss mehr drin sein
Peter Zumthor, Kunsthaus Bregenz; © Foto: Hélène Binet

Alberto Campo Baeza, Edouardo Souto de Moura und dieSchweizer Diener et Diener sowie Gigon /Guyer stehen fürkompakte, introvertierte Gebäude, die ihre Materialien derUmgebung entlehnen. Peter Zumthor ist mit seiner Felsen-therme in Vals bekannt geworden. Reduziert auf die sinn -lichen Erfahrungsqualitäten von Fels, Wasser und Licht wirddie Geologie der umliegenden Berge in einen inneren Raumaufgenommen, der über die optischen und taktilen Erinne-rungen das Individuum als Ganzes erreichen soll. Das kriti-sche Moment des Minimalismus, die Beziehung zwischen In-nen und Außen, wird vielleicht am komplexesten verdeutlichtin den Gebäuden Tadao Andos, dessen Church on the Waterin Hokkaido von 1988 ganz japanisch Landschaft und Ge-bäude ineinander übergehen lässt. Zur selben Zeit entstanddie Church of Light in Ibaraki /Osaka, deren einzige Verbin-dung zum Außen aus einem Lichtkreuz besteht, das die ge-samte Altarwand einnimmt.
Hier entfaltet eine minimale Formensprache maximale Wir-kung und komplexe Konzentration. Das Negativ eines Fens-terkreuzes spielt mit den Polen von Introversion und Extrover-sion. Was ist, wenn minimalistische Architektur den natürli-chen oder sakralen Raum verlässt und als städtisches Wohn-haus Stellung nehmen muss zu dem, was das tägliche Lebenkennzeichnet, dem Gegensatz zwischen Privatheit und Öf-fentlichkeit?
Andos Azuma House in Sumiyoshi aus den Siebzigerjahrenschottet sich provozierend gegen das Chaos der umliegen-
den Häuser ab und scheint als schöner Bunker mit seiner sei-digen fensterlosen Oberfläche den Begriff der Neunzigerjah-re, das Cocooning, vorwegzunehmen: müde von den Zumu-tungen des Konsums und Überflusses zog sich der Gutsituier-te in rein puristische Genüsse zurück, zum Beispiel in ein ele-gantes Appartement John Pawsons, der die Moral des kriti-schen Verzichts predigte. Wie weit diese Konsum-Kritikreicht, lässt sich an der Werbebotschaft der Calvin-Klein-Sto-res von 1994 ablesen: „Das erste von Pawson realisierte Objekt für Calvin Klein, derTokio-Store, besetzt eine genuin kommerzielle Struktur imHerzen des städtischen Mode-Bezirks. Inneres und Äußeresgehören verschiedenen Welten an. Der Eingang funktioniertals Dekompressions-Kammer, der das visuelle Chaos des ge-genwärtigen Japans ausfiltert und darauf vorbereitet, in dasruhige weiße Herz des Ladens zu gelangen. Der intensive Ge-brauch von Stein und natürlichem Licht schafft eine Umge-bung des ruhigen Luxus, in der die Kleidung in den natürli-chen Fokus der Aufmerksamkeit rückt.“
Dasselbe leistet Claudio Silvestrin für die Armani-Welt, derenRäumen Kritiker „mythische, archaische Heiligkeit“ beschei-nigen. Aus den üppigen Warentempeln früherer Zeiten, indenen jedermann Götzendienste vor exotischen Obstpyrami-den leisten durfte, waren weihevolle Orte der Askese gewor-den, deren Hemmschwellen für das Publikum reziprok zurGröße der Produkte wuchsen. Luxus und Armut hatten ihreVorzeichen gewechselt. Draußen stopften sich die Armen mitBurgern dick und kamen garantiert nicht mehr durch >>>
Peter Zumthor, Aussenbad mit Dampf / Therme /Vals; © Henry Pierre Schultz, Zürich
09

die Dekompressionskammer, drinnen schnupperten die runt-ergehungerten Reichen an Essentiellem: unsichtbaren Par-fums und zurückhaltenden Stoffen, bezahlt wurde erstmalsdiskret mit Karte. Strenge minimalistische Formen sind alsonicht per se tugendhaft. Auch wenn sie in der Lage sind,Sinnlichkeit und Aufmerksamkeit zu steigern, spielt immernoch eine Rolle, in wessen Diensten sie stehen. Bleibt die Fra-ge: finden die Architektur und die Menschen in diesen Räu-men tatsächlich zu sich selbst? Macht die minimalistischeRaumerfahrung frei zu oder von etwas? Oder kneift der Mi-nimalismus vor der Welt den Hintern zu?
Interessant ist der Rückblick auf die Minimal Art der Sechzi-gerjahre, ein zutiefst amerikanisches Phänomen, das demganzen Ismus seinen Namen gab, und als dessen Nachfolgerdie minimalistische Architektur gesehen wird. Welche Vor-stellung hatte sie vom Raum? Die teils enorme Größe minimalistischer Skulpturen, ihre ein-fache Geometrie, ihre serielle Anordnung und ihre Einbet-tung in die Umgebung lassen die Frage berechtigt erschei-nen, ob es sich dabei nicht um eine Weiterführung modernerTendenzen in den Raum handelt, die hin zur Architekturführt. Aber gerade von den Modernen wollten die Minimalis-ten nichts wissen. „Ich finde all diese geometrische Malerei –diese Post-Max-Bill-Schule – merkwürdig, sehr öde.“ Europäi-sche Kunst und das Bauhaus interessierten Donald Judd nichtdie Bohne. Wie die der europäischen Konstruktivisten gehor-
chen Judds, Flavins, Stellas und Morris` minimalistische Wer-ke einfachen geometrischen Ordnungsprinzipien. Die Motivewaren unterschiedlich. So sachlich die schwarzen Quadrateaus Europa auch wirken, sie richteten ihre Komposition nacheiner inneren Erfahrung von Proportion, Spannung und Ba-lance aus, einer individuellen Erfahrung verborgener, aber ge-ordneter Wirklichkeit. Als Moderne suchten die Konstruktivis-ten nach Wahrheit und Authentizität der Kunst. Judd: „Nun,diese [kompositorischen] Wirkungen sind mit den Strukturen,Werten und Gefühlen der ganzen europäischen Tradition ver-knüpft. Es ist mir recht, wenn diese im Kehricht landet.“ Den Minimalisten geht es nicht um die Essenz in den Dingen:„What you see is what you see“ (Frank Stella), sondern umdie schiere Anwesenheit ihrer Objekte im Raum. Die Materia-lien und Formen sind gerade nicht der landschaftlichen Um-gebung entlehnt und wollen auch keine Erinnerungen auslö-sen, sie sind künstlich und vorfabriziert, Authentizität ist su-spekt. Die specific objects springen aus dem Bilderrahmenund vom Sockel, wollen nichts bedeuten, sondern den Raumerobern. 1964 sagte Frank Stella in der Radiosendung mitdem Titel New Nihilism or New Art: „Ich verwickle mich stän-dig in Diskussionen mit Menschen, die die alten Werte in derMalerei erhalten wollen – die humanistischen Werte, die sieauf jeder Leinwand entdecken. In die Enge getrieben be-haupten sie schließlich immer, es sei noch etwas anderes aufder Leinwand außer Farbe. Meine Malerei gründet in der Tat-sache, dass nur das auf der Leinwand ist, was man dort auch
Tadao Ando, Church On The Water; © Tadao Ando
10

sehen kann. Es ist in Wirklichkeit ein Objekt. Jedes Bild ist einObjekt, und jeder, der sich genügend in diese Sache einlässt,muss der Objekthaftigkeit dessen, was er macht, ins Gesichtsehen, was immer dies auch sei. Er macht ein Ding.“Der Betrachter befindet sich in einer konzeptionellen räum-lichen Situation, einem actual space mit Dingen, deren ge-schlossene Oberflächen den Blick abprallen lassen und jedeGenerierung eines Gefühls, jede Bedeutung ablehnen. DieObjekte verweigern den Zugriff zu ihrem Innenraum undschaffen einen Raum zwischen sich, dem Betrachter und derUmgebung. Objektive Überzeugungskraft des Offenkundi-gen? Unglück liche Erfahrung der Leere? Oder unkünstle-risch, weil theatralisch? Wo keine Bedeutung geboten wird,überschlägt sich die Kritik und sucht nach ihr. Die MinimalArt war wohl eher eine postmoderne Kunst der Oberflächeund des Betrachters, hatte enormen finanziellen Erfolg undwurde begierig als cooler Hintergrund für Fotoshootings undallerlei Life-Style-Inszenierungen aufgegriffen.
Obwohl sich das Formenrepertoire gleicht, scheinen die Mo-tive der Minimal Art andere zu sein als die der minimalisti-schen Architektur. Was auch kein Wunder ist, denn die kom-plexen Bezüge zwischen Innen und Außen, Betrachtern undObjekten, sind in den Disziplinen nicht identisch. Welche so-ziale Funktion hätte beispielsweise eine Architektur, deren In-nenräume man, wie die von Kunstobjekten, nicht begehenund einsehen könnte?
Anhand der Mode, die in den Neunzigerjahren ebenfalls mi-nimalistisch wurde, könnte man trotzdem ganz allgemein da-nach fragen, welche Beziehung zwischen ornamentlosenopaken Oberflächen und einer dahinter vermuteten Bedeu-tung besteht. Gibt es mehr zu finden, wenn etwas anderesfehlt? Warum liefen die Leute in den Städten bevorzugt inschwarz, grau und weiß herum, und warum tun sie es heuteimmer noch überwiegend? Was soll die vermeintlich neutra-le Verpackung?Adolf Loos schloss 1908 seinen Text „Ornament und Verbre-chen“ mit den Worten: „Wir sind feiner, subtiler geworden.Die herdenmenschen mussten sich durch verschiedene far-ben unterscheiden, der moderne mensch braucht sein kleidals maske. So ungeheuer stark ist seine individualität, daß siesich nicht mehr in kleidungsstücken ausdrücken lässt. Orna-mentlosigkeit ist ein zeichen geistiger kraft. Der modernemensch verwendet die ornamente früherer und fremder kul-turen nach seinem gutdünken. Seine eigene erfindung kon-zentriert er auf andere dinge.“
Als sich die Stadtmenschen Mitte des Neunzehnten Jahrhun-derts nicht mehr wie Pfauen, sondern wie die Raben kleide-ten, hatte das den Sinn der unsichtbaren Maske. Der Flaneurwollte nicht mehr Akteur in der Öffentlichkeit sein, die ernicht mehr verstand und die seine Individualität bedrohte. Er war jetzt Beobachter, der sich unter seiner Unauffälligkeitversteck te. Die nicht verschwundenen >>>
Tadao Ando, Church Of The Light; © Mitsuo Matsuoka Tadao Ando, Row House, Sumiyoshi-Azuma House; © Tadao Ando
11

Standesunterschiede wur den mittels kleinster Nuancen in derKleidung vermittelt, der öffentliche Ausdruck des Individu-ums maximal kon trolliert den Eingeweihten dargeboten. ImGegensatz zum Mönch, der seine Individualität auslöschenwill und dem egal ist, was die anderen von ihm denken, ent-springt die innerweltliche Askese dem Impuls der Selbstrecht-fertigung. Nachdem Ende der Achtziger der Börsenkrach den Yuppiesdie Schulterpolster weggefegt hatte, setzten Modeschöpferwie Ladicorbic Zoran, Donna Karan, Jil Sander, Issey Miyakeoder Giorgio Armani Kontrapunkte zu den schrillen Posi -tionen der letzten Jahrzehnte. Calvin Klein bewarb seine Basics bezeichnenderweise mit dem Slogan „Be yourself!“,Minimalismus galt als urban und sophisticated und HelmutLang als Modeschöpfer der Intellektuellen.
Ob „neutrale“ Oberflächen ihre Träger oder Bewohner realermachen, bleibt dahin gestellt. Minimalismus kann ein sehrangenehmer Hintergrund für alles Mögliche sein. Wie alle an-deren Stile kommt er aber nicht ohne doppelten Boden ausund eine Tugend ist er schon gar nicht.
Geraldine Zschocke
Abb. oben: Gigon&Guyer, Erweiterungsbau des Kunstmuseums Winterthur; © Foto: Heinrich
Helfenstein, Zürich
Abb. unten: Gigon& Guyer, Anbau einer historischen Villa; Villa Kastanienbaum; © Foto:
Lukas Peters, Zürich
12

GU
T G
EFU
ND
ENA
RTE
FAK
T
Nicht nur für Herren Ein minimalistischeres Rasiergerät als den Taschenrasierer Rasant von monofaktor kann man sich kaum ausdenken. Zusammengefaltet wie einStreichholzheftchen passt er in jedes Portemonnaie, um im Fall der Fälleoder bei spontanem Haarwuchs zur Stelle zu sein. Der aus Kunststofffoliegefaltete Reiserasierer kann mit handelsüblichen Wechselklingen bestücktwerden. Hinter monofaktor verbergen sich die Produktgestalter Luzius Huber undFlorian Steiger, die bereits mit ihrem preisgekrönten Tisch Janus und demlightmapping-Projekt an der ZHdK auf sich aufmerksam machten. Mehrdarüber demnächst in INFORM. [RC]
monofaktor | Huber und Steiger GmbH
Hofstr. 1 | CH-8032 Zürich | www.monofaktor.ch
Klassiker des Glasdesigns Der Architekt Adolf Loos stand für eine kompromisslose Auffassung bei derGestaltung von Gebrauchsgegenständen: die Abwesenheit von Ornamen-ten war für ihn oberste Maxime (s. S. 11). Das von ihm 1929 entworfeneund durch Lobmeyr ausgeführte Trinkservice TS248GS „Loos” wurde zu-nächst für die American Bar in Wien produziert. Die Becher tragen am Bo-den einen feinen, seidenmatt polierten Brillantschliff. Rund zwanzig Jahrespäter begannen ähnliche Service als typische Kaufhausbecher aus der Au-tomatenproduktion verschiedenster Fabriken zu kommen. Die bis heute bei Lobmeyr unverändert handwerklich hergestellten Origi-nale haben indes Kultstatus.
limited stock GmbH
Spiegelgasse 22 | CH-8001 Zürich | T +41 43 2685620
www.limited-stock.com | [email protected]
KIRU – japanisch „schneiden“ –Das modulare Leichtbau-Boxen-Stecksystem bietet den Heimatlosen vonheute größtmögliche Flexibilität: die KIRU-Boxen, die auf höhenverstellba-ren, aufgesteckten Aluminiumfüßen stehen, können vertikal und horizon-tal beliebig addiert und umkomponiert werden. Es sind auch keine Rück-wände oder Verstrebungen notwendig, so dass die Boxenkonglomeratefrei im Raum aufgestellt werden können, und die Hohlräume lassen sichals Kabelkanäle nutzen. Das Ergebnis ist filigran, aber hochstabil. KIRU istnachträglich um Schubkästen, Rückwände und Beleuchtungselemente er-weiterbar. Bei Umzug werden die Boxen einfach flach zusammengelegtund ab geht die Post. [RC]
KIRU SYSTEM | Martin Borgs | Huttenstr. 71 | D-10553 Berlin | T +49 30 3454171
www.kiru-system.de | [email protected]
Fot
os: H
erst
elle
r
13

PE
RS
ON
A > IM GESPRÄCH MIT CHRISTOPH DIETLICHER | Neue Werkstatt Winterthur
14
Christoph Dietlicher betreibt zusammen mit seinem Kompa-gnon Andreas Giupponi seit 1988 die Neue Werkstatt inWinterthur, die Leuchten für Büros, Warenhäuser oder Kir-chen herstellt. Außerdem unterrichtet er an der ZürcherHochschule der Künste Produktdesign. Das Interview fand inder Vorhalle der ZHdK statt.
Inform > Erzählen Sie von der Gründung der Neuen Werk-statt.C. Dietlicher > Ich habe 1988 die Ausbildung in der KlasseSchmuck und Gerät an der damaligen HGKZ abgeschlossen.Das war Design mit dem Werkstoff Metall und sehr hand-werklich geprägt. Dort habe ich meinen Partner kennen ge-lernt. Der dritte Partner, der mittlerweile ausgestiegen ist, wargelernter Mechaniker. Für uns war immer klar, dass wir keinDesign-Büro sind, sondern ein Produktionsbetrieb mit hausei-gener Werkdesign-Abteilung. Diese Haltung hieß: immerauch in der Lage zu sein, auch wirklich realisieren zu können,was wir uns ausgedacht haben. Wenn man die Produktion sohart im Nacken hat, weiß man genau, wo die Grenzen in denEntwürfen liegen. Die Phantastereien, die nicht realisierbarenIdeen haben wir uns ziemlich bald abgewöhnt.Nicht, dass mich das nicht interessieren würde, aber bei unswaren die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht rosig, wir habenmit einfachsten Mitteln als eine Werkstatt, als Manufakturangefangen. Im Prinzip ist das auch heute noch so. Leuchten-bau ist Manufaktur, keine hochtechnologische Massenindus-trie. Die Stückzahlen sind klein und es gibt von jeder Leuchtesofort Varianten.
Inform > Warum?C. D. > Es gibt einfach wahnsinnig viele Anbieter auf demMarkt. Bei wirklich großen Firmen werden natürlich dieLeuchtenbau-Teile schon industriell als Module gefertigt, abernicht die ganze Leuchte. Und die Endmontage geht sowiesonur von Hand. Also ich weiß von keiner Leuchte, die amSchluss vom Roboter montiert worden ist.
Inform > Am Anfang haben Sie nicht nur Leuchten gemacht,sondern alles Mögliche.C. D. > Ja, wir haben alles gemacht, was man aus Metall ma-chen kann. Nicht gerade Landmaschinen, aber sonst alles
vom Schmuck bis zu einfachen Tafelgeräten, Wohnaccessoi-res, Kleiderhaken, Möbel.
Inform > Wieso machen Sie nur noch Leuchten?C. D. > Zum einen sicher aus wirtschaftlichen Gründen, soein großes Spektrum kann man eigentlich gar nicht bewälti-gen und noch Geld damit verdienen. Wir haben alle drei, vierJahre etwas weg gestrichen und eingegrenzt. Die Leuchtensind übrig geblieben. Mit ihnen haben wir von Anfang anGeld verdient, und sie wurden technisch so komplex und an-spruchsvoll, dass wir immer weniger Zeit für Anderes hatten.Bis letztes Jahr gab es noch so ein paar lieb behaltene alteProdukte, die einfach zu unserer Geschichte gehörten. Dannmussten die auch raus. Was nicht leuchtet, gibt es nicht. Esist natürlich auch einfacher zu kommunizieren. Aber in die-sen alten Produkten ist ganz viel Herzblut drin und es fälltschwer, sich von ihnen zu trennen.
Inform > Sie sagten, der Leuchtenbau sei aufgrund der Tech-nik immer anspruchsvoller geworden. Machen Sie auch sehrinnovative Sachen?C. D. > Das, was an Technik in der Leuchte drin ist, wird alleseingekauft. Das liegt überhaupt nicht in unserem Bereich,denn da stecken astronomische Entwicklungsbudgets dahin-ter. An den neuesten LEDs oder den noch besseren Fluores-zenzleuchten, also Leuchtstofflampen, sind die ganz großenFirmen dran. Die vorgeschaltete Elektronik und Steuerungwird von World-Playern wie Siemens, Osram und Philips ent-wickelt. Wir versuchen die Ergebnisse in einem für uns mög-lichst sinnvollen Zeitrahmen einzusetzen. Das heißt, nicht zu
Christoph Dietlicher (links) und Andreas Giupponi (rechts)
Im Laden von Christa de Carouge, Modegeschäft Zürich; Indirekte Fluter mit HGI-Technik

früh, weil uns das, wenn es ganz dumm käme, das Genickbrechen könnte. Wenn wir auf eine Technik setzen, die sichdann doch nicht durchsetzt, dann haben wir nicht nur ziem-lich viel Geld, sondern auch Energie und Zeit verloren. Wirwarten eigentlich schon so lange, bis die Technik wirklichfunktioniert, bis wir sicher sind, dass es auch gut läuft. Eskommt vor, dass ein Hersteller ein neues Gerät nach einemJahr einfach wieder zurückziehen muss, weil es noch Kinder-krankheiten hat.Der Abwägungsprozess ist manchmal sehr schwierig. ZumBeispiel schreien jetzt alle, wie toll LED sei. Es ist aber nichtleicht, hochwertige und auch langlebige Produkte mit LEDanzubieten, weil sich diese Komponenten in sehr schnellenRhythmen überholen, was einem langlebigen Produkt wider-spricht. Ähnlich wie in der Computerbranche kann es sein,dass ich in fünf Jahren keine Ersatzteile mehr bekomme. Die-ses Tempo können wir nicht mitmachen, das geht nicht.Wenn man mit den Produzenten spricht, heißt es: Besser,besser, besser, LED werde jährlich besser, das heißt: mehrLicht aus weniger Strom. Diese Steigerung der Lichtleistungmüsste, ich sag jetzt mal in 2– 4 Jahren am Limit sein, weil ir-gendwann die physikalischen Grenzen erreicht sind. Unddann kann fast nichts mehr passieren.
Inform > Dann kommt wieder was Neues.C. D. > Ja. Jetzt sollen die Organischen kommen. Im PrinzipGlühwürmchen, Biolumineszenz. Es werden Versuchsreihengemacht und es gibt auch schon Halbfabrikate für Handys.Die Japaner sind da ganz groß am Üben. Es handelt sich umdünne Folien, die leuchten. Das ist faszinierend, man könntedamit theoretisch die Wände tapezieren, man bräuchte garkeine Leuchten mehr.
Inform > Wie würden Sie Ihr Design um die Technik herumbeschreiben? Ist es minimalistisch? C. D. > Sicher sehr funktional, optisch sehr ruhig und zurück-haltend. Wir arbeiten vorwiegend für öffentliche Räume. ImGegensatz zum Wohnraum können sich die Leute, die bei-spielsweise in einem Großraumbüro arbeiten, die Lampen dortnicht selbst aussuchen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass mansich dessen bewusst ist, dass man eigentlich für Leute arbeitet,denen man das Zeug aufdrückt und aufzwingt. Darum mussdas auch sehr unaufdringlich sein. Wir sagen zum Beispiel überunsere Stehleuchte „Hellseher“, die es jetzt bald zehn Jahregibt, das sollen die grauen Mäuse in den Büros sein. Die müs-sen zwar möglichst gut funktionieren, hilfreich sein und ein an-genehmes Lichtklima schaffen, sollten als Produkt aber ambesten gar nicht wahrgenommen werden. Sie sollen dienen.Als technische Dienstleistung für den Arbeitsplatz.
Inform > Meinen Sie, dass das funktioniert? Dass man de-zente Dinge gar nicht wahrnimmt?C. D. > Man nimmt sie nicht gar nicht wahr, man nimmt sienicht negativ wahr. Mir fällt dazu ein, dass wir vor sicherschon 10 Jahren für die Delikatessenabteilung im Globus Wa-renhaus an der Bahnhofstrasse in Zürich gearbeitet haben,den gehobenen Warenhäusern der Schweiz. Über den Lauf-bändern der Kassen und Theken hängen immer noch unsereLeuchten, was relativ lang ist für Läden. Wir haben keine ein-zige Nachbestellung von irgendeinem anderen Laden bekom-men, der die auch möchte. Für mich heißt das, dass sie zwarinnerhalb des ganzen Ensembles wunderbar funktionieren,aber das Produkt selbst sieht man nicht und will es als Einzel-teil auch gar nicht besitzen. Das ist natürlich schade, ich hät-te gern noch mehr verkauft. >>>
Christoph Dietlicher+Andreas Gipponi, Tropfenleuchte; Glühbirne in einem Glastropfen
15

Inform > Vorhin sagten Sie, ihr Herzblut habe in den altenSachen gesteckt. Und jetzt sagen Sie, jetzt machen Sie solcheSachen…C. D. > …da ist trotzdem Herzblut drin! Also ich denke, dasVerdichten auf das Minimum, das Erreichen der reduziertes-ten Aussage, dazu gehört viel konstruktives Nachdenken. DasRunterfahren auf die banalste Äußerung ist sehr anspruchs-voll und ästhetisch. Es ist nicht so, dass mir anderes Designprivat nicht auch gefallen würde. Eine Murano-Lampe, einKitsch-Haufen aus Glas ist wunderbar und schön, wenn sieam richtigen Ort hängt.
Inform > Sie unterrichten als Dozent für Produktdesign ander Zürcher Hochschule der Künste. Ist der minimalistischeFormenkanon noch aktuell? Wie empfinden die jungen Leu-te minimalistische Formen?C. D. > Die ganze Zürcher Gestaltung ist natürlich sehr redu-ziert, schon das Haus hier selber in dem wir sitzen. Die streng-gläubigen Modernen, die das wirklich gelebt haben, sind abernicht mehr da, schon tot oder nahe daran. Die Jungen kennendas zwar alles, aber sind nicht mehr so dogmatisch, überhauptnicht. Das Spektrum ist viel breiter geworden. Tendenziell aberist Zürich das Pflaster, wo man das nicht ungern sieht, wennauch Studenten reduziert arbeiten. Minimalistisch wäre zustreng ausgedrückt, aber schon reduziert, klare Linien.
Inform > Und allgemein gefragt: Ist es überhaupt noch zeit-gemäß? Ist das Organische Design nicht viel aktueller und nä-her dran an den Jungen? C. D. > Was ich faszinierend finde, ist, dass die jungen Leuteganz extrem wechseln. Die bedienen sich wie im Selbstbedie-nungsladen, benützen alte Stilmittel, zum Teil schamlos, ichfinde das eigentlich auch okay.
Inform > Aber nur eigentlich.C. D. > Wirklich neue Formen zu erfinden, zu schöpfen wirdnatürlich mit jedem Jahr schwieriger, wenn es überhaupt nochgeht. Es ist extrem schwierig, ohne Zitate einen neuen Gegen-stand zu entwickeln und dabei ohne Anlehnungen auszukom-men. Ich müsste schon wirklich fest nachdenken, wann ich dasletzte Mal was wirklich Neues gesehen habe. In der Ausstel-lung „Nature Design“ hier im Museum fanden sich teilweiseDinge, die im Moment ihres Auftauchens wirklich neu waren.
Inform > Wie erklären Sie sich das? Ästhetisch neu aufgrundder Technik, die eingesetzt worden ist? C. D. > Sicher ist es zum Teil die Technik. Heute ist die Freiheithin zu neuen Formen so groß wie selten zuvor. Und zwar sehrfrüh im Produktionsprozess. Prinzipiell kann man gleich amComputer Prototypen generieren und wahnsinnig schnell mit3-D-Plottern räumlich gestalten. Man kann aus diesen For-men problemlos Werkzeuge herstellen und produzieren. Dasgeht heute und wird laufend billiger. Die Schule hat in derWerkstatt Rapid-Prototyping-Maschinen, da geht die Ideevom Computer direkt ins Modell. Wie bei einem Drucker,wird ein Gips-Modell Schicht für Schicht aufgebaut. Die Mo-delle werden immer besser und es geht mittlerweile schon soweit, dass die Produzenten eigene Maschinen haben und dasvon Anfang an mit dem Werkzeugbau abgleichen. Damitman keine Sachen mehr macht, die man nachher nicht mehraus der Form kriegt oder damit die Wandstärken dem Mate-rial entsprechen; damit alles von Anfang an zusammenläuft. Obwohl das nicht meine Kernkompetenz ist, glaube ich, dassdas die Formensprache verändert. Natürlich in einem indus-triellen Rahmen. Was Manufaktur betrifft, da ist nicht mehrmöglich als vor 50 Jahren. Da handelt es sich um andere Prei-se und Geschwindigkeiten.
Aber was meine Studenten betrifft: wenn ich ihnen eine Auf-gabe stelle, dann dränge ich sie immer sehr, in ihren Aussa-gen präzis zu werden. Konjunktive sind verboten. Da bin ichsehr minimalistisch. Ich fordere Genauigkeit. Es soll nicht hei-ßen: Es könnte auch so… – Nein, es könnte nicht: es i s t ent-weder…oder.
Inform > Diese Präzision bezieht sich auf das Arbeiten…C. D. > Ja, das kann trotzdem eine üppige Form ergeben.Aber eine, die dann ganz klar üppig ist und nicht ein bisschenüppig oder vielleicht doch nicht. Ich fordere eindeutige for-male Aussagen und keine Hybriden. Es gibt schon gute Hy-briden, aber ich glaube nicht daran, dass ein Student imzweiten Semester eine erfindet. Ein guter Hybrid bedeutethöchste Anforderung.
Inform > Noch einmal zurück zu ihren Lampen. Sie machenGebrauchsdesign, das eindeutig einem sehr pragmatischenZweck dient. Wie ordnen Sie solche Objekte des Designs in-nerhalb des Diskurses über die Minimal Art oder minimalisti-
Banane, Wandleuchte aus Alublech, eloxiert, 1989
kaspar 455 Pendelleuchte; Gemeischaftszentrum im Quartier Grünau, Zürich
16

sche Architektur ein? Welche Beziehung zum Benutzer undBetrachter schaffen minimalistische Gebrauchsobjekte?C. D. > Diese Leere, die in der Kunst das Thema ist, das kannes bei Design gar nicht sein. Das geht gar nicht, das ist ja einfunktionaler Gegenstand. Dem schreibt man eine Funktionzu und die muss der Gegenstand erfüllen, sonst ist es Kunstoder was weiß ich was, aber sicher kein Design. Ich rede nichtüber die Kulissen im Design.
Inform > Das heißt, man übernimmt nur die Form, aber al-les was dahinter steckt eigentlich nicht.C. D. > Es sind reduzierte, zurückgefahrene Formen, abersonst hat das nichts mit Minimalismus zu tun. Ich finde es auchin der Architektur schwierig von Minimalismus zu sprechen.
Inform > Aber es gibt ja doch unbestritten auch so etwaswie eine Annäherung der Design-Objekte an Kunst-Objekte.Sie werden ja nicht mehr nur wegen ihres Gebrauchswertesgekauft, sondern auch wegen ihres Stils.C. D. > Ja, Stil. Ein Stil ist das sicher, ein minimalistischer Stil,das darf man schon sagen, aber Minimalismus finde ichschwierig. Das, was die Neue Werkstatt produziert, das hatnichts mit Minimal Art zu tun. Da wird sich der Betrachterauch nicht irgendwelche tiefsinnigen Fragen stellen, nachdem Motto, wo hört mein Raum auf und wo beginnt der an-dere, oder, wie steht das im Raum, also überhaupt nicht. Ichbin kein Künstler. Und wenn ich Kunst machen würde, wür-de ich andere machen.
Inform > So wie Dan Flavin, der gekaufte Leuchtstoffröhrenaufgehängt hat? C. D. > Er versteht sich ganz klar als Künstler. Wenn er etwasmacht, dann hat das nichts zu tun mit einer funktionalen Be-leuchtung. Ich möchte natürlich auch, dass es den Leuten, seies in einer Kirche oder einem Schulhaus, wohl ist in den Räu-men, diesen Anspruch habe ich. Eigentlich möchte ich nicht,dass die Leute von unseren Leuchten sprechen. Zur Zeit be-schäftigen wir uns mit einer Jugendstil-Kirche, die unbedingteine neue Beleuchtung braucht. Ich möchte nicht, dass dieKirchengänger nach dem Besuch der Kirche über die schönenoder die hässlichen Leuchten sprechen, sondern dass sie sichin der Kirche wohl fühlen, gerne reingehen und zufriedenwieder rauskommen. Das Ziel ist, etwas Selbstverständlicheszu suchen, das wie gewachsen ist, als wenn es nicht anderssein könnte. Die ganze Atmosphäre muss stimmen.
Inform > Ist das das Spezielle am Licht, dass es mit Stimmun-gen und Emotionen arbeitet?
C. D. > Ja. Licht hat einen starken Einfluss auf das Wohlbe-finden. Mit Mustern probieren wir gemeinsam mit der Bau-herrschaft, dem Architekten oder Denkmalpflegern vor Ortaus, wie das Licht wirkt. Ansonsten weiß man schon relativviel über Licht, allgemein Bekanntes wie die Vorliebe dermeisten Menschen für warmes Licht. Also man muss in einerKirche nicht unbedingt mit blauem Licht provozieren. Undauch die Lichtmengen haben einen großen Einfluss auf dengesamten Organismus, im Dunkeln wird man krank. Die Leu-te haben es sehr gern hell.
Inform > Wann wird es für Sie schwierig? C. D. > Also zum Beispiel sind Kirchen heute sehr schwierig.Die Kirche, an der wir grade dran sind, ist 1907 fertig gestelltworden. Zu dieser Zeit konnten alle Leute, die in eine Messegingen, die Lieder auswendig. Mit zehn Kerzen war die Stim-mung wunderschön festlich, ruhig und gedämpft, eine Inselauf der Welt, und die Leute waren zufrieden. Heute will mandas immer noch, aber gleichzeitig gibt es Veranstaltungen,Konzerte, Hochzeiten, da müssen die Leute lesen können,und zwar auf allen 500 Plätzen. Das sind Anforderungen, diedem Raum und der Architektur widersprechen. Wir müssenda einen Weg finden, ohne die Kirche zu misshandeln.Ein anderes Beispiel, die Zürcher Kreuzkirche. Dort hängt ei-ne wunderschöne Originalleuchte, eine riesige rundum ver-glaste Laterne, die wir innen völlig ausgehöhlt haben undhemmungslos mit Leuchtstoffröhren gefüllt haben. Alle ha-ben Angst vor diesen Röhren mit ihrem schlechten Ruf , abersie sind sehr viel besser geworden, haben abgesehen vomDimmen ein wesentlich wärmeres Farbspektrum bekommenund wenn sie versteckt sind, merkt es auch kaum einer. EineBeleuchtung aus Glühbirnen mit einer derartigen Lichtleis-tung wäre viel zu kostspielig.
Apropos Glühbirne. Anlässlich seines 75. Geburtstages bat unsdas Schweizer Einrichtungshaus wohnbedarf eine Leuchte zuentwerfen. Max Bill hatte das bekannte Logo kreiert, die Blasemit dem Namen des Hauses. Unsere Bill-Reminiszenz, die Trop-fenleuchte, ist auch „minimalistisch“, nichts weiter als eineGlühbirne in einem Glastropfen, aber trotzdem etwas ganz an-deres als unsere anderen Leuchten. Sie ist wie ein Haustier. Ent-weder man will eine Katze in der Wohnung haben oder nicht.Sie kann nichts und will nichts, nur vor sich hinleuchten.
Das Interview führte Geraldine Zschocke
Neue Werkstatt GmbH | Oberer Deutweg 1 | Ch-8400 Winterthur | www.neuewerkstatt.ch
links: Historischer Leuchter in der Kreuzkirche
in Zürich; rechts: Neue Wandleuchten in der
Kreuzkirche, dimmbar
17

Goldschmiede im Schwabentor Team Hanne Beyermann-Grubert
www.goldschmiede-im-schwabentor.de
Wo Freiburgs Altstadt am schönsten ist: am Fuße des Schlossbergs in einem
der beiden Stadttore haben wir einen wunderschönen Raum für Schmuck etabliert.
Geöffnet: Di - Fr 10 - 18 h, Sa 10 - 15 h , Mo geschlossen.
18

TEX
TMuseum für Gestaltung Zürich, PlakatsammlungPOSTER COLLECTION 16COMIX! mit Texten von Pascal Lefèvre, Bettina RichterMfG Zürich, Plakatsammlung (Hg.) | 96 S. | Lars Müller Publishers | dt., engl. | CHF 36,–
Plakativ ist nicht gleich primitiv. Nach dem Comic entdeckt man jetzt seinen Bruder, das Plakat.Beide Medien oszillieren zwischen Kunst und Kommerz und nutzen in ihrem Kampf um die Auf-merksamkeit sowohl das Bild als auch den Buchstaben. Hat der Comic aber Zeit, seine Ge-schichte in vielen kleinen Panels allmählich zu entfalten, muss das Plakat auf den Punkt genauseine Botschaft in die kurze Aufmerksamkeitsspanne des Passanten schleudern. GemeinsameWurzeln sind die japanische Lithographie, der Jugendstil und die Liebe zur Typographie. In den letzten 20 Jahren scheint sich das Plakat mit Stilmitteln der Verdichtung und Karikatur,surrealen Bildwelten und der Übernahme zeichnerischer Techniken noch enger an den Comicanzulehnen. Auf Kommerzplakaten knallt, blitzt und woooooomt es, Expressionisten wie Feuch-tenberger und Atak wechseln vom Comic zum Plakat, und in Genf kommt keiner, der Tim undStruppi geliebt hat, an den kapitalistischen Kraken Exems vorbei, die sich in Komposition undLinienführung am verehrten Hergé orientieren. Einen guten Einstieg, um die Verflechtungen vonComic und Plakat kennen zu lernen, bietet die aktuelle Veröffentlichung der Plakatsammlungdes Museums für Gestaltung in Zürich, deren riesiger Bestand von geschätzten 300.000 Plaka-ten etappenweise der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. [GZ]
Gian Carlo CalzaJAPAN STILGian Carlo Calza | 303 S.⏐Phaidon⏐dt.⏐EUR 49,95
Was kennzeichnet den „japanischen Stil“, worin liegt die besondere Ästhetik, was prägt dieKultur dieser traditionsbewussten Inselbewohner? Abseits gängiger Klischees untersucht CalzaMerkmale und Besonderheiten in der japanischen Kunst, Literatur und Architektur, befasst sichmit Alltagsobjekten und bis ins kleinste Detail geregelten Ritualen. Geprägt durch Strenge undKlarheit liegt die Priorität des schöpferischen Schaffensprozesses dabei stets vor dem gefertig-ten Gegenstand, dem Produkt. In drei großen Kapiteln, aufgelockert durch kurze Zwischenspie-le zu Bonsai und japanischer Esskultur, erfährt man zunächst Neues über Teezeremonien, klas-sisches No-Theater, Zen-Gärten, traditionelle Kleidung und Kostüme. In einem zweiten Teil ge-winnt man einen interessanten Überblick zum Naturverständnis und der stark durch Shinto undBuddhismus beeinflussten Lebensphilosophie der Japaner. Im dritten Kapitel werden einigeexemplarische Persönlichkeiten und Meister aus Theater, Malerei und Literatur in kurzen biogra-phischen Abrissen mit hilfreicher historischer Einordnung vorgestellt. Gian Carlo Calza, Japanexperte, Dozent für ostasiatische Kunstgeschichte und Ausstellungsor-ganisator legt hier eine faszinierende Kultur- und Kunstgeschichte Japans mit wunderschönenAbbildungen, Fotographien und Farbholzschnitten vor. Hochwertiges Material und ein hervorra-gendes Glossar unterstützen das Vergnügen im Auge des Betrachters. [DZ]
Kenya HaraDESIGNING DESIGNKenya Hara | Lars Müller Publishers⏐467 S. | 400 farb., teils ganzseit. Abb., davon 1 doppelseit. Falttafel, sowie 50
Zeichn.⏐engl.⏐EUR 42,69
Nach Kenya Hara ist Design das bewusste Hinzufügen der Essenz der zahllosen Möglichkeitendes Denkens und der Wahrnehmung zu alltäglichen Objekten, Phänomenen und Kommunika -tionsformen. Designing Design präsentiert ungewöhnliche, verfremdende und futuristische An-sätze zum Re-Design von Alltagsprodukten des 21. Jahrhunderts wie quadratische WC-Papier-rollen, Streichhölzer in Zweigform oder Nudelarchitektur. In weiteren Kapiteln sind haptischeLogos, laserprojezierte Armbanduhren oder Türgriffe und Fernbedienungen aus Hydro-Gel zubewundern, darauf folgen organisch anmutende, hyperrealistische Fruchsaftverpackungen undBücher als Informationsskulpturen. Ein beeindruckendes Spiel mit Materialien und Wahrneh-mungen, provozierten Sinnestäuschungen und kalkulierter „Exformation“ zur Verwirrung desBetrachters. Neben dem Abschlusskapitel zur Designgeschichte, behandeln eigene Abschnitteauch Ursprung, Entwicklung und Differenzen von Design in Asien und Europa oder den völligenVerzicht auf Farbe im Design, das Weiß als Konzept. Ein Buch, das Zeit, Aufmerksamkeit und Offenheit verlangt, den Leser aber – wenn er sich da-rauf einlässt – auch großzügig belohnt. Mind-expanding ! [DZ]
19

EX
PO > MAX BILL | Retrospektive zum 100. Geburtstag des „Konkreten“
Zwei Festredner löstenKopfschütteln aus, als sie1955 anlässlich der Ein-weihung neuer Gebäudean der Ulmer Hochschulefür Gestaltung sprachen.Redeten sie tatsächlich vonderselben Hochschule?
Zunächst Walter Gropius,dem es als lebende Legen-de nicht unmaßgeblich zuverdanken war, dass dieAme rikaner den Bau derHochschule überhaupt un -
terstützt hatten. Er wehrte sich darin gegen die einseitigeWahrnehmung der Bauhäusler als Rationalisten. Für ihn soll-ten die Ulmer als deren Nachfolger das Magische wieder mitden logischen Wissenschaften und der mechanistischen Mo-derne versöhnen. Der Künstler solle als Poet und Prophet ver-edeln und vermenschlichen, am besten unter Ausschluss dernoch unreifen Demokratie, die über quantitative Mehrheits-beschlüsse funktioniere.
Nach dieser Ode hebt Max Bill an mit der Aufzählung der Produkte, die unter seinem Direktorat an der HfG in den Jah-ren zuvor hergestellt worden waren: der Pavillon auf der Lan-desausstellung, die Plakate der Volkshochschule, die Radio-modelle und Plattenspieler der Firma Max Braun, die Feder-flächen für Schaumgummimatratzen, Waschbeckenstudienusw.. „Wir wollen durch unsere ehrliche Arbeit, nach unsererwohl fundierten Überzeugung helfen, für möglichst vieleMenschen eine den Möglichkeiten und Bedürfnissen unsererZeit entsprechende Umgebung zu gestalten.“ Im Gegensatzzu seinem Vorredner und Gönner spricht hier eine ganz an-dere Stimme und Generation, die sich pragmatisch den„unscheinbaren“ Gegenständen zuwendet. Die Persönlich-keit des Gestalters ist unwichtiger geworden, er wendet einbestimmtes gestalterisches Verfahren an, mit dem er nichtmehr Dinge und Bedürfnisse verändert, sondern versucht,ihnen am besten zu entsprechen.
Zu den „unscheinbaren Dingen“, die Mitte der Fünfzigerjah-re an der Ulmer Hochschule für Gestaltung unter der Leitungvon Max Bill entstanden sind, gehört der berühmte UlmerHocker. Man kann auf ihm in zwei verschiedenen Höhen sit-zen, ihn als Tisch gebrauchen, Bücher transportieren, sicherauch Spinnen totschlagen oder gegen Einbrecher kämpfen.Er besteht aus nicht mehr als drei Brettern, die durch einRundholz verbunden sind. Die von den Studenten „in der Ab-tei des rechten Winkels“ (Rübenach) entwickelten Türklinkensind auch so ein Fall: mit wenig Aufwand hergestellt, solltensie trotzdem auch mit einem Tablett, einem Glas oder einemUlmer Hocker in der Hand zu öffnen sein. Mit einem Mini-mum an Mitteln möglichst viele Anforderungen zu bewälti-gen, das war das Ziel, das dem Direktor Max Bill vorschweb-te. Dem hatte er sich schon als Architekt der „Behältnisse“auf dem Kuhberg unterworfen, denn Geldmittel und Materi-al waren rar, waren mühsam von Inge Scholl über Jahre hin-weg zusammengebettelt worden.
Da man ihn zu dieser Aufgabe aber keineswegs drängenmusste, scheint es ihm gelegen zu haben. 1908 in Winterthurgeboren, war er selbst am Dessauer Bauhaus gewesen undarbeitete seither nicht nur als Architekt, Produktgestalter undTypograph, er war auch als Künstler eine Größe seiner Zeit.Schönheit spielte für ihn trotz der Zweckmäßigkeit seiner Pro-dukte eine große Rolle, bloß erwuchs diese Schönheit aus ei-nem anderen ästhetischen Verfahren als das bei der humanis-tischen Gestaltung der Fall war, einem Verfahren, das auchseine „konkreten“ Kunstwerke bestimmte. „was der geist zur not noch packt / ist abstrakt / was man garnicht mehr versteht / ist konkret“, reimte ein Kritiker 1944zur Basler Ausstellung „Konkrete Kunst“. Wenn man bedenkt, dass die beteiligten Künstler selbst oftnicht wussten, in welche Kategorie sie gehörten, und man esden Bildern ebenfalls nicht ansehen konnte, kann man dieVerwirrung des Publikums nachvollziehen. Sind sowohl abs-trakte als auch konkrete Werke ungegenständlich, so ent-springen sie unterschiedlichen Intentionen. Im Paris der Zwanzigerjahre war es zum Zerwürfnis zwi-schen dem „Abstrakten“ Piet Mondrian und dem „Konkre-ten“ Theo van Doesburg gekommen. Doesburg hatte es ge-wagt, rechteckige Leinwände mit Diagonalen zu bedecken.Mondrian selbst malte Senkrechte auf ein diagonal gestell-tes Quadrat, was für ihn das universelle Prinzip der dynami-
20
Max Bill im Atelierhaus Zürich-Höngg, 1947;
Foto: Ernst Scheidegger; © NZZ 2008
Max Bill, Plakat Wohnausstellung Neubühl, 1931; Buchdruck, Linolschnitt und Schriftsatz,
128x90.5 cm; © Pro Litteris, Zürich, 2008

schen Bewegung im Gleichgewicht darstellte. Diagonale imBild widersprachen dem und wurden vom „Abstrakten“ alsdementsprechend skandalös empfunden. Doesburg hattesich diese unerhörte Frechheit geleistet, weil er jede Reprä-sentationsfunktion der Kunst ablehnte, sie als Teil der Rea -lität, aber mit ganz eigenen Ausdrucksmitteln ansah. DieAutonomie ihrer Prinzipien bestand in ihrer unmittelbarenästhetischen Wirkung ohne Bezug zu humanistischen Idea-len oder Gefühlen. Insofern war sie „konkret“.1936 löst sich die Künstlervereinigung „abstraction-création“auf und das konkrete Geschehen verlagerte sich von Paris indie Schweiz zu Max Bill und Richard P. Lohse. Max Bill präzi-sierte das Anliegen der Konkreten Kunst: „konkrete gestal-tung ist jene gestaltung, welche aus ihren eigenen mittelnund gesetzen entsteht, ohne diese aus äußeren naturerschei-nungen ableiten oder entlehnen zu müssen, die optische ge-staltung beruht somit auf farbe, form, raum, licht, bewe-gung (…)durch die formung nehmen die entstehenden wer-ke konkrete form an, sie werden aus ihrer rein geistigen exis-tenz in tatsache umgesetzt, sie werden zu gegenständen, zu optischen und geistigen gebrauchsgegenständen.“ Dieseeigenen Mittel und Gesetze müssen nicht unbedingt die derGeometrie sein, Bill vergleicht sie mit den „ewig gültigen For-men“ der Musik, etwa der der Bachschen Fugen.So „mechanisch“ das klingt, Max Bill grenzte die Gestaltunggegenüber einem rein mathematischen Verfahren ab: „dasbedeutet, dass kunst nur dort und nur dann und nur deshalbentstehen kann, wenn und weil ein individueller ausdruckund persönliche erfindung sich dem prinzip der struktur un-terstellen und diesem ordnungsprinzip neue gesetzmässigkei-ten und gestalt-möglichkeiten abgewinnen können.“Der Künstler unterwarf sich dem Prinzip der Struktur, der Ge-stalter von Gebrauchsgegenständen wertete diese auf, gabihnen eine größere Autonomie. Bills Übertragung der Geset-ze seiner konkreten Kunst auf das Massenprodukt, die Archi-tektur und die Grafik hatte er auf der „Transversale“, demSchweizer Beitrag zur Mailänder Triennale von 1936 demons-triert. Dort mischte er seine „Unendliche Schleife“ eine bild-hauerische Umsetzung der mathematischen MöbiusschenFläche, unter Plakate, Gebrauchsgegenstände und Ausstel-lungsarchitektur. Schon 1934 hatte der Kunsthistoriker Herbert Read entdeckt,dass sich damit die „freie“ Kunst der „angewandten“ annä-herte, denn sowohl konkrete Kunst als Gebrauchgegenstän-de stünden nur für sich selbst.Dieses „Für-sich-selbst-stehen“ war für das Publikum nichtleicht zu verdauen, die Autonomie der Kunstobjekte wurdeals nihilistisch missbilligt, das Entdecken ihrer Strukturprinzi-pien erforderte Intellektualität, sie galt als lebensfern. Für Billdagegen wurde die Kunst frei; frei von der Repräsentationvon Macht und Individualismus. Sie stelle sich den Notwen-digkeiten des Lebens und entwickle eine demokratische Auf-fassung von Kultur (Über konkrete Kunst, 1938). Max Bense:„das werk max bills, wie überhaupt die konkrete malerei undplastik, lassen sichtbar werden, dass die moderne kunstpro-duktion aus einem hermetischen raum für kunst herausgetre-ten ist und im wirklichen sinne öffentlich, übertragbar, fastein gesellschaftliches phänomen geworden ist.“Max Bill war in diesem Sinne ganz Schweizer. Sein demokra-tisches Anliegen verwirklichte er nicht nur in der Kunst, er warauch im Zürcher Gemeinderat und dem Schweizer National-rat politisch aktiv. Trotz dieser starken Verwurzelung schiender Prophet im eigenen Land nicht die große Reputation zugenießen, die ihm sonst weltweit zukam. Nach 25 Jahren oh-
ne nennenswerte Ausstellungen widmet sich nun anlässlichseines 100. Geburtstages eine umfassende Retrospektive sei-nem Werk. Das Kunstmuseum Winterthur zeigt seine Gemäl-de und Plastiken, das angeschlossene Gewerbemuseum allseine anderen „Transversalien“. Dort kann man den Kom-mentar Bills zu seinen „transcolorationen“ überprüfen:„ein werk der konkreten kunst ist ähnlich einem generator.durch die ordnung seiner elemente produziert es energie inform von strahlungen.“
Olga Emzet
Bis 12.Mai 2008
Max Bill zum 100.Geburtstag | Gewerbemuseum und Kunstmuseum Winterthur
Kirchgasse 14 + Museumsstr. 52 | CH-8400 /8402 Winterthur
T +41 52 2675136 und +41 52 2675162 | www.gewerbemuseum.ch /www.kmw.ch
Max Bill, Höhensonne für die Firma Novelectric, 1952; Foto: Theres Büttler, Luzern;
© Pro Litteris, Zürich, 2008
Max Bill, Auswechslungen, 1983; Öl / Leinwand, 100x100 cm; Kunstmuseum Winterthur;
Dauerleihgabe des Kt. Zürich, 1984; © Pro Litteris, Zürich, 2008
21

INS
TITU
TIO
N
Jeder hat schon einmal beim Frühstücksbuffet aus verschla -fenen Augen auf das stapelbare Hotelgeschirr geblinzelt: re-du zierte Formen in purem Weiß, Tasse für Tasse, Kännchenfür Kännchen, sei es in Rom, London oder Paris. Hans (Nick)Roericht erhielt den Kulturpreis des Bundesverbandes derDeutschen Industrie für seine schnörkellosen Formen in ihrerFunktionalität. Seit den Fünfzigerjahren begleiten viele Krea-tionen der Hochschule für Gestaltung in Ulm unser Leben,obwohl der Institution selbst nur ein vergleichsweise kurzesLeben beschieden war.
Im vierzigsten Jahr nach der Schließung der Hochschule kün-digt die Stiftung HfG Ulm eine Schriftenreihe vor allem überdie Nachwirkungen der Hochschule an. „Bewerbungen zurTeilnahme an der neuen Schriftenreihe werden seit Jahres -beginn 2008 in der Geschäftsstelle entgegen genommen“,sagt Dieter Bosch, Vorsitzender der Stiftung HfG Ulm und Ini-tia tor der Schriftenreihe. Das Projekt fällt zugleich auf dasMax-Bill-Jahr, das 100. Geburtsjahr des Mitbegründers derHfG Ulm. Themen werden die sogenannten Septemberta-gungen in den Jahren 1988 bis 2003 sowie die Hearings seit2005 des Internationalen Forums für Gestaltung (IFG UlmGmbH), einer Tochtergesellschaft der Stiftung HfG Ulm, sein.Die Schweizer Politik- und Medienwissenschaftlerin RegulaStämpfli begleitet die Schriftenreihe. „Die Stiftung HfG Ulmträgt auf Grund ihres weltbekannten Design-Erbes eine gro-ße Verantwortung als Hüter der Marke ‚HfG Ulm’ und als Im-pulsgeber für junge Kreative weltweit. Dieser Verantwortungwollen wir gerecht werden, indem wir Designer und Gestal-ter aufrufen, sich wissenschaftlich mit den Jahren nach 1968zu beschäftigen“, so Dieter Bosch.Neu ist auch eine Dauerausstellung im Neubau des UlmerMuseums, die auf 80 Quadratmetern einen Überblick überdas Schaffen an der HfG gibt. Hier kann man das Hotelge-schirr, auch TC 100 genannt, nun im musealen Kontext be-wundern, so wie andere Exemplare der Produktgestaltungder HfG. Filme geben einen vertiefenden Einblick in Projekteund Geschichte, Tondokumente aus der Zeit lassen die Ak-teure lebendig werden. Anlässlich dieser Eröffnung soll mitder neuen Schriftenreihe ein Beitrag zur Vervollständigungder HfG-Geschichte geleistet werden. Seit 1987 gibt es be-reits das HfG-Archiv Ulm, das auf Initiative ehemaliger HfG-Angehöriger von der Stadt Ulm eingerichtet wurde und seit1993 eine Abteilung des Ulmer Museums ist.
Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierten sich Inge Schollund Otl Aicher für die Ulmer Volkshochschule, um durch po-litische Bildung und Gestaltung der Umwelt das demokra -tische Denken zu festigen und eine neue Kultur zu fördern.Im Gedenken an ihre Geschwister Sophie und Hans Schollgründete Inge Scholl die Geschwister-Scholl-Stiftung, die Trä-gerin der künftigen HfG wurde. Der erste Unterricht fand1953 in provisorischen Räumen der Volkshochschule statt,doch gleich mit so hochkarätigen Lehrern wie Josef Albersund Johannes Itten. Gleichzeitig baute sie nach Plänen vonMax Bill die Hochschulanlage am „Oberen Kuhberg“, die1955 offiziell eröffnet wurde. Nicht nur Mitbegründer MaxBill (siehe unser Beitrag in der Rubrik Expo), sondern auch OtlAicher wurde mit zahlreichen Erscheinungsbildern wie denender Lufthansa, der Olympischen Spiele 1972 und der Firma
Braun zum Vorbild für Gestaltergenerationen weltweit. „DieHfG ist nicht nur eine Schule, an der man eine bestimmteFachausbildung erhält; die HfG ist vielmehr eine Gemein-schaft, deren Mitglieder dieselben Intentionen teilen: dermenschlichen Umwelt Struktur und Gehalt zu verleihen“,brachte es Tomás Maldonado auf den Punkt. Das Konzeptspiegelt sich bereits in der Architektur wieder. So stand diepraktische Entwurfstätigkeit im Mittelpunkt der Ausbildung,korrespondierend dazu waren die Werkstätten in der HfGsehr groß und boten viel Platz. Max Bill sah die Hochschulewie ein kleines Dorf. Hier waren Arbeiten und Leben der Stu-denten und Dozenten verschmolzen. Die Mensa und die The-ke waren ein einladender Ort für viele Menschengruppen, et-wa so, wie ein Platz im Mittelpunkt eines Dorfes. Variabel vonder Mensa abgetrennt war die Aula, die Raum für Festlichkei-ten, Konzerte und Vorführungen bot. Die Innenausbautenund Möblierungen der Hochschule waren für flexiblen Nut-zen entwickelt. Die Theke in der Mensa war das einzige ge-schwungene Element in der ganzen Hochschule. Das inte-grierte Leben und Arbeiten prägte den gesamten Alltag. Soentstand eine „verdichtete“ Studienatmosphäre, die ent-scheidend für die Auseinandersetzung mit Fragen der Gestal-tung und der Gesellschaft war. Ergänzend dazu wurden ge-staltungsrelevante Inhalte aus verschiedenen Wissenschaftenvermittelt.„Von der Kaffeetasse bis zur Wohnsiedlung“, diese AussageMax Bills veranschaulicht das weit gefasste Ziel der Initiato-ren, Gestalter für eine neue Massenkultur auszubilden. DieAusbildung gliederte sich in die einjährige Grundlehre unddie darauf folgende dreijährige Spezialausbildung in einer derAbteilungen Produktgestaltung, Visuelle Kommunikation,Bauen, Information und Film. Neben der Fachausbildungwurde den Studierenden ihre künftige kulturelle und sozialeVerantwortung vermittelt.
Die Zeit zwischen 1953 und 1956 war geprägt von Max Billals erstem Rektor. Er verstad die HfG als eine Weiterführungdes Bauhauses, doch schon im Jahr 1956 fanden die erstenoffenen Kontroversen über den pädagogischen Aufbau unddas Lehrprogramm statt. Entgegen dem Konzept der Bau-haus-Anhänger forderten die jüngeren Dozenten ein eigen-
> Hochschule für Gestaltung Ulm | Ein Rückblick
Hochschule für Gestaltung Ulm, 1950 – 1955; Foto: Ernst Scheidegger; © NZZ, 2008;
Foto aus der Ausstellung Max Bill im Gewerbemuseum Winterthur (s. S. 20 f.)
22

ständiges, an Wissenschaft und Theorie orientiertes Ausbil-dungsmodell. Der Designer sollte nicht mehr übergeordneterKünstler, sondern gleichwertiger Partner im Entscheidungs-prozess der industriellen Produktion sein. Dies betonte TomásMaldonado in seiner programmatischen Rede auf der Welt-ausstellung in Brüssel 1958. Unzufrieden mit dem „UlmerModell“ und der Form einer kollektiven Leitung, eines so ge-nannten Rektoratskollegiums, war Max Bill als erster Rektorzurückgetreten und hatte die HfG schließlich 1957 verlassen.
Nun öffnete man sich stärker der Industrie. Die Entwicklungs-gruppen funktionierten wie eigenständige Designbüros in-nerhalb der Hochschule. Viele der dort entstandenen Entwür-fe gingen sofort in Produktion wie die Audiogeräte für die Firma Braun, das Erscheinungsbild der Deutschen Lufthansaund die Züge für die Hamburger Hochbahn. Unter Dozentenwie dem Mathematiker Horst Rittel, dem Soziologen HannoKesting und dem Industrial Designer Bruce Archer überwo-gen eine strenge, an mathematischen Operationen orientier-te Methodik sowie analytische Studien zur Ergonomie oderUnternehmensanalyse. Otl Aicher, Hans Gugelot, Walter Zei-schegg und Tomás Maldonado widersetzten sich dieser Ent-wicklung und betonten dagegen, dass Gestaltung mehr alsnur „analytische Methode“ sein muss.All die internen Auseinandersetzungen, die einerseits das„Experiment HfG“ förderten und der Institution immer neueImpulse gaben, boten andererseits Anlass zu heftiger Kritik.So debattierte der Baden-Württembergische Landtag wieder-holt über die Förderungswürdigkeit der Hochschule. Hinzukam die hohe Verschuldung der Geschwister-Scholl-Stiftung,die dazu führte, dass Dozenten entlassen und Lehrveranstal-tungen reduziert wurden. Im November 1968 beschloss derLandtag die Zuschüsse zu streichen. Der Hochschulbetriebwurde daraufhin unter Protest Ende 1968 eingestellt.
„Heroisch war nicht das Ende der HfG, sondern die Hoffnungam Anfang. Die HfG ist nicht zu messen an dem, was sie er-reichte, sondern an dem, was zu erreichen ihr verwehrtblieb“, resümiert Gui Bonsiepe 1968, doch in unserem Alltagfindet sie sich wieder in den Dingen, die Ideen leben weiterin den Ausbildungskonzepten heutiger Hochschulen.
Maria Lauber
www.hfg-archiv.ulm.de | museum.ulm.de
Stapelgeschirr TC100, 1959; Diplomarbeit: Hans (Nick) Roericht; Foto: Ernst Fesseler
23

> Wir sind Originale | Seipp Wohnen in Waldshut
Horst Seipp, Geschäftsführervon Seipp Wohnen in Walds -hut, beantwortet Fragen zumThema Original vs. Plagiat.
Herr Seipp, was ist ein Möbelklassiker?H. S. > Mit „klassisch“ im allgemeinen Sinne bringen wir oft-mals Dinge in Verbindung, die wir als formvollendet und har-monisch empfinden. Ein Möbelklassiker erfüllt diese Voraus-setzungen und hat darüber hinaus über eine Generation oderlänger am Markt Bestand.
Gibt es einen Schutz gegen das Kopieren von Möbeln, alsogegen Plagiate?H. S. > Wir unterscheiden zwischen Patenten, Gebrauchs-und Geschmacksmustern, die den Eigentümer in seinem Ur-heberrecht schützen. Im Bild: *Möbelsystem von Fritz Haller,produziert von USM, sieht man z.B. ein Möbelsystem mit pa-tentierter Konstruk tion, was den höchsten Produktschutz ga-rantiert. Der Handel mit Plagiaten ist bei uns verboten, Origi-nale dürfen nicht kopiert werden, sie unterliegen dem Urhe-berrecht. Einen wirklich wirksamen Schutz gibt es aber nicht,denn den Herstellern von Plagiaten ist geltendes Recht egal.Es gab in der letzten Zeit eine Reihe von Gerichtsurteilen,nach denen die Plagiateure empfindliche Strafen zu zahlenhatten und sämtliche Produkte vernichten mussten. Doch esgibt viele schwarze Schafe, und die Gefahr, erwischt zu wer-den, ist für sie offenbar noch nicht groß genug. Übrigens, inöffentlich zugänglichen Räumen wie z.B. Banken, Boutiquen,Arztpraxen oder Behören dürfen Plagiate nicht stehen.
Man hört immer wieder das Argument, dass Originale viel zuteuer seien. Können die Kopien qualitativ mit ihnen mithalten?H. S. > Nein, auf gar keinen Fall. Wer ein Plagiat kauft, machtsich oft gar nicht klar, dass es, wenn überhaupt, nur ein paarJahre hält. Viele Käufer wissen nicht einmal, dass sie kein Ori-ginal gekauft haben und sind unangenehm überrascht, wenndie ersten Mängel auftreten. Sie freuen sich über den niedri-gen Preis, werden aber beim Kauf nicht darauf hingewiesen,dass es sich um ein unrechtmäßig hergestelltes Produkt in ei-ner deutlich geringeren Qualität als das Original handelt.
Warum ist denn ein Plagiat so günstig? H. S. > Der Raubkopist hat, anders als die Hersteller von Ori-ginalprodukten, keine Ausgaben für Werbung, Entwicklungund Vermarktung. Und er spart bei Material und Verarbei-tung. Die Firmen, deren Originale wir vertreiben, geben meisteine sehr lange Garantie und Gewährleistung auf ihre Möbel-stücke. Der Alu-Chair z.B. hat gute Chancen, seinen Käuferzu überleben. Und sollte einmal ein neuer Bezug oder ein Er-
satzteil benötigt werden, erhält er dieses ohne Problemeauch nach 30 Jahren.Das macht diese Möbelstücke auch so nachhaltig. Sie sindunter anderem ein Plädoyer gegen die Wegwerfgesellschaft.Und betrachten Sie erst den künstlerischen Wert – der Desig-ner hat ein Urheberrecht. Dieses zu verletzen ist ebenso ver-werflich wie das unerlaubte Kopieren eines Gemäldes.
Apropos Kunst: Zählen Möbelklassiker für Sie zu den Kunst-werken?H. S. > Diese Möbel haben eine bestimmte Formensprache. Invielen Fällen geht mit der Verwendung eines neuen Materials(Stahlrohr, Kunststoff u.a.) auch eine ganz neue Form einher,die vorher so noch nicht da gewesen ist. Der Klassiker gehörtfür mich durchaus zur Kunst. Auch die Wertsteigerung sollteman nicht außer acht lassen. Manche Käufer von Originalensehen neben dem ästhetischen Aspekt auch die Wertsteige-rung und erstehen das Möbel als gut angelegtes Kapital.
Was sehen Sie, wenn Sie einem Klassiker gegenüber stehen?H. S. > Ich finde es immer wieder faszinierend, den Möbel -stücken auf den Grund zu gehen. Viele der bekanntesten Klas-siker stammen aus der Bauhauszeit. Mit der Industrialisierungmussten die Entwürfe einfacher gestaltet werden, denn dieMöbel sollten in Serie produziert werden und erschwinglichsein. Diese Zeit brauchte ganz neue Gestaltungsansätze, unddas Bauhaus gab diesen Anforderungen ein Gesicht. Die Ent-würfe prägten eine Epoche, man sieht der Gestaltung und denMaterialien an, zu welchem Zweck sie kreiert wurden – formfollows function. Doch auch spätere Entwürfe, z.B. aus denSechziger- und Siebzigerjahren, haben sich bereits als Klassikeretabliert. Andere gelten schon heute als die zukünftigen Klas-siker. Dass sie bis heute Bestand haben und noch lange Zeithaben werden, erfüllt mich mit Freude und Respekt.
Was strahlt zum Beispiel die Liege LC4 von Le Corbusier –wohl einer der bekanntesten Klassiker – für Sie aus?H. S. > Es ist vor allem ihre organische Form, die mich an-zieht. Sehen Sie sich einmal diese perfekte Formensprache
PO
RTR
AIT
24
Sessel Barcelona, Design Ludwig Mies van der Rohe (1929);
produziert von Knoll International

an. Tatsächlich ist es der Entwurf, an dem Le Corbusier amlängsten gearbeitet und gefeilt hat. Er stammt aus dem Jahr1928, die Liege wurde wie kaum eine andere kopiert unddoch nie erreicht. Sie ist einfach einzigartig, auf ihr zu liegenist ein Erlebnis, sie anzusehen immer wieder bezaubernd.
Sie sprechen von Freude und Zauber. Können Sie das näherbeschreiben?H. S. > Das lässt sich nicht in Worte fassen. Viele dieser Mö-belstücke senden tatsächlich einen Zauber aus durch Formen,Materialien, technische Besonderheiten, Farbgestaltung oderdurch ihre Komposition. Man muss das selbst erlebt haben.Und eben diesen Zauber sendet eine Kopie nicht aus, auchwenn sie rein äußerlich bis auf wenige Details dem Originalsehr ähnlich ist. Das lässt sich nicht rational beschreiben, daist einfach Magie im Spiel.
Kann der Laie den Unterschied zwischen Original und einergut gemachten Kopie überhaupt sehen?H. S. > Einige Hersteller versehen ihre Möbel mit Prägungen,einem Siegel oder anderen Merkmalen. Zusätzlich hat derVerband creativer inneneinrichter das Echtheitssiegel ent -wickelt. Der Freischwinger von Thonet, der Adjustable Tablevon Eileen Gray oder die LC-Liege tragen im Gestell die Prä-gung des Herstellers. Oft werden Zertifikate angehängt, dieaber nicht immer fälschungssicher sind. Neben diesen Merk-malen gibt es nur kleine Unterschiede, die dem ungeübtenAuge oft verborgen bleiben.
Was sagen Sie Ihren Kunden in Bezug auf Plagiate?H. S. > Die ci-Mitgliedshäuser handeln ausschließlich mit Ori-ginalen, dafür bürgen sie mit dem ci-Echtheitszertifikat undEchtheitssiegel, das ähnlich einer TÜV-Plakette nicht übertra-gen werden kann und sich beim Abnehmen von selbst zer-stört. Wer bei einem seriösen Fachhändler einkauft, erhältimmer das Original – und eine gute Beratung dazu. Wer diesnicht weiß, hat jedoch als Laie kaum eine Chance, das Origi-nal von der Fälschung zu unterscheiden. Wer ungewollt inden Besitz einer Kopie gelangt ist, ärgert sich umso mehr,wenn er den Irrtum aufdeckt. Wir laden Sie ein, in einem per-sönlichen Gespräch mit uns eine Lösung zu finden und bie-ten Ihnen das Original zu einem fairen Preis an.
Was sagen Sie den Kopisten?H. S. > Sie sind Trittbrettfahrer, die sich am geistigen Eigen-tum der Designer bereichern. Sie bewegen sich außerhalb derLegalität, und ich freue mich über alle Plagiathersteller, dererdie Justiz habhaft werden kann. Aber man kann das Ganzeauch mit einem Augenzwinkern beantworten: Wer ein Origi-nal kopiert, weiß, dass er etwas Gutes kopiert. Schon TheodorFontane gelangte zu der Überzeugung, dass Plagiate wahr-scheinlich die aufrichtigsten aller Komplimente sind.
Regina Claus
seipp | D-79761 Waldshut, Bismarckstr. 35, T +49 7751 8360
D-79761 Tiengen, Schaffhauser Str. 36, T +49 7741 60900
www.seipp.de
LC 4, Design Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand (1928); produziert von Cassina.
* Möbelsystem, Design Fritz Haller (1962); produziert von USM Haller.
25

26

SC
HM
UC
KTE
ND
EN
ZE
N Z
H> Stefan Wettstein | Kugelarmreif
Der Kugelarmreif von Stefan Wettstein ist eine wunderbareSynthese aus weichem Fluss und geometrischer Stringenz.Er hat alles, was einen Klassiker ausmacht. Die Form konse-quent reduziert auf Funktion, schwingt und schwebt er ausder Fläche in den Raum, dabei fasziniert und erfreut er mitseiner lebendigen Bewegung am Arm.
Stefan Wettstein entwickelte den Armreif fast beiläufigbeim spielerischen Experimentieren für seine Diplomarbeitan der Schule für Gestaltung in Zürich. Aus Vierkant-Drahthatte er fünf Ringe zusammen gelötet – jeder etwas größer
als der andere, berührungsfrei perfekt ineinander passend.Dann vernietete er sie miteinander – immer um 90° ver-setzt. Als der Prototyp des Armreifes an seinem Handgelenkhin und her schwang, war Stefan Wettstein hingerissen vonseiner neuen Entdeckung. Erst später realisierte er, dass er – knapp fünfhundert Jahrenach Gerolamo Cardano – die kardanische Aufhängung fürSchiffskompasse nochmals neu erfunden hatte. Ein Klassi-ker halt!
Bruna Hauert
Stefan Wettstein Geboren 1960 in Winterthur, absolvierte eine Lehre als Sil-berschmied und studierte anschließend in der Fachklasse fürSchmuck und Gerät an der Schule für Gestaltung in Zürich.Er arbeitet heute als Dozent an der Zürcher Hochschule derKünste ZHDK und als freischaffender Schmuckdesigner.
Weitere Arbeiten Stefan Wettsteins sind bei friends of carlotta in der Ausstellung
zu sehen.
Friends of Carlotta | Galerie für Schmuck und Objekte
Neumarkt 22 | CH-8001 Zürich | www.foc.ch
präsentiert von
27

28

Seit mittlerweile zehn Jahren entwirft der gebürtige Freiburger Designer Kai Orlob Lichtsysteme mit Acrylglas, besser bekannt unter der Handelsbezeichnung Plexiglas.Bruchsicher, leicht und nahezu beliebig form- und färbbarbietet dieser Werkstoff die Voraussetzung für die ästheti-schen und eigenwilligen Lichtkonzepte des Designers. Ge-paart mit der Verwendung von Neonlichtfarbwechselan -lagen bis hin zu DX-gesteuerten LED Lichtsystemen haben
die Objekte ihren Weg in namhafte Büros und Gastrono-mien gefunden. Seine künstlerische Ader findet in der Lichtinszenierung vonGebäuden ihren Ausdruck, wobei ihm seine langjährigeTheatertätigkeit zu gute kommt.
Terminabsprachen unter T +49 157 72051666
> Kai Orlob | Lichtlabor
JUNGES L ICHTDES IGN PRÄSENT IERT VON LUMINA | FRE IBURG > WWW.LUMINA-BELEUCHTUNG.DE
LIC
HTB
LIC
KDie Firma Lumina fühlt sich der wertbewussten und intelligenten Umsetzung des Themas Licht verpflichtet und bietet deshalb jungen Designerinnen und Designern die Möglichkeit, ihre Arbeiten einem anspruchsvollen Publikum vorzustellen. In der Rubrik LICHTBLICK präsentiert die Fa. Lumina in loser Folge Lichtdesign von Zurich bis Karlsruhe.
29

S A E G N E R
A G K B 7 H Z 8
X Q 1 G K 3 J U
S R 6 W C L Z E
A R T 8 V K A P
LIEBER ZWEITE AUGEN … ALS DRITTE ZÄHNE
brombergstraße 33 • 79102 freiburg • tel. 07 61 . 70 12 12
Großer Sehtest …. bei uns im Laden
JEDER DER SICH DIE FÄHIGKEIT ERHÄLT, SCHÖNES ZU ERKENNEN, WIRD NIE ALT WERDEN FRANZ KAFKA
some thingsSchöne Dinge, Antikes und Vintage:
Möbel, Bilder, Bücher, eine einladende Mischungausgesuchter Designerstücke undnostalgischen Wohndekors, die das Leben bereichen.
ANWESEN LEONHARDT • MARKTPLATZ 14 • D-79312 EMMENDINGEN • DI– FR 14.30– 18.30 UHR, SA 11– 14 UHR
30

> muba 2008Gastland Österreich15. bis 24. Februar 2008
Rund 1000 Aussteller zeigen während zehn Tagen und verteilt auf vierMessehallen ihre Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Woh-nen, Gesundheit, Bau/Garten, Haushalt, Multimedia, Mode, Degustation,Reisen und Kultur. Das Gastland Österreich präsentiert eine Vielfalt an ku-linarischen Köstlichkeiten sowie Informationen zum Kultur- und Tourismus-angebot. Der Gastkanton Tessin vermittelt Themen wie Tourismus, Sport,Oenogastronomie oder Kultur. Innerhalb der muba findet mit 120 Ausstellern eine der umfangreichstenWohnausstellungen, die Wohnsinn, statt. Traditionell zeigen an der Wohn-sinn zehn Gestalter ihre neuen Objekte innerhalb der Plattform „Design“.Die Schweizerische Vereinigung für das gestaltende Handwerk stellt ihrbreites und exklusives Angebot im „Form Forum“ vor.Das Schweizer Möbel-Label „Team by Wellis“ präsentiert im Bereich Wohn-sinn eine Gemeinschaftsausstellung mit den fünf Schweizer Marken Revox,Feller, Zumtobel, Makro und Schlossberg. Die Sonderpräsentation steht un-ter dem Motto „Form, Material, Ton und Licht als Einheit“.
Messezentrum Basel MCH Messe Schweiz (Basel) AG | 10– 18h | Degustation bis 20h
www.muba.ch
> Ursi Näf: Reduktion und Eleganz Modenschau Frühlings- und Sommerkollektion 200812. März 2008, 18h
Nach dem Motto „Individualitätleben, zeigen und tragen“ arbei-tet Ursi Näf in Basel. Die erfolg-reiche Individualmodedesignerinentwirft, produziert und verkauftihre zeitlosen und auf das We-sentliche re duzierten Kleidungs-stücke am Spalenberg 60. Ein universelles Figurverständnis,Zeitlosigkeit, Einfachheit kombi-niert mit Eleganz und hochwerti-gen Materialien sowie ihre Lieb-lingsfarbe Schwarz sind ihr Mar-kenzeichen. Ihre Kleider engendie TrägerIn niemals ein und fal-len durch die spezielle Verarbei-tungstechnik so, dass jedes Mo-
dell das Individuum unterstreicht. Ursi Näf steht für „Qualitätsproduktemade in Basel“: hochwertige Stoffe und perfekte Verarbeitung aus Über-zeugung.
Ursi Näf Individual Modedesign
Spalenberg 60 | CH-4051 Basel | T +4161 2615820 | www.ursinaef.ch | [email protected]
> some thingsEin neuer Laden für Preziosen in der Alten Metzig
Am Anfang war die Leidenschaft für alles Alte, der Respekt vor der Histo-rie. Daraus erwuchs die Liebe für schöne Dinge. Unter dem Fresko einesOchsenkopfs im historischen Ambiente der ehemaligen Metzgerei eines300 Jahre alten Ackerbürgerhauses hat die Kunsthistorikerin, Autorin undfreie Journalistin Eva Schumann-Bacia nun die geeignete Plattform für ih-re unbändige Sammel- und Kunstleidenschaft. Im eigenen Laden „somethings“ im Anwesen Leonhardt am kleinen Marktplatz von Emmendingengelingt die Verbindung von alten und neuen Dingen. Antikes und Vintage– antike Möbel, historische Ölbilder, Reprints alter Kinderbücher, elsässi-sches Geschirr und Glas verbinden sich elegant mit einer sehr persönlichenAuswahl ausgesuchter Designerstücke der klassischen Moderne zu einereinladenden Mischung nostalgischen und zeitgenössischen Wohndekors.Geschmackvolle Kleinigkeiten, Postkarten, Dosen, Kalender und Papeteriekommen aus England und Schweden. Dazu passen historisches und neu-es Spielzeug, Lampen und Heimtextilien aus Frankreich. Auch eine Einrich-tungsberatung findet sich in der Wundertüte von „some things“ .Das Areal im Kern der Altstadt wird durch ein großes Hoftor erschlossen,hinter dem sich Scheune, Magazin und das barocke Bürgerhaus befinden.Das Holz für den Dachstuhl des Bürgerhauses wurde im Winter 1780 /81geschlagen. Die Maßverhältnisse der Scheune entsprechen denen des„Goldenen Schnitts“, was dem Bau eine schöne Harmonie verleiht. Der Bau von „some things“ entlang der Markgrafenstraße erscheint zuerst1843 im städtischen Brandversicherungsbuch als „Alte Metzig von Steinerbaut“. Das Parterre beherbergte nacheinander Schreiner, Metzger,Kürschner, Schuhmacher und Sattler. Auffallend sind der schöne Sand -steinboden, ein hölzernes Säulchen, das die tragenden Balken stützt, Res-te von Wandmalereien und der unter Glas konservierte Mauerschadendurch eine Seifensiederei.Der Verein „Anwesen Leonhardt“ fungiert heute als Pächter bei der StadtEmmendingen und restauriert unter Aufsicht der Denkmalpflege nun en-gagiert Schritt für Schritt das romantische Ambiente. Der Laden „somethings“ ist das einzige bisher vollständig renovierte Gebäude – in der An-mutung eines englischen Dorfladens ein kleines Schmuckkästchen.
„some things“ | Alte Metzig, Anwesen Leonhardt
Marktplatz 14 | D-79312 Emmendingen | Di–Fr 14.30–18.30h, Sa 11– 14hTI
PP
S
31
Basel (CH)
Emmendingen (D)

DESIGNMAGAZIN > Ich bestelle O das INFORM > ABO (5 Ausgaben im Jahr) zum Preis von 28,– EUR /Jahr (D)
O das INFORM > ABO (5 Ausgaben im Jahr) zum Preis von 32,– EUR /Jahr (CH/EU)
beginnend mit der Ausgabe (Monat) .......................................
Vor- und Nachname: ……………………………........................... Postanschrift: .....................................................................................
...................................................................................................... ............................................................................................................
Telefon: ....................................................................................... Email: .................................................................................................
Datum/Unterschrift ..........................................................................
Ich bezahle O gegen Rechnung | O per Bankeinzug: KTO.-NR.: ...........................................................................................
BLZ: ....................................................................................................
BANK: ................................................................................................
Widerrufsrecht Ich kann diese Vereinbarung innerhalb von 2 Wochen bei art-media-edition Verlag, Sandstr. 17, D-79104 Freiburg schriftlich widerrufen. Die Frist ist durch die rechtzeitige Absendung des Widerrufs gewährt.
Ich bestätige dies mit meiner zweiten Unterschrift: Datum/Unterschrift ..............................................................................................
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post an: INFORM Designmagazin, Stichwort: ABO, Sandstr.17, D-79104 Freiburgoder per Fax an: + 49(0)7 61 8 81 74 79Dieses Abo-Bestellformular finden Sie auch unter www.inform-magazin.com
32

> Focus Green Internationaler Designpreis Baden-Württemberg 2008Anmeldeschluss 20. März 2008
Der diesjährige Internationale Designpreis Baden-Württemberg widmetsich mit dem Themenschwerpunkt Focus Green Produkten mit ökologi-scher Orientierung. Umweltorientierte Lebensweisen sind populär, nach-haltige Entwicklung, Klimaschutz und die Schonung natürlicher Ressour-cen werden zu wesentlichen Aspekten politischer und wirtschaftlicher Ent-scheidungen. Bedingt durch die weltweite Verknappung und Verteuerungvon Rohstoffen entscheiden zusätzlich energie- und ressourcensparendeMaßnahmen über den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Deshalbsind Design und Entwicklung gefragt, gestalterische Lösungen und Inno-vationen für umweltverträglichere Produkte aufzuzeigen und zu realisie-ren. Charakteristisch für ökologisch orientierte Produkte sind potentielleLanglebigkeit durch formal zeitlose und qualitativ hochwertige Gestal-tung, Optionen für Servicemaßnahmen, Wartung und Reparatur oder Re-duzierung des Rohstoff- und Ressourcenverbrauchs durch angepassten,minimierten Materialeinsatz. Auch die bevorzugte Auswahl von Materia-lien mit günstiger Umweltbilanz, die Berücksichtigung sinnvoller und tech-nisch machbarer Recyclingmöglichkeiten durch Materialkennzeichnungenund Konstruktionsprinzipien sowie der Energieverbrauch bei der Herstel-lung und im Gebrauch von Produkten sollen durch den Wettbewerb in denBlick genommen werden. Der Staatspreis wird jährlich für zukunftsweisen-de und herausragende Gestaltungsleistungen verliehen. Zur Teilnahmesind Hersteller und Designer aus aller Welt eingeladen. Jedes Produkt, dasnicht länger als zwei Jahre auf dem Markt ist, kann für eine der Katego-rien angemeldet werden. Zugelassen sind auch Prototypen, deren Serien-reife gewährleistet ist, jedoch keine künstlerischen Arbeiten.
Design Center Stuttgart | Regierungspräsidium Stuttgart
Willi-Bleicher-Str .19 | D-70174 Stuttgart | www.design-center.de
Informationen zum Wettbewerb Hildegard Hild, T +49 711 1232684
Preisverleihung 17. Oktober 2008
> Blickfang Stuttgart 2008 Designverkaufsmesse mit über 200 jungen Designern 7. bis 9. März 2008
In der Liederhalle Stuttgart präsentiert die 16. Blickfang Stuttgart rund 200junge Möbel-, Schmuck- und Modedesignschaffende aus ganz Europa. Neuist dieses Jahr auch eine Architektur-Sonderschau mit acht Stuttgarter Ar-chitekturbüros. In der City Corner werden sich zehn Designer aus Sydneyvorstellen. Bereits zwei Wochen vor der Messe kann man sich in Stuttgartund Umgebung mit Ausstellungen und Vorträgen auf das Thema Designeinstimmen im Design Center Stuttgart, im Modemuseum im Schloss Lud-wigsburg, in den Wagenhallen sowie bei raumPROBE und im Kunstmu-seum. Vorträge aus den Bereichen Design und Architektur flankieren dasMessegeschehen. Beispielsweise spricht Architekt HG Merz über „AudioVideo Disco – Gegenwart und Zukunft der Museumsgestaltung“ und Mar-tina Kühne vom Gottlieb Duttweiler Institut stellt ihre Studie „Shoppingand the City 2020 – wie die Städte von morgen Konsumenten anziehen“vor. Jungen Designstudierenden bietet die BLICKFANG in Stuttgart dieChance, eine Präsentationsfläche auf der Messe zu gewinnen und so Um-setzbarkeit und Marktpotential ihrer Ideen am Publikum zu testen. Im Rah-men der Hochschulpräsentation informieren verschiedene Designhoch-schulen über ihr Studienangebot.
Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle Berliner Platz | D-70174 Stuttgart
www.blickfang.com
Fr 12– 22h | Sa 12– 22h | So 11– 20h
> „Wouldn’t it be nice… – 10 Utopien in Kunst und Design” Ausstellung im Museum für Gestaltung bis 25. Mai 2008
Den gemeinsamen sozialkritischen und politischen Methoden und Zielenvon Kunst- und Designprojekten ist die neueste Ausstellung im ZürcherMuseum für Gestaltung gewidmet. Die utopischen Hoffnungen der Moder-ne und der Glaube an Funktion und neutrale Form sind im Design längstpassé. Heute ist klar, dass Design keine neutralen Produkte schafft – son-dern jedes Produkt soziale, politische, ethische oder ökologische Dimensio-nen beinhaltet. „Wouldn’t it be nice… – 10 Utopien in Kunst und Design“stellt fünf Kunstschaffende fünf Designern und Designerinnen gegenüber.Mit diesem Ansatz verweist die Ausstellung auch auf den Auflösungspro-zess der Grenze zwischen Kunst und Design, der sich beispielsweise darinniederschlägt, dass einige der beteiligten Künstler respektive Designer we-der als Künstler noch als Designer kategorisiert werden möchten. In derDenktradition von Marcel Duchamp, Andy Warhol oder Jeff Koons arbeitensie bewusst an den Trennlinien zwischen Kunstwerken und Gebrauchs -objekten.Die gezeigten Arbeiten verbindet ein politischer Umgang mit Artefaktender zeitgenössischen Populärkultur. So entwerfen beispielsweise Dunne,Raby und Anastassiades Konsumgüter „für fragile Persönlichkeiten in ban-gen Zeiten“: The Statistical Clock liefert permanent aktualisierte Infor -mation zu unnatürlichen Todesursachen wie Tod durch Feuer, Erschießen,Messerstechereien, Bombenanschläge etc. Das Objekt zählt die entspre-chenden Todesmeldungen und verkündet diese in Echtzeit mittels eineseingebauten Lautsprechers. Die Arbeit Status Watch vermittelt Informatio-nen zur derzeitigen Wahrscheinlichkeit, aktuell einem Terroranschlag zumOpfer zu fallen.Die zehn beteiligten Autorinnen und Autoren sind: Jürgen Bey (NL), Bless(F/D), Dexter Sinister (GB/USA), Dunne & Raby und Michael Anastassiades(GB), Alicia Framis (E), Martino Gamper (I/GB), Ryan Gander (GB), MartíGuixé (E), Tobias Rehberger (D) und Superflex (DK).
Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellungsstr. 60 | CH-8005 Zürich | www.museum-gestaltung.ch
Jurgen Bey, The Modelworld Maquette, 2007; © Foto: Francis Ware
33
Stuttgart (D) Zürich (CH)


AG
EN
DA
35
Augsburg (D)kehrbaumarchitektenProjekte 1993–200812.3.–25.5.Architekturmuseum SchwabenBuchegger-Haus | Thelottstr. 11 | D-86150 AugsburgT +49 821 2281830www.architekturmuseum.de | [email protected]–So 14–18h
Basel (CH) Arch/Scapes Die Verhandlung von Architektur und Landschaftbis 11.5.Schweizerisches Architekturmuseum SAMArch/Scapes Beitrag der Schweiz zur Architektur Biennale in São Paulo2. 2.–11. 5.Schweizerisches Architekturmuseum SAMSteinenberg 7 | CH-4051 BaselT +41 61 2611428www.sam-basel.org | [email protected], Mi, Fr 11–18h, Do 11–20.30h, Sa, So 11–17h
Die Nord-Süd-Empörungbis 21.2. Cores do Silencio13.3.–24.4.Stiftung Brasilea Westquai 39 | CH-4019 BaselT +41 61 2623939www.brasilea.com | info@brasilea
mubaErlebnismesse15.–24.2. Messezentrum Baselwww.muba.chtäglich 10–18hBASELWORLD 2008Schmuckmesse3.–10.4.Messezentrum Baselwww.baselworld.comtäglich 9– 18h, am letzten Tag 9– 16h
50 Jahre HelvetiaKleine Jubiläumsausstellung zum 50. Geburtstag einer Schriftbis 30.6.Basler PapiermühleChinesische KalligraphieDemonstrationen und Schreiben von Namen der Besucher in chinesischer Schriftjeden 2. So im Monat, 14– 16.30hBasler PapiermühleBuntpapier selber herstellenDi+Do 14–16.30hBasler PapiermühleSchweiz. Museum für Papier, Schrift und DruckSt. Alban-Tal 35/37 | CH-4052 BaselT +41 61 2729652www.papiermuseum.chDi–So 14–17h
Bosc – Les jeux sont faitsbis 30.3.Karikatur & Cartoon MuseumSt.Alban-Vorstadt 28 | CH-4052 BaselT +41 61 2711336www.cartoonmuseum.chMi–Sa 14–17h, So 10–17h
Berlin (D)Werkbundausstellung Paris 1930Leben im Hochhausbis 7.4.Bauhaus-Archiv /Museum für GestaltungKlingelhöferstraße 14 | D-10785 Berlin (Tiergarten)T +49 30 2540020www.bauhaus.de | [email protected]–Mo 10–17h
Präsentation des Qualitätszeichen ausgezeichnet!Universal Design28.2. 17.30hAusstellung: 29.2. +3.3. 9–18hIDZ Berlin | Reinhardtstr. 52 | D-10117 BerlinT +49 30 28095111 www.idz.de | [email protected]
Bern (CH)spezifisch Ausstellung zu Landschaftsarchitektur aus der Schweiz25.3.– 19.4.Kornhausforum | GalerieZu Tisch!Jahresausstellung der Berner FH für Architektur, Holz & Bau29.2.– 9.3.Kornhausforum | StadtsaalBernische Stiftung für angewandte Kunst und GestaltungKornhausforum | Kornhausplatz 18 | CH-3000 Bern T +41 31 3129110 | www.kornhausforum.ch
Kiwanis Förderpreis 2007/08Für junge Gestalterinnen und Gestalter29.2. – 27.3. (20. –24.3. geschlossen) Schule für Gestaltung Bern und BielSchänzlihalde 31 | CH-3013 Bernwww.kiwanis-bern-aare.ch | www.sfgb-b.chMo–Fr 8–21h, Sa 8–12h
Bregenz (A)Vlow! 08 Konferenz, Open Space, Award25.–27.4.Festspielhaus BregenzPlatz der Wiener Symphoniker 1 | A-6900 BregenzT +43 5574 413352www.vlow.net | [email protected]
Brüssel (B)5. Design Triennalbis 2.3.Musée du CinquantenaireMusées royaux d'Art et d'Histoire Parc du Cinquantenaire 10 | B-1000 Bruxelleswww.kmkg-mrah.beDi–So 10–17h
Darmstadt (D)Plexiglas® Werkstoff in Architektur & Design bis 24.3.Museum Künstlerkolonie | Institut MathildenhöhePeter Behrens Das Wertheim-Speisezimmer28.3.–26.10.Museum Künstlerkolonie | Institut MathildenhöheOlbrichweg 13 | D-64287 DarmstadtT +49 6151 132778 | www.mathildenhoehe.infoDi–So 10–17h
Dessau (D)Bauhaus Dessau – Werkstatt der ModerneDauerausstellungBauhaus Dessau Gropiusallee 38 | D-06846 Dessau-RosslauT +49 340 6508225 | www.bauhaus-dessau.de täglich 10– 17 h
Flims Dorf (CH)Diego Giacomettibis 13.4.Das Gelbe haus | Via Nova | CH-7017 Flims DorfT +41 81 9367414 www.dasgelbehaus.ch | [email protected]–So 14–18h
Frankfurt a.M. (D)Fur & Fashion 200860. Frankfurt International Outerwear Fair6.–8.3.Internationale Frankfurter MesseLight + Building 2008Internationale Fachmesse für Architektur und Technik6.–11.4.Internationale Frankfurter MesseLudwig-Erhard-Anlage 1 | D-60327 Frankfurt a.M. T +49 69 75750 www.messefrankfurt.com
Kveta Pacovská – Maximum Contrastbis 6.4.Museum für Angewandte Kunst FrankfurtMangamania27.2.–25.5.Museum für Angewandte Kunst FrankfurtSchaumainkai 17 | D-60594 Frankfurt T +49 69 21234037 www.museumfuerangewandtekunst.frankfurt.deDi, Do–So 10–17h, Mi 10–21h
Megacity NetworkZeitgenössische Architektur in Koreabis 17.2.Deutsches ArchitekturmuseumShrinking Cities Schrumpfende Städte: Neun Stadtideenbis 17.2.Deutsches ArchitekturmuseumDAM Deutsches Architektur Jahrbuchbis 17.2.Deutsches ArchitekturmuseumTensegrityFlächentragwerke aus Seilen und Röhrenbis 24.2.Deutsches ArchitekturmuseumDas Erbe Kalkuttasbis 24.3.Deutsches ArchitekturmuseumVon der Urhütte zum WolkenkratzerDauerausstellungDeutsches ArchitekturmuseumSchaumainkai 43 | D-60596 Frankfurt am MainT +49 69 21238844 www.dam-online.deDi, Do–So 11–18h, Mi 11–20h
Freiburg (D)Ausstellung Nr.6Saskia Detering, Hildesheim (Schmuck)Gabi Ehrminger, Radolfzell (Keramik)Camille Schpilberg, F-Altkirch (Keramik)bis 29.3.Galerie BollhorstAusstellung Nr.7Sonja Duò-Meyer, CH-Wetzikon (Keramik)Anne Gericke, München (Schmuck)Marit Kathriner, F-Prissac (Keramik)4.4.–28.6.Galerie BollhorstKonviktstr. 11 | D-79098 FreiburgT +49 761 7667278www.galerie-bollhorst.de [email protected]–Fr 14–19h, Sa 11–16h >>>

Tapeten aus der ersten Hälftedes 19. Jahrhunderts
29.3.2008 – 1.3.2009
La Commanderie28 rue ZuberF – 68171 RixheimTél. +33 (0)3 89 64 24 56
www.museepapierpeint.org
MUSÉE DU PAPIER PEINTR IXHE IM - ALSACE� TAPETENMUSEUM� MUSEUM OF WALLPAPER
36

Gaggenau (D)Die schönsten deutschen Bücher 200715.2.–15.3.Stadtbibliothek GaggenauHaus am Markt | D-76571 Gaggenau T +49 7225 962521
Greifensee (CH)Internationale Ostereierausstellung 8.–9.3.Stiftung Schloss Greifensee Im Städtli | CH-8606 Greifensee T +41 44 9421333www.schlossgreifensee.ch | [email protected] 10–18h, So 10.30–17.30h
Hanau (D)Momentopia – Jiro Kamata bis 3.4.Deutsches Goldschmiedehaus Schönheit und Magie – Schmuck ferner Länder bis 6.4.Deutsches GoldschmiedehausAltstädter Markt 6 | D-63450 Hanau T +49 6181 256556 www.gfg-hanau.de | [email protected]–So 11–17h
Heidelberg (D)Far East Meets West Wouter Dam, NiederlandeSuck Woo (Suku ) Park, Koreabis 13.4.Galerie HellerFriedrich-Ebert-Anlage 2 | D-69117 HeidelbergT +49 6221619090www.galerie-heller.de | [email protected]–Fr 11–13h, 14–18h, Sa 11–18h, u. n.V.
Das Deutsche Verpackungs-MuseumDeutsches Verpackungs-Museum e.V.Hauptstr. 22 (Innenhof) | D-69117 HeidelbergT +49 6221 21361www.verpackungsmuseum.de [email protected]–Fr 13–18h, Sa–So, feiertags 11–18h
Quilt Art 2024.2.–1.6.Textilsammlung Max BerkKurpfälzisches MuseumBrahmsstr. 8 | D-69118 Heidelberg-ZiegelhausenT +49 6221 [email protected], Sa, So, 13–18h
Karlsruhe (D)Neue Künstlerkeramikaus der Karlsruher Majolikabis 25.5.Museum beim Markt | Karl-Friedrich-Str. 6 | 76133 KarlsruheT +49 721 9266578www.landesmuseum.de | [email protected]–Do 11–17h, Fr–So, feiertags 10– 18h
art KARLSRUHE Internationale Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst28.2.–2.3.Messe Karlsruhewww.art-karlsruhe.detäglich 12–20h, am 2.3. 11–19h
Rolf Behm, Joachim Czichon, Heiko Herrmannbis 27.4.Majolika Galerie
art party Offizielle Party für Aussteller, Künstler, Besucher und Gäste der art Karlsruhe 1.3. 19hMajolika Eventraum | Staatl. Majolika Manufaktur Karlsruhe Ahaweg 6– 8 | D-76131 Karlsruhe T +49 721 9123770www.majolika-karlsruhe.com [email protected]–Fr 10–19h, Sa, So 10–17h
Kronberg (D)Braun Innovationskultur: Pioniergeist in Technik und Designbis 30.3.BraunSammlung der Braun GmbH | Westerbach CenterWesterbachstr. 23c | D-61476 KronbergT +49 6173 302244 | www.braunsammlung.infoDi–Fr 11–17h, Sa, So 11–18h
München (D)Architektur im Kreis der Künste – 200 Jahre Kunstakademie München15.2.–18.5.Pinakothek der ModerneDes Wahnsinns fette Beute1.3.–31.5.Pinakothek der Moderne Barer Str. 40 | D-80333 München T +49 89 23805360 www.pinakothek.deDi–So 10–18h, Do 10–20h
Toca Medesign conference 0823.2. 13.30–2hReithalle | Heßstr. 132 | D-80797 MünchenT +49 89 55052361www.toca-me.com | [email protected]
Internationale Handwerksmesse (IHM)28.2.–5.3. Neue Messe München Messegelände | D-81823 München | T +49 89 949550www.ihm.detäglich 9.30– 18h
Mulhouse (F)Le Noir et BlancDans les étoffes imprimées du XVIIIe au XXIe sièclebis 19.10.Musée de l'Impression sur EtoffesRue Jean-Jacques Henner 14 | BP 1468F-68072 Mulhouse cedex T +33 389 468300www.musee-impression.com [email protected]–So 10–12h, 14–18h
Pforzheim (D)GlassWearZeitgenössischer Schmuck aus Glas14.3.–25.5.Schmuckmuseum PforzheimJahnstr. 42 | D-75173 Pforzheim T +49 7231 392126www.schmuckmuseum-pforzheim.deDi–So, feiertags 10–17h
Kip-Kunstmarkt „Das Gelbe vom Ei“15.–16.3.Kulturhaus Osterfeld PforzheimOsterfeldstr.12 | D-75172 Pforzheim T +49 7231 318210www.kip-kunstmarkt.de | [email protected] 14–20h, So 11–18h
Philipp Morlock – schnelle frauen, schöne autosbis 24.3.Kunst- u. Kunstgewerbeverein Pforzheim e.V. | ReuchlinhausJahnstr. 42 | D-75173 Pforzheim | T +49 7231 21525www.kunstvereinpforzheim.de | [email protected]–So, feiertags 10–17h
SchmuckweltenEinkaufs- und Erlebniszentrum für Schmuck und UhrenWestliche-Karl-Friedrich Str. 68 | D-75172 Pforzheim T +49 7231 994444 www.schmuckwelten.de | [email protected]–Sa 10–19h, So, feiertags 11–18h
Rixheim (F)Les papiers peints en tontissebis 1.6.Musée du papier peint / TapetenmuseumLes papiers peints de la première moitié du XIXe siècle29.3–1.3.2009Musée du papier peint / TapetenmuseumLa Commanderie Rue Zuber 28 | BP 41 | F-68171 Rixheimwww.museepapierpeint.orgMi–Mo 10–12h und 14–18h
Seewen (CH)Als der Ton noch aus dem Trichter kam11.4.–26.10.Museum für MusikautomatenBollhübel 1 | CH-4206 Seewen | T +41 61 9159880 [email protected]–So 11–18h
Staufen (D)... und leuchtet wie das Licht der SonneIslamische Keramik vom 10. Jh. bis heutebis 15.6.Keramikmuseum StaufenStudioausstellungen 2008Sabine Kratzer, Scholen15.2.–30.3.Violette Fassbänder, Basel4.4.–11.5.Wettelbrunner Str. 3 | D-79219 Staufen i. Br. T +49 7633 6721Mi–Sa 14–17h, So 11–13h, 14–17h
St. Gallen (CH)Vision Herbst / Winter 2008/09Trendinformationbis 30.3.Textilmuseum12. Internationale Biennale der Spitzebis 30.3TextilmuseumZeit-Stücke – Textile Arbeiten als Zeichen der ZeitDörte Bach, Münchenbis 30.3.TextilmuseumSwiss Embroidery – Broderies Suisses –St.Galler StickereiDauerausstellungTextilmuseum | Vadianstr. 2 | CH-9000 St.Gallen T +41 71 2221744www.textilmuseum.ch | [email protected]–So 10–17h
Wayang – Licht und Schattenbis 15.6.Historisches und VölkerkundemuseumMuseumstr. 50 | CH-9000 St.GallenT +41 71 2420642www.hmsg.ch | [email protected]–So 10–17h >>>
37

Strasbourg (F)Le salon de la rue – Plakatkunst 1890 bis 1910bis 17.2.Museum für moderne und zeitgenössische Kunst Place Hans Jean Arp 1 | F-67076 StrasbourgDi–So 11–19h, Do 11–22h
Stuttgart (D)BLICKFANGDesignmesse für Möbel, Mode und Schmuck7.–9.3.Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle Berliner Platz 1–3 | D-70174 StuttgartT +49 711 9909390www.blickfang.com | [email protected], Sa 12–22h, So 11–20h
Mahler Günster Fuchs Architekten20.2.–23.4.Architekturgalerie am WeissenhofAm Weissenhof 30 | D-70191 Stuttgart | T +49 711 257434www.weissenhofgalerie.de | [email protected]–Sa 14–18h, So 12–17h
Messe & MöbelAusstellungsreihe Ein( )sichtenbis 23.2.Design Center Stuttgart | Haus der Wirtschaft Turm BMia Seeger Preis 2007bis 15.3.Design Center Stuttgart | Haus der Wirtschaft Foyer Design-BibliothekDie wilden JungenArchitektur & Design aus Dänemark21.2.–16.4.Design Center Stuttgart | Haus der Wirtschaft15 Jahre HochspannungAusstellungsreihe Ein( )sichten27.2.–5.4.Design Center Stuttgart | Haus der Wirtschaft Turm BDänisches Design – Alltag oder MythosVortrag von Ulrich Büttnerim Rahmen der Ausstellung „Die wilden Jungen“7.3. 18hDesign Center Stuttgart | Haus der Wirtschaft Bertha-Benz-SaalHugo Boss Fashion Award 2008Ausstellungsreihe Ein( )sichten4.–24.4.Design Center Stuttgart | Haus der Wirtschaft Eyth-Saal und Turm BDesign Center StuttgartHaus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 | D-70174 StuttgartT +49 711 1232781www.design-center.de | [email protected]–Sa 11–18h
Weissenhofmuseum Im Haus Le CorbusierRathenaustr. 1– 3 | D-70191 StuttgartT +49 7112579187www.weissenhofmuseum.de | [email protected], Mi, Fr–So 11– 18h, Do 11– 20h, Mo geschlossen
Uster (CH)zwischenspielAusstellung Kunstschaffender des Zürcher Oberlandesbis 16.3.Städtische Galerie für Kunst und GestaltungVilla am Aabach | Brauereistr. 13 | CH-8610 UsterT +41 44 9409991www.villaamaabach.ch | [email protected], Fr, Sa, So, 14–17h, Do 14–19h auch an Feiertagen
Weil am Rhein (D)Leben unter dem Halbmond – Die Wohnkulturen der arabischen Welt23.2.–31.8.Vitra Design MuseumCharles-Eames-Str. 1 | D-79576 Weil am RheinT +49 7621 7023700 www.design-museum.de Mo–So 10–18h, Mi 10–20h, Führung Sa und So 11h
Verfilzt+zugenäht – alles über Filzbis 2.3.Museum Weiler TextilgeschichteAm Kesselhaus 23 | D-79576 Weil am Rhein-FriedlingenT +49 7621 [email protected] | www.museen-weil.dejeden 1. So im Monat 14–17h, für Gruppen nach Vereinbarung am Vormittag
Winterthur (CH)Büroweltenbis 2.3.Öffentliche Führungen:Do 7.2., 14.2., jeweils 18.30 | So 2.3. 11 hRahmenprogramm:– Referat Bürowelten
Ronan & Erwan Bouroullec, Paris29.2. 19h
– MobbingLesung mit Annette Pehnt 2.3. 12.30h
Gewerbemuseum WinterthurMax BillZum 100. Geburtstagbis 12.5.Gute Form und Kalter Krieg, Podiumsgespräch4.4. 20.30hGewerbemuseum WinterthurFarblaborbis 29.6.Gewerbemuseum WinterthurKirchplatz 14 | CH-8400 Winterthur T +41 52 2675136 www.gewerbemuseum.chDi– So 10– 17 h, Do 10–20h, Mo geschlossen
Max Bill Zum 100. Geburtstag Ausstellungbis 12.5.Rahmenprogramm:22 Fragen an Max BillInspiration /KonstruktionZu den Skulpturen von Max BillGespräch mit Kristina Gersbach20.2. 12hFilmabend Max Bill (1995)1.4. 18hKunstmuseum Winterthur Museumstr. 52 | CH-8400 WinterthurT +41 52 267562www.kmw.chMarlis Candinas – Masche um Maschebis 1.3.tuchinform Obere Kirchgasse 8 | CH-8400 WinterthurT +41 52 2031830www.tuchinform.ch | [email protected]– Fr 10– 12.30h, 13.30–18.30h, Sa 10–16h
Zürich (CH)ArosaDie Moderne in den Bergenbis 21.2.ETH Zürich | Haupthalle | Zentrum
Neubau Oberer LeonhardResultate des Projektwettbewerbs27.2.–12.3.ETH Zürich | Haupthalle | ZentrumRämistr. 101 | CH-8006 Zürich | T +41 44 6332936www.gta.arch.ethz.ch | [email protected]–Fr 8–21h, Sa 8–16h
La finestra apertaInstitut gta – Bücher und Ausstellungen 1968–200821.2.–19.3.ETH Zürich | Hönggerberg | HIL | ARchENA+ArchitekturfoyerItaly Now?Country_Positions in Architecture9.4.–29.5.ETH Zürich | Hönggerberg | ArchitekturfoyerScience City InfospotpermanentETH Zürich | Hönggerberg | HIL | CH-8093 ZürichT +41 44 6332936www.gta.arch.ethz.ch | [email protected]–Fr 8–22h, Sa 8–12h
Wouldn't it be nice…– 10 Utopien in Kunst und Designbis 25.5.Museum für Gestaltung | HalleKunst und Design, ein ungleiches Paar?(Unterschiede und Gemeinsamkeiten zweier Disziplinen)Gespräch in der Ausstellung23.4. 20h Museum für Gestaltung Ausstellungsstr. 60 | CH-8005 Zürich T +41 43 4466767www.museum-gestaltung.chDi–Do 10–20h, Fr–So 10–17h
Comix! – Plakatsammlungbis 24.2.Museum für Gestaltung | PlakatraumFoto Grafik – Plakate seit 19959.4.–20.7.Museum für Gestaltung | PlakatraumLimmatstr. 55 | CH-8005 Zürich T +41 43 4466767www.museum-gestaltung.chDi–Sa 13–17h
Der schöne Schein– Facetten der Zürcher Raumkultur7.3.–8.6.Museum Bellerive Höschgasse 3 | CH-8008 Zürich T +41 43 4464469 | www.museum-bellerive.chDi–So 10–17h, Do 10–20h
Carte Blanche V: Miller & Maranta, Baselab 5.3.Architektur Forum ZürichBrauerstr. 16 | CH-8004 Zürich T +41 43 3220066 www.architekturforum-zuerich.ch [email protected]
Marianne Schmidhauserbis 22.3.Elia GilliProduktedesignerin, Basel3.4.–31.5.Meister Boutique & GalerieIm Zunfthaus zur Meisen Münsterhof 20 | CH-8001 ZürichT +41 44 [email protected] Mo–Fr 9–18.30h, Sa 9–16hGalerie Mi–Fr 12–18.30h, Sa 12–16h
38

IMPR
ESSU
M INFORM Designmagazin | Sandstr. 17, D-79104 Freiburg | [email protected] | T + 49 761 89 75 94 94 | F +49 761 8 81 74 79
art-media-edition Verlag Freiburg | Sandstr. 17 | D-79104 Freiburg | www.art-media-edition.com • Herausgeber: Björn Barg [email protected] • Anzeigenleitung: Jascha Seliger [email protected] | T +49 761 89759494 • Chefredaktion: Regina Claus [email protected]
• Mitarbeitende dieser Aus gabe: Björn Barg [email protected]; Anke Bluth [email protected]; Nike Breyer [email protected]; Regina Claus [email protected]; Olga Emzet [email protected]; Maria Lauber [email protected]; Geraldine Zschocke [email protected]; Dietmar Zuber [email protected]
• Gastbeiträge von: Bruna Hauert (friends of carlotta, Zürich)
• Gestaltung und Grafik: Piotr Iwicki, [email protected] • Titelbild: Piotr Iwicki, Objekt, ohne Titel - 1989, Holz / Lack / Metallpigmente, (H) 90 x (B) 200 x (T) 100 cm; © Foto: Piotr Iwicki, Freiburg
Erscheinungsweise: 5 mal im Jahr • Auflage: 5 000 Stück Titelrechte: Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Erlaubnis des Verlages und der Redaktion gestattet. • Alle Angaben in der Agenda ohne Gewähr
INFORM Designmagazin 4/2008 | 06/2008 erscheint am 15. April 2008 • Schwerpunktthema: Muster• Anzeigenschluss: 25.3.2008 • Terminschluss für die Agenda: 15.3.2008
39