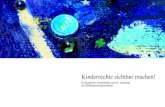Innovationen fördern und sichtbar machen. Vernetzung und Unterstützung für die Weiterentwicklung...
Transcript of Innovationen fördern und sichtbar machen. Vernetzung und Unterstützung für die Weiterentwicklung...
75
Katja Lengnink
Innovationen COrdern und sichtbar machen. Vernetzung und Unterstiitzung fiir die Weiterentwicklung von Schulpraxis
Rezension des Buches K. Krainer, W. Dorjler, H. Jungwirth, H. Kuhnelt, F. Rauch, T. Stern (Hrsg.): Lernen im Aujbruch: Mathematik und Naturwissenschaften - Pilotprojekt IMSr, Studienverlag, Innsbruck, 2002.
Mit dem Buch liegt ein umfassender Zwischenbericht zum osterreichischen bildungswissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsprojekt IMST2 (Innovations in Mathematics, Science and Technology Teaching) vor, das als die Reaktion auf die Ergebnisse von TIMSS in Osterreich angesehen werden kann. Das Buch umfasst die Konzeption, die Aktivitaten und erste Ergebnisse im Rahmen von IMST2 bis einschlieBlich des Pilotjahres 200012001. Es regt auf vielfriltige Weise an, iiber die Qualitatssteigerung von mathematisch-naturwissenschaftlichem Unterricht neu und ganzheitlich nachzudenken. Zum Weiterlesen finden sich aktuellere Ergebnisse des Projektes auf der Web-Seite http://imst.uni-klu.ac.at/. In dieser Rezension wird zunachst das Buch in seinem Anliegen vorgestellt. Dieses konkretisiert sich in vier Schwerpunktprogrammen, die in ihren Zielsetzungen und ihren ersten Umsetzungen dargestellt werden. Zuletzt wird der in dem Buch vorgestellte Ansatz mit anderen Konzepten zur Qualitatssteigerung mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts verglichen.
1. Historie, Anliegen ond Design von IMST2
Die Ergebnisse der TIMS-Studie, insbesondere im hoheren Bildungsbereich, gaben auch in Osterreich Anlass zur Besorgnis. Die Defizite waren schnell beschrieben: die osterreichischen Schiiler/innen (genau wie die deutschen) hatten vor all em Defizite im Bereich des Argumentierens, Begriindens und Vemetzens, wahrend ihre Kenntnisse im Bereich der Grundfertigkeiten oder Routinen noch im intemationalen Durchschnitt lagen. Zur Analyse der Ursachen dieser Defizite wurde das Projekt IMST yom osterreichischen Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Kultur in Auf trag gegeben. Das Besondere dieses Projektes ist, dass aile fur mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung zustandigen Gruppen in die Erstellung einer selbstkritischen Gesamtanalyse einbezogen wurden: die Schulbehorde, die Fachdidaktiken und die Schulpraxis. Dafur wurde ein umfassender Ansatz gewahlt, in den aile im Rahmen von TIMSS verfugbaren Datenquellen einbezogen, Selbstevaluationen an den Schulen durchgefuhrt und die Situation in Osterreich mit Reformansatzen in ausgewahlten anderen Liindem verglichen wurden. Danach liegen die Ursachen hauptsachlich in • einer mangelnden Einbindung der Lemenden in den Lemprozess, • dem verbreiteten Schemata des fragend-entwickelnden Unterrichts (Monokultur), • der schlechten Offentlichen Stellung der Naturwissenschaften und der Mathematik,
(JMD 25 (2004) H. 1, S.75-80)
76 Katja Lengnink
• der Fragmentierung des osterreichischen Bildungssystems (d.h. hoch differenzierte und jeweils autonome Systeme von Schuitypen, Isolation der einzelnen Fachdidaktiken und unterschiedliche Institutionen fUr Lehrerausbildung).
Auf dieser Grundlage setzt nun das Folgeprojekt IMST2 an, das zwei zentrale Aufgaben verfolgt:
1. ,Jnitiieren, Fordern und Sichtbar-Machen von Innovationen sowie deren wissenschaftsgeleitete Analyse und Verbreitung".
2. "Mitwirkung beim Aujbau eines Unterstiitzungssystems fUr die Weiterentwicklung der Schulpraxis im Bereich der Mathematik und Naturwissenschaften". (S.16)
Das Design des Projektes sieht vor, dass Schulpraxis und Fachdidaktik kooperativ Beispiele fUr "gute Praxis" erarbeiten und verbreiten. Parallel dazu soli die gesellschaftliche Relevanz von mathematisch-naturwissenschaftlicher Bildung deutlicher herausgestellt werden. Fur diese Vorhaben gilt es ein Unterstiitzungssystem zu installieren, das diesen ganzheitlichen und langfristigen Prozess zu tragen in der Lage ist. In dies em "bottom-up" Prozess sind alle Beteiligten gefragt, Anstrengungen zur QualWitsverbesserung mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts vorzunehmen - insbesondere auch die Gemeinschaft der Fachdidaktiker/innen, die durch Praxisforschung Innovationen an den Schulen unterstiitzen mussen.
2. Leitziele und Schwerpunkte im Rahmen von IMST2
1m Rahmen von IMST2 werden die folgenden Leitziele angestrebt (vgl. S. 39): • Bessere Grundbildung in Mathematik und Naturwissenschaften - niveauvolleres
Verstehen, angemesseneres Problemlosen, effizienteres und problembewussteres Argumentieren und Reflektieren im Unterricht.
• Groj3ere Vielfalt an Lehr- und Lernformen - KreativiHit, Selbststandigkeit und situationsgerechtes Lehren und Lemen, unterstutzt durch neue Medien und Technologien, sowie mehr und intensivere Formen der Reflexion von Unterricht.
• Zahlreichere und besser gestaltete Formen des professionellen Erfahrungsaustauschs unter den Lehrenden, die Auswirkung auf die Weiterentwicklung der Schule haben.
• Etablierung und Weiterentwicklung eines Netzwerks, das die Durchfiihrung und Evaluation von Unterrichtsinnovationen unterstiitzt sowie einer Offentlichkeit zuganglich macht.
• Verbessertes "Image" - gunstigere Wahmehmungsmuster und Erwartungshaltun-gen gegenuber Mathematik und Naturwissenschaften in Schulen und Gesellschaft.
Die Umsetzung dieser Leitziele wird in den vier Schwerpunktprogrammen Grundbi/dung, Schu/entwicklung, Lehr- und Lernprozesse und Praxisforschung angegangen, die im Projekt weitgehend unabhangig voneinander entwickeit und durchgefUhrt wurden. Auch die Schwerpunktprogramme werden von allen beteiligten Gruppen mit gestaitet (Lehrende, Lemende, Schulleitungen und Fachdidaktiken wie auch Eltem). Die bei der Konzeption von IMST2 als zentral angesehene Balance zwischen Aktion und Reflexion bei der Umsetzung von Innovationen in die Schulpraxis wird im Konzept dadurch verankert, dass yom Projektteam betreute Verschriftlichungen etwa in Projektantragen, Konzepten, Berichten, und Evaluationsinstrumenten gefordert
Diskussionsbeitrage 77
werden. Hierdurch sollen erarbeitete Ergebnisse und die dabei stattgefundenen Prozesse auch fiir andere nachvollziehbar, verfiigbar und kommunizierbar werden.
Zielsetzungen der Schwerpunktprogramme und Innovationen
Grundbildung 1m Schwerpunktprogramm Grundbildung soll ein Konzept fur mathematischnaturwissenschaftliche Grundbildung erarbeitet und fiir die schulische Praxis nutzbar gemacht werden. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Auswahl und Begriindung von Leminhalten und -umgebungen. Dazu werden die folgenden Leitlinien zur Begriindung von Inhalts- und Zielwahl angegeben: Weltverstiindnis, kulturelles Erbe, Alltagsbezug, Gesellschaftsrelevanz, Einblick in wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftlicher Nachwuchs. Ahnliche Leitlinien werden auch fur die Methodenwahl formuliert. Diese ubergreifenden Visionen werden bereits in den fachbezogenen Konzeptbeschreibungen unterschiedlich aktiviert. Fur die biologische Grundbildung werden die Leitlinien durchdekliniert, jedoch bleiben sie mit den vorgeschlagenen Fachthemen weitgehend unverbunden. Bei der Frage nach chemischer Grundbildung wird von der Fachthematik ausgehend ein Konzept chemischer Grundbildung entwickelt, das allerdings nicht mehr an den Leitlinien gemessen wird Der Beitrag zur mathematischen Grundbildung fokussiert ausschlieBlich auf Grundvorstellungen beim Lemen mathematischer Inhalte, wodurch nicht zu allen Leitlinien Bezuge hergestellt werden konnen. In dem Aufsatz zur physikalischen Grundbildung wird ausgehend von den Fragen Was? Warum? Wie? an Beispielen der Beitrag der Physik zur Allgemeinbildung diskutiert und konsequent mit den Leitlinien zur Zielsetzung und Methodik verschrankt. Diese Heterogenitat setzt sich auch im Bereich der Unterrichtsprojekte zum Schwerpunkt Grundbildung fort. Die vorgestellten Ansatze scheinen ihrer Beschreibung nach sehr unterschiedlich tragfahig fiir die mit dem Schwerpunktprogramm intendierten Ziele zu sein. Das Spektrum reicht von SchUler/innenibefragungen in Bezug auf die Relevanz des von ihnen verlangten Wissens uber die Anfrage an Universitiiten, welche Grundbildung sie von Maturandlinnlen erwarten, bis hin zur gemeinsamen Auseinandersetzung von Lehrenden und Lemenden uber die Grundbildung in einem Themenkreis. Ein beeindruckendes Beispiel dafiir, welche Kraft eine solche Auseinandersetzung uber Grundbildung in der Schulpraxis entfalten kann, ist die Vorstellung eines Unterrichtsprojekts zur Astronomie, in dem SchUler/innen die Stemwarte ihrer Schule fiir die Offentlichkeit geOff net haben. In diesem Projekt wurden von den Lemenden selbststandig Bildungsinhalte und Ziele definiert, die sie fiir ihre Besucher fiir wesentlich hielten. Es wurden eigenstandig Fiihrungen durchgefiihrt und evaluiert. Die Lehrenden iibemahmen die Aufgaben, die Lemenden bei ihrer eigenstandigen Arbeit zu unterstutzen und zu beraten sowie den Prozess der Auseinandersetzung iiber astronomische Grundbildung zu moderieren und kritisch zu begleiteten.
Schulentwicklung Das Schwerpunktprogramm Schulentwicklung f6rdert MaBnahmen zum Aufbau mathematisch-naturwissenschaftlicher Schwerpunktsetzungen als Schulprogrammelemente, den Aufbau eines Netzwerks solcher Schulen und Begleitforschung zu Schul-
78 Katja Lengnink
entwicklungsprozessen. Dabei geht es auch urn Werbung fUr mathematischnaturwissenschaftliche Zweige an den Schulen, die Einrichtung von Lehrer/inneniteams, urn Strukturen in dies em Bereich zu schaff en, und die Entwicklung von Leitbildem an den Schulen. Die weitgreifenden und visionaren Ziele in dies em Schwerpunktprogramm werden von den Lehrenden in kleinen konkreten Projekten angegangen, die mit dem Geist des Rahmenprogramms in Einklang stehen. So wird etwa an der Einrichtung eines naturwissenschaftlichen Labors vorgestellt, wie facheriibergreifender Unterricht zu starker vemetztem Denken beitragen kann, das an Situationen orientiert, aktiv experimentierend, aus unterschiedlichen Fachkompetenzen heraus entwickelt wird. Die Strukturen zur Einrichtung eines solchen Labors und anderer mathematischnaturwissenschaftlicher Schwerpunktbildungen an den Schulen zu schaffen, stellt sich als muhsames Unterfangen heraus, das von diesem Teil des Projekts begleitet und unterstiitzt wird.
Lehr- und Lernprozesse 1m Schwerpunktprogramm Lehr- und Lemprozesse stehen das Fordem von Diagnose- und Handlungskompetenzen bei den Lehrenden sowie die Befahigung zu situationsgerechtem Lehren und Lemen im Vordergrund. Es sollen Methoden zur systematischen Untersuchung von Lehr- und Lemprozessen an Lehrer/innen vermittelt, Lehr- und Lemprozesse fallbezogen untersucht, Konzepte fUr situationsgerechtes Lehren und Lemen entwickelt und erprobt sowie Mentoren ausgebildet werden, die dann weitere Schulprojekte begleiten konnen. Damit geht es in diesem Projektteil zentral urn die Professionalisierung von Lehrerlinne/n in Bezug auf ihr unterrichtliches Handeln und das Schaff en von Strukturen, die es moglich machen, diesen Prozess auch uber die Laufzeit von IMST2 hinaus weiterzufuhren. Konkretisiert fur die Teilbereiche Mathematik und Naturwissenschaften werden unterschiedliche Herangehensweisen der Betreuerinnen deutlich. Bei den Schulprojekten zur Mathematik werden ausgehend von Interessenschwerpunkten der Lehrenden Fragestellungen formuliert und Instrumente zu ihrer Untersuchung entwickelt sowie fallbezogen eingesetzt. Mit gemeinsam von Betreuerin und Lehrer/inne/n geplanten Untersuchungen und ihren Auswertungen wird eine Sensibilisierung der Lehrenden in Bezug auf die sie interessierenden Fragen intendiert, die dann Ausgangspunkte fur weitere Analysen und eine reflexionsbezogene Anderung der Unterrichtspraxis sein konnen. Fur die Betreuung der Schulprojekte zu den Naturwissenschaften wird die Methode des Videofeedbacks zum Unterricht angeboten, die durch Erfassen und verlangsamtes Darstellen von Lehr- und Lemprozessen Lehrer/innen dazu anregt, ihren Unterricht zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Beim Lesen der Berichte zu den konkreten Schulprojekten fallt auf, dass die beiden Betreuerinnen den Lehrerlinne/n das Verfassen der Berichte in fast allen Fallen abgenommen haben. Sosehr dies inhaltlich gerechtfertigt sein mag, so wertvoll ware doch gerade fur den Erwerb diagnostischer Kompetenzen eine solche Auseinandersetzung mit dem eigenen unterrichtlichen Handeln gewesen.
Praxisforschung Der Schwerpunkt Praxisforschung zielt darauf ab, fachdidaktische Forschung insbesondere zu praxisnahen Themen zu initiieren und zu etablieren, in deren Fokus
Diskussionsbeitrage 79
selbststandiges und eigenverantwortliches Arbeiten der Lemenden liegt. In dies em Teilprojekt von IMST2 ist eine enge Kooperation von Schulpraxis und Fachdidaktik vorgesehen, in der Fragestellungen aus der Schule und Methoden aus der Fachdidaktik gewinnbringend verknupft werden sollen. Es geht auch urn eine Weiterentwicklung der schulubergreifenden fachdidaktischen Kultur, was durch die Elemente Fondsstruktur, Beratung und Verbreitung erreicht werden solI. Damit zielt dieses Schwerpunktprojekt darauf ab, die Qualitat des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts in der gesamten "community of practice" anzuheben. 1m Rahmen dieses Schwerpunkts bestand die Moglichkeit, flir kleinere fachdidaktische Projekte Fordermittel bei IMST2 zu beantragen. Diese Projekte sollten im Sinne der "Lehrerforschung" uberschaubare Unterrichtseinheiten und deren Evaluation beinhalten, wie dies auch in den osterreichischen Lehrerfortbildungsprogrammen Tradition hat (s. Altrichter und Posch 1998). Es bestand die Moglichkeit, sich zu dies en Projekten beraten zu lassen und die Ergebnisse sollten knapp publiziert werden. Die vier beschriebenen Projekte haben aIle eine Forschungsfrage, die mit veranderter schulischer bzw. universitarer Praxis zusammenhangt. So wurde Projektunterricht in Abgrenzung zu herkommlichem Unterricht flir das Themenfeld Trigonometrie evaluiert. Es wurde ein interdisziplinares Projekt zum Thema "Sonne - Motor des Lebens" von Studierenden ftir Schiiler/innen geplant und durchgeflihrt. Der Fulle physikalischer Themen wurde in einem Vorhaben durch einen eigentatigen Zugang der Lemenden in Projektform zu begegnen versucht. Der Einsatz des Intemets im Rahmen von eigenverantwortlichem Lemen im Physikunterricht wurde untersucht. Die vorgestellten Proj ekte stellen im Vergleich zu dem umfassenden Anspruch des Schwerpunkts eher lokale Initiativen zur Praxisforschung dar, dennoch ist das Projektteam zuversichtlich, dass ihre Darstellung Modellcharakter hat und als Initialzundung zum Autbau der ubergreifenden fachdidaktischen Kultur dienen kann. Beim Anwerben der Projekte im Rahmen dieses Schwerpunkts und bei der Publikation der Ergebnisse wurde in einer prozessbegleitenden Evaluation festgestellt, dass der zeitliche Aufwand auf Seiten der Lehrer/innen deutlich unterschatzt wurde. Es wurden bereits klein ere Korrekturen in der Prozessbegleitung vorgenommen, die das Problem abmildem sollen.
3. Bilanz Die Konzeption und Durchflihrung von IMST2 in ihrem ganzheitlichen Zugang, auf moglichst vielen verantwortlichen Ebenen Strukturen zur Qualitatssteigerung mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts zu erarbeiten, ist sehr uberzeugend. Dies fangt bereits mit der soliden Ursachenforschung im Rahmen von IMST an. Eine solche Auftragsarbeit hat es in Deutschland nicht gegeben, dennoch sind im Rahmen des BLK-Programms zur "Steigerung der Effizienz des mathematischnaturwissenschaftlichen Unterrichts" (BLK 1997) ebenfalls Ursachen fUr das schlechte Abschneiden deutscher Schiiler/innen benannt und Module zur Qualitatssteigerung entwickelt worden. IMST2 wird von der Auffassung getragen, dass sich Unterricht nicht ohne eine Veranderung der Kompetenzen und Einstellungen von Lehrerlinne/n weiterentwickeln kann und dass daflir notwendige Rahmenbedingungen an den Schulen und durch den Aufbau von Netzwerken und Unterstiitzungssystemen geschaffen werden mussen.
80 Katja Lengnink
Dies gibt .dem Projekt seine spezifische Gestalt, die es klar von den Initiativen der deutschen Bildungspolitik nach TIMSS und PISA abgrenzt. Dort wird, im Gegensatz zu der in IMSr2 verfolgten "bottom-up" Philosophie, durch Einflihren von verbindlichen Bildungsstandards versucht, zu einer von auBen vorgegebenen Qualitat von mathematisch-naturwissenschaftlichem Unterricht zu gelangen. Eine von den Autoren gegebene Begriindung (vgl. S. 38) fUr den mit IMSr2 verfolgten Ansatz ist die Beobachtung, dass von auBen vorgegebene MaBnahmen die Praxis kaum erreichen und auf Systemwiderstande stoBen. Ahnlich sieht es auch mit der Kluft zwischen fachdidaktische Forschung und Schulpraxis aus. In IMSr nimmt man dieses Problem ernst und versucht durch ein Etablieren praxisbezogener Forschung langfristig zu einer Verbesserung der Situation zu kommen. Prozessbegleitend und zum Abschluss des Projektes sind umfassende Evaluationen der MaBnahmen geplant, von denen jedoch zum Zeitpunkt der VerOffentlichung des Buches kaum Ergebnisse vorlagen. Damit ist IMSr2 Ausdruck eines Paradigmenwechsels in der fachdidaktischen Forschungslandschaft, in der sich nach TIMSS und PISA eine Kultur des Fragens nach Effekten von InterventionsmaBnahmen entwickelt und durchgesetzt hat. Seinem ganzheitlichen Anspruch und seiner hohen theoretischen Substanz werden die beschriebenen Einzelprojekte natiirlicherweise nicht gerecht, sie sind Beschreibungen individueller Lernprozesse von Lehrer/inne/n, die damit zur Auseinandersetzung und Nachahmung ermutigen. Schulische Entwicklungsprozesse, gesellschaftliche Lernprozesse und die Professionalisierung von Lehrer/inne/n konnen nur als langfristige Prozesse geplant und strukturell gefOrdert werden. Mit dem in IMSr2
verfolgten Ansatz wird der schulischen Realitat mehr Raum und Bedeutung gegeben als bisher, ihre spezifischen Probleme und Moglichkeiten werden ausgelotet und ernst genommen. Dies birgt ein enormes Entwicklungspotential, das allerdings Geduld und vor all em gute strukturelle Rahmenbedingungen benotigt. So kann eine spiirbare Qualitatssteigerung mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts gelingen, es ware Osterreich zu wiinschen.
Literatur Altrichter, H. und Posch, P.: Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einfiihrung in die Akti
onsforschung, Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1998. BLK (Hrsg.): Gutachten zur Vorbereitung des Programms "Steigerung der Effizienz des
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts", in: Materialien zur Bildungsp1anung und ForschungsfOrderung, Heft 60, Bonn 1997.
Katja Lengnink TU Darmstadt Fachbereich Mathematik Arbeitsgruppe F achdidaktik Schlossgartenstr.7 64289 Darmstadt Email: [email protected]