JACC | 21. November 2013 | Nahostkorrespondent Johannes Gerloff | Naher Osten im Umbruch
-
Upload
cdu-fraktion-des-saechsischen-landtages -
Category
Documents
-
view
219 -
download
2
description
Transcript of JACC | 21. November 2013 | Nahostkorrespondent Johannes Gerloff | Naher Osten im Umbruch

20. November 2013
Im Rahmen der Vortragsreihe „Forum Frauenkirche“
Schriftenreihe zu Grundlagen, Zielen und Ergebnissen der parlamentarischen
Arbeit der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages
Naher Osten im Umbruch – Israel und die arabische Welt

cdu-fraktion-sachsen.de
twitter.com/CDU_SLT
facebook.com/cdulandtagsfraktionsachsen

1
Inhaltsverzeichnis
EinführungSteffen Flath MdLVorsitzender der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages
BegrüßungSebastian FeydtPfarrer der Frauenkirche
„Naher Osten im Umbruch – Israel und die arabische Welt“Johannes Gerloff Nahostkorrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP e.V. und der Nachrichtenagentur www.israelnetz.com
4 – 6
2 – 3
7 – 21
SchlusswortDr. Fritz HähleEhrenpräsident des Johann-Amos-Comenius-Clubs Sachsen
22 – 24 cdu-fraktion-sachsen.de
twitter.com/CDU_SLT
facebook.com/cdulandtagsfraktionsachsen

2
Sebastian Feydt
Begrüßung
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist Buß- und Bettag, Feiertag im Freistaat Sachsen und der Johann-Amos-Comenius-Club ist zu Gast in der Dresdner Frauen-kirche. Und in welcher Größenordnung! Wir haben eben überlegt, ob das heute ein Rekordbesuch ist.
Ich grüße Sie alle herzlich. Als Gäste und
Freunde des Clubs, als Bürgerinnen und
Bürger dieser Stadt, auch als Gäste in
Dresden. Ich grüße Sie als Verantwor-
tungsträger in der Kommunalpolitik, in
der Landes-, Bundes- und Europapolitik.
Diese Zusammenarbeit, die der Johann-
Amos-Comenius-Club jährlich am Buß-
und Bettag mit der Stiftung Frauenkir-
che Dresden und insbesondere mit dem
Forum Frauenkirche, der Vortrags- und
Gesprächsreihe, hier in dieser Kirche ein-
geht, verdanken wir einer guten Tradition.
Über viele Jahre ist das so und das gibt mir
Anlass, Ihnen, lieber Herr Flath, für diese
Kooperation herzlich Dank zu sagen.
Die biblische Botschaft am Buß- und
Bettag bestimmt in unseren Kirchen ein
Gleichnis, das der Evangelist Lukas er-
zählt. Da hat einer einen Feigenbaum in
seinem Weinberg und er kommt um zu
schauen, ob dieser Baum Frucht trägt.
Und er spricht zu seinem Weingärtner:
„Ich komme nun seit drei Jahren und die-
ser Baum trägt keine Frucht. Hau ihn ab!“
Und der Weingärtner spricht: „Herr, lass
noch dieses eine Jahr vergehen, bis ich
ihn umgegraben und gedüngt habe. Viel-
leicht bringt er doch Frucht. Wenn aber
nicht, hau ich ihn ab!“
Was trägt dieses berühmte biblische
Wort am Buß- und Bettag zu unserem
heutigen Thema bei: „Naher Osten im
Umbruch“? Ist die Axt schon angelegt
an den Baum des Friedens, der im Na-
hen Osten wachsen soll? Das Alte Testa-
ment, das erste Testament offenbart uns
den Feigenbaum als ein Zeichen des Frie-
dens und des Wohlstands. Vielleicht ha-
ben Sie diesen Baum vor Augen.
Ist nun die Axt nur angelegt oder ist der
Baum umgehauen, weil nicht über drei
Jahre, nicht über fünf oder zehn Jahre,
sondern jahrzehntelang keine Früchte
des Friedens zu sehen sind? Oder gibt es
doch das Wort von der Hoffnung? Viel-
leicht noch ein Jahr. Noch ein Versuch.
Innehalten. Zurücktreten. Umgraben.
Das Unterste zuoberst drehen, düngen,
um einige wenige Früchte des Friedens
zu sehen.
Gibt es dieses Wort der Hoffnung „viel-
leicht“. Ein Wort, das allen, die im Nahen
Osten leben, eine Perspektive auf ein Le-

3
ben in Wohlstand, Sicherheit und Frieden
offenbart. Allen: Israelis wie Palästinen-
sern, Muslimen, Christen, Juden und vie-
len anderen Denominationen.
Um Antwort auf diese Frage ist heute Jo-
hannes Gerloff gebeten, den ich herzlich
begrüße. Sie sprechen als Nahostkorres-
pondent des Christlichen Medienverbun-
des KEPV e. V. Herr Gerloff, Sie sind un-
ter die Kuppel der Dresdner Frauenkirche
gekommen. Diese Kirche prägt mit ih-
rer Botschaft des Friedens. Und Sie prä-
gen heute Nachmittag diesen Raum mit
Ihren Ausführungen, vielleicht mit Ih-
ren Antworten auf Fragen, die ich in den
Raum gestellt habe. Neben Ihnen sitzt
Herr Flath und ihm ist es jetzt anheimge-
stellt, Sie vorzustellen und einzuführen.
Herr Flath, Sie haben das Wort.

4
Steffen Flath MdL
Einführung
Lieber Herr Pfarrer Sebastian Feydt, ich danke Ihnen für die freundliche Begrüßung und die Gastfreundschaft hier in der wun-derbaren Frauenkirche. Seit Jahren pflegen wir eine Kooperation zum Buß- und Bettag zwischen der Stiftung Frauenkirche und der CDU-Landtagsfraktion. Und ich möch-te Ihnen sagen, ich empfinde das nicht als Selbstverständlichkeit. Vielen Dank für das gute Miteinander.
Ich begrüße Sie alle, meine Damen und
Herren, zur Veranstaltung des Johann-
Amos-Comenius-Clubs Sachsen. Lieber
Dr. Fritz Hähle, du hast diese beispiellose
Veranstaltungsreihe in den 90er Jahren
des letzten Jahrhunderts begonnen. Und
dass wir heute die bereits 71. Veranstal-
tung durchführen, spricht für sich. Dass
Sie alle gekommen sind, dafür danke ich
Ihnen sehr.
Ich begrüße Sie als Vorsitzender der CDU-
Landtagsfraktion natürlich stellvertretend
für die Mitglieder. Ich freue mich, dass
Uta Windisch, meine Stellvertreterin und
Schatzmeisterin der Fraktion, hier ist und
ebenso Aline Fiedler, Thomas Colditz, Ger-
not Krasselt und Gert Mackenroth Platz
genommen haben. Wie so oft bei Veran-
staltungen des Comenius-Clubs sind auch
viele ehemalige Abgeordnete und Minis-
ter wie Dr. Hans Geisler, Dr. Rolf Jähnichen
oder die Staatssekretäre Dr. Nees, Dr. Jork,
Dr. Münch und Dr. Reinfried anwesend.
Ebenfalls begrüße ich die Herren Bürger-
meister Kunze, Dr. Laub, Michaelis, Oer-
tel und Pallas und den Altlandrat Wilfried
Oettel. Die Treue halten uns auch in die-
sem Jahr viele Vertreter der Kirchen, ob
im Amt oder im Ruhestand, auch das ist
für uns ein großartiges Zeichen der Ver-
bundenheit. Und unter Ihnen, meine Da-
men und Herren, sind viele Präsidenten
von Verbänden, Vorsitzende von Gewerk-
schaften, Aufsichtsratsvorsitzende, Ge-
schäftsführer von Unternehmen sowie
Direktoren verschiedener Institutionen.
Alle, Herr Pfarrer Feydt hat uns schon
darauf hingewiesen, alle in Deutsch-
land, außer uns Sachsen, müssen heute
arbeiten. Wir haben Feiertag, den Buß-
und Bettag 2013. Buße und beten gehö-
ren zum christlichen Leben. Aber wo-
für? Nun, beten zum Beispiel könnten
wir, dass wir nach den Wahlen im Sep-
tember nun hoffentlich bald eine Regie-
rung in Berlin bekommen. Unser Minis-
terpräsident Stanislaw Tillich – ich darf
Sie herzlich grüßen – arbeitet auch heute
in Berlin am Koalitionsvertrag mit. Er un-
terstützt dabei Angela Merkel, die hof-
fentlich bald wieder zur Bundeskanzle-
rin gewählt werden kann.

5
Beten zum Beispiel für Asylsuchende, da-
mit sie in Deutschland unter uns keine
Angst haben oder im Mittelmeer ertrin-
ken müssen. Beten aber auch für die, die
zum Beispiel neben der Landesaufnah-
mestelle für Asylsuchende in Chemnitz
wohnen. Oder beten für die Polizisten,
die dort manchmal nachts um sich schla-
gende Tschetschenen und Nordafrikaner
bändigen und wieder trennen müssen.
Vergessen wir nicht, auch diese Polizis-
ten haben Angst. Beten zum Beispiel für
syrische Flüchtlinge oder verfolgte Chris-
ten in vielen Ländern dieser Welt.
Und Buße wäre, einmal darüber nach-
zudenken, ob wir nicht etwas zu viel für
uns selbst beanspruchen. Oder aber, ob
wir nicht oft zu schnell und zu oft auch
ungerecht über andere urteilen.
Und spätestens jetzt, meine Damen und
Herren, sind unsere Gedanken in Israel
angekommen. Begleitet von Wolfgang
Baake, dem Geschäftsführer des Christ-
lichen Medienverbundes, begrüßen Sie
mit mir den Journalisten Johannes Ger-
loff, der heute Morgen von Jerusalem
hierher geflogen ist. Mir fällt ein Stein
vom Herzen, dass er gut angekommen
ist. Herzlich Willkommen im Johann-
Amos-Comenius-Club.
Johannes Gerloff ist Journalist und Theo-
loge, er ist verheiratet und hat mit seiner
Frau fünf Kinder. Seit fast 20 Jahren lebt
© L
ight
spri
ng /
shu
tter
stoc
k.co
m

6
er in Jerusalem und vor sechs Jahren ha-
ben wir uns kennengelernt. Fritz Hähle
war es, der mich damals mit nach Israel
genommen hat. Ich war Kultusminister
und in Yad Vashem habe ich für Sach-
sen einen Vertrag unterzeichnet. Wir
waren in einer Schule direkt am Gaza-
streifen und wir besuchten einen Ausch-
witz-Überlebenden in seinem Haus im
Siedlungsgebiet.
Gespannt lauschte ich damals den Be-
richten und Einschätzungen von Johan-
nes Gerloff und ich hatte mir gedacht,
das könnte viele hier in Sachsen interes-
sieren. Und so habe ich versprochen, ihn
nach Sachsen zum Vortrag einzuladen.
Schließlich ist es Uta Windisch zu verdan-
ken, die sehr dazu beigetragen hat, dass
es tatsächlich gelungen ist, nach sechs
Jahren ein Versprechen heute hier einzu-
lösen. Ich hoffe, wir alle verstehen nach
diesem Vortrag von Johannes Gerloff die
Menschen in Israel besser und sind et-
was vorsichtiger, wenn wir hier aus dem
warmen Wohnzimmer vorm Fernseher
sitzend, so manchmal urteilen. Ich freue
mich jetzt auf den Vortrag, lieber Johan-
nes Gerloff, Sie haben das Wort.

7
Sehr verehrte Damen und Herren,
seit nunmehr einigen Jahren sind wir
Zeitzeugen eines Umbruchs in Nordaf-
rika und dem Nahen Osten, der die Ge-
sellschafts- und Staatenordnung um-
stürzt, die nach dem Ersten Weltkrieg
entstanden ist. Wohin der so genannte
„Arabische Frühling“ führen wird, weiß
heute niemand. Allerdings können wir
jetzt schon sagen: Der Orient, wie wir ihn
bis vor zehn Jahren gekannt haben, wird
nie mehr derselbe sein.
Unvorstellbare Grausamkeiten haben
Wunden in Gesellschaften und Men-
schenleben gerissen. Hunderttausende
von Menschen wurden getötet. Das al-
les wird Generationen brauchen, um zu
heilen. Und im Moment sind wir noch
gar nicht an einem Punkt angelangt, an
dem wir von Wiederherstellung oder gar
Heilung reden könnten. Der Brand des
wunderschönen Basars von Aleppo in
Nordsyrien ist mir persönlich ein Sym-
bol dafür, dass diese Revolution histo-
rische Schätze zerstört, die unersetzbar
sind. Uralte religiöse und kulturelle Ge-
meinschaften haben ihr Ende vor Augen.
Denken Sie nur daran, dass schon im
Neuen Testament (Apostelgeschichte 9)
„Naher Osten im Umbruch – Israel und die arabische Welt“Johannes Gerloff
eine christliche Gemeinde in Damaskus
erwähnt wird. Erstmals in der Geschichte
hat „die Straße“ in der arabischen Welt
Macht geschmeckt. Einfache Menschen
haben erkannt, dass sie sich ihre poli-
tische Ordnung nicht diktieren lassen
müssen. Allmächtig geglaubte Herr-
scher können gestürzt werden. Deshalb
ist der „Arabische Frühling“ nicht nur Re-
bellion oder Aufstand, sondern eine Re-
volution. Schon jetzt wurde unumkehrbar
Neues hervorgebracht. Ob das notwen-
digerweise besser ist, bleibt abzuwar-
ten. Dabei ist die Gesellschafts- und Re-
gierungsform, die wir als „Demokratie“
propagieren, in keinem arabischen Land
auch nur als entfernte Option am Hori-
zont erkennbar.
Wenn ich Ihnen heute einige Beobach-
tungen und Überlegungen aus meiner
Perspektive mitteile, ist Verzerrung und
Fehlurteil vorprogrammiert.
Ich arbeite und lebe mit meiner Fami-
lie in Israel. Der Vorteil des Standorts
Jerusalem liegt auf der Hand: Ich muss
nur die Haustür öffnen und sehe mich
Menschen gegenüber, die aus Tunesien,
Marokko, Libyen und Ägypten, aus Sy-
rien, dem Jemen, dem Irak und dem Iran
stammen; die sich dort auskennen, die

8
Landessprache sprechen und nicht sel-
ten mit Freunden und Verwandten in die-
sen Ländern regen Kontakt pflegen. Mit
der Gründung des Staates Israel wurden
Ende der 1940er Jahre nicht nur 700 000
bis 900 000 Araber zu Flüchtlingen, son-
dern auch eine Million arabischer Juden
gezielt aus ihrer Heimat vertrieben. Dass
die Länder der Arabischen Liga eine ge-
plante ethnische Säuberung ihrer jüdi-
schen Bürger im Sinn hatten, ist heute
durch Dokumente im Archiv der Verein-
ten Nationen belegt.1
Wie eng die Verbindungen zwischen den
Ländern des Nahen Ostens sind, zeigte
sich im August. Damals erfuhr die Familie
Waqed aus Nazareth, dass bei dem Che-
miewaffen-Massaker in einem Vorort von
Damaskus 21 ihrer Verwandten ermordet
wurden – darunter eine Mutter und ihre
sechs Kinder, sowie ein Ehepaar mitsamt
seinen vier Kindern. Über Verwandte in
Jordanien war die Nachricht nach Israel
gelangt. Beim selben Vorfall waren auch
elf Mitglieder der Familie Churani aus der
palästinensischen Stadt Dschenin ums
Leben gekommen. Die Opfer waren im
Alter von drei bis 75 Jahren.
Einerseits sind wir in Israel ganz nahe
dran am „Arabischen Frühling“. Gleich-
zeitig sind wir fast aber genauso weit da-
von entfernt wie Europa – oder, um es mit
den Worten eines Israelis zu sagen: „Wir
sind eine Villa im Dschungel.“ Die Ge-
fahr der Verzerrung und des Fehlurteils
kommen nun aus der Nähe Israels zum
Orient. Sie kommt aus unserer Nähe zu,
unserem Interesse für und unserer Kon-
zentration auf den jüdischen Staat und
dem eigenartigen Mythos, „der Nahost-
konflikt“ – also, der Konflikt zwischen
dem jüdischen Staat und seinen arabi-
schen Nachbarn oder gar Israels Schwie-
rigkeiten mit den Palästinensern, – sei
„orientalisch blumig“ gesagt „die Mut-
ter aller Konflikte“. Tatsache ist, dass die
Auseinandersetzung zwischen Israelis
und Arabern mit den aktuellen Umwäl-
zungen in der arabisch-islamischen Welt
überhaupt nichts zu tun hat. Daran än-
dert auch nicht, dass sich Juden und vor
allem Israelis selbst nur zu gerne für den
Nabel der Welt halten, für alles verant-
wortlich zu sein meinen und alles ver-
bessern meinen zu können. Politisch ge-
sehen ist Israel im „Arabischen Frühling“
schlicht irrelevant. Aber selbstverständ-
lich hat der Arabische Frühling eine hohe
Relevanz für die Zukunft Israels. Deshalb
ist es durchaus berechtigt, sich das Ge-
schehen im Nahen Osten aus israelischer
Sicht und mit besonderem Fokus auf Is-
rael zu betrachten.
Der Iran
ist zwar kein arabisches Land, aber ei-
ner der einflussreichen Spieler auf der
1 Cf. z.B. “Jews Displaced from Arab Countries: A Story of Collusion”, http://www.justiceforjews.com/chrono_web.pdf (zuletzt eingesehen am 17.11.2013).

9
politischen Bühne des Nahen Ostens.
Mit der Wahl von Hassan Rouhani zum
7. Präsidenten der Islamischen Republik
Iran hat sich aus israelischer Sicht nichts
geändert. Der eigentliche Machthaber
im Land ist – wie schon zu Zeiten seines
Vorgängers Mahmud Ahmadinedschad –
der „Oberste Führer“ Ayatollah Ali Kha-
menei. Seit der Revolution im Jahre 1979
ist aus dem Iran mit unterschiedlichen
Formulierungen und in verschiedenen
Variationen immer wieder zu hören, das
„zionistische Gebilde“ müsse „von der
Landkarte verschwinden“. Wohlgemerkt,
soweit mir bekannt, hat bislang kein ira-
nischer Führer direkt gefordert, der Iran
müsse Israel vernichten. Es wird lediglich
prophezeit, Israel werde verschwinden.
Gleichzeitig deuten alle Indizien dar-
auf, dass der Iran nicht nur eine zivile
Nutzung der Atomkraft verfolgt, son-
dern ein waffenfähiges Programm auf-
zubauen sucht.
Und schließlich hat das Land in den ver-
gangenen Jahren Mittel entwickelt, die
es ihm ermöglichen, eine Atombombe
an einen effektiven Explosionsort zu be-
fördern – etwa durch sein weit reichen-
des Raketenprogramm.
In Israel ist sich jeder, der etwas vom Iran
versteht, darüber im Klaren, dass die Ira-
ner kein Volk von traditionellen Israel-
hassern sind. Im Gegenteil weiß man,
welche Rolle der Iran bei der Flucht und
Rettung der irakischen Juden Anfang der
1950er Jahre gespielt hat. Zur Zeit des
Schahs war Israel einer der engsten Part-
ner Persiens – und das war offensicht-
lich nicht nur eine „von oben“ verordnete
Freundschaft. Bis heute steht der Iran
nicht auf Israels Liste von Feindstaaten
und noch vor wenigen Jahren gerieten
Israelis in die Schlagzeilen, wenn sie auf
Iranreisen nachdrücklich zur Mitarbeit
für den iranischen Geheimdienst aufge-
fordert wurden und aus diesem Grunde
ihr Urlaub im Iran unfreiwillig verlängert
wurde. Zu den ursprünglichen Partnern
des iranischen Atomprogramms gehörte
neben Deutschland auch Israel. Viele Ira-
ner bewundern die Israelis und der tra-
ditionelle Hass zwischen Schiiten und
Sunniten, ebenso wie der Graben, der
Araber und Perser voneinander trennt,
verbunden mit dem alten Reflex „der
Feind meines Feindes ist mein Freund“,
spricht eher für eine tiefe iranisch-israe-
lische Verbundenheit. Nicht selten höre
ich von iranisch-stämmigen Israelis, wie
sehr sie sich in ihre alte Heimat und Kul-
tur zurücksehnen.
Aber der eigenartige Mix von Hege-
monialstreben, religiösen Ambitionen,
apokalyptischen Spekulationen, anti-is-
raelischer Martial-Rhetorik und einem
hochentwickelten Nuklearprogramm las-
sen der israelischen Regierung – ganz
unabhängig davon, wer sie nun stellt –

10
kaum Spielraum für intellektuelle Diffe-
renzierungen. Wir dürfen nicht verges-
sen: Raison d'être des Staates Israel ist
und bleibt, die Existenz des jüdischen
Volkes sicher zu stellen. Dabei ist für uns
Nichtjuden nur schwer nachvollziehbar,
dass das jüdische Volk bis heute verbal
immer wieder in seiner bloßen Existenz
in Frage gestellt wird. Für uns Mitteleu-
ropäer gab es (zumindest kollektiv) im-
mer nur eine politische oder ideologische
Bedrohung. Für Juden ist das etwas ganz
Anderes. Deshalb kann sich eine israeli-
sche Regierung mit nicht weniger begnü-
gen als mit dem absoluten Ausschließen
jeder Möglichkeit, dass die Islamische Re-
publik Iran eine Atombombe bekommt.
Dabei ist man sich in Jerusalem und Tel
Aviv durchaus darüber im Klaren, dass
sich ein nuklear bewaffneter Iran mit
militärischen Mitteln nicht verhindern,
höchstens verzögern lässt. Und man weiß
auch, dass ein einfacher Militärschlag ge-
gen das riesige Reich im Osten viel mehr
unerwünschte Nebenwirkungen – etwa
in der Stimmung der iranischen Bevöl-
kerung gegenüber Israel und im Blick auf
die eigene Mullahkratie – haben wird,
als dass er sich lohnen würde. Zudem er-
scheint gar nicht so sehr ein nuklear auf-
gerüsteter Iran aus israelischer Perspek-
tive das Problem, als vielmehr die Frage,
wie man damit umgehen kann, wenn nu-
kleares Material in die Hände von Ter-
rororganisationen gelangen sollte. Und
dann ist da das Gespenst eines unkon-
ventionellen Rüstungswettlaufs zwi-
schen der schiitischen Welt unter der
Führung des Iran und der arabischen,
mehrheitlich sunnitischen Welt. Man be-
denke: Eine mutmaßliche Atommacht Is-
rael war für sunnitische Staaten wie die
Türkei, Saudi Arabien oder Ägypten kein
Grund, über ein eigenes Atomwaffenpro-
gramm nachzudenken. Erst mit dem Auf-
stieg einer real vorstellbaren Atommacht
Iran hat sich das grundlegend geändert.
Heute denkt man in diesen Ländern laut
über die Notwendigkeit eigener Nukle-
arwaffenprogramme nach.
Zum „Arabischen Frühling“
möchte ich Ihnen einige Beobachtun-
gen und Anmerkungen weitergeben. Ei-
niges habe ich bereits angedeutet. Ein
zusammenhängendes Bild zu vermitteln
ist heute noch kaum möglich. Der An-
teil dessen, was wir nicht wissen, ist weit
höher als das, was wir wissen. Was wir
wissen, sind Einzel- oder Puzzleteile, die
eher widersprüchlich erscheinen, als ei-
nander erklären.
Der Arabische Frühling hat deutlich ver-
gegenwärtigt, dass der gesamte arabi-
sche Raum, vom Maghreb am Atlantik
im Westen bis ins Zweistromland, von
der Zentral-Sahara bis hinauf an die Kur-
dengebiete, ein zusammenhängender
Kulturraum ist. Was ein Mensch in Tu-

11
nesien twittert, geht die Menschen in
Syrien an. Wenn einer in Ägypten „face-
booked“, interessiert das im Jemen oder
auch in Marokko.
Gleichzeitig lässt sich kaum ein Land,
kaum eine Region in ihrem Wesen, in ih-
rer Zusammensetzung, in ihren Heraus-
forderungen und ihrer Entwicklung mit
einer anderen vergleichen. In Ägypten ist
es ein Militärregime, das mit der Muslim-
bruderschaft um die Vorherrschaft ringt.
In Libyen sind es drei große Stammes-
verbände, in Syrien eine Minderheiten-
koalition gegen die sunnitische Mehr-
heit. Am stabilsten erscheinen bislang
die Monarchien, die eine westliche Ori-
entierung mit einer religiösen Legitimie-
rung ihres Machtanspruchs verbinden.
So leiten etwa König Abdallah II. von Jor-
danien und König Mohammed VI. von
Marokko ihre Herkunft direkt vom Pro-
pheten Mohammed ab.
Spätestens mit dem Fall von Saddam
Hussein im April 2003 ist in der arabi-
schen Welt ein Machtvakuum entstan-
den. Die Menschen fragen: Wer vertritt
uns und unsere Interessen glaubhaft ge-
genüber der westlichen Welt? In die-
ses Machtvakuum hinein melden sich
Mächte mit uralten, teils aus der Antike
stammenden Machtansprüchen zu Wort:
Der Iran, die Türkei, Ägypten. Nicht we-
nige Verhaltensweisen und politische
Entscheidungen dieser Spieler im Na-
hen Osten lassen sich auf diesem Hin-
tergrund erklären. Dazu gehören etwa
die antizionistischen Hasstiraden in Te-
heran, aber auch der propagandistisch
motivierte türkische Hilfskonvoi, der
Ende Mai 2010 vor der Küste von Gaza
ein unrühmliches Ende fand. Die Kehrt-
wende in der Politik der Türkei, die jahr-
zehntelang der engste Partner Israels im
Nahen Osten war, ist auf diesem Hinter-
grund zu verstehen. Nachdem die „euro-
päische Option“ für die Türken in immer
weitere Ferne zu rücken scheint, orien-
tiert man sich neu in Richtung islami-
sche Welt, erinnert sich daran, wer bis
1917 vierhundert Jahre lang den Nahen
Osten beherrscht hat – und meldet die-
sen alten Herrschaftsanspruch neu an.
Die Politik des Westens – vor allem Ame-
rikas – hat in den vergangenen Jahren zu
einem spürbaren Glaubwürdigkeits- und
Vertrauensverlust geführt. Die Rede von
Präsident Obama Anfang Juni 2009 an
der Al-Azhar-Universität in Kairo wurde
von nicht wenigen als Annäherung der
Amerikaner an die Muslimbruderschaft
empfunden. Als die Amerikaner im Fe-
bruar 2011 ihren treuen Verbündeten
von drei Jahrzehnten innerhalb weniger
Tage fallen ließen, war jedem Menschen
in der Arabischen Welt – ganz gleich wel-
cher politischen oder religiösen Couleur
– klar: Auf den Westen ist kein Verlass.
Wenn es deren Interessen dient, lassen
sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel.

12
De facto gilt die Unterstützung des von
Amerika angeführten Westens im Na-
hen Osten heute den Gruppierungen,
die wir als „Muslimbruderschaft“, „Salafi-
ten“ und „Al-Qaida“ kennen – auch wenn
es nicht offiziell ausgesprochen ist. Dass
dies nicht erklärten westlichen Absich-
ten entspricht, ist allen Beteiligten klar
– trägt aber wenig dazu bei, die Glaub-
würdigkeit des Westens zu rehabilitie-
ren. Interessant in diesem Zusammen-
hang ist die Politik Russlands, das wieder
ganz neu im Nahen Osten Fuß zu fassen
sucht. Auch die Chinesen sind auf stille
Weise, meist hinter den Kulissen, aber
zielstrebig dabei, ihren Einflussbereich
auszuweiten.
Israel schottet sich zunächst einmal ab,
baut Grenzanlagen auf den Golanhöhen
und im Sinai aus und lässt die Akteure,
wenn es zu Berührungen kommt, wis-
sen, dass mit dem jüdischen Staat nicht
zu spaßen ist. Aber die Schotten dicht
machen, ist auf die Dauer nicht möglich.
Israel muss mit seinen Nachbarn leben.
Deshalb müht man sich, zu verstehen,
wer in den Nachbarländern gegen wen
steht, wer welche Absichten hat und wel-
che Ziele verfolgt.
In Syrien etwa kommen uralte Stammes-
fehden und Religionskonflikte neu zur
Geltung. In Israel rätseln Akademiker
und Militärs, wer da gegeneinander zu
Gange ist, und suchen nach Definitio-
nen: Sunniten gegen Schiiten, Säkulare
gegen Religiöse, Konservative gegen Ex-
tremisten. Die Liste ließe sich fortführen.
Gegen das Assad-Regime und seine Ver-
bündeten (Iran, die libanesische Hisbol-
lah) kämpft ein unüberschaubares Heer
von Milizen und Dschihadisten aus aller
Welt. Ein Forscher am Interdisziplinären
Institut in Herzlia hat aufgrund von Bil-
dern aus dem Internet Kämpfer aus 83
Ländern identifiziert, darunter etwa eine
Gruppe von 50 Finnen. Auf die Frage,
was diese Leute verbindet und warum
sie sich ausgerechnet Syrien als Kriegs-
schauplatz ausgesucht haben – warum
sie nicht etwa früher im Irak oder auf der
südlichen Arabischen Halbinsel oder in
Somalia in ähnlicher Weise zu Hauf ge-
kommen sind – erhält man gruselige, re-
ligiös-ideologische Antworten. Einer der
Forscher hat herausgefunden, dass sie
die Wiederkunft von Jesus Christus er-
warten; dass er alle wahrhaft Gläubigen
in Syrien sammeln werde, um sie dann
gegen den endzeitlichen Antichristen
und sein jüdisches Heer in die Schlacht
zu führen. Ich erspare Ihnen weitere Ein-
zelheiten.
Die Auswirkungen des Arabischen Früh-
lings auf Israel sind vielfältig. Viele Isra-
elis sind froh, dass es zu dem Frieden mit
Syrien, den etwa der ehemalige Minis-
terpräsident Jitzchak Rabin angestrebt
hat, nie gekommen ist. Sonst stünden die
Dschihadisten heute am Ufer des See Ge-

13
nezareth. Arabische Christen in Israel ma-
chen sich Gedanken über ihre Zukunft.
Sie treten – wie in den vergangenen Mo-
naten geschehen – an die Öffentlichkeit
mit der Forderung, zur Wehrpflicht in die
israelische Armee einbezogen zu wer-
den. Pater Gabriel Naddaf aus der Nähe
von Nazareth scheut sich nicht, vor der
Presse zu verkünden: „Wenn wir heute
nicht Schulter an Schulter mit den Juden
Dienst an der Waffe tun, wird es uns in
fünfzig Jahren nicht mehr geben.“
Natürlich bleiben von alledem auch
die israelisch-palästinensischen Beziehungen nicht unberührt.
Die aktuellen Friedensverhandlungen fin-
den hinter verschlossenen Türen statt.
In der Öffentlichkeit kann niemand et-
was zum tatsächlichen Stand der Dinge
sagen.
Aber die Parameter für eine Einigung zwi-
schen Israelis und Palästinensern sind
spätestens seit dem Clinton-Plan vom
Sommer 2000 klar. Es geht
1. um einen Palästinenserstaat auf
ca. 94-96% der Westbank
2. in den „Grenzen von 1967“ – das
heißt, korrekterweise muss man
sagen, den „Waffenstillstandslinien
von 1949“.
3. Die großen Siedlungsblöcke bleiben
bei Israel.
4. Im Austausch dafür bekommen die
Palästinenser von Israel entspre-
chende Gebiete, die an die Palästi-
nensergebiete grenzen.
5. palästinensische Flüchtlinge dürfen
nur in den Palästinenserstaat zu-
rückkehren,
6. der demilitarisiert sein wird.
Unklar ist nach wie vor die Zukunft des
Gazastreifens und Ostjerusalems.
Wenn man heute durch die Palästinen-
sische Autonomie fährt, fällt der Bau-
boom auf. Dabei werden nicht nur Sozial-
wohnungen gebaut – schon gar nicht für
rückkehrwillige Flüchtlinge – sondern Lu-
xusappartements und Paläste, die ihres-
gleichen im benachbarten Israel suchen.
Die Städte Palästinas blühen. Die Super-
märkte sind gefüllt. Palästinenser reisen
in der ganzen Welt herum. Manch einer
fragt sich: Was ist eigentlich so schlecht
am Status quo? Das ist keine Rechtfer-
tigung von Missständen, aber es geht
heute einem Durchschnittspalästinen-
ser im Nahen Osten nirgends so gut, wie
unter israelischer Besatzung.

14
Was verhindert ein Abkommen zwischen Israel und den Palästi-nensern? Da ist zunächst – und das ist vielleicht
der entscheidendste Punkt! – die Stim-
mung in der Bevölkerung. Sowohl auf is-
raelischer, wie auch auf palästinensischer
Seite sehen sich die Unterhändler vor der
schier unüberwindbaren Herausforde-
rung, wie sie ihrem jeweiligen Elektorat
verkaufen sollen, was sie ausgehandelt
haben. Von Meinungsforschern habe ich
vor einiger Zeit gehört: Die gemäßigts-
ten Palästinenser und die liberalsten Isra-
elis haben praktisch keine deckungsglei-
chen Bereiche in ihren Meinungen über
die politische Zukunft – und beide haben
keinerlei Chance einen nennenswerten
Rückhalt in ihrer jeweiligen Bevölkerung
zu bekommen. Ein israelischer Professor,
der in Talkshows in Deutschland gerne
zu Rate gezogen wird, meinte vor eini-
ger Zeit in einem privaten Gespräch: „Die
Leute, die mich unterstützen, haben be-
quem in einer Telefonzelle Platz.“ Im Ja-
nuar 2011 veröffentlichte der arabische
Nachrichtensender Al-Dschasira die so-
genannten „PaliLeaks“ – in Anlehnung an
„Wikileaks“:2 1.684 als „vertraulich“ einge-
stufte Dokumente aus den vorhergegan-
genen elf Jahren israelisch-palästinensi-
scher Verhandlungen. Das Ergebnis war,
dass Chefunterhändler Saeb Erekat um
sein Leben fürchten musste. Schleunigst
suchte man zu dementieren, was Schwarz
auf Weiß geschrieben stand. Die Palästi-
nensische Autonomiebehörde bemühte
sich die Dokumente als Fälschungen dar-
zustellen. Ein christlicher Palästinenser in
Bethlehem vertraute mir bereits vor eini-
gen Jahren an: „Abu Mazen – wie der pa-
lästinensische Präsident Mahmud Abbas
im Volk genannt wird – muss sich ent-
scheiden zwischen Gesprächen mit Israel
und der Popularität im eigenen Volk. Bei-
des zusammen geht nicht.“
Für Israelis sind die Rückzugserfahrun-
gen, im Jahr 2000 aus dem Südlibanon
und 2005 aus dem Gazastreifen, wenig
ermutigend im Blick auf einen Friedens-
prozess, für nicht wenige gar traumatisch.
„Land für Frieden“ hat noch nie in der Ge-
schichte funktioniert. In Israel weiß heute
jedes Kind, dass man für Land nur Raketen
und Radikalisierung und neue Bedrohun-
gen bekommt – nicht aber Frieden.
Ein weiterer Grund für das Scheitern ei-
ner politischen Einigung sind vollkom-
men überzogene und unrealistische Er-
wartungen – in ganz unterschiedlichen
Bereichen – die von westlichen Politikern
und Journalisten auch ständig am Leben
erhalten und geschürt werden.
Um Beispiele zu nennen: Ein „Staat Paläs-
tina“ wird niemals „gleichberechtigt sou-
verän“ neben Israel stehen, solange in der
UNO auch nur ein Staat prophezeit, der
2 Todd Warnick, “Palileaks Gone Wild” (MONDAY, JANUARY 24, 2011): http://www.jerusalemcentral.com/2011/01/palileaks-gone-wild.html (14.10.2013).

15
„Schandfleck Israel [müsse] von der Land-
karte verschwinden“. Die Palästinenser
werden niemals gleichberechtigt mit Is-
rael eine Panzerarmee, eine Luftwaffe, U-
Boot-Marine haben, oder militärisch mit
ihren iranischen Freunden auf eigenem
Territorium zusammenarbeiten können,
wie das die Israelis etwa mit ihren ame-
rikanischen Freunden tun. Palästina wird
niemals existieren können als gäbe es kein
Israel sowie auch der jüdische Staat Israel
niemals ohne die umliegenden arabischen
Völker existieren wird.
Ähnliches gilt für die Frage der israeli-
schen Siedlungen auf den umstrittenen
Gebieten. Der Politikwissenschaftler Pro-
fessor Schlomo Avineri war unter Jitzchak
Rabin Generaldirektor des Außenministe-
riums. Er selbst ist davon überzeugt, dass
jedes jüdische Haus auf Gebiet, das vor
1967 jordanisch war, eine politische Ver-
fehlung ist. Trotzdem ist er der Ansicht,
dass die von manchen westlichen Politi-
kern geforderte Räumung aller Siedlun-
gen politisch schlicht nicht durchsetzbar
wäre. Avineri meint, dass auch eine Dikta-
tur keine fünf bis zehn Prozent ihrer Be-
völkerung umsiedeln könnte – es sei denn
nach einem total verlorenen Krieg.
Ein weiteres entscheidendes Problem für
die Zweistaatenlösung ist, dass die Paläs-
tinenser vielfach selbst gar keinen Staat
wollen. Vor einem halben Jahrzehnt habe
ich diese Behauptung noch aufgestellt,
um meine Gesprächspartner zu provozie-
ren und eine Diskussion in Gang zu set-
zen. Mittlerweile ist mir klar, dass es mehr
als eine provokante Behauptung ist. Im
Januar 2006 hat mir der Hamas-Scheich
Nayef Radschub aus Dura in den südlichen
Hebronbergen erklärt, dass ein National-
staat „unislamisch“ sei, eine europäische
Erfindung und – soweit im Nahen Osten
vorhanden – ein kolonialistisches Diktat.
Tatsächlich werden die Gesinnungsge-
nossen von Scheich Radschub heute im-
mer wortgewaltiger und sind politisch
wie militärisch nicht mehr einfach als ir-
relevant abzutun. Aber auch aus christ-
lichen Kreisen unter den Palästinensern
wird die Zweistaatenlösung nicht wirklich
bejubelt. In Kairos-Palästina-Dokument,
das in bestimmten Kreisen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland viel Beach-
tung fand, findet man keinen Hinweis auf
„zwei Staaten für zwei Völker“. Der evan-
gelikale Baptistenpastor und Mitbegrün-
der des Bethlehem Bible College, Alex
Awad, schreibt in einer grundsätzlichen
theologischen Positionierung im Septem-
ber 2011: „Der Verfasser würde eine Ein-
Staaten-Lösung vorziehen, weil sie seiner
Meinung nach die demokratischste und
gerechteste Lösung wäre. Ihm ist jedoch
klar, dass diese Lösung nicht zu erreichen
ist, weil sie von der Mehrheit der Israelis
abgelehnt wird. Es bleibt also nur die Zwei-
Staaten-Lösung, Israel und Palästina.“3
3 Alex Awad, Studienleiter des Bethlehem Bible College, im September 2011 in der Ausarbeitung „Grundsätzliche theologische Positionen Bethlehem Bible College (BBC)“.

16
Oder, um ein letztes Beispiel zu erwähnen:
In einem vom Christlichen Medienver-
bund KEP herausgegebenen „Israelreport“
aus dem vergangenen Jahr beantwortet
der in Deutschland lebende „palästinen-
sische Israeli“ Ahmad Mansour die Frage,
was denn geschehen müsse, damit es
zu einem umfassenden Frieden kommt:
„Auf palästinensischer Seite brauchen wir
Kräfte…, die einen palästinensischen Staat
wollen und Israel akzeptieren.“
Ganz bestimmt hilfreich für den politi-
schen Prozess zwischen Israel und den
Palästinensern wäre, wenn westliche Ak-
teure (Politiker, Journalisten, Mitarbeiter
von NGOs) mehr Bezug zur Realität des
Nahen Ostens, zu seiner Geschichte und
den aktuellen Entwicklungen hätten. Mit
„mehr Realitätsbezug“ meine ich nicht,
dass wir alles gut heißen sollen, was wir
im Nahen Osten sehen. Aber wir soll-
ten die Realität dort, das heißt, histori-
sche Entwicklungen, Mentalitäten und
Denkweisen sehen, zu verstehen suchen
und ernst nehmen. Ob uns das gefällt
oder nicht: Religion spielt im Nahen Os-
ten eine andere Rolle, als in Europa – das
säkulare Europa ist auf dem Rückzug und
wird mehr und mehr zum Ghetto.
Wenn wir im Nahen Osten ernst genom-
men werden wollen, müssen wir uns ent-
scheiden, zwischen unseren westlich-
christlichen Werten und der Äquidistanz
zu den Parteien in diesem Konflikt. Da-
bei steht unsere Glaubwürdigkeit auf dem
Spiel! Wir müssen Unterschiede zwischen
den Aussagen der Bibel und des Koran
wahrnehmen und es wagen, diese beim
Namen zu nennen. Wenn ein Muslim fried-
lich und wirklich gleichberechtigt Seite an
Seite mit einem selbstbestimmten Juden
leben will, muss er im Koran mehr umin-
terpretieren, „neu verstehen“ oder auch
ignorieren, als ein seiner Tradition ver-
pflichteter Christ in der Bibel. Es ist wich-
tig, dass wir die Einstellung des radika-
len Islams zum jüdischen Volk – etwa den
kaum verhohlenen Traum von einer künf-
tig judenreinen Welt – wahrnehmen. Die
Einstellung der islamischen Tradition zur
Wahrheit, zur Gewalt, zur Gleichberech-
tigung zwischen den Geschlechtern und
von Andersdenkenden, ist für einen gro-
ßen Teil der Menschheit prägend. Araber
und Muslime haben andere Werte und er-
warten vom Leben etwas anderes als wir.
Zu einem Realitätsbezug im Nahen Osten
gehört auch, dass wir die jüdischen Sied-
lungen sehen, als das, was sie tatsächlich
sind, keine Politik von oben diktiert a la
Stalin oder Hitler, sondern eine „Grass-
Roots-Bewegung“, die letztendlich so
stark geworden ist und so viel Rückhalt
im Volk bekommen hat, dass Politiker
sich dem Druck beugen mussten.
Im vergangenen Herbst hat Israels Bot-
schafter a.D. in Kanada, Alan Baker, einen
Brief an US-Außenminister John Kerry

17
verfasst. Mit Erlaubnis von Botschafter
Baker darf ich Ihnen daraus zitieren:
Alan Baker, Rechtsanwalt, Botschafter a.D.
The Hon. John Kerry, U.S. Secretary of State, The State Department, Washington D.C.
8. November 2013
Sehr geehrter Herr Außenminister Kerry,
nachdem ich in den vergangenen Wochen wiederholt gehört habe, wie sie „die israe-lischen Siedlungen“ als „nicht legitim“ [ille-gal] bezeichnet haben, möchte ich mit allem Respekt, aber unmissverständlich entgeg-nen: Sie irren sich und wurden schlecht bera-ten, sowohl im Blick auf die rechtliche Lage, wie auch faktisch.
In den „Abkommen von Oslo“ und insbe-sondere im „israelisch-palästinensischen In-terimabkommen“ (1995) ist „die Frage der Siedlungen“ einer der Gegenstände, die in den Endstatusverhandlungen ausgehandelt werden müssen. Für die Vereinigten Staa-ten hat Präsident Bill Clinton als Zeuge die-ses Abkommen unterzeichnet, gemeinsam mit führenden Vertretern der EU, Russlands, Ägyptens, Jordaniens und Norwegens.
Ihre Äußerungen sind nicht nur eine Vor-wegnahme dieses Verhandlungsgegen-
stands, sondern unterminieren dieses Ab-kommen, wie auch die Verhandlungen, die Sie so begeistert unterstützen.
Ihre Behauptung, israelische Siedlungen seien illegitim, kann von einem rechtlichen Standpunkt aus nicht bewiesen werden. Das so häufig zitierte Verbot eines Bevöl-kerungstransfers in besetzte Gebiete (Arti-kel 49 der 4. Genfer Konvention) war, laut der eigenen offiziellen Auslegung dieser Konvention durch das Internationale Ko-mitee des Roten Kreuzes, 1949 entworfen worden, um den Massentransfer von Bevöl-kerung durch die Nazis im Zweiten Welt-krieg zu verhindern. Sie war niemals für die israelische Siedlungstätigkeit gedacht. Anstrengungen in der internationalen Ge-meinschaft, diesen Artikel auf Israel anzu-wenden, entspringen eindeutig propagan-distischen Interessen, mit denen Sie und die USA sich jetzt identifizieren.
Formal kann diese Konvention nicht auf die umstrittenen Gebiete angewandt werden, weil sie niemals als Gebiete einer anderen, vorher dort präsenten, legitimen souverä-nen Macht besetzt wurden.
Diese Gebiete können nicht als „palästinen-sische Gebiete“ oder wie Sie selbst das häu-fig tun, als „Palästina“, bezeichnet werden. Eine so genannte Einheit existiert nicht und es ist Zweck der Endstatusverhandlungen durch ein Abkommen den Status der Ge-biete festzulegen, auf die Israel einen legiti-

18
men Anspruch hat, auf der Grundlage von internationalem und historischem Recht. Wie können Sie sich anmaßen, diese Ver-handlungen zu unterminieren?
In keinem der von Israel und den Palästi-nensern unterzeichneten Abkommen gibt es eine Verpflichtung, dass Israel die Sied-lungstätigkeit einstellt oder auch nur ein-friert. Das Gegenteil ist der Fall. Das oben erwähnte Interimabkommen von 1995 er-mächtigt beide Parteien in den Gebieten un-ter ihrer jeweiligen Kontrolle zu planen, in Zonen aufzuteilen und zu bauen.
Israels Siedlungspolitik nimmt weder den Ausgang der Verhandlungen vorweg, noch werden dadurch palästinensische Bürger von ihrem Privatbesitz vertrieben. Tatsäch-lich sieht sich Israel verpflichtet, die Sied-lungsfrage zu verhandeln, weshalb über-haupt kein Anlass Ihrerseits besteht, die Verhandlungsergebnisse vorwegzunehmen.
Indem sie die unbegründete Meinung wie-derholen, Israels Siedlungen seien illegitim, und wenn Sie Israel mit einer „dritten pa-lästinensischen Intifada“, internationaler Isolierung und Delegitimierung bedrohen, schließen Sie sich in der Tat dem palästi-nensischen Propagandanarrativ an, gießen Öl in’s Feuer und üben so unberechtigten Druck auf Israel aus. Dies gilt gleicherma-ßen für Ihre falsch eingeschätzten und un-realistischen zeitlichen Rahmensetzungen für die Verhandlungen.
Mit alledem positionieren Sie sich einseitig, kompromittieren ihre persönliche Glaub-würdigkeit und die der Vereinigten Staaten.
Um Ihre eigene Glaubwürdigkeit und die der Vereinigten Staaten wiederherzustellen, und um mit sauberen Händen an den Verhand-lungstisch kommen zu können, werden Sie hiermit respektvoll gebeten, öffentlich und förmlich ihre Stellungnahme im Blick auf die Illegitimität von Israels Siedlungen zu-rückzunehmen und ihren Druck auf Israel einzustellen.
Hochachtungsvoll,
Alan Baker, Rechtsanwalt, Botschafter a.D. ehemaliger Rechtsberater des israelischen Außenministeriums ehemaliger Botschafter Israels in Kanada
Alan Baker repräsentiert mit seinen Aus-
sagen in diesem Brief nicht etwa eine ex-
tremistische Randgruppe, sondern die
israelische Mitte und eine Mehrheit der
Bevölkerung.
Mein Anliegen mit diesem Zitat und die-
sen Ausführungen ist nicht, Siedlungsbe-
fürwortern oder Siedlungsgegnern eine
Stange zu brechen. Vielmehr wünsche
ich mir unsererseits mehr Sachkenntnis,
mehr Geschichtsbewusstsein, mehr Of-
fenheit, mehr Verständnis für die Kompli-
ziertheit der Sachlage und konstruktive,
kontroverse Diskussionen. Nur wenn wir

19
uns offen und kontrovers miteinander
auseinandersetzen, besteht die Chance,
dass neue Ideen entstehen und uns neue
Türen öffnen in einem Prozess, der so
festgefahren ist. Wer sich heute der Rea-
lität verschließt, sich nur Gesprächspart-
ner auswählt, die ihm nach dem Munde
reden, muss sich nicht wundern, wenn
er morgen „ent-täuscht“ wird. Ich weiß
nicht so recht ob ich mir das wünsche
und ich nicht lieber ein falscher Prophet
wäre: Aber spannend wird sein, wie sich
Europa und Deutschland mit einem is-
raelischen Ministerpräsidenten namens
Avigdor Lieberman arrangieren werden.
Zu mehr Realitätsbezug unsererseits ge-
hört auch, dass wir uns dem stellen, was
unsere Aktionen bewirken. Ich denke da
etwa an den von Christen vorangetriebe-
nen, von Kirchen propagierten und jetzt
auch von der EU vorbereiteten Boykott
von Produkten aus israelischen Siedlun-
gen. Dieser Boykott schadet – und das
kann schon jetzt sehen, wer offene Au-
gen hat – zu allererst
1. den Palästinensern,
2. den Schwächsten in der Gesell-
schaft und
3. den letzten Resten täglich gelebter
Koexistenz zwischen israelischen
Juden und palästinensischen
Arabern.
Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass
der westliche Boykott von Siedlungspro-
dukten heute schon dazu führt, dass sich
Palästinenser gezwungen sehen, ihr Land
an Juden zu verkaufen, nur um sich und
ihre Familien ernähren zu können. Und
das, während wenige Hundert Meter ent-
fernt von ihren eigenen Volksgenossen
protzige Paläste in die Landschaft ge-
klotzt werden.
Ich denke, es würde unserer Glaubwür-
digkeit und unserer Effizienz als beglei-
tende Gesprächspartner im politischen
Prozess zwischen Israelis und Palästinen-
sern entscheidend nutzen, wenn wir auf-
hörten, die Palästinenser als Unmündige
oder Menschen zweiter Klasse, als Ent-
wicklungsbedürftige zu behandeln.
Als Vater von fünf Kindern sehe ich die
Erziehung zur Eigenverantwortlichkeit
als einen ganz entscheidenden, wenn
nicht den entscheidenden Faktor auf
dem Weg zu einer erfolgreichen Lebens-
gestaltung.
Die Palästinenser wurden von der westli-
chen Welt zur Unmündigkeit verdammt.
Das zeigt sich daran, wie viel Geld sie be-
kommen, ohne Rechenschaft dafür able-
gen zu müssen; dass Entwicklungspro-
jekte zu 100% finanziert werden – ohne
die übliche Erwartung einer Selbstbetei-
ligung oder Eigenleistung; dass histori-

20
sche Fehlentscheidungen und Fehlent-
wicklungen unter den Teppich gekehrt
werden – oder gar die andere Seite, in
diesem Fall das jüdische Israel, dafür ver-
antwortlich gemacht wird. Ich denke da-
bei etwa an das Massaker, das die jüdi-
sche Gemeinde in Hebron im Jahr 1929
ausgelöscht hat; an alle Angriffskriege
der Araber – mit dem ausdrücklich for-
mulierten Ziel, Israel zu vernichten; an
alle kategorischen Nein zur Anerkennung
Israels, zu Verhandlungen und zu einem
Frieden mit Israel; Wer weiß heute noch,
dass der Ausgangspunkt für Oslo der ab-
solute Bankrott der PLO war – nachdem
Arafat sich im Golfkonflikt auf die Seite
von Saddam Hussein gegen Kuwait und
die Welt gestellt hatte? Arabisches Un-
recht an Juden muss genauso beim Na-
men genannt werden, wie jüdisches Un-
recht an Nichtjuden.
Ich wünsche mir mehr Mut bei unseren
Vertretern, in der Öffentlichkeit, unsere
Werte genauso selbstbewusst einzufor-
dern, wie das Juden und Muslime tun.
Vielleicht könnten wir noch lernen etwas
liebevoller mit Andersdenkenden und An-
dersmeinenden umzugehen. Wahrhaftig-
keit und Glaubwürdigkeit sind entschei-
dend. In der hebräischen Bibel kommt
immer wieder das Wortpaar „ “,
„Gnade oder Barmherzigkeit und Wahr-
heit“ vor. Nicht selten vergessen die Ver-
treter der Wahrheit die Barmherzigkeit.
Und leider geht politisch propagierte
„Gnade“ meist zu Lasten der Wahrheit.
Beide gehören untrennbar zusammen,
Gnade und Wahrheit, wenn unsere Ent-
scheidungen und Aktivitäten heute und
morgen gute Frucht bringen sollen.
Wir können nicht die Theologie der deut-
schen Christen ablehnen und die Theolo-
gie der palästinensischen Christen tole-
rieren oder gar propagieren. Wenn Jesus
Christus tatsächlich geborener Jude war,
dann hat Martin Luther das nicht nur
deutschen Lutheranern ins Stammbuch
geschrieben, sondern auch palästinensi-
schen Lutheranern.
Wir sollten unsere palästinensischen Ge-
schwister, wenn sie von ihrer Lage erzäh-
len, zur Wahrhaftigkeit anhalten. Für je-
den Konflikt (zwischen Völkern, Klassen,
Religionen, Ländern, Generationen und
Ehepartnern) gilt, dass der erste Schritt
in Richtung Versöhnung ist, den Ande-
ren in seiner Wahrnehmung als gleichbe-
rechtigten Partner und „Nächsten“ ken-
nen- und akzeptieren zu lernen. Es muss
angesprochen werden, dass Muslime,
die sich dafür entschieden haben, Jesus
Christus als ihren Herrn zu benennen und
nach den Maßstäben der Bibel zu leben,
heute in Bethlehem im Untergrund le-
ben müssen. Sie sagen mir: Wir werden
nicht von den Juden verfolgt; auch nicht
von den Muslimen, sondern von den tra-
ditionellen Christen. Die Unversöhnlich-
keit von arabischen Christen gegenüber

21
ihren muslimischen Mitbürgern muss an-
gesprochen werden.
Meiner Meinung nach liegt die Zukunft
von Israelis und Palästinensern nicht in
der Trennung, sondern im Zusammenle-
ben von Juden, Christen und Muslimen –
ganz unabhängig davon, wie dieses Zu-
sammenleben politisch geregelt wird.
Deshalb fände ich gut, wenn sich west-
liche Politiker heute darauf konzentrie-
ren würden die humanitären Bedingun-
gen der Menschen, die tatsächlich leiden,
zu verbessern: Es sollte darum gehen,
dass jeder in Würde seinen Lebensunter-
halt verdienen kann, inklusive einer me-
dizinischen Versorgung. Es geht um Bil-
dungsmöglichkeiten, Meinungsfreiheit,
Rechtssicherheit, Reisefreiheit…
Bitte, sehen Sie mir nach, dass ich als
ein Mensch, der im Nachkriegsdeutsch-
land aufgewachsen und erzogen wurde,
wenig Verständnis dafür habe, wenn je-
mand politisch-nationalistische Ambitio-
nen über das Wohl seiner Mitmenschen
stellt. Das Elend der palästinensischen
Flüchtlinge wurde von ihren arabischen
Brüdern viel zu lange für politische und
propagandistische Zwecke missbraucht.
Gerade als Deutsche dürfen wir den Ju-
denhass, den Antisemitismus und die da-
mit verbundene antiisraelische Hetze in
der arabischen Welt nicht länger überse-
hen. Wir sollten nicht einfach alle antise-
mitischen Märchen glauben, auch nicht
wenn sie von Christen verbreitet wer-
den. Der Antisemitismus frisst letztend-
lich und vor allem den Antisemiten, ge-
nauso wie Hass vor allem den zerstört,
der hasst. Das gilt übrigens für alle, die
am Nahostkonflikt beteiligt sind – und
damit meine ich auch diejenigen unter
uns, die sich auf der einen oder anderen
Seite engagieren. Hass zerstört zu aller-
erst denjenigen, der hasst.
Ich wünsche mir mehr Realitätssinn –
und dazu gehört vielleicht auch, dass wir
den Traum von einer Lösung aufgeben.
Wir werden das grundsätzliche Problem
dieser Welt nicht lösen, sondern höchs-
tens eindämmen können. Konflikte wer-
den zu unserem Leben gehören, solange
es dauert, solange es uns gibt. Vielleicht
sollten wir deshalb das so viel verachtete
Wort „Konfliktmanagement“ wieder auf-
werten – und von unseren Vorstellun-
gen von „Konfliktlösung“, die uns nur von
„Ent-täuschung“ zu „Ent-täuschung“ füh-
ren, Abschied nehmen.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit.

22
SchlusswortDr. Fritz Hähle
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich bedanke mich im Namen des Johann-
Amos-Comenius-Clubs Sachsen bei Jo-
hannes Gerloff für seinen eindrucks-
vollen, von eigenem Erleben geprägten
Vortrag. Für mich zeigt das Gehörte ein-
mal mehr, dass es vermessen wäre, aus
der Ferne gute Ratschläge zu erteilen.
Warum haben wir uns ein solch brisan-
tes außenpolitisches Thema gewählt?
Außenpolitik ist Bundes- und nicht Län-
dersache. Gleichwohl ist es wichtig, regi-
onale, kommunale und zwischenmensch-
liche Beziehungen zu pflegen, denn nur
so kann das Verständnis füreinander
wachsen und gedeihen.
Ich erinnere mich gern an die erste Is-
raelreise unserer Fraktion, 1994, gegen
Ende der ersten Legislaturperiode des
Sächsischen Landtags. Mit großer Er-
leichterung haben wir damals feststel-
len können, dass wir in Israel freundlich,
ja freundschaftlich empfangen und be-
gleitet wurden. Ich und andere bestimmt
auch, sind mit großer Beklemmung nach
Israel gekommen, weil die Last dessen,
was Deutsche den Juden während der
Naziherrschaft in grauenvoller Weise an-
getan hatten, wohl niemals ganz weichen
wird. Mir geht es jedenfalls so.
Dass das heutige, das demokratische
Deutschland, für das Existenzrecht Isra-
els eintritt, halte ich für eine verpflich-
tende Selbstverständlichkeit. Und die-
ses Existenzrecht soll aus unserer Sicht
nicht gegen andere gerichtet sein. An-
dere haben auch ein Existenzrecht, jeder
Mensch hat ein Existenzrecht und dabei
soll es bleiben.
Wir, die wir in der DDR leben mussten,
waren ja nicht beteiligt am beginnenden
Annäherungs- und Versöhnungsprozess.
Juden gab es bei uns sehr wenige. Die
Chemnitzer jüdische Gemeinde hatte
meines Wissens kaum mehr als zehn
Mitglieder. Reisen nach Israel waren den
meisten verwehrt. Insofern hatten wir
nicht nur einen gefühlten, sondern einen
tatsächlichen Nachholbedarf.
Sehr dankbar bin ich dafür, dass es kurze
Zeit nach dem politischen Umbruch und
dem demokratischen Neubeginn gelun-
gen ist, dass der Freistaat Sachsen von
Anfang an mithelfen konnte, den Frie-
densprozess im Nahen Osten zu unter-
stützen und gute Beziehungen zu Israel
aufzubauen.
Während unserer erwähnten Israelreise
war eine kleinere Gruppe zu Gast an der
Bar Ilan-Universität in RamatGan in der

23
Nähe von Tel Aviv. Im Ergebnis dieses
Besuchs wurde am 08. Februar 1995 das
Kuratorium der Fördervereine der Uni-
versität in der Dresdner Staatskanzlei
gegründet. Der Vorsitzende dieses Ku-
ratoriums war Ministerpräsident Prof.
Biedenkopf. Der Freistaat Sachsen und
die Stadt Dresden beteiligten sich an
der Finanzierung des “Josef-Burg-Lehr-
stuhls für Erziehung zur Ethik, Toleranz
und Frieden“ an der Bar-Ilan-Universität,
auf den am 12. Februar 1997 in Anwesen-
heit des sächsischen Ministerpräsidenten
Herr Prof. Yaakov Iram berufen wurde.
Prof. Iram war Gastredner des 12. Ge-
sprächsforums am 31. Oktober 1998 in der
Unterkirche der Frauenkirche. Da wurde
oberhalb noch gebaut. Das Thema hieß
damals "Toleranz, Koexistenz und die
Verantwortung vor Gott und den Men-
schen“.
In diesem Sinne hat sich seit 1990 viel
Gutes entwickelt. Ich denke an die Ein-
richtung des Simon-Dubnow-Instituts für
jüdische Geschichte und Kultur an der
Universität Leipzig mit seinem Direktor
Prof. Dan Diner.
In Chemnitz, Dresden und Leipzig gibt es
wachsende jüdische Gemeinden, neue Sy-
nagogen in Dresden und Chemnitz und das
Kultur- und Begegnungszentrum der Isra-
elitischen Religionsgemeinde in Leipzig.
Im Jahr 2008 durfte ich dabei sein, als der
damalige Kultusminister Steffen Flath in
Israel einen Vertrag über den Schüler-
und Lehreraustausch zwischen Israel und
Sachsen unterzeichnete. Steffen Flath ist
schon darauf eingegangen.
Das sind nur einige Beispiele dafür, wie
Vertrauen und gegenseitiges Verständ-
nis nach und nach wachsen.
Ich will schließen mit einem Zitat aus
dem Vortrag von Prof. Iram vom Refor-
mationstag 1998 in der Unterkirche der
Frauenkirche: „Der eine Gott, der Frie-
den im Himmel schafft, wird uns Frieden,
Schalom, bringen“.
Ich danke noch einmal Johannes Ger-
loff, ebenso Herrn Pfarrer Feydt und der
Stiftung Frauenkirche, Steffen Flath und
nicht zuletzt dem Frauenkirchenkantor
Herrn Matthias Grünert, von dem wir
zum Abschluss den letzten Satz aus dem
d-Moll-Concerto von Johann Sebastian
Bach hören werden.
Das nächste Gesprächsforum des Johann-
Amos-Comenius-Clubs Sachsen findet im
Frühjahr 2014 in Leipzig oder Chemnitz

24
statt. Die Vorbereitungen dazu sind noch
nicht ganz abgeschlossen. Sie erhalten
dazu rechtzeitig eine Einladung.
Und nun danke ich Ihnen, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, wie immer für
Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.
Kommen Sie gut nach Hause und blei-
ben Sie uns gewogen!
Vielen Dank!

Impressum
Zum Vertrauen in die Einhaltung von Recht und Gesetz zurückkehrenVeranstaltung am 20. November 2013
HerausgeberCDU-Fraktiondes Sächsischen Landtages
RedaktionJan Donhauser
Satz, Gestaltung und DruckZ&Z Agentur Dresden
Dresden, Mai 2014
Diese Broschüre wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlhelfern im Wahlkampf zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Den Parteien ist es gestattet, die Druck-schrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.


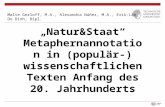
















![Schulcurriculum Deutsch - saksa.tln.edu.ee · [Tirana (Albanien), Sami-Frasheri-Gymnasium] vermutlich in naher Zukunft Auf einer regionalen Konferenz dieser Schulen im November 2016](https://static.fdokument.com/doc/165x107/6061e1be1adb591ec0451ff4/schulcurriculum-deutsch-saksatlneduee-tirana-albanien-sami-frasheri-gymnasium.jpg)
