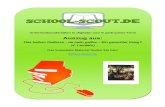FHoeV Bielefeld Ulrike Lucan 1 / 15 Willkommen Witamy welcome.
Krieg und Bürgerkrieg bei Lucan und in der griechischen Literatur (Studien zur Rezeption der...
Transcript of Krieg und Bürgerkrieg bei Lucan und in der griechischen Literatur (Studien zur Rezeption der...

6. Schluss
Krieg und Bürgerkrieg bilden die Quintessenz von Lucans Bellum civile. Diese zunächst gleichsam tautologisch wirkende Feststellung erhält da-durch ihre spezifische Bedeutung, dass das Thema des Bürgerkriegs sich nicht nur auf der Oberflächenebene des Inhalts manifestiert, sondern sich auf alle Wesensmerkmale des Epos erstreckt, von der komplexen narrati-ven Gestaltung von Szenen, der durch innere Widersprüche geprägten Cha-rakterisierung von Figuren und den prominenten Interventionen des Erzäh-lers bis hin zu den instabilen Raum- und Zeitstrukturen und der expres-siven sprachlich-stilistischen Form. Die Frage nach Lucans Darstellung des Bürgerkriegs erweist sich damit als zentrales heuristisches Instrument für die Interpretation des gesamten Epos.
Die vorliegende Studie hat sich auf die Dimension der Intertextualität im Bellum civile gerichtet und dabei besonders dessen bisher vernachläs-sigte Beziehungen zur griechischen Literatur in den Blick genommen. Ziel war aber nicht ein bloßer Nachweis, dass Lucan zentrale Werke der grie-chischen Dichtung gekannt und in seinem Epos verarbeitet habe. Vielmehr stand auch hier im Kontext der übergreifenden Fragestellung nach den Darstellungsmitteln und Darstellungsabsichten von Lucans Bürgerkriegs-epos die Funktion seiner Bezugnahmen auf die griechischen Prätexte im Vordergrund. Die Strategie seines Umgangs mit den griechischen Vorläu-fertexten erwies sich dabei als weitaus komplexer als das eindimensionale Modell einer polemischen Verkehrung, wie es oft in Definitionen von Lu-cans Verhältnis zu seinem römischen Vorgänger Vergil postuliert wird. In einem viel umfassenderen Sinn verwendet Lucan Bezugnahmen auf seine literarischen Vorgänger produktiv auf allen Ebenen zur Konstituierung seines Epos. Die gesamte Tradition wird mobilisiert, um dem eigenen Stoff zugleich Dichte und Vielfalt und eine historisch-mythische Tiefe zu geben.
Dabei könnte es beinahe scheinen, als habe Lucan die mythischen Stoffe und literarischen Gattungen ganz systematisch auf Exempla von Krieg und Bürgerkrieg hin abgesucht, um sie als Folie für seine Darstel-lung des römischen Bürgerkriegs einsetzen zu können. Das Spektrum reicht von urzeitlichen Schöpfungsmythen und Götterkriegen über die drei großen Mythenzyklen von den Kriegen um Theben und Troia und dem Zug der Argonauten bis zu den im engeren Sinne historischen Kriegen wie den Perserkriegen, den Feldzügen Alexanders des Großen oder den Punischen
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 5:58 PM

Schluss 398
Kriegen. Lucans Epos erscheint dadurch als Summe und Überbietung der gesamten vorangegangenen Literaturgeschichte im Zeichen von Krieg und Bürgerkrieg. Auch diese Überbietungsstrategie erschöpft sich jedoch kei-neswegs in einer hyperbolischen Rhetorik um ihrer selbst willen. Gerade dadurch, dass Lucan aus der literarischen Tradition bekannte Themen und Darstellungselemente in einem neuen Kontext wiederverwendet, kann er dem spezifischen Charakter seiner Bürgerkriegsdarstellung ein deutlicheres Profil verleihen.
Wie die hier vorgelegte Studie nicht das Verhältnis von Lucans Epos zu den historiographischen Quellen, sondern seine produktive Auseinan-dersetzung mit der Dichtungstradition und deren spezifischen Gestal-tungsmitteln betrachten wollte, so hat sich auch die Untersuchung von Lucans Umgang mit der griechischen Literatur in erster Linie auf die dich-terischen Gattungen konzentriert, obwohl punktuell auch Verbindungen etwa zu den Geschichtswerken des Herodot und des Thukydides aufgezeigt werden konnten. Dass dabei die mythischen Stoffe ins Zentrum rücken, ist einerseits Konsequenz dieser Bevorzugung der dichterischen Prätexte, andererseits aber auch ein für Lucans intertextuelles Verfahren charakteris-tisches Merkmal, zumal der griechische Mythos in Rom ja primär durch literarische und weitere Medien als Kulturgut vermittelt ist. Durch die Interpretation der Gleichnisse mit mythischem Inhalt und sonstiger Text-elemente im Bellum civile, die auf bestimmte Mythologeme Bezug neh-men, konnte nachgewiesen werden, dass der Mythos in Lucans histori-schem Epos anders als oft behauptet eine zentrale Rolle als eigenständiges Referenzsystem übernimmt, das eine zusätzliche Bedeutungsebene gene-riert. Darauf weisen auch die Erzählerkommentare im Umfeld der mythi-schen Exkurse hin, die in quasi alexandrinischer Manier in metaliterari-schen Reflexionen zur ‚fama‘ die zeitliche Distanz zum Mythos und dessen Status als literarische Fiktion thematisieren, was aber nicht eine Ablehnung und Entwertung, sondern ganz im Gegenteil eine gezielte Aneignung des Mythos impliziert. Die Einbruchstellen des Mythos und der (Vor)-Geschichte ins Bellum civile konstituieren gewissermaßen eine ‚mise en abyme‘, indem die mythischen Paradigmata Lucans literarische Gestaltung des Bürgerkriegs präfigurieren. Die mythisch-literarische Vergangenheit wird so zu einem Omen für die historische Gegenwart, die sich aber als weitaus grausamer und negativer als sie erweist.
Diese rezeptionslenkende Funktion mythischer Paradigmata findet ihre Ausprägung vor allem in der Geographie des Bellum civile, dessen Land-schaften zwar eine konkrete Rolle als Schauplätze der Bürgerkriegs-schlachten spielen, darüber hinaus aber auch eine symbolische Bedeutung als intertextuelle Erinnerungsspeicher annehmen. Die vom Blut mythischer Opfer von Krieg und Gewalt getränkte Erde lässt analog zu den Manen des
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 5:58 PM

Schluss 399
Marius und des Sulla im Prodigienkatalog des ersten Buches die Phantome mythischer Gestalten wie das verfeindete thebanische Brüderpaar Eteokles und Polyneikes, den von seiner Mutter Agaue zerrissenen Pentheus oder den von seiner Schwester Medea zerstückelten Apsyrtos aufsteigen, die auf die Bühne von Lucans Epos treten und gewissermaßen die Akteure des Bürgerkriegs infizieren. Diese Phänomene ausschließlich mit einer ‚manie-ristischen‘ Ästhetik erklären zu wollen, die Parallelen in den Tragödien von Lucans Onkel Seneca findet, würde zu kurz greifen. Vielmehr er-scheint der römische Bürgerkrieg im Bellum civile in prägnanter Weise als eine Re-Inszenierung mythischer Dramen.
Die im Bellum civile bevorzugt aufgegriffenen mythischen Paradigma-ta drehen sich denn auch nicht zufällig um Krieg und Gewalt innerhalb der Familie, Themen, welche insbesondere die für die Tragödie typischen Stof-fe kennzeichnen. Als besonders reicher Fundus für das Motiv des Ver-wandtenmords erweist sich der thebanische Zyklus, der seinen Höhepunkt im Bruderkrieg um Theben erreicht. Auch im Kontext des Troianischen Krieges sind namentlich die von den Siegern an der Königsfamilie verüb-ten Verbrechen wie der Mord an Priamos oder die Opferung der Polyxena ins Zentrum gerückt, die in der literarischen Tradition der Iliupersis bereits vorgebildet sind und in der attischen Tragödie ihre Ausgestaltung gefunden haben. Diese Taten haben sich dem Gedächtnis der Rezipienten durch ihre drastische Bildhaftigkeit und normüberschreitende Grausamkeit besonders stark eingeprägt und können damit als Folien für die in den römischen Bürgerkriegen begangenen Greueltaten dienen, durch die sie selbst noch übertroffen werden. In beiden Fällen rezipiert Lucan die epischen Stoffe vor allem in der Vermittlung über die attische oder auch die römische Tra-gödie, welche die in den Homerischen Epen zum Teil bereits angelegte Perspektive der Opfer ins Zentrum rückt. Dass gerade die Kriegsstücke des Euripides als Reflexe des Peloponnesischen Krieges gedeutet worden sind, der im Phänomen der Stasis ebenfalls Züge eines griechischen Bruder-kriegs annimmt, kann die literarische Analyse um die kulturübergreifende Perspektive einer gesellschaftlichen Bewältigung von Kriegs- und Bürger-kriegserfahrungen im Medium der Literatur ergänzen.
Durch den Rekurs auf Tragödienplots verdichtet Lucan den römischen Bürgerkrieg zu einem innerfamiliären Konflikt nach tragischem Muster, weitet ihn aber zugleich durch den Vergleich mit dem Troianischen Krieg in seiner Dimension als Proto-Weltkrieg und mit dem Zug der Sieben ge-gen Theben in seinem Doppelcharakter als Bruderkrieg und zugleich ex-ternem Krieg zwischen Thebanern und Argivern wieder ins Globale aus, um ihn schließlich ins Kosmische zu übersteigern. Die beiden extremen Pole von Lucans Gestaltung des Bürgerkriegs als eines suizidalen Bruder-kriegs und einer die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehenden Völker-
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 5:58 PM

Schluss 400
schlacht sind somit beide in mythischen Mustern vorgeprägt, ebenso wie der Kontrast zwischen anonymen Massenszenen und dem Fokus auf pro-minenten Einzelgestalten als Tätern oder Opfern.
Die Gattung der Tragödie lässt sich über die Beziehungen auf der in-haltlichen Ebene hinaus auch als ein Modell für bestimmte formale Cha-rakteristika von Lucans Epos heranziehen. So wurde der tragische Boten-bericht in narratologischer Hinsicht als ein mögliches Modell für Lucans primären Erzähler in seiner Rolle als Zeitgenosse und Augenzeuge des Bürgerkriegs identifiziert. Die streckenweise an dramatische Darstellungs-muster angelehnte und diese selbst noch transzendierende Präsentation der Handlung als eines sich direkt vor den Augen des Erzählers und der Rezi-pienten vollziehenden Geschehens erhöht die emotionale Wirkung, hat als Kehrseite aber auch eine quälende Ungewissheit der menschlichen Akteure und des Erzählers in seiner Eigenschaft als ‚dramatis persona‘ über den Ablauf des Geschehens zur Folge. Die Abwesenheit der Götter in Lucans Epos erweist sich damit letztlich auch als ein tragisches Darstellungsele-ment.
Die Verbindung von epischen und tragischen Darstellungsmustern im Bellum civile resultiert in einer komplexen intertextuellen Struktur. Die Bezüge auf unterschiedliche Texte und Gattungen werden miteinander vermischt und gegeneinander ausgespielt, Lesererwartungen durch den Rekurs auf scheinbar vertraute Erzählmuster geweckt und gleich wieder durchkreuzt. Dieser Verfremdungseffekt wirkt sich auch auf die Charakte-risierung der historischen Protagonisten des Bürgerkriegs aus, die fiktiona-lisiert und durch vielfache, oft zueinander im Widerspruch stehende oder einander überkreuzende Assoziationen mit intertextuellen Vorgängern aufgeladen werden. Eine eindeutige moralische Bewertung der drei Haupt-helden ebenso wie der Nebenfiguren im Sinne einer Schwarz-Weiß-Malerei wird dadurch verhindert. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Assoziation von Caesar und Pompeius mit Eteokles und Polyneikes. Lucan greift die in der Tragödie angelegte Verwischung der moralischen Unterschiede zwischen den Brüdern, die sich durch ihren Willen zum Bru-derkrieg beide schuldig machen, auf, kompliziert die intertextuelle Figu-renkonstellation darüber hinaus aber noch dadurch, dass er die jeweiligen Identifikationsmodelle in der Darstellung und Selbstdarstellung der Bür-gerkriegsgegner fortwährend wechselt, so dass beide Rivalen Züge sowohl von Eteokles als auch von Polyneikes annehmen. Generell wird die in der epischen und tragischen Tradition durchaus bereits angelegte Problemati-sierung des Heldentums von Lucan insofern ins Extrem gesteigert, als der Bürgerkrieg überhaupt keinen konsistenten Referenzrahmen mehr bietet.
Auf einer übergreifenden Ebene lässt sich die mythisch-literarische Geographie und Chronologie des Bellum civile schließlich auch in einem
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 5:58 PM

Schluss 401
metapoetischen Sinn lesen. Wie die epische Erzählung im Großen und Ganzen den Schauplätzen des Bürgerkriegs folgt, von Rom und Italien über Massilia und Spanien nach Griechenland und Thessalien und von dort nach Ägypten und Libyen, um schließlich via Caesars Abstecher nach Troia in Alexandria zu enden, folgt sie zugleich auch literarhistorischen Routen.
Das Thema der Eroberung und Zerstörung Troias, das zunächst im zweiten Buch indirekt als Folie für die Erinnerungen des Greises an die Schrecken des früheren Bürgerkriegs unter Marius und Sulla und im neun-ten Buch in einem selbstreflexiven Gestus anlässlich von Caesars Besuch bei den Ruinen Troias aufgerufen wird, nimmt Bezug auf die verschiede-nen Troia-Bilder in den Epen Homers, der attischen Tragödie, dem helle-nistischen Epigramm und der römischen Dichtung, insbesondere bei Ca-tull, Vergil, Ovid und Seneca, die sich wie Schichten überlagern und damit auch eine innerliterarische Chronologie suggerieren. Der als Folge des Krieges eingetretene Verfall Troias zu einer unkenntlichen Ruine bietet dabei Anlass für eine metapoetische Reflexion über die verewigende Kraft der Dichtung, die Lucans Bürgerkriegsepos im Spannungsfeld zwischen epischem Verewigungsanspruch und tragischer Klage verortet.
Das mythische Theben, das von seiner Gründung bis zum Bruder-kampf der Söhne des Oidipus um die Macht durch Bruderkrieg und Ver-wandtenmord geprägt ist, wird zunächst in Exempla und Gleichnissen als Paradigma für den Machtstreit zwischen Caesar und Pompeius eingeführt und dann durch subtile geographische Verschiebungen gezielt mit Lucans Thessalien assoziiert, das somit durch seine mythisch-literarische Vorge-schichte zum Schauplatz der Entscheidungsschlacht des Bürgerkriegs ge-radezu prädestiniert erscheint. Mit dem Bestattungsverbot reicht der Ein-fluss thebanischer Themen über die Schlacht von Pharsalos hinaus bis zu Caesars Besuch auf dem Schlachtfeld und der improvisierten Bestattung des Pompeius am ägyptischen Strand. Da in diesem Fall die Lucan voran-gehenden epischen Bearbeitungen des Stoffes weitgehend verloren sind, hat die Untersuchung der intertextuellen Beziehungen auf die tragischen Prätexte und darunter insbesondere auf die noch erhaltenen Tragödien des Aischylos, des Sophokles und des Euripides sowie Senecas Phoenissae fokussiert, mit einem Ausblick auf die Thebais des Statius. Dass gerade Theben als poetische Chiffre für Pharsalos stehen kann, lässt sich nicht nur mit der geographischen Koinzidenz erklären, sondern hängt eng mit der im Mythos und in der Tragödie vorgeprägten Rolle von Theben als Verkörpe-rung des Zusammenbruchs aller zivilisationsstiftenden Normen zusammen.
Die Argonautensage fungiert ebenfalls als eine mythisch-literarische Landkarte für Teile der Route des Bürgerkriegs, insbesondere längs der adriatischen Küste und quer durch die libysche Wüste. Auch hier verbindet
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 5:58 PM

Schluss 402
Lucan eine Bezugnahme auf mythische Paradigmata mit einer intertextuel-len Auseinandersetzung mit den Argonautika des Apollonios und deren rö-mischen Adaptationen. Dies impliziert eine Erweiterung des historischen Epos in Richtung auf die hellenistische Poetik, wie etwa im Schlangenkata-log des neunten Buches, der die hellenistische Lehrdichtung in einem gro-tesken Totentanz überbietet. Der alexandrinische Fokus tritt schließlich am Ende des Bellum civile ganz prominent ins Bild, wo Alexandria zum Schauplatz der Handlung wird, zugleich aber in der Ekphrasis von Cleo-patras Palast und Bankett auch die durch kleinere Gattungen wie das Epi-gramm und die Elegie repräsentierte hellenistische Ästhetik aufgegriffen wird, die in einem eigentümlichen Spannungsverhältnis zum großen Bür-gerkriegsepos steht. In der temporären Unterbrechung und Retardierung der Kriegshandlung im zehnten Buch lässt sich entsprechend ein Dialog mit dem auf Kallimachos’ Aitien-Prolog zurückgehenden Anti-Kriegs-Dis-kurs der römischen Dichtung erkennen, der bereits zuvor in den subtilen Anspielungen des Thessalien-Exkurses auf den Kallimacheischen Delos-Hymnos angeklungen war.
Lucans Bellum civile ruft somit von Homer über die attische Tragödie bis zur alexandrinischen Dichtung verschiedene Epochen und Gattungen der griechischen Literatur auf. Die verschiedenen Schauplätze suggerieren durch die Evokation bestimmter Prätexte vage eine literarhistorische Ent-wicklungslinie, die über Theben-Thessalien und Troia nach Alexandria führt, doch ist dabei keineswegs eine strikte chronologische Abfolge impli-ziert. Analog zum Kollaps der mythischen und historischen Zeitebenen in der narrativen Struktur von Lucans Epos ist auch eine Kopräsenz der ver-schiedenen griechischen und römischen Prätexte zu beobachten. Der Cha-rakter von Lucans Bürgerkrieg als einer Weltkatastrophe prägt sich in die-ser Weise auch auf der Ebene der Intertextualität im Bellum civile aus, welche die gesamte Literaturgeschichte in der Retrospektive als eine An-häufung von Erzählungen über Krieg und Gewalt erscheinen lässt, die ihren negativen Höhepunkt in Lucans Bürgerkriegsepos erreicht.
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical ServicesAuthenticated
Download Date | 12/9/14 5:58 PM