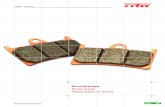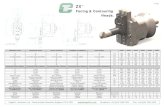kumo
-
Upload
petzpoertner -
Category
Documents
-
view
113 -
download
0
Transcript of kumo

1
Peter Pörtner, Japan-Zentrum der LMU München
Japanische Wolken und Wolkenbilder I
WOLKE, f., nubes. westgerm. wort. ursprünglich starkes neutr. *wulkna: as. wolcan, n.; ahd. wolkan, n.; mhd. wolken, n.; mnd. wolken, n.;
afries. wolken, n.; ags. wolcen, n., 'nubes', wolcnu 'himmel'. daneben bereits ahd. wolka und anfrk. uulca. auch als n-stamm fem. wolka (oder mask. wolko?), s. KELLE Otfrid 2, 164 und VAN HELTEN altostniederfrk. psalmenfragm. 159. mit wolka, wulca hat nichts zu tun ags. ('in der älteren sprache') wolc, da dessen genitiv stets wolcnes lautet, s. SIEVERS-BRUNNER § 243 anm. mhd. und frühnhd. neben neutr. auch
masc. und fem. (s. u.). das wort wird von SCHADE adt. wb.2 1197 als part. prät. zu *walk 'wälzen' gestellt, also 'zusammengeballtes, gewälztes', doch scheitert diese deutung am fehlen des mittelvokals (s. u.). dagegen hat JOH. SCHMIDT s. etymologie (vocalismus 2, 20) zu
welk 'feucht', idg. *wel-g, lett. vel ̃gans (dazu val ̃gans, val ̃gs 'feucht', velgt 'waschen, feucht machen', vilgans 'feucht' MÜHLENBACH-ENDZELIN 4, 530; 453f.; 587), lit. vìlgyti 'anfeuchten', preusz. welgen 'schnupfen', aksl. vlьgьkь 'feucht', russ. volgnut 'feucht werden' fast
allgemeine anerkennung gefunden, so auch (mit reserve) bei FALK-TORP spracheinheit 402 f. neben idg. uelg- steht uelq- in air. folc 'wasserflut', folcaim 'wasche' (PEDERSEN kelt. gr. 1, 59, wo weiteres), gotl. valgar 'rivuli' HELLQUIST2 1302, lett. valka 'ein flieszend
wässerchen, bach, quelle', valks 'feucht' (MÜHLENBACH-ENDZELIN 4, 456 f.), lit. valkà 'pfütze', s. WALDE-POKORNY 1, 306; TRAUTMANN baltoslav. wb. 358 f.; LIDÉN Göteborgs högskolas årsskrift 26, 95 ff.
in den älteren sprachstufen fast immer st. neutr. wolkan, wolken bis ins spätmhd., so im Heliand (nsg. uuolcan 3144; gen. uuolcnes 655; dat. uuolcne 3146; apl. thiu uuolcan 392; 415; dpl. undar uuolcnun 649), ebenso in den ahd. gloss., im ahd. Tatian und bei NOTKER, s.
GRAFF 1, 796 (urspr. ohne mittelvokal gen. pl. uuolcno ahd. gl. 2, 213, 35; dat. pl. uuolcnum Monseer fragm. 19, 7, vgl. SCHATZ ahd. gr. § 93). auch bei OTFRID als neutr., nur ein dpl. wolkon
Unter Nebel (althochdeutsch nebul, verwandt mit lateinisch nebula, und griechisch νέφηλη (nephele) oder νέφος = „Wolke“) versteht man in der Meteorologie einen Teil der Atmosphäre, in dem Wassertröpfchen fein verteilt sind, und der in Kontakt mit dem Boden steht, wobei die
Wassertröpfchen durch Kondensation des Wassers der feuchten und gesättigten Luft entstanden sind. Fachlich gesehen ist Nebel ein Aerosol, in der meteorologischen Systematik wird er jedoch zu den Hydrometeoren gezählt
Erst bei einer Sichtweite von weniger als einem Kilometer wird von Nebel gesprochen. Sichtweiten von einem bis etwa vier Kilometern gelten als Dunst. Einen Nebel in räumlich sehr begrenzten Gebieten bezeichnet man als Nebelbank und einen Tag, an dem mindestens einmal
ein Nebel aufgetreten ist, als Nebeltag.
Nebel wie Dunst unterscheiden sich von Wolken nur durch ihren Bodenkontakt, sind jedoch ansonsten nahezu identisch mit ihnen. In ansteigendem Gelände kann daher eine Wolkenschicht in höheren Lagen zu Nebel werden. In der Luftfahrt spricht man in solchen Fällen
von aufliegender Bewölkung.

2
Der französische Kunstwissenschaftler Louis Marin (1931-1992) verwendet in vielen seiner Studien - vor allem zur Malerei der italienischen Renaissance - das Begriffspaar Repräsenta-tion/Präsentation. Mit „repräsentativ“ und „präsentativ“ kennzeichnet er zwei elementar verschiedene Darstellungsweisen, ja Dimensionen der Malerei als Malerei, die sich - Marin ist Semiotiker und versteht auch Gemälde als „Texte“ - auch als die zwei Dimensionen des Zeichens oder des Zeichengebrauchs in der Malerei beschreiben lassen: Ein Zeichen kann „transitiv“ sein, das meint: Es repräsentiert ein Etwas und ist auf dieses Etwas hin „transparent“. Ein Zeichen kann aber auch „reflexiv“ sein, das meint: Es präsentiert, indem es sich (nur) auf sich selbst bezieht, sich selbst und bleibt dabei - das ist der wesentliche Punkt - „opak“ (weil es nicht „transparent“ ist auf ein Etwas hin, das es nicht ist, sondern nur repräsentiert). Mit anderen Worten: Für Marin zeichnet sich die Repräsentation durch Transparenz, die Präsentation aber durch Opazität, durch eine genuine Dunkelheit aus. Dass damit aber keinesfalls etwas Unaussprechbares, Unauslotbares oder gar Rätselhaftes markiert werden soll, lässt sich mit Marins eigenen Worten am deutlichsten zeigen. Er sagt in einem Gespräch: „Opazität, dem Sinn nach im Plural, würde all das bezeichnen, was in der Kunst des Sichtbaren jenseits oder diesseits der Repräsentation im Spiel ist, [...] Opazitäten: Gegenwart einer Materie, eines Fleisches, eines Malerkörpers in der reinen Bewegung der Bedeutungsannahme des Bildes vom Sichtbaren, welches das Gemälde darstellt, das Skelett eines Rahmens, die raue oder glatte Haut seiner Leinwand mit ihrer Größe und ihrem Format, die Farbpigmente, die Farbmischungen, die Putzbeläge und die Lacke; im Pinselstrich hinterlassene Spuren der Gesten des Malers; Akzente, Abstände, Anordnungen, Verber-gungen und Verdunkelungen, Explosionen, Verwirbelungen, Flüsse und Rückflüsse, Salbungen, Versüßungen, Lieblichkeiten, Flüssigkeiten, Klebrigkeiten, Krümel, Tropfen und Ausflüsse, Kratzer, Einschnitte, Spritzer: all das Opazitäten. Selbst wenn eine Repräsentation etwas repräsentiert, präsentiert sie sich immer auch selbst ...“ - Es ist bemerkenswert, dass ein europäischer Kunstwissenschaftler und -philosoph mit Blick auf die (selbst-)reflexive Dimension der europäischen Malerei Voraussetzungen, Bedingungen (ihrer Möglichkeit), sozusagen ein a priori wahrnimmt und aufdeckt, in dem ich versuchen möchte, ein Grund-merkmal der japanischen Kunst überhaupt zu sehen: eben das „Präsentative“. Bemerkenswert ist aber auch, dass der gute Abendländer Marin das „Präsentative“ als „opak“ charakterisiert; denn was „opak“ ist, ist nicht „transparent“ auf etwas Anderes hin, vor allem aber nicht auf „Transzendenz“. Das „Opake“ verstellt den Blick auf jedwedes Dahinter, selbst wenn es in einem übertragenen Sinne noch so „brillant“ ist wie auf Bildern des Piero della Francesca oder des Filippo Lippi. Es ist und bleibt ein Ärgernis, aber ein unabdingbares, von dem gerade Marin zu sagen weiß, wie viel die Kunst ihm verdankt: „Eben weil es sich um die Materie des Werkes selbst handelt, mit seinen unüberwindbaren Zwängen, weil es sich um die künstlerische Praxis handelt, die mit ihm verknüpft ist, kann sich die Bedeutung nicht in der Idee der „zu repräsentierenden“ Sache erschöpfen, noch in der Absicht des Subjekts „Schöpfer“, seine Repräsentation hervorzubringen. Jede Repräsentation präsentiert sich, indem sie etwas repräsentiert. Opazität dieses „Reflektierten“, das sich in der Repräsentation öffnet und ihre reine Bewegung des Bezeichnens jenseits oder diesseits von jeder Position eines Subjekts, eines cogitos: Subjektwirkung, ich will sagen, dass der Gegenstand (der Repräsentation) aus der Setzung als Wirkung seiner Präsentation auftaucht ...“ Erstaunlich ist vor allem, dass ein durch und durch alteuropäisch denkender Kunstphilosoph auf seinen langen Denkwegen zu der Erkenntnis kommt, dass die Repräsentation nur eine Wirkung der Präsentation sein kann. War also auch in der langen Geschichte des (nicht nur christlichen) Abendlandes die Repräsentation – wie auch das alteuropäische „Ich“ – letztlich eine Fiktion? Es gibt eine Art der Darstellung von Natur in der japanischen Malerei, die zumindest in ihrer entwickelten Form als charakteristisch „japanisch“ gelten kann. Es handelt sich dabei um eine

3
Technik, die „shunpô“ genannt wird; das chinesische Schriftzeichen für „shun“ wird auch „shiwa“ gelesen und bedeutet „Falte“, „hô“ nicht mehr und nicht weniger als „Methode“; „shunpô“ ist also der japanische Name für eine „Faltenmethode“ genannte Art des Malens. Man bezeichnet damit eine spezielle Art des „Schraffierens“ (freilich nicht in seinem ursprünglichen Sinne von „(ein)kratzen“) und Schattierens, um Bergen und Felsen auf Land-schaftsbildern, „sansuiga“, Masse, Körperlichkeit und Prägnanz zu verleihen. Auch diese Methode hat ihren Ursprung im alten China; sie verfeinerte und diversifizierte sich mit der Entwicklung der Tuschmalerei, „suibokuga“, und wurde als spezifischer Malstil von den Japanern übernommen. Diese Methode zielt nicht auf einen „realistischen“ Effekt, auf realistische „Abbildung“, sondern gleichsam auf die Darstellung eines Konzepts. Ein Charakteristikum (traditioneller) chinesischer und japanischer Landschaftsbilder ist, dass sie mit Vorliebe erfundene Landschaften darstellen bzw. Szenerien, von denen die Maler nur gehört oder gelesen hatten. Oft kopierten sie Vorlagen, die ihnen zur Hand waren, oder „montierten“ kopierte Motive zu neuen Arrangements. „Naturdarstellungen“ waren also in einem mehrfachen Sinne „Kunstdarstellungen“, also eine bestimmte Ausprägung von „concept art“. Erst im 18. Jahrhundert begannen japanische Maler wie Itô Jakuchû und Maruyama Ôgyo Natur auch vor und „nach“ der Natur zu malen. Mehr als 80 Prozent der Landschaften auf „fusuma“-Schiebetüren und „byôbu“-Stellwänden, die vor dem 17. Jahr-hundert entstanden sind, zeigen eine Natur, die es nie und nirgendwo gab. Sie sind geschickte und kunstvolle Kollagen aus Pflanzen-, Stein-, Tier- und Fluss-Motiven. Darüber hinaus ver-folgten die Maler offensichtlich weder die Absicht, die Illusion einer „wirklichen“ Landschaft zu evozieren, noch Natur zu „reproduzieren“. Die Kunst-Landschaft sollte nur sich selbst ähnlich sehen; das verlangte auch eine Art „Realismus“, in dem Sinne, dass die einzelnen Motive und die Bildkomposition als solche den Betrachter „überzeugen“ mussten. Vielleicht sollte man sagen: Gefordert war ästhetische Plausibilität. Was an artistischen Fähigkeiten dazu erforderlich war, lernten die japanischen Maler von den alten - chinesischen Meistern. Unter solchen Voraussetzungen scheint nicht nur der vergleichsweise kleine Bestand an Motiven erklärbar, sondern auch der Einsatz effektiver Techniken, wie der „shunpô“-Methode. Bei den Malern der Muromachi-Momoyama-Periode war eine „fuhekishun“ genannte Variante der „Falten-Methode“ überaus beliebt, bei der Felsen so gemalt wurden, als seien sie „mit der Axt“ geformt worden; eine Maltechnik, welche die Felsformationen besonders „wild“ oder „expressiv“ erscheinen ließen. Die Tatsache, dass die japanischen Maler nicht bei chinesischen Meistern, die ihrerseits über 30 verschiedene „Falten-Methoden“ anwendeten - in die Lehre gehen konnten, sondern gezwungen waren, sich an deren Bildern - die sie mehr oder minder zufällig vor Augen bekamen - zu orientieren, hatte den Vorteil, dass sie auf sehr eigene – sollen wir sagen: unkontrollierte? - Weise mit den erworbenen Techniken und Fähig-keiten umgingen und zahlreiche stilistische Varianten entwickelten, an denen Maler und/oder Malschule - dem Kenner - erkennbar sind. Zum Thema Darstellung - und damit mittelbar wieder zum Thema Präsentation und Reprä-sentation - sei ein weiteres Beispiel „präsentiert“, das für die japanische Kunst „repräsen-tativ“ ist, nämlich das so genannte „suyari-gasumi“; „suyari“ nennt man eine „kerzen-gerade“ Lanze; „kasumi“ ist der Nebel, genauer der „Frühlingsnebel“. Aber was haben eine schnurgerade Lanze und der Frühlingsnebel miteinander zu tun? Mit dem lanzengeraden Nebel sind die horizontalen Nebelstreifen genannt, die japanische Bilder aus verschiedenen Epochen in Segmente teilen, die auf vielfältigste Weise miteinander in Beziehung stehen können. Die Schnitt- und Verkittungsfunktionen des „suyari-gasumi“ sind von einer erstaunlichen Variabilität, da sie räumlicher, zeitlicher und sachlicher Art sind/sein können. Das Motiv der Nebel- oder Wolken-Streifen und -Schwaden war schon ein beliebter Topos in der heian-zeitlichen Lyrik (10. und 11. Jahrhundert n. Chr.). In der Malerei überwiegt ihr „funktionaler“ Wert. Wolken und Nebel „bedeuten“ hier im Grunde nichts, sie sind keine

4
„Abbildungen“ von Wolken- oder Nebel-Formationen, sondern ein malerisches Mittel der Bildorganisation oder Bilderzählung. In einem prägnanten Sinne müssen sie nicht gesehen, sondern „gelesen“ werden. Sie „signalisieren“ etwas. Sie signalisieren den Betrachtern nicht was, sondern wie sie zu sehen haben. Sie programmieren die Wahrnehmung. Sie verführen den Betrachter zu einer „Als-ob“-Wahrnehmung: Sieh das so, als ob Zeit vergangen wäre, sieh das so, als ob es weit weg wäre; sieh das so, als ob es gleichzeitig geschieht! Der Funktion nach also nicht unähnlich dem Goldgrund und der so genannten Bedeutungs-perspektive in der mittelalterlichen europäischen Malerei. Sie haben, wenn der Vergleich erlaubt ist, keine emotive oder impressionistische Valenz wie etwa die Wolken auf den Gemälden William Turners. Nur aus den überlieferten Texten der Heian-Zeit können wir schließen, dass die Wohnungen der Aristokraten üppig mit im Stil der Yamato-e bemalten Schiebetüren und Stellwänden ausgestattet waren. Nichts davon hat die Jahrhunderte überlebt. Wir müssen uns aus den erhaltenen Bilderrollen, „emakimono“, der Epoche die notwendigen Informationen extra-hieren. Dabei leisten uns auch die hinzugefügten Texte große Dienste. Aber schon im Man-yôshû (8. Jh. N. Chr.), einer der ältesten Gedichtsammlungen Japans, finden sich Gedichte, in denen von „kasumi tanabiku“ die Rede ist, also von einem Nebel, der „sich hinzieht, sich erstreckt“, lassen vermuten, dass Nebel und Wolken vornehmlich oder gerne als Streifenformationen wahrgenommen wurden, die vor und über Bergen vorüber- und entlang zogen; dabei Blick und Aussicht bald verdeckten, bald öffneten; dem Blick also ein Schauspiel des „Fort-Da“ boten. Möglicherweise wurden Wolken und Nebel von den frühen Japanern schon im Blick auf eine reale Landschaft nicht in ihrer Eigenqualität, sondern eher als Choreographen der Sichtbarkeit wahrgenommen. Das Moment der Bewegung, des Wechsels und des Umschlags hat dabei wohl auch eine entscheidende Rolle gespielt. Daraus, darf man annehmen, hat sich der konventionelle Topos des „suyari-gasumi“ entwickelt, der für viele japanische Bild-Genres prägend wurde, in denen Wolken und Nebel primär die Aufgabe haben, zu zeigen und zu verbergen, sehen oder nicht sehen zu lassen. Für die Bilderrollen, als frühe Vorläufer des Films, war die Wolken- und Nebel-Technik ein höchst geeignetes Mittel, Räume und Zeiten zu trennen und zu verbinden, Schnitte zu setzen und Übergänge zu schaffen. Die „suyari-gasumi“ spielten in den „emakimono“ auch die Rolle, die im Film von der Technik des „fade out“ und des „fade in“ übernommen wird. Auch das, was wir das „offene Ende“ einer Geschichte nennen, hat hinter Nebelschwaden geradezu seinen angestammten Platz. Ein Musterbeispiel für das, was Louis Marin die „Opakheit des Präsentativen“ nennt. Auf einem Bild des Kanô Motonobu (1476-1559) sind es zahlreiche übereinander gelagerte Wolken- und Nebelschichten, die räumliche Tiefe gleichsam simulieren: Wolken als Statthalter der Perspektive, wie sie auf anderen Bildern überhaupt als Provokateure von Räumlichkeit oder als Index von Nacht und Dunkelheit fungieren können. Wenn Nebel- oder Wolkenschwaden wie Rauch vertikal nach oben steigen, dann indizieren sie einen Ort, etwa einen Höllenort, an dem sich etwas Ungewöhnliches ereignet, vielleicht infernalische Quälgeister, gaki, ihren malignen Auftritt haben. Die „Opakheit präsentativer Zeichen“ lässt sich auch an dem „doha“ genannten Phänomen verdeutlichen. Zwar ist es schwer, das Wort in einem japanischen Wörterbuch zu finden, aber das, was es bezeichnet, ist ein wichtiges Element künstlerischen Gestaltens in Japan. Die wörtliche Bedeutung von „doha“ ist unspektakulär; „doha“ meint nicht mehr als „Erdhügel“, englisch „mound“ oder „ein leicht erhöhter Ort“, wie es das Daikanwajiten, das Große Zeichenlexikon, von Morohashi Tetsuji definiert. Konkret werden damit zum Beispiel die kleinen künstlichen Berge, „tsukiyama“, in japanischen Gärten, bepflanzte Erdhügel oder Flussufer und dergleichen bezeichnet. In den Landschaftsdarstellungen der „emakimono“ (im so genannten Yamato-Stil) stehen Bäume oft auf eleganten mit einer geschwungenen Linie

5
markierten Erdwellen, die nicht selten - ähnlich wie Wolken- oder Nebelstreifen – schichten-weise übereinander gemalt sind, um Räumlichkeit ins Bild zu bringen. Die „doha“ erscheinen spätestens auf vielen Bildern der Muromachi-Zeit als malerische Topoi; ganz so, als hätten sie die Gärten der Heian-Aristokraten verlassen, um als Bild-Topos ein Eigenleben zu führen. Schon in einem Werk wie dem „Isemonogatari-emaki“ von der Wende des 13. zum 14. Ja-hrhundert wirken die zu lichtgrünen Farbwellen mutierten „doha“ kaum mehr als „organi-scher“ Teil der Gartenlandschaft oder als malerische Gestaltungsmittel, - eher wie „auf dem Absprung“, alert. Und diesen „Abrspung“ haben sie spätestens auf einem Stellschirm aus dem 17. Jahrhundert geschafft: Auf den „tsuta-no-hosomichi-zubyôbû“ sind sie eigenständige Bildelemente, Motive in eigener Regie, in einer Art kubistischer Gleichberechtigung mit allen anderen Motiven; selbst mit der Schrift, die es sogar schwer hat, dem malerischen Gewicht der „doha“ Paroli zu bieten. Anders als sie heute in Museen exponiert werden, standen die „byôbû“-Stellwände tatsächlich in Räumen, in so genannten „zashiki“; bisweilen standen sich auch zwei „byôbû“ gegenüber. Denke ich mir also, dass ich zwischen den beiden (sich gegenüber stehenden) Stellwänden mit dem Titel „Schmaler Weg mit Efeu“ sitze und mir vorstelle, jenen/m goldfarbenen Pfad zu folgen, der auf der rechten Seite mäßig breit beginnt, dann vom Grün der „doha“ sozusagen „domestiziert“ wird; nicht nur, indem sie ihm räumlich Grenzen setzen, sondern auch dadurch, dass sie ihm in Gestalt des grün wuchernden Efeus seine eigene Goldfarbe streitig machen. Eine Weile folgt der Pfad - jetzt anscheinend ohne äußeren Zwang - dem Maß, das ihm gesetzt wurde, um dann auf der linken Stellwand diskret, aber deutlich aus seiner vorgeschriebenen Bahn auszubrechen – und sich offensichtlich (kein geringer Ehrgeiz!) bis ins Unendliche auszubreiten; wohlgemerkt: ins Unendliche dieses einen Raums, - präziser gesagt, ins Unendliche des Hier und Jetzt. Dies ist der Grund, warum die Vorstellung, das Privileg zu haben, diese Erfahrung zu machen, (zumindest) mich mit einem nicht geringfügigen Schwindelgefühl erfüllt (man müsste es lernen, sich ein Labyrinth oder einen Traum als eine geschlossene Unendlichkeit zu denken). Dieser „Schwindel“ ist nichts anderes als die wirkungsästhetische Pointe der „Opakheit des präsentativen Zeichens“. - Um wieder festeren Boden zu betreten, möchte ich noch nachtragen, dass diese Stellwände wahrscheinlich im Auftrag des Politikers, Dichters und Kalligraphen Karasuma Mitsuhiro (1579-1638) entstanden sind. Die Kalligraphien auf dem „byôbû“-Paar hat Mitsuhiro selbst geschrieben. Das Bildmotiv der Stellwände ist einerseits - natürlich - auch literarisch ver-mittelt (es bezieht sich auf einen Abschnitt des Ise-monogatari), andererseits geographisch genau zu „verorten“ bzw. zu identifizieren: Es handelt sich um den Utsunoya-Pass über dem Utsunoyama-Berg in der Nähe von Shizuoka, einen Abschnitt der Tôkaidô – der bedeuten-dsten „Reichsstraße“ des vormodernen Japan -, von hoher poetische Valenz (u. a. als „uta-ma-kura“, d.h. als konventioneller Topos der japanischen Literatur). In einem seiner Texte beschreibt Mitsuhiro, wie ihm die „realen“ Berge und Täler rechts und links der Tôkaidô, die er oft bereiste, wie „Stellwände“ vorkamen. Disee „Stellwände“ hat er wohl malen lassen, um sich - umgekehrt - die Tôkaidô gleichsam „ins Haus“ zu holen - oder um seine Verwirrung nur größer zu machen - und zu genießen. Das von ihm verfasste und geschriebene Gedicht auf der linken Stellwand lautet: „Ohne hinzugehen / seh ich den Berg von Utsu / vergesse sogar / dass es sein wahres Bild ist / und frag mich: ist es ein Traum?“

6
Es gibt ein Bild, welches das Spiel mit der Opakheit der Zeichen ins Extrem treibt: Eine Stellwand mit der Darstellung eines Kiefernhains, „shôrin-zûbyôbu“, von Hasegawa Tôhaku (1539-1610), der verschiedene Malstile beherrschte, vor allem aber als Meister der „suiboku“-Tuschmalerei gilt. Das Bedeutendste seiner „suibakuga“ soll dieser Kiefernhain sein, bei dem er vielleicht an die Kiefernwälder seiner Heimat, der Halbinsel Noto, im nördlichen Honshû dachte. In einem gewissen Sinne opak ist auch die Entstehungsgeschichte des Bildes. Man hat nämlich festgestellt, dass es ursprünglich nicht für eine Stellwand gemalt worden ist. Wahr-scheinlich war es ursprünglich für „fusuma“-Schiebetüren konzipiert.
Die Rekonstruktion der ursprünglichen Fassung zeigt ein entschieden stärkeres „Gefälle“ und spielt damit meiner Interpretation - in die Hände. Aber für das, worauf es mir hier ankommt, sind die rekonstruierte und die überlieferte Fassung gleichermaßen dienlich. Ist doch in bei-den Fassungen das „Opake präsentativer Zeichen“ mit Augen greifbar.

7
Das Bild als solches, als Ganzes ist ein „doha“, eine Erdwelle, ein Hügel, ein unsichtbarer Hügel, der nur durch die Kiefern markiert wird. Ein Hügel, der nur bezeugt durch die Kiefern, die auf ihm stehen. Selbst der Nebel, von dem wir wissen, dass er (zum Beispiel) das Sichtbare vom Unsichtbaren scheiden kann, ist hier ausgespart. Er „erscheint“ als Leere, als opake Blankheit. Er „funktioniert“, obwohl, d.h. weil „er“ gar nicht „da“ ist. Anders gesagt: das Opake des Zeichens, glänzt mittels Abwesenheit. Und selbst der Berg, am äußersten rechten Ende der einen (hier: unteren) Stellwand, in den das ganze Bild „mündet“, und der den heiligen Fuji-Berg gleichsam herbei-zitiert, ist nur „da“ als/dank seiner Schattenhaube. Die Kiefern treten hervor aus dem Nichts, das ihr Wurzelgrund ist. Sie sind – wenn wir das Wort in seiner Grundbedeutung verstehen -: Funktionäre des Nichts, denen - im Gegenzug - das Nichts alles verdankt, auch sich selbst. Denn wären da nicht seine opaken Stellvertreter, wäre da auch das Nichts nicht.
II
WOLKENBILD, n., wolkengebilde, wolke 'ein gebild, dergleichen die wolken oft bilden' CAMPE 5, 764:
darum musz manches wolkenbild, veränderlich sowol an farben als figur,
sehr schnell entstehn und schnell verschwinden BROCKES ird. vergn. in gott (1721) 2, 3; 8, 258;
ein schöner himmel erglänzte mit seinen ... buntgefärbten wolkenbildern über ihnen TIECK schr. (1828) 16, 301; grosze wolkenbilder schwebten über dem teich KLUGE Kortüm (1938) 210.
Ixion ward geäfft mit rechte
als er ein wolckenbild anstatt der Juno küszt LOHENSTEIN Arminius (1689) 2, 1417a; J. J. SCHWABE belustigungen (1741) 6, 304; WIELAND Lucian (1788) 1, 412. in diesem griechischen mythos und auch sonst in vergleich und metaphorischem gebrauch nähert sich die bedeutung von wolkenbild der von 'trugbild,
phantom, täuschung':
vergeblich wie der träumenden entschlysse, wie wolkenbilder, die der ost verwehet
WIELAND I 1, 361 akad.; wenn ich träume, so sind es phantasieen und wolkenbilder BODE Mich. Montaigne (1793) 6, 316; 1, 339; schatten und wolkenbilder
WIELAND Agathon (1766) 1, 211; nach einem wolkenbild im orient haschend gab er (d. röm. hierarch) im occident eine wirkliche krone verloren SCHILLER 9, 225 G.; sieh nur wie diese verblendeten ... ihrem wolkenbild nachjagen GÖRRES ges. schr. (1854) 5, 465; dieser
patriotismus ... ist das wolkenbild, das unsre sinne verwirrt ALEXIS ruhe ist d. erste bürgerpflicht (1852) 3, 200. --
Nun ist unser Blick endlich ausreichend vernebelt, bewölkt und überwölkt; mit horizontal hingestreckten „Lanzenwolken“, selbst mit Wolken und Nebeln, die gar nicht zu sehen sind - und auch mit vertikal aufsteigenden Dünsten aus der Unterwelt. Doch es scheint mir, dass damit noch nicht genug der Verdunkelungsarbeit geleistet ist, die notwendig ist, das Unsicht-bare sichtbar werden zu lassen oder als sichtbar erscheinen zu lassen, obgleich es nicht

8
„wirklich“ sichtbar wird. Vor allem aber wurde die abendländische Wolkenarbeit, der abend-ländische Wolkeneinsatz noch nicht gebührend mit der japanischen Dunstchoreographie ver-glichen und von ihr abgegrenzt. Das sei nun – ansatzweise - nachgeholt. Wir begannen mit Louis Marin und seiner Unterscheidung von „transitiver Repräsentation“ und „opaker Präsentation“; jetzt werden wir die Thesen einen anderen Kunstwissenschafters in unserer Argumentation einbinden: Joseph Imorde, der nicht nur ein großartiges Buch mit dem Titel „Präsenz und Repräsentanz. Oder: Die Kunst, den Leib Christi auszustellen“ ge-schrieben hat, in denen es um die grandiosen theatralischen Installationen geht, die zu Anfang des 17. Jahrhunderts das so genannte „Quarantore“, das „Vierzigstündige Gebet“ vor allem in Rom und Mailand begleiteten. Imorde schreibt: „Die Kunst stand dabei immer wieder vor der Aufgabe, die Glaubensgeheimnisse erbaulich, unterhaltend und erschütternd vor Augen zu stellen ...“ Imorde referiert in diesem Zusammenhang auch Thomas von Aquin, der „... die Eucharistie [als] sakramentales Zeichen [verstand], in dem Christus zwar real präsent sei, aber nicht so wie im Himmel, sondern so wie der abwesende Kaiser in seinem Bilde ...“ Ein Hinweis, der sehr klar und schön verdeutlicht, wie eng die Darstellungsprobleme der abend-ländischen (vornehmlich christlichen) Kunst mit denen der Theologen verknüpft sind, wenn sie über Präsenz oder Realpräsenz Christi in der Eucharistie streiten. Und immer dreht es sich um das Problem von Repräsentation und/oder Präsentation. Von Joseph Imorde liegt auch ein Aufsatz mit dem Titel „Die Wolke als Medium“ vor, mit dem ich im folgenden in eine Art Ost-West-Dialog treten möchte. „Die Wolke als Medium“ ist 2004 in einem von David Ganz und Thomas Lentes herausge-gebenen Sammelband mit dem Titel „Ästhetik des Unsichtbaren. Bildtheorie und Bildge-brauch in der Vormoderne“ beim Verlag Dietrich Reimer erschienen. Imorde stellt die Aus-einandersetzung mit dem Problem der Verborgenheit und der Darstellung des Verborgenen - im Christentum also der Darstellung des „Allerheiligsten“, verbatim, also das Problem der „Ästhetik des Unsichtbaren“ - selbst eine in sich paradoxe Formulierung - an repräsentativen Beispielen, d. h. Texten dar: Der Jesuit und Poetologe Emanuele Tesauro etwa konstatierte in seinem 1654 erschienenen Buch „Aristotelisches Fernrohr“, Cannochiale Aristotelico, „... dass Gott dem Menschen die höchsten und entferntesten Dinge nur im verschleierten Zustand aufdecke, also in ihrer offenbaren Verborgenheit: „’le cose píu alte ...’“ - so formulierte Tesauro - „’vengono copertamente scoperte’“ Fast dreißig Jahre vorher hatte schon der Jesuit Maximilianus Sandaeus in seiner „Theologia Symbolica“ (von 1626) kurz und bündig festgestellt, dass man „... in der äußeren Welt nur Anzeichen der verborgenen Dinge vor sich habe. Da die göttliche Natur an sich geheim und arkan (Dopplung) sei, brauche es Abbilder (simulacra), Vorstellungen (imagines), Spuren (vestigia), zusammengefasste Symbole des Allerhöchsten ...“ Sandaeus kam, von seiner Theo-Logik gelenkt, nicht umhin zu behaupten, dass dem Menschen „... die göttliche ’Maiestas’ immer verborgen bleiben [müsse], hinter der „Humanitas Christi“ nämlich, dem fleischlichen Schleier, der die Glorie des Allerhöchsten“ verdunkle. Das muss man sich klarmachen: Es ist gerade der „fleischgewordene“, inkarnierte Gott, Christus, der den Blick auf Gott, den „Allerhöchsten“, verschleiert, verdunkelt, ver-hindert. Der Körper Christi selbst ist es, der wie eine Wolke die Göttlichkeit Gottes unsichtbar macht. Und der Vergleich mit der Wolke stammt von Sandaeus selbst. Er beschrieb in seinem 1627 erschienen Buch „Theologie Mystica“ die „humanitas“ Christi „... als Dunkelheit (caligo), als Nebel (nebula), Schatten (umbra), Rauch (fumus) [...], und schließlich auch als Wolke (nubes) [...] Allegorisch - so meinte Sandaeus - sei die Wolke nichts anderes als das Fleisch Christi, das auf Erden seine Göttlichkeit verborgen habe und weiter verberge...“ Auch Autoren wie Augustinus, Gregor der Große, Hrabanus Maurus, Rupert von Deutz und die späteren Neuscholastiker hatten und haben das Bild der „Wolke“ - auf je eigene Weise - auf die Inkarnation angewendet. In seiner „Explanatio in Psalmos“ hat der Gelehrte Roberto

9
Bellarmino erklärt: „Der Satz „’Gewölk und Dunkelheit umgeben ihn’“ bezeichne zuerst [...] die Unsichtbarkeit des Herrn, da dieser im unzugänglichen Licht hause. [...] Weiterhin weise diese Psalmstelle aber auf die Parusie, das Erscheinen Christi zum Jüngsten Gericht hin, denn da werde er [...] in Herrlichkeit und auf den Wolken des Himmels wiederkehren ...“ Interessant, wie hier das undenkbare Aufbrechen der Verborgenheit ans Ende der Zeiten ver-legt wird, wobei die Wolke im Bild zu einem Vehikel, einem Schwebekissen der göttlichen Herrlichkeit umgedeutet wird (wie man es ja auf vielen Bildern, die das Jüngste Gericht zeigen, sehen kann). Allerdings tragen die Wolken des Jüngsten Gerichts Gott insofern nur zum Schein, als er, dank seiner Verklärtheit, keines tragenden Elementes bedarf. Die Wolken werden hier eher Zeichen seiner Maiestas sein: wie ein Thron oder ein Triumphwagen. - Höchst spekulativ und von einer unerhörten geistigen Verve ist der Gedanke des Francisco Suáres, der in seinem Kommentar zur „Summa Theologica“ des Thomas von Aquin an-kündigt, „... dass die göttliche Wunderkraft für den Moment der Wiederkunft Christi aus den irdischen Dünsten Wolken so wohlgeordnet zusammenhäufen werde, dass in diesen vom strahlenden Glanz des Leibes Christi gleichsam ein Widerschein entstehe, der die Heiligen außerordentlich erfreuen, die Verworfenen aber entsetzlich erschrecken werde ...“ In unserer Diktion könnte man also sagen, dass mit dem Einbruch des Endes aller Tage, im Ereignis des Jüngsten Gerichtes das „Repräsentativ“ der Wolken in ein „Präsentativ“ umschlägt - und zwar, das ist das Bemerkenswerte, durch Wohlgeordnetheit: Die Wunderkraft Gottes „ordnet“ die Wolken zu einen Präsentativ; bringt sie also in einen wohlgeordneten Bezug. Wodurch sich ihr Zeichen-Charakter verwandelt: Im Sinne Marins muss man sagen: Sie verlieren ihre Transparenz und gewinnen an Opakheit. Aber darauf müssen wir, um es geboten prägnant zu sagen, bis zum Jüngsten Tag warten. Bis dahin gilt, was der Licht-Maniac Bernhard von Clairvaux auf die Formel gebracht hat: „Caligo ... est Deus in carne, tanquam sol in nube“ - „Die Dunkelheit ist Gott im Fleisch, also gleichsam die Sonne in den Wolken“. Strukturell, wenn auch in einem völlig anderen metaphysischen Milieu, arbeitet sich diese unabschließ-bare Debatte um die „caligo divina“, um den „Deus absconditus“, um das „lux invisibilis“ an dem Gedankenexperiment ab, das Plato in seinem „Höhlengleichnis“ als Parabel vorführt. Es geht, mit Verlaub, um das Geheimnis des Präsentativen. Aber wenn man den Code des Präsentativen knackt, (und vielleicht ist das möglich) verdunstet - um im Wolkenbild zu bleiben - auch sein Mysterium, und damit die Repräsentation selbst. In der Umgangssprache schlägt sich das so wieder: Einerseits wird die Würde der Demokratie auch damit begründet, dass die Politiker hier gewählte „Repräsentanten“ des Volkes seien; andererseits ist es eine äußerst verächtliche Form der Kritik, zu sagen ein gewisser Politiker „repräsentiere“ ja nur noch, gehe nur noch seinen „repräsentativen“ Pflichten nach; aber gehören diese nicht zu den höchsten Pflichten eines „Repräsentanten“. - Wir schmarotzen in einem gewissen Sinne in unserem Alltag noch immer an der unabgeschlossenen und unabschließbaren theologischen Debatte um das, was Repräsentation bedeutet und wie sie funktioniert. Um so rätselhafter die Frage, wie das moderne Japan, mit seiner unchristlichen Vergangenheit und ohne dass bis heute das Christentum für dieses Land und in diesem Land eine relevante Rollte spielt, die westlichen Dunst- und Nebelstrategien und Wolkentaktiken so effektiv einsetzt. Vielleicht deutet das darauf hin, dass die Soziologen Recht haben, die Gesellschaften nur als selbstl-äufiges Spektakel, mithin Systeme, zu interpretieren, die erfolgreich mit „S(t)imulakren“ hantieren, denen keine „Substanzen“ oder „realen Signifikate“ korrespondieren. Sodass Goethe - aus dem Kontext gerissen - es wieder einmal getroffen hätte: „... welch Schauspiel, aber ach, ein Schauspiel nur ...“ - Jetzt sind wir - spätestens - an den Punkt gekommen, wo wir aus dem Wolken-Kuckucksheim der Spekulation zurückspringen müssen auf den Boden zumindest vermeintlicher Tatsachen. -Dazu bedienen wir uns der Hilfestellung japanischer Wind- und Donnergötter. Wir bleiben also bei Götter- und Wolkenerscheinungen; - aber (wie) anders als auf Darstellungen des Jüngsten Gerichts. Sie begegnen uns auf einem Stellschirm des Tawaraya Sôtatsu (17. Jahrhundert)

10
Die beiden hier abgebildeten Gottheiten, die gerade eine Vorform des „hang gliders” auszuprobieren scheinen (das Motiv soll die altgriechischen Boreas-Darstellungen zum Vor-bild haben!), sind uns aber nur Vorwand, um uns mit einer weiteren Wolkendarstellungs-technik vertraut zu machen, die „tarashikomi“ genannt wird: Auf einer noch nicht getrock-neten Farbe wird eine andere - wässrigere oder dünnere - aufgetragen, die sich „wolken-artig“ in der zunächst aufgetragenen Farbe (oder Tusche) zu so genannten „mura“, diffusen Farbflecken, zerfließt. Eine Auffälligkeit der Bilder Sôtatsus ist, dass sie maltechnisch doppelt registriert sind. Einerseits liebte Sôtatsu es, kräftige Konturen zu zeichnen, um sie dann flächig auszumalen, eine Malweise, die man „kôrokutensai“ nennt. Daneben findet man auf denselben Bildern Sôtatsus auch die Technik des „tarashikomi“, die eher auf Vagheit, Zufall, eben Unbestimmtheit der Konturen zielt und die kräftigen Linien und gleichsam eindeutigen Farbflächen mit Delikatesse und Weichheit konterkariert; oder sollte man sagen: konterkoloriert? Einen Ochsen hat Sôtatsu fast ganz in der „tarashikomi“-Technik gemalt, um ihm Körperlichkeit und eine Art malerischen Rhythmus zu verleihen. Maler des 18. und des 19. Jahrhunderts nutzten die Technik, um den Dekor- oder Design-Charakter ihrer Bilder zu betonen oder zu verstärken, so als wäre die Form nur noch Vorwand für einen malerischen Effekt: fast gewinnt das Farbenspiel, das Kolorit Übergewicht über die Form. Bei Sôtatsu erscheinen Form und Kolorit noch in einer Art luftiger Balance, wie ich es nennen will. Etwa auf dem einem Bild, das Wasservögel in einem Lotosteich zeigt, dem „renchisuikin-zu“. Auch dieses Bild ist ein Spiel mit Zeigen und Verbergen, Andeuten und Auslassen. Es verdeutlicht, wie genau der Maler die Zufallseffekte der „tarashikomi“-Technik hat berechnen können müssen. Auch die Flussufer, die übrigens als „doho“ dargestellt sind, empfehlen sich als Meisterstücke der „tarashikomi“-Technik. Selbst das Bild als solches scheint wie zufällig aus dem Weltzusammenhang herausgeschnitten. Es könnte die Momentwahrnehmung eines wandernden Blickes sein. Es hat keine Ränder; gleich könnten die beiden Wasservögel aus dem Bild, in das sie gerade herein geschwommen sind, wieder heraus schwimmen.

11
Noch nie haben die beiden sich von der Stelle gerührt, und dennoch vermitteln sie einen Inbegriff, ein Inbild dessen, was „Schwimmen“ ist oder sein kann. Als hätte das Wasser nicht die Spur eines Widerständigen. Das Wasser trägt sie so wie das Bild selbst seine Zeichen. Das ganze Bild trägt einen Wolkeneffekt oder soll man gleich sagen: es ist ein Wolkeneffekt. Als wollte es uns sagen: Ich zeige euch, was ihr alles nicht seht. Und doch „zeigt“ es andererseits nichts als die Präsenz eines bestimmten „unbedeutenden“ Augenblicks oder einen Augenblick, der seine Bedeutung nur in seiner bestimmten Präsenz hat. Mithin wieder ein Fall vollendeter „Opakheit“, wie Louis Marin es nennen würde. Oder, um den Titel eines Vortrags von Jacques Derrida kontextfern zu verwenden: Das Bild bietet uns etwas an, nämlich: „Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen“. – Als könnte es gar nicht anders sein, ist auch über das Leben Tawaraya Sôtatsus fast nichts be-kannt; weder sein Geburts- noch sein Sterbejahr ist übermittelt. In dem einzigen Brief aus seiner Hand, der noch vorliegt, bedankt er sich für die Übersendung fünf gedünsteter Pilze, „daigo no mushitake“, eine damals hochgeschätzte Spezialität aus dem Daigoji-Tempel in der Nähe von Kyôto. Man weiß, dass er ein „machishû“, ein Bürger der Stadt war, die heute

12
Kyôto heißt. Berühmt wurde er als Maler großformatiger Bilder; sein Geld hat er aber als Hersteller und Illustrator von Fächern verdient. Hauptsächlich saß er in seinem Laden, dem „tawaraya“, daher sein Name - und stellte Fächer her; d. h. er produzierte das, was man heutzutage „kôgeihin“, kunstgewerbliche Produkte, nennt. Aber er bemalte sie auch; was er dabei lernte, demonstrierte er auch an/in seinen großen Bildern, übertrug er auf seine großen Bilder. Das mag ein Grund dafür sein, dass auch seine großformatigen Bilder - bei all ihrer Subtilität - ein gewisses illustratives Moment besitzen, einen Zug zum Design, der sich darin äußert, dass es Sôtetsu nie wirklich um die nachahmende Darstellung von Natur ging. In eben dem Tempel, aus dem die Pilze stammten, für die Sôtatsu sich in der erwähnten Epistel bedankte, befindet sich heute eine Stellwand, auf der elf Fächer aus der Hand Sôtetsus auf dekorative Weise zu einem bemerkenswerten künstlerischen Arrangement zusammen gestellt sind. Diese Stellwand erinnert uns daran, dass Fächer nicht immer schon hand-betriebene air conditioner waren, sondern - gerade in der Edo-Zeit - signifikante Accessoires, die man auch verschenkte, um damit bestimmte Botschaften zu vermitteln: Fächer (auch) als Medien gesellschaftlicher Kommunikation. Man nutzte sie auch in geselligen Situationen, in denen, wie man heute sagen würde, „Kommunikation unter Anwesenden“ geübt wurde, als The-menlieferanten - communication tools: Was ist hier dargestellt? Wie lautet das Gedicht, was sagt es uns? - Fächer als Vorwände für eine Art von Rätselspielen. Fächer, die Bilder und Gedichte trugen, nannte man zu Sôtetsus Zeiten „ôgi no sôshi“, „Fächer-Hefte“. Auf der kleinen Fläche der Fächer traten Bild und Text in einen engen, man möchte sagen: intimen Bezug. Auf einem Stellwandbild im Nationalmuseum von Tôkyô ist eine Stellwand voller Fächer dargestellt, vor der sich Gäste einer Kirschblüten-Party höchst angeregt unterhalten. Die elf Fächer auf dem „byôbu“ im Godaiji-Tempel zeigen sehr verschiedene Motive: einerseits solche, die als „ga“, „elegant“, andererseits solche, die als „zoku“, „alltäglich, profan“, charakterisiert werden können: Das Motiv „Hunde, die sich anbellen“ steht neben dem Motiv „Höfische Szene“; und der „Höfischen Szene“ wird arglos ein „Ochsenkarren, der einen Fluss durchquert“ beigesellt. Allerdings wissen wir nicht, ob das Arrangement der elf Fächer, wie wir es heute vor Augen sehen, von Sôtatsu selbst stammt; sie bezeugt aber die ungemeine Vielfalt der Kunst und Kunstfertigkeit Tawaraya Sôtatsus - und ineins damit einen veritablen Katalog von Fragen, die nur sehr schwer zu beantworten sind. Zumindest einen Rückschluss oder eine These lässt sie zu, nämlich die, dass die von mir (notorisch) behauptete „Präsentativität“ der Bild-Zeichen die Unterscheidung von „Kunst“ und „Kunsthand-werk“ und „Dekor“ und „Design“ problematisch erscheinen lässt. - Dies gibt mir die Gelegen-heit, einen weiteren Topos der japanischen Kunst vorzustellen, den des „suhama“: „su“ steht für „sasu“, was „Sandbank“ bedeutet, „hama“ bedeutet „Strand“. Mit „suhama“ ist eine Ge-stalt, eine Form gemeint, die an eine von einem Stück Strand und einer Sandbank gebildeten Bucht oder Einbuchtung erinnert, wie etwa im Garten der Katsura-Residenz in Kyôto, aber auch auf vielen japanischen Küsten-Bildern. Bisweilen wurde das „suhama-dai“ mit „hôrai“, der aus China importierten „Insel der Seligen“ gleichgesetzt: Jedenfalls ein „heiliger Bereich“, ein Anderswo, im Hier und Jetzt, von dem wir uns wieder Tawaraya Sôtatsu zu wenden müssen. Denn auch er hat eine Stellwand mit einer „Kieferninsel“ bemalt: „matsushima-zubyôbu“.

13
Auf weiß schäumenden Wellen treibt oder schwimmt hier etwas, gleichsam ein frei flottier-endes „suhama“-Zeichen, von dem sich nicht sicher sagen lässt, was es sein soll. Es könnte – wir sind uns dessen jetzt sicher - auch schweben, etwas Wolkenhaftes meinen. Wie ja auch die Kiefern in der oberen Hälfte des Bildes zwar noch als Kiefern erkennbar sind, aber schon in einen metamorphotischen Prozess eingetreten sind, an dessen Ende sie sich in Wolken ver-wandelt, verwirklicht haben werden.
III Mit dem 17. Jahrhundert begann nn der ökonomische Aufstieg der Kaufleute, die – wie auch die neuen Machthaber - durchaus keine urbane Herkunft hatten. Ihre neue Wohlhabenheit - nicht ihr gesellschaftlicher Status - verlangte nach einem eigenen, „erkennbaren“ life style. Was sich ihnen im damaligen Kyôto anbot, war einerseits die Welt der Tuschmalerei und andererseits die der so genannten Yamato-e. Sie entschieden sich für die Farbe, für die bunte Welt der Yamato-e, die ihrem urbanen Geschmack offensichtlich mehr entsprach als das Monochrome mönchischer Provenienz. Auch die überlieferten Salonkulturen des Tee-Wegs und der Gedichtwettbewerbe mauserten sich bei den neuen Aristokraten wie bei den nouveaux riches ebenfalls zu etwas Neuem: Die Salons wurden mit rustikalem und/oder fremdländischen Dekor ausgestattet. Und während man sich früher bei den „uta-awase“-Gedichtwettbewerben von den berühmten Landschaften Japans inspirieren ließ, suchte man jetzt nach dem Ungewöhnlichen, Nicht-Alltäglichen. Außerhalb der Salons, in den wirklichen Räumen, den Wohnräumen des Alltags aber war das Japanische gefragt. - Wieder ein spezifischer Fall von – japantypischer - doppelter Registriertheit. - Dies waren die Räume, für die man die Kunst eines Sôtatsu und eines Ogata Kôrin brauchte, für diese Räume entwickelten sie ihr Kunst-Design, ihre Design-Kunst. Die vorausgegangene Epoche war die/wie eine „Rotierung“ aller gesellschaftlichen Verhältnisse gewesen, wie Jean Paul es genannt hätte, „... the world turned upside down ...“, jap. „gekokujô“. Folglich war die Jetztzeit eine Zeit, welche die Ordnung der Zeit davor negierte; anders gesagt: das Neue war das, was das, was davor war, negierte. In einem gewissen Sinne könnte man von einem umfassenden Parodieverfahren sprechen. Die Maler, die für die Städter neue Yamato-e malten, verkehrten darauf die Ordnung des Hofes. Aber: sie arbeiteten im Auftrag des Hofes und für den Hof (davon mehr in der nächsten Vorlesung). Sôtatsu malte zahlreiche Motive aus dem Genji-monogatari und dem Ise-monogatari; was in seinen Bildern aber eine auffällig untergeordnete Rolle spielt, das sind - die Menschen; an deren Stelle ist die Natur getreten, bisweilen nichts als Natur. Die Menschen, die man sehen kann, wirken einsam und - ängstlich. Hierin äußert sich sicher auch die Angst der Städter, die mit unberechenbaren Machthabern leben mussten; das Leben der „chônin“, war zwar nicht ärmlich, aber dauergefährdet. Vor allem in der Zeit des Übergangs, in der auch Tawaraya Sôtatsu lebte und arbeitete. Mag sein, dass hierin eine soziologische Pointe des „präsentativen“ Zeichens und seines Gebrauchs liegt: als eines vorzüglichen Ausdrucks- und Darstellungsmittels, das es erlaubte, Kunst, Dekor und Design (und mehr) in ein höchst lebendiges Wechsel- und Tauschverhältnis zueinander treten zu lassen, zu dem, was Rilke einen „luftigen Austausch“ genannt hätte. Ein Spiel der Opakheit, das sich zu keiner Transparenz und der damit gemeinten Transzendenz zu bekennen braucht und (nur) das Gefühl eines grenzenlosen Raums vermitteln möchte, in dem Zeit und Weg und Himmel gleichsam kurzgeschlossen sind. 海くれて 鴨のこゑ ほのかに白し umi kurete kamo no koe honokani shiroshi Es dunkelt über dem Meer Der Schrei der Wildgans: Ein Spur von Weiß.
(Matsuo Bashô)

14
Kanô Eitoku (1543-1590) soll der erste gewesen sein, der für seine (großformatigen, „deko-rativen“) Bilder (byôbu-zu) Blattgoldhintergründe verwendet hat; wobei die Goldflächen Land, Wolken, Nebel „bedeuten“ können oder einfach ein „unbestimmter“ Hintergrund, in den ein Motiv positioniert wird. Man weiß nicht, ob Eitoku, der Name bedeutet „Ewige Tugend“, ob er den Goldhintergrund „erfunden“ hat - oder ob er ihn (auch) auf spanischen oder portugiesischen sakralen Gemälden gesehen hatte. Er traf damit jedenfalls genau den auf „Grandezza“ gepolten Geschmack der machtvollen „daimyô“, Feudalherren, seiner Zeit. Horizontale Bänder „leerer“ Flächen - oft vergoldet - wurden zu einem Gemeinplatz der Malerei nach Eitoku. Anders als früher „bedeuteten“ leere Flächen jetzt nicht mehr „Ferne“, sondern sie wurden als „visual devices“ multifunktional (wir haben im Kontext der Wolken- und Nebelmotive schon recht ausführlich darüber gesprochen). - Aber das Stichwort des Goldhintergrunds verlangt einen kleinen Exkurs, den ich mit einem caveat! beginnen muss, weil ich Sie kurz auf ein Feld führe, auf dem ich mich selbst nicht besonders gut auskenne. Goldfolie, japanisch „kinpaku“, spielt eine große Rolle in der Kunst. In Streifen-, Dreiecks-, Vierecks- oder Blütenform wurde Blattgold auf Bilder oder Skulpturen aufgezogen, um Konturen zu markieren oder Flächen dekorativ zu strukturieren; seit der zweiten Hälfte der Heian-Zeit fand es auch auf buddhistischen Bildern Verwendung. Hier wohl, wenn man diesen abendländisch-philosophisch höchst belasteten Begriff ausleihen darf, um „Er-habenheit“ zu signalisieren. Auch diese Technik haben die Japaner von den Chinesen gelernt. - Es sind chinesische Buddha-Skulpturen aus der Mitte des 8. Jahrhunderts bekannt, die mit Blattgold überzogen waren. - Aber schon in der Phase der Übernahme scheint die Japaner das „dekorative“ Moment vor allem fasziniert zu haben. Dafür gibt es einige Indizien. Während Skulpturen durch einen Goldüberzug an Plastizität und „Gegenständlichkeit“ gewinnen, hat die Verwendung von Blattgold auf Bildern einen „verflachenden“ Effekt; anders: es „entmaterialisiert“ das Dargestellte. Die Maler der chinesischen Song-Epoche, denen eine gewisse „realistische“ Tendenz nachgesagt wird, verzichteten folglich auf den Gebrauch von „kirigane“ oder „kirigin“. In Japan nahm man den „verflachenden“ Effekt des Goldes indessen in Kauf. - Ein prächtiges Exempel für die „Opakheit“ eines Zeichens, die gänzlich unabhängig ist von seinem „sinnlichen Scheinen“, seinem Glanz. Im Gegenteil: gerade in seinem Glanz drängt sich die „Opazität“ des Goldes auf, wie man es auf einem Bild aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts zeigen kann, das Amida-Buddha zeigt, wie er, aus dem „Westlichen Paradies“ oder dem „reinen Land“, jôdo, kommend, die „westlichen Ber-ge“ überquert. Dabei bleibt er aber „unheimlich“, zu unnahbar für einen, der „daherkommt“. In Abwandlung des Sprichworts muss man sagen: Es ist nur Gold, was da glänzt. – Wie dem auch sei, als „dekoratives“ Element - nicht zuletzt in der - uns schon vertrauten - „Wolkenform“. Aber bei weitem nicht nur. Der „Goldtechniken“ gibt es viele. Der Goldgrund wird „kinji“, die Goldwolken werden „kin´un“ genannt. Das Gold ist aus der japanischen Kunst, nicht nur der Malerei, seit der Kamakura-Zeit (13./14. Jh.) nicht wegzudenken. Kanô Eitoku und seine Nachfolger haben den Einsatz des Goldes als malerisches Mittel aber radi-kalisiert. Auf dem „karashishizu-byôbu“ Eitokus sind „Goldgrund“ und „Goldwolken“ kaum mehr zu unterscheiden. Der „verflachende“ Effekt des Goldes, der, wie wir hörten, zum Beispiel für die chinesischen Maler der Song-Zeit ein Problem darstellte, wird hier genutzt, um „Raum überhaupt“ zu inszenieren. Auf den berühmten „rakuchû-rakugai-zu“ genannten Bildern, auf denen die Hauptstadt und ihre Umgebung und das Leben darin dargestellt ist, „wuchert“ es, - das Gold scheint hier gefräßig. Und gefräßig durfte es sein. Eitoku malte für die Machthaber seiner Zeit. - Auch ein Grund dafür, dass nur wenige seiner Werke erhalten geblieben sind, die nur noch erahnen lassen, wie er die legendäre Azuchi-Burg für Oda Nobunaga ausgestattet hatte. - Zudem sind Eitokus Werke in fragmentierter und ummontierter Form auf uns gekommen; was uns heute als Stellwand vor Augen steht, schmückte einmal die

15
„fusuma“-Schiebetüren eines Prachtraums. Von Anfang an ein „fusuma-e“ ist das „kachô-zu-fusuma-e“ im Jukô-in des Daitoku-ji-Tempels in Kyôto.
Dahinter verbarg und befand sich der „Buddha-Raum“, „butsu-ma“ (der Abtswohnung, „hôjô“), die „Privatkapelle“ des Abts. Endlich also ein Bild, das tatsächlich auf etwas hin-weist; dies tut es aber nicht symbolisch oder „repräsentativ“; oder dadurch, dass es auf etwas hin „transparent“ wäre. Nein, es macht etwas vor, es macht uns etwas vor: Der eine der zwei Vögel auf dem Pflaumenbaum zeigt dem Anderen eine Richtung an. Sein malerisch ein wenig „unorganisch“ angesetzter Flügel, man möchte von einem „Zeige-Flü-gel“ sprechen, sagt: „Dort!“ oder „Dorthin“ – Offensichtlich geschieht dies mit Gezeter, denn einer der drei Wasservögel - auf der zweiten Schiebetür von links - schaut sich fast verwundert, ja verärgert um: „Was zetert der?!“ - Und selbst der Baum reckt und streckt sich in die gewiesene Richtung: in den realen Raum hinter dem Bild. – Stellen wir uns nun vor, dass die beiden mittleren „fusuma“ nach rechts und links beiseite geschoben werden - und den Blick auf die im Hintergrund des „butsu-ma“, des „Buddha-Raums“ aufgestellte Buddha-Skulptur freigibt, dann bleiben nur noch die beiden kleinen Vö-gel ganz rechts zu sehen, die plötzlich zu erkennen geben, dass ihre Haltung auch „Vereh-rung“ bedeuten kann; und der Vogel links oben scheint sich zu beeilen, „mit von der Partie“ zu sein. Was auf diesem Bild „in Szene“ gesetzt ist, ist eine Inszenierung; mithin eine Inszenierung voller Witz. Die Botschaft ist „Herein spaziert und adoriert“! Das Bild ist durch und durch „performativ“, es tut, was es sagt. Keine Augentäuschung; überhaupt keine Sinnestäuschung, sondern eine Sinn-Täuschung. Ein Sinn-Austausch. Wer ladet wen ein? Und wer ist schon da? Wir dürfen beim Schauen, über dem Schauen vergessen, einzutreten und zu beten. Denn das wäre ja das Schlimmste nicht; ein Ikonen-Effekt. Eitoku hat diesen Effekt wahrscheinlich nicht „gewollt“, aber er hat ihn erreicht, indem er ihn bewirkt. Die Selbstvergessenheit bei der Betrachtung einer „Einladung zum Gebet“ kann ja selbst als eine Art der „Andacht“ gelten.

16