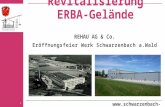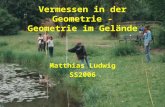Herzlich Willkommen… …im Luftkurort Willebadessen Kulturland Kreis Höxter.
Lagerte die Drususarmee an der Nethemündung bei Höxter? · N. Ricus von der möglichen Opferung...
Transcript of Lagerte die Drususarmee an der Nethemündung bei Höxter? · N. Ricus von der möglichen Opferung...
Lagerte die Drususarmee an der Nethemündung bei
Höxter?
Rolf Bökemeier∗
Februar 2004
Die vom Luftbildfotographen Alfons Koch,Fürstenberg, fotographierte, vermutlich römi-sche militärische Anlage unweit der Nethe aufeinem Terrassensporn bei Brakel−Sudheim(Abb. 1) ermöglicht die Formulierung vonzwei wichtigen Hypothesen über den mögli-chen Weg der Drususarmee im Jahre 11. v.Chr. an die Weser und über den möglichenOrt ihrer ersten Lager an diesem Strom.Die erste Hypothese beschreibt, basierend aufder Lage dieses wahrscheinlichen römischenMilitärlagers von Brakel, rein strategisch denAnmarsch der Drususarmee durch das dortigebreite Nethetal zur Weser. Dieser Feldzug desDrusus im Jahre 11 v. Chr. wird von CassiusDio (LIV/33) geschildert.Nach Dios Aussagen zog Drusus im Früh-jahr dieses Jahres von castra Vetera nach Er-richtung einer Brücke über die Lippe durchdas zwischen Lippe und Ruhr liegende Su-gambrerland. Dort stieÿ er auf keinen Wi-derstand, weil die sugambrischen Krieger ge-gen die südlich wohnenden Chatten gezogenwaren. Durch diesen günstigen Umstand ver-anlasst, führte Drusus sein Heer weiter nachOsten durch das Cheruskerland an die Weser.Topographisch bedingt, kam er vermutlichaus dem Sugambrerland über den Hellweg zu-nächst in die Region Geseke/Paderborn undkonnte von dort südlich von Driburg das Eg-gegebirge überwinden. Nunmehr lag über dieBördelandschaft von Brakel der Weg durch
das breite Nethetal Richtung Höxter o�en.Die von A. Koch auf Infrarot�lm so deutlichfotographierte quadratische Umrandung mitRundecken mit der möglichen Funktion einesWachtkastelles von Brakel, etwa einen Tages-marsch von Höxter entfernt, mag ein wichti-ges Indiz für diese erste These über den Wegder Drususarmee sein. Dieses Indiz erfährt sei-ne Bekräftigung durch den Fund einer römi-schen Tonlampe in Hembsen etwa zwei kmunterhalb dieses vermutlich römischen Lagersvon Brakel (W. R. Lange Vor und Frühge-schichte im Weserbergland bei Höxter, Muse-um f. Archäologie, Münster 1981, S. 41), de-ren zeitliche Zuordnung zum 1. oder 2. Jahr-hundert aber noch umstritten ist.Die zweite These folgt aus den bisherigenFeststellungen und umfangreichen Recher-chen auf den D−SAT−Aufnahmen des rus-sischen Satelliten Cosmos (CD−ROM, TOPWARE, Art. 641), die im Verlauf dieses Bei-trages dargestellt werden sollen.Zunächst einmal versuchte Verf. auf diesenSatellitenaufnahmen Lagerspuren am Ort desKochschen Infrarotfotos in Brakel−Sudheimzu entdecken. Dieser Versuch war nicht vonvornherein als erfolgreich anzusehen, weilnämlich ähnliche vergleichende Versuche mitOrten von weiteren der ausgezeichneten In-frarotfotos von A. Koch wie von Sommersell,Holzhausen/Nieheim und der Groÿen Maschvon Stahle keine eindeutigen Ergebnisse ge-
∗verö�entlicht auf http://www.roemerfreunde-weser.info
Seite 1 von 17
bracht hatten. Hier in Brakel−Sudheim aufdem Terrassensporn mit weitem Überblicküber das Nethetal aber waren genau am Ortdes vermutlichen Lagers auf den russischenD−SAT−Aufnahmen in Form und Gröÿe pas-sende Rechteckstrukturen neben einem weite-ren nicht weit entfernten kleineren Quadratdirekt an der Nethe erkennbar. Damit hattendie von A. Koch als Lagerumrandung deutba-ren Bodenverfärbungen ihre Bestätigung ge-funden. Jetzt war es vertretbar, den Zug derDrususarmee über den Ort dieses vermutli-chen Lagers und damit durch das Nethetalvorauszusetzen. Daraus ergibt sich eine wei-tere Schlussfolgerung: Wenn nämlich die Dru-susarmee nach ihrem beschwerlichen Zug vomgroÿen Hellweg oder von der oberen Lippeüber das Eggegebirge durch das breite Nethe-tal an die Weser gelangt wäre, dann hätte siehier in ihrem Mündungsgebiet lagern müssen.Hier lag nämlich geradezu optimal die weitausgröÿere Talebene als die ca. 6 km weiter nörd-lich bei Höxter.Verf. erinnerte sich bei diesem Gelände anden �Lochgürtelhaken von Godelheim� in dervon Bendix Trier herausgegebenen Publikati-on �2000 Jahre Römer in Westfalen� (Mainz1989, S. 134), in der dieses wichtige Fund-stück mit einem strukturidentischen Stückaus dem Bereich des drusianischen Zweile-gionenlagers Oberaden (Abb. 2) verglichenwird. Das Museum für Vor− und Frühge-schichte Berlin soll nach W. R. Lange indessen o. a. Verö�entlichung �seit 1905 zweidurchbrochene Gürtelhaken....von der Sand-wisch in Godelheim aufbewahren�. Nach N.Ricus wurde vom gleichen Gelände �Auf derSandwisch� in Godelheim der wissenschaft-lich noch immer umstrittene �sitzende Kna-be� (Merkur) geborgen, der nahezu ein Eben-bild in der lebensgroÿen Merkurbronze ausHerculaneum (geborgen in der Mitte des 18.Jahrhunderts, vgl. Abb. 3) und in der nochfrüheren Vorgängerstatue von Lysippus im 4.Jahrhundert v. Chr. besitzt. Gegner der The-se von der römischen Herkunft dieser kunst-vollen Godelheim−Statuette verweisen auf ei-
ne angeblich spätmittelalterliche bis neuzeitli-che Herkunft und auf entsprechende Gutach-ten. Wenn das Godelheimer Stück eine Re-plik wäre und erst in der Renaissance odereiner jüngeren Zeitepoche entstanden undam gleichen Fundplatz des römischen Loch-gürtelhakens verloren gegangen wäre, müs-ste man jedoch von einem kaum vorstellba-ren Zufall ausgehen. Der gleiche Fundplatzdes Godelheimer Merkur und der Lochgür-telhaken in Oberadener Muster spricht dage-gen eher für die gemeinsame römische Her-kunft dieser drei Fundstücke. Die These vonN. Ricus von der möglichen Opferung die-ser Fundstücke in einem Opferteich an ei-nem ehemaligen Weseraltarm am Gelände�Auf der Sandwisch� von Godelheim als rich-tig vorausgesetzt (nach einem Verf. überlas-senen unverö�entlichten Manuskript), könnteein Zeitraum ab der Renaissance nicht zutref-fen. Eine Opferung in heiligen Gewässern wä-re dagegen typisch für die germanische Zeit.Der Godelheimer Kleinbronzenfund so wie diedortigen Lochgürtelhakenfunde könnten so-mit am ehesten auf eine Opferung als Beu-testücke durch germanische Krieger zurück-geführt werden, die vom Schlachtfeld zurück-strömten. Ähnlich könnte im nahen Lobachein römischer Lugdunum−As mit Varusge-genstempel (FMRD VII, 7035) in das dortigeQuellheiligtum (?) gelangt sein.Durch diese Betrachtungen motiviert,forschte Verf. um so genauer in denD−SAT−Aufnahmen vom Gelände der Net-hemündung von Godelheim. Es zeigten sichau�ällig viele Strukturen und, besonders be-achtenswert, Teile von ovalen bzw. polymor-phen Umrissen. Eine bogenförmige Wallum-randung ist sowohl auf der Topographiekartedes Deutschen Reichs von 1924 als auch teil-weise in der Natur noch heute vorhanden undverdankt ihr Überleben wohl nur der Anfangdes 20. Jahrhunderts dort erbauten und heutefür den Personenverkehr nicht mehr benutz-ten Eisenbahntrasse (Abb. 4), wodurch eineschützende Abgrenzung gegen weitere Sied-lungsausdehnungen stattgefunden hat.
Seite 2 von 17
Im Urkataster von 1838 �nden sich inner-halb des �Wallbogens� die Flurnamen �In denDummen� und �Dummenhügel� (Abb. 5). Dieetymologische Namensdeutung von �Dumme�könnte nach H. Bahlow (Deutschlands geo-graphische Namenswelt, Suhrkamp 1985) alsSumpf− oder Moorgebiet abgeleitet werden.Am �Dummenhügel� �ndet heute Kiesabbaustatt, so dass dort weitere Nachforschungennicht mehr möglich sind. Da die Wallrestesehr deutlich erhalten sind, könnten sie einerelativ � junge Herkunft� vermuten lassen. Siekönnten als Hochwasserschutz für das in die-sem Bereich wüst gewordene Dorf Eggersenangesehen werden. Andererseits kann die frü-here Herkunft aus der Römerzeit nicht völ-lig ausgeschlossen werden. In seinem westli-chen Teil überdeckte der Wallbogen (Struk-tur 1 in Abb. 6) eine etwa 10−12 ha groÿeovale Umrandung (Oval 3 in Abb. 6). DieseUmrandung verläuft auf einer bogenförmigenNiederterrasse etwa 6 m hoch über einem ehe-maligen Weseraltarm, der o�ensichtlich einsteine Insel im Strom um�ossen hat (Abb. 7).Hier gab das Gelände bei der möglichen er-sten Lagerung des Drususheeres die ovale, frü-here Umrandung vor. Innerhalb dieses Ovals(3) erscheint die Struktur eines groÿen �ügel-förmigen Gebäudes, die einer archäologischenUntersuchung bedürfte.Die Karte �Corbeiensis Dioecesis Pro� ausdem 17. Jahrhundert lässt die vor diesem ehe-maligen Altarm vermutete Insel tatsächlicherkennen. Somit ergibt sich an dieser Stelledurch die Insellage an der Nethemündung einstrategisch wichtiger Ort mit einer Furt anzwei Weserarmen mit ruhigem, �achen Was-ser.Eine ähnliche Insel zwischen dem StadtkernHöxter und der Abtei Corvey sorgte auchdort für eine Furt. Sind nun auch auf die-sem ebenfalls bevorzugten Gelände �Tom Ro-den� nahe bei Kloster Corvey weitere Ova-le zu �nden? Dort hatte Heribert Klabes be-reits in seinem Buch Corvey (Höxter, 1997)auf zwei rechteckige Strukturen auf einem Fo-to des Landesvermessungsamtes aufmerksam
gemacht, die er als Römerlager interpretier-te. Leider hatte eine überhastet durchgeführteProbegrabung keinen Erfolg. Auf der entspre-chenden D−SAT−Aufnahme sind Teile dervon Klabes vorgestellten Strukturen zu sehen.Auÿerdem ist bei stärkster Vergröÿerung imAusdruck tatsächlich ein Oval von etwa 3 haGröÿe erkennbar. Einige hundert Meter wei-ter nördlich und westlich von Lüchtringen er-scheint auf einem Infrarotfoto von A. Koch einweiteres Oval von ca. 5−6 ha Gröÿe (Abb. 8).Teile der gröÿten möglichen ovalen Umran-dung von ca. 18−20 ha Gröÿe (Oval 2, Abb. 6)scheinen nördlich der Netheeinmündung undca. 500 m westlich der alten Dorfwüstung Ol-dentorpe auf der Flur �Auf der Höhe� (Ur-kataster von 1838) zu liegen (Abb. 9). Auchhier sind geometrisch genaue Strukturen einesmöglichen groÿen Flügelgebäudes und in zweiparallelen Reihen angeordnete mögliche qua-dratische, miteinander verbundene Gebäude-strukturen zu sehen.Grundsätzlich sollte hier darauf hingewiesenwerden, dass alte ehemalige Fundamentstruk-turen von Wüstungsorten und Wüstungsge-bäuden auf den D−SAT−Aufnahmen aus 270km Höhe weitaus besser als auf technisch per-fekten Schwarzweiÿ− oder Coloraufnahmenaus geringeren Höhen auszumachen sind. Solassen sich z. B. für das untere Nethetal so-wohl die bekannten kaiserzeitlichen bis mittel-alterlichen Siedlungen Herbram bei Amelun-xen als auch das erwähnte Oldentorpe dichtan der Weser nordwestlich von Godelheim(Nr. 9 in Abb. 6) erkennen.Auch die auf topographischen Karten (z.B. auf der Wanderkarte �Bergland Lippi-scher Südosten� von 1981) vermerkte Wü-stung �Stoppelberg� östlich von Steinheim bil-det sich unübersehbar auf der entsprechendenD−SAT−Aufnahme ab. Im Nethemündungs-gebiet selbst lag einst der bereits erwähn-te wüst gewordene mittelalterliche Ort Eg-gersen. Nach den D−SAT−Aufnahmen zei-gen sich dort jedoch zwei getrennte wüsteSiedlung�ächen (Nr.7 und 8 in Abb. 6). Da-mit könnte durch diese D−SAT−Aufnahmen
Seite 3 von 17
möglicherweise tatsächlich das Vorhandenseinvon zwei ehemaligen Orten bestätigt wer-den. Diese alternativ aufgeworfene Vermu-tung gegenüber einer bloÿen Namensmodi-�kation für einen einzigen Ort wird durchH. G. Stephan (Archäologische Studien zurWüstungsforschung I, S. 211) o�en gelassen.Die fraglichen Namen aus den von Stephanangeführten Dokumenten des 14. Jahrhun-derts werden dabei mit �tygerickessen, dictumup der Dumme� (�Tygerickessen, benannt aufder Dummen�) und �Eygeritzen�, bzw. �Ex-gerxen� oder �Eygerikessen� angegeben. DerUrkataster legt damit die Siedlungsstelle für�Tygerickessen� für den Ort der Flurbezeich-nung �In der Dummen� fest, den Verf. in sei-ner Skizze in Abb. 6 mit der Zi�er 8 belegt.Stephan gibt die Fundplätze für Eggersen füreine leicht westlicher gelegene Terrasse an, dieVerf. mit der Zi�er 7 in Abb. 6 angegeben hat.Während der Ortsname �Tygerickessen� ver-loren gegangen zu sein scheint, haben sich of-fensichtlich die anderen drei ähnlichen Namenzu �Eggersen� fortentwickelt. Wüst gewordensind jedenfalls nach der D−SAT−Aufnahmezwei Ortsteile, die infolge den früheren an-dersartigen Verlaufs der Nethe möglicherwei-se auf den entgegengesetzten Uferseiten diesesFlusses gelegen haben.Am Steinberg lassen sich auf denD−SAT−Aufnahmen deutlich weitere Wü-stungsstrukturen ausmachen. Es wäre verfüh-rerisch, zusammen mit vorhandenen Umran-dungsstrukturen an die jüngere Chronik derFürstenberger Kirchengemeinde zu denken,die formuliert: �Der Steinberg zwischen Go-delheim und Wehrden soll Ort des römischenLagers unter Varus gewesen sein...� Sicher-lich erinnert die groÿe Fläche des östlichenSteinbergs in ihrer Lage, Ausdehnung undNeigung sehr an das berühmte Lagergeländevon castra Vetera in Xanten. Die sehr deut-lichen Fundament−Strukturen eines riesigenehemaligen Gebäudes am Steinberg (Struktur5 in Abb. 6) lassen sich schwer auf römischeLagerreste beziehen und auch kaum auf dieReste des �Heiligenhauses� (H. G. Stephan in
o. a. Publikation, S. 211) auf dem Clus vonEggersen zurückführen, weil der erkennbareGrundriss dieses Gebäudes wenig dem einermittelalterlichen Kirche entspricht. Entschei-dend für die hier angestellten Betrachtun-gen ist: Die D−SAT−Aufnahmen ermögli-chen das Au�nden von Wüstungsstrukturen.Können nun die vorgestellten Ovale mögli-cherweise ehemaligen Drususlagern zugeord-net werden? Es ist heute herrschende wissen-schaftliche Meinung, dass das Mehrlegionen-lager Oberaden und das unweit davon an derLippe vorgelagerte Kastell Beckinghausen derDrususarmee zuzuweisen sind. Das KastellBeckinghausen zeigt eine ovale Grundform.Etwa aus der gleichen Zeit stammt das römi-sche Lager auf dem Kops Plateau in Nijmwe-gen. Es ist dem Gelände angepaÿt und zeigteinen ovalen bis polymorphen Umriss mit dreiRundungen. Im Jahre 10 v. Chr. zog Drususvom Standort Mainz aus über die Wetterauin das Gebiet der Chatten. Auf dieses Jahr isto�ensichtlich die Errichtung des oval geform-ten Versorgungslagers Bad Nauheim−Rödgenzurückzuführen. Erst im Februar 2004 wur-den von Klaus Grote ca. 50 römische Fund-stücke aus einem Lageroval von ca. 4 ha Grö-ÿe in Hedemünden, Kreis Göttingen, im südli-chen Weserbergland geborgen und in den Me-dien vorgestellt: �Wir sind uns ganz sicher,dass römische Soldaten (�möglicherweise ausder Zeit des Drusus� , im Fernsehinterview)hier vor rund 2000 Jahren eine Art Basis-lager für ihre Feldzüge gegen die Germanenunterhalten haben� (WP, 11. 2. 2004). NachHery A. Lauer (Archäologische Wanderungenin Südniedersachsen, Eigenverlag, Angerstein1988, S. 163−165) wird dieser ovale Ringwallals �Wallanlage Hünenburg bei Hedemündenvorgestellt� und auf deren �vorläu�ge Datie-rung in die vorrömische Eisenzeit� verwiesen.Diese Au�assung wird nun durch diese neuenGrabungen korrigiert. Damit liegt jetzt durchNachweis der Kreisarchäologie Göttingen einrömisches Lageroval im Weserbergland vor,das die bisher vorgebrachten Indizien für mög-liche zeitgleiche Lagerovale der Drususarmee
Seite 4 von 17
in dieser Region verstärkt.In früheren Luftbildforschungen waren Verf.auf den englischen Luftfotos 3096 und 3097vom März 1945 vom Gelände Wilhelmsbergvon Schloss Neuhaus/Paderborn (Genehmi-gung der Wiedergabe durch: The Aerial Re-connaissance Archieves at Keele University,England) mehrere ovale Groÿstrukturen auf-gefallen (Abb. 10). Auf der gröÿten Umran-dung von über 20 ha Gröÿe liegen inner-halb des Waldgebietes Wilhelmsberg an zweiAbschnitten heute noch sichtbare mächtigeDoppelgräben. Es könnten − mit aller Vor-sicht, da bisher Funde fehlen − Merkmale ei-nes stark befestigten Römerlagers sein. Einkleineres Oval von immerhin noch ca. 9 haGröÿe ist dort ebenfalls auf den russischenD−SAT−Aufnahmen erkennbar.Verf. vermutet hier an der Vereinigung vonAlme und Lippe am Wilhelmsberg vonSchloss Neuhaus aufgrund der dargelegten In-dizien, strategischer Rückschlüsse und Ana-lysen entsprechender Ortsnamen trotz feh-lender Funde (auch wegen nicht ausreichen-der bisheriger Prospektionen) den Ort desvon Drusus errichteten Kastellgeländes �Ali-so� (Rolf Bökemeier, Die Varusschlacht....,Tübingen 2000), wohl wissend um die neuer-lich wieder um das Enddatum Halterns (Ali-so?) entbrannte Diskussion.Verf. hat östlich von Kleinenberg auf denD−SAT−Aufnahmen an einer besondersschmalen Stelle des Eggegebirges an dem dortalternativ möglicherweise einst verlaufendenWeg des Drususheeres aus dem Gebiet der Su-gambrer zur Weser Teile einer dunklen Dop-pelspur auf der Südseite eines Ovals auf demdortigen Winzenberg entdeckt. Diese Doppel-strukturen werden seitlich durch tiefe, halb-kreisförmig angeordnete Bachschluchten auchohne dortige Anlegung eines Wall−Grabenswirksam geschützt, während im Norden dieovalen Strukturen durch eine Straÿe gestörtsind. Es kann hier bei dem durch das Geländeperfekt vorgegebenen Oval die mögliche Um-
randung eines etwa 15 ha groÿen römischenMarschlagers nicht ausgeschlossen werden.All diese hier angeführten teils archäolo-gisch bestätigten, teils vom Verf. vermute-ten Drusus−Lager passen sich dem Geländean, besitzen keine Lagerecken und verzichtenauf die �korrekte� Rechteckstruktur mit Run-decken, die in den folgenden Jahren römischerEroberung üblich war. Besonders bei den La-gern Beckinghausen, Bad Nauheim−Rödgen,Hedemünden und den vermuteten Lagernvon Schloss Neuhaus zeigen sich diese ovalenStrukturen. O�ensichtlich erschien es zu Be-ginn der römischen Eroberungskriege leichter,Lager mit Rundungen oder Anpassung an dasGelände statt wie später in Rechteckform zuerbauen (Abb. 11).Die Umrandungen im Nethemündungsgebietweisen ebenfalls keine Ecken auf, dafür demdortigen Gelände angepasste mögliche Lager-wallstrukturen in ovalen und polymorphenFormen. Zwei dieser gröÿten Umrandungenenthalten Strukturen, die an �Flügelgebäu-de� erinnern (Umrandung 2 und 3, Abb. 6).Wenn es denn Fundamentreste von Gebäu-den sein sollten, dann allerdings von beträcht-licher Gröÿe. Magnetometrische Erfassungenwürden erfahrungsgemäÿ die Strukturen nochdeutlicher darstellen können. Bei der Umran-dung westlich Lüchtringens wird dagegen einGrabungsschnitt durch den möglicherweiseheute noch nachweisbaren Graben als ersterUntersuchungsschritt vom Verf. für zweckmä-ÿiger angesehen.Unter Umständen ist ein derartiger Schnittauch bei einem bisher noch nicht erwähntenOval angebracht. Es ist auf dem Urkatastervon 1832 auf dem Hochufer zwischen Wehr-den und Blankenau als ovales Flurstück vonca. 6 ha Gröÿe (Abb. 12) abgegrenzt undauf den D−SAT−Aufnahmen und in Restenheute noch im dort vorhandenen Waldgebietsichtbar (Abb. 13). Ein dort angesiedeltes La-ger der Drususarmee hätte zur oberen Weserhin Wachtfunktionen haben können.
Seite 5 von 17
Abb 1: Die vermutliche römische Militäranlage von Brakel-SudheimDie quadratische Lagerumrandung mit Rundecken hat eine Seitenlänge von ca. 180m. Obenrechts könnte eine Lagerverkleinerung mit Innenausbau vorgenommen worden sein, wie sieähnlich in dem Limeslagern Burgsalach und Eining anzutre�en sind.Infrarotfoto von Alfons Koch, Fürstenberg
Abb 2: Der Lochgürtelhaken von Godelheim/Höxter
Oben: Der Lochgürtelhaken von Godelheim (Auf der Sandwisch), Museum für Vor− und Früh-geschichte, Berlin
Unten: Lochgürtelhaken vom Gelände des drusianischen Römerlagers Oberaden, Museum fürKunst− und Kulturgeschichte der Stadt Dortmund, jeweils als Abb. 136 und 137 ausB. Trier (Hg.), �2000 Jahre Römer in Westfalen�, Mainz 1989.
Seite 6 von 17
Abb. 3: Die Merkur−Statuette von Godelheim/HöxterLinks: Groÿbronze des Merkurs aus dem durch Vesuvasche verschütteten Herculaneum hatnach Norbert Ricus (in einem an Verf. überreichten Script) als Vorbild eine Groÿbronze desBildhauers Lysippus aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. gehabt.Mitte und rechts: Kleinbronze des Merkurs vom Fundplatz �Auf dem Sandwisch� bei Go-delheim, nach Ricus �aus einem Opferteich aus einem alten Weserarm�. Diese Kleinbronzewurde auf dem Laufband der dortigen Kiesgrube entdeckt. Der gemeinsame Fundplatz vonLochgürtelhaken und Merkur−Kleinbronze liegt im Gebiet der Nethemündung, wo Verf. dieehemaligen Lager der Drususarmee vermutet. Das mögliche Lager Nr. 3 (Abb. 6) ist z.B.durch die dortige Kiesgrube zu etwa einem Viertel abgebaut worden. Nach Ricus �ist dieKleinbronze ein Unikat; sie ist nach dem Wachsausschmelzverfahren in zwei Abschnittengegossen worden.�Fotos: Norbert Ricus
Seite 7 von 17
Abb. 4: Nethemündung (modi�ziert) nach der topographischen Kar-te des deutschen Reiches von 1924In der rechten Hälfte des Kartenausschnittes sind die beiden im Text besprochenen Wall-abschnitte zu sehen, die im Urkataster als eine bogenförmig abgegrenzte Fläche dargestelltist. Der rechte Nethearm bestand zu einer unbekannten früheren Zeitepoche. Die Höhenli-nien und der ehemalige Westbogen der Nethe scheinen rein hypothetisch ein nierenförmigesehemaliges Lager einzugrenzen.
Seite 8 von 17
Abb. 5: Gelände an der Nethemündung auf Grundlage des Urkata-sters von 1838In Rot sind Oval−Strukturen von den D−SAT−Aufnahmen (Top-Ware, Art. 641) einge-zeichnet. Im Oval Nr. 3 ist der Umriss eines möglichen Flügelgebäudes, im Oval Nr. 4 sindzwei Rechtecke zu erkennen. Der Dummenhügel ist durch ein Kieswerk abgebaut. In demvom ehemaligen westlichen Nethebogen (gestrichelte blaue Line) abgegrenzten Gebiet �Inder Dummen�; liegt auf der D−SAT−Aufnahme eine Vielzahl an Strukturen (Wüstung Ty-gerickessen?). Unten links ist nach H. G. Stephan die Wüstung des Dorfes Eggersen zu suchen,deren Reste in der D−SAT−Aufnahme sichtbar sind.
Seite 9 von 17
Abb. 6: Skizze der Strukturen der D−SAT−Aufnahmen des Nethe−-MündungsgebietesDiese Strukturen lassen sich beim Betrachten der entsprechenden D−SAT−Aufnahmen (TOP-WARE, Art. 641) erkennen.
1 = Bogenförmiger teilweise erhaltener Wall unbestimmter Zeitstellung,
2 = ovale Teilumrandung mit Innenstrukturen (ca. 18−20 ha Gröÿe) liegt nach derUrkataster−Karte von 1838 auf der Flur �Auf der Höhe!�,
3 = ovale Teilumrandung (ca. 10−12 ha Gröÿe) mit möglicher Innenstruktur in Formeines Flügelgebäudes,
4 = ovale Umrandung mit Strukturen in Form zweier Rechtecke,
5 = Strukturen am Steinberg, Gebäudefundamente,
6 und 7 = vermutlich Wüstungsreste des ehemaligen Dorfes Eggersen,
8 = vermutlich Wüstungsreste des ehemaligen Dorfes �Tygerickessen�,
9 = vermutlich Wüstungsreste des ehemaligen Dorfes Oldentorpe,
10 = nicht deutbare, sehr deutliche Groÿstruktur.
Diese D−Sat−Strukturen sind z.T. nur auf dem Monitor deutlich.
Seite 10 von 17
Abb. 7: Mögliches Lageroval auf bogenförmiger Niedertrasse an derNethemündungDie gestrichelte Linie gibt annähernd den Verlauf der ovalförmigen Struktur des möglichenLagers Nr. 3 (Abb. 6) auf der Niederterrasse über der Senke eines ehemaligen Weser−Altarms(rechts oben im Bild) wieder.
Abb. 8: Wesertalung auf der linken Weserseite bei LüchtringenVorne ist deutlich ein etwa sechs ha groes Oval erkennbar, das möglicherweise die Umrandungeines ehemaligen Lagers für eine Kohorte oder Ale des drusianischen Heeres gewesen seinkönnte.Luftbild von Alfons Koch, Fürstenberg
Seite 11 von 17
Abb. 9: Oval Nr. 2 im Gebiet der NethemündungDie hier rot dargestellten Teile einer groen ovalen Umrandung von etwa 18−20 ha Gröe aufder Urkatasterkarte von 1838 mit Innenstrukturen, die deutlich auf den D−SAT−Aufnahmensichtbar sind. Sie sind hier ebenfalls rot unterlegt und könnten ein Indiz für ehemalige Holz-bauten in einem Lager der Drususarmee sein. Das Drususheer lag den Sommer des Jahres 11v. Chr. an der Weser.
Seite 12 von 17
Mit der Digitalkamera erstellter Ausschnitt aus dem englischen Luftbild 3097, vom 22. 3.1945, Air Photo Archive, University Keele, England, vom Gebiet Wilhelmsberg, Schloss Neu-haus/Paderborn
Nachgezogene Strukturen möglicher Römerlager auf dem obigen Luftbildausschnitt:Ausgezogene Doppellinienstücke = heute noch vorhandene Doppelgrabenrestegestrichelte Linien = vermutlicher Verlauf der Gräben verschiedener Lagerdurchgezogene Geraden = Heerwegsverlauf.
Seite 13 von 17
Doppelgräben am Standort 1 (vgl. obiges Foto)
Abb. 10: Die �Ovale� vom Wilhelmsberg/Schloss NeuhausDiese ovalen Umrandungen sind auf den englischen Luftaufnahmen 3096 und 3097 vom März1945, teilweise auf den russischen D−SAT−Aufnahmen zu erkennen, aber auch in Restenals Doppelgräben heute noch zu sehen. Eine archäologische Untersuchung hat noch nichtstattgefunden.
Seite 14 von 17
Abb 11: Skizze von Umrissen von archäologisch dokumentiertenRömerlagern und von Strukturen auf D−SAT−AufnahmenLinke Skizzenhälfte: Umrisse von archäologisch dokumentierten Römerlagern aus der Dru-suszeit, von oben: Kops−Plateau in Nijmwegen, Kastell Beckinghausen/Oberaden, römischesBasislager Hedemünden, Versorgungslager Bad Nauheim/Rödgen.Rechte Skizzenhälfte: Umrissstrukturen auf D−SAT−Aufnahmen (TOP WARE, Art. 641),von oben: Tom Roden/Höxter, Wilhelmsberg in Schloss Neuhaus/Paderborn, Nethemündung(3), Nethemündung (2).
Seite 15 von 17
Abb. 12: Das Oval von WehrdenAuf der Urkataster−Karte von Wehrden unweit der Nethemündung ist eine ovale Flächeumrandet. Sie ist auf der entsprechenden D−SAT−Aufnahme an gleicher Stelle und in Restenim heute dort vorkommenden Wald zu sehen.
Seite 16 von 17
Abb. 13Reste des möglichen Lagerovals von ca. 6 ha Gröÿe auf dem westlichen Heggeberg von Wehr-den an der Weser. Der gut auf den D−SAT−Aufnahmen auszumachende Ringwall zeigt sichim Gelände als sehr �ache in der Basis etwa 10 m breite ovale Erhebung auf etwa zwei Drittelndes Gesamtovals.
Seite 17 von 17