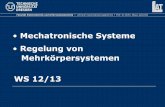Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II1 Systeme II – erste Vorlesung Lehrstuhl für...
-
Upload
jirgen-bogenrief -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
Transcript of Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II1 Systeme II – erste Vorlesung Lehrstuhl für...

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 1
Systeme II – erste Vorlesung
Lehrstuhl für KommunikationssystemeInstitut für Informatik / Technische Fakultät
Universität Freiburg2009

2
Vorlesung Systeme 1Lehrstuhl für KommunikationssystemeProf. Gerhard [email protected]
Assistenten:Dirk von Suchodoletz <[email protected]>Klaus Rechert <[email protected]>
Web:http://www.ks.uni-freiburg.de
Informationen zur Vorlesung:http://www.ks.uni-freiburg.de/php_veranstaltungsdetail.php?id=28

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 3
Vorlesung Systeme 1 – Organisatorisches
Vorlesung (wöchentlich) Montag und Mittwoch 14 – 16 Uhr (c.t.) Start: 20. April 2009 (heute) Hörsaal 026 im Gebäude 101 (Flugplatz) Klausur: 08.09.2009, 10.00 Uhr, angesetzt auf 90 Minuten
in den Hörsälen 026, 036, 010/14 Anmeldung für Klausur erforderlich (via Prüfungssystem)

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 4
Vorlesung Systeme 1 – Organisatorisches
Übung (ergänzend) Vorlesung teilweise ersetzt durch Doppelübung, siehe
Vorlesungsplan online Start: 29. April 2009 (nächste Woche, Mittwoch) Übungsräume -100/-101, Keller Rechenzentrum
(Institutsviertel, H.-Herder-Str. 10, Nähe Mensa, JVA) ~ 1 Übungszettel (theoretisch/praktisch) pro Woche

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 5
Übung (ergänzend) Teilnahme an Übungen nicht verpflichtend (kein
Eingangs- kriterium zur Klausurzulassung) Korrektur durch Tutoren Zentraler Termin zur Zettelrückgabe/Präsentation der
Ergebnisse je nach Bedarf (siehe Ankündigungen) direkt nach Vorlesung oder Übung
Bonussystem: Teilnahme ab 70% Gesamtpunktzahl (entspricht Klausurpunkte von 1/3 Note Verbesserung) bis 90% Gesamtpunktzahl (2/3 Note Verbesserung)
Vorlesung Systeme 1 – Organisatorisches

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 6
Medien
‣ PDF-Foliensätze• Teilweise/basierend auf Systeme II von Prof.
Schindelhauer• Siehe auch dessen Vorlesung von SS2008
‣ Lecturnity-Aufzeichnung (so sie gelingen)‣ Literaturhinweise
• Folgen gleich und auf der Web-Site zur Vorlesung
‣ Mailingliste (bei Bedarf / wird noch eingerichtet)• Für allgemeine Ankündigungen/Fragen&Antworten
‣ Übungszettel• Auf der angegebenen Web-Site (Download-Bereich)

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 7
Inhalte
‣ Einführung• Literatur, Beispiele• Referenzmodelle
‣ IP als zentrales Bindeglied‣ Aufbau dann lose dem Hauptwerk Kurose&Ross folgend

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 8
Inhalte
‣ Anwendungsschicht (Application Layer)‣ Transportschicht (Transport Layer)‣ Vermittlungsschicht (Network Layer)‣ Sicherungsschicht (Data Link Layer)‣ Mediumzugriffs-Steuerung
(Medium Access Control Sub-Layer - MAC)‣ Bitübertragungsschicht (Physical Layer)‣ Sicherheit in Netzwerken‣ Ausblick

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 9
Veranstaltungen im Bereich Netzwerke
Netzwerke I = Systeme II jeden Sommer Einführung in NetzwerkeEthernetGrundlagen des InternetsNetzwerke II = Communication Systems jeden Winter
ab nächstes Semester
WLAN, ISDN, Mobil-telefonie, UMTS, VoIP, u.v.a.
Vertiefung Netzwerke
z.B. Peer-to-Peer-NetzwerkeMobile Ad-Hoc-NetzwerkeInternet-SicherheitTelematik IV
jeden Sommer
Praktika, Projekte,Teamprojekte
z.B. Ad-Hoc-NetzwerkeWireless Sensor NetworksLocation Based Service
jeden Winter
SeminareBachelor-/Master-Arbieten
je nach Lehrstuhl,individuell
jedes Semester
forschungsnahe Arbeit

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 10
Motivation

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 11Systeme IISommer 2008
Internet 2007www.internetworldstats.com

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 12
Internet Wachstum von 2000-2007

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 13
Internet Datenmengen
‣ Monatlicher Datenverkehr weltweit• Minnesota Internet Traffic Studies:• 3000-5000 PB• 1 PetaByte = 1015 bytes
‣ Monatlicher Datenverkehr pro Kopf• Europa: 2,3 GB• Japan 2,6 GB• USA: 3 GB• Hongkong, Südkorea: 17 GB
‣ Jährliche Wachstumsrate• Weltweit: 50-60%

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 14
Literatur I
‣ Das primäre Buch zur Vorlesung:• Vorlesung folgt grob diesem
Ansatz• “Pflichtlektüre” (primäre
Angaben auf zu lesende Kapitel)
• Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the Internet, James F. Kurose, Keith W. Ross, Prentice Hall, Fourth Edition
• Mehrfach in der TF-Bibliothek/UB vorhanden

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 15
Literatur II
‣ Alternativlektüre zur Vorlesung• Computer Networks, Andrew S.
Tanenbaum (Prentice Hall)• Auch in Deutsch:
Computernetzwerke• Lange Zeit der Standard

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 16
Literatur III
‣ Zur Vertiefung• Klassiker: TCP/IP Illustrated,
Volume - The Protocols, W. Richard Stevens, Addison-Wesley
• Daneben inzwischen etliche weitere Bücher ...

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 17
Literatur IV
‣ Weiteres (Standard)Buch: • Data and computer
Communications• William Stallings• Pearsons, Prentice-Hall, 2007• In TF-Bibliothek vorhanden

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 18Systeme IISommer 2008
Rechnernetze und TelematikAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg
Christian Schindelhauer
Literatur V
‣ Weiteres Buch (älter):• Fred Halsal, Data
Communications, Computer Networks and Open Systems, Addison-Wesley, 1995

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 19
Das Internet
‣ ... ist das weltweite, offene WAN (wide area network) ‣ ... ist nicht das World Wide Web (WWW)‣ ... ist systemunabhängig (zentrale Idee)‣ Verbindet LANs (local area networks)‣ Keine zentrale Kontrolle‣ Konzepte von Robert Kahn (DARPA 1972)
• Jedes (lokale) Netzwerk ist autonom- arbeitet für sich - muss nicht gesondert konfiguriert werden für das WAN

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 20
Netzwerk offen für alle Architekturen
‣ Kommunikation nach “best effort”- schafft es ein Paket nicht zum Ziel, wird es gelöscht- es wird von der Anwendung wohl wieder verschickt werden
• Black Box Ansatz für Verbindungen- Black Boxes später umgetauft in Gateways und Routers- Paketinformation werden nicht aufbewahrt- keine Flußkontrolle
• Keine globale Kontrolle‣ Das sind die Grundprinzipen des Internet

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 21
Struktur-Vergleich
‣ Hierarchisches Telefon-Netzwerk ‣ Struktur des Internets

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 22
Originaldiagramme des “Ur-Internets”
Geschichte des Internets
‣ 1961: Packet Switching Theory • Leonard Kleinrock, MIT, “Information Flow in Communication Nets”
‣ 1962: Konzept des “Galactic Network”• J.C.R. Licklider and W. Clark, MIT, “On-Line Man Computer
Communication”‣ 1965: Erster Vorläufer des Internet
• Analoge Modem-Verbindung zwischen zwei Rechnern in den USA
‣ 1967: Konzept des “ARPANET”• Entwurfspapier von Larry Roberts
‣ 1969: Erster Knoten im “ARPANET”• an der UCLA (Los Angeles)• Ende 1969: vier Rechner verbunden

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 23
ARPANET
Wachstum ARPANET (a) Dezember 1969. (b) Juli 1970.(c) März 1971. (d) April 1972. (e) September 1972.

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 24
ARPANET
Zahl vernetzter Rechner (Internet): 1980: 14 (NSF-Net, USA) 1984: 1.000 1988: 60.000 1990: 300.000 1991: 700.000 1992: Millionengrenze 1997: 20 Millionen

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 25
NSFNET 1988

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 26
Architektur des Internet

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 27
Das BelWue(Landes-
netz)

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 28
Das Deutsche Forschungs-
netz (~ 2001)

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 29
Internet 2000 - Autonome SystemeQuelle:netdimes.org

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 30Systeme IISommer 2008
Rechnernetze und TelematikAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg
Christian Schindelhauer
Das Internet 2006Autonome Systeme
30
Quelle:netdimes.org

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 31
Das Internet 2006IP Routers
netdimes.org
Netzwerkmodelle / Formalisierung Im Netzwerkbereich typischerweise Schichtenmodelle
Komplexe Kommunikationsrealität wird in überschaubare Teile aufgegliedert
Schichten als Gesamheit sind einfacher zu betrachten Konzentration auf jeweilige Aufgaben

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 32
Das Internet 2006IP Routers
netdimes.org
Netzwerkmodelle Idee/Merkmale im Schichtenmodell
Beide Kommunikationspartner je gleich hoch auf einem Schichtenstapel
Inhaltliche Kommunikation auf der gleichen Schicht statt Jeweils durch geeignete Protokolle gesteuert →
Protokollstapel (protocol stack) Physische Kommunikation in der Vertikalen statt, dabei an
Übertragungsmedium gebunden: elektrische Signale, Funk- und Lichtwellen

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 33
Das Internet 2006IP Routers
netdimes.org
Netzwerkmodelle Jede Schicht bietet über wohl definierte Schnittstellen nach
oben Dienste an und jede Schicht beansprucht von unten Dienste
Jede Schicht versteckt die Komplexität der unteren Schichten für die darüber liegenden
Jede Schicht ist für die darüber liegende eine virtuelle Kommunikationsmaschine
Kommunikation nach unten: jede Schicht hat die Aufgabe ein Bündel binärer Signale von oben in Empfang zu nehmen
Dem Bündel werden einige Daten angebunden oder eingewickelt (Kapselung) und dann nach unten gesendet
Nach oben: ein empfangenes Bündel wird ausgepackt und nach oben gesendet

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 34
Das Internet 2006IP Routers
netdimes.org
Netzwerkmodelle Begriffe für die Datenbündel: Pakete (packets),
Datengramme (datagrams), Zellen (cells) Ein Bündel kann von Daten eingehüllt werden: Rahmen
(frames) mit Kopfteil (header) und Schwanzteil (trailer) Das Schichtenmodell stammt von der ISO/OSI von 1977
Ziele der sieben-schichtigen Kommunikations-Architektur Ablösung/Integration der herstellerabhägigen Protokollstapel Kommunikation in heterogenen Umgebungen Spezifizierung einer offenen, herstellerneutralen und kon-
kurrenzfreundlichen Kommunikationswelt OSI-Modell legt keine detaillierte Netzwerkarchitektur fest
sondern sellt einen Rahmenstandard dar

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 35
Das Internet 2006IP Routers
netdimes.org
ISO/OSI Modell
Schichten 5 bis 7 regeln die Anwendung der Daten
→ finden üblicherweise innerhalb einer Anwendung statt
Schichten 1 bis 4 regeln das Transportswesen
(Implementation in der Netzwerkhardware oder im Betriebsystem)

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 36
Informatik IIIWinter 2007/08
Rechnernetze und TelematikAlbert-Ludwig-Universität Freiburg
Christian Schindelhauer
Das ISO/OSI Referenzmodell
‣ 7. Anwendung (Application)• Datenübertragung, E-Mail, Terminal, Remote login
‣ 6. Darstellung (Presentation)• Systemabhängige Darstellung der Daten (EBCDIC/ASCII)
‣ 5. Sitzung (Session)• Aufbau, Ende, Wiederaufsetzpunkte
‣ 4. Transport (Transport)• Segmentierung, Stauvermeidung
‣ 3. Vermittlung (Network)• Routing
‣ 2. Sicherung (Data Link)• Prüfsummen, Flusskontrolle
‣ Bitübertragung (Physical)• Mechanische, elektrische Hilfsmittel

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 37
ISO/OSI Schicht 7
7. Anwendungsschicht• Große Vielfalt aller möglichen Funktionen, z.B.
- Virtuelle Terminals- Filetransfer (FTP), HTTP- E-mail (SMTP)- Video- Radio- Spiele ...
• Anwendungen verfügen über eine Programmierschnittstelle, um sie plattformspezifischen der Anwendungsprogrammierung zugänglich zu machen

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 38
ISO/OSI Schicht 6
6. Präsentationsschicht• Anpassung von Kodierungen, • z.B. Zeichensätze, Namen, Addressfelder, Formulare, etc.• Daten erhalten eine universelle Form• “Gemeinsame Sprache” damit die Übertragbarkeit zwischen
unterschiedlichen Plattform möglich ist: ASCII oder Unicode, Kodierung negativer Ganzzahlen als Einer- oder Zweierkomplement, ...
• Übernimt auch Datenkompression, Ver- und Entschlüsselung• Auf dieser Schicht (sowie 7) arbeiten die Betriebssysteme

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 39
Informatik IIIWinter 2007/08
Rechnernetze und TelematikAlbert-Ludwig-Universität Freiburg
Christian Schindelhauer
ISO/OSI - Schicht 55. Sitzungsschicht
• Festlegung der Sitzungsart, z.B.- Dateitransfer, Einloggen in ein entferntes System
• Dialogkontrolle- Falls Kommunikation immer nur abwechselnd in einer
Richtung geht, regelt die Richtung die Sitzungsschicht• Token Management
- Falls Operationen nicht zur gleichen Zeit auf beiden Seiten der Verbindungen möglich sind, verhindert dies die Sitzungsschicht
• Synchronisation- Checkpoints zur Wiederaufnahme abgebrochener
Operationen nach Ausfall (z.B. Filetransfer)

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 40
Informatik IIIWinter 2007/08
Rechnernetze und TelematikAlbert-Ludwig-Universität Freiburg
Christian Schindelhauer
ISO/OSI - Schicht 4
4. Transportschicht• Unterteilung der Daten aus der Sitzungsschicht in kleinere
Einheiten (Pakete)• In der Regel Erstellung einer Transportverbindung für jede
anfallende Verbindung• Möglicherweise auch mehrere Transportverbindungen zur
Durchsatzoptimierung• Art der Verbindung
- fehlerfrei, logische Punkt-zu-Punkt (z.B. TCP)- fehlerbehaftet, Unidirektional (z.B. UDP)- Multicasting (einer an viele)- Broadcasting (einer an alle)
• Multiplexing: Zu welcher Verbindung gehört dieses Paket• Flusskontrolle: Wieviele Pakete können/sollen versendet
werden (ohne das Netzwerk zu überfordern)

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 41
Informatik IIIWinter 2007/08
Rechnernetze und TelematikAlbert-Ludwig-Universität Freiburg
Christian Schindelhauer
ISO/OSI - Schicht 3
3. Vermittlungsschicht• Packetweiterleitung (packet forwarding)• Routenermittlung/Wegewahl der Pakete (route
detection)• Kontrolle von Flaschenhälsen (bottleneck) in der
Wegewahl• Abrechnung der Pakete (Abrechnungssystem)

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 42
Informatik IIIWinter 2007/08
Rechnernetze und TelematikAlbert-Ludwig-Universität Freiburg
Christian Schindelhauer
ISO/OSI - Schicht 2
2. Sicherung (Data Link Layer)– Bereinigung von Übertragungsfehler– Daten werden in Frames unterteilt mit
Kontrollinformation (z.B. Checksum)
– Bestätigungsframes werden zurückgesendet– Löschen von Duplikaten– Ausgleich schneller Sender - langsamer
Empfänger (Flusssteuerung)– Lösung von Problemen beim Broadcasting
• Zugriff auf gemeinsames Medium = Mediumzugriff (medium access control = MAC)

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 43
Informatik IIIWinter 2007/08
Rechnernetze und TelematikAlbert-Ludwig-Universität Freiburg
Christian Schindelhauer
ISO/OSI - Schicht 1
‣ Bitübertragung (Physical)• Übertragung der reinen Bits• Technologie (elektronisch/Licht)• Physikalischen Details (Wellenlänge, Modulation)• Nur hier Teinehmer eigentlich gekoppelt• Transport ist ungesichert• Daten können unterwegs auch vom analogen in ein
digitales Format umgewandelt, vom eletrischen Leiter in den optischen übertragen werden

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 44
Informatik IIIWinter 2007/08
Rechnernetze und TelematikAlbert-Ludwig-Universität Freiburg
Christian Schindelhauer
ISO/OSI - Zusammenfassung

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 45
OSI versus TCP/IP
Tanenbaum

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 46
TCP/IP-Schichtenmodell‣ 1. Host-to-Network
• nicht spezifiziert, hängt vom LAN ab, z.B. Ethernet, WLAN 802.11b, PPP, DSL
‣ 2. Vermittlungsschicht (IP - Internet Protokoll)• Spezielles Paketformat und Protokoll• Paketweiterleitung• Routenermittlung
‣ 3. Transportschicht• TCP (Transport Control Protocol)
- zuverlässiger bidirektionaler Byte-Strom-Übertragungsdienst- Fragmentierung, Flusskontrolle, Multiplexing
• UDP (User Datagram Protocol)- Paketübergabe an IP- unzuverlässig, keine Flusskontrolle
‣ 4. Anwendungsschicht• zahlreiche Dienste wie TELNET, FTP, SMTP, HTTP, NNTP
(für DNS), ...

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 47
Anwendung Application Telnet, FTP, HTTP, SMTP (E-Mail), ...
Transport TransportTCP (Transmission Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
Vermittlung NetworkIP (Internet Protocol)+ ICMP (Internet Control Message Protocol)+ IGMP (Internet Group Management Protocol)
Verbindung Host-to-Network LAN (z.B. Ethernet, Token Ring etc.)
Das Internet 2006IP Routers
netdimes.orgSchichtung des Internets - TCP/IP-Layer

Lehrstuhl für Kommunikationssysteme - Systeme II 48
Das Internet 2006IP Routers
netdimes.org
Ende erste Vorlesung
Nächste Vorlesung am Mittwoch an diesem Ort, gleiche Zeit: Einführung IP (Vermittlungsschicht)
Alle relevanten Informationen auf der Webseite zur Vorlesung: http://www.ks.uni-freiburg.de/php_veranstaltungsdetail.php?id=28
Zu lesen: Einführungskapitel der angegebenen Literatur!