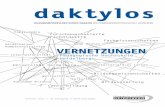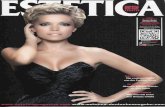Methoden in der Fremdsprachenforschung – ein kurzer ... · PDF fileW. Dilthey, H.-G....
Transcript of Methoden in der Fremdsprachenforschung – ein kurzer ... · PDF fileW. Dilthey, H.-G....

Gerald Schlemminger
Methoden in der Fremdsprachenforschung
– ein kurzer Überblick – in: Karlsruher Pädagogische Beiträge Nr. 57, 2004, S. 20- 34.
Ich möchte in diesem Vortrag zunächst kurz die Entwicklung und die wichtigsten methodischen
Ansätze vorstellen, die zur Untersuchung eines institutionell gesteuerten Fremdsprachenerwerbs
beitragen. Dann werde ich auf eigene Forschungsmethodik eingehen.
1. Entwicklung der Fremdsprachdidaktik zu einer Forschungsdisziplin
„Fremdsprachendidaktik ist die Wissenschaft vom Lehren und Lernen fremder Sprachen in jeglichem institutionellen Zusammenhang […].“
Diese etwas lapidare Feststellung von H. Christ / W. Hüllen (1995:1) im Handbuch zum
Fremdsprachenunterricht deckt eine komplexe Geschichte einer jungen Forschungsdisziplin ab.
Die Wissenschaft, die sich zuerst mit fremder Sprache und Kultur beschäftigte, war zunächst die
Philologie. In diachronisch vergleichenden Studien versuchte sie, die Entwicklungsgesetze einer
Sprache darzulegen. Bei der synchronen Betrachtung von literarischen Werken benutzte sie
hermeneutische Texterschließungsverfahren. Diese begründen in der Auseinandersetzung mit
Historismus und Positivismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts die moderne Literaturwissenschaft.
W. Dilthey, H.-G. Gadamer, P. Ricueur u.a. sind auch für die einzelnen Fachwissenschaften
Anglistik, Romanistik usw. die Bezugsgrößen. Mit dem epistemologischen Neuansatz des
Strukturalismus etabliert sich die Linguistik als Wissenschaftsdisziplin. Die ersten Lehrstühle
werden in Europa in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts eingerichtet.1 In den 60er Jahres
lösen sich die Landes- und Kulturstudien von der Philologie und der Literaturwissenschaft und
konstituieren sich zu einem eigenen wissenschaftlichen Paradigma, der Landeskunde.2
Zwar wird sich seit der neusprachlichen Reformbewegung zu Ende des 19. Jahrhunderts (u.a. W.
Viëtor) verstärkt und systematisch mit den Inhalten und den Methoden der
Fremdsprachenvermittlung auseinandergesetzt (vgl. C. Puren (1988), aber die wissenschaftlichen 1 Der erste Linguistenkongress tagt 1929 in Den Haag. 2 Vgl. dazu u.a. die Darstellungen von R. Hillgärtner (1976) zur Entwicklung der Anglistik ; zur Romanistik siehe
u.a ; H.-J. Lüsebrink (1993).

2 / 14
Weihen als autonome Disziplin ließen lange auf sich warten. Die „Neusprachendidaktik“ bzw. ab
1950 die „Fremdsprachendidaktik“ stand lange Zeit unter einem stark normativen
Selbstverständnis. Bei den ersten Feldstudien herrschten zunächst empirisch beobachtende
Methoden, die in der hermeneutischen Tradition stehen, vor. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts setzen
sich mit der Fehlerdiagnostik, Sprachstandserhebung, und systematischer Unterrichtsbeobachtung
empirisch-datenerhebende Ansätze durch. Die ersten Lehrstühle (seit 1960) sind aber nicht in der
jeweiligen Wissenschaftsdisziplin, sondern an den Pädagogischen Instituten, bzw. in den
Erziehungswissenschaften angesiedelt.
Mit der Verwissenschaftlichung der Methoden in den jeweiligen Fachrichtungen (Anglistik,
Romanistik…) und in den Bezugswissenschaften (Linguistik, Psychologie,
Sozialwissenschaften…) erheben seit ca. 1970 eine Anzahl von Konkurrenzdisziplinen auch einen
Anspruch auf die Fremdsprachendidaktik, wie die angewandte Linguistik, die Psycholinguistik,
die Zweitsprachenerwerbsforschung, die Sprachlehrforschung… In der Tat hat jeder dieser
Bereiche zu einer genaueren Definition des Forschungsgegenstands, zur Präzisierung des
methodischen Vorgehens, der Hypothesenbildung, zu einer stärker empirisch orientierten
Herangehensweise beigetragen. Besonders die Auseinandersetzung mit der Sprachlehr- und -
lernforschung zwischen 1970 und 1980 hat einerseits dazu geführt, den gesteuerten
Fremdsprachenerwerb als einen interdisziplinären, multifaktorell geprägten
Forschungsgegenstand zu beschreiben. Anderseits ermöglichte dieser Einfluss eine
Weiterentwicklung geeigneter methodischer Ansätze1.
Seit 1980 arbeiten Fremdsprachendidaktiker und Sprachlehrforscher gemeinsam an Projekten.
Das findet seinen Ausdruck in der sog. jährlichen „Frühjahrskonferenz zur Erforschung des
Fremdsprachenunterrichts“ und ihren Veröffentlichungen sowie in den Kongressen und Arbeiten
der Gesellschaft für Fremdsprachenforschung.
2. Forschungsmethoden und deren methodologischen Probleme
Auch in der Fremdsprachendidaktik unterscheidet man gemeinhin zwei
forschungsmethodologische Ansätze: (a) die analytisch-nomologische Methodologie und (b) die
explorativ-interpretative Methodologie. Erste unternimmt die „Prüfung von Gesetzeshypothesen
(nomologische Hypothesen) mit dem Ziel der Theoriekonstruktion“ (R. Grotjahn 1995:458). Für
letztere ist vor allem ein interpretatives, hermeneutisches Verfahren kennzeichnend. Sie hat zum 1 Koordinationsgremium im DFG-Scherpunkt « Sprachlehrforschung » (Hrsg.): (1977), (1983).

3 / 14
Ziel, durch Exploration eines Realitätsausschnitts Hypothesen erst aufzubauen (vgl. R. Grotjahn
1995:458). Zu diesem Ansatz zählen ethnographisch orientierte Methoden mit teilnehmender
Beobachtung, Aktionsforschung / Handlungsforschung usw.
2.1 Methodologische Fragenstellungen
Trotz methodologischer Differenzen ist beiden Forschungsansätzen die Einhaltung
wissenschaftlicher Gütekriterien, sowie ein gemeinsames Verständnis wissenschaftstheoretischer
Konzepte und Vorannahmen gemeinsam1, wie wir es im Folgenden kurz an einigen
Fragestellungen darlegen werden2.
• Empiriebegriff: Ist die Empirie die Grundlage für induktiv zu gewinnende
Verallgemeinerungen von Erfahrungen (z.B. über Unterrichtsbeobachtungen) oder ist die
Empirie die Grundlage, um bereits bestehende Hypothesen und Theorien zu überprüfen?
(vgl. R. Grotjahn 1995:458)
• Wahrheitsfindung: Leitet sich die Wahrheitsfindung von den ontologischen Qualitäten des
Gegenstandes ab oder ergibt sie sich aus dem kognitiven Operieren des Forschers?
• Anthropologische Vorannahmen: In wieweit werden anthropologische Vorannahmen
(implizites Lernmodell, Handlungsmodell usw.) explizit in Bezug zu ihren
untersuchungsmethodischen Konsequenzen gestellt? (vgl. dazu R. Grotjahn 2000 und A.
Faustmann 1994)
• Hypothesenüberprüfung: Wie wird der Tatsache Rechnung getragen, dass wir die Realität
also solche nicht beobachten können, sondern diese immer schon durch unseren Hypothesen
und Untersuchungsmethoden beeinflusst ist?
• Validität der Untersuchung: Durch welches methodische Vorgehen wird gewährleistet,
„dass der in der Hypothese formulierte Sachverhalt auch in der Realität zutrifft“?
(R. Grotjahn 2000:22)
• Reliabilität: Wie wird erreicht, dass die Datenerhebungs- und Messverfahren so genau sind,
dass die Ergebnisse repräsentativ und generalisierbar sind, bzw. die Untersuchung potentiell
reproduzierbar ist?
• Wie wird Standardisierung und Variablenkontrolle sichergestellt?
1 Vgl. die Diskussion in : A. Müller-Hartmann / M. Schocker- v. Ditfurth (Hrsg.) (2001) und in K. Aguado (Hrsg.)
(2000): 2 Vgl. R. Grotjahn (1995), (2000), G. Henrici (2000), A. Müller-Hartmann (2001), G. Schlemminger (2003).

4 / 14
• Triangulation: In wieweit wird durch Triangulierungsverfahren die Zuverlässigkeit der
Ergebnisse gefördert (Datentriangulierung, Methodetriangulierung,
Untersuchungstriangulierung, Thoerietriangulierung)?
2.2 Einige Forschungsvorhaben, die auf empirischer Datenerhebung basieren
Wir beschränken uns hier auf die Vorstellung einiger exemplarischer Forschungsdesigns, die im
Bereich des Bilingualen Lehrens und Lernens – unserer eigenen Forschdomäne – maßgebend
sind.
• Hier sind zu nennen die Untersuchungen zum Lauterwerb, zum Lexikerwerb usw. im
bilingualen Kontext Englisch im Kindergarten, durchgeführt im „Zentrum für
Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt“ der Christian-Albrechts-Universität (Kiel)1. Es geht
darum, Gesetzmäßigkeiten in der bilingualen Sprachentwicklung aufzudecken, mit dem
Ziel, eine Theorie des (natürlichen) bilingualen Spracherwerbs aufzubauen. Dieser Ansatz
steht in der Tradition der Zweitsprachenerwerbsforschung.
• Auf dem Gebiet der empirischen Sozialforschung liegen Untersuchungen zum
Bilingualismus – auch im Vorschulbereich – von N. Huppertz der Pädagogischen
Hochschule Freiburg vor (vgl. N. Huppertz 2002, N. Huppertz Hg., 2002). Er deckt die
(Rahmen-) Bedingungen für ein erfolgreiches bilinguales Lernen von Englisch und
Französisch auf.
• Im Bereich der Lehrer- und Lernerforschung ist der Forschungsansatz der subjektiven
Theorien zu nennen. Er greift auf die didaktischen Alltagsvorstellungen der Lerner (und
Lehrpersonen) zurück, um die ablaufenden Lernprozesse besser zu verstehen, mit der
Absicht, die Methodik und die Didaktik des bilingualen Sachfachunterrichts weiter zu
entwickeln (z.B. C. Meyer 2003, B. Viebrock 2003).
• In der Erforschung von kognitiven Aspekten der Lernprozesse sind u.a. die Untersuchungen
von H. J. Vollmer zu den Verarbeitungsprozessen bei der Lösung von Fachaufgaben und
dem Aufbau von Konzepten im bilingualen Geschichtsunterricht sowie die Arbeiten zum
Fremdverstehen von D. Klose (G. Blell / D. Klose 2002) zu erwähnen. Letztere versucht im
Rahmen von sog. Feldstudien (hauptsächlich über Dilemmasituationen) Lernstrategien zum
Aufbau von Fremdverstehen im bilingualen Geschichtsunterricht aufzudecken.
1 H. Wode/ C. Berger / S. Klust / G. Tonn (2001), H. Wode / S. Devich-Henningsen / U. Fischer / V. Franzen / R.
Pasternak (2002), H. Wode / U. Fischer / V. Franzen / R. Pasternak (2002).

5 / 14
• Im Rahmen eines Praxisforschungsprojekt untersuchen S. Schauwienold-Rieger (2001,
2003) und A. Münst die Bedingungen für ein bilinguales Lehramtsstudium an der
Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.
• Die Diskursanalyse von bilingualem Lehen und Lernen werde ich anhand eigener Vorhaben
(siehe auch G. Schlemminger 2003 a, 2003 b) im Weiteren vorstellen.
3. Eigenes Forschungsdesign: die Diskursanalyse im bilingualen
Fremdsprachenunterricht
Wir beziehen uns auf den Begriff des „funktionalen Bilinguismus“. Soziolinguistisch heisst das,
dass sich die untersuchten Personen – SchülerInnen in Baden-Württemberg – in einem
monolingualen Umfeld befinden. Mit der im Schuljahr 2003-04 stattfindenden, flächendeckenden
Einführung der Fremdsprachen Englisch oder Französisch ab Klasse 1 geht auch ein neues
Konzept von Zweisprachigkeitserziehung einher. Es wird ein funktionaler Zusammenhang von
Sach- und Sprachunterricht hergestellt. In diesem Ansatz werden Elemente des Sachfaches,
welche die SchülerInnen bereits in der Muttersprache behandelt haben, in der Fremdsprache
wieder aufgenommen. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem „funktional-bilingualen
Sprachmodell“. Es bedeutet im methodisch-didaktischen Bereich einen Paradigmawechsel, der
sich auch auf die LehrerInnenausbildung auswirkt1.
3.1 Diskursanalyse als fremdsprachenerwerbsspezifische Interaktionsanalyse
Unser Forschungsansatz, die fremdsprachenerwerbsspezifische Interaktionsanalyse2, hat in der
Sprachlehrforschung, besonders im Rahmen der Interimssprachenforschung, eine lange Tradition.
Bezogen auf bilinguales Lehren und Lernen liegen hauptsächlich Analysen zum Sprachwechsel
vor3. Erst jüngere Arbeiten aus dem französischsprachigen Raum (Kanada, Schweiz, Frankreich)1
1 Zum Bildungsplan der Frühfremdsprachenunterrichts, wo u.a. diese Positionen entwickelt werden, vgl.:
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2001); zu weiteren Ausführungen, siehe auch S. Schauwienold-Rieger (2003), G. Schlemminger (2003 c).
2 Die Begrifflichkeit ist etwas schwankend. Im Deutschen ist er oft deckungsgleich mit dem Terminus „fremdsprachenerwerbsspezifische Diskursanalyse“; im Englischen findet der Begriff „Classroom interaction studies“ und im Französischen „Analyse interactionnelle (de la classe de langue) Anwendung.
3 M. Martin-Jones (2000) gibt eine Übersicht zu den empirischen Forschungen in Bilingualklassen; es handelt sich hierbei fast ausschließlich um angloamerikanische Arbeiten. Für den deutschsprachigen Bereich sind u.a. W. Butzkamm (o.J. [1996]), J. Vögeding (1995), Jannis Androutsopoulos / Volker Hinnenkamp (2001), S. Ehrhart (2003 a), J. Rymarczyk (2003) und G. Schlemminger (2003 a) zu nennen.

6 / 14
setzen auch andere Analyseschwerpunkte; sie richten ihr Augenmerk insbesondere auf Sprach-
und Sachfacherwerbsinteraktionen.
In der Diskursanalyse besteht das Datenmaterial aus der Transkription von verbalen und
nonverbalen Unterrichtsabläufen. Hierbei gehen wir von einer Typologie möglicher
Interaktionssequenzen in gesteuerten Lernsituationen aus. Explorative Studien2 haben grob sechs
verschiedene Interaktionstypen herausgearbeitet (siehe Tabelle 1).
Unsere Untersuchungsmethode besteht nun darin, die Interaktionen auf ihre Funktion im
Unterrichtsgeschehen zu analysieren und im Besonderen den Stellenwert von sprach- und
wissenerwerbsfördernden Sequenzen und ihre Rolle im kognitiven Lernprozess hervorzuheben.
Unter erkenntnistheoretischer Sicht handelt es sich jedoch bei den Interaktionstypen nicht um
Axiome, die den Charakter tragen: Wenn ‘x’ dann ‘y’, also um logische Ableitungen linear
kausaler Bestimmungen. Die Interaktionstypen stellen also im engeren Sinne keine Hypothesen
deskriptiver Art dar, die sich im Popperschen Sinne ggf. auf ‘wahr’ oder ‘falsch’ überprüfen
ließen.
Wie häufig in der Didaktik haben wir es hier mit einem anderen Typus von Aussagen zu tun:
Wenn du ‘a’ als Verhalten erreichen willst, dann tue ‘b’. Wie P. Portmann-Tselokas - (1997 :
217) schreibt: “Der Zusammenhang von ‘a’ und ‘b’ wird nicht behauptet, sondern vorausgesetzt;
zur Sprache kommt [hier] eine Mittel – Zweck – Relation […].” Es handelt sich hiermit um
präskriptive Annahmen, bei denen es weniger um die Frage nach ‘richtig’ oder ‘falsch’ geht,
sondern um die der Effizienz, um den besten Weg, das angestrebte Ziel optimal zu erreichen. Wir
sind also hier strictu sensu nicht in einem empirischen Forschungsdesign.
Tabelle 1: Übersicht die häufigsten Interaktionstypen
Typus Interaktionsschema Funktion im Unterrichts-geschehen / Erwerbsprozess
1 Zu erwähnen sind hier u.a. P. Bange (1992 a), (1992 b), L. Gajo / C. Serra (1998), S. Sibon (1998/1999), M.-T.
Vasseur (2000), B. Py (2000), Gajo (2001), C. Springer (Hg.) (2001), F. Cicurel (2002), D. Moore / D. Lee-Simon (2002), M. Farco (2002).
2 Siehe Anmerkung 1. H. Mehan (1985), G. Henrici (1995), L. Gajo / C. Serra (1998, K. Lochmann (2002). Hierbei handelt es sich nicht immer um Interaktionsanalysen in Klassen mit bilingualen Lehren und Lernen. Die von diesen Forschern entwickelte Interaktionstypen lässt sich doch auf bilingualen Unterricht übertragen.

7 / 14
1 Aufgaben – Lö-sungsabfolge 1 [Initiation + response + feedback (IRF) / Séquence interactive d’élicitation]
• Lehrerinitiative • Lernerreplik • Lehrer-Auswertung der
Angmessenheit der Schüler-Replik
• ev. lehrerinitiierte Wiederholung durch den Lerner
• lehrerzentrierte Sequenz, mit dem Ziel der Organisation und Vermittlung von Wissen
2 wissenserwerbs-fördernde Sequenz [Knowledge acquisitional sequence / séquence potentiellement acquisitionnelle (SPA)]
Typ A: (Autostrukturierung) • (nicht erfolgreicher) Versuch
des Lerners, Wissen selbst zu strukturieren
• Stützung durch den Lehrer • selbständiges Wieder-
aufgreifen durch den Lerner • ev. Lehrerbestätigung Typ B: (Heterostrukturierung) • Lehrerangebot an Stützung • Annahme des Angebots
durch den Lerner • Stützung durch den Lehrer • selbständiges Wieder-
aufgreifen durch den Lerner • ev. Lehrerbestätigung
• lernerinitiierte Sequenz, mit dem Ziel, dem Lerner bei der Organisation, Vermittlung und Aufnahme von Wissen zu unterstützen
3 Korrektur-sequenz 2 [Corrective sequence / séquence de correction]
• Lerneräußerung mit inhaltlicher Fokalisierung
• lehrerinitiierte (oft formal orientierte) Intervention
• ev. lehrerinitiierte Wiederholung durch den Lerner
• lernerinitiierte Sequenz, mit dem Ziel, formale / inhaltliche Aspekte klar zu stellen.
4 Bi-Fokussierung3 [Bifocalisation / bifocalisation / double énonciation4]
(es liegt kein einheitliches Schema vor)
• die Hauptaufmerksamkeit der beiden Sprecher liegt auf dem inhaltlichen Aspekt der Kommunikation,
• treten bei der Organisation, Koordination und Durchführung der Kommunikationshandlung Probleme auf, so wird auf diese eine periphere Aufmerksamkeit gerichtet.
5 Metasequenz [Metalinguistic sequence /
(es liegt kein einheitliches Schema vor)
• eindeutige Fokussierung auf den Kommunikationsablauf und / oder den Handlungs-ablauf und
1 Siehe dazu schon J. Wagner (1983). 2 Vgl. dazu: K. Lochmann (2002) und L. Gajo (2001 : 211). 3 Vlg. auch P. Bange (1992 : 56). 4 Der erste Begriff wird für die natürliche Kommunikation zwischen Muttersprachler und Nichtmuttersprachler
benutzt, der zweite eher für die gesteuerte fremdsprachliche Kommunikation in der Schule.

8 / 14
séquence méta-linguistique]
den Problemen, die dort auftreten, mit dem Ziel, diese zu beseitigen
6 Begleitdiskurs 1 [Accompanying discourse / séquence latérale]
(es liegt kein einheitliches Schema vor)
• Störung und Behinderung des Interaktionsablauf, so wie ihn der sog. pädagogische Vertrag zwischen Lehrer und Schülern – implizit oder explizit – festlegt.
3.2 Exemplarische Fallanalyse
An zwei ausgewählten Beispielen soll unsere Methode exemplarisch dargestellt werden.
Beispiel 1: 4. Klasse: La galette (Korpus GS 2002,3)2
1 L Vous vous rappelez *de la crêche ? 2 S (mehrere nicken) 3 L Quels animaux y-a-t-il? 4 S1 la vache 5 L oui. 6 S2 l’âne 7 S3 le mouton 8 9
L (kopfnicken) … Qui sont les rois mages ? (zeigt auf Figurinen, die sie an die Tafel gehängt hat)
10 S4 Balthazar, *Kaspar et Melchior. 11 S5 (an S4) Woher kennst du die? 12 S4 Aus der Kirche. 13 14 15
L Les rois arrivent pour la naissance de Jésus. Les rois arrivent pour offrir un *don à Jésus. Les rois apportent *l’or, *la myrrhe et *l’encens.
Der Interaktionsablauf 1 – 10 ist ein typisches Beispiel für den sog. fragenentwickelnden
Unterricht im Bereich Fremdsprachen: Die Schüler reagieren verbal auf Lehrerfragen; die
Lehrperson validiert die Aussagen verbal oder nonverbal. In dieser Interaktion handelt es sich
jedoch nicht um den Sprachakt „Fragen“ im eigentlichen Sinne, da es der Lehrperson nicht um
1 Siehe dazu B . Götz (1994). 2 Der Corpus dieser Beispiele besteht aus Transkripten von Unterrichtsaufzeichnungen aus Französischstunden an
Grundschulen im Bundesland Baden-Württemberg aus den Jahren 2001, 2002, gekennzeichnet durch GS2001… usw.)
Transkriptionszeichen : L = LehrerIn; S = SchülerIn, * = sprachlich nicht korrekt.

9 / 14
eine inhaltliche Abklärung von Ungewissheiten geht. Im konkreten Fall steht eine
Wiederaufnahme von früher Gelerntem an. Die Lehrperson möchte sich dessen absichern.
Als Wiederholungsphase mag dieser Interaktionstypus seine Berechtigung haben; als Strategie für
den Erwerb von Wissen (über Sprache und / oder über Sachwelt) hat diese Art von Maieutik ihre
Grenzen, da sie einem stark behavioristischen Lernansatz verfolgt und Wissen nicht prozesshaft
entwickelt und aufbaut.
Mit der Interaktion (9 L) arbeitet die Lehrperson zwar immer noch nach dem Aufgaben–
Lösungsmuster, nimmt aber einen Fokuswechsel vor, indem sie von der formalsprachlich-
lexikalischen Ebene zur Inhaltsebene übergeht. Da die Frage ein gewisses Kulturwissen
voraussetzt, ist es nicht unbedingt zu erwarten, dass Grundschüler die Namen der drei Könige
kennen, zumal in dieser Klasse, wo viele Kinder anderer – auch nicht christlicher – Kulturen sind.
Schüler (S4) kann sie aber benennen und antwortet. An diese Sequenz schließt sich eine
schülerinitiierte Interaktion an. Der Schüler (S5) scheint so stark motiviert zu sein, dass er sich im
Gesprächsschritt (11 S5) direkt an seinen Mitschüler (S4) wendet.
Diese Aktionsabfolge mag daraufhin deuten – weitere Untersuchungen müssten dies belegen –,
dass Schüler – gerade in der unterrichtsbezogenen Interaktion untereinander – eher auf die soziale
Gruppe bezogene oder inhaltlich orientierte Gesprächsanlässe reagieren, bzw. diese initiieren und
hier interaktiv tätig werden. (Die Intervention des Schülers S5 lässt sich mit beiden Argumenten
begründen.) In formalsprachlich fokussierten Gesprächshandlungen dagegen ist eher ein passives
Verhalten zu erwarten.1
Beispiel 2: 4. Klasse: Quoi? (Korpus GS 2002,10)
1 S1 Ich versteh die nicht. 2 S2 Du musst immer sagen *<kva>, *<kva>.
Dann wiederholt sie immer. 3 S1 (für sich): *<kva>.
Die deutsche Klasse ist zu Besuch im Elsass bei ihrer französischen Korrespondenzklasse, die
‘Frühdeutsch’ lernt. Dieses Gespräch zweier deutscher Schüler findet in der Mittagspause nach
dem gemeinsamen Sportfest statt. Schüler (S1) hat offensichtlich Schwierigkeiten, sich mit den
französischen Kindern erfolgreich zu verständigen und wendet sich an einen Mitschüler (S2).
Dieser hatte – wie sich in dieser Interaktion zeigt – scheinbar wirksamere
1 Auf das Code-Switching und seine Funktion in dieser Sequenz gehe ich in G. Schlemminger (2003 b) näher ein.

10 / 14
Verständigungsstrategien angewandt. Da er das Fragewort „Quoi ?“ nicht im
Französischunterricht gelernt hat (dort wurde das Standardfranzösisch wie „Pardon ?“ „s’il vous
plaît“ usw. vermittelt), muss er es sich im Laufe des Vormittags angeeignet haben. Es ist zu
vermuten, dass er versucht hat, mit den Franzosen Deutsch zu sprechen. Diese werden ihm mit
Unverständnis ein „Quoi ?“ entgegen gesetzt haben. Der Schüler (S2) hat dieses Lexem
situationsgerecht übernommen und dessen Aussprache an die seiner Muttersprache angepasst:
<kva> statt <kwa>. Diese Lernfahrung hat er in eine Sprachlernstrategie umgesetzt, die er nun auf
Nachfrage einem Mitschüler (S1) vermittelt.
Es ist sicher plausibel und berechtigt anzunehmen, dass in dieser Interaktionssequenz bei dem
Schüler (S1) ein schülerinitiierter Wissenserwerb sowohl auf dem Gebiet der Lexik als auch auf
der Ebene der Sprachlernstrategie prozesshaft eingeleitet worden ist.
3.3 Fazit
Mit Hilfe der Interaktionsanalyse können wir u.a. exemplarisch aufdecken:
a) unter welchen Kontextbedingungen welche Interaktionstypen auftreten können und
b) welche Funktion sie in der Interaktion und im Spracherwerbsprozess haben.
Unter Einbezug der aktuellen Forschungslage (siehe u.a. L. Gajo / C. Serra 1998) deuten sich
erste heuristische Hypothesen zum bilingualen Sprach- und Sachfachlernen an:
• Die LernerInnen nehmen aktiver und selbstinitiierter an Interaktionen teil, wenn diese
inhaltlich orientiert sind;
• Aufgaben-Lösungsabfolgen sind weniger effizient als wissenserwerbs-fördernde Sequenzen,
• Die größere Kleinschrittigkeit, Bildhaftigkeit und die stärke Exemplifizierung im
bilingualen Unterricht fördern – auch bei schwächeren Schülern – den Sachwissenserwerb
stärker als im monolingualen Unterricht.
• Mit zunehmender inhaltlicher Orientierung der Lernsituation entwickeln die LernerInnen
zunehmend auch sachfachgebundene Diskurstypen und eine an die Sachfachinhalte
gebundene Sprachkompetenz.
Wie unser Vorgehen zeigte, ist die Interaktionsanalyse eine qualitativ interpretierende
Forschungsmethode mit deskriptiven Charakter. Besonders für die Unterrichtsforschung zum
bilingualen Lehren und Lernen bringt dieser Forschungsansatz ein umfassenderes Verständnis

11 / 14
• von der Art der Interaktionen, die auf sprachlicher und inhaltlicher Ebene ablaufen,
• in Bezug auf die Typen von Interaktionen, die den Prozess des Sprachlernens, des
Sprachstrategielernens, der Sprach- und Metareflexion und des Sachweltlernens (wie
Begriffsbildung usw.) behindern bzw. eher fördern.
Im Rahmen der Lehrerausbildung ermöglicht die Diskursanalyse (z.B. bei „Micro teaching“, bei
Unterrichtsbeobachtung) das Aufzeigen von Interaktionsschemata und eine Sensibilisierung für
Unterrichtsabläufe und sprach- und sachwissen-erbwerbsfördernde Sequenzen.1
Literatur
Androutsopoulos, Jannis / Hinnenkamp, Volker (2001): Code-Switching in der bilingulen Chat-Kommunikation: ein explorativer Blick auf #hellas und #turks“, in Beisswanger, Michael (Hg.) (2001): Chat-Kommunikation: Sprache, Interaktion, Sozialität & Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation; Perspektiven auf ein interdisziplinäres Forschungsfeld, Stuttgart, Ibidem (35 S.). [Eingesehen auf: http://www.chat-kommunikation.de]
Bange, Peter (1992a): Analyse conversationnelle et théorie de l’action. Paris : Didier, coll LAL. Bange, Peter (1992b): “A propos de la communication et de l’apprentissage en L2, notamment
dans ses formes institutionnelles.” Aile [revue de l’association Encrages, Université de Paris VIII], 1992, n°1 : 53 - 85.
Blell, Gabriele / Klose, Dagmar (2002) : « Fremdverstehen im Spannungsfeld von Geschichte und Fremdsprachen: Der Forschungsgegenstand und seine Methodologie“, in: Krück, B. / Loeser. K. (Hrsg.) (2002): Innovationen im Fremdsprachenunterricht 2: Fremdsprachen als Arbeitssprachen, Frankurt / M.: P. Lang, S. 61-74.
Butzkamm, Wolfgang (o.J.): „Zum Sprachwechsel im Bilingualen Unterricht.“ Online (1996): http://www.learn-line.nrw.de/angebote/bilingual/Downloads/butzkamm.pdf
Causa, Maria (2002): L’alternance codique dans l’enseignement d’une langue étrangère. Stratégies d’enseignement bilingues et transmission de savoirs en langue étrangère. Bern, P. Lang.
Christ, Herbert / Hüllen, Werner (1995): “Fremdsprachendidaktik”, in: Bausch, Karl-Richard / Christ, Herbert / Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.) (1995): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Tübingen: Franche (3. Auflage); S. 1-7.
Cicurel, Francine (2002): “La classe de langue, un lieu ordinaire, une interaction complexe.” Aile [revue de l’association Encrages, Université de Paris VIII], 2002, n°16 : 145 – 164.
Ehrhart, Sabine (2003 a): „Code-switching im Sprachunterrricht anhand von Beispielen aus dem Projektcorpus “Effizienz des Frühunterrichts Französisch in saarländischen Schulen“. Wie funktioniert code-switching bei Schülern und Lehrern in der Interaktion im Unterricht? Vortrag auf der 33. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik. Köln 19.-21. September 2002 [Veröffentlichung in den Akten 2003].
Ehrhart, Sabine (2003 b): « L’alternance codique dans le cours de langue : le rôle de l’enseignant dans l’interaction avec l’élève Synthèse à partir d’énoncés recueillis dans les écoles
1 Die Arbeiten von M. Causa (2002) zu den Lehrstrategien weisen in diese Richtung.

12 / 14
primaires de la Sarre ». In : Anxo M. Lorenzo Suarez, Fernando Ramallo & Xóan Paulo Rodriguez-Yanez (Hrsg.): Proceedings / Actas. Second International Symposium on Bilingualism / Segundo Simposio Internacional sobre o Bilingüismo. Universidade de Vigo (Galicia, Spain) October 23-26, 2002. Vigo : Servicio de Publicacions da Universidade de Vigo. CD-Rom.
Farco, Martine (2002): “Répétition, acquisition et gestion de l’interaction sociale.” Aile, [revue de l’association Encrages, Université de Paris VIII] 2002, n°16 : 97 - 120.
Faustmann, Astrid (1994): Entschlüsselung anthropologischer Strukturen in Didaktik-Modellen, Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung.
Gajo, Laurent (2001): Immersion, bilinguisme et interaction en classe, Paris, Didier, coll LAL. Gajo, Laurent / Serra, Cecilia (1998): De l’alternance des langues à un concept global de
l’enseignement des disciplines. Projet ‘Disciplines et Bilinguisme’, année scolaire 1997/98. Rapport de recherche, Assessorat de l’Éducation et de la Culture, Surintendance aux Écoles, Région Autonome Vallée d’Aoste.
Götz, Berthold (1994): « Wenn Schüler schwatzen: Form und Funktion von Begleitdiskursen im Untericht ‚Deutsch als Fremdsprache’.“ OBST [Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie] 49: 39-52.
Grotjahn, Rüdiger (1995): „Empirische Forschungsmethoden: Überblick“, in: Bausch, Karl-Richard / Christ, Herbert / Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.) (1995): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Tübingen: Franche (3. Auflage); S. 457-461.
Grotjahn, Rüdiger (2000): „Einige Thesen zur empirischen Forschungsmethdologie“, in: Aguado, Karin (Hrsg.) (2000): Zur Methodologie in der empirischen Fremdsprachenforschung, Hohengehren: Schneider Verlag, 19 – 30.
Henrici, Gerd (1995): Spracherwerb durch Interaktion? Eine Einführung in die fremdsprachenerwerbsspezifische Diskursanalyse. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Henrici, Gerd (2000): „Methodologische Probleme bei der Erforschung des Fremdsprachenerwerbs“, in: Aguado, Karin (Hrsg.) (2000): Zur Methodologie in der empirischen Fremdsprachenforschung, Hohengehren: Schneider Verlag, S. 19-30.
Hillgärtner, Rüdiger (1976): Aspekte der Entwicklung und der gegenwärtigen Situation der Anglistik der BRD“, in: Kramer, Jürgen (Hrsg.) (1976): Bestandsaufnahme Fremdsprachenunterricht, Stuttgart: Metzler.S. 85-97.
Huppertz, Norbert (2000): Bilinguale Bildung. Französisch im Kinderarten. Das Projekt am Oberrhein. Projektbericht. Freiburg: Pädagogische Hochschule Freiburg, Abteilung Sozialpädagogik.
Huppertz, Norbert (Hg.) (2000): Französisch so früh? - Bilinguale Bildung im Kindergarten. Das Projekt am Oberrhein. Freiburg: PAIS-Verlag.
Koordinationsgremium im DFG-Scherpunkt « Sprachlehrforschung » (Hrsg.) (1977): Sprachlehr- und Sprachlernforschung: Eine Zwischenbilanz, Königstein / Ts.: Scriptor.
Koordinationsgremium im DFG-Scherpunkt « Sprachlehrforschung » (Hrsg.) (1983) : Sprachlehr- und Sprachlernforschung: Begründung einer Disziplin, Tübingen: G. Narr.
Lochmann, Katja (2002): Korrekturhandlungen im Fremdsprachenunterricht. Bochum: AKS-Verlag.
Lüsebrink, Hans-Jürgen (1993): „Französische Kulturwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation. Theorieansätze, Gegenstandsbereiche, Forschungsperspektiven“, in: Lüsebrink, Hans-Jürgen (1993) (Hrsg.): Landeskunde und Kulturwissenschaft in der

13 / 14
Romanistik. Thoerieansätze, Unterrichtsmodelle, Forschungsperspektiven, Tübingen: Narr, S. 23-39.
Martin-Jones, Marilyn (2000): „Bilingual classroom interaction: A review of recent research.“ Language Teaching 33: 1 - 9.
Mehan, H. (1985): “The structure of classroom discourse”, in : van Dijk, Teun A. (1985): Handbook of Discourse Analysis, vol. 3 : Discourse and Dialogue, 1985, London, Academic Press: 119 - 131.
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2001): Ergänzung zum Bildungsplan Grundschule Fremdsprachen Englisch / Französisch, Stuttgart.
Moore, Danièle / Lee-Simon, Diana (2002): „Déritualisation et identité d’apprenants.“ Aile [revue de l’association Encrages, Université de Paris VIII] 2002, n° 16: 121-144.
Müller-Hartmann, Andreas (2001): „Fichtenschonung oder Urwald? Der forschende Blick ins vernetzte fremdsprachliche Klassenzimmer – Wie Trianlulation und Interaktionsanalyse der Komplexität gerecht werden können“, in: Müller-Hartmann, Andreas / Schocker- v. Ditfurth, Marita (Hrsg.) (2001): Qualitative Forschung im Bereich Fremdsprachen lehren und lernen, Tübingen: G. Narr, S; 206 – 237.
Portmann-Tselokas, Paul (1997): “Deutsch als Fremdsprache - Was tun wir, wenn wir Didaktik machen?”, in: Germanistische Linguistik Nr. 137 - 138, S. 211-228.
Puren, Christian (1988) : Histoire des méthodologie de l’enseignement des langues, Paris: Nathan, CLE international..
Py, Bernard (2000): “La construction interactive de la norme comme pratique et comme représentation.” Aile [revue de l’association Encrages, Université de Paris VIII] 2002, n°12: 77-97.
Rymarczyk, Jutta (2003): Kunst auf Englisch. Ein Plädoyer für die Erweiterung des bilingualen Sachfachkanons, München: Langenscheidt-Longman, Münchener Arbeiten zur Fremdsprachendidaktik (MAFF).
Schauwienold-Rieger, Sabine (2003): „Europalehramt“, in: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.) (2003): Realschule Baden-Württemberg. Lernende Schule. Bd. 3, Theorie und Praxis innovativer Schulentwicklung: Neue Herausforderungen für die Lehrerbildung. Donauwörth: Auerverlag: 179 - 197.
Schlemminger (2003 a): „Interaktionsanalyse bilingualen Unterrichts – Skizze eines Forschungsdesigns mit exemplarischen Beispielen“, in: Bonnet, Andreas / Breidbach, Stephan: Fremdsprachen- und Sachfachdidaktiken im Dialog, Bern: Peter Lang Verlag, Reihe "Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht" [erscheint 2003].
Schlemminger, Gérald (2003 b) „Wenn Schüler auf die Muttersprache zurückgreifen – Sprachwechsel im bilingualen Lehren und Lernen, Ergebnisse einer empirischen Unterrichtsforschung.“ In: Schlemminger, Gérald (Hg.) (2003): Erfahrungen mit bilingualem Lehren und Lernen, Baltmannsweiler, Schneider Verlag Hohengehren. [erscheint 2004].
Schlemminger, Gérald (2003 c): “Europalehramt – La filière bilingue à l’École Supérieure de Pédagogie de Karlsruhe“. In: Eckerth, Johannes / Wendt, Michael (2003): Interkulturelles und transkulturelles Sprachenlernen. Frankfurt/M.: Lang. [erscheint 2003]
Sibon, Sébastien (1998/1999): Sections européennes et apprentissage des langues: le cas de la physique-chimie. Mémoire de maîtrise. Strasbourg: Université Marc Bloch de Strasbourg.
Springer, Claude (Hrsg.) (2001): Le recours aux langues étrangères dans le cadre d’activités relevant d’autres disciplines. Polycopie. Paris: ACEDLE.

14 / 14
Vasseur, Marie-Thérèse (2000): „De l’usage de l’inégalité dans l’interaction-acquisition en langue étrangère.“ Aile [revue de l’association Encrages, Université de Paris VIII] 2002, n° 12: 51 - 76.
Vögeding, Joachim (1995): ‚Wenn in einen gesättigten Wasser Kochsalz gibt…’ – Zur Lernbarkeit naturwissenschaftlicher Fächer in der Fremdsprache Deutsch am Beispiel eines deutschsprachigen Chemieunterrichts in der Türkei (Istanbul Lisesi). Heidelberg: Groos.
Vollmer, Helmut J. (2001): „Untersuchungsfeld 1: Kognitive Aspekte“, in: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 12 (2), S. 43-61.
Wagner, Jürgen (1983): Kommunikation und Spracherwerb im Fremdsprachenunterricht, Tübingen: Narr.
Wode, Henning / Berger, Claudia / Klust, Svenja / Tonn, Gesa (2001): L2-Lauterwerb in bilingualen Kindertagesstätten. Kiel: Englisches Seminar und Zentrum für Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt, Christian-Albrechts-Universität.
Wode, Henning / Devich-Henningsen, S. / Fischer, U. / Franzen, V. / Pasternak, R. (2002): Englisch durch bilinguale Kitas und Immersionsunterricht in der Grundschule: Erfahrungen aus der Praxis und Forschungsergebnisse. Polykopie. Kiel: Englisches Seminar und Zentrum für Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt, Christian-Albrechts-Universität.
Wode, Henning / Fischer, U. / Franzen, V. / Pasternak, R. (2002): Englisch im Altenholzer Verbund von Kita und Grundschule: Erfahrungen aus Praxis und Forschung, zum Ende der 2. Klasse (2001). Polykopie. Kiel: Englisches Seminar u. und Zentrum für Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt, Christian-Albrechts-Universität.
Die angegebenen Webseiten sind zuletzt überprüft worden am 15. 07. 2003.

![W ] l î ì í ò filew ] l î ì í ò %(=(,&+181* 9(53$&.81*6(,1+(,7 9( %hvwhoo 1u 3uhlvh &+) h[no 0z6w 0(1*( 8pnduwrq 6.$/3(//./,1*( 15 lp 0djd]lq](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5e1c730ff8c0283e1d4042e3/w-l-l-181-95381617-9-hvwhoo.jpg)