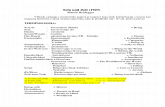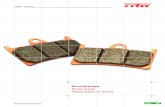MPF_2001_2
Transcript of MPF_2001_2

MaxPlanckForschungMaxPlanckForschungDas Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft
SCHWERPUNKT
Güter & GesellschaftSCHWERPUNKT
Güter & Gesellschaft
B20396F2/2001
KREBSFORSCHUNG
Wenn gestörte Kommunikation
krank macht
KREBSFORSCHUNG
Wenn gestörte Kommunikation
krank macht
KONGRESSBERICHT
Heißes Leben im Verborgenen
KONGRESSBERICHT
Heißes Leben im Verborgenen
STAMMZELLEN
Stammkapital einerneuen Medizin?
STAMMZELLEN
Stammkapital einerneuen Medizin?

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 32 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
INHALT
FORSCHUNG aktuellDicke Luft über dem Indischen Ozean 4
Das Schwingen der inneren Uhr . . . . . 5
Geruchswahrnehmung braucht Zeit . . 6
Gewickelte Nanoröhrchen . . . . . . . . . . 8
Eine neue Art Supraleitung . . . . . . . . 9
Vulkane am Meeresboden . . . . . . . . . 10
Pflanzen als Giftmörder . . . . . . . . . . 12
Delphine sind farbenblind . . . . . . . . . 13
Im Herbst Geborene leben länger . . . 14
Atomare Struktur von Quantenpunkten entschlüsselt . . . . . 16
Taktgeber im Gehirn der Singvögel . . 18
ESSAY
❿ Eine Quelle der Demut . . . . . . . . . 20
SCHWERpunkt GÜTER & Gesellschaft
❿ Im Kleinen liegt die Kraft . . . . . . . 24
❿ Auch Datenschutz ist ein Gemeinschaftsgut . . . . . . . . . . 30
❿ Das süße Gut oder: Sind die Bedürfnisse der Menschen unersättlich? . . . . . . . . . . 36
❿ Der europäische Weg zur sicheren Rente . . . . . . . . . . . . . . 42
FASZINATION Forschung❿ Strukturbiologie:Molekularer Kraftakt bringt Muskeln in Bewegung . . . . . . . . . . . . 48
❿ Radioastronomie: Neuer Superrechner für die Erde und für Schwarze Löcher . . . . . . . . . 54
❿Molekularbiologie:Wenn gestörte Kommunikation krank macht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
WISSEN aus erster Hand❿ Zellbiologie:Stammzellen – Stammkapitaleiner neuen Medizin? . . . . . . . . . . . . 66
KONGRESSbericht❿ Nachwuchsförderung:„Wir können selbst unsere besten Leute nicht halten“ . . . . . . . . . . . . . . 72
❿ Mikroorganismen:Heißes Leben im Verborgenen . . . . . . 76
FORSCHUNG & Gesellschaft❿ Evolutionäre Anthropologie:Zum Affenschach ins Pongoland . . . 82
❿ Jahr der Lebenswissenschaften:Exkursion ins Reich der Zelle . . . . . . 88
NEU erschienenBeim Rollenspiel an Streitkultur gewinnen . . . . . . . . . 87
zur PERSON
❿ Don Zagier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
INSTITUTE aktuell Nachruf: Zum Tod von Franz Emanuel Weinert . . . . . . . . . . . 97
Nachruf: Zum Tod von Tyll Necker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Fischen nach Genen . . . . . . . . . . . . 100
Prof Haim Harari ausgezeichnet . . . 101
Neugründung: Max-Planck-Institut für vaskuläre Biologie . . . . . . . . . . 102
Ausgründung: Scienion AG in Berlin . . . . . . . . . . . 103
Blick zum Ursprung . . . . . . . . . . . . 104
Forschung in der Nanowelt . . . . . . 105
Science-Tunnel auf Tournee in China . . . . . . . . . . . 106
STANDorteForschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft . . . . . 107
Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
SCHLUSSlicht❿ Bilder aus der Wissenschaft: Die Siegerfotos . . . . . . . . . . . . . . . . 108
GÜTER SIND IN DER GESELLSCHAFT allgegenwärtig und – wie Luft und
Wasser – bisweilen unabdingbar zum Leben. Wirtschaftstheoretisch gesehen,
sind sie Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Warum kleine Firmen
und lokale Kollektive Güter besonders erfolgreich produzieren und vermarkten können, ohne im Wettbewerb mit Groß-
unternehmen hintenan stehen zu müssen, haben der Wirtschaftssoziologe Prof. Helmut Voelzkow vom Kölner Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung und Mitglieder einer internationalen Forschergruppe herausgefunden (SEITE 24).
Welche Regelungsprobleme sich im Umgang der Gesellschaft mit Gütern wie Daten und Wissen, aber auch mit Abfall
ergeben, erläutern Prof. Adrienne Héritier und Prof. Christoph Engel von der Bonner Projektgruppe Recht der Gemeinschafts-
güter im Interview ab SEITE 30. Am Beispiel des Zuckers geht Wilhelm Ruprecht vom Max-Planck-Institut zur Erforschung
von Wirtschaftssystemen in Jena der Frage nach, wie sich der Konsum dieses Verbrauchsguts historisch entwickelt hat
(SEITE 36). Dr. Yves Jorens, Leiter einer Selbständigen Nachwuchsgruppe am Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Sozialrecht, untersucht mit seinen Mitarbeitern, wie ein (noch) national geregeltes Gut wie die Alters-
sicherung künftig unter Einfluss internationaler Organisationen europaweit koordiniert werden wird (SEITE 42).
STAMMZELLEN: Was siesind, was sie können, be-schreibt Prof. Peter Gruss
vom MPI für biophysikalische Chemie.
ZUM TITELBILD: Am laufenden Band werden in unserer Gesellschaft Güter produziert – und konsumiert.
FOTO: CORBIS-STOCKMARKET
66KRAFTAKT: Was bei der Muskelarbeit passiert, unter-sucht Prof. Kenneth Holmes
vom MPI für medizinische Forschung.48 SCHWARZE RAUCHER: Bei
einem Kongress in Münchentauschten Forscher neue
Erkenntnisse über Mikroorganismen aus.76 AFFENSCHACH: Im Leipziger
Zoo schauen die Besucher denVerhaltensforschern vom MPI für
evolutionäre Anthropologie über die Schulter.82 HÖHERE MATHEMATIK:
Prof. Don Zagier, Träger desStaudt-Preises, beschäftigt
sich unter anderem mit Jacobi-Formen.90
Schwerpunkt Güter & Gesell schaft
24
30
ANTIKÖRPER: Der Kom-munikation von Zellenauf der Spur ist Prof.
Axel Ullrich vom MPI für Biochemie.58
GEOMAX:Diesem Heft liegt die neueAusgabe des GEOMAX bei. Wie sein „Bruder“ BIOMAXrichtet er sich vorwiegend an Lehrer und Schüler.
42
3624

FORSCHUNG
4 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Der ungewöhnlich dunkleDunst bestand aus Ruß, der dasSonnenlicht stark absorbiert,enthielt aber auch Sulfate,Nitrate, organische Teilchen,Flugasche und mineralischenStaub. Einerseits verminderndiese Aerosol-Teilchen die Er-wärmung des Ozeans um etwa15 Prozent, andererseits ver-stärken sie die Erwärmung derGrenzschicht um etwa 0,4 GradCelsius pro Tag. Beides gemein-sam beeinflusst den regionalenWärmekreislauf und das Klima.Das Ruß-Aerosol und die Flug-asche sind zweifelsohne aufmenschliche Tätigkeiten zu-rückzuführen, da es natürlicheQuellen dafür in dieser Regionpraktisch nicht gibt. Ebensokann Sulfat, das nicht aus demMeer stammt, überwiegend anthropogenen Quellen zuge-ordnet werden. Insgesamt wirdder auf menschliche Aktivitä-ten zurückgehende Anteil anden Aerosolen über dem Indi-schen Ozean auf mindestens 85 Prozent geschätzt. Wegen der weit verbreitetenVerbrennung von Biomasse unterscheidet sich die Luftver-schmutzung über dem Indi-schen Ozean in ihrer Zusam-mensetzung von der in Europaund Nordamerika. So ist zumBeispiel die gesamte Emissionvon Kohlenmonoxid (CO)schätzungsweise 50 Prozenthöher als die entsprechendeMenge in Europa und Nord-amerika zusammen genommen.Am Kaashidhoo-Klimaobser-vatorium auf den Maledivenwurden im Februar 1999durchschnittliche CO-Kon-zentrationen gemessen, dievergleichbar sind mit ver-schmutzten Luftströmungen in Europa und Nordamerika.Doch dieses Observatoriumliegt über 1000 Kilometer vonden wichtigsten Emissions-quellen entfernt, was denweiträumigen Transport dieserSchadstoffe deutlich macht.Aus Simulationsrechnungen,die in guter Übereinstimmungmit den Messungen sind,schließen die Wissenschaftler,
dass 60 bis 90 Prozent desKohlenmonoxids aus der Ver-brennung von Biomasse stam-men (Abb. 2).Modellrechnungen zeigenaußerdem, dass – im Gegensatzzu den Luftschadstoffen in Europa und Nordamerika – dieanthropogenen Emissionen ausSüd- und Ostasien die Konzen-tration der Hydroxylradikale(OH) vermindern. Da OH einstarkes Oxidationsmittel undgewissermaßen das Reini-gungsmittel für die Atmosphä-re ist, schwächen die Schad-stoffe die Selbstreinigungs-fähigkeit der Atmosphäre inAsien. Das bedeutet zum Bei-spiel, dass sich die Lebensdauervon Methan, einem wichtigenTreibhausgas, verlängert.Die zunehmende Schadstoff-belastung im Indischen Ozeanverursacht eine umfassendeVerschlechterung der Luftqua-lität, verbunden mit lokalen,regionalen und globalen Aus-wirkungen, einschließlich einerVerminderung der Selbstreini-gungskräfte der Atmosphäre.Es ist in naher Zukunft zu er-warten, dass der vermehrteEinsatz fossiler Brennstoffe bei den Schadstoffemissionenwahrscheinlich zu einer Ent-wicklung führen wird, wie siein den siebziger Jahren in Euro-pa und Nordamerika zu beob-achten war. Doch angesichtsder hohen Bevölkerungszahlkann die Schadstoffbelastungin Asien noch viel bedrohlicherwerden. �
Weitere Informationen erhalten Sie von: PROF. DR. JOS LELIEVELD
Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz Tel.: 06131/305-458Fax: 06131/305-436 E-Mail: [email protected]
Nähere Informationen über INDOEX unter: http://www-indoex.ucsd.edu/
Wer auf LangstreckenflügenZeitzonen durchquert, leidethinterher mehr oder wenigerunter Jetlag. Die inneren Uh-ren, die in einem etwa 24-stündigen Rhythmus ticken,müssen sich plötzlich an einganz neues Hell-Dunkel-Schema anpassen. Währenddie Armbanduhr sich einfachvor- oder zurückstellen lässt,braucht die Uhr im Innerndes Körpers ein wenig längerfür die Umstellung.
Doch es funktioniert: Nach ei-nem oder mehreren Tagen ticktsie wieder synchron zur Außen-welt – Symptome wie Müdig-keit, Schlafstörungen, Appetit-losigkeit verschwinden. Welchemolekularen Mechanismenstecken dahinter? Schon voreinigen Jahren fanden Wissen-schaftler im Erbgut von Men-schen und Mäusen so genannteUhren-Gene, die für die Peri-odizität zuständig sind. NeueErgebnisse zeigen nun, wieLichtsignale von außen und ❿
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 5
FORSCHUNG aktuell
KLIMAFORSCHUNG
Dicke Luft über dem Indischen Ozean
Eine Gruppe von Wissen-schaftlern aus Deutschland,USA, den Niederlanden,Österreich, Indien undSchweden unter der Feder-führung des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainzberichtet am 9. Februar 2001in der amerikanischen Fach-zeitschrift SCIENCE über dieErgebnisse der Indian-Ocean-Experiment-Messkampagne(INDOEX). Ihr Befund: eineunerwartet hohe Luftver-schmutzung über dem ganzennördlichen Indischen Ozeandurch Schadstoffe aus Süd-und Südostasien.
Das „INDian Ocean EXperi-ment“ (INDOEX) war eine inter-nationale Messkampagne zurUntersuchung des Einflussesder Luftverschmutzung auf dasKlimageschehen im Gebiet destropischen Indischen Ozeans.Indien und die Länder in Süd-und Südostasien erzeugen miteiner Gesamtbevölkerung vonüber zwei Milliarden Menschenwachsende Mengen an Schad-stoffen. Diese werden währendder trockenen Monsunzeitdurch die stetig aus Nordostwehenden Winde auf den Indi-schen Ozean hinausgeblasen.Ziel des INDOEX-Projekts war
es deshalb, zu klären, wie dieSchadstoffe in der Atmosphäretransportiert werden und wie sie sich auf die chemische Zusammensetzung der Atmo-sphäre und die Sonnenein-strahlung über dem Ozean auswirken. Das internationaleTeam umfasste über 150 For-scher, darunter mehr als 20 ausden Abteilungen Atmosphären-chemie und Biogeochemie desMax-Planck-Instituts für Che-mie in Mainz. Die Messungenfanden während der trockenenMonsunperiode von Januar bisMärz 1999 statt; dafür wurdenvier Forschungsflugzeuge, zwei Forschungsschiffe, meh-rere Bodenstationen, Ballonsund Satelliten genutzt. Das Zentrum der Messkam-pagne befand sich auf dem Internationalen Flughafen vonMale auf den Malediven, woauch die Flugzeuge stationiertwaren.Die Messungen der INDOEX-Kampagne ergaben, dass wäh-rend des Wintermonsuns dieEmissionen aus Süd- und Südostasien die Luft über eineFläche von mehr als zehn Millionen Quadratkilometernerheblich belasteten. EineDunstschicht, die sich von derMeeresoberfläche bis in dreiKilometer Höhe erstreckte, hingüber großen Teilen des Unter-suchungsgebiets (Abb. 1).
Abb. 1: GrauerDunst von Aerosol-partikeln über dem IndischenOzean währenddes trockenenMonsuns (Januarbis März 1999).Das Bild in Echt-farben wurde ausSatellitenaufnah-men entwickelt,die von SeaWiFSProject, NASA/Goddard SpaceFlight Center und ORBIMAGEzur Verfügung gestellt wurden.
Abb. 2: MittlereKohlenmonoxid(CO)-Konzentra-tionen knapp überder Oberflächedes IndischenOzeans im Febru-ar 1999. DieseAbbildung ent-stand mit einemComputermodell,das durch die IN-DOEX-Messungenüberprüft wurde.
@FO
TO+
GRA
FIK:
MAX
-PLA
NCK
-IN
STIT
UT
FÜR
CHEM
IE
aktuellCHRONOBIOLOGIE
Das Schwingender inneren Uhr
Die Uhren-GenePer1 und Per2regulieren dieinnere Uhr unddamit dieNachtaktivitätvon Mäusen.
aktuell
Länge
Breite
50 O 64 O 78 O 92 O 106 O 120 O
45N
25
N
15N

Zeitverschiebungen über diesePeriod-Gene (Per1 und Per2) andie inneren Uhren weitergege-ben werden (JOURNAL FOR BIO-LOGICAL RHYTHMS, April 2001).Prof. Urs Albrecht und seineArbeitsgruppe Biochronologievom Max-Planck-Institut fürexperimentelle Endokrinologiein Hannover sowie Kollegen inHouston arbeiten mit Mäusen,die sich hervorragend für For-schungen über biologischeRhythmen eignen. Die Uhren-Gene dieser Tiere sind gut cha-rakterisiert; sie funktionierenwie eine Wasseruhr: Laufendsetzt die Zelle sie in Proteineum, bis sie quasi überläuft.Dann blockieren die Proteineihre eigene Produktion undwerden abgebaut. Dieser Kreis-lauf dauert eigentlich 25 Stun-den, doch das Tageslicht sorgtdafür, dass die inneren Räder-werke immer wieder ein wenignachgestellt werden und so mitder Außenwelt und dem 24-Stundenzyklus synchron laufen.Doch wie funktioniert dieseFeinabstimmung zwischen Ge-nen und Außenwelt, die bei extremen Zeitverschiebungenund Jetlag noch wichtigerwird? Um das herauszufinden,experimentierten die Forschermit Knockout-Mäusen, das sindTiere, in denen bestimmte Genegezielt ausgeschaltet werden.Mäuse, die in jeweils einem derUhren-Gene Per1 und Per2oder in beiden defekt waren,wurden unterschiedlichenLichtverhältnissen ausgesetzt. Die Aktivität der Mäuse lässtsich anhand ihrer Laufrad-aktivität messen. Sobald dasLicht ausgeht, beginnen dienachtaktiven Säuger zu ren-nen. Gibt man nun Lichtpulsein der frühen oder in der spä-ten Nacht, stellen die Mäusesich in ihrem Zyklus um: Ihreinnere Uhr reagiert auf dasSignal von außen. Dabei schei-nen die Per-Gene als Regulato-ren wichtig zu sein; sie funk-tionieren in etwa wie Stell-
rädchen an einer Armbanduhr.Die Versuche mit den Knock-out-Mäusen zeigten, dass zweiStellrädchen mit spezifischerFunktion vorhanden sind.Während Per1 die innere Uhrnach vorn verstellt, verursachtPer2 eine Verschiebung nachhinten. Gibt man den Lichtpulsbeispielsweise in der frühenNacht, denken die Tiere, derTag wäre länger und dement-sprechend werden sie in dernächsten Nacht später aktiv;ein Lichtpuls gegen Morgenaber verschiebt die Uhr nachvorn. Die Gene Per1 und Per2 spielendemnach eine entscheidendeRolle, wenn es darum geht, denOrganismus an einen neuen Tagesrhythmus zu gewöhnen.Jetlag nach Langstreckenflügenist dabei nur ein Beispiel fürdie Bedeutung der Synchroni-sation zwischen äußerer Zeitund inneren Uhren. Wichtigsind diese Befunde auch fürProbleme bei Schichtdienst, fürWinterdepression und Syndro-me wie das der vorverlagertenoder verzögerten Schlafphase.Hier könnten die Forschungenzu neuen Behandlungsansätzenführen. Einen Beweis für dieÜbertragbarkeit der Ergebnisseauf den Menschen gibt es be-reits: Bei Patienten, die amSyndrom der vorverlagertenSchlafphase leiden, wurde vorkurzem ein defektes Per2-Gengefunden (SCIENCE, 9. Februar2001). Lesen Sie auch den Beitrag ab Seite 18. �
Weitere Informationen erhalten Sie von: KAROLA NEUBERT
Max-Planck-Institut für experimentelle Endokrinologie, HannoverTel.: 0511/5359-120Fax: 0511/5359-186E-Mail: [email protected]
FORSCHUNG aktuell
Gerüche werden im Riechhirndurch die Aktivitätsmuster vie-ler Nervenzellen repräsentiert,die sich während der Geruchs-wahrnehmung jedoch dyna-misch verändern. Am Califor-nia Institute of Technology haben die beiden Neurowis-senschaftler Gilles Laurent undRainer Friedrich, Otto-Hahn-Stipendiat der Max-Planck-Gesellschaft, jetzt herausge-funden, dass durch diese dyna-mische Veränderung die Ge-ruchserkennung erleichtertwird: Auf einer Zeitskala vonmehreren hundert Millisekun-den entwickeln sich die Akti-vitätsmuster der Zellen so, dassRepräsentationen verwandterDuftmoleküle zunehmendunähnlich und damit besserunterscheidbar werden. (SCIENCE, 2. Februar 2001).
Die Welt der Düfte fasziniertnicht nur die Parfümindustrieund ihre Kunden, sondern auchNeurowissenschaftler interessie-ren sich seit langem dafür, wiedas Gehirn Gerüche analysiert. In der Nase erregen die Duftmo-leküle Sinneszellen, die ihre In-formation an das Riechhirn wei-tergeben. In diesem Stadium derInformationsverarbeitung ist einGeruch durch ein komplexesMuster elektrischer Signale repräsentiert, die von einer Viel-zahl von Nervenzellen stammen.Um einen Geruch zu erkennen,muss das Gehirn diese Aktivitäts-muster auswerten. Dabei stelltsich das Problem, dass verwandteGerüche sehr ähnliche Akti-vitätsmuster produzieren. Das Gehirn muss also, wie in ei-nem Suchspiel der Sonntagszei-tung, kleinste Unterschiede inkomplizierten „Bildern“ auffin-den, um einen Geruch korrekt zuidentifizieren – und dies ist fürviele Tiere lebenswichtig. Im Riechhirn werden die von denSinneszellen kommenden Signaleauf Zellen übertragen, die in einkomplexes neuronales Netzwerk
Weitere Informationen erhalten Sie von: DR. RAINER FRIEDRICH
Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, HeidelbergTel.: 06221/486-408, Fax: 06221/486-325, E-Mail: [email protected]
FORSCHUNG aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 7
Aktivitätsmuster in 49 Nervenzellen des Riechhirns (angeordnet in einem 7x7-Gitter) am Beispiel der Geruchsantwort auf die Aminosäure Histidin: In der Darstellung wurden die einzelnen Nervenzellen so angeordnet, dass ihre„Feuerrate“ (farbkodiert) vom Zentrum nach außen abfällt. Über einen Zeit-raum von mehr als einer Sekunde ändert sich dieses Muster vollkommen.
NEUROBIOLOGIE
Geruchswahr nehmung braucht Zeit
@
ABB.
: M
PI F
ÜR
MED
IZIN
ISCH
EFO
RSCH
UN
G
6 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Änderung der Ähnlichkeit: Zu Beginn der Geruchsantwort sind die Aktivitäts-muster verwandter Duftmoleküle hochgradig überlappend, erkennbar an denBereichen hoher Ähnlichkeit entlang der Diagonalen (warme Farben). MitFortschreiten der Geruchsantwort nehmen diese Ähnlichkeiten ab (kalte Far-ben). Damit wird die Unterscheidung verwandter Geruchsstoffe anhand ihrerAktivitätsmuster zuverlässiger. Dargestellt sind die paarweisen Korrelationenzwischen 16 verschiedenen Aktivitätsmustern.
Dynamische Geruchsantwort einer Nervenzelle im Riechhirn des Zebrabärblingsauf zwei verschiedene Geruchsstoffe, die Aminosäuren Alanin [Ala] und Serin[Ser]: Die Geruchsgaben erfolgten während der durch den offenen Balken an-gegebenen Zeit. Die kleinen Striche repräsentieren das Auftreten eines elektri-schen Signals (Aktionspotenzial); mehrere Reihen entsprechen wiederholtenGeruchsgaben. In einem Zeitfenster von jeweils 100ms lassen sich daraus ge-mittelte Frequenzwerte berechnen. Diese ergeben ein so genanntes Peri-Stimu-lus-Zeithistogramm. Die beiden Histogramme zeigen, dass die Zelle auf die bei-den Geruchsstoffe zu verschiedenen Zeitpunkten mit einer erhöhten Frequenzan Aktionspotenzialen („Feuerrate“) antwortet. Skalierungsbalken horizontal400ms, vertikal 40Hz.
eingebettet sind. Das führt dazu, dass sich diese Nerven-zellen gegenseitig beeinflussen:Aktivitätsmuster bleiben so-mit nicht stationär, also fest-stehend, sondern verändernsich, während ein Geruch zugegen ist.Die Veränderung in einem bestimmten Zeitraum ist für jeden Geruch charakteristisch.Seit geraumer Zeit kennen Wissenschaftler diese Dynamik,aber sie konnten sich langekeinen Reim darauf machen.Im Rahmen seines Forschungs-aufenthalts im Labor von GillesLaurent am California Instituteof Technology hat RainerFriedrich herausgefunden, wases mit der Veränderung der„Geruchsbilder“ auf sich hat:Auf einer Zeitskala von meh-reren hundert Millisekundenwerden Repräsentationen ver-wandter Geruchsmoleküle zu-nehmend unähnlich und damitbesser unterscheidbar. Offen-bar löst das Gehirn also dieSuchspielaufgabe, indem es –durch entsprechende Verrech-nungen in den neuronalenSchaltkreisen des Riechhirns –die Überlappungen in denSuchbildern reduziert (alsoGleiches von Gleichem abzieht)und so die Unterschiede ver-stärkt.Die Forscher untersuchtenzunächst einzelne Nervenzellenim Riechhirn des Zebrabärb-lings, eines kleinen Süßwasser-fisches, der sich unter Geneti-kern ähnlich großer Beliebtheiterfreut wie die FruchtfliegeDrosophila. Mit feinen Mikro-elektroden registrierten sie dieAktivität einzelner Nervenzel-len im winzigen Gehirn des Fi-sches und fanden, wie erwar-tet, dynamische Geruchsant-worten: Es gibt Phasen mit ei-ner hohen Frequenz an elektri-schen Signalen und Phasen, in denen die Nervenzelle quasi„stumm“ ist (siehe Abbildung).Andersherum betrachtet, ant-
wortet eine Zelle zu verschie-denen Zeitpunkten auf unter-schiedliche Geruchsstoffe. Die Zahl der Geruchsstoffe, die eine Antwort hervorrufen,bleibt jedoch immer etwagleich; die Geruchsantwortwird also nicht spezifischer mit der Zeit.Die Bedeutung dieser Verände-rungen in der Geruchsantwortwurde erst klar, als die beidenWissenschaftler dazu übergin-gen, die Aktivitäten vieler Ner-venzellen als Muster zu analy-sieren. Auf diese Art und Weiseerhielten sie eine ganze Reihevon „Geruchsbildern“, die siemit mathematischen Methodenzur Musteranalyse bearbeite-ten. Dabei stellten sie fest, dasszu Beginn einer Geruchsant-wort die vom Riechhirn er-zeugten „Bilder“ verwandterDuftmoleküle hochgradigüberlappen und nur schwer zu unterscheiden sind. In dendarauffolgenden mehrerenhundert Millisekunden werden diese „Bilder“ jedoch umge-baut, sodass die Geruchsunter-scheidung präziser wird.Diese Ergebnisse stoßen nichtnur bei Duftforschern, sondernauch bei anderen Wissen-schaftlern auf Interesse, ent-hüllen sie doch eine bemer-kenswerte neuronale Verarbei-tungsstrategie: Offensichtlichbenutzt das Riechhirn die Zeitals Variable für neuronale Re-chenoperationen. Die Aktivitätim Riechhirn wird allmählichumstrukturiert und das Systemso in einen zunehmend infor-mativeren Zustand überführt.Es sind also „bewegte Bilder“,die unser Gehirn von einemGeruch zeichnet – kein Stille-ben, eher ein Kurzfilm – undnur wer Verlauf und Endekennt, vermag die Botschaft zu verstehen bzw. den Geruchzu identifizieren. �
@

FORSCHUNG aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 9
würde“, erläutert er weiter.Das Röhrchen in Abb. 2 ist mit530 Nanometer und einer Län-ge von 20 Mikrometern nochimmer relativ groß. Doch dieneue Nanotechnologie ermög-licht es, die Größe der Nano-tubes über ein sehr breitesGrößenspektrum gezielt zu be-stimmen. Die eingebaute Ver-spannung der in diesem Fallverwendeten Silizium-Germa-nium-Doppelschicht betrug nur1,5 Prozent. Baute man einevierprozentige Ver-spannung (das ent-spricht der Span-nung zwischen rei-nem Silizium undreinem Germanium)in eine Doppel-schicht von zweiAtomlagen Dickeein, so würde sichder Radius des Na-notubes auf einigewenige Nanometerreduzieren.Aufdampftechnikenwie die Molekular-strahl-Epitaxie er-möglichen es, unterschied-lichste Materialien – darunterHalbleiter, Isolatoren, Metalle,Polymere – in fast unbegrenz-ter Vielfalt miteinander zukombinieren. Schmidt meintdeshalb: „Aus diesem Reich-tum an Kombinationen kön-nen neue Nanoobjekte in heutenicht vorstellbarer Vielfalt ent-stehen, die ihre Anwendung in dem weiten und sehr inter-disziplinären Feld von mikro-und nano-elektromechanischen Systemen finden werden.“ �
Weitere Informationen erhalten Sie von:
DR. OLIVER G. SCHMIDT
Max-Planck-Institut für FestkörperforschungHeisenbergstraße 170569 StuttgartTel.: 0711/6891312Fax: 0711/6891010E-Mail: [email protected]
Metalle können unterhalb einer bestimmten Sprung-temperatur ihren elektri-schen Widerstand vollständigverlieren und zu Supraleiternwerden. Dazu müssen dieElektronen ihre gegenseitigeAbstoßung überwinden: Sie binden sich zu Paarenund kondensieren in einemkollektiven Zustand, der als Ganzes den elektrischenStrom trägt. Dagegen resul-tiert der Strom im Normal-zustand, also oberhalb derSprungtemperatur, aus derSumme der Beiträge allerEinzelelektronen. Bisherkannten die Forscher zweiMechanismen, durch die sol-che Elektronenpaare entste-hen. Einen dritten, bisher un-bekannten Weg zur Paarbil-dung haben jetzt deutscheund japanische Wissenschaft-ler für nichtkonventionelleSupraleiter beschrieben: Ur-sache für diesen Prozess istder Austausch von magneti-schen Exzitonen – wellenarti-gen Kristallfeld-Anregungen.(NATURE, 15. März 2001)
Die Supraleitung als ein auchtechnisch bedeutendes Phäno-men zieht seit ihrer Entde-ckung zu Beginn des 20. Jahr-hunderts immer wieder dieAufmerksamkeit der Physikerauf sich – zuletzt vor wenigenMonaten nach der Entdeckungeines sehr einfachen Magnesi-um-Bor-Supraleiters mit einererstaunlich hohen Sprungtem-peratur von 39 Kelvin (0 K =–273,15 °C). Supraleitung trittein, wenn die Elektronen in einem Material bei tieferenTemperaturen Paare bilden und ohne Widerstand fließen.Dieser Zustand wirft für dieForschung zwei grundsätzlicheFragen auf: Welche physikali-schen Kräfte ermöglichen esden Elektronen, ihre Abstoßungzu überwinden? Welchen Dreh-impuls haben diese Elektronen-paare? Letzteres ist wichtig
für die thermodynamischen Eigenschaften bei tiefen Tem-peraturen.Bisher kannten die Wissen-schaftler zwei Arten von Bin-dungsmechanismen zwischenElektronen. In gewöhnlichenintermetallischen Supraleiternkönnen zwei Elektronen überden Austausch eines Phonons(einer Schwingung des Kristall-gitters der Atome) eine Bin-dung, also einen Zustand tiefs-ter Energie erreichen. In diesemFall haben die Elektronenpaareimmer den Drehimpuls Null.Verbindet man einen derarti-gen Supraleiter über eine iso-lierende, dünne Schicht mit einem Normalleiter und legteine elektrische Spannung an,so fließt durch die dünneSchicht ein Tunnelstrom. DieserStrom ist spannungsabhängigund gibt Auskunft über dasSpektrum der Gitterschwin-gungen, die zur Paarbildungder Elektronen führen. DiesesSpektrum ist auch aus unab-hängigen Neutronenstreuex-perimenten bekannt. Eine Übereinstimmung beider Spek-tren ermöglicht die eindeutigeIdentifikation der Paarbildungdurch Gitterschwingungen.In der zweiten Klasse von Supraleitern, zu denen auch
FESTKÖRPERFORSCHUNG Gewickelte Nanoröhrchen CHEMISCHE PHYSIK Eine neue Art Supraleitung
Nanoröhrchen aus Kohlen-stoffatomen gehörten zu denwissenschaftlichen Highlightsdes vergangenen Jahres. Wissenschaftler vom Stutt-garter Max-Planck-Institutfür Festkörperforschung ha-ben jetzt eine sehr einfacheMethode dazu benutzt, umsolche winzigen Röhrchenauch aus anderen Materiali-en, wie Halbleitern, Metallenoder Polymeren, herzustellen(NATURE, 8. März 2001). Diese Technik erlaubt außer-dem, Nanotubes schichtge-nau aufzubauen und gezieltzu positionieren. Damit rücktdas kontrollierte Design von Nano-Objekten für neuemikro- und nano-elektro-mechanische Systeme einganzes Stück näher.
Wenn sich eine unter innererSpannung stehende Halbleiter-schicht von der sie tragendenKristallschicht ablöst, wickelt
sich diese Schicht zu einemRöhrchen auf. Das ist – ganzeinfach ausgedrückt – dastechnische Grundprinzip, dasdie Stuttgarter Max-Planck-Forscher für die Herstellungvon Nanoröhrchen entwickelthaben. Sie bringen auf einHalbleitersubstrat zunächst eine Opferschicht und darüberdann zwei dünne Lagen ausMaterialien auf, die unter-schiedliche Kristalleigenschaf-ten haben. Die obere Schichthat eine kleinere, die untereSchicht eine größere Gitter-konstante. Dadurch entstehtzwischen beiden Lagen eineVerspannung, wie bei einem Bimetall. Wird nun die Opferschichtschrittweise vom Substrat weg-geätzt (Abb. 1), löst sich diedarüber liegende Doppelschichtals dünne Folie ab. Wegen derunterschiedlichen innerenSpannung der beiden Schich-ten rollt sich die Folie wie eineFeder ein und bildet – nach einer vollständigen Rotation –ein einfaches Nanoröhrchen.Ein derart aufgewickeltes Na-noröhrchen zeigt Abb. 2. DiesesRöhrchen besteht aus einer Silizium-Germanium-Folie, diezuvor auf einem Siliziumsub-strat aufgebracht worden war. „Wir haben schon Nanotubeshergestellt, die sich bis zu 30-mal aufrollten“, erklärt OliverSchmidt, einer der beiden Na-ture-Autoren. „Eine faszinie-rende Möglichkeit dieser Tech-nologie besteht darin, dassman die Nanotubes jetzt anfast jeder Stelle auf der Sub-stratoberfläche erzeugen kann.In dem abgebildeten Fall wur-de die Position präzise durchdie Probenkante und die Dauerdes selektiven Wegätzens derOpferschicht bestimmt“, sagtSchmidt. „Statt der Probenkan-te könnte man in die Schichtenauch an einer bestimmten Stel-le einen ‚Nanoschlitz’ einritzen,der dann zum Ausgangspunktfür das Aufrollen des Nanotube
FORSCHUNG aktuell
8 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Abb. 2: Elektronen-mikroskopischeAufnahme eines Silizium-Germani-um-Nanoröhrchens,dass sich kontrol-liert entlang derKante eines Sili-ziumsubstrats auf-gerollt hat.
Übergangsmetalle mit so ge-nannten 5f-Elektronen gehö-ren, bilden sich die Paare ausschweren Elektronen durch denAustausch von Fluktuationender magnetischen Momenteder Leitungselektronen. Diesemagnetischen Fluktuationensind – im Gegensatz zu Gitter-schwingungen bei gewöhn-lichen Supraleitern – starküberdämpft und können sichnicht wie diese frei ausbreiten.Die hierbei entstehenden Elek-tronenpaare haben zumeist einen endlichen Drehimpuls.Dieser Bindungsmechanismuswar bis heute allerdings nichtdirekt nachweisbar, da es nichtgelungen war, an diesen Supra-leitern Tunnelstromexperimen-te vorzunehmen, und diesedann – wie bei gewöhnlichenSupraleitern – mit Neutronen-streuexperimenten zu ver-gleichen. ❿
@
FOTO
+ G
RAFI
K: M
PI F
ÜR
FEST
KÖRP
ERFO
RSCH
UN
G
Intensität der Neutronenstreuung als Funktion von Energie und Wellenvektor. Der Balken rechts gibt denIntensitätsmaßstab (hellrot: hohe Intensität, dunkel-blau: niedrige Intensität). Das Gebiet hoher Intensitätvon links unten bis Mitte oben definiert die Energieder magnetischen Exzitonen als Funktion der Wellen-zahl L. Im Bereich hoher Intensität ist auch in denTunnelstromspektren für die entsprechende Spannungeine charakteristische Variation sichtbar.
Abb. 1: Schema-tische Darstellungdes Aufrollpro-zesses. Sobald dieverspannte Dop-pelschicht durchselektives Ätzenvom eigenen Sub-strat gelöst wird,rollt sich die epi-taktisch definierteSchicht zu einemNanoröhrchen auf.
En
erg
ie (
me
V)

FORSCHUNG aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 11
Dem japanisch-deutschen Wis-senschaftlerteam ist es nun ge-lungen, bei einem Supraleitermit schweren Elektronen (derVerbindung UPd2Al3) hochauflösende Neutronenstreuex-perimente durchzuführen unddiese mit bereits vorliegendenErgebnissen aus Tunnelstrom-experimenten zu vergleichen.UPd2Al3 gehört zu einer Handvoll so genannter Schwere-Fermionen-Supraleiter, in denen Antiferromagnetismus(eine Form des Magnetismus)und Supraleitung nebeneinan-der bestehen können. Zu ihrerÜberraschung stellten die Forscher fest, dass die Supra-leitung in diesem Material offenbar durch einen bisherunbekannten Mechanismusverursacht wird. Dieser neue Mechanismus derSupraleitung beruht auf demdualen Charakter der 5f-Elek-tronen von UPd2Al3: Zwei derdrei Elektronen sitzen fest an ihrem U-Atom. Der Grund-zustand beider Elektronen istvom ersten angeregten Zustanddurch eine feste Kristallfeld-Anregungsenergie getrennt.Das dritte 5f-Elektron bewegtsich frei durch den Kristall undführt zur elektrischen Leit-fähigkeit. Auf Grund derWechselwirkung zwischen denmagnetischen Momenten derbeiden festsitzenden 5f-Elek-tronen ist UPd2Al3 unterhalbeiner Temperatur von 14,2 Kmagnetisch geordnet. Und ausdemselben Grund entsteht ausder Kristallfeld-Anregung einbreites Band von magnetischenExziton-Anregungen, das beieiner Energie von etwa 1 meV(Millielektronenvolt) beginnt.In den Neutronenstreuexperi-menten ist es nun gelungen,diese wellenartigen Anregun-gen der lokalisierten 5f-Elek-tronen nachzuweisen und zuzeigen, dass sie sehr stark mitden supraleitenden 5f-Lei-tungselektronen in Wechsel-wirkung treten. Die Energiedieser Anregungen konnte alsFunktion ihrer Wellenzahl ge-messen werden. Dabei stellte
FORSCHUNG aktuell
10 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
sich heraus, dass bei derselbenEnergie das Spektrum vonUPd2Al3 im Tunnelstromexpe-riment charakteristische Struk-turen aufweist. Da diese Struk-turen direkt mit den Trägernder Bindungskräfte zwischenden supraleitenden Elektronenzusammenhängen, kommen dieForscher zu der Schlussfolge-rung, dass die Paarbindung derElektronen in supraleitendemUPd2Al3 durch den Austauschvon magnetischen Exzitonenverursacht wird. Diese Ergebnisse sind vongrundlegender Bedeutung fürdie Supraleiter-Forschung:Erstmals wurde ein Materialvorgestellt, in dem magnetischvermittelte Elektronenpaarungdieselbe Rolle spielt wie diePhonon-vermittelte Elektro-nenpaarung in konventionellenSupraleitern. Peter Thalmeier,einer der Autoren der Nature-Publikation: „Dieser neuartigeMechanismus der Supraleitungkommt zu den beiden bereitsbekannten hinzu. Jetzt mussnoch eingehend untersuchtwerden, welcher Drehimpulsder supraleitenden Elektronen-paare für diesen neuen Mecha-nismus realisiert wird.“ DieWissenschaftler gehen davonaus, dass dieser Mechanismusder Supraleitung auch bei an-deren Materialien mit schwe-ren Elektronen eine Rolle spie-len könnte. Um das nachzuwei-sen, müsste es aber auch beidiesen Supraleitern erst gelin-gen, Tunnelstromexperimentedurchzuführen und mit Mess-ergebnissen aus der Neutro-nenstreuung zu vergleichen. �
Weitere Informationen erhalten Sie von:
DR. PETER THALMEIER
Max-Planck-Institut für chemische Physik fester Stoffe,DresdenTel.: 0351/4646-2234Fax: 0351/4646-22 62E-Mail: [email protected]
@
GEOCHEMIE Vulkane am Meeresboden
Gestein wird im Erdmantelunter den mittelozeanischenRücken ständig neu aufge-schmolzen; dadurch fließtaus den Vulkanen am Mee-resboden Basalt aus. Dasssich dabei der Gehalt be-stimmter Haupt- und Spu-renelemente geochemischsehr ähnlich verhält, habenWissenschaftler am MainzerMax-Planck-Institut für Chemie bei der Analyse vonErdmantelmineralen heraus-gefunden (NATURE, 5. April2001). Die jetzt festgestellteKorrelation ermöglicht es,mit einfachen Mitteln denAufschmelzungsgrad entlangder ozeanischen Rücken zubestimmen und damit in Zukunft die Variation derErdmanteltemperatur.
Etwa 70 Prozent unserer Erdesind mit Wasser und daruntermit submarinen Vulkangestei-nen (Basalten) bedeckt. Der Basalt bildet sich an den mit-telozeanischen Rücken im Pazi-fik und Atlantik ständig neu.Die Entstehung der mittel-ozeanischen Rückenbasalte isteiner der wichtigsten Stoff-
flüsse auf der Erde. Jährlich bilden sich entlang der 75.000Kilometer langen mittelozea-nischen Rücken mehr als 20Kubikkilometer neue magma-tische Kruste. Das entsprichtetwa 90 Prozent der globalenMagmaproduktion. Obwohlozeanische Rücken und mit-telozeanische Rückenbasalte zuden am meisten untersuchtengeologischen Themen gehören,gibt es noch immer einige offene Fragen. Dazu zählen derabsolute Aufschmelzgrad desErdmantels und die Faktoren,die diesen bestimmen. Das Aufschmelzen unter denmittelozeanischen Rücken kann man am besten mit einemSchwamm vergleichen, ausdem beim langsamen Aufstei-gen Magma herausgepresstwird und auf den Ozeanbodenfließt. Unter der sechs bis sie-ben Kilometer dicken basalti-schen Kruste bleibt der trocke-ne Schwamm in Form vonHarzburgit – ein magnesium-reiches Gestein, zum ersten Mal im 19. Jahrhundert in BadHarzburg beschrieben – imobersten Erdmantel zurück.Beim Aufschmelzen werden sogenannte inkompatible Be-standteile (wie Aluminium) undSpurenelemente (wie die selte-nen Erden) aus dem Harzburgitentfernt und in das Magma
aufgenommen. An bestimmtenStellen in der ozeanischen Kruste konnten in den vergan-genen Jahrzehnten solcheMantel-Harzburgite untersuchtund zusätzliche Informationüber die Bildung von mittel-ozeanischen Rückenbasaltengewonnen werden. BisherigeArbeiten zeigten, dass der Aufschmelzgrad – die „Tro-ckenheit“ des ausgepresstenSchwammes – nicht überallgleich ist, sondern in Abhän-gigkeit von der Manteltempe-ratur, der Geschwindigkeit, mitder sich die tektonischen Plat-ten auseinander bewegen, undweiteren Faktoren variiert. Die Zusammensetzung derMantelminerale aus den mit-telozeanischen Rücken enthältInformationen über diesen va-riablen Aufschmelzprozess. Sozum Beispiel das meerwasser-resistente Mineral Spinell, des-sen Verhältnis von Chrom (Cr)zu Aluminium (Al), Cr/(Cr+Al),die so genannte Cr-Zahl, imAllgemeinen als guter qualita-tiver Indikator für den Auf-schmelzgrad betrachtet wird,da das eine Element (Cr) imMantelmineral verbleibt, wäh-rend das andere (Al) in dieSchmelze übergeht. Die Elek-tronenstrahl-Mikrosonde liefertdie Hauptelementzusammen-setzung der vorhandenen Man-telrelikte. Die Konzentrationender inkompatiblen Spurenele-mente werden mit der wenigerverbreiteten Ionensonde be-stimmt. Die entscheidendeHürde zum quantitativen Ver-ständnis der Schmelzvorgängeunter den mittelozeanischenRücken war aber bisher, dassdiese beiden Methoden zur Bestimmung des Aufschmel-zungsgrads nicht miteinanderin Einklang zu bringen waren –ein Grund, weshalb diese Gesteine bisher relativ seltenuntersucht wurden.Eric Hellebrand hat im Rahmenseiner Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für ChemieTiefseeharzburgite des Indi-schen Ozeans untersucht unddabei festgestellt, dass die
Dünnschliff von un-tersuchten Mantel-mineralen, betrachtetunter dem Mikro-skop in polarisiertemLicht (Bildbreite 1,8 mm). Die Pfeilemarkieren die„Einschusskrater“(nur 20 MikrometerDurchmesser!), diebei der Messung mitder Ionensonde ent-standen sind. DiesesKorn ist von beson-derer Bedeutung,weil es die niedrig-sten inkompatiblenSpurenelementge-halte aller bisher gemessenen Mantel-gesteine vom Ozean-boden besitzt.
FOTO
: MPI
FÜ
RCH
EMIE
fehlende Korrelation zwischenHaupt- und Spurenelementenin den Harzburgiten zum Teilauf einem Irrtum beruht. Dievon Hellebrand untersuchtenProben und weitere, aus der Literatur bekannte Daten an-derer Peridotite, zeigen, dassbestimmte Spurenelemente wiedie schweren Seltenerdelemen-te Dysprosium, Erbium und Ytterbium sehr gut mit der Cr-Zahl der koexistierendenSpinelle korrelieren. Spurenele-mente wie die leichten Selten-erdelemente (zum BeispielLanthan und Cer) korrelierenhingegen überhaupt nicht mitder Spinell-Zusammensetzungund sind also tatsächlich vomVerhalten der Hauptelementeentkoppelt. Die Auswertungder guten Korrelation zwischenschweren Seltenerdelementenund Cr-Zahl im Spinell ergibteinen quantitativen Auf-schmelzindikator für Residuen,welcher auf dem Spinellche-mismus basiert. Damit könnender Schmelzgrad als Funktionder vergleichsweise einfachmessbaren Cr-Zahl im Spinellausgedrückt und die oben erwähnten geodynamischenFragestellungen aus einer neuen Perspektive betrachtetwerden. Zukünftig könnten somit heiße und kalte Fleckenim Erdmantel unter den mittelozeanischen Rücken sowie deren zeitliche Entwick-lung auskartiert werden. �
Weitere Informationen erhalten Sie von:
DR. ERIC HELLEBRAND
Max-Planck-Institut für Chemie, MainzTel.: 06131/305-220 Fax: 06131/371-051E-Mail: [email protected] DR. JONATHAN SNOW
Max-Planck-Institut für Chemie, MainzTel.: 06131/305-202 Fax: 06131/371-051E-Mail: [email protected]
@

FORSCHUNG aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 13
FORSCHUNG aktuell
12 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Pflanzen speichern in ihrenSamen und Früchten großeMengen von Zucker- undAminosäure-Nährstoffen alsGrundversorgung für ihrenNachwuchs. Diese Vorrätehaben Krankheitserreger, wiebeispielsweise Schadpilze,zum Fressen gern. Um ihrenNachwuchs zu schützen,„vergiften“ Pflanzen mit ei-ner Reihe von AbwehrstoffenFrüchte und Samen. Nebenbereits bekannten, so ge-nannten Defensinen und Enzym-Inhibitoren habenWissenschaftler im Team umDr. Richard Thompson amKölner Max-Planck-Institutfür Züchtungsforschung injungen Maiskörnern ein wei-teres Arsenal bisher unbe-kannter Abwehrproteine mitbreiter fungizider (pilztöten-der) Wirkung entdeckt. Darüber berichten die For-scher in dem Magazin THE
PLANT JOURNAL (issue 25/6, pp 687-698).
Aufgespürt wurden die neu-artigen Anti-Pilz-Proteine inder Grenzschicht zwischen derpflanzlichen Plazenta und demheranwachsenden Maissamen.Sie werden deshalb als BasalLayer Antifungal Proteins(BAPs) bezeichnet. BAPs wer-den als inaktive Propeptidesynthetisiert. Anschließendspalten Enzyme die Propeptideund setzen aktive BAP-Peptidefrei. Sie bestehen aus etwa 40 Aminosäuren. Diese BAP-Peptide werden hauptsächlich
in einer dicken, aus mütter-lichem Gewebe aufgebautenZellwand gespeichert, die an das Korn grenzt. Hier reichern sich die aktivenPeptide innerhalb nur wenigerTage an, wenn Samen undFrüchte sich entwickeln unddie Konzentration an Nährstof-fen besonders große Werte er-reicht. Im reifen Korn hingegensind die Abwehrproteine nichtzu finden. Vermutlich schützendie BAP-Peptide das jungeMais-Korn demnach über dienährstoffreichen, mütterlichenVersorgungszellen vor einemAngriff der Schadpilze.Dem Team um Richard Thomp-son gelang der Nachweis, dassbereits geringste Konzentratio-nen an aktiven BAP-Peptidendas Wachstum des Getreide-Schädlings Fusarium culmore-um hemmen. Gleiches gilt auchfür viele andere Pilzarten. Sokonnten die Wissenschaftlerdes Kölner Max-Planck-Insti-tuts für Züchtungsforschungzeigen, dass BAP-Peptide nichtnur das Pilzwachstum unter-drücken, sondern auch diePilzäste verkümmern lassen.Einen Hinweis darauf, wie dieBAP-Peptide ihre Wirkung ent-falten, erhielten die Kölner For-scher mithilfe eines Nuklein-säure bindenden Indikatorfarb-stoffs. Dazu versetzten die Wissenschaftler verschiedeneSchadpilze sowohl mit denPeptiden als auch mit demFarbstoff. Daraufhin begannendie Zellkerne deutlich zu flu-oreszieren. Der Farbstoff kannsich jedoch nur an die Nukle-insäuren binden, wenn er diePilzmembranen durchdrungenhat. Das setzt voraus, dass dieMembranen durchlässig oderbeschädigt sind. Wie allerdingsdie BAP-Peptide in die Mem-bran eindringen können, istbisher noch unklar. Zur Zeituntersucht die Arbeitsgruppeam Max-Planck-Institut, ob dieBAP-Peptide selbst Poren in der
ZÜCHTUNGSFORSCHUNG
Pflanzen als Giftmörder
Querschnitt durch ein junges Maiskorn an derGrenzschicht zummütterlichen Gewebe. Das BAP-Peptid wurde mit einem Antikörper-Farbstoff gekop-pelt und erscheintschwarz.
FOTO
: MPI
FÜ
RZÜ
CHTU
NG
SFO
RSCH
UN
G
Membran verursachen oder ob sie mit spezifischen Rezep-toren zusammenwirken.Neben solchen biochemischenStudien haben die Max-Planck-Züchtungsforscher die Geneuntersucht, welche die ver-schiedenen BAP-Proteine ko-dieren. Eine Kartierung ergab,dass die Gene in Gruppen aufden Mais-Chromosomen ange-ordnet sind. Zudem fanden dieWissenschaftler auch BAP-Ge-ne in Teosinte, der Ursprungs-form von Mais, und in Hirse.Alle drei Pflanzensorten zählenzu einer Unterfamilie der Grä-ser. BAP-Gene kommen aberweder in anderen Getreidear-ten noch in sonstigen Pflanzenvor. Das könnte darauf hindeu-ten, dass sich Pflanzen dieserGräser-Unterfamilie im Laufder Evolution schnell auf be-stimmte Krankheitserreger ein-gestellt haben. Da die BAP-Peptide gegenübereiner Vielzahl von schädlichenPilzen als natürliches Abwehr-mittel wirken und zudem nurzeitlich und räumlich begrenztauftreten, lassen sie sich in Zu-kunft vielleicht als Alternativezu synthetischen Pilzbekämp-fungsmitteln nutzen. So er-scheint es möglich, BAP-Genemit speziellen genetischenSteuerelementen (Promoto-ren) zu koppeln und aufPflanzen zu übertragen, die gegen Schadpilze besondersanfällig sind, wie beispielsweiseWeinreben. Sie würden danndie Abwehr-Peptide nur an denStellen bilden, die von den Erregern angegriffen werden.Für die menschliche Gesund-heit sind die BAP-Peptide vermutlich unbedenklich. Siewerden mitverspeist, wenn wir zum Beispiel Maiskolbenoder -körner essen. Der für die menschliche Ernährung an-gebaute Süßmais wird nämlichbereits im unreifen Zustand geerntet, wenn die BAPs besonders aktiv sind. �
Weitere Informationen erhalten Sie von: DR. RICHARD THOMPSON
Max-Planck-Institutfür Züchtungs-forschung, KölnTel.: 0221/5062-440Fax: 0221/5062-413E-Mail: [email protected]
@
HIRNFORSCHUNG
Delphine sind farbenblindDie meisten Säugetiere kön-nen Farben sehen. Grundlagedafür sind zwei spektral unterschiedlich empfindlicheTypen von Zapfen-Photo-rezeptoren in der Netzhaut,die Blau- und die Grünzap-fen. Wissenschaftler amMax-Planck-Institut fürHirnforschung in Frank-furt/Main, am Alfred-Wege-ner-Institut in Bremen undan der Universität Lund inSchweden haben entdeckt,dass Walen und Robben dieBlauzapfen fehlen (EUROPEAN
JOURNAL OF NEUROSCIENCE, Vol. 13, pp. 1520-1528, April 2001). Diese Meeres-säuger besitzen nur Grünzap-fen und sind damit farben-blind, denn mit nur einemZapfentyp sind keine Farb-unterscheidungen möglich. Hingegen verfügen die anLand lebenden Verwandtender Wale und Robben nochüber beide Zapfentypen.
Menschen und viele anderePrimaten können sehr gut Far-ben sehen. Das ermöglichendrei Typen von Zapfen-Photo-rezeptoren (Lichtsinneszellen)mit unterschiedlicher spektra-ler Empfindlichkeit in der Netzhaut des Auges: die Blau-,Grün- und Rotzapfen (trichro-matisches Farbensehen). Diemeisten anderen Säugetiere
sind etwas weniger farbtüchtig.Sie besitzen nur zwei Zapfen-typen: Blau- und Grünzapfen.Einige Arten haben nur Blau-und Rotzapfen. Dieses dichro-matische Farbensehen ist ge-wissermaßen die Grundausstat-tung im Bauplan der Säuge-tiere. Zwei große Gruppen vonMeeressäugern, die Wale undRobben, fallen jedoch aus diesem Muster völlig heraus. Walen und Robben fehlen dieBlauzapfen, sie besitzen nur dieGrünzapfen. Da sich mit nur ei-nem Zapfentyp Farben nichtunterscheiden lassen, sind Waleund Robben somit farbenblind(Zapfen-Monochromaten). Darüber hinaus ist ihre Hellig-keits- und Kontrastwahrneh-mung im blauen Bereich desSpektrums stark eingeschränkt.Der Defekt erscheint den Wissenschaftlern paradox, dain klarem Meerwasser das Licht mit zunehmender Tiefeimmer blauer wird. Bei der Untersuchung der Augen verschiedener Meeres-säuger stießen Leo Peichl vomMax-Planck-Institut für Hirn-forschung, Günther Behrmannvom Alfred-Wegener-Institutfür Polar- und Meeresfor-schung in Bremen und RonaldKröger vom Zoologischen Institut der Universität Lund(Schweden) auf ein überra-schendes Defizit: Allen 14
untersuchten Arten aus denGruppen der Zahnwale (Delphi-ne), der Seehunde und der See-löwen fehlen die blauempfind-lichen Zapfen; in ihrer Netz-haut finden sich nur die Grün-zapfen und die für das Däm-merungssehen wichtigen Stäb-chen-Photorezeptoren. Der Defekt wurde immunzytoche-misch mit Antikörpern gegendie Sehfarbstoffe (Opsine) derZapfen nachgewiesen. DieseMethode erlaubt die Untersu-chung konservierter Augen vongestrandeten oder in Zoos gestorbenen Meeressäugern.Peichl, Behrmann und Krögervermuten aufgrund ihrer taxo-nomisch breiten Stichproben,dass alle Wale und Robben denBlauzapfen-Defekt haben. Wa-le und Robben sind stammes-geschichtlich nicht miteinanderverwandt. Die Wale stammenvon landlebenden Paarhufernab, ihr nächster terrestrischerVerwandter ist das Flusspferd.Die Robben haben sich auslandlebenden Raubtieren (Car-nivoren) entwickelt, zu ihrennahen Verwandten zählen zumBeispiel Wolf, Frettchen undFlussotter. Bei all diesen terre-strischen Verwandten fand dieForschergruppe Blauzapfen.Der Verlust der Blauzapfen beiden marinen Vertretern dieserbeiden so unterschiedlichenSäugergruppen spricht für eineevolutionäre Anpassung (kon-vergente Evolution) an denmarinen Lebensraum und ❿
FOTO
: ZO
OLO
GIS
CHEN
INST
ITU
TD
ERU
NIV
ERSI
TÄT
LUN
D/ R
ON
ALD
KRÖ
GER Großer Tümmler: In den Augen
dieser Meeressäuger fehlen die Blauzapfen, sie besitzen nurGrünzapfen. Der evolutive Vor-teil des Blauzapfenverlustes bei Meeressäugern ist rätselhaft,denn in klarem Meerwasser wird das Licht mit zunehmender Tiefe immer blauer.

FORSCHUNG aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 15
FORSCHUNG aktuell
14 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
im ersten Lebensjahr unter ei-nem höheren Sterblichkeitsrisi-ko leiden und diese Selektionnur die robustesten Kinderüberleben lässt, die dann län-ger leben. Die vierte Hypothesehieß: Saisonal auftretende negative Umwelteinflüssewährend der Entwicklung desFötus oder im ersten Lebens-jahr erhöhen die Anfälligkeitfür Krankheiten im Erwachse-nenalter.Die aufwendigen statistischeUntersuchungen von GabrieleDoblhammer-Reiter und JamesVaupel, dem Direktor des Insti-tuts, beweisen nun, dass es vorallem letztere Hypothese ist,die die Gründe für die unter-schiedliche Lebenserwartungliefert. Umwelteinflüsse, denender Mensch im Mutterleib undin den ersten Lebensjahrenausgesetzt ist, können bis zueinem Viertel für das Variierenmenschlicher Langlebigkeitverantwortlich gemacht wer-den, glauben die Wissenschaft-ler; ein weiteres Viertel liegeaber auch in genetischen Ur-sachen und die verbleibendenzwei Viertel verteilten sich aufdie erwachsenen bzw. jeweilsaktuellen Lebensumstände imAlter. Zu den Umwelteinflüssen vorder Geburt gehören in ersterLinie Ernährungslage und Ge-sundheitszustand der Mutterwährend der Schwangerschaft,die sich wiederum auf das Ge-burtsgewicht des Kindes aus-wirken. So gibt es eine Reihevon Untersuchungen, nach de-nen Säuglinge mit unterdurch-schnittlichem Geburtsgewichtals Erwachsene häufiger anBluthochdruck, erhöhtem Cho-lesterinspiegel und verminder-ter Lungenfunktion leiden – alles Krankheiten, die zu einemfrühen Tode führen können.Die Forschung über Geburtsge-wicht insgesamt legt nahe, dassdie Bedingungen im Mutterleibmit Ernährungsstatus und Ge-sundheit auch jahreszeitlichbestimmt sind. So treten eineReihe von Infektionskrankhei-ten saisonal gehäuft auf. ❿
Wer bislang dachte, benach-teiligt zu sein, weil er in dendüsteren Wintermonaten Geburtstag hat, der irrt. Klar,man kann nicht zur gemüt-lichen Gartenparty einladenund muss deswegen bei der Zahl der Gäste auf dieWohnzimmergröße Rücksichtnehmen. Aber dafür ist dieChance groß, dass man zu-mindest öfter feiert. Denn:Die weitere Lebenserwartungeines Menschen im Alter von50 Jahren hängt von seinemGeburtsmonat ab, wie Gabri-ele Doblhammer-Reiter undJames W. Vaupel vom Max-Planck-Institut für demo-grafische Forschung in Rostock herausfanden. Werzwischen Oktober und Dezember auf die Welt kam,kann im Durchschnitt sechsMonate länger leben als imApril, Mai oder Juni Gebore-ne – egal ob Mann oder Frau(PNAS, 27. Februar 2001).
Der Unterschied scheint zwargering. „Würde man jedoch dieKrebssterblichkeit komplett eli-minieren, verlängerte sich dieLebenserwartung „nur“ um et-wa drei Jahre. Daran gemessen,ist ein halbes Jahr doch sehrviel“, meint Doblhammer-Rei-ter. Dass der Befund kein Zufallist, hat die Demografin anhandstatistischer Untersuchungenvon riesigen, kompletten Be-völkerungsdaten dreier Länderüberprüft; es heißt darum nun:Der Unterschied in der Lebens-erwartung ist statistisch signi-fikant. Insgesamt basieren dieErgebnisse auf mehr als einerMillion Geburts- und Sterbe-daten von Menschen ausÖsterreich, Dänemark und Australien. Sie haben also denVorteil einer breiten, unselek-tierten Datenbasis, während
vorangegangene Studien bis-lang vergleichsweise kleine Datenmengen von Teilpopula-tionen nutzten. So kommt Ells-worth Huntington zwar dasVerdienst zu, bereits 1938 ei-nen Zusammenhang in den Un-terschieden der Lebenserwar-tung mit dem Geburtsmonaterkannt zu haben. Doch seineAussagen waren Ergebnis vongenealogischen Informationenvon lediglich 39.000 Personen.Ein interessantes Detail, dasdarüber hinaus belegt, wie wenig zufällig die höhere Lebenserwartung ist, findetman in der Verschiebung diesesMusters auf der südlichen Erd-halbkugel. Dort ist es genauumgekehrt; in Australien lebennämlich die im zweiten QuartalGeborenen am längsten. Dasses vor allem frühe Lebensum-stände zu sein scheinen, diedafür verantwortlich sind, be-weist die Tatsache, dass beienglischen Einwanderern inAustralien der Zusammenhangvon Geburtsmonat und Lang-lebigkeit dem der Herkunfts-region, also in diesem Fall derenglischen Heimat in der nörd-
DEMOGRAFIE
Im Herbst Geborene leben länger
lichen Hemisphäre, entspricht.Der spürbare Rückgang der Al-terssterblichkeit im letzten hal-ben Jahrhundert hat zu einemrapiden Anwachsen der älterenBevölkerung geführt. Trotzdemsei das Wissen über die Fakto-ren, die Sterblichkeit und Über-leben im höheren Alter beein-flussen, noch begrenzt, erläu-tert Doblhammer-Reiter einenAusgangspunkt ihrer For-schungsüberlegungen. Zwarstellten aktuelle Forschungser-gebnisse die Rolle der soge-nannten early-life factors imZusammenhang mit Sterblich-keit im höheren Alter bereitsheraus. Umweltbedingungenwährend der Schwangerschaftsowie in den ersten Lebens-jahren eines Kindes beeinflus-sen demnach die Gesundheitvon Erwachsenen und ihreSterblichkeit signifikant. Dochdiese Ergebnisse würden immer noch kontrovers diskutiert. Im Mittelpunkt ihrer Über-legungen stand für die Demo-grafin die Annahme, dass derGeburtsmonat ein Indikator für Umweltbedingungen seinkönnte, weil diese wiederum je nach Jahreszeit besser oderschlechter sind. Nachdem dieDaten diesen Zusammenhangbestätigten, testete sie vier Hy-pothesen bzw. mögliche Grün-de zur Erklärung des gefunde-nen Musters. Die erste ging davon aus, dass die Beziehungzwischen Alter und saisonalerVerteilung von Sterblichkeit dieUnterschiede verursacht (Bei-spiel: Menschen, die im Aprilgeboren sind, sind älter als imNovember Geborene, wenn siedas höhere Sterblichkeitsrisikodes Winters trifft.) Die zweiteHypothese testete eine Kon-stellation von sozialen Fakto-ren, die das saisonale Timingvon Geburten möglicherweisebeeinflussen, während die drit-te Hypothese den Unterschiedin der Lebenserwartung mitjahreszeitlichen Unterschiedenin den Überlebenswahrschein-lichkeiten im ersten Lebensjahrzu erklären suchte. Das meint,dass im Herbst geborene Kinder
damit für einen adaptiven Vorteil des Defekts.Rätselhaft wird die Sache aller-dings durch das Phänomen,dass bei der Ausbreitung vonLicht in klarem Wasser, zumBeispiel im offenen Meer, dielangwelligen Anteile bevorzugtgestreut werden und deshalbmit zunehmender Wassertiefedie kurzwelligen, blauen An-teile immer mehr dominieren –ein Effekt, den jeder Taucherkennt. Unter diesen Bedingun-gen erscheint der Verlust derBlauzapfen als denkbarschlechte Anpassung. Selbstwenn Farbensehen (auf der Basis von mindestens zwei Zapfentypen) in einer mono-chrom blauen Unterwasserweltnicht besonders nützlich ist, so sollte doch zur Kontrast-und Helligkeitswahrnehmungder Zapfentyp erhalten bleiben,der das vorhandene Licht ambesten nutzen kann. So besit-zen viele Fische, die in ver-gleichbaren Lichtverhältnissenleben, Blauzapfen.Die Forscher nehmen an, dassder Verlust der Blauzapfen ineiner frühen Phase der Evolu-tion aufgetreten ist, als die ersten Vertreter der Wale undRobben auf dem Weg zurückins Meer zunächst nur küsten-nahe Gewässer bewohnten.Dort ist das Licht unter Wasserwegen des höheren Gehaltesan organischen und anorgani-schen Trübstoffen langwelligerund enthält nur geringe Blau-anteile und der Verlust „un-
tätiger“ Blauzapfen wäre einevorteilhafte oder zumindestunschädliche Entwicklung. Der Wegfall des Farbensehenskönnte die visuelle Informa-tionsverarbeitung im Gehirnvereinfacht haben, wodurchKapazitäten für andere sensori-sche Leistungen frei wurden.So haben viele Wale ein Echo-Ortungssystem entwickelt undRobben können die von Beute-fischen erzeugten Wasserbe-wegungen mit ihren Schnurr-haaren wahrnehmen.Für die Arten, die auch heutenoch küstennah leben, wäreder Blauzapfenverlust weiter-hin vorteilhaft. Die Arten hin-gegen, die im Verlauf der Evo-lution das offene Meer eroberthaben, würden nun wahr-scheinlich von Blauzapfen pro-fitieren, doch der in der Evolu-tion eingetretene genetischeDefekt ist wohl so gravierend,dass er sich nicht rückgängigmachen lässt. „Vielleicht ist jadie Farbenblindheit der Waleund Robben der Preis, den die-se Säugetiere für den Zugangzu der Fülle an Nahrungsmit-teln in den Meeren zahlenmussten“, sagt Leo Peichl. �
Weitere Informationen erhalten Sie von: PD DR. LEO PEICHL
Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Frankfurt/MainAbteilung NeuroanatomieTel.: 069/96769-348Fax: 069/96769-206E-Mail: [email protected]
@
Zapfen-Photorezeptorenin der Netzhaut einerRingelrobbe, eingefärbtmit einem Antiserum gegen das Sehpigmentder Grünzapfen. Robbenund Wale besitzen nurdiesen grünempfind-lichen Zapfentyp. DerPlatz zwischen den Zap-fen ist mit den zahlrei-cheren Stäbchen-Photo-rezeptoren gefüllt, diedas Dämmerungssehenvermitteln.
FOTO
: MPI
FÜ
RH
IRN
FORS
CHU
NG
/ LEO
PEIC
HL
FOTO
: STO
CKM
ARKE
T

FORSCHUNG aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 17
FORSCHUNG aktuell
16 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Wissenschaftler des Fritz-Haber-Instituts fanden heraus,dass (137)-Bereiche nur bis zueiner bestimmten, sehr kleinenAusdehnung stabil bleiben. Dies könnte möglicherweise erklären, warum alle Quanten-punkte ungefähr dieselbeGröße haben. Für technologische Anwendun-gen werden die Nanoberge ausInAs mit GaAs zugedeckt. Auf-grund der unterschiedlichen Ei-genschaften dieser beiden Ma-terialien werden Ladungsträger(Elektronen und Löcher) in denInAs-Quantenpunkten „einge-sperrt“. Wegen der winzigenAusdehnung der Inseln kom-men dabei die Gesetzmäßigkei-ten der Quantenphysik zumTragen, und die Ladungsträgerkönnen nur bestimmte Zu-
stände einnehmen. Die Entdeckungen der BerlinerPhysiker könnten auf längereSicht Halbleiter-Laser entschei-dend verbessern: Die Wellen-länge ( „Farbe“) des ausgesand-ten Lichts hängt nämlich vonForm und Größe der als Laser-medium eingesetzten Quanten-punkte ab. Ein Ziel von weite-ren Untersuchungen wird des-halb sein, die spontanen Bil-dungsprozesse dieser winzigenNanoberge so zu steuern, dassBauelemente möglich werden,die mit hoher Effizienz Lichtauch in Farben liefern, die fürherkömmliche Halbleiterlaserbisher unerreichbar waren. �
Weitere Informationen erhalten Sie von: PROF. DR. KARL JACOBI
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, BerlinTel.: 030/8413-5201Fax: 030/8413-5106E-Mail: [email protected]
Wissenschaftler des BerlinerFritz-Haber-Instituts der Max-Planck-Gesellschaft haben die atomare Strukturvon Quantenpunkten aus demHalbleitermaterial Indium-arsenid entschlüsselt. Das ge-lang Forschern der AbteilungPhysikalische Chemie um Prof. Karl Jacobi mithilfegleichzeitiger Untersuchungenvon Galliumarsenid. Bei die-sem Halbleiter mit ähnlichenEigenschaften wurde eine bis-her völlig unbekannte, stabileOberfläche entdeckt. (Appl.PHYS. LETTER Band 78, Seite2309, 16.04.2001 / PHYS. REV.LETTER Band 86, Seite 3815,23.04.2001).
Quantenpunkte aus Halbleiter-kristallen sind winzige, aus nureinigen zehntausend Atomenbestehende „Inseln“ – noch hun-dertmal kleiner als die derzeiti-gen Bauelemente der Mikroelek-tronik. Mit ihren Abmessungenvon nur wenigen Nanometern(millionstel Millimeter) besitzendiese ultrakleinen Systemegrundlegend neue physikalischeEigenschaften. Bereits bei Zim-mertemperatur wirken Quanten-punkte als Käfige für Elektronen.Darin können sich die Ladungs-träger nicht mehr frei bewegen,ihre Energie ist vollständig„quantisiert“. Quanteneffekte bestimmen in solchen Nano-kristallen aus Halbleitermaterialdas Geschehen. In Quantenpunkten könnenElektronen nur noch ganz be-stimmte – diskrete – Energie-niveaus besetzen. Das sind Bedingungen wie in einem ein-zelnen Atom. Springt beispiels-weise ein Elektron vom höherenin den niedrigeren Energiezu-stand, wird der Energieunter-schied in Form von Licht ausge-strahlt. Quantenpunkte eignensich daher besonders als aktivesMedium für Halbleiterlaser. Nanostrukturen aus Halbleiter-materialien gelten deshalb alsSchlüsseltechnologie für künf-
tige Bauelemente der Quanten-und Opto-Elektronik, sie stehenweltweit im Mittelpunkt intensi-ver Forschungen.Voraussetzung für den techni-schen Einsatz von Quantenpunk-ten ist die genaue Kenntnis desatomaren Aufbaus der Halblei-ter-Nanokristalle. Auf dieserwinzigen Größenskala ist einegezielte Strukturierung mitWerkzeugen oder Masken, wiesie etwa aus der Produktion vonMikrochips bekannt ist, praktischnicht möglich. Die dafür bishervor allem eingesetzten Ätzver-fahren verursachen zu viele Defekte in den Strukturen undmachen sie damit unbrauchbar.Vielmehr werden die natürlichenOrdnungskräfte beim Wachstumvon Halbleitern ausgenutzt. Ohne fremde Einwirkung ent-stehen solche Quantenpunkteselbstorganisiert, sie bilden sichalso quasi von alleine. Dabei istes für technologische Anwen-dungen (etwa in Lasern) wichtig,dass die so erzeugten Quanten-punkte eine möglichst gleichar-tige, regelmäßige Form und einevorherrschende Orientierung er-halten. Doch diese selbstständigablaufenden Mechanismen, diezur Bildung der Inseln im Halb-leiter führen, konnten bisher
nur unvollständig nachvollzo-gen werden. Mit der Entschlüs-selung der genauen Strukturvon Indiumarsenid-Quanten-punkten sind Wissenschaftlerum Karl Jacobi am BerlinerFritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft einenwichtigen Schritt vorangekom-men.Mithilfe der Molekularstrahl-Epitaxie (MBE) werden Quan-tenpunkte aus Indiumarsenidhergestellt, indem eine geringeMenge Indiumarsenid (InAs)auf eine Unterlage ausGalliumarsenid (GaAs) aufge-bracht wird. Dabei bedeckt nurdie erste atomardünne InAs-Schicht die Unterlage gleich-mäßig. Danach läuft das wei-tere InAs zu winzigen kristalli-nen Inseln, den Quantenpunk-ten, zusammen. Diese Nano-berge wurden von den BerlinerWissenschaftlern mit der fei-nen Spitze eines Rastertunnel-mikroskops abgetastet. Bei dieser Technik entsteht von der Oberfläche eine Abbildung, die einzelne Atome zeigt. Aller-dings ist die Interpretation dieser Bilder sehr schwierigund nicht immer eindeutig.Parallel dazu untersuchten dieWissenschaftler daher Ober-flächen von Galliumarsenid; eshat sehr ähnliche physikalischeEigenschaften wie Indiumarse-nid. Dabei entdeckten die Max-Planck-Forscher eine völligneue stabile GaAs-Oberfläche.Ein Vergleich der entsprechen-den Aufnahmen aus dem Rastertunnelmikroskop liefertedann den Schlüssel zum ato-maren Aufbau der InAs-Quan-tenpunkte: Sowohl die neueOberfläche als auch die Seiten-flächen der „Nanoberge“ wei-sen außergewöhnliche Orien-tierungen auf, die bisher nichtbeobachtet worden waren. Inder Sprache der Kristallogra-phen werden die GaAs-Ober-fläche mit (2 5 11) und die InAs-Seitenflächen mit (137)bezeichnet. Die Zahlenkombi-
HALBLEITER Atomare Struktur von Quantenpunkten entschlüsselt
nationen beschreiben dabei jeweils eine Richtung im drei-dimensionalen Raum.Kristalle können in verschiede-nen Orientierungen geschnit-ten werden. Dadurch entstehenverschiedene Oberflächen, diesich durch die Anordnung ihrerAtome unterscheiden. Abernicht jede der möglichen Ober-flächen ist stabil. Den Atomenan der Oberfläche eines Kri-stalls fehlen im Vergleich zuden Atomen im Inneren Bin-dungspartner. So entstehen of-fene Bindungen, die energe-tisch ungünstig sind. Deshalbsind viele Oberflächen instabil.Als Modell für den GaAs-Kris-tall und den gleichartigen InAs-Kristall kann im einfach-sten Fall ein Würfel angenom-men werden. Seine Oberflächewird als (001)-Fläche bezeich-net. Normalerweise werden nur solche Oberflächen unter-sucht und technologisch ein-gesetzt, die den Seiten- oderDiagonalflächen des Würfelsentsprechen. Diese Oberflächensind stabil. Von allen anderen,schräg im Würfel liegendenFlächen wird generell erwartet,dass sie in kleine Facetten derstabilen Oberflächen zerfallen.Die Berliner Wissenschaftlerfanden jetzt erstmals eine sta-bile GaAs-Oberfläche, die „sehrschräg“ im Kristallwürfel liegt.Mit der Analyse der Ober-flächenstruktur und theoreti-schen Berechnungen von PeterKratzer konnten die Physikerdas generelle Verständnis vonHalbleiter-Oberflächen verbes-sern. Solche Erkenntnisse wer-den für die Halbleiter-Industriezunehmend wichtig, da dieStrukturen elektronischer Bau-elemente immer kleiner werdenund damit der Anteil vonOber- und Grenzflächen stän-dig zunimmt. Darüber hinaus lieferten diese Oberflächenuntersuchun-gen auch wichtige Hinweise für den Entstehungsprozess derInAs-Quantenpunkte. Die
Oben: MehrereIndiumarsenid-Quantenpunkte(orangefarbene„Berge“) auf einer Unterlageaus Gallium-arsenid.
Unten: Detail-ansicht schrägvon oben eineseinzelnen Indium-arsenid-Quanten-punkts. Die klei-nen „Buckel“ auf den Seiten-flächen entspre-chen jeweils zweiArsenatomen.
Seitenansicht eines einzelnenIndiumarsenid-Quantenpunkts.Die kleinen„Buckel“, die aufder linken Seiten-fläche in einemregelmäßigen
Gitter angeordnetsind, entsprechenjeweils zweiArsenatomen.
@
RAST
ERTU
NN
ELM
IKRO
SKO
PISC
HE
AUFN
AHM
EN: F
RITZ
-HAB
ER-I
NST
ITU
TD
ERM
AX-P
LAN
CK-G
ESEL
LSCH
AFT
In früheren Jahrhunderten waraußerdem die Ernährungslage jenach Jahreszeit besser oderschlechter. Obst und Gemüse wa-ren im Sommer und Herbst leich-ter und preiswerter zu bekom-men. Im Winter dagegen war einMangel an Vitaminen oder Mi-kronährstoffen keine Seltenheit.Wer also im Sommer und Herbstschwanger war, lebte einfach ge-sünder.Dass dies auch heute noch gilt,obwohl es rund ums Jahr jedesnur erdenkliche Obst und Gemüsegibt, kann nicht ausgeschlossenwerden. Die Beziehung zwischenGeburtsmonat und Lebenserwar-tung der später geborenen Jahr-gänge ist im Datenmaterial zwarsignifikant kleiner, bleibt aberweiterhin bestehen. Die Befunde,so Doblhammer-Reiter und Vau-pel, seien für die klinische Praxisund die Gesundheitspolitik aufjeden Fall von Bedeutung, da siebelegen, wie wichtig adäquateVersorgung von Schwangerenund Neugeborenen zur Präven-tion späterer Erkrankungen immittleren und hohen Alter sind. Die Öffentlichkeit ist schon inte-ressiert: Die Herausgeber vonPNAS registrierten erfreut, dass in den ersten zwei Tagen nach Er-scheinen des Artikels ungewöhn-lich viele Leute die Forschungs-ergebnisse im Internet studierten.Sie dürfen auf weitere Untersu-chungen gespannt sein, denn Doblhammer-Reiter ist sich sicher: „Durch die zunehmendeVerfügbarkeit von umfangreichenLebensdaten ganzer Bevölke-rungsgruppen tun sich neue Forschungsperspektiven auf, die die komplexen Mechanismen entwirren können, die frühe undspäte Lebenssituationen mit-einander verknüpfen.“ �
Weitere Informationen erhalten Sie von:
DR. GABRIELE DOBLHAMMER-REITER
Max-Planck-Institut für demografische Forschung, RostockTel.: 0381/2081-124Fax: 0381/2081-424E-Mail: doblhammer@ demogr.mpg.de
@

FORSCHUNG aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 19
FORSCHUNG aktuell
18 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
den Hypothalamus verstreutsind als beim Säuger. Die Untersuchung von Haus-sperling-Gehirnen zu unter-schiedlichen Zeitpunktenwährend Tag und Nacht ergab,dass dieses Gen in einer ganzbesonderen Art und Weise ex-primiert wird. Bereits vor demAnbruch des Tages ist das alspPer2 bezeichnete Gen im vor-dersten Teil des SCN des Haus-sperlings zu finden. Die Stärkeder Expression nimmt dann biszur Mitte des Tages zu unddehnt sich über das ganzeKerngebiet aus, sinkt bis zumAnbruch der Dunkelheit undverschwindet schließlich wäh-rend der Nacht völlig. Erstaun-licherweise taucht dieses Genzur Tagesmitte auch in einemdem SCN benachbarten Kern-gebiet auf, das bisher wederklar anatomisch abgegrenztnoch benannt worden war.Dieses Kerngebiet, derzeit als„lateraler hypothalamischerNucleus“ bezeichnet, zeigt nurwährend der zweiten Tages-hälfte eine Expression despPer2. Während also im SCNbereits vor „Licht an“ Uhren-Gene exprimiert werden, sind
im benachbarten lateralen Hypothalamus nur während derTagphase Uhren-Gene aktiv.Diese aktuellen Ergebnisse(Brandstätter et al., NEUROREPORT
2001; 12(6): 1167-1170) ermög-lichen nicht nur einen erstenEinblick in das molekulare Uhr-werk des Haussperlings, sondernverdeutlichen ein sehr komple-xes räumlich-zeitliches Musterder Gen-Expression. Zusätzlich deuten diese Ergeb-nisse darauf hin, dass das eigentliche Schrittmacher-zentrum in einem Bereich des Hypothalamus liegt, der in bisherigen Studien völlig ver-nachlässigt worden ist.Um auszuschließen, dass diesesExpressionsmuster des pPer2-Gens nur durch Licht, nicht jedoch von der inneren Uhr hervorgerufen wird und somitmöglicherweise gar kein Aus-druck der Aktivität der innerenUhr ist, haben die Wissenschaft-ler die zuvor genannten Experi-mente wiederholt, nachdem die Haussperlinge einige Tageim Dauerdämmerlicht lebten,
also keine Tag-Nacht-Wechselmehr wahrnehmen konnten.Unter solchen Bedingungen be-ginnen innere Uhren „frei“ zulaufen, das heißt: Sie steuerndie Rhythmik des Organismusvöllig umweltunabhängig. Dabei fanden die AndechserForscher ein praktisch iden-tisches Expressionsmuster despPer2-Gens. Das lässt daraufschließen, dass in beiden hypo-thalamischen Kerngebieten innere Uhren aktiv sind. Gibt es also neben der Zirbel-drüse einen – aus mehreren Ab-schnitten bestehenden – oderzwei möglicherweise sogar von-einander unabhängige circa-diane Schrittmacher im Hypo-thalamus der Vögel? Gibt es einen Zusammenhang zwischender (im Vergleich zum Säuger)komplizierten Organisation desSchrittmachersystems der Vögelund dem hohen Grad an Flexi-bilität dieser Tiergruppe, diepraktisch alle Lebensräume besiedelt? Insbesondere der Ver-gleich zwischen Standvögeln,also Vögeln, die das ganze Jahr
sind und eine optimale Anpas-sung an den Tag/Nacht-Wech-sel benötigen, um überleben zukönnen, muss die innere Uhrnicht nur an die Umwelt ange-passt sein, sondern auch mög-lichst schnell wechselnden Um-weltbedingungen folgen kön-nen. So ist die innere Uhr derVögel aus mehreren Kompo-nenten aufgebaut, die auf un-terschiedliche Arten Verände-rungen der Umwelt wahrneh-men können; dabei nimmt dieZirbeldrüse eine besondereStellung ein (Brandstätter et al., PNAS 2000; 97: 12324-12328). Im Gegensatz dazusitzt der Hauptschrittmacherder inneren Uhr der Säugetiere– und somit auch des Men-schen – in einem kleinenKerngebiet im Hypothalamusdes Gehirns, dem so genanntenNukleus suprachiasmaticus(SCN). Bereits seit mehrerenJahrzehnten suchen Forscheraus den USA, Japan und ver-schiedenen europäischen Län-dern nach einer zur hypothala-mischen Uhr der Säuger ver-gleichbaren Struktur im Gehirnder Vögel. Bisher haben jedochweder experimentelle nochfunktionelle Studien klareRückschlüsse zugelassen.Ausgehend von speziellen Ei-genschaften des SCN der Säu-ger sind in den vergangenen 15 Jahren mehrere Kerngebieteim Hypothalamus der Vögel als mögliche Kandidaten dis-kutiert und kontrovers alsSchrittmacherzentren prokla-miert worden. Roland Brand-stätter und Ute Abraham vonder Max-Planck-Forschungs-stelle für Ornithologie habennun in den vergangenen zweiJahren umfangreiche anato-mische und neurochemischeInformationen über den Hypo-thalamus der Singvögel erar-beitet. Ergebnis: Im Hypotha-lamus der Vögel wurden zwarweitestgehend die gleichenneurochemischen Botenstoffewie bei den Säugetieren ge-
funden, deren anatomischeVerteilung unterscheidet sichjedoch grundsätzlich von derder Säuger. Dies gilt auch fürdie anatomische Abgrenzungder vorhandenen Kerngebiete.Diese Forschungen zeigen, dassder klassische neurobiologischeAnsatz, der zu einer umfassen-den Beschreibung des SCN derSäuger geführt hatte, nichtausreichte, um bei den Vögelnzu schlüssigen Informationenzu gelangen.
In Zusammenarbeit mit UrsAlbrecht vom Max-Planck-In-stitut für experimentelle Endo-krinologie in Hannover habendie Forscher aus Andechs nunerstmals ein „Uhren-Gen“ einesSingvogels kloniert und dessenVorkommen im Gehirn festge-stellt. Dieses Gen entsprichtstrukturell dem Per2-Gen derSäuger, das wesentlich am Auf-bau und an der Aufrechterhal-tung circadianer Rhythmen beteiligt ist (siehe dazu MAX-PLANCKFORSCHUNG 4/1999, S. 14bis 23). Im Gegensatz zum Säu-ger ist dieses Per2-Gen beimVogel jedoch nicht nur im SCNlokalisiert, sondern in mehre-ren hypothalamischen Kernge-bieten zu finden. Dieser ersteNachweis eines Uhren-Gens im Hypothalamus eines Nicht-Säugers deutet darauf hin, dassdas hypothalamische Schritt-macherzentrum der Vögel eineweniger klar erkennbare ana-tomische Struktur aufweistund die einzelnen Schritt-macher-Zellen weiter über
Veränderungen der pPer2-Expres-sion im SCN (Pfeil-spitzen) und im lateralen hypotha-lamischen Nukleus(Pfeile) des Haus-sperlinggehirns imTag/Nacht-Wechsel.Die Unterschiededer Gen-Expressionin den unterschied-lichen Regionen zu unterschied-lichen Tages- undNachtzeiten ver-deutlichen diekomplizierte räum-lich-zeitliche Organisation deshypothalamischenSchrittmacher-zentrums. DaspPer2-Signal ist rot eingefärbt. Dielinke Spalte zeigtAufnahmen desvordersten (rostra-len) Teils des SCN,in der rechtenSpalte ist der hin-tere (caudale) Ab-schnitt des SCN so-wie der laterale hy-pothalamische Nu-kleus zu sehen. DieZahlen repräsentie-ren die jeweiligenZeitgeber-Zeiten: 24 = unmittelbarvor Tagesanbruch, 6 = Tagesmitte, 12 = unmittel-bar vor Anbruch der Nacht, 18 = Mitternacht.
… „Bisher wussten die Experten nicht, auf wel-cher Ebene des circadianen Schrittmachersys-tems Erinnerungsleistungen zu Stande kommen.Die neuen Ergebnisse zeigen erstmals die Beteili-gung der Zirbeldrüse, die bei Singvögeln einenwichtigen Teil der inneren Uhr darstellt. Ange-sichts der Tatsache, dass das photoperiodischeGedächtnis der Zirbeldrüse jedoch kürzer anhältals das des intakten Tieres, wird auch offensicht-lich, dass es zumindest noch einen weiteren cir-cadianen Oszillator in diesem System gebenmuss. So stellt sich die Frage nach dem Ort derzweiten circadianen Uhr im Haussperling. Diesevermuten die Wissenschaftler – ähnlich wie beimSäuger – im Hypothalamus des Gehirns; dieseUhr ist Gegenstand intensiver Untersuchungeneines von der Deutschen Forschungsgemein-schaft mitfinanzierten Projekts von RolandBrandstätter an der Andechser Forschungsstelle.Die aktuellen Ergebnisse zeigen schon jetzt deut-lich, dass circadiane Uhren mehr können als nurtagesperiodische Rhythmen zu produzieren: Siesind wesentlich an der Umsetzung biologisch re-levanter Zeitverläufe der Umwelt in das Verhal-ten des Organismus beteiligt.“
Nachtrag
oder ihr ganzes Leben am sel-ben Ort verbringen, und Zugvö-geln, die in der Regel zweimalpro Jahr bis zu mehrere TausendKilometer zurücklegen, um ihreSommer- oder Winterquartierezu erreichen, erscheint dabei für die Zukunft lohnenswert.Wie vermeiden Zugvögel nachBewältigung langer Zugstreckenund der Überquerung ökolo-gischer Barrieren den Jetlag, derohne Zweifel zu ungünstigen,möglicherweise sogar lebensbe-drohenden Lebensbedingungenführen könnte?Dies sind nur einige der Fragenmit denen die Andechser For-scher derzeit konfrontiert sind.Durch eine Kombination ausMolekularbiologie, Neurobio-logie, Physiologie und Verhal-tensforschung erhoffen sichRoland Brandstätter und seineKollegen neuartige Erkennt-nisse zur biologischen Bedeu-tung der inneren Uhr für spezielle Aspekte der Lebens-weise und die Bewältigungständig wechselnder Umwelt-anforderungen. �
Weitere Informationen erhalten Sie von: DR. ROLAND
BRANDSTÄTTER
Max-Planck-Forschungsstellefür Ornithologie,ArbeitsbereichBiologische Rhythmen undVerhalten, AndechsTel.: 08152/ 373-135Fax: 08152/373-133E-Mail: [email protected]
@
Sicher hätten Sie, liebe Leserinnen und Leser, den Artikel „Das Zeitgedächtnis der innerenUhr“ in der MaxPlanckForschung 1/2001 gerne zu Ende gelesen. Leider hat sich auf Seite 63 ein Belichtungsfehler eingeschlichen.Auf Grund eines Versehens unserer Litho imletzten Stadium der Heftproduktion wurde aufdem Film durch einen Anwendungsfehler desOperators die Textspalte auf Seite 63 ver-drängt und durch die letzte Textspalte vonSeite 62 ersetzt. Für diesen Fehler entschuldi-gen wir uns und drucken im Folgenden daskorrekte Ende des Beitrags ab. In dem Artikelbeschreiben Dr. Roland Brandstätter und Prof. Eberhard Gwinner von der AndechserMax-Planck-Forschungsstelle für Ornithologieneue Ergebnisse bei der Untersuchung der Zirbeldrüse von Vögeln. Die Forscher fandenheraus, dass diese innere („circadiane“) Uhr –sie produziert dem Tag/Nacht-Wechsel fol-gend das Hormon Melatonin – nicht nur tagesperiodische Rhythmen erzeugt, sondernauch in der Lage ist, sich spezielle Informatio-nen über Zeitverläufe in der Umwelt zu „mer-ken“, also eine Art Erinnerungsvermögen hat:
Durch die Zusammenarbeitder Max-Planck-Forschungs-stelle für Ornithologie unddes Max-Planck-Instituts fürExperimentelle Endokrinolo-gie haben Forscher erstmalsein Uhren-Gen eines Singvo-gels kloniert und dessen Vor-kommen im Gehirn festge-stellt (NEUROREPORT, 8. Mai2001). Dadurch ist es gelun-gen, die komplizierte Organi-sation des tagesperiodischenSchrittmachersystems derVögel auf molekularer Ebenezu zeigen und die Modell-Vorstellungen der innerenUhr der Vögel beträchtlich zu erweitern.
Die Erde dreht sich im 24-Stunden-Rhythmus um ihre eigene Achse. Dadurch wirdsämtliches Leben auf unseremPlaneten – vom Einzeller bishin zum Menschen – vom stän-digen Tag/Nacht-Wechsel be-einflusst. Alle uns bekanntenOrganismen folgen auf die eineoder andere Weise regelmäßi-gen Veränderungen der Um-welt. Allerdings nicht nur, weildie Umwelt sich verändert,sondern in erster Linie auf-grund „innerer biologischerUhren“, die die Physiologie unddas Verhalten steuern und denOrganismus in Einklang mitdem Takt der Umwelt bringen.„Außergewöhnliche“ Umständewie unerwartete Veränderun-gen der Umweltbedingungenpassen jedoch – insbesonderebei Säugetieren – nicht unbe-dingt in das Konzept der inne-ren Uhr. Diese Erfahrung kön-nen wir Menschen zum Beispielnach Überseeflügen machen,wenn der tagesperiodische Takt unserer inneren Uhr nicht mehr mit den „neuen” Tag/Nacht-Bedingungen unseresAnkunftsorts zusammenpasst:Wir durchleben dann einenJetlag. (Siehe dazu den Beitragauf Seite 5 dieser Ausgabe). Bei Tieren, die einem höherenDruck der Umwelt ausgesetzt
ORGANISMISCHE NEUROBIOLOGIE Taktgeber im Gehirn der Singvögel
ABB.
: RO
LAN
DBR
AND
STÄT
TER
MAX
-PLA
NCK
-FO
RSCH
UN
GSS
TELL
EFÜ
RO
RNIT
HO
LOG
IE

20 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
ESSAY
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 21
HUMANgenom
„Die Erkenntnis, dass ein einziger Zufall oder wenige genetische Zufälle
die menschliche Geschichte erst möglich machten, wird uns völlig neue
philosophische Herausforderungen bescheren, über die wir nachdenken
müssen“, schreibt PROF. SVANTE PÄÄBO, Direktor am MAX-PLANCK-
INSTITUT FÜR EVOLUTIONÄRE ANTHROPOLOGIE, in dem US-Magazin
SCIENCE. Lesen Sie die Übersetzung dieses Essays über die Erforschung des
genetischen Gerüsts und die Folgen für Wissenschaft und Gesellschaft.
Vielleicht ist für den pragmatischen Biologen dieBestimmung der menschlichen Genom-Sequenz
ein alltägliches Ereignis – die Bereitstellung eines wun-derbar machtvollen Instrumentariums, aber trotz allemnur ein Instrumentarium. Für die Allgemeinheit ist diemenschliche Genom-Sequenz jedoch von enormer sym-bolischer Bedeutung, und die Veröffentlichung der Se-quenz in Sonderausgaben der Zeitschriften SCIENCE (1)und NATURE (2) wird wahrscheinlich mit dem gleichenehrfürchtigen Gefühl aufgenommen werden, wie man esauch bei der Landung des ersten Menschen auf demMond und der Zündung der ersten Atombombe emp-fand.
Warum sind gewisse Errungenschaften – die ersteMondlandung, die erste Atomspaltung, die Bestimmungder menschlichen Genom-Sequenz – durchtränkt vonemblematischer Bedeutung? Ich glaube, der Grund liegtdarin, dass derartige Ereignisse unsere Einstellung unsselbst gegenüber verändern. Die Landung eines Men-schen auf dem Mond gab uns eine außerirdische Sicht-weise des menschlichen Lebens, die Spaltung des Atomsgab uns die Macht, enorme Energiereserven zu schaffen,aber auch alles menschliche Leben auszulöschen; jetzterlaubt uns die menschliche Genom-Sequenz einenBlick auf das innere genetische Gerüst, um das jeglichesmenschliche Leben geformt wird. Dieses Gerüst wurde
von unseren Vorfahren an uns weitergegeben, unddurch dieses Gerüst sind wir mit allem anderen Lebenauf der Erde verbunden.
Wie beeinflusst die vollständige menschliche Genom-Sequenz die Art und Weise, wie wir über uns selbst den-ken? Es ist ganz klar, dass die Verfügbarkeit einermenschlichen DNA-Sequenz, auf die man zurückgreifenkann, einen Meilenstein darstellt auf dem Weg zum Ver-ständnis, wie sich die Menschheit entwickelt hat. Dennsie öffnet die Tür zu umfassenden Vergleichsstudien. Diewichtigste Auswirkung solcher Studien wird sein, dasssie enthüllen, wie ähnlich sich die Menschen unterein-ander sind und wie sehr sie anderen Spezies ähneln.
Die ersten Vergleiche werden zwischen dem menschli-chen Genom und entfernt verwandten Genomen ange-stellt werden, beispielsweise mit den Genomen von Hefe, Fliegen, Würmern und Mäusen. Einen kleinenHinweis auf das, was dabei herauskommen wird, erhältman, wenn man bedenkt, dass etwa 26.000 bis 38.000Gene in einer vorläufigen Version unseres eigenen Genoms zu finden sind – eine Zahl, die nur zwei- bisdreimal höher ist als die 13.600 Gene im Genom derFruchtfliege. Außerdem sind etwa zehn Prozent der
Eine Quelleder Demut
Die Einheit des Lebens wird offensichtlich
FOTO
: STO
CKM
ARKE
T

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 23
(4) und zu unserer augenblicklichen Vorherrschaft aufder Erde führte. Die Erkenntnis, dass ein einziger Zufalloder wenige genetische Zufälle die menschliche Ge-schichte erst möglich machten, wird uns völlig neuephilosophische Herausforderungen bescheren, über diewir nachdenken müssen.
In großem Umfang sind jetzt Vergleiche von mensch-lichen Genomen vieler Individuen möglich, seit es diehocheffizienten Schnelldurchlauf-Techniken für die Be-stimmung von DNA-Sequenzen gibt. Das allgemeineBild, das aus solchen Studien bereits ersichtlich ist,zeigt, dass der Gen-Pool in Afrika mehr Variationenaufweist als anderswo und dass die genetische Variati-on, die außerhalb Afrikas zu finden ist, eine Untergrup-pe derer ist, die auf dem afrikanischen Kontinent gefun-den wurde (5). Vom Blickwinkel der Genetik aus sind al-so alle Menschen Afrikaner, ob sie nun in Afrika woh-nen oder seit kurzer Zeit im Exil leben.
Wenn man bedenkt, welch traurige Rolle Rasse undRassenzugehörigkeit in den meisten Gesellschaften im-mer noch spielen, dann sind Bedenken angebracht, dassdie genetische Analyse von verschiedenen menschlichenBevölkerungsgruppen missbraucht werden könnte.Glücklicherweise ist aus den wenigen Studien der DNA-Sequenzen von Zellkernen ersichtlich, dass das, was„Rasse“ genannt wird und kulturell von großer Bedeu-tung ist, lediglich einige vererbte Merkmale widerspie-gelt, die von einem winzigen Teil unserer Gene be-stimmt sind. Dieser winzige Teil gibt keinerlei Hinweisauf Variationen in anderen Bereichen unseres Genoms.So ist es aus der Sicht der Gene des Zellkerns oft derFall, dass zwei Personen aus dem gleichen Teil der Welt,die sich oberflächlich betrachtet ähnlich sehen, mitein-ander weniger verwandt sind als mit Personen aus an-deren Teilen der Welt, die vielleicht sehr viel anders aus-sehen (6). Obwohl kleine Segmente des Genoms – wiedie mitochondriale DNA und die Y-chromosomale DNA(die auf ungewöhnliche Weise vererbt werden) oder diewenigen Gene, die sichtbare Merkmale bestimmen (dievielleicht selektiert wurden) – ein Muster zeigen, beidem die Gene in einer speziellen menschlichen Bevölke-rung auf einen einzelnen gemeinsamen Vorfahrenzurückverfolgt werden können, trifft dies für die großeMehrheit unserer Gene nicht zu. Tatsächlich ist einMerkmal, in dem wir Menschen uns von den Men-schenaffen zu unterscheiden scheinen, die Tatsache,dass wir uns mit sehr geringer Unterteilung entwickelthaben. Das liegt sicher daran, dass wir (im evolu-tionären Sinn) eine junge Spezies sind und eine größereTendenz zur Wandertätigkeit haben als viele andereSäugetiere. Ich vermute daher, dass Studien am gesam-ten Genom bezüglich genetischer Variation bei mensch-lichen Gruppen nicht so leicht missbraucht werden kön-
Jahrzehnts führten zu einer Verschiebung in Richtungauf eine fast vollständig genetische Sicht von uns selbst.Ich finde es bemerkenswert, dass noch vor zehn Jahrenein Genetiker die Idee verteidigen musste, dass nicht nurdie Umwelt, sondern auch Gene die menschliche Ent-wicklung bestimmen. Heute fühlt man sich verpflichtetzu betonen, dass es eine bedeutende umweltbedingteKomponente bei alltäglichen Krankheiten, Verhaltens-mustern und Persönlichkeitsmerkmalen wirklich gibt! Es besteht unterschwellig die Tendenz, bezüglich dermeisten Aspekte unseres „Menschseins“ auf unsere Genezu schauen und zu vergessen, dass das Genom nur eininneres Gerüst für unsere Existenz darstellt.
Wir müssen die Vorstellung überwinden, dass die ge-netische Geschichte unserer Spezies die Geschichte parexcellence ist. Wir müssen erkennen, dass unsere Genenur ein Aspekt unserer Geschichte sind und dass es vie-le andere Geschichten gibt, die sogar noch viel wichtigersind. Beispielsweise empfinden viele Menschen in derwestlichen Welt eine Verbindung zum alten Griechen-land, aus dem fundamentale Merkmale der westlichenArchitektur, Wissenschaft, Technologie und politischenIdeale (wie die Demokratie) hervorgingen. Im besten Fallstammt jedoch höchstens ein kleiner Teil des Gen-Poolsder westlichen industrialisierten Welt von den altenGriechen. Offensichtlich vermindert diese Tatsache inkeinster Weise die Bedeutung des antiken Griechenland.Es ist also eine Täuschung, wenn man denkt, dass dieGenomik allein uns jemals sagen wird, was es bedeutet,ein Mensch zu sein. Im Hinarbeiten auf dieses ferne Zielbrauchen wir einen Ansatz, der die kognitiven Wissen-schaften, die Primatologie, die Gesellschaftswissenschaf-ten und die Geisteswissenschaften mit einschließt. Abermit der vollständigen menschlichen Genom-Sequenz, dieuns jetzt zur Verfügung steht, befindet sich die Genetikin einer ausgezeichneten Position, um in diesen Bestre-bungen eine herausragende Rolle zu spielen. �
1. J.C. Venter et al., SCIENCE 291, 1304 (2001)2. International Human Genome Sequencing Consortium,
NATURE 409, 860 (2001)3. M.-C. King, A.C. Wilson, Science 188, 107 (1975)4. R.G. Klein, The Human Career
(Univ. of Chicago Press, Chicago, IL, 1999)5. L.B. Jorde, M. Bamshad, A.R. Rogers, Bioessays 20, 126 (1998)6. H. Kaessmann, F. Heissig, A. von Haeseler, S. Pääbo,
Nature Genet. 22, 78 (1999)
Abdruck aus SCIENCE 291, 1219f. (2001) mit freundlicher Genehmigung des Verlags
HUMANgenom
22 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
menschlichen Gene eindeutig mit speziellen Genen derFliege oder des Wurms verwandt. So haben wir also of-fensichtlich sehr viel von unserem genetischen Gerüstsogar mit sehr entfernten Verwandten gemeinsam. DieÄhnlichkeit zwischen Menschen und anderen Tierenwird noch deutlicher, wenn Genom-Sequenzen von Or-ganismen wie der Maus, mit der wir einen Vorfahrenaus jüngerer Zeit gemeinsam haben, verfügbar werden.Denn diese Spezies sind wahrscheinlich sowohl auf-grund ihrer Anzahl der Gene als auch aufgrund ihrerallgemeinen Genom-Struktur der unseren sehr ähnlich.Obwohl diese Tatsache bei Insidern in Genetik-Kreisenbereits seit langem bekannt ist, wird die große Ähnlich-keit unseres Genoms mit den Genomen anderer Organis-men die Einheit des Lebens für alle offensichtlicher ma-chen. Ohne Zweifel wird die genomische Sicht unseresStellenwerts in der Natur sowohl eine Quelle der Demutals auch ein Schlag gegen die Idee der menschlichenEinzigartigkeit sein.
Die offensichtlichste Herausforderung an die Vorstel-lung der menschlichen Einzigartigkeit tritt wahrschein-lich dann auf, wenn die Genome von Spezies, die demMenschen nahe stehen, entschlüsselt werden. Wir wis-sen bereits, dass die Ähnlichkeit der DNA-Sequenz beiMenschen und Schimpansen insgesamt bei rund 99 Pro-zent liegt (3). Wenn die Genom-Sequenz der Schimpan-sen verfügbar wird, stellen wir sicherlich fest, dass Inhalt und Organisation ihrer Gene unseren Genen sehrähneln. Vielleicht liegt es an unserem unterbewusstenUnbehagen über diese zu erwartende Tatsache, dass Ge-nom-Wissenschaftler sich nur mit solcher Trägheit andie Idee eines Schimpansen-Genom-Projekts heranwa-gen. Wie auch immer: Da nun der größte Teil dermenschlichen Genom-Sequenz vollständig bekannt ist,wird es ganz einfach sein, die Schimpansen-Sequenz zubestimmen, indem man die menschliche Sequenz alsBauanleitung benutzt. Das Ergebnis wird sicherlich einenoch gewaltigere Herausforderung an die Vorstellungvon der menschlichen Einzigartigkeit darstellen als derVergleich des menschlichen Genoms mit dem andererSäugetiere.
Dabei werden genau die geringen Unterschiede zwi-schen unserem Genom und dem der Menschenaffenhöchst interessant sein, weil eben darin die genetischenGrundvoraussetzungen liegen, die uns von allen ande-ren Lebewesen unterscheiden. Vor allem enthüllen dieseUnterschiede vielleicht die genetische Grundlage für un-sere schnelle kulturelle Entwicklung und geographischeVerbreitung, die vor 150.000 bis 50.000 Jahren begann
ESSAY
nen – im Hinblick darauf, dass Daten als „wissenschaft-liche Stütze“ für Rassismus oder andere Formen der In-toleranz zu verwenden sind – als man augenblicklichbefürchtet. Wenn überhaupt, dann werden solche Studi-en die gegenteilige Wirkung haben, denn Vorurteil, Un-terdrückung und Rassismus nähren sich von Unwissen.Die Kenntnis des Genoms sollte Mitgefühl hervorbrin-gen, nicht nur weil unser Gen-Pool ausgesprochen ge-mischt ist, sondern auch weil ein umfassenderes Ver-ständnis dafür, in welchem Verhältnis unser Genotypuszu unserem Phänotypus steht, zeigen wird, dass jederwenigstens einige gesundheitsschädliche Allele in sichträgt. Folglich wird es sich als absurd erweisen, wenn irgendeine spezielle Gruppe von Individuen aufgrundihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Trägerstatusfür gewisse Allele stigmatisiert wird.
Vom medizinischen Standpunkt aus bergen verbesser-te Vorhersagemöglichkeiten, die durch die Identifikationkrankheitsbezogener Allele zur Verfügung stehen wer-den, große Chancen, aber auch Probleme. Die Chancenwerden darin liegen, dass die Feststellung des individu-ellen Risikos dazu verwendet wird, die umweltbedingtenund verhaltensbedingten Komponenten von alltäglichenKrankheiten zu verändern. Relativ geringfügige Maß-nahmen, die zu einem frühen Zeitpunkt im Leben einge-setzt werden, können sich als äußerst effektiv erweisen,indem sie den Ausbruch einer Krankheit auf einen spä-teren Zeitpunkt verschieben oder sogar ganz verhin-dern. Aber eine individualisierte Risikofeststellung kanneine „genetische Hypochondrie“ als Preis haben, indemviele dazu gebracht werden, ihr Leben damit zu verbrin-gen, auf eine Krankheit zu warten, die vielleicht niemalsauftritt. Schließlich stellt eine gesteigerte Fähigkeit dermedizinischen Vorhersage offensichtlich eine gesell-schaftliche Herausforderung im Hinblick auf die medizi-nische Versicherung dar, besonders in Ländern, die nichtwie die westeuropäischen Länder mit einem Kranken-versicherungssystem gesegnet sind, das Risiken in einerausgleichenden Form auf die ganze Bevölkerung ver-teilt. Gesetzgeber in solchen Ländern wären gut beraten,jetzt zu handeln und den zukünftigen Versuchungenentgegenzuwirken, wenn Versicherungsrisiken „perso-nalisiert“ werden könnten. Später, wenn einmal wir-kungsvolle genetische Diagnosetests eingeführt sind,wird es schwer werden, dem Druck von Seiten der Versi-cherungslobby zu widerstehen, um eine derartige Ge-setzgebung zu verhindern.
Da wir in der Medizin und in der Biologie in ein Ge-nom-Zeitalter eintreten, stammt die vielleicht größteGefahr meiner Meinung nach aus dem enormen Ge-wicht, das von Seiten der Medien auf das menschlicheGenom gelegt wird. Die Erfolge in der medizinischenGenetik und Genomtechnik während des vergangenen
Die menschliche Sequenz als Bauanleitung
Interdisziplinärer Ansatz als Ziel

24 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
SCHWERpunkt
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 25
GÜTER & Gesellschaft
„T hink Bigger“ heißt ein Leit-satz internationaler Finanz-
manager, die in den vergangenenJahren eine in der Wirtschaftsge-schichte beispiellose Fusionswelle inBewegung gesetzt haben. Ökonomi-sche Größe bedeutet Macht, so dasKalkül, und je mehr Kapital undKöpfe ein Unternehmen vorzuweisenhat, desto weniger anfällig ist es,von einem mächtigeren Wettbewer-ber irgendwo auf der Welt ge-schluckt zu werden. Doch es gibt einen Gegentrend zum Fusionsfie-ber: „Small is Beautiful“ statt „Think Bigger“. Ein länderübergreifendesForscherteam mit Wissenschaftlernaus Italien, Frankreich und Deutsch-land hat es sich zum Ziel gesetzt, dieFunktionsweise und die Entwicklungsolcher lokaler Ökonomien zu unter-suchen, wie sie etwa im GroßraumStuttgart oder im so genannten„Dritten Italien“ – im Gebiet zwi-schen dem ländlich geprägten Südenund den Industriezentren im Nord-westen – existieren.
Warum sind diese Regionen in Eu-ropa deutlich erfolgreicher als ande-re? Warum lässt sich dort ein überJahre konstantes Wirtschaftswachs-tum konstatieren? Was ist das Er-folgsgeheimnis der Region Emilia-Romagna in Mittelitalien, die in den
Spezialisierte Kleinunternehmer können im Wettbewerb mit Großunternehmen als Gewinner hervorgehen.
Dies beobachten Wirtschaftssoziologen wie PROF. HELMUT VOELZKOW vom MAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR GESELLSCHAFTSFORSCHUNG in Köln schon seit zwei Jahrzehnten. Nicht die Großen fressen die Kleinen,
sondern die Schnellen überholen die Langsamen. Und als besonders schnell können sich kleine Unternehmen
erweisen, die nicht isoliert auftreten, sondern als Teil eines lokalen Produktionssystems von Gütern, das
sich aus einer Vielzahl von spezialisierten Firmen zusammensetzt. Wie aber funktionieren diese lokalen
Ökonomien? Dies aufzuklären ist Ziel einer internationalen Forschergruppe, an der Voelzkow beteiligt ist.
Im Kleinen liegt die Kraft
ILLU
STRA
TIO
N: S
TOCK
MAR
KET

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 27
ge Journalisten, die den Status vonKöln als eines der vier wichtigstenMedienzentren in Deutschland nebenMünchen, Hamburg und Berlin ga-rantieren. Im Schatten von RTL undBertelsmann ist in Köln eine ganzeReihe von Produktionsfirmen heran-gewachsen, die wiederum weitereSpezialisten anlocken. Der berühmte„Schneeballeffekt“ ist für die Attrak-tivität einer Wirtschaftsregion ent-scheidend. Gemeinschaftliches Mar-keting ist ein weiteres Pfund, mitdem eine lokale Ökonomie wuchernkann. Die badischen Weinbauernhatten genau dies erkannt, als sievor zehn Jahren in Zeitungsanzeigeneine kollektive Werbekampagne star-teten. Der Slogan „Von der Sonneverwöhnt“ wurde zum sprichwörtli-chen Markenzeichen der Region,Wein aus Baden avancierte zum Ver-kaufsschlager.
Sogar die Strategie des Weltkon-zerns DaimlerChrysler in der RegionStuttgart beruht zumindest teilweisenoch immer auf einer regional ge-prägten Ökonomie, in der viele klei-ne Zulieferbetriebe aus der Elektro-und Metallbranche ihre Nischen fin-den. „Gleichzeitig profitieren ausge-wählte Betriebe von der Globalisie-rungsstrategie von Daimler“, sagtVoelzkow. „Die Kleinen wurden mit-genommen auf dem Weg in diegroße weite Welt.“ DaimlerChryslerhabe den Vorzug erkannt, sich aufdie Endproduktion von Fahrzeugenzu konzentrieren. Viele kleine Unter-nehmen liefern Fertigteile für dasEndprodukt – den wirtschaftlichenNutzen hat die ganze Region.
Auch wenn die Fusionitis im Zeit-alter der Globalisierung nicht aufzu-halten sei, wird es auch künftig guteChancen für kleinere Zulieferbetriebegeben. „Die Herstellung industriellerProdukte wird immer weiter aufge-gliedert“, glaubt Voelzkow. „Make itor buy it” heiße die Alternative, undoft sei es wirtschaftlicher, Produk-tionsprozesse auszulagern. Es kannökonomisch sinnvoll sein, Fertigteilefür ein Fahrzeug nicht unter demDach des Konzerns zu produzieren,
❿ 1. Nur beschränkt tauglich istdas Marktmodell, denn bei der Pro-duktion von kollektiven Gütern ver-sagt der Markt häufig, weil das ein-zelne Unternehmen nicht für unter-nehmensbezogene Dienstleistungenzahlen will, von dem auch die Kon-kurrenten profitieren, obwohl diesesich nicht an den Kosten beteiligen.Denkbar ist aber, dass ein größeresUnternehmen gewisse Vorleistungenfür eine lokale Ökonomie übernimmt,weil der Aufbau eines gemeinsamenDienstleistungs-, Informations- oderBeratungsangebots die Wettbewerbs-fähigkeit jener Kleinbetriebe erhöht,die für das größere Unternehmen alsZulieferer fungieren.❿ 2. Ebenfalls nur bedingt taug-
lich ist das Organisationsmodell dervertikalen Integration – also der Zu-sammenschluss kleinerer Firmen inein integriertes Unternehmen. Zuguter Letzt gäbe es nur noch ein ein-ziges größeres Unternehmen undkeine Vielzahl kleinerer Einheitenmehr. Damit wäre zwar ein unter-nehmensbezogener Dienst gesichert,aber fortan als ein privates Gut desgrößeren Unternehmens, nicht mehrals kollektives Gut von mehrerenKleinfirmen.❿ 3. Das Staatsmodell rückt die
Zusammenarbeit der Betriebe mit öf-fentlichen Einrichtungen ins Blick-feld: Informationen, Beratung oderDienstleistungen werden vom Staatoder den Kommunen erbracht.❿ 4. Das Gemeinschaftsmodell
räumt der spontanen Solidarität vonAngehörigen einer sozialen Einheiteinen hohen Stellenwert ein. Famili-en, Clans, Dorfgemeinschaften fun-gieren hier als soziale Einheiten.Nicht der Profit, sondern die Wert-schätzung der anderen Mitglieder istausschlaggebend.❿ 5. Das Verbandsmodell schließ-
lich betont die Rolle der Organisatio-nen: Unternehmerverbände, Gewerk-schaften, Berufsverbände und andereversorgen ihre Mitglieder mit kollek-tiven Gütern.
Elemente dieser fünf Modelle sindpraktisch in jeder lokalen Ökonomie
GÜTER & Gesellschaft
26 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
achtziger Jahren zu einem der reichs-ten Gebiete Europas wurde? Warumbilden sich gerade dort Schwerpunk-te mit einer Reihe von kleineren, ei-genständigen Firmen heraus, die sichauf die Produktion eines bestimm-ten, regional typischen Gutes spezia-lisieren? All diese Fragen lassen sichnur beantworten, wenn man einzel-ne Fallanalysen anfertigt und danndie unterschiedlichen Regionen mit-einander vergleicht. Die Kooperati-onspartner des Forschungsprojektshaben für diese Aufgabe jeweils ei-gene Beiträge geliefert, die in einemweiteren Arbeitsschritt nun zu einemGesamtbild führen sollen.
Vor dem Hintergrund der Globali-sierung sind die Ergebnisse des Pro-jekts überraschend, das unter der ge-meinsamen Leitung von ColinCrouch (Florenz), Patrick Le Gales(Paris), Carlo Trigilia (Florenz) undHelmut Voelzkow vom Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsfor-schung steht. Die Ergebnisse sind ineinem Buch zusammengefasst, dasvor kurzem erschienen ist: „LocalProduction Systems in Europe – Riseor Demise“.
Kleine Unternehmen, so lautet eineder Hauptthesen der Autoren, könnensich in der Welt der Konzerne durch-aus behaupten – auch langfristig. ImKern erinnern solche kleinteiligenStrukturen an die ökonomischen Ver-hältnisse, wie sie in der Mitte des 19.Jahrhunderts einmal im Mutterlanddes Kapitalismus, in Großbritannien,bestanden. In Anlehnung an denWirtschaftswissenschaftler AlfredMarshall sprechen die Soziologen da-von, dass sich im 21. Jahrhundertwieder lokale „Industriedistrikte“ bil-den, die auch in Konkurrenz zurMassenproduktion der Großbetriebeüberlebensfähig sind. Die Vorteilesolcher lokaler Kleinunternehmenliegen auf der Hand: Sie sind kun-denfreundlich, flexibel beim Einsatzneuer Technologien und oft innovati-ver als Großfirmen.
Es gibt Regionen in Europa, derenWirtschaftkraft auf einem Verbundvon Mini-Firmen beruht. Das „Dritte
Italien“ dient hier als geradezu klas-sisches Beispiel. In einer Stadt wieBologna etwa dominiert die Ver-packungsindustrie, in der viele klei-ne Firmen Marktanteile halten. Eineganze Kommune hat sich auf eineProduktpalette spezialisiert und lebtnicht schlecht davon. In Prato, einweiteres Fallbeispiel der Forscher-gruppe, existiert eine schier unüber-schaubare Anzahl von Kleinstunter-nehmen, die alle in der Textil- undModebranche erfolgreich sind. Undder berühmte Parmaschinken ist weitmehr als ein Markenname: Er stehtfür die Stärke einer lokalen Ökono-mie – und für die Qualität eines Pro-dukts, das die Verbraucher unabhän-gig von einer bestimmten Firma ei-ner Region zuordnen.
GENÜGEND ANREIZE
ZUR INNOVATION
Welche Bedingungen muss eineWirtschaftsregion erfüllen, um amMarkt zu bestehen? Voraussetzungist, dass die lokale Ökonomie als in-tegriertes Produktionssystem agiert,von dem alle Mitglieder profitieren.„Eine lokale Wirtschaft muss für ihreTeilhaber genügend Anreize zur In-novation und Differenzierung bie-ten“, hat Voelzkow festgestellt. Ent-scheidend sind unternehmensbezo-gene Dienstleistungen, die imSprachgebrauch des Projekts „kol-lektive Wettbewerbsgüter“ genanntwerden.
Das können gemeinsame For-schungsprojekte sein oder gemeinsa-me Produkt- und Qualitätsstandards.Sehr wichtig ist außerdem die Aus-und Weiterbildung von Mitarbeiternin den Instituten von Unternehmenoder an privaten Hochschulen, vondenen eine ganze Region profitierenkann.
„Der Medienstandort Köln leistetin puncto Ausbildung Vorbildliches“,sagt der Wirtschaftssoziologe: Gibtes hier doch mit der Fachhochschulefür Medien, der von Bertelsmann fi-nanzierten Journalistenschule oderden RTL-Ausbildungsstätten gleichmehrere Kaderschmieden für künfti-
SCHWERpunkt
sondern sie von einem spezialisier-ten Kleinunternehmen zu kaufen.Dies ist die andere Seite der Globali-sierung: Bei der klassischen Produk-tion gibt es gerade unter dem ver-schärften internationalem Wettbe-werbsdruck eine Rückbesinnung aufkleinere Einheiten – und damit eineKonzentration auf die Stärken derRegionen.
LOKALES KOLLEKTIV
SICHERT GEMEINSAMES GUT
Voraussetzung einer solchen loka-len Erfolgsgeschichte ist indes, dassgenügend kollektive Güter zur Ver-fügung stehen. Güter also, die dieWettbewerbsfähigkeit der in dem in-formellen Verbund beteiligten Unter-nehmen steigern. Dazu zählt etwadie Verfügbarkeit von qualifiziertenArbeitskräften: Ein Angebot von Ar-beitnehmern mit passender Qualifi-kation kommt allen klein- und mit-telständischen Unternehmen einerRegion zugute. Bedroht sind kollek-tive Güter aber immer vom kurzsich-tigen Zweckrationalismus der Unter-nehmen: Als individuelle Nutzen-Maximierer unterliegen die Firmennicht selten der Versuchung, alsTrittbrettfahrer die Aus- und Weiter-bildungsleistungen ihrer Konkurren-ten auszunutzen, ohne selbst in dieQualifizierung der Arbeitnehmer zuinvestieren.
Nur wenn sich tatsächlich etwaswie ein lokales Kollektiv bildet, istdas gemeinsame Gut – zum Beispieldie Ausbildung von Fachkräften –gesichert. Ganz gleich, ob eine sol-che „Qualitätssicherung“ nun von einem Unternehmensverbund odervon der öffentlichen Hand organi-siert wird.
Methodisch arbeiten die Wissen-schaftler mit dem „Governance-An-satz“, um ein geeignetes Instrumen-tarium für die Analyse der lokalenÖkonomien zu schaffen. Die Gover-nance-Methode unterscheidet fünfverschiedene Modelle, mit deren Hilfe sich die Bereitstellung kollekti-ver Wettbewerbsgüter idealtypischerklären lässt:

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 29
ne diese technologischen Impulsenur schwer überleben.
Nicht zu unterschätzen ist zudemdie Rolle von Hochschulen und Uni-versitäten, die mit Unternehmen ko-operieren. In der Wissensgesellschaftwird die Bereitstellung des kollekti-ven Gutes Bildung immer wichtiger.Das haben auch die Konzerne wieDaimlerChrysler erkannt, die ihreZulieferbetriebe teilweise in die For-schungs- und Entwicklungsabteilun-gen – und damit in die Wertschöp-fungskette – einbinden.
„VIELE UNTERSCHIEDLICHE
KAPITALISMEN“
Wenn eine Region wirtschaftlichErfolg haben wolle, da sind sich die Mitarbeiter des Forschungspro-
jekts sicher, müssen viele Faktorenzusammenwirken. Eine These aberkann der WirtschaftswissenschaftlerHelmut Voelzkow nach den bisheri-gen Forschungsergebnissen eindeu-tig belegen: Die Abhängigkeit klei-nerer und mittlerer Unternehmenvon kollektiven Gütern und dem in-stitutionellen Umfeld ist viel größerals bisher angenommen. Sowohl derErfolg der Region Stuttgart als auchder Wirtschaftsboom von der Emilia-Romagna beruht auch auf der gutenVersorgung mit kollektiven Gütern:In Italien dominieren dabei die starkdifferenzierten Kleinökonomien, inBaden-Württemberg sind die kleine-ren und mittleren Unternehmen indie Wertschöpfungsketten der GlobalPlayer wie DaimlerChrysler, Alcatel
oder IBM eingebunden. „Es gibt ebennicht einen Kapitalismus, sonderneine Vielzahl unterschiedlicher Kapi-talismen“, sagt Voelzkow.
Im Wettbewerb des 21. Jahrhun-derts benötigt man künftig mehr alsnur eigene Kräfte und Kapital: Jeweiter sich der Trend zur Desintegra-tion, zum Outsourcing von Produkti-onsabläufen fortsetzt, je mehr dieSpezialisierung voranschreitet, destostärker wächst die Bedeutung des lo-kalen Umfelds und der kollektivenGüter. Wer in Zeiten der Globalisie-rung nur auf seine eigene Stärke ver-traut, ist verloren. Das gilt auch fürdie so genannten Global Players, dieauf die Zuarbeit kleiner und mittlererBetriebe im lokalen Umfeld angewie-sen bleiben. CHRISTIAN MAYER
GÜTER & Gesellschaft
28 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
enthalten. Besonders spannend wirddas Forschungsprojekt, wenn dieWissenschaftler die einzelnen Länderbeleuchten. Im Vergleich der vier un-tersuchten Staaten ist Italien einSonderfall. Ein Blick auf die Wirt-schaftsstatistik und verschiedeneFallstudien verrät: Lokale Ökonomienin Italien haben häufig die Qualitätvon Unternehmensnetzwerken, diesich am besten anhand des Gemein-schaftsmodells erklären lassen. Miteinfachen Marktbeziehungen, wie sieetwa in Großbritannien seit der ÄraMargaret Thatchers dominieren, hatdas kaum etwas gemein. Vielmehroperieren in Italien Gemeinschaften,die auf der Grundlage von Vertrauenund Solidarität ihre kleinbetrieblicheStruktur als Stärke nutzen. Horizon-tale Kooperation heißt hier das Er-folgsgeheimnis, wie das Beispiel dervielen kleinen Modefirmen aus Pratobeweist, die Oberhemden in derganzen Welt verkaufen.
HIERARCHISCH
GEORDNETE EINHEITEN
Ein ganz anderes Bild bietet sichaußerhalb Italiens, wo Unternehmenmit weniger als 20 Mitarbeitern imindustriellen Sektor kaum eine tra-gende Rolle spielen. Dafür ist dasGewicht größerer Betriebe mit mehrals 500 Beschäftigten in Frankreichund Großbritannien deutlich größer.Ein weiteres Merkmal, das die For-schergruppe dem Organisationsmo-dell zurechnen, ist die Gliederung inhierarchisch untergeordnete Einhei-ten. So dominiert etwa der Großkon-zern DaimlerChrysler den gesamtenGroßraum Stuttgart; nicht umsonsthaben sich hier viele kleinere Ma-schinenbaufirmen angesiedelt.
Gravierende Unterschiede zwi-schen den Ländern haben Voelzkowund seine Kollegen auch in der Rolledes Staates ausgemacht. In Italien ist der Zentralstaat vergleichsweiseschwach, dafür aber übernehmen dieKommunen einen gewichtigen Partbei der Bereitstellung von kollekti-ven Gütern. In Frankreich und Groß-britannien ist die Zentralregierung
traditionell dominant. „Es ist er-staunlich, wie sehr die politischeStruktur auch die Wirtschaftsgeogra-fie bestimmt“, sagt Voelzkow.
In beiden Ländern sind die Poten-ziale von lokalen Ökonomien erst inden vergangenen Jahren entdecktworden. Lange Zeit orientierte sichbeispielsweise die französische Wirt-schaftspolitik an einem Modell, daseine enge Zusammenarbeit zwischender Zentralregierung und einigenführenden Großunternehmen vorsah.Entsprechend sind noch immer diemeisten Konzerne in der Ile de France konzentriert: „Die Hauptstadt Paris stellt alle anderen Städte nichtnur politisch, sondern auch ökono-misch in den Schatten“, erklärt derKölner Gesellschaftsforscher.
In Deutschland spielen dagegendie Bundesländer eine aktive Rolleals wirtschaftspolitische Akteure.Statt Konzentration dominiert dieVielfalt. Der Freistaat Bayern etwanutzt seine Privatisierungserlöse, umlokale Ökonomien zu fördern – auchabseits des Großraums München, dergleichzeitig als Magnet für neue Me-dien, IT-Firmen und Biotech-Unter-nehmen eine starke Anziehungskraftbesitzt. Der Biotech-Standort Mar-tinsried bei München ist ein ein-drucksvoller Beleg für die Renais-sance lokaler Ökonomien gerade imZeitalter der Globalisierung undzeigt, dass eine hohe Anzahl qualifi-zierter Fachkräfte in einer Regionunabdingbar für den wirtschaftli-chen Erfolg sind.
Auch Baden-Württemberg pflegteine lange Tradition der Wirtschafts-förderung, wie das Beispiel derSteinbeis-Stiftung deutlich macht,die bereits seit Mitte des 19. Jahr-hunderts existiert und einen Techno-logietransfer für kleinere Unterneh-men ermöglicht. Ein Netzwerk vonTechnischen Beratungsdiensten undSteinbeis-Transferzentren, die alleauf einen bestimmten Schwerpunktkonzentriert sind, bieten der mittel-ständischen Industrie einen einmali-gen Service. Viele Firmen, denen dasnötige Know-how fehlt, könnten oh-
SCHWERpunkt
ANZEIGE

30 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
SCHWERpunkt
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 31
Auch Datenschutz ist ein
Gemeinschaftsgut
GÜTER & Gesellschaft
MPF: Frau Professor Héritier, Herr Professor Engel,charakteristisch für Ihre Projektgruppe „Recht der Gemeinschaftsgüter“ ist, dass Politologen, Soziologen,Ökonomen und Juristen gemeinsam forschen. Wiesieht die interdisziplinäre Arbeit konkret aus? LeitenSie jeweils Ihr eigenes Wissenschaftlerteam an?
PROF. HÉRITIER: Wir haben interdisziplinäre For-schungsprogramme. Das Forschungsprogramm, das ichim Wesentlichen betreue, befasst sich mit „governanceacross multiple arenas“, der institutionellen Bereitstel-lung von Gemeinschaftsgütern. Darin arbeiten Politolo-gen, Soziologen und Juristen. Des Weiteren gibt es eininterdisziplinäres Forschungsprogramm, das die norma-tive Dimension der Gestaltung von Institutionen bei derBereitstellung von Gemeinschaftsgütern zum Thema hat.Hier forschen Politologen gemeinsam mit Ökonomenund Juristen. PROF. ENGEL: An dem Abfallprojekt, das ich betreue,sind Juristen und Ökonomen beteiligt, und eine Poli-tikwissenschaftlerin schaut uns auf die Finger. Gemein-sam mit Frau Héritier leite ich das schon erwähnte Pro-jekt zu der normativen Theorie der Bereitstellung vonGemeinschaftsgütern. Im Moment bin ich dabei, ein neu-es Projekt auf den Weg zu bringen, das auch instituts-übergreifend gedacht ist, also noch andere Institute derMax-Planck-Gesellschaft mit einbeziehen soll. Wir ha-ben es vorläufig „Formen und Grenzen der Rationalität“genannt.
MPF: Was ist eigentlich ein Gemeinschaftsgut? Wie lässt sich der Begriff definieren? Ein Gut im ökonomischen Sinne ist doch etwas, das von Menschen in irgendeiner Form erzeugt worden ist. Sie fassen aber auch Umweltmedien wie Luft und Wasser als Gemeinschaftsgüter auf.
HÉRITIER: Gemeinschaftsgüter sind Güter, zu denen einallgemeiner Zugang besteht, und die, wenn sie von einerPerson konsumiert werden, nicht an Nutzen für andere
verlieren. Das ist die reinste Form. Es gibt Güter, die zwarallgemein zugänglich sind, bei denen aber das, was man„rivalisierenden Konsum nennt“, gegeben ist. Darüberhinaus kann ein Gut auch normativ als Gemeinschafts-gut definiert werden.
MPF: Das rivalisierende Moment entsteht wohl dadurch, dass jemand dem Gemeinschaftsgut Schaden zufügen kann. Ich kann zum Beispiel die Luft vergiften, ich kann das Grundwasser verun-reinigen, so dass andere es nicht mehr in der Form benutzen können, wie sie es eigentlich – normativ gesehen – sollten. Kann man sagen, dass es Gütergibt, zu denen jeder Zugang haben muss?
ENGEL: Ja, obwohl uns dieser Ansatz in Untiefenführen könnte. Denn damit würden Sie letztlich von dergesellschaftlichen oder politischen Definition ausgehen.Ein Gemeinschaftsgut ist dann etwas, das der politischeProzess als solches definiert hat. Man kann so vorgehen,aber dann wird der Gegenstand dessen, was wir hier ma-chen, nahezu beliebig. Ich würde nicht so anfangen, ichwürde erst einmal versuchen, die Struktur des Gutes zuklären: Wenn die Verfügungsrechte an dem Gut wohl de-finiert sind, dann gibt es weder ein Problem der Kon-sumrivalität noch ein Problem mit dem Ausschlussprin-zip. Nur wenn Sie es nicht schaffen, die Verfügungsrech-te an dem Gut zu definieren, dann bekommen Sie dievon Frau Héritier beschriebenen Schwierigkeiten. Luftkann man nicht in Säcke packen. Beim Boden fangen Sieschon an zu grübeln, denn der Boden ist, bis auf wenigeEcken in der Welt, fest vergeben.
MPF: Sie interessieren sich also für Güter, für die es zur Zeit keine Verfügungsrechte gibt und zu denen praktisch jeder Zugang hat?
HÉRITIER: Man sollte zunächst mit der ökonomischenDefinition anfangen, weil die klar ist. Das heißt, das Gutwird nach der Ausschließbarkeit und nach rivalisieren-
Was ist ein Gemeinschaftsgut? In welchem Maße spielen politische Entscheidungen, dass
ein Gut allgemein zugänglich sein soll, eine Rolle? Welche institutionellen Lösungen werden für
die Überwindung des Konflikts zwischen kurzfristigen Individual- und längerfristigen Kollektiv-
interessen an einem Gut gefunden? Dies ist nur eine Auswahl von Fragen, mit denen sich die im
Oktober 1997 gegründete PROJEKTGRUPPE RECHT DER GEMEINSCHAFTSGÜTER in Bonn
beschäftigt. MAXPLANCKFORSCHUNG sprach mit den beiden Leitern PROF. ADRIENNE HÉRITIER
und PROF. CHRISTOPH ENGEL über ihre Arbeit und ihre Forschungsergebnisse.
FOTO
S: U
LRIC
HZI
LLM
ANN

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 33
sen rezipiert wird. Wenn Sie die Grundidee des Ganzennoch einmal mit einem Begriff versehen möchten: Unsinteressiert nicht die Rechtsdogmatik des Abfallrechtsoder sie interessiert uns höchstens in ihrer Instrumen-talität. Unser Ziel ist vielmehr, die Rechtspolitik einesGebiets zum wissenschaftlichen Gegenstand zu machen.
MPF: Frau Prof. Héritier, Ihre Gruppe behandelt eine ganze Palette von Themen, wie etwa die Liberalisierung bestimmter wirtschaftlicher Sektoren oder die Politik internationaler Organisationen.
HÉRITIER: Ja, es ist nicht so, dass viele Forscher an ei-nem Gegenstand arbeiten, wie im Abfallbereich, sondernsie haben jeweils ihre eigenen Projekte unter dem Dacheiner Problemstellung, der Bereitstellung von Gemein-schaftsgütern unter Bedingungen, unter denen man sienicht hierarchisch steuern kann, über Arenen und Gren-zen hinweg.
MPF: Sie unterscheiden zwischen Arenen und Ebenen der politischen Handlungen. Können Sie dieBegriffe gegeneinander abgrenzen?
HÉRITIER: Arenen ist der umfassendere Begriff, weil ersich auf die Interaktion zwischen politischen Einheitender vertikalen und horizontalen Dimension bezieht. Inter-aktion zwischen politischen Einheiten auf verschiedenenEbenen impliziert natürlich nur die vertikale Dimension.
MPF: Sie dehnen den Begriff des Gemeinschafts-guts auf die Versorgungsindustrie aus. Sie untersuchenunter anderem, welche Folgen die Liberalisierung und die Privatisierung der Telekommunikation, der Energiewirtschaft und des Transportwesens hat.
HÉRITIER: Ja, wir analysieren, wie sich aufgrund desWechsels vom Staatsmonopol zum Wettbewerb regulati-ve Strukturen auf nationaler und internationaler Ebeneändern. Wir untersuchen regulatorische Maßnahmen unddie Interaktion zwischen Regulierungsbehörden und re-gulierten Unternehmen.
MPF: Ist die Liberalisierung wirklich ein Vorteil für den Verbraucher? Zeichnet es sich nicht ab, dass nach einer Periode, in der sich viele Unternehmeneinen Preiskrieg liefern, wieder ein Prozess der Monopolisierung stattfindet? Nur, dass wir es jetztnicht mit staatlichen Monopolen, sondern mit global agierenden Konzernen zu tun haben?
HÉRITIER: Die Auswirkungen fallen je nach Sektorund/oder Land unterschiedlich aus. Im Telekommunika-tionsbereich beispielsweise sind die Preise eindeutig ge-fallen. Im liberalisierten Bahnsektor in Großbritanniensind sie – auch aufgrund erneuter Regulierung – zumTeil konstant geblieben, zum Teil gestiegen. Es ist richtig,dass sich nach der Liberalisierung von Märkten häufigzwar nicht neue Monopole, sondern einige dominierendeUnternehmen im Markt herausbilden.
MPF: Auch der Schutz persönlicher Daten ist einer Ihrer Forschungsgegenstände.
HÉRITIER: Auch Datenschutz ist ein Gemeinschaftsgut.Unser Projekt befasst sich mit der Frage, wie die Rege-lung des Datenschutzes in den Verhandlungen zwischenden Vereinigten Staaten und der EU gehandhabt wird.Die EU hat eine Direktive zum Schutz persönlicher Datenverabschiedet, die von öffentlichen und privaten Akteu-ren eingehalten werden muss. Wenn amerikanische Un-ternehmen diesen Anforderungen nicht entsprechen,werden die Daten nicht in die USA exportiert. Die Verei-nigten Staaten sind daher mit der EU in Verhandlungeneingetreten und haben als Lösung eine neue Form der fürsie bindenden betrieblichen Selbstregulierung angeboten.
MPF: Führt die EU-Direktive also zu einem höherenLevel des Schutzes der privaten Daten in den USA?
HÉRITIER: Dies ist zu erwarten. Man muss jedoch die Im-plementation des Selbstregulierungsabkommen abwarten.
MPF: Wegen der zunehmenden Verflechtung der Finanzmärkte können finanzielle Krisen schnellvon einem Land auf ein anderes übergreifen. Welche Rolle können hier Rating Agencies spielen?
HÉRITIER: Credit-Rating Agencies stellen Informationenüber Risikoverhältnisse im Fi-nanzmarkt bereit. Es handeltsich dabei um kommerzielleFirmen, die dafür bezahlt wer-den, dass sie die Kreditwür-digkeit ihrer Klienten eva-luieren und die Ergebnisseveröffentlichen. In den ver-gangenen Jahren haben Rating Agencies bei dem Management von Finanz-marktrisiken immer mehr anBedeutung gewonnen. Wiruntersuchen, welche Rollediese Einrichtungen bei derRegulierung der Finanzmärktespielen und welche Konse-quenzen dies hat.
MPF: In einem anderen Projekt befassen Sie sich mit der Politik internationaler, multilateraler Organisationen wie der Weltbank oder der Welthandelsorganisation.
HÉRITIER: Ja, hier wird die Ausgestaltung von interna-tionalen Organisationen im Hinblick auf die Qualität ih-rer Entscheidungen untersucht. Wir legen die Hypothesezugrunde, dass Institutionen, die deliberativ und in sichdemokratisch argumentierend vorgehen und Entschei-dungen abwägen, bessere Entscheidungen fällen im Hin-blick auf Umweltpolitik als internationale Institutionen,die nicht das ganze Spektrum von betroffenen Interessenrepräsentieren.
GÜTER & Gesellschaft
32 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
dem Konsum beurteilt. Wenn man das spezifische Gut andiesen beiden Dimensionen gemessen hat, dann kannman fragen, wie Probleme des rivalisierenden Konsumsbehoben werden können. In diesem Fall muss man überLösungen nachdenken und mit politischen und gericht-lichen Entscheidungen Instrumente zur Verfügung stel-len, um zum Beispiel die von Ihnen genannte Luftver-schmutzung zu reduzieren.ENGEL: Frau Héritier hat jetzt die Frage gestellt, ob es
überhaupt möglich ist, Verfü-gungsrechte zu begründen.Ich bin gleich einen Schrittweiter gegangen und habegesagt: Ich interessiere michnicht nur für die Güter, beidenen das – wie bei der Luft –technisch ausgeschlossen ist,sondern auch für die, bei de-nen aus anderen Gründenkeine Verfügungsrechte be-stehen. So könnten zum Bei-spiel die Transaktionskostenzu groß sein, oder wir wollenfür das Gut aus normativenGründen keine Verfügungs-rechte definieren, obwohl wires prinzipiell könnten.
MPF: Können Sie hierfür ein Beispiel geben?ENGEL: Es hat mit unserem Gegenstand nur bedingt et-was zu tun, aber es ist das eindringlichste Beispiel. Wirhaben in Deutschland etwas dagegen, dass menschlicheOrgane gehandelt werden, aber möglich wäre es.
MPF: Herr Engel, einer Ihrer Forschungsschwer-punkte ist, wie eingangs erwähnt, das Managementvon Abfall. Hier haben wir es mit etwas völlig anderem zu tun als beispielsweise mit Umweltmedien.Abfall ist von Menschen gemacht, und man sollte annehmen, dass der jeweilige Urheber auch dafür verantwortlich ist. Warum fassen Sie das dennoch unter den Begriff Gemeinschaftsgut?
ENGEL: Dies genau macht den Gegenstand so interes-sant. Denn beim Abfall ist der konzeptionelle Grund,warum er überhaupt ein Regelungsproblem auslöst, vielweniger offensichtlich als bei Umweltmedien. Als Ersteskönnen wir sagen: Das Abfallproblem entsteht in demMoment, in dem jemand ein Produkt, das er nicht mehrbraucht, an die Umwelt abgibt. Mit etwas Nachdenkenfindet man dann heraus, dass das ursprüngliche Problemschon immer in dem Gut drinnen steckte. Das ist nämlichdie Stoffgefahr. Das heißt: Die im Abfall enthaltenenStoffe beeinträchtigen die Umwelt oder unmittelbar dieGesundheit, wenn sie mit anderen Medien zusammenge-bracht werden, oder unter Umständen sogar ganz iso-
liert. Das Interessante am Abfall ist also, dass das Rege-lungsproblem latent ist. Es ist so lange domestiziert, wiejemand das Gut selber nutzen will. Dann ist sein Anreiz,im Eigeninteresse dafür zu sorgen, dass sich die Stoffge-fahr nicht realisiert, so groß, dass sich die Rechtsordnungdarum typischerweise nicht kümmert. Es gibt Ausnah-men, zum Beispiel bei Farben, Arzneien oder Giftstoffen.Bei den meisten Stoffen sagt sich das Recht aber: Solan-ge die Leute das nutzen, ist es nicht gefährlich. Aber so-bald sie die Stoffe an den Abfallpfad weitergeben, reali-siert sich potenziell deren Gefahr, und in dem Momentinteressiert sich die Rechtsordnung dafür. Das ist eineMöglichkeit, zu erklären, warum Abfall zu den Gemein-schaftsgütern gehört. Ein zweiter Grund ist die transito-rische Dimension. Abfall ist wahrscheinlich ein Rege-lungsproblem geworden, weil sich die Knappheitsver-hältnisse geändert haben.
MPF: Welchen Einfluss kann das Verhalten der Konsumenten dabei haben?
ENGEL: Die Abfallpolitik möchte die Umweltbeein-trächtigungen vermindern, indem sie die anfallendenMüllmengen reduziert. Zugleich will sie im Interesse spä-terer Nutzung und vor allem künftiger GenerationenRohstoffe schonen. Aus beiden Gründen ist sie an der –wenn nicht sortenreinen, so doch grob nach Stoffen ge-trennten – Sammlung von Haushaltsabfällen interessiert.Dieses Ziel ist nicht mit Befehl und Zwang zu erreichen.Der Staat kann nicht neben jeden Mülleimer einen Poli-zisten stellen. Statt dessen hat er sich mit gutem Erfolgdarauf verlegt, seinen Bürgern eine „Abfallmoral“ einzu-impfen. Ein Wissenschaftler unserer Projektgruppe un-tersucht, wie gut dieses Instrument funktioniert. Er be-wertet diesen Verzicht auf eine Steuerung durch dasRecht aus dem Blickwinkel des Verfassungsrechts.
MPF: Verfolgen Sie in Ihrer Forschung auch dasZiel, unterschiedliche Entsorgungskonzepte wie dasDuale System Deutschland und das englische Konzepthandelbarer Abfall-Zertifikate abschließend zu bewerten oder sogar neue Vorschläge zu erarbeiten?
ENGEL: Das Ziel des gesamten Abfallprojektes ist es,der Rechtspolitik einen analytischen Rahmen zur Verfü-gung zu stellen, in dem schon diskutierte Lösungen be-wertet und hoffentlich auch neue Lösungsmöglichkeitengeneriert werden.
MPF: Dafür brauchen Sie, wie Sie gerne betonen,den „Input“ von Sozial- und Politikwissenschaftlern.Wenn Sie konkret Richtlinien – zum Beispiel Grenz-werte für Chemikalien im Grundwasser – festlegenwollen, müssen Sie sich außerdem auf Fachleute, also Naturwissenschaftler, verlassen können?
ENGEL: Aber sicher. Uns kann zwar nicht interessieren,ob ein Sachverhalt physikalisch so oder anders ist. Unsinteressiert aber, wie die Institutionen aussehen müssen,die dazu führen, dass zum Beispiel physikalisches Wis-
SCHWERpunkt

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 35
tion, in der wir kein strenges Monopol haben. Ein be-stimmtes Produkt wird vielmehr durch die Existenz an-derer Produkte kontrolliert, die zwar eine vergleichbareFunktion ausüben, aber nicht identisch sind. Mein Ein-druck ist, dass die Staaten von einer Situation, in der sieechte Monopole hatten, immer stärker in eine Situationwandern, in der sie zueinander im monopolistischenWettbewerb stehen. Das heißt, die Tätigkeit des einenStaates kann teilweise durch die Tätigkeiten eines ande-ren Staates oder anderer politischer Arenen ersetzt wer-den. Es ist aber nicht so, dass plötzlich eine atomistischeStruktur da wäre, dass sozusagen „jeder alles kann“, son-dern die typische Situation ist die: Sie können zwar einanderes Arrangement wählen, also beispielsweise denBetrieb ins Ausland verlagern, aber das bringt solche er-heblichen Wechselkosten mit sich, dass Sie sich auchdiese Entscheidung eine ganze Weile überlegen.
MPF: Ständig ereignen sich gravierende Unglücks-fälle, die Gemeinschaftsgütern beträchtlichen Schadenzufügen. Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht ein Tanker verunglückt und den Ozean mit Öl ver-schmutzt. Sehen Sie Möglichkeiten, rechtliche Schritteeinzuleiten, dass eben Tanker, die unter Billigflaggefahren, nicht zugelassen oder stärker kontrolliert werden? Oder nehmen Sie den Betrieb eines Kern-kraftwerkes und die Entsorgung radioaktiven Mülls: Auch hier sind die Gemeinschaftsgüter Luft und Boden einer potenziellen Gefahr ausgesetzt, wennnicht auf äußerste Sicherheit geachtet wird.
HÉRITIER: Wir sind keine politische Beratungsinstituti-on, sondern eine Forschungseinrichtung. Der ersteSchritt wäre, systematisch zu untersuchen, unter wel-chen Bedingungen welche Risiken entstehen, um dann,im nächsten Schritt, Lösungen zu entwickeln, wie mandiese Probleme, die Sie angesprochen haben, behebenkönnte.ENGEL: Also, ich habe ein bisschen geschmunzelt beiIhren Beispielen, weil wir gerade im vergangenen De-zember eine Konferenz veranstaltet haben, bei der es umsolche Fälle ging. Die These des Soziologen, den wir ein-geladen hatten, lautete: Eigentlich ist die Welt nicht ge-fährlicher geworden, sondern wir merken nur mehr da-von, wie gefährlich sie ist. Das, was wirklich anders ge-worden ist, ist das Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit,das für Störfälle hergestellt wird. Katastrophen hat esimmer gegeben, die Welt war vor hundert Jahren wahr-scheinlich viel stärker von Katastrophen durchsetzt, alssie es heute ist. Aber wenn sich irgendwo fernab ein Un-glücksfall ereignete, nahm das die dortige Umgebungwahr und sonst niemand. Durch unsere Kommunika-tionstechniken erfahren wir inzwischen alle, wenn zumBeispiel eine Gletscherbahn verunglückt. Dies ist sicher,wie jede gute These, überzeichnet. Sicher stimmt auch,dass man nur aufgrund neuer Transporttechniken undder vernetzten Gütermärkte auf die Idee kommt, Dingeüber riesige Distanzen zu transportieren, sagen wir mal,
Mineralöl einmal halb um die Welt zu schippern. Abereines der Dinge, auf die wir auch in der politischen Dis-kussion aufmerksam machen könnten, ist, dass das sichverstärkende Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerungvielleicht selbst das Problem ist.
MPF: Ich sehe allerdings das Problem, dass natio-nale Maßnahmen, Gemeinschaftsgüter vor Gefahrenzu schützen, ins Leere laufen können. Dieser Fall kann eintreten, wenn die im Inland gültigen Sicher-heitsstandards nicht weltweit gelten, wie bei denschon erwähnten Tankern oder Kernkraftwerken. Denndas Äquivalent zu einem gewählten nationalen Parla-ment, das Gesetze verabschieden und Verbote erlassenkann, gibt es auf internationaler Ebene noch nicht.
ENGEL: Sie haben Recht, das Geschäft der Regulierungwird schwieriger, sobald man Systemwettbewerb hat.Den sprechen Sie jetzt an, und gerade die weltweitenTransportmärkte sind ein ziemlich harter Gegenstand.Denn Sie können den regu-lierten Gegenstand hinlegen,wohin Sie wollen, sodass Sieder Regulierung des einenStaates relativ leicht entge-hen können. Auf der anderenSeite ist der Schluss: „Alsolasst uns doch das Maß desRegulierungswettbewerbs be-schränken, dies ist wohl-fahrtsfördernd“, höchst pro-blematisch. Eine unserer Auf-gaben ist es, die Dinge in Per-spektive zu rücken, zu sagen,ja gut, wir haben vielleichtbei den Tankerunfällen einProblem, das wir früher einbisschen leichter lösen konn-ten. Dafür haben wir auf an-deren Gebieten sehr viel bessere Zustände dadurch, dassder Wettbewerbsdruck auf nationale Regulierungenwächst. Insbesondere lösen sich auf diese Art die Proble-me des Missbrauchs politischer Macht viel leichter. Wenneine Regierung nicht mehr ein Monopol hat, sondernweiß, dass sie unter Druck vom Ausland geraten kann,falls sie es mit ihren Regulierungsabsichten übertreibt, indie eigene Tasche oder ihren Interessengruppen etwaszuwirtschaftet, dann überlegt sie sich ein bisschen ge-nauer, was sie tut. Oder sie generiert neuartige Lösungen,weil sie sich angestoßen fühlt, viel intensiver darübernachzudenken. Der Systemwettbewerb ist einer der Ge-genstände, der uns interessiert, und der ist – wie die mei-sten Dinge, wenn man darüber nachdenkt – ambivalent.
DAS INTERVIEW FÜHRTE OLIVIA MEYER
GÜTER & Gesellschaft
34 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
MPF: Wie sieht das deliberative Vorgehen konkret aus? Diskutieren bestimmte Gremien internationaler Organisationen mit so genannten „non governmental organisations“?
HÉRITIER: Deliberation umfasst einen Entscheidungs-prozess, in dem Argumente zwischen Beteiligten mit un-terschiedlichen Vorstellungen ausgetauscht werden undwo diese bereit sind, ihre Ansichten in Frage zu stellenund dazuzulernen, um den Nutzen für alle Beteiligten zuerhöhen und auf dieser Basis dann zu einem Konsensuszu kommen.
MPF: Ich habe den Eindruck, dass die Bedeutung,die Gemeinschaftsgüter und ihre Erforschung jetzt gewinnen, mit der zunehmenden Globalisierung zusammenhängt.
HÉRITIER: Die Voraussetzung des Handelns, des Findensvon institutionellen Lösungen, haben sich durch die Glo-balisierung verändert. Die grundsätzliche Problematik,Gemeinschaftsgüter bereitzustellen hat sich dadurchnicht gewandelt. Die hat es immer gegeben. Nur dieHandlungsvoraussetzungen sind andere.ENGEL: Also ich würde es weitgehend auch so sehen.Es gibt freilich einzelne Fälle, da hat die Globalisierunguns auch ein neues Gemeinschaftsproblem gebracht. Dies
trifft offensichtlich dann zu,wenn Sie einen Systemzu-sammenhang schützen wol-len, der nur weltweit schütz-bar ist. Naturwissenschaft-liche Beispiele wären das Kli-maproblem, die globale Er-wärmung oder der Arten-schutz. Wenn Sie ein gesell-schaftliches Problem betrach-ten wollen, dann könnten Sie die zusammenwachsen-den Kommunikationsnetzenehmen. Solange die Netzenicht vorhanden beziehungs-weise so verbreitet waren, wiesie heute sind, sah man auchkeine Notwendigkeit, dasdeutsche Tabu gegen jedes
nationalsozialistische Gedankengut vor einer ganz an-deren amerikanischen Kultur zu schützen. Denn dieKulturen trafen vorher nicht in dieser Form aufeinan-der. Es gibt also Konstellationen, wo tatsächlich das en-gere Zusammenwachsen der Welt überhaupt erst dasProblem entstehen lässt. Sie sind aber nicht der Nor-malfall. Der Normalfall ist, dass das Problem vorhandenist und dass sich die Bedingungen ändern, unter denenes bewältigt wird.
MPF: Nehmen wir das Beispiel Internet. Sollten „Wissensbasen“ der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, sodass jedermann das Recht hätte, darauf zuzugreifen?
ENGEL: Das ist eine spannende Frage, denn historischverlief die Entwicklung gerade umgekehrt: Nicht dieNutzergemeinschaft rief nach dem Staat, sondern der Urheber. Der Staat räumte dem geistigen Vater mit demUrheber- und Patentrecht ein Monopol auf Zeit für diewirtschaftliche Verwertung seines Guts ein. Diesesgleichsam künstliche Recht wurde allerdings einschrän-kend gestaltet. So wurde etwa nur die Formulierung eines Schriftwerks geschützt, nicht aber die darin enthal-tenen Ideen. Dritte durften den Text zwar nicht einfachabschreiben, die geistige Leistung aber für eigene Zweckenutzen. Durch die Kommunikationstechniken, auf denenauch das Internet basiert, ist der Urheber noch stärkergefährdet als zuvor. Denn der einmal digitalisierte Inhaltkann heute ohne nennenswerten Aufwand oder Qua-litätsverlust kopiert werden. Die gleichen Technikenkann der Urheber aber auch zum Schutz seiner „files“einsetzen, er kann sie zum Beispiel so gestalten, dass derEmpfänger den Text nur ein einziges Mal am Bildschirmlesen kann. Elektronische „Wasserzeichen“ erlauben es,Urheberrechtsverletzungen einfach und präzise nachzu-weisen.
Es ist deshalb eine rechtspolitische Frage, in welchemUmfang die persönliche Leistung des Urhebers geschütztwerden sollte. Würde man auf den Schutz gänzlich ver-zichten, so würde der Anreiz für die Leistung verlorengehen. Doch reichte es vielleicht aus, die Nachahmungder Leistung beziehungsweise Erfindung zu verhindern.Dritte könnten dann darauf aufbauen und selbst Neuesfinden.
MPF: Würden Sie dann das im Internet abgelegteWissen als Gemeinschaftsgut ansehen?
ENGEL: Vielleicht sollte man sich die Menge der zu ei-nem Zeitpunkt wahrscheinlichen Erfindungen als eineArt Pool vorstellen, aus dem kein Erfinder eine zu großeMenge für sich allein herausnehmen kann. Dann hätte eseine gewisse Ähnlichkeit mit einem Gemeinschaftsgut.Doch sollten wir uns vor einfachen Analogien hüten. Esist nicht sehr wahrscheinlich, dass auf dieses putativeGemeinschaftsgut dieselben Lösungen passen wie etwaauf die Umweltgemeingüter.
MPF: Die neuen Kommunikationsnetze haben auchgesellschaftliche Konsequenzen. Wenn Individuen zumBeispiel mithilfe des Internet nationalen Regeln ent-kommen können und rechtsradikales Gedankengutüber eine amerikanische Homepage erlangen, verliertder Nationalstaat in gewisser Weise an Bedeutung. Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch von demmonopolistischen Wettbewerb der Regierungen.
ENGEL: Diese Formulierung trifft den Sachverhalt ganzgut. Der monopolistische Wettbewerb ist eine Konstella-
SCHWERpunkt

36 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
SCHWERpunkt
Das süße Gut oder:Sind die Bedürfnisse der Menschen unersättlich?
GÜTER & Gesellschaft
Morgens Marmelade, nachmit-tags Kaffee und Kuchen, zwi-
schendurch einen Espresso oder eineLimonade – Zucker oder ein Süßstoffsind immer dabei. Und das in erheb-lichen Mengen: Zehn Prozent in Li-monade und 60 Prozent in Marmela-de sind normal. Rund 33 KilogrammZucker konsumiert jeder Bundesbür-ger derzeit durchschnittlich im Jahr.Anfang des 20. Jahrhunderts lag derZuckerkonsum pro Kopf in Deutsch-land noch bei etwa 13 Kilo jährlich.Seit den achtziger Jahren sind Süß-stoffe wie Saccharin „in“ – obwohldie chemische Verbindung Saccharinschon seit 1879 bekannt ist. Wie lässt sich dieser Wandel erklären?Wird der Konsum von Süßstoffenimmer weiter wachsen, weil das Bedürfnis nach Süße unersättlich ist?Wieso ist der Konsum von künst-lichen Süßstoffen erst in der letz-ten Zeit so stark gestiegen? DasFazit der Studie von Wilhelm Ruprecht lautet: Dieser Wandellässt sich am besten als histo-rischer Lernprozess analy-sieren. Der psychologischeErklärungsansatz unterschei-det sich erheblich von denbisherigen Erklärungsversu-chen der Ökonomik, die sol-
che Wandlungsprozesse im Wesentli-chen nur mit geänderten relativenPreisen erklärt.
Im Forschungsprogramm der Ab-teilung, die Professor Ulrich Witt lei-tet, ist die Untersuchung der histori-schen Entwicklung des Zucker- undSüßstoffkonsums (als Süßstoffe wer-den hier alle süß schmeckenden Sub-stanzen bezeichnet, die keine Kohle-hydrate sind) nur ein Fallbeispiel füreine tiefer liegende Fragestellung: In den westlichen Gesellschaften hatim Zuge des Wirtschaftswachstumsin den vergangenen 100 Jahren einbeispielloser Einkommenszuwachsstattgefunden, der bisher auch miteiner beispiellosen Ausweitung desindividuellen Konsums verbundenist. Entscheidende Fragen für die
weiteren Wachstumsmöglichkei-ten der Volkswirtschaften sind:Wird sich das Wachstum desKonsums weiter fortsetzen?Oder wird es zur Sättigung kom-
men? Welche Bedürfnisse desMenschen können gesättigtwerden? Welche Branchenwerden weiterhin wachsen?
WACHSTUM
UND SÄTTIGUNG
Seit in der Mitte des 19.Jahrhunderts der ÖkonomErnst Engel herausfand,
dass mit steigendemHaushaltseinkommendie Ausgaben fürNahrungsmittel rela-
Wie wird ein „Ding“ zum „Gut“, das Nutzen stiftet? Dies ist eine der Fragen, die WILHELM RUPRECHT, Doktorand in der Abteilung für Evolutionsökonomik am
MAX-PLANCK-INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG VON WIRTSCHAFTSSYSTEMEN in Jena, untersucht hat – und zwar am Beispiel des Zuckers.
Darstellung von Zuckerrohr aus dem 17. Jahrhundert.
Diese Berliner Zuckerplastik entstand
im Jahr 1880 zum Jubiläum der Freiheits-
idee von 1830.
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 37
FOTO
S: A
KG, B
ERLI
N(1
), ZU
CKER
MU
SEU
MBE
RLIN
(1)

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 39
Das sensorische Nervensystem desMenschen ist biologisch so organi-siert, dass es verschiedene Ge-schmacksrichtungen identifizierenkann, die mit verschiedenen positi-ven oder negativen Eigenschaftender Nahrungsmittel verbunden wer-den: Süßes steht für Kalorien; dieVorliebe für Süßes zeigen schonNeugeborene. Bitterer Geschmackwarnt vor Verderb: Verdorbenes Ei-weiß, in dem sich Bakterien tum-meln, enthält Eiweißbruchstücke, dieder Geschmackssinn als bitter wahr-nimmt. Auch Salz braucht der Kör-per von Zeit zu Zeit, um sein physio-logisches Gleichgewicht aufrechtzu-erhalten. Über die Funktion der bio-logischen Aversion gegen das Sauresind sich Ernährungswissenschaflternoch nicht im Klaren.
Auf diesen teilweise angeborenenVorlieben und Abneigungen gegen-über Geschmacksrichtungen baut derMensch als Konsument durch einfa-che Konditionierungs-Lernvorgängeseine Nahrungspräferenzen auf. Da-bei kann neben den angeborenenGeschmacksvorlieben und –aversio-nen auch das Sättigungsgefühl amEnde einer Mahlzeit als Verstärkerwirken. Durch die angeborene Vor-liebe für Süßes und den hohen Kalo-riengehalt ist die Aufnahme vonZucker hochgradig selbstverstärkend.
Eine weitere biologisch erklärbareVerhaltensweise, die aus der Eigen-schaft des Menschen als Allesfresserresultiert, ist die Neophobie, die Ab-
GÜTER & Gesellschaft
38 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
tiv sinken, ist es in der ÖkonomikStand der Erkenntnis, dass mancheBedürfnisse des Menschen zur Sätti-gung neigen. Die Ausgaben für Nah-rungsmittel unterscheiden sich nachEngels Gesetz von anderen Berei-chen: Die Ausgaben für Miete etwableiben mit wachsendem Wohlstandprozentual gleich, die Ausgaben fürdas, was man Luxusgüter nennt undfür Ersparnisse wachsen an. Schondie Begriffsbildung der „Sättigung“zeigt, dass die Nahrungsmittelin-dustrie von dieser Sättigung der Be-dürfnisse zuallererst betroffen seinkönnte. „Das Bedürfnis nach Mobi-lität etwa scheint jedoch kaum zusättigen zu sein – und wann ist un-ser Bedürfnis nach Unterhaltung ge-sättigt?“, fragt Ulrich Witt. Solchegrundsätzlichen Dimensionen derWirtschaftsentwicklung aufzuklärenpasst in die auf Grundlagenfor-schung orientierte Programmatik derMax-Planck-Gesellschaft.
STEIGENDE VERFÜGBARKEIT
VON ZUCKER
Zurück zu unserem „süßen“ Bei-spiel: Etwa seit dem Jahr 1400 wurdeZucker aus Indien über Venedig nachEuropa importiert. Gewonnen wurdeer aus Zuckerrohr, das vermutlichauch in Indien heimisch ist. Seithergibt es relativ gute Daten über denKonsum von Zucker in Europa, dadie Ware als Importgut im Zoll re-gistriert und der Verbrauch besteuertwurde. Etwa von 1800 an versuchte
der Berliner Chemiker Franz CarlAchard Zucker aus Rüben herzustel-len. Im Jahr 1806 erließ Napoleonein als „Kontinentalsperre“ bekann-tes Edikt, durch das Europa von Im-porten und auch vom Rohrzuckerabgeschnitten wurde. Dieses Ediktwar ein erheblicher Impuls, um dieGewinnung von Rübenzucker weiterzu verbessern: Es wurden Rüben ge-züchtet, die einen höheren Zuckerge-halt aufwiesen, und es wurden Her-stellungsverfahren für weißenZucker gesucht – zu Anfang war derbraune Rübenzucker nur ein qualita-tiv minderwertiger Ersatzstoff fürden fast weißen Rohrzucker.
In ökonomischen Begriffen ausge-drückt: Die Gewinnung von Zuckeraus Rüben war keine „Produktinno-vation“, weil das Produkt chemischmit dem Rohrzucker identisch war,sondern eine „Prozessinnovation“,wenn auch zunächst eine wenig er-folgreiche. Denn Achard fand keinenWeg, die Zuckergewinnung aus derRübe gegenüber dem Rohrzuckerkonkurrenzfähig zu machen. Erstlangfristig konnte der Rübenzuckermit dem Rohrzucker in Konkurrenztreten: Durch Züchtung wurde derZuckergehalt der Rübe zwischen1800 und 1900 von fünf auf zehnProzent gesteigert. Mitte des 19.Jahrhunderts wechselten viele Bau-ern in Deutschland vom Getreide aufden Zuckerrübenanbau, weil die Ge-treidepreise durch Importe aus denUSA gefallen waren. Auf diese Weise
wurde Deutschland ab 1860 von einem Zucker-Import- zu einemZucker-Exportland. Zucker ist einesder Nahrungsmittel, das im Lauf des19. Jahrhunderts stetig billiger unddamit verfügbarer wurde – die Preisefür Fleisch dagegen stiegen im Ver-hältnis zur Kaufkraft an. Allein inden vergangenen 200 Jahren ist derdurchschnittliche Pro-Kopf-Konsumvon Zucker in Deutschland etwa umden Faktor 15 angestiegen. Heutewird Saccharose (Haushaltszucker) imGegensatz zu anderen Nahrungsmit-teln praktisch von 100 Prozent derWeltbevölkerung konsumiert. EineAusnahme bilden die grönländischenInuit, von denen zehn Prozent eineSaccharose-Intoleranz aufweisen.
VERSTÄRKUNGSLERNEN
BEIM „ALLESFRESSER“
Um einer Erklärung dieser enor-men Steigerung des Zuckerkonsumsnäher zu kommen, müssen wir ersteinen Ausflug in die Anthropologiedes Geschmacks unternehmen. Men-schen sind „Allesfresser“, biologischgesprochen: Omnivoren. Das schafftdas Problem zu entscheiden, was essbar ist und was nicht, da vielePflanzen und Tiere von Natur ausungenießbar oder sogar giftig sind.Zur Lösung dieses Problems existie-ren verschiedene Mechanismen, diezum Teil individuell erworben wer-den, zum Teil jedoch auch schon imLauf der biologischen Evolution desMenschen entstanden sind.
SCHWERpunkt
„Der Zucker-bäcker“: Der Kup-ferstich stammt aus dem 1698 entstandenen Band„Abbildung und Beschreibung dergemeinnützlichenHauptstände“.
Süß muss es sein: Ober in einem Wiener Kaffeehaus im Jahr 1953.
„Vista de una Casa de Calderas“ist nebenstehendeLithografie beti-telt. Sie zeigt eineZuckersiederei auf Kuba in derMitte des 19.Jahrhunderts.
Zucker schadet denZähnen. Das warschon 1888 bekannt,als dieser Holzstichmit dem Titel „Nach-klänge der Festtage –Im Vorzimmer desZahnarztes“ nach einer Zeichnung vonGeorg Koch entstand.
Zuckerkonsum in Kalorien pro Kopf und Tag zwischen1700 und 2000 in ausgewählten Ländern.
— Großbritannien— USA— Deutschland— Italien— Frankreich
QU
ELLE
: DAV
IDG
RIG
G, S
PATI
ALVA
RIAT
ION
SIN
THE
CON
SUM
PTIO
NO
FSW
EETE
NER
S,
TIJD
SCH
RIFT
VOO
REC
ON
OM
ISCH
EEN
SOCI
ALE
GEO
GRA
FIE,
VOL.
89, N
O. 2
, PP.
178-
192. 600
500
400
300
200
100
01700 1750 1800 1850 1900 1950 2000
FOTO
S: A
KG, B
ERLI
N

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 41
sind Faktoren, die hier Einfluss ha-ben können. Allerdings: Auch nachder Phase der Steigerung des Zucker-konsums ist das Verbrauchsniveau in Großbritannien sehr viel höher,obwohl heute Unterschiede im Ein-kommen und in der physischen Ver-fügbarkeit von Zucker keine Rollemehr spielen. In Großbritannien istjedoch auch heute noch für „konti-nentale Geschmäcker“ alles sehr süß.„Das spricht für Lernprozesse, dievon Generation zu Generation wei-tergegeben werden. Auch der Kon-sum künstlicher Süßstoffe ist höherals auf dem europäischen Festland“,sagt Ruprecht.
Seit 1879 kennt man Saccharin,aber erst seit rund 20 Jahren sindkünstliche Süßstoffe in Mode ge-kommen. In Zuckeräquivalenten um-gerechnet sind künstliche Süßstoffe(also alle süß schmeckenden Sub-stanzen, die keine Kalorien enthal-ten) im Begriff, etwa in den USA denKonsum von Zucker zu übersteigen.Dabei waren künstliche Süßstoffe bisin die zweite Hälfte des 20. Jahrhun-derts hinein in der Wahrnehmungder Öffentlichkeit ausgesprocheneSurrogate für Zeiten des Zuckerman-gels: In Deutschland kletterte derSaccharin-Absatz in den Kriegs- undNachkriegszeiten des Ersten undZweiten Weltkriegs in unerreichteHöhen. Dieses schlechte Imagekonnten die künstlichen Süßstoffeerst ablegen, als die Kalorienversor-gung an Sättigungsgrenzen stieß –
bekanntlich ist seit einiger Zeit inden Industrieländern eher ein Über-angebot an Kalorien als deren Man-gel das Problem. Darüber hinaussinkt der Kalorienbedarf unter ande-rem durch die verminderte körperli-che Bewegung in der sich wandeln-den Arbeitswelt zusätzlich.
„LITE-PRODUKTE“SCHÄTZEN LERNEN
Dass Konsumenten unter diesenUmständen zu kalorienarmen Süß-stoffen greifen, ist eine „konservati-ve“ Substitution. Sie hilft Kalorienzu sparen, während sie gleichzeitigdas angeborene Bedürfnis nach Sü-ßem befriedigt und die Spielregelnder „flavor principles“ einhält. Hinterdem Wunsch, Kalorien zu sparen,steht jedoch nicht bloß das Erreicheneiner physiologischen Sättigungs-grenze: Als Folge des zunehmendenWohlstandes hat sich zuerst in deneinkommensstarken Gruppen in ent-wickelten Volkswirtschaften eine so-ziale Schlankheitsnorm herausgebil-det, die zunehmend auch die ein-kommensschwächeren Gruppen er-fasst.
Umfragen aus den USA zeigen,dass sich etwa 70 Prozent der Be-fragten für übergewichtig halten –obwohl nur etwa 20 Prozent der Be-völkerung dies nach klinischen Maß-stäben wirklich sind. Dank der Angstvor dem Übergewicht ist ein riesigerzusätzlicher Markt für kalorienre-duzierte „Lite-Produkte“ entstanden,
die allesamt künstliche Süßstoffe an-stelle des in der öffentlichen Wahr-nehmung verpönten Zuckers enthal-ten. Entscheidend ist, dass die Kon-sumenten von einem direkten Zu-sammenhang zwischen dem Konsumder „Lite-Produkte“ und ihrem Kör-pergewicht überzeugt sind, auchwenn wissenschaftliche Studien zurLangzeitwirkung des Konsums von„Lite-Produkten“ auf das Körperge-wicht noch ausstehen.
Durch technische Innovationenund Erfindungen entkoppelt dieNahrungsmittelindustrie die ver-schiedenen Qualitätsdimensionen derProdukte und damit gleichzeitig diephysische Sättigung von der Markt-sättigung: Kalorien und Süße sinddurch die künstlichen Süßstoffe un-abhängig voneinander verfügbar.
„Die Nahrungsmittelindustrie ent-geht der drohenden Sättigung desBedarfs, indem sie durch die immerneue Kombination von Qualitätenneue Produkte schafft, die neue,kombinierte Bedürfnisse befriedigen.Auf den angeborenen Bedürfnissensetzen zahlreiche erlernte Bedürfnis-se auf, die sich immer neu zusam-mensetzen können“, sagt UlrichWitt. Und: „Im langfristigen ökono-mischen Wandel sind nur relativ we-nige Tendenzen robust – vermutlichhaben diese dann mit den geneti-schen Gemeinsamkeiten der Men-schen zu tun.“ Der Drang zur Süßescheint zu diesen gleichbleibendenTendenzen zu gehören. GOTTFRIED PLEHN
GÜTER & Gesellschaft
40 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
neigung vor dem Neuen. Neue Nah-rungsmittel nicht zu konsumieren istein sinnvoller Schutz vor möglicher-weise giftigen Substanzen. DerVolksmund fasst dieses Verhalten indem Sprichwort: „Was der Bauernicht kennt, das isst er nicht.“ Diesererlaubte Set von Nahrungsmittelnwiederum ist im Alltag kulturell be-stimmt, nämlich durch „regionaleKüchen“, die sich durch die Verwen-dung bestimmter Grundstoffe, durchlokale Zubereitung, durch Tabus unddurch das Vorherrschen bestimmterGeschmacksrichtungen auszeichnen.Eine „regionale Küche“ und nochmehr die vorherrschenden Ge-schmacksrichtungen („flavor princi-ples“) ändern sich nur in langenZeiträumen.
Ob eine Küche auf Spätzle undMaultaschen oder Oliven, Tomatenund Oregano aufbaut, ist natürlichein großer Unterschied. Indem die„regionale Küche“ ein Ensemble anessbaren Dingen beschreibt, schließtsie zugleich die weniger essbaren ausund ist damit auch ein Ausdruck derAbneigung vor dem Neuen. DieseAbneigung gegen neue Nahrungs-mittel muss erst überwunden wer-den, bevor sich Innovationen ver-breiten können. Die Zeit, in der derZucker langsam vom Luxusgut zumAlltagsgut wurde, war zugleich dieZeit, in der neue Genussmittel wieTee, Kaffee und Schokolade massen-haft ins Angebot kamen. Ein Grundfür die konservativ eingestellten
Konsumenten, von ihren ange-stammten „flavor principles“ ab-zurücken, liegt also in der verstär-kenden Wirkung von Süßstoffen, de-ren Verfügbarkeit ja gestiegen war.
Wie aber lässt sich der enorme his-torische Anstieg des Zuckerkonsumsgerade im 19. und im 20. Jahrhun-dert erklären? In der Zeit der Indu-strialisierung wurde auch die Her-stellung von Nahrungsmitteln immerstärker industrialisiert und auf eineMassenproduktion ausgerichtet. Weildie neuen Produkte jedoch überallakzeptiert werden sollten, wurde dieangeborene Vorliebe für Süßes zumVehikel, um die Neophobie der regio-nalen Küchen „aufzusprengen“.
Die Geschmacksnote „süß“ signa-lisiert den Konsumenten in einemeinfachen Verstärkungslernvorgang,dass auch völlig neue Nahrungsmit-tel oder (neuerdings) industriell zu-bereitete Nahrungsmittel genießbarsind. Um den Zucker herum habensich eine ganze Reihe von zuneh-mend industriell hergestellten Nah-rungsmitteln gruppiert, die vom süßen Geschmack leben wie zumBeispiel Limonaden, Kekse, Marme-laden oder Schokolade. Dieser „in-direkte Konsum“ von Zucker als Zutat in einem Fertigprodukt machtheute den Großteil des Zuckerver-brauchs aus.
Der großzügige Einsatz von Zuckerals „Primärverstärker“ im indirektenKonsum erleichterte zugleich dieUmstellung von selbst versorgenden,
bäuerlichen Haushalten auf (städti-sche) Haushalte, die ihre Lebensmit-tel komplett einkaufen, wie es unterden Bedingungen der Industrialisie-rung der Fall ist. Durch die verlän-gerte Arbeitszeit bleibt weniger Zeitfür Zubereitung und Verzehr von Es-sen – Zucker wird ein klassischer Be-standteil von Fastfood.
Es können sogar Auswirkungendes gestiegenen Saccharose-Kon-sums auf den Konsum nicht-indu-striell hergestellter Lebensmittel ver-mutet werden. „Parallel zum Anstiegdes Zuckerkonsums ist im 19. Jahr-hundert auch der Konsum von Honigund Früchten dramatisch angestie-gen“, sagt Wilhelm Ruprecht. „Dasspricht dafür, daß Süße unabhängigdavon, ob sie aus Saccharose, Gluco-se oder Fructose gewonnen wird, zueinem anerkannten flavor principlegeworden ist.“
NATIONALE UNTERSCHIEDE
UND KULTURELLES LERNEN
Dieser Zusammenhang von In-dustrialisierung und Zuckerkonsumpasst auch zu den erheblichen inter-nationalen Unterschieden in Ver-lauf und Niveau des Konsums vonZucker: Die starke Steigerung desVerbrauchs begann in Großbritan-nien fast 100 Jahre früher als in Ita-lien. Der bessere Zugang zu Zuckerin Großbritannien durch die Koloni-en und das höhere Einkommen, dasin Großbritannien durch die früheIndustrialisierung erreicht wurden,
SCHWERpunkt
Zuckersiederei in Brasilien oder Kuba, un-datiertes Foto
„Die Nigritten werdenzum Zucker sieden angehalten“. Das Bildzeigt einen Kupferstichmit Schwarzen in denspanischen KolonienAmerikas. Er illustriertdie Reisebeschreibun-gen Girolamo Benzonis,der Mitte des 16. Jahr-hunderts den Konti-nent besuchte.
Zuckerrationie-rung in Englandim Jahr 1925: Die Zuteilung an Restaurants wirdin Portionstütenverpackt.
FOTO
S: A
KG, B
ERLI
N

SCHWERpunkt
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 43
Der europäische Wegzur sicheren Rente
GÜTER & Gesellschaft
Arbeitgeber als Beitragszahler weiterwachsen – dies jedoch führt zu stei-genden Lohnnebenkosten, die alsNachteil im internationalen Wettbe-werb zu Arbeitsplatzverlusten füh-ren. Was also ist zu tun, wenn aufder einen Seite die Rente nach wievor nicht nur eine Mindestsicherung,sondern die Sicherung des Lebens-standards leisten, aber auf der ande-ren Seite die Beitragsbelastung nichtins Unermessliche steigen soll?
Die Antwort der Bundesregierungdarauf ist, das Sicherungsniveau derumlagefinanzierten Rente langfristigzurückzuschrauben und die Ein-bußen durch die Einführung einerzweiten Vorsorgeform, der kapitalge-deckten Altersvorsorge, aufzufan-gen: Die Versicherungspflichtigenmüssen also neben ihren Sozialversi-cherungsbeiträgen auch eine privateZusatzversicherung abschließen odersich in Betriebsrentensystemen absi-chern lassen. Davon verspricht mansich durch günstige Verzinsung ei-nen kompensierenden Effekt für dieKürzungen im Umlagesystem. DieRentenversicherung wird in Zukunftalso aus einem Mix bestehen: aus ei-ner Rente aus dem umlagefinanzier-ten System und einer Rente aus demangelegten Kapital.
ALLE EU-STAATEN HABEN
DASSELBE PROBLEM
Die Deutschen sind nicht die Ein-zigen in Europa, die ihre sozialenSysteme reformieren. Sozialkostensind ein potenzieller Wettbewerbs-nachteil in einem Zeitalter, in dem
der grenzüberschreitende Austauschvon Waren, Kapital und Dienstleis-tungen (Globalisierung) immer in-tensiver wird. Hier wird ein interna-tionaler Bezug deutlich. Hinzukommt, dass die beschriebene demo-graphische Entwicklung in allenwesteuropäischen Industrieländernzu beobachten ist: Die europäischeKommission hat im Oktober 2000 fürdie 15 EU-Mitgliedsstaaten prognos-tiziert, dass sich im Jahr 2050 dasVerhältnis der Menschen über 65Jahren zu Menschen im Alter von 20bis 64 Jahren verdoppelt haben wird.
Die Arbeitslosenquote innerhalbder EU liegt durchschnittlich beirund zehn Prozent. Umlagefinanzier-te Rentensysteme spielen in denmeisten EU-Ländern eine tragendeRolle innerhalb des Rentensystems.Deutschland und die anderen EU-Mitgliedsstaaten stehen also vor den-selben Problemen. Hinzu kommt derbevorstehende Beitritt der mittel-und osteuropäischen Staaten. Inner-halb der EU ist man sich bewusst,dass die gewünschte ökonomischeStärkung der Union durch den Bei-tritt nicht erreicht werden kann, oh-ne dass diese Entwicklungen durchsozialpolitische Maßnahmen ange-messen flankiert werden. Es kann also nicht nur um einen Austauschvon Erfahrungen bei der Suche nachLösungen ähnlich gelagerter Proble-me im Sozialbereich gehen, um dasinternational anerkannte Gut „Sozi-alsicherungssystem“ zu erhalten. Esgeht auch um eine gegenseitige Ab-stimmung als Element einer europäi-
Das deutsche System sozialer Sicherung gilt allgemein als hohes Gut – nicht nur dann, wenn
man es konkret in Anspruch nimmt und trotz der wachsenden Kosten für die einzelnen Leistungen.
Doch was hat die Europäische Gemeinschaft damit zu tun, dass und wie viel Geld beispielsweise
ein deutscher Rentner, eine deutsche Rentnerin jeden Monat aufs Konto bekommen, um den
Lebensunterhalt bestreiten zu können? Um – wirtschaftstheoretisch ausgedrückt – ein weiteres
Gut zur Verfügung zu haben, also ein Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse?
Die von PROF. YVES JORENS geleitete SELBSTSTÄNDIGE NACHWUCHSGRUPPE im
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES SOZIALRECHT
geht der Frage nach, wie die Vorstellungen der EU und anderer
internationaler Organisationen beim Thema Alterssicherung die
Sozialpolitik Deutschlands beeinflussen und welche
Instrumente ihnen dabei zur Verfügung stehen.
Der Autor des folgenden Beitrags, ROLAND KLEIN,
ist Mitarbeiter der
Nachwuchsgruppe.
Eines der derzeit ehrgeizigsten,aber auch umstrittensten Re-
formprojekte der rot-grünen Koali-tion ist die Rentenreform. Die Bun-desregierung plant, eine zusätzlicheForm der Altersversorgung einzu-führen. Bislang war das bundesdeut-sche Rentensystem dadurch gekenn-zeichnet, dass die Altersrenten im sogenannten Umlageverfahren finan-ziert wurden, das im internationalenSprachgebrauch sehr treffend mitdem Begriff „pay-as-you-go-system“bezeichnet wird. Umlageverfahrenbedeutet, dass die Erwerbstätigen mitihren Rentenversicherungsbeiträgengemeinsam mit den Arbeitgebern dasEinkommen der Rentner bereitstel-len. Die Rentenversicherungspflich-tigen erbringen keine Zahlungen aufein persönliches, verzinstes Konto –ihr Geld wird stattdessen sofort andie Empfänger weitergegeben.
Das Umlageverfahren ist aberdurch die demographische Entwick-lung in die Krise geraten. Das hoheGut der sozialen Sicherung scheintzunehmend gefährdet: Die Lebens-erwartung vieler Menschen steigt,während die Geburtenrate und damitdie Zahl der künftigen Rentenzahlerkontinuierlich sinkt. Ebenso ist dieZahl der Menschen, die bereits weitvor dem 65. Lebensjahr in Rente ge-hen, gestiegen; die Arbeitslosigkeitbleibt weiter hoch. Das bedeutet,dass immer mehr Rentenempfängernimmer weniger Rentenzahler ge-genüberstehen. Um das Niveau derLeistungen zu halten, muss die Bei-tragsbelastung für Arbeitnehmer undFO
TO: S
TOCK
MAR
KET

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 45
aus dem Jahr 1971 und 574 aus demJahr 1972 ist ein solches Rege-lungssystem errichtet worden. EG-Verordnungen wirken – ohne Mit-wirkung des deutschen Gesetzgebers– in allen Mitgliedsstaaten, also auchder Bundesrepublik, wie einheimi-sche Gesetze. Auf die in ihnen ver-liehenen Rechte kann sich jeder Bür-ger berufen.
Diese Verordnungen stellen abernur ein „Anhängsel“ zu der wirt-schaftlichen Grundfreiheit, der Ar-beitnehmerfreizügigkeit, dar. Diegrundsätzliche sozialpolitische Kom-petenz verblieb bei den Mitglieds-staaten – es gibt keine „europäische“Sozialversicherung oder Sozialhilfe,sondern nur belgische, französischeoder deutsche Sozialsysteme, diedurch die Verordnung koordiniertwerden. Eine Harmonisierung derSozialsysteme wurde damals alsnicht wünschenswert angesehen. Sozialpolitik auf europäischer Ebenewar also vor allem zu verstehen alsNebenprodukt zu vorrangig wirt-schaftspolitischen Regelungen. Undauch in der Folgezeit wurden dieKompetenzen der EG, auf sozial-rechtlichem Gebiet harmonisierendeNormen zu erlassen, nur sehr vor-sichtig erweitert.
Erst 1992, im Vertrag von Maas-tricht, kam es zu einer Kompeten-zen-Erweiterung, seit 1997 unterEinschluss Großbritanniens. So darfder Rat, das gesetzgebende Organder EG, in dem sich die zuständigenFachminister der Mitgliedsstaatenversammeln, gemäß Artikel 137 IIIdes EG-Vertrags – wenn auch ein-stimmig – Richtlinien zur „sozialenSicherheit und zum sozialen Schutzder Arbeitnehmer“ verabschieden.Bislang ist von Artikel 137 III aberkein Gebrauch gemacht worden. DasEinstimmigkeitserfordernis und derWiderstand der Mitgliedsstaaten ge-gen verbindliche Sozialregeln ausBrüssel ist offenbar noch zu groß.
GÜTER & Gesellschaft
44 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
schen, wenn nicht sogar globalenSozialpolitik.
Diese internationale Dimensionändert aber zunächst nichts daran,dass Sozialrecht eine Angelegenheitder staatlichen Gesetzgebung bleibt.Soziale Sicherungssysteme sindstaatlich und nicht etwa internatio-nal organisiert. Die bundesdeutscheRentenreform wird in Berlin erarbei-tet, nicht in Brüssel oder Genf. Damitist aber noch nichts darüber ausge-sagt, ob und in welchem Maße sichder nationale Gesetzgeber von außenbeeinflussen lässt. Organisationenwie die Internationale Arbeitsorgani-sation (IAO) in Genf, der Europarat,die Organisation für Entwicklungund Zusammenarbeit in Europa(OECD) oder die Weltbank befassensich mit sozialpolitischen Fragen: DieIAO hat zum Beispiel wegweisendeÜbereinkommen zu Mindeststan-dards der sozialen Sicherheit erlas-sen, die für die Mitgliedsländer nachentsprechender Ratifikation verbind-lich sind und deren Einhaltung voneinem Sachverständigenausschussüberwacht wird. Die Weltbank hat inihrem im Jahr 1994 erschienenen Bericht „Averting the old-age crisis“einen Wechsel von der umlagefinan-zierten Rente zur privat finanzierten,kapitalgedeckten Rente empfohlen;öffentliche Rentensysteme, seien siesteuer- oder umlagefinanziert, solltennur eine Mindestsicherung bieten.
Und die EU leistet für die Transfor-mationsstaaten Ost- und Mitteleuro-pas gerade auch im Bereich der Reform von Systemen der sozialenSicherheit Hilfe durch Beratung, umsie so an den „acquis communau-taire“, den rechtlichen Besitzstand innerhalb der Gemeinschaft, heran-zuführen und für einen zukünftigenBeitritt vorzubereiten.
EU ALS SUPRANATIONALE
ORGANISATION
Die Europäische Union spielt abereine Sonderrolle, denn sie stellt einesupranationale Organisation dar undunterscheidet sich so von den ande-ren internationalen Organisationen.Supranational bedeutet in diesemZusammenhang, dass die Gemein-schaft eine eigene Rechtsordnung füralle Mitglieder darstellt, die Vorrangvor den einzelstaatlichen Rechtsord-nungen genießt: Rechtsakte der Ge-meinschaft und Urteile des Europäi-schen Gerichtshofs wirken unmittel-bar in den Mitgliedsstaaten.
Im Rahmen einer Tagung über denEinfluss von IAO, OECD, Weltbank,Europarat und EU auf nationales So-zialrecht beim Thema Alterssiche-rung, zu der Nachwuchsgruppenlei-ter Prof. Yves Jorens kürzlich einge-laden hatte, wurde deutlich, wie sehrangesichts der Rentenprobleme inallen EU-Mitgliedsländern und desbevorstehenden Beitritts der Mittel-
und Osteuropäer die sozialpoliti-schen Aktivitäten der EU in den ver-gangenen eineinhalb Jahren an Dy-namik gewonnen haben. Um dies zuverdeutlichen, ist ein Rekurs auf dieEntwicklung der Sozialpolitik inner-halb der EU notwendig.
NORMEN ANFANGS
DÜNN GESÄT
Die Europäische Gemeinschaft be-ruht auf dem Prinzip der Einzeler-mächtigung, das bedeutet: Sie kannnur dort tätig werden, insbesondereNormen erlassen, wo sie die dazu er-forderliche Kompetenz besitzt. DieseNormen waren im sozialpolitischenBereich anfangs sehr dünn gesät. DieEuropäische Gemeinschaft ist bei ihrer Gründung 1957 ursprünglich eine Wirtschaftsgemeinschaft gewe-sen. Die Idee war, die Integration derStaaten Europas zuerst wirtschaftlichvoranzutreiben, bevor an weitere politische Schritte gedacht wurde.Dementsprechend spielten sozialeund sozialpolitische Fragen zunächstnur eine sehr untergeordnete Rolle;es fanden sich ursprünglich nur zweisozialrechtlich relevante Vorschriftenim EG-Vertrag.
Einmal Artikel 119 (141 neue Fas-sung), der Gleichbehandlung vonMännern und Frauen beim Arbeit-sentgelt vorschreibt. Zum ZweitenArtikel 51 (42 neue Fassung), der derGemeinschaft auferlegt, Rechtsregelnzu erlassen, die dafür sorgen, dassArbeitnehmern keine sozialrechtli-chen Nachteile entstehen, wenn siedie vom EG-Vertrag vorgesehene Ar-beitnehmer-Freizügigkeit in An-spruch nehmen (das ist das Recht, injedem Mitgliedstaat einer Berufs-tätigkeit nachgehen zu dürfen).
Solche Nachteile können beispiels-weise durch Ausfall von Versiche-rungszeiten in der heimischen Ren-tenversicherung während einer Tä-tigkeit im EU-Ausland entstehen.Durch die EG-Verordnungen 1408
SCHWERpunkt
Welchen Einfluss haben Weltbank, die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa (OECD), die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) sowie die Europäische Union mit ihren Organen auf das Sozialrecht der EU-Mitgliedsstaaten, also auch auf Deutschland? An dieser Fragestellung arbeitet die Selbständige Nachwuchsgruppe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Sozialrecht (v.l.n.r.): Marc Schenk, Roland Klein, Yves Jorens, Marcus Göbel und Kim Heimerer.
Mitgliedsstaaten formulieren gemeinsameZiele im Bereich der Rentenpolitik
Prüfung der Zieleinhaltung durch die Gemeinschaftmittels Sozialindikatoren (Benchmarking)
Europäische Gemeinschaft (Rat) sprichtggf. Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten aus
Erstellung eines Jahresberichts über die Erreichungder gemeinsamen Ziele
EG-Mitgliedsstaaten
Ratder Arbeits- und Sozialminister
Entscheidungsgremium im Rahmender Kompetenzen des EG-Vertrags
SozialschutzausschussHochrangige Beamte der Arbeits- undSozialministerien der Mitgliedsstaaten
und ein Vertreter der KommissionZusammenarbeit auf der Ebene
der Ministerialbürokratie im Rahmender übertragenen Aufgaben
KommissionUnabhängiges Organ der EG
ExekutivvorgangInitiativrecht
Kontrollfunktion
EG-VertragSieht nur geringe Kompetenzen für die Europäische Gemeinschaft
im Bereich der sozialen Sicherheit vor
Altersquotient für das Jahr 2000 undfür den Höchststand im Jahr 2040 bzw. 2050
0
10
20
30
40
50
60
70
80
B 20
40
DK
2040
D 2
040
EL 2
050
E 20
50
F 20
50
IRL
2050
I 205
0
L 20
40
NL
2040
A 20
50
P 20
50
SF 2
050
S 20
40
UK
2040
EU g
es. 2
040
F OTO
S : P
RIVA
T (1)
/ ST
OCK
MAR
KET(
1) /
GRA
FIKE
N: R
OH
RER
Das Institutionengefüge inner-halb der EU: Der neu geschaffe-ne Sozialschutzausschuss (ESSA) wird zentrale Koordinierungs-stelle im Hinblick auf nationaleAktionspläne sein, die der Ent-wicklung des Sozialschutzes in Langzeitperspektive dienen.
Die Grafik zeigt die Altersquotienten in den EU-Ländern, definiert als das Verhältnis zwischen dem mindestens 65-jährigen Bevölkerungsanteil und der Bevölkerung imErwerbsalter (20 bis 65 Jahre). Danach wird sich die Zahl der Rentner bis zum Jahr 2050etwa verdoppeln – immer weniger Erwerbstätige müssen immer mehr Renten finanzieren.
DER ALTERSQUOTIENT WIRD SICH BIS 2050 VERDOPPELN
DIE METHODE DER „OFFENEN KOORDINIERUNG“
Ob die Methode der „offenen Koordinierung“ die Zurückhaltung der EU-Mit-gliedsstaaten abbauen kann, wenn es darum geht, der Europäischen Union „harte“ Kompetenzen auf sozialrechtlichem Gebiet zu übertragen, bleibt fraglich.

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 47
ren“ hinarbeiten. Anhand eines ge-meinsamen Jahresberichts des Ratesund der Kommission prüft der Eu-ropäische Rat jährlich die Beschäfti-gungslage in der Gemeinschaft undnimmt hierzu Schlussfolgerungenan. Mithilfe dieser Schlussfolgerun-gen legt der Rat auf Vorschlag derKommission Leitlinien fest, die dieMitgliedsstaaten in ihrer Beschäfti-gungspolitik berücksichtigen.
Jeder Mitgliedsstaat übermitteltdem Rat und der Kommission jähr-lich eine Aufstellung über die wich-tigsten Maßnahmen, die er zur prak-tischen Umsetzung der gemeinsamenBeschäftigungspolitik im Einzelnengetroffen hat. Danach unterzieht derRat die Beschäftigungspolitik imLicht der Leitlinien einer jährlichenPrüfung. Er kann dabei auf Empfeh-lung der Kommission mit qualifizier-ter Mehrheit Empfehlungen an dieMitgliedsstaaten richten. Die Ähn-lichkeit dieser koordinierten Be-schäftigungsstrategie mit dem Vor-gehen nach der Konvergenz-Emp-fehlung ist offenkundig. Allerdingsist das Verfahren für die Beschäfti-gungspolitik detaillierter ausgestaltetund mit der Möglichkeit versehenworden, Empfehlungen an die Mit-gliedsstaaten zu richten.
Die koordinierte Beschäftigungs-strategie wiederum ist Vorbild für ei-nen neuen Ansatz in der europäi-schen Sozialpolitik: In einer Mittei-lung der Kommission von Juli 1999zur konzertierten Strategie der Mo-dernisierung der sozialen Sicherheitwurden vier sozialpolitische Kern-ziele formuliert.
Sie beinhalten: Erstens, dass Ar-beit sich lohnen muss und das Ein-kommen gesichert ist; dass zweitensRenten sicher und die Rentensystemelangfristig finanzierbar sind; dassdrittens die soziale Eingliederung zufördern und viertens eine hohenQualitätsansprüchen genügende undlangfristig finanzierbare Gesund-
heitsversorgung zu sichern ist. Darü-ber hinaus wurde die Einberufung einer Arbeitsgruppe hochrangigerBeamter aus den Mitgliedsstaatenunter Vorsitz der Kommission ange-regt, die die erreichten Fortschritteauf sozialpolitischem Gebiet analy-sieren und bewerten soll.
Der Europäische Rat griff diesenVorschlag auf der Konferenz vonLissabon im März 2001 auf und gabeine Studie über die Entwicklung desSozialschutzes in Langzeitperspek-tive in Auftrag, die dem Europäi-schen Rat in Göteborg vorgelegtwerden soll. Diese Studie soll derAusgangspunkt für eine strategischeKooperation, die so genannte „offeneKoordination“ sein.
AKTIONSPLÄNE ALS
KONTROLLINSTRUMENT
Auf der Grundlage gemeinsamentwickelter Kriterien und Zielvorga-ben (benchmarks) sollen nationaleAktionspläne über das Erreichen die-ser Ziele in den Mitgliedsstaaten er-stellt werden, die wiederum Gegen-stand einer institutionalisierten Be-wertung durch die EU mit der Mög-lichkeit der Abgabe von Empfehlun-gen sein soll. Erarbeitet wird die Stu-die vom neu installierten Europäi-schen Sozialschutzausschuss (ESSA).Er wird nach Ratifizierung der Ver-träge von Nizza auch eine Rechts-grundlage im EG-Vertrag und direk-ten Zugang zum Rat haben, was denEinfluss des Ausschusses im Institu-tionengefüge der EU deutlich er-höhen wird.
Die neue Initiative wurde von denVertretern der Einzelstaaten auf derTagung begrüßt, denn die Mitwir-kung der Mitgliedsstaaten werdedurch den neu geschaffenen Sozial-schutzausschuss verbessert. Bislangseien die Ministerien bei der Erarbei-tung nationaler Reformvorhaben imSozialrecht im Vergleich zu anderenRechtsgebieten von Brüssel wenig
beeinflusst. Die neue Vorgehenswei-se auf europäischer Ebene sei abervon Vorteil, da sie eine nötige politi-sche Abstimmung der Staaten unter-einander forciere und damit auch diepolitische Bindung der zuständigenMinister in der Öffentlichkeit. DieseBindung erzeuge auf die Ministerial-bürokratie einen entsprechendenUmsetzungsdruck. So könne eine zu-künftige politische Abstimmung aufeuropäischer Ebene effektiv in deneinzelnen Staaten realisiert werden.
Trotzdem: Auch von den Vertre-tern der Europäischen Union wurdeder Eindruck bestätigt, dass die Mit-gliedsstaaten immer noch sehrzurückhaltend sind, wenn es darumgeht, der Gemeinschaft „harte“ Kom-petenzen auf sozialrechtlichem Ge-biet zu übertragen beziehungsweiseder Ausübung solcher Kompetenzenzuzustimmen. Hier liegt der Zwie-spalt zwischen nationaler Souverä-nität und der Notwendigkeit zur Zu-sammenarbeit innerhalb der Ge-meinschaft.
Was angesichts der internationalenProblematik bleibt, ist eine Politikder Abstimmung, der unverbindli-chen Empfehlungen. Hier allerdingsist seit jüngster Zeit eine neue Dy-namik entstanden: Die Aktivitäten,die auf die Mitteilung der Kommis-sion im Jahr 1999 folgten, sind weit-aus umfangreicher als alles, was auf die Charta der Grundrechte oder die Konvergenz-Empfehlung folgte,auch wenn mit der offenen Koordi-nierung keine grundsätzlich neueMethode erfunden worden ist.
Mit der Einrichtung von ESSA undder neuen Möglichkeit, Empfehlun-gen auszusprechen, wird der politi-sche Druck zur Kooperation erhöht.Es verstärkt sich der Eindruck, dassdie einzelnen Mitgliedsstaaten denAbstimmungsbedarf im Zeitalter derGlobalisierung immer stärker spürenund daher eher als bisher zur Zu-sammenarbeit bereit sind. ROLAND KLEIN
GÜTER & Gesellschaft
46 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Damit verlagerte sich die sozialpo-litische Aktivität der Gemeinschaftauf das der freiwilligen Abstimmungund Zusammenarbeit: Im Jahr 1989verabschiedeten elf Mitgliedsländerdie von der EG-Kommission ausge-arbeitete „Charta sozialer Grund-rechte der Arbeitnehmer“, die recht-lich allerdings unverbindlich blieb.Im Vorfeld jedoch wurde zum erstenMal die Grundlage einer „Konver-genzstrategie“ debattiert: Nach Auf-fassung von Experten sollten ge-meinschaftliche soziale Standardsunter Vereinbarung einer „gemeinsa-men Richtung“ von den Mitglieds-staaten auf weitgehend freiwilligerBasis verwirklicht werden. Korres-pondierend sollten Instrumente zumVergleich der Sozialstandards einge-führt werden. Daraus folgte 1992dann die – allerdings ebenfallsrechtlich unverbindliche – Empfeh-lung des Rates zur Konvergenz übersoziale Sicherheit. In ihr spiegelnsich die Überlegungen zur „gemein-samen Richtung“ wider. Die Empfeh-lung erfasst alle Bereiche der sozia-len Sicherungssysteme.
In Bezug auf Altersversorgungs-systeme wird den Mitgliedsstaatenempfohlen, „Mechanismen einzu-führen, durch die Arbeitnehmern miteinem vollständigen Versicherungs-verlauf ein vertretbares Niveau anErsatzleistungen gewährt wird, wo-
bei gesetzliche und zusätzliche Sys-teme zu berücksichtigen sind“. Wei-ter wird empfohlen, dass die Alters-versorgungssysteme an die demogra-phische Entwicklung angepasst wer-den sollen. In der Empfehlung wurdedie Kommission immerhin verpflich-tet, dem Rat Bericht zu erstatten überden Fortschritt der Mitgliedsstaatenin Bezug auf die angegebenen Leit-linien. Ferner sollten mit den Mit-gliedsstaaten konkrete Indikatorenfür diesen Zweck entwickelt werden.
WIDERSTAND
GEGEN KONVERGENZ
Die Konvergenzempfehlung von1992 war als Antwort der Gemein-schaft auf Kritik zu verstehen, dasssie die soziale Dimension der eu-ropäischen Integration vernachlässi-ge. Sie erzeugte allerdings kaumWirkung – zu allgemein formuliertwaren die gemeinsamen Leitlinien,zu groß das Misstrauen und der Wi-derstand bei den Mitgliedsstaaten.Der Begriff der „Konvergenz“ wurdevielfach als drohender Eingriff in na-tionale Kompetenzen gesehen, insbe-sondere im Hinblick auf den parallelgebrauchten Begriff der Konvergenz-kriterien bezüglich der Währungs-union. Es wurden von der Kommis-sion nur reine Länderberichte überdie nationalen Sozialsysteme erstellt;nähere Kriterien, wie von der Emp-
fehlung verlangt, arbeitete die Kom-mission nie aus. Mit dem Vertragvon Amsterdam, der am 1. Mai 1999in Kraft trat, wurde die soziale Di-mension in der Gemeinschaft erheb-lich verstärkt. In Artikel 136 des EG-Vertrags wird nun als Ziel europäi-scher Sozialpolitik die „Förderungder Beschäftigung, ein angemessenersozialer Schutz, der soziale Dialogund die Bekämpfung von Ausgren-zungen“ benannt.
Um diese Ziele zu verwirklichen,unterstützt und ergänzt die Gemein-schaft die Tätigkeiten der Mitglieds-staaten auf diesem Gebiet (Artikel137). Das bedeutet, dass die Mit-gliedsstaaten weiterhin primär fürden Bereich des sozialen Schutzeszuständig bleiben. Die Gemeinschaftkann aber insbesondere Anregungenund Impulse bei der Anpassung derSozialsysteme an veränderte Rah-menbedingungen geben.
Im Vertrag von Amsterdam wurdezudem ein neuer Titel zur Beschäfti-gungspolitik in den Vertrag einge-führt, mit dem die Mitgliedsstaatenund die Gemeinschaft auf die Ent-wicklung einer koordinierten Be-schäftigungsstrategie in den Berei-chen „Förderung der Qualifizierung,Ausbildung und Anpassungsfähig-keit der Arbeitnehmer sowie derFähigkeit der Arbeitsmärkte, auf dieErfordernisse des Wandels zu reagie-
SCHWERpunkt
FOTO
: STO
CKM
ARKE
T

48 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
FASZINATION Forschung StrukturBIOLOGIE
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 49
Molekularer Kraftakt bringt Muskeln
in BewegungDas Rätsel der Körperbewegung beschäftigt die Menschheit seit mehr als zweitausend Jahren.
PROF. KENNETH HOLMES, Direktor am MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE
FORSCHUNG in Heidelberg, befasst sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Prozess der Muskel-
kontraktion, der jeder Bewegung zugrunde liegt. Seine Experimente haben dazu geführt,
dass Synchrotronstrahlung als Röntgenstrahlquelle in der Strukturbiologie eine Nutzung fand.
Damit boten sich der Forschung in diesem Bereich völlig neue Entwicklungsmöglichkeiten.
In diesem Jahr hat der Achter ausCambridge das 147. Universitäts-
Bootsrennen gegen die Kommilito-nen aus Oxford für sich entschiedenund sich damit gleichzeitig für dieNiederlage im vergangenen Jahr re-vanchiert. Für die Light-Blues war esder 77. Erfolg im seit 1829 ausgetra-genen Ruderklassiker auf der Them-se. Den Dark-Blues aus Oxford ge-lang es nicht, ihren Überraschungs-sieg aus dem Vorjahr (nach siebenNiederlagen in Folge) zu wiederho-len. 19:59 Minuten brauchte derCambridge-Achter für die 6,7 Kilo-meter lange Strecke zwischen PutneyBridge und Chiswick Bridge – imwahrsten Sinne des Wortes ein Kraft-akt für alle, die im Boot saßen.
Ausgangspunkt für diese erstaun-liche sportliche Leistung sind dieMuskeln in unserem Körper, die aufeffiziente Weise (ihr Wirkungsgradliegt zwischen 40 und 50 Prozent)chemische Energie in mechanische
Arbeit umzuwandeln vermögen.Prof. Kenneth Holmes, Direktor amMax-Planck-Institut für medizini-sche Forschung in Heidelberg, wid-met sich bereits seit den sechzigerJahren der Erforschung von Mus-kelkontraktionen – und das nichtnur, weil er ein begeisterter Rudererist und seine wissenschaftliche Lauf-bahn im englischen Cambridge be-gann.
Im Jahr 1961 begegnete er im neugegründeten Medical ResearchCouncil Laboratorium für Moleku-lare Biologie der Universität Cam-bridge dem Physiologen Hugh E.Huxley – einem der Väter der so ge-nannten Gleitfilamenttheorie. Hol-mes arbeitete dort seinerzeit an derAufklärung der Struktur des Tabak-mosaikvirus, zeigte aber auch großesInteresse für die molekularen Struk-turen von Muskelfasern. Ihm warklar: Um das Phänomen der Muskel-kontraktion zu verstehen, bedarf es
einer detaillierten Kenntnis des Auf-baus der im Muskel vorhandenen Ei-weißmoleküle.
Im 19. Jahrhundert – zu diesemZeitpunkt wurde auf der Themse be-reits um die Wette gerudert – hatteman sehr gründliche mikroskopischeUntersuchungen zur Struktur desMuskels durchgeführt, besonders inBezug auf seine Streifenmuster. Sofanden die Forscher heraus, dass diequergestreifte Muskulatur abwech-selnd aus optisch dichten und weni-ger dichten Bereichen aufgebaut ist.Die dichten Bereiche bezeichnet manals A-Streifen (anisotrop). Sie sinddoppelbrechend und weisen einenhohen Brechungsindex auf. Die we-niger dichten sind die nicht-doppelbrechenden I-Streifen (iso-trop). Die A-Streifen sind durch einezentrale Aufhellung (H-Zone) ge-kennzeichnet, durch deren Mitte eine dünne Linie, die Mittelscheibe,läuft. Die I-Streifen sind hingegenFO
TO: S
TOCK
MAR
KET

50 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
StrukturBIOLOGIE
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 51
durch die Zwischenscheibe Z unter-teilt, die einen hohen Brechungsin-dex aufweist. Grundeinheit des Mus-kels ist das zwischen zwei Z-Schei-ben eingeschlossene Sarkomer. Dermenschliche Bizeps beispielsweiseenthält mindestens zehn MillionenSarkomere.
In den folgenden Jahrzehnten ge-riet dieses hoch spezialisierte Wissenüber Muskelgewebe nahezu in Ver-gessenheit. Erst in den dreißiger undvierziger Jahren des 20. Jahr-hunderts bekam das Forschungsge-biet wieder einen Schub, vor allemdurch neue biochemische Erkennt-nisse. So wurde festgestellt, dassAdenosintriphosphat (ATP) und nicht– wie lange Zeit angenommen –Phosphokreatin die hauptsächlicheEnergiequelle für die Muskelkontrak-tion ist. Diesen universellen Energie-speicher der Zelle hatte zuvor KarlLohmann entdeckt. Er war Assistentbei Otto Meyerhof, der einer der be-deutendsten Biochemiker seiner Zeit
und gleichzeitig Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biologie gewe-sen ist. Aus dem KWI ist 1948 dasMax-Planck-Institut für medizini-sche Forschung hervorgegangen,heutige Wirkungsstätte von Holmes.
Anfang der fünfziger Jahre brach-te das Phänomen der Streifenumkehrdie Muskelforscher auf die Spur der„gleitenden Filamente“. Während derMuskelkontraktion wird nämlich derbisher am wenigsten dichte Teil (alsoder Bereich mit dem niedrigsten Bre-chungsindex und der niedrigstenProteinkonzentration) am dichtesten.Der spätere Nobelpreisträger AndrewF. Huxley sowie Rolf Niedergerkeuntersuchten das Phänomen anisolierten, lebenden Froschmuskel-fasern unter dem Interferenz-mikroskop. Zur selben Zeit analy-sierten Hugh E. Huxley und JeanHanson Querschnitte von Muskelge-webe im Elektronenmikroskop. Dievier Forscher kamen zu demselbenErgebnis, welches 1954 in NATURE als
Gleitfilamenttheorie publiziert wur-de: Danach verkürzt sich ein Muskeldurch das Übereinandergleiten vonAktin- und Myosinfilamenten, wobeisich die dünneren Aktinfilamenteüber die dickeren Myosinfilamenteschieben; die einzelnen Filamentebleiben dabei aber in ihrer Längeunverändert (siehe Abb. 2).
EIN BRÜCKENSCHLAG, DER WIRKUNG ZEIGT
Drei Jahre später konnte Hugh E.Huxley anhand elektronenmikros-kopischer Aufnahmen zeigen, dassdie beiden Arten von Filamentendurch kleine „Querbrücken“ mit-einander verbunden sind; es handeltsich dabei um die gestaffelt angeord-neten Myosinmoleküle, aus denendie Myosinfilamente bestehen. DieForscher mutmaßten, dass es sich beidiesen Myosin-Aktin-Verbindungenum jene Stellen handelt, an denendie Muskelkraft entsteht. Und tat-sächlich konnte bald nach ihrer Ent-
Abb. 1: Kraftschlag einerMyosin-Querbrücke (verein-facht). Der Anfangszustandist hellblau, der Endzustanddunkelblau dargestellt. DieBewegung des Hebelarmen-des während des Kraftschlags beträgt 10nm. Rechts dasModell eines Aktinfilamentsbestehend aus fünf Aktin-Bausteinen (grau und blau).
FASZINATION Forschung
MyosinköpfchenMyosinfilamentAktinfilament
Z-Linie
deckung gezeigt werden, dass dieQuerbrücken für die ATPase-Akti-vität des Myosins verantwortlichsind. In Abwesenheit von ATP heftensie sich fest an die Aktinfilamente.Durch Zugabe von ATP kann diesestarke Bindung wieder gelöst wer-den. Myosin alleine ist dabei einschlechtes, eine Mischung aus Aktinund Myosin dagegen ein sehr wirk-sames Enzym für die Umsetzung desphysiologischen Substrats Magne-sium-ATP. Diese etwas eigenartigenenzymatischen Eigenschaften vonMyosin und Aktomyosin lassen sichjedoch sehr gut in Einklang bringenmit den Vorstellungen, die die For-scher über die Umsetzung der Ener-gie der ATP-Hydrolyse in mechani-sche Arbeit entwickelt haben.
Besonders hilfreich waren dabeiauch die von Kenneth Holmes undseinen Kollegen 1965 gemachtenRöntgenbeugungsbilder vom Insek-tenflugmuskel. Im Unterschied zuzahlreichen anderen Methoden er-laubt die Röntgenbeugung eine Be-obachtung der molekularen Struktu-ren am sich kontrahierenden Muskel.So konnten die Forscher zeigen, dasssich nach Zugabe von ATP der Nei-gungswinkel der Querbrücken (dassind die Myosinköpfchen) zur Fila-
mentachse deutlich verändert: InAbwesenheit von ATP beträgt derNeigungswinkel 45 Grad, nach Zu-gabe von ATP erhöht er sich auf 90Grad. Diese zyklische Orientie-rungsänderung – so die Arbeits-hypothese der Wissenschaftler – er-zeugt die notwendige Verschie-bungskraft, die aufgrund ihrer ru-derähnlichen Bewegung auch als„Kraftschlag“ bezeichnet wird.
MUSKELN
IM RÖNTGENLICHT
Mit den konventionellen Röntgen-strahlquellen bedurfte es allerdingsmehrerer Stunden Beobachtungszeit,um ausreichend interpretierbare Da-ten zu erhalten. Der Vorgang derMuskelkontraktion selbst dauert abernur wenige Millisekunden. Die Er-gebnisse lagen also um den FaktorTausend bis Zehntausend vom eigentlichen Ziel entfernt. Auf derSuche nach einer geeigneten Alter-native stieß Holmes auf die Synchro-tronstrahlung. Sie besitzt drei Eigen-schaften, die sie vor allem für dieRöntgenkristallographie wertvollmacht: Sie hat eine hohe Intensitätund weist eine laserähnliche Bünde-lung sowie ein relativ breites Wel-lenspektrum auf.
DIE „MACHINA CARNIS“
Seit mehr als zweitausend Jahren werden Forschervon einer tief sitzenden Neugierde dazu getrieben,den Mechanismus der Bewegung zu ergründen. Bereits im dritten Jahrhundert v. Chr. entwickelteeine Physiologieschule in Alexandria eine Theorieder Muskelkontraktion. Einige hundert Jahre spä-ter stellte der in Rom lebende griechische Arzt Galenus fest, dass alle Muskeln - unabhängig vonihrer Funktion im Organismus - nach demselbenPrinzip arbeiten: Während sich eine Muskelfaserdurch Kontraktion verkürzt, dehnt sich ihr Gegen-spieler entsprechend in die Länge. Was aber dieVerkürzung konkret bewirkt und wie sie im Detailabläuft, das blieb bis in das 20. Jahrhundert unge-klärt. Das erste Modell einer Muskelkontraktionstammt von Vesalius aus der Schule von Padua.Nach seinen um 1550 entwickelten Vorstellungenist der Muskel eine „machina carnis“ – also eineMaschine aus Fleisch – die erst durch einen gött-lichen Lebensatem, den „spiritus vitalis“, in Bewe-gung gesetzt wird. Einen wirklich erhellenden Einblick in die Vorgängeder Muskelarbeit lieferte um 1860 der Physikerund Physiologe Hermann von Helmholtz. Als einerder Ersten hat er den Nachweis erbracht, dassMuskeln „Maschinen“ sind, die chemische Energiein mechanische Arbeit umwandeln. Um dieselbeZeit machte der Physiologe Willi Kuehne in Leipzigeine nicht minder wichtige Entdeckung: Er be-schrieb das „Muskeleiweiß“ Myosin.Bis sich Vesalius’ „spiritus vitalis“ endgültig er-übrigt hatte, vergingen jedoch noch weitere knapphundert Jahre. 1938 identifizierten zuerst Lubi-mova und Engelhadt in Moskau das Myosin als eine ATPase, also ein ATP spaltendes Enzym. 1943 schließlich stellten die beiden ungarischenWissenschaftler Albert Szent-Györgyi und seinSchüler F. Bruno Straub fest, dass es sich beim Kuehneschen Myosin nicht um einen Eiweißstoffhandelt, sondern um ein Gemisch aus zwei Pro-teinen – dem Aktin und dem Myosin.Heute wissen die Forscher, dass ein Gramm Ske-lettmuskulatur jeweils etwa 100 Milligramm derkontraktilen Eiweißstoffe enthält, wobei auf dasAktin etwa 30 Prozent und auf das Myosin 70 Prozent dieser Masse entfallen. MARCELLA ULLMANN
Abb. 2: Gleitfilament-theorie. Das zwischenzwei Z-Scheiben lie-gende Sarkomer um-fasst dünnere Aktin-filamente und dickereMyosinfilamente.Durch die zyklischeWechselwirkung derMyosin-Querbrückenmit den Aktinfilamen-ten gleiten die beidenFilamentarten überein-ander, sodass sich dasSarkomer verkürzt.
FOTO
: MPI
FÜ
RM
EDIZ
INIS
CHE
FORS
CHU
NG
/ GRA
FIK:
RO
HRE
R

52 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
dass sich beim Kraftschlag ganz offensichtlich nicht die gesamteQuerbrückenlänge bewegt, sondernnur der Teil, der vom Aktin wegzeigt.Der größte Teil der Querbrückenmas-se scheint sich an das Aktin anzu-heften und keine größeren Bewegun-gen auszuführen. Es folgten zwanzigJahre ohne größeren Fortschritt. Umdie Funktionsweise von Proteinen imDetail zu verstehen und Hypothesenüber ihren Reaktionsmechanismusaufzustellen oder zu über-prüfen, ist es nötig, siemolekularbiologisch ma-nipulieren zu können undihre dreidimensionaleStruktur auf atomarerEbene zu kennen.
Anfang der neunzigerJahre gelang es der Ar-beitsgruppe von KennethHolmes, die atomarenStrukturen von G-Aktinund F-Aktin zu lösen. F-Aktin ist die Hauptkom-ponente der dünnen Fila-mente und aus einzelnenG-Aktin-Bausteinen zu-sammengesetzt. Die re-sultierende Helix gleichtzwei Ketten von Aktin-Molekülen, die sich um-einander winden (siehe Abb. 3). EinAktin-Molekül wiederum besteht aus375 Aminosäuren mit insgesamt et-wa 3000 Atomen. Der Weg hin zu ei-ner dreidimensionalen Ansicht diesesMoleküls war kein leichtes Unterfan-gen; denn die bislang einzige Me-thode, die atomare Struktur großerMoleküle zu bestimmen, ist dieRöntgenstrukturanalyse. Sie setztvoraus, dass sich gut geordnete Kris-talle herstellen lassen. Die Einzel-bausteine von Aktin aggregieren je-doch spontan zu dünnen Filamenten,die sich nicht kristallisieren lassen.Mit dem Enzym Desoxyribonuklease Ibildet Aktin allerdings einen sehr stabilen 1:1-Komplex, der sich kris-tallisieren lässt. Die Strukturanalysedieser Kristalle stellte sich gleichwohlals schwierig heraus. Erst Neuent-wicklungen sowohl in der Erfassungund Auswertung der Röntgenbeu-gungsdaten als auch in der Methode
der Strukturanalyse selbst, die durchHolmes Mitarbeiter Wolfgang Kabsch entscheidend vorangetriebenworden sind, ermöglichten eine drei-dimensionale hoch aufgelöste Abbil-dung. Danach ist Aktin ein flachesMolekül, das in zwei Haupt- bezie-hungsweise insgesamt vier Sub-domänen unterteilt werden kann.Subdomäne 1 beinhaltet die Haupt-bindungsstellen für die Myosin-Querbrücke. Deren Struktur wurde
1993 von der Arbeits-gruppe von Ivan Ray-ment, Madison (USA),aufgeklärt.
Das atomare Modell desMyosin-Moleküls hat in-teressante neue Hinweisegeliefert. So gehen dieWissenschaftler heute da-von aus, dass sich nichtder ganze Kopf des Myo-sin-Moleküls dreht. Er istvielmehr in der Mitte miteinem Scharnier verse-hen, so dass nur ein Teildes Kopfes als Hebelwirkt. Röntgenkristallo-graphische Untersuchun-gen des Myosinkopfeshaben gezeigt, dass derHebelarm in zwei Konfor-
mationen vorkommt (sie sind in Abb.1 auf Seite 50 hell- beziehungsweisedunkelblau dargestellt). Dies sind dieEndstufen der vermuteten Hebelarm-bewegung. Jetzt bleibt es den Phy-siologen überlassen, den genauenAblauf der Hebelarmbewegung zuuntersuchen – mit den Methoden derklassischen molekularen Physiologie.Die bisherigen Ergebnisse stützendas von Kenneth Holmes 1997aufgestellte molekulare Modell desQuerbrückenzyklus, die „swinginglever arm hypothesis“, recht gut.
Übrigens: Während der EngländerKenneth Holmes in Heidelberg den„molekularen Kraftschlag“ erforschtund dafür im vergangenen Jahr denmit 65.000 Euro dotierten Europäi-schen Latsis-Preis erhielt, war es derDeutsche Tim Wooge, der in diesemJahr als Schlagmann den Cam-bridge-Achter zum Sieg führte.
CHRISTINA BECK
FASZINATION Forschung
Kenneth Holmes (geb.1934) erhielt 1997 dieGabor Medal der RoyalSociety of London, denEuropäischen Latsis-Preis 2000 sowie imMärz den von der Königlich SchwedischenAkademie der Wissen-schaften verliehenenAminoff-Preis.
Abb. 3: In ein dreidimensionales Gittermodell (orange) des mit Myosin-S1 (Teil des Myosinköpfchens) dekoriertenF-Aktins können die atomaren Modelle der Einzelmoleküleeingepasst werden (vier in Blau, eines in Gelb). Dadurch wird das Zusammenspiel des Aktins und des Myosins aufatomarer Ebene beschrieben.
Als der Wissenschaftler 1968 – ge-rade 34-jährig – zum Direktor derneu gegründeten Abteilung Biophy-sik am Max-Planck-Institut für me-dizinische Forschung berufen wurde,konnte er seine Idee von der Syn-chrotronstrahlung als Quelle fürRöntgenstreuexperimente am DESYin Hamburg auf den Prüfstein stel-len. Bereits die ersten Versuche, dieHolmes 1970 zusammen mit GerdRosenbaum unternahm, liefertenaussichtsreiche Ergebnisse. Die Rönt-genstrukturanalyse eines Insekten-muskels, die die beiden Wissen-schaftler mit dieser Methode 1971vollendeten, war ein echter Durch-bruch. „Die Bedeutung, welche dieSynchrotronstrahlung heute für diemolekulare Strukturbiologie hat,geht weit über unsere damaligen Er-wartungen hinaus“, sagt Holmes.
AKTIN IN
DREI DIMENSIONEN
Obwohl die „swinging cross bridgehypothesis“ seit 1972 in allen Lehr-büchern zitiert wurde, blieb esschwierig, die Querbrücke in flagran-ti delicto abzubilden. In den folgen-den Jahren wurde allerdings klar,
FOTO
S: M
PI F
ÜR
MED
IZIN
ISCH
EFO
RSCH
UN
G(1
) / A
RCH
IV(1
)

54 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
FASZINATION Forschung
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 55
hohen Datenraten, also hoher Band-breite, ausgerüstet.
Der VLBI-Messprozess erfolgt indrei zeitlich getrennten Stufen: JedeVLBI-Station empfängt vollständigunabhängig von den anderen Beob-achtern die kosmischen Radiosignaleund speichert sie mit hoher Daten-rate. Höchststabile Atomuhren (Was-serstoffmaser) an jeder Antenne sor-gen für verzerrungsfreien Empfang(eine extreme Form von „HiFi“) undpräzise Zeitmarkierung der in digi-taler Form auf Magnetband aufge-zeichneten Daten.
Nach Abschluss der meist mehr-stündigen Messungen werden die
Bei der neuen Maschine – einemso genannten Korrelator –
handelt es sich um einen „festver-drahteten“ Digitalrechner. Er ist4000mal leistungsfähiger als seinVorgänger und erreicht im Endaus-bau eine Rechenleistung von 25 Tau-send Milliarden Instruktionen proSekunde.
Radioastronomen und Geophysikerwerten mit dem Bonner „Mark IV-Korrelator“ digitale Daten aus, die imRahmen der Radiointerferometriemit großen Basislängen (englisch:Very Long Baseline Interferometry,VLBI) gesammelt werden. Bei diesemVerfahren beobachten zahlreiche,
über die gesamte Erde verteilte Ra-dioteleskope gleichzeitig ein astro-nomisches Objekt. An solchen Ge-meinschaftsaktionen sind typischer-weise acht bis 20 einzelne Anten-nen beteiligt, die zwischen 100 und10.000 Kilometer weit voneinanderentfernt sein können.
Wegen dieser großen Abständelassen sich Antennen und Korrelatorwährend der Messungen nicht „ko-härent“ (breitbandig) in „Echtzeit“miteinander verbinden. Deshalb istjede Station mit einem einheitlichenVLBI-System mit Geräten zur Erfas-sung, Speicherung, Wiedergabe undKorrelation von Signalströmen mit
Neuer Superrechnerfür die Erde
und für Schwarze Löcher
Bis in den Weltraum hinaus mit einer um die Erde kreisenden Antenne haben Radioastronomen ihre Beobachtungen imRahmen der Radiointerferometrie mit großen Basislängen (VLBI) ausgedehnt. Zusammen mit erdgebundenen VLBI-Netz-werken lässt sich so ein virtuelles Superteleskop synthetisieren, dessen Durchmesser um ein Vielfaches größer als jener der Erde ist. Wie ein Zoom machen solche VLBI-Messungen von kosmischen Objekten am Rand des Universums, etwaSchwarzen Löchern, Einzelheiten erkennbar, die um so deutlicher ausfallen, je kürzer die untersuchte Wellenlänge ist.
Beim Start des neuen Hochleistungsrechners (von links) Markus Rothacher, München, Dietmar Grünreich, Frankfurt, Hayo Hase, Wettzell, Hermann Seeger, Bad Neuenahr, Richard Wielebinski, Bonn, Anton Zensus, Bonn, und Peter Brosche, Bonn.
RadioASTRONOMIE
Gemeinsam werten Radioastronomen und Geophysiker digitale Datenströme weltweiter Teleskop-
Netzwerke aus. Ein neuer Hochleistungsrechner, der die schärfsten Bilder aus den Kraftwerken
von Quasaren am Rand des beobachtbaren Universums liefert, aber auch winzige Änderungen der
Umdrehungsgeschwindigkeit unserer Erde oder minimale Schwankungen ihrer Achse erkennbar
macht, hat kürzlich im Max-Planck-Institut für
Radioastronomie in Bonn offiziell den Betrieb auf-
genommen. „Das lässt“, so hat MPG-Präsident
HUBERT MARKL in seinem Grußwort geschrieben,
„eine neue Epoche für die hochauflösende Radio-
astronomie in Bonn und für die Forschungen auf
dem Gebiet der Geodäsie anbrechen“.

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 57
Bonn für astronomische und geo-physikalische Messungen eingesetztwerden. Entwickelt hat den BonnerVLBI-Korrelator das MassachusettsInstitute of Technology, Beiträge da-zu leisteten NASA, USNO (UnitedStates Navel Observatory) und dasSmithsonian Institute in den USA so-wie BKG, JIVE (Joint Institute for VLBI in Europe) und NFRA (Nether-lands Foundation for Research inAstronomy) in Europa. Insgesamtvier dieser Maschinen, je zwei in denUSA und Europa, sind bisher welt-weit in Betrieb.
Seit dem Jahr 1973 nutzen dieBonner Astronomen und Geophysi-ker gemeinsam mit internationalenForschungsinstituten das 100 Meterim Durchmesser große Max-Planck-Radioteleskop bei Bad Münstereifel-Effelsberg für astronomische und geodätische VLBI-Messungen. Mitt-lerweile arbeitet die astronomische VLBI-Gruppe des Bonner Max-Planck-Instituts unter Leitung von
Dr. Anton Zensus, Direktor am Insti-tut, daran, nach dem Zentimeter-auch den kurzwelligen Millimeterbe-reich für VLBI-Messungen zu er-schließen. Dafür sind noch einigetechnische Herausforderungen zuüberwinden. Doch die Millimeterwel-len-VLBI eröffnet spektakulär ge-naue Detailbeobachtungen mit Win-kelauflösungen von nur wenigenMillionstel Bogensekunden: Damitlässt sich – theoretisch – von der Er-de aus ein zehn Zentimeter großerStein auf dem Mond erkennen.
Mittlerweile haben die Radioastro-nomen die VLBI-Technik bis in denWeltraum erweitert. 1997 hat Japaneine acht Meter im Durchmessergroße Radioantenne mit dem NamenHALCA in eine Bahn um die Erde gebracht. Zusammen mit erdgebun-denen VLBI-Netzwerken lässt sichdamit die „Synthese“ eines 30.000Kilometer-Superteleskops verwirkli-chen. Das ist drei- bis viermal größerals die mit einem VLBI-Verbund auf
RadioASTRONOMIE
56 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Primärdaten von allen Stationen indem Korrelationsrechner paarweise„überlagert“, das heißt, zur Interfe-renz gebracht. In einem dritten undletzten Schritt wird dann aus den geeichten Interferometerdaten dieIntensitätsverteilung errechnet, alsodas Radiobild des beobachteten kos-mischen Objekts „restauriert“.
In dem neuen Hochleistungsrech-ner können gleichzeitig Datenströmevon bis zu 256 Millionen Bit pro Se-kunde paarweise zur Korrelation ge-bracht werden. Künftig lassen sich
die Aufzeichnungsraten sogar bisauf eine Milliarde Bit pro Sekundeund mehr steigern. Zum Vergleich:Vier Millionen Bit reichen zur Ver-schlüsselung von 250 Schreibma-schinenseiten.
Der Korrelator bereitet die von deneinzelnen Antennen im globalen VLBI-Netzwerk empfangenen Datenso auf, als wären sie von einem ein-zigen, virtuellen Riesenteleskop vonder Größe der Erde empfangen wor-den. Damit lassen sich die schärfs-ten Bilder synthetisieren, die in derAstronomie möglich sind.
Auch von weit entfernten kosmi-schen Radioquellen, beispielsweiseQuasaren, werden so mithilfe derVLBI-Technik Details mit Winkelauf-lösungen von weniger als einer Tau-sendstel Bogensekunde unterscheid-bar – das entspricht von Deutschlandaus gesehen dem Durchmesser einerPfennigmünze in den USA. Damitbietet sich den Radioastronomenzum Beispiel die Möglichkeit, die un-mittelbare Umgebung von Schwar-zen Löchern direkt zu beobachten
Zudem erlaubt es das VLBI-Verfah-ren, die Position von kompakten Ra-dioquellen im Weltraum unerreicht
genau festzulegen. Diese präzisenOrtsangaben nutzen die Geophysikerals kosmische Referenzpunkte, umauf der Erde beispielsweise die Ent-fernungen der Kontinente zueinanderoder aber auch die Orientierung derErdachse millimetergenau zu messen.Damit lassen sich Bewegungen vonTeilen der Erdkruste, wie Verschie-bungen kontinentaler Schollen,ebenso verfolgen wie Änderungender Achse oder der Drehgeschwindig-keit der Erde und damit der Tageslän-ge – Variationen, die im Lauf von Ta-gen, Wochen, Monaten und längerenZeiträumen stattfinden.
WELTWEIT VIER
MASCHINEN IN BETRIEB
Das Bundesamt für Kartographieund Geodäsie (BKG), Frankfurt/Main,hat sich an der Finanzierung desjetzt im Bonner Max-Planck-Institutfür Radioastronomie in Betrieb ge-nommenen „Mark IV-Korrelators“mit einem Betrag von rund fünf Mil-lionen Mark beteiligt. Der neueSuperrechner soll zu etwa gleichenAnteilen vom Max-Planck-Institutfür Radioastronomie und dem Geo-dätischen Institut der Universität
FASZINATION Forschung
Ein neuer Hochleistungsrechner, der im Rahmen der Radiointerferometrie mit großen Basislängen (VLBI) sowohl für die Astronomie als auch für die Erdvermessung eingesetztwird, hat im Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn offiziell den Betrieb aufgenommen. Im Bild unten rechts (von links) Wolfgang Zinz, Kuchenheim, Richard Wielebinski, Bonn, Hermann Seeger, Bad Neuenahr, und Dietmar Grünreich, Frankfurt.
der Erde maximal erreichbare virtu-elle Antenne.
Auch bei dieser Entwicklung istdas Max-Planck-Institut für Radio-astronomie von Anfang an dabeiund wird sich bei dem weiteren Aus-bau der Weltraum-VLBI verstärkt be-teiligen. Das 100-Meter-Radiotele-skop des Max-Planck-Instituts spieltdabei eine wichtige Rolle. Mit seinerungewöhnlich genauen und gleich-zeitig großen Sammelfläche gilt esals eines der empfindlichsten Inter-ferometer-Instrumente im interna-tionalen VLBI-Netzwerk – sowohlbei Beobachtungen im Zentimeter-als auch im Millimeter-Wellenlän-genbereich. Das trifft auch für das30-Meter-Radioteleskop in Südspa-nien bei Granada zu: Zusammen mitspanischen und französischen Part-nern ist das Max-Planck-Institut fürRadioastronomie an dem vom „Insti-tut für Radioastronomie im Millime-terwellenbereich“ (IRAM) betriebe-nen weltweit größten Einzelteleskopfür Millimeterwellen beteiligt.
ÜBERWACHUNG
DER ERDROTATION
Der Forschungsschwerpunkt dervon Prof. James Campbell geleitetengeodätischen VLBI-Gruppe der Uni-versität Bonn richtet sich auf die re-gelmäßige Messung und Überwa-chung der Schwankungen der Erdro-tation. Diese Arbeiten sind in diedeutsche Forschungsgruppe Satelli-tengeodäsie (FGS) und in den Inter-national VLBI Service (IVS) als Zu-lieferer zum Internationalen Erdrota-tionsdienst (IERS) eingebunden.
Den Hauptanteil der geodätischenVLBI-Beobachtungen trägt das 20-Meter-Radioteleskop der Fundamen-talstation Wettzell im BayerischenWald. Gelegentlich wird auch das100-Meter-Radioteleskop in Effels-berg mit einbezogen – vor allem,wenn es um das Messen kleinster Be-wegungen der Erdkrusten im Bereichdes Oberrheingrabens bis zur Nie-derrheinischen Bucht geht: DiesesGebiet gilt als Westeuropas tekto-nische „Schwächezone“ und machtsich mit gelegentlichen Erdbeben be-merkbar. �
Die schärfsten Bilder der Astronomie liefern über die Erdeverteilte Radioteleskope bei gleichzeitigen Beobachtungennach der Auswertung im Korrelator-Rechner.
FOTO
S: M
PI F
ÜR
RAD
IOAS
TRO
NO
MIE

58 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1 2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 59
Wenn gestörte Kommunikation krank macht
MOLEKULARbiologie
Das biologische Signalüber-
tragungssystem einzelner Zellen
eines hoch differenzierten
multizellulären Organismus
ist sowohl essenziell für die
Entwicklung als auch für die
Erhaltung seiner Lebensfunktionen
im ausgewachsenen Zustand.
Signalmoleküle regulieren diesen
Prozess, sind aber gleichzeitig
an der Entstehung und Progression
von Krankheiten beteiligt.
Wie das bei Krebs und Alters-
diabetes vor sich geht, hat
PROF. AXEL ULLRICH vom
MAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR BIOCHEMIE erforscht.
FASZINATION Forschung
Dreidimensionales Modell des Antikörpers „Trastuzumab“ (Herceptin®).
Der Bagger hatte ganze Arbeitgeleistet. Ein unvorsichtiger
Hieb der Schaufel hatte das zentraleGlasfaserkabel durchtrennt, das dasMax-Planck-Institut für Biochemiein Martinsried bei München mit demRest der Welt verbindet. Fast einenganzen Tag blieben Telefone undFaxgeräte stumm, Internetverbin-dungen und E-Mail-Austausch wa-ren unmöglich. Mancher ging gleichnach Hause, weil er ohnehin nichtsvon dem erledigen konnte, was ersich für den Tag vorgenommen hat-te. Die Panne machte ziemlich dras-tisch deutlich, wie abhängig moder-ne Forschung von schneller Kommu-nikation ist: Ohne ständigen Kontaktzur Außenwelt würde das Institutzumachen müssen.
Axel Ullrich, Direktor der Abtei-lung Molekularbiologie, hätte dieseLektion allerdings kaum gebraucht,um sich der Bedeutung von Kommu-nikation für das Funktionieren kom-plexer Systeme bewusst zu werden.Der Austausch von Botschaften istnämlich das Arbeitsgebiet, mit demsich die Gruppe um den Biologen be-schäftigt, seitdem Ullrich 1988 sei-nen Direktoren-Posten im Max-Planck-Institut übernommen hat: Erversucht, die Arbeitsweise jener„Glasfaserkabel“ zu verstehen, mitdenen jede Zelle des Körpers Kontaktzu ihrer Außenwelt hat. Und Ullrichhat durchaus auch die Absicht, eini-ge dieser „Kabel“ gezielt zu durch-trennen.
Mit einer dieser Sabotage-Ideenhat der „Schatzsucher der Moderne“
Am Max-Planck-Institut für Biochemie überprüft Prof. Axel Ullrich die Analyse von zellulären Signalen.
FOTO
S: W
OLF
GAN
GFI
LSER
/ ABB
.: M
PI F
ÜR
BIO
CHEM
IE

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 61
dern gewonnene Hormon abgelöst.Ullrichs Erfolge an der Universität
weckten auch das Interesse vonPharmafirmen. Das erste Biotech-nologie-Unternehmen warb um den Nachwuchswissenschaftler. DerSchritt kostete ihn Überwindung,aber schließlich wechselte Ullrich zuGenentech – heute eine der wenigenBiotech-Firmen, die Gewinne ab-wirft. Dort begann er ein Projekt, indem es um den epidermalen Wachs-tumsfaktor EGF (epidermal growthfactor) ging, ein Hormon, mit dembenachbarte Hautzellen sich Signalezu Teilung und Wachstum geben, etwa wenn es gilt, eine Wunde zuschließen. Bei Genentech hoffte man,solche Hormone als Medikamentenutzen zu können. Zahlreiche Grup-pen waren damals weltweit auf derJagd nach den Botenstoffen. „Jederversuchte der schnellste zu sein“, erinnert sich Ullrich. Und er warschnell: Zusammen mit Kollegenidentifizierte er als Erster dasmenschliche Gen für den Rezeptorvon EGF, über den das Hormon seineBotschaft vermittelt.
ZELLEN, DIE AUS
DEM RUDER LAUFEN
Diese Arbeiten sind heute einStück klassische Biologie. Es stelltesich heraus, dass ein „Verwandter“des EGF-Rezeptors wenige Monatevorher aufgeklärt worden war, dochdieser „vErbB“ genannte Verwandtewar ein „Krebsgen“. Wenn ein Virusdieses Gen in Hühner einschleuste,erkrankten die Tiere an Blutkrebs.Mit der Entdeckung, dass das Virusdas Gen offenbar aus ursprünglichnormalen Zellen gekapert hatte,konnte Ullrich erstmals eine direkteVerbindung herstellen zwischenKrebs und „Kommunikation“: Krebsschien eine Krankheit von Zellen zusein, die nicht mehr den Botschaftendes Körpers gehorchen, sondern diesich offenbar ihre Wachstumsbefehleselbst geben. Die offensichtliche Ver-bindung zwischen Störungen in derSignalübermittlung und Krebs hatUllrich seitdem nicht losgelassen. Ermachte sich auf die Suche nach wei-teren, ähnlichen Rezeptor-Genen;
mehr als ein Dutzend sollten es inden nächsten Jahren werden. Das erste, das er fand, nannte er „HER2“für „human epidermal growth factorreceptor-2“ (menschlicher epider-maler Wachstumsfaktor-Rezeptor-2).Auch dieses Gen war kein Neuling:Kurz zuvor hatten US-Forscher eineVariante namens „Neu“ bei Mäusenals Ursache von Tumoren identifi-ziert. Das Modell „Krebs = gestörteKommunikation“ bestätigte sich.
Was allerdings fehlte, waren Be-lege, dass diese Gene auch beimenschlichen Tumoren eine Rollespielen. Auf dem Weg zum Nachweishalf der Zufall: Ullrich lernte denamerikanischen Krebsarzt DennisSlamon kennen, den er überzeugte,mit ihm zu kooperieren. Slamonsuchte in Tumorgewebeproben, dieer seinen Patienten entnommen hat-te, nach Veränderungen in den Sig-nalprotein-Genen, die Ullrich mitt-lerweile identifiziert hatte. HER2 er-wies sich als Volltreffer. Bei einigenBrusttumoren, so stellten die beidenWissenschaftler fest, hatte sich dasGen für den Rezeptor vervielfältigt.Normalerweise trägt eine Brustkrebs-zelle etwa 10.000 HER2-Rezeptorenauf ihrer Oberfläche. Wenn das Genvervielfältigt war, stieg die Zahl aufbis zu eine Million. Eine Reihe wei-terer Experimente bestätigte dannden nahe liegenden Verdacht, dassdie Vermehrung des HER2-Rezeptorseine wesentliche Ursache der Entar-tung der Zellen zu sein schien. DieseAnnahme konnten die Forscher er-härten: Es gelang ihnen zu zeigen,dass die Patientinnen, die den abnor-mal vermehrten Rezeptor im Tumorhatten, an einer erheblich aggressi-veren Erkrankung litten als die Ver-gleichsgruppe. Und das wiederumlegte unmittelbar die Idee zu einerTherapie nahe: Ließe sich das Tu-morwachstum stoppen, indem manden HER2-Rezeptor blockiert?
Ullrich initiierte die Herstellungvon Antikörpern gegen den Rezep-tor; so sollte die Idee in die Tat um-gesetzt werden. Schnell stellte sichheraus, dass diese Antikörper inTierversuchen tatsächlich dasWachstum von Tumoren stoppten,
die zuviel HER2 herstellten. „Wirwaren elektrisiert“, erinnert sich Ull-rich. Es mussten dann allerdings eineReihe weiterer Hürden überwundenwerden, bis der mittlerweile abge-wandelte und „Trastuzumab“ getauf-te Antikörper – Jahre später – an Pa-tientinnen erprobt werden konnte.Positive Ergebnisse dieser Studienhaben zur Zulassung des Antikörpersals eine der wenigen wirklichen In-novationen der Krebsmedizin ge-führt. Tatsächlich ist Herceptin® daserste Krebsmedikament, das auf Er-gebnissen der Genomforschung ba-siert, zielspezifisch ist, ein defektesSignalsystem angreift und bei einerdefinierten Patientengruppe (indivi-dualisierte Therapie) eingesetzt wird.Dennoch ist die Erprobung von„Trastuzumab“ auch fast 20 Jahrenach der ersten Idee noch nicht ab-geschlossen.
AUF DER JAGD
NACH REZEPTOREN
Die zweite Konsequenz der Jagdnach den Hormonrezeptoren war,dass Ullrichs Interesse erwachte, dieFunktion der neu entdeckten Mo-leküle näher zu verstehen. Er fragtesich: Wie leiten solche Rezeptorendas Signal des Hormons ins Innereder Zelle weiter? Und was passiertdann mit der Botschaft in der Zelle?Ullrich und seine Kollegen musstenbei der Suche nach der Antwort al-lerdings nicht ganz bei Null anfan-gen. Bereits in den 50er-Jahren hat-ten Biochemiker begonnen, dieseFragen gleichsam vom anderen Ende
MOLEKULARbiologie
60 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Planck-Institut für Biochemie dar-auf, zu verstehen, wie die Zellkom-munikation bei zwei ganz unter-schiedlichen Volkskrankheiten ge-stört ist: Krebs und Altersdiabetes.Die eine kostet einem von vier Deut-schen das Leben, die andere trifft etwa jeden Zehnten – Tendenz stei-gend. Um Ergebnisse seiner For-schung, die vielleicht kommerziellverwertbar sein könnten, kümmertsich die Garching Innovation GmbH,eine Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft. „Grundlagenforschungist ohne Zweifel die beste Quelle für Innovationen“, sagt Ullrich. Undnicht nur seine Liste mit mehr als 50Patenten spricht für die These: DreiJahre nach seinem Arbeitsantritt imMax-Planck-Institut gründete Ull-rich in Kalifornien das Biotechnolo-gie-Unternehmen Sugen, das seit-dem versucht, zwei seiner Ideen zuKrebsmedikamenten weiter zu ent-wickeln. Darüber hinaus existierenzwei weitere Firmen: AXXIMA sowieein Unternehmen, dessen Name nochnicht feststeht.
Allerdings liegen Forschung undAnwendung bei Ullrichs Arbeitsge-bieten auch ziemlich nahe beieinan-der. Wie nahe, hat Ullrich Mitte der
70er-Jahre gelernt; in einer Phase,die seiner wissenschaftlichen Karrie-re die entscheidende Wende gab. Mit32 Jahren war der in Heidelberg pro-movierte Biologe an die Universityof California in San Francisco ge-wechselt, dort befand sich eines derweltweit führenden Zentren der ge-rade entstandenen Gentechnik. Ull-rich arbeitete mit Insulin, dem Hor-mon, das bei Anstieg des Blutzucker-spiegels im Blut von der Bauchspei-cheldrüse ausgeschüttet wird unddann die Organe veranlasst, Zuckeraus dem Blut aufzunehmen, um denBlutzuckerspiegel abzusenken. Erwar der Erste, der das Gen für Insulin(von Ratten) isolierte und es 1977 soin Bakterien einschleuste, dass diesedas Hormon herstellten. Damit stan-den im Prinzip unbegrenzte Insulin-mengen zu Forschungszwecken zurVerfügung. Kurz darauf führte dieszur Klonierung von humanem Insu-lin, das die Firma Eli Lilly als Humu-lin seit 1985 mithilfe des von Ullrichisolierten Gens produziert. Heutewerden Diabetiker fast ausschließlichmit menschlichem Insulin behandelt,das von Bakterien oder Hefezellenproduziert wird. Es hat das bis in die80er-Jahre aus Schweinen oder Rin-
FASZINATION Forschung
Die „neue“ Therapie hatte sich schon vor zwei Jahren unter Brustkrebspa-tientinnen herumgesprochen. Lange bevor der Antikörper „Trastuzumab“(Handelsname Herceptin®) in Deutschland zur Behandlung von Frauen mitfortgeschrittenem Brustkrebs zugelassen war, häuften sich bei Ärzten be-reits die Anfragen. Grundlage des Interesses war vor allem eine internatio-nale Studie, in der der Antikörper an etwa 470 Frauen mit metastasiertemKrebs erprobt worden war. Im April 2001 wurde die Studie, deren vollstän-dige Ergebnisse den Behörden längst bekannt waren (Herceptin® wurde1998 von der US-amerikanischen „Federal Drug Administration“ zugelas-sen), endlich im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht. „Die Ergebnisse sind überzeugend“, kommentiert Elizabeth Eisenhauer von derQueens Universität im kanadischen Kingston: „Verbesserungen in der Über-lebenszeit von Frauen mit metastasiertem Brustkrebs sind selten.“Tatsächlich bestätigt die Studie, dass die Therapie mit dem Antikörper sinn-voll sein kann, wenn sie an strenge Bedingungen geknüpft wird. Der Anti-körper bindet an den HER2-Rezeptor, ein Protein auf der Oberfläche vonZellen, das diese zum Wachstum anregen kann. In gesundem Brustgewebeist der Rezeptor selten, bei einer von vier an Brustkrebs erkrankten Frauenweisen die Tumorzellen aber eine Anreicherung des HER2-Proteins auf. Dar-auf beruht die Idee, HER2 für eine Attacke gegen Krebszellen zu nutzen. Soganz haben die Forscher die Wirkung der Immuntherapie noch nicht ver-standen. Zum einen scheint der Antikörper gezielt die Aufmerksamkeit desImmunsystems auf die Tumorzellen zu lenken. Doch offenbar beeinflusst erauch die Funktionsweise des Rezeptors und verändert die Signalkaskade inden Zellen, schildert Axel Ullrich.
Die Erprobung an 469 Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs be-stätigt, dass das Konzept einer Immuntherapie im Prinzip tatsächlich funk-tioniert. In der Studie erhielt die eine Hälfte der Patientinnen eine üblichepalliative Chemotherapie, die andere zusätzlich zur Chemotherapie auch denAntikörper. Die Patientinnen wurden mit einer Chemotherapie-Kombinationaus den Anthrazyklinen Epirubicin/Doxorubicin und Cyclophosphamid be-handelt, wenn sie vorher noch keine anthrazyklinhaltige Chemotherapie er-halten hatten, andernfalls mit Paclitaxel.Insgesamt war die Kombination Chemotherapie und Antikörper durchgehendwirksamer als Chemotherapie alleine. Unter Chemotherapie alleine war nacheinem Jahr bei neun von zehn Frauen der Tumor bereits wieder gewachsen,unter der Kombination mit dem Antikörper war das bei sieben von zehn derFall – zwei von zehn Frauen hatten also einen Zeitgewinn. Die Auswirkun-gen auf die Überlebensrate waren jedoch nur moderat. Ohne Antikörperdauerte es 20,3 Monate, bis die Hälfte der Patientinnen gestorben war, mitAntikörper 25,1 Monate. Nach vier Jahren waren allerdings in beiden Grup-pen 80 Prozent der Frauen gestorben.In Kombination mit Paclitaxel zeigt die Antikörpertherapie eine 42-prozen-tige Erfolgsrate. Natürlich gibt es auch Nebenwirkungen wie etwa Übelkeitund Haarausfall oder ein erhöhtes Risiko für Herzschäden. Meist konntendie Symptome durch die übliche Therapie behandelt werden. Nach der Ana-lyse scheint vor allem die Kombination mit Anthrazyklinen riskant zu sein.Allerdings laufen noch Studien, die den Antikörper in Kombination mit wei-teren Therapien erproben. Offen ist auch, welche Wirkung er hat, wenn erbereits vor der Diagnose von Metastasen eingesetzt wird. KLAUS KOCH
(DIE WOCHE) bereits ein Stück Medi-zingeschichte geschrieben. Das Er-gebnis ist ein ungewöhnliches Medi-kament gegen Brustkrebs: „Trastuzu-mab“ heißt der Antikörper, der seit1998 bei Frauen mit bestimmtenBrustkrebs-Formen eingesetzt wer-den darf. Er verschafft ihnen zumin-dest einige Monate Zeitgewinn imKampf gegen die Krankheit (sieheKasten unten). Die Arbeit, die Ullrichin das Medikament gesteckt hat,brachte ihm bereits einige Ehrungenein: Sie reichen vom humorvollen Ti-tel „Busenfreund 2001“ von einerBrustkrebs-Selbsthilfegruppe bis zumdiesjährigen Robert-Koch-Preis, ei-ner der höchsten wissenschaftlichenAuszeichnungen Deutschlands (sieheKasten auf Seite 63).
Was Ullrich kennzeichnet, ist, dasser auf die Verwirklichung dieser The-rapie-Idee ebenso stolz ist wie aufeine lange Liste von fundamentalenArbeiten der Grundlagenforschung.Der 57-Jährige ist ein Wanderer zwi-schen den Welten; einer der wenigendeutschen Forscher, die es schaffen,Grundlagenforschung und kommer-zielle Anwendung miteinander zuverknüpfen. Derzeit konzentriert sichseine Arbeit am Martinsrieder Max-
Antikörper gegen Krebs
In seinen Forschungsarbeiten beschäftigt sich Axel Ullrich mit der molekularen Signalübertragung.

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 63
MOLEKULARbiologie
Brustkrebszellen in Kultur unter dem
Mikroskop.
Ein Blutgefäß wird von einem Tumor (links) angelockt.
ändert der Rezeptor seine Form, so-dass sich zwei Rezeptormoleküle zueinem Paar zusammenlagern. DiesePaarung sorgt auch dafür, dass dieKinase-Einheiten im Innern der Zellein unmittelbare Nachbarschaft zu-einander kommen. Dann können siesich zuerst gegenseitig phosphorylie-ren und etwas später auch andereZellbestandteile aktivieren, die dasSignal dann weitertragen.
Freilich zeigten weitere Studien,dass der Vergleich mit „Glasfaserka-beln“ nur sehr bedingt auf das Mo-dell zutrifft, das Forscher heute vonder Kommunikation in Zellen haben.Seit Anfang der 80er-Jahre habendie Wissenschaftler mehrere tausendProteine entdeckt, die an der Signal-verarbeitung in den Zellen beteiligtsind – darunter mehr als tausend Re-zeptoren. „Jede Zelle trägt Dutzendesolcher Rezeptoren auf der Ober-fläche, die je nach Situation ganzverschiedene Effekte auslösen undsich gegenseitig beeinflussen kön-nen“, sagt Ullrich.
Zellen sind sogar so durchwobenmit Systemen zum Austausch undzur Verarbeitung von Signalen, dassman sie durchaus als chemischeComputer verstehen kann: Eine„Eingabe“ führt innerhalb vonBruchteilen von Sekunden zu einerersten Reaktion, oft setzen Signaleaber auch stunden- oder tagelangdauernde Prozesse in Gang. Was Zel-len von Computern unterscheidet,ist, dass sie nicht Elektrizität, son-dern chemische Stoffe als Überträgervon Information benutzen.
Signalverarbeitung nach Art derZelle bedeutet also, die Konzentrati-on eines Stoffes zu messen und, jenach Ergebnis dieser Messung, dieKonzentration eines anderen Stoffszu verändern. Dieser im Prinzip simple Ablauf ist jedoch im Innernder Zellen zu mehrstufigen Kaska-den hintereinander geschaltet. Zu-dem verläuft er nicht linear, sonderndie von einem Rezeptor ausgehendenKaskaden verzweigen sich und sindmit den Kaskaden anderer Rezepto-ren verflochten, sie werden verstärktund abgeschwächt. Dutzende vonElementen können beteiligt sein, die
Signalverarbeitung ist laut Ullrich„extrem komplex“.
Doch auch das neue Modell bein-haltet die Idee, dass Krebs das Ergeb-nis gestörter Kommunikation ist. In Krebszellen sind gerade die Genedefekt, die normalerweise den gere-gelten Ablauf von Zellteilung undWachstum sicherstellen sollen. „Wirwissen heute, das fast alle in Krebs-zellen veränderten oder gestörtenGene in diese Gruppe gehören“, er-läutert Ullrich.
SIGNALE IN
DER FALSCHEN STÄRKE
Dies hat zur Folge, dass Signalezum falschen Zeitpunkt oder in derfalschen Stärke gegeben werden.Manche Krebsarten produzierenselbst die Hormone, mit denen sie ihreigenes Wachstum stimulieren. An-dere Tumoren tragen defekte Rezep-toren, die gleichsam kurzgeschlossensind, sodass sie dauerhaft Wachs-tumssignale vortäuschen oder aberdie Wirkung teilungshemmenderSignale aufheben.
Obwohl sich also dieses Konzeptder Krebsentstehung bewahrheitethat, reicht es längst nicht aus, umdie Eigenschaften von Tumoren zuerklären. „Wenn wir bessere Therapi-en entwickeln wollen, müssen wiruns um weitere Fähigkeiten vonKrebszellen kümmern“, meint Ull-rich. Neben dem Vermögen, sichselbst Wachstumssignale zu geben,haben Tumoren noch vier weiterewichtige Fähigkeiten: Krebszellenkönnen der Aufmerksamkeit des Im-munsystems entgehen; Krebszellenkönnen die in jeder Zelle vorhande-nen Sicherheitssysteme ausschalten,die ihr Wachstum stoppen sollen;Krebszellen können den Körper dazubewegen, neue Blutgefäße wachsenzu lassen und das Erbgut von Krebs-zellen ist instabil und damit anfälligfür Defekte und Veränderungen. Jededieser Eigenschaften betrifft ein an-deres Sicherheitssystem, dessen Sinneigentlich gerade darin liegt, die un-geregelte Vermehrung von Zellen zuverhindern. „Wer an einem Tumorerkrankt, zeigt dadurch schon, dassdiese Systeme bei ihm anfällig für
62 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
her aufzurollen. Sie hatten sich ge-wundert, wie es Zellen schaffen, tau-sende von chemischen Reaktionen inihrem Inneren aufeinander und aufdie Anforderungen der Umwelt ab-zustimmen.
Ein entscheidender Durchbruchwar dabei Edwin G. Krebs und Ed-mond H. Fischer gelungen. Sie hat-ten sich für einen Ausschnitt ausdem Zuckerstoffwechsel interessiert:Wenn beispielsweise Insulin auf Le-ber- oder Muskelzellen trifft, begin-nen die Zellen Glucose aufzunehmenund in ihrem Innern als Glykogen,als tierische Stärke, abzulagern. Derumgekehrte Prozess läuft ab, wennbeispielsweise in StresssituationenAdrenalin ins Blut gelangt. Das Hor-mon führt in Leber und Muskelzellendazu, dass Enzyme aus dem Glyko-gen wieder Zuckermoleküle abspal-ten, die dann zur Energiegewinnungzur Verfügung stehen.
Krebs und Fischer fanden schnellheraus, dass die Zellen diese gegen-läufigen Reaktionen nicht dadurchregulierten, dass sie ständig die pas-senden Enzyme herstellten und nachGebrauch wieder zerstörten; viel-mehr blieben die Enzymmengenkonstant. Offenbar verfügten dieZellen über Möglichkeiten, die Enzy-me je nach Bedarf ein- und wiederauszuschalten. Diesen Schalter iden-tifizierten Krebs und Fischer: Um ak-tiviert zu werden, werden einigenEnzymen an bestimmten StellenPhosphatgruppen angeheftet, Chemi-ker nennen das „Phosphorylierung“.Werden diese Phosphatgruppen wie-der entfernt, fallen die Enzymeprompt in den Ruhezustand zurück.
Die beiden Forscher fanden auchheraus, dass das Anheften und Ent-fernen der Phosphatgruppen vonzwei weiteren Proteinen übernom-men wird: Eine „Kinase“ heftet Phos-phatgruppen an, eine „Phosphatase“entfernt sie wieder. Es stellte sich so-gar heraus, dass auch die Aktivitätdieser beiden Enzyme wiederumdurch Phosphorylierung gesteuertwird; das Regulationsprinzip ist inmehreren Stufen kaskadenartig hin-tereinander geschaltet. Jede Stufesorgt für eine Verstärkung des Sig-
nals, so dass letztlich das Eintreffeneiniger weniger Insulin- oder Ad-renalinmoleküle ausreicht, um denZuckerstoffwechsel der Zellen völligumschlagen zu lassen. „Dieses Prin-zip der Steuerung über Phosphat-gruppen erwies sich als einer dervielseitigsten Regulationsmechanis-men in der Zelle“, sagt Ullrich. Undals einer der wichtigsten: Fischerund Krebs erhielten für ihre Ent-deckungen 1992 den Nobelpreis fürMedizin.
Die Bedeutung dieses Prinzips fürseine eigene Arbeit erkannte Ullrich,als er den Rezeptor für den Epider-malen Wachstumsfaktor EGF genau-er untersuchte. Die Analyse zeigte,dass das Protein in drei Regionenunterteilt ist, die typisch sind für Re-zeptoren, die in der Zellmembranverankert sind. Der außerhalb derZelle liegende Teil des Rezeptors ragtantennenartig in die Umgebung derZelle. In ihm befindet sich unter an-derem die Bindungsstelle für dasHormon. Eine speziell geformte „Ta-sche“ sorgt dafür, dass von Millionenvon möglichen Stoffen nur eineroder wenige auf den Rezeptor pas-sen. Dieser extrazelluläre Teil istdurch einen Fuß in der Zellmembranverankert, die die Zelle einhüllt. Unddieser Fuß ist das Bindeglied zumdritten Teil des Rezeptors, der sichim Zellinnern befindet. Ullrich klärte1984 zum ersten Mal die Amino-säure-Sequenz der EGF-Rezeptor-kinase auf, also eines Enzyms, dasPhosphatgruppen an andere Proteineanheften kann, und zwar an solchenStellen, an denen sich die Amino-säure Tyrosin befindet.
ZWEI MOLEKÜLE
WERDEN EIN PAAR
Damit lag eine Erklärung auf derHand, wie Rezeptoren funktionieren.Wenn außen ein Hormon bindet,dann wird die Tyrosinkinase im In-neren der Zelle aktiv und beginntandere Proteine zu phosphorylieren.Heute wissen die Forscher auch, wiedie Kinase „erfährt“, dass sich an denRezeptor ein Hormon angelagert hat.Das Prinzip ist verblüffend einfach:Wenn ein Hormon bindet, dann ver-
Fehler sind“, sagt Ullrich. Ein Tumorbeweist also schon alleine durch sei-ne Existenz, dass er sich gegenüberdem Immunsystem tarnen kann. Da-zu tragen mehrere Faktoren bei. Zumeinen sind viele Tumoren für das Im-munsystem schwer zu erkennen, weilsie kaum Markierungen tragen, diesie vom Rest des Körpers unterschei-den. Aber möglicherweise hängenTumoren auch spezielle „Schilder“aus, die auf Abwehrzellen des Im-munsystems besänftigend wirken.Das würde erklären, warum das Im-munsystem vieler Patienten auchsolche Krebsarten nicht entdeckt, diedurchaus verräterische Moleküle tra-gen, die das Immunsystem eigentlichattackieren sollte.
Die Idee ist plausibel, wenn mansich den Lebenslauf einer Abwehr-zelle anschaut. Bevor solch eine Zel-le einen Tumor oder auch einen In-fektionsherd attackieren kann, musssie aktiviert werden. Dieser Prozessgeschieht aber meist weit entferntvom späteren Einsatzort in einemLymphknoten, wo die Zellen auf„Botschafter“ – so genannte Anti-gen-präsentierende Zellen – aus al-len Teilen des Körpers treffen. Nach
DER ROBERT-KOCH-PREIS
Für seine Forschungen auf dem Gebiet der Krebs-bekämpfung erhält Axel Ullrich im November den mit120.000 Mark dotierten Robert-Koch-Preis 2001. Die Robert-Koch-Stiftung würdigt damit seine For-schung an Rezeptoren, die die Grundlagen für eine völligneue Generation von Krebsmedikamenten geschaffenhaben, die Tumoren das weitere Wachstum erschwert.Der Robert-Koch-Preis gehört zu den angesehenstenwissenschaftlichen Auszeichnungen der BundesrepublikDeutschland. Er wird jährlich unter der Schirmherr-schaft des Bundesgesundheitsministers an Forscher fürhervorragende, international anerkannte wissenschaft-liche Leistungen verliehen. Die Träger des Robert-Koch-Preises genießen hohe internationale Wertschätzung.Dazu hat auch beigetragen, dass seit 1977 fünf ihrerPreisträger nach der Verleihung des Robert-Koch-Preises mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden.Die Robert-Koch-Stiftung e.V., Bonn, hat sich zum Zielgesetzt, den Kampf gegen Infektionskrankheiten undandere Volksseuchen zu unterstützen. Sie fördert finan-ziell und durch öffentliche Anerkennung wissenschaftli-che Arbeiten vor allem auf den Gebieten der Grundla-genforschung bei Infektionskrankheiten, der Immunolo-gie sowie Maßnahmen zur Lösung medizinischer und hy-gienischer Probleme in den Ländern der Dritten Welt.
ABB .
: MPI
FÜ
RB I
OCH
EMIE
Tumorzellen nach Immunofluoreszenz-
markierung.

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 65
der Zellen, der auf die Therapie an-spricht. Einige Tumorzellen besitzenaber per Zufall bereits eine Unemp-findlichkeit. Sie überleben und bil-den dann die Grundlage für einenneuen, besser angepassten Tumor.Dieser Prozess geschieht offenbarauch während der Therapie mit„Trastuzumab“, dem von Ullrich mit-entwickelten Antikörper gegen Brust-krebs. Auch wenn der Antikörper inKombination mit Chemotherapie beivielen Frauen den Tumor deutlichschrumpfen lässt, kommt er bei denmeisten Frauen irgendwann wiederund ist dann resistent gegen den An-tikörper. Was dabei genau passiert,wissen die Forscher noch nicht.
Axel Ullrich geht davon aus, dassKrebstherapien der Zukunft mehrereMedikamente miteinander kombinie-ren und sich so gegen alle Fähigkei-ten richten. Je nach Eigenschaften
des Tumors wird die Kombinationfür jeden Patienten eigens zusam-mengestellt werden müssen. „DieAuswahl der besten Therapie wirdaufgrund von molekularen Charak-terisierungen des Tumors passieren“,glaubt Ullrich – einer Analyse also,welche Gene defekt sind. Forscherwissen schon heute, dass sich selbstähnliche Tumoren durch die Kombi-nation von Gendefekten unterschei-den können. Schon jetzt haben Ana-lysen der ErbgutveränderungenKrebs in mehrere hundert Einzel-krankheiten zerlegt. Das hat auchFolgen für die Suche nach neuenTherapien: Weil sie meist nur für ei-nige Varianten eines Tumors Verbes-serungen bringen, sind sie oft nurnoch für einige hundert oder tausendPatienten einsetzbar.
„Diese Aufsplitterung in immerfeiner abgestimmte Therapien wird
weitergehen“, prognostiziert Ullrich.„Als Nahziel hoffen wir, Krebs zu einer chronischen Krankheit zu ma-chen, mit der der Patient alt werdenkann.“ Das zwingt zum Nachdenkendarüber, wer die neuen Therapienbezahlen soll. Denn je weniger Pa-tienten es mit derselben Krebser-krankung gibt, desto höher ist derPreis pro Medikament. Und das wirddie auf spezielle Tumorvarianten zu-geschnittene Therapie vermutlichteuer werden lassen. Allein die The-rapie mit „Trastuzumab“ kostet proPatient im Monat 2500 Euro. Auf dieFrage, ob sich die Gesundheitswesender Industrieländer zukünftig einganzes Arsenal solcher Krebstherapi-en leisten werden können, hat auchUllrich keine Antwort. Doch vorerstdominiert noch ein anderes Problem:Diese Therapien müssen erst einmalgefunden werden. KLAUS KOCH
MOLEKULARbiologie
64 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
dieser Aktivierung haben die Ab-wehrzellen dann noch ein zweites,ganz praktisches Problem: Nachdemsie in den Blutkreislauf gelangt sind,müssen sie ihren Einsatzort finden.Das entspricht in etwa der Aufgabe,einen bestimmten Kanaldeckel zufinden, nachdem man ohne Licht inder Kanalisation einer Großstadtausgesetzt wurde. Die Innenwandder Blutgefäße ist das Einzige, wasdie Abwehrzellen vom Körper „se-hen“ können – und die ist normaler-weise mit einer glatten und unauf-fälligen Zellschicht ausgekleidet, denEndothelzellen.
WIE KREBSZELLEN
ÜBERLEBEN
Forscher haben in den vergange-nen Jahren jedoch gelernt, dass dieseZellen ihr Aussehen verändern kön-nen. Wenn etwa in der Leber eine In-fektion auftritt, dann produzierenZellen des Organs Botenstoffe, diedie Endothelzellen in den Leberge-fäßen veranlassen, neue Proteine aufder Oberfläche vorzuzeigen. Dadurchwird die Gefäßwand in dieser Passa-ge gleichsam klebrig – für vorbei-schwimmende, aktivierte Abwehrzel-len ist das die Aufforderung zur Hil-fe. Mit etwas Mühe zwängen sie sichzwischen den Endothelzellen hin-durch und gelangen so aus dem Blut-gefäß hinaus in das Organ. Tierversu-che zeigen aber, dass Gefäße in denTumoren keinerlei Anhaltspunkte fürdie Abwehrzellen geben, dass hier et-was nicht stimmt. Eine aktivierte Ab-wehrzelle treibt offenbar einfach vor-
bei – vom Ziel ihrer Suche nur durchdie Bruchteile von Millimetern starkeGefäßwand getrennt.
Ullrichs Gruppe konzentriert sichderzeit auf drei andere Fähigkeitender Krebszellen. Neben den Signal-kaskaden, die Wachstum und Teilungsteuern, gibt es auch Systeme, dieden Zustand der Zelle überwachen,insbesondere den des Erbguts. Wennsie Fehler oder Störungen entdecken,hält diese interne Qualitätskontrolledie Zellteilung vorübergehend an,um Reparatursystemen Zeit zu ge-ben, die Schäden zu beheben. Fälltdie Reparatur nicht zufriedenstel-lend aus, setzt die Qualitätskontrolleein Selbstzerstörungsprogramm inGang: Die Zelle stirbt ab. Forschernennen das Apoptose. „Krebs kannsich aber nur entwickeln, wenn dieZellen es geschafft haben, auch dieseSicherheitsmechanismen zu sabotie-ren“, sagt Ullrich.
Oft ist diese Sabotage noch nichtganz perfekt, diesen Umstand nutzenviele heutige Krebstherapien. Che-motherapie und Bestrahlung lösenbeispielsweise so massive Schädenam Erbgut von Tumorzellen aus, dasdann doch der Selbstmordmechani-mus aktiviert wird. Der Erfolg derTherapien ist also davon abhängig,dass sich die geschädigten Zellenletztlich selbst umbringen. Diese Ab-hängigkeit ist aber auch ein großerNachteil konventioneller Therapien:Unter den Milliarden von Tumorzel-len finden sich sehr oft bereits Zel-len, deren Apoptose-Maschinerie soschwer geschädigt ist, dass sie auchauf die Therapie nicht mehr reagiert.
Stattdessen hat die Therapie dannoft den Effekt, dass sie gerade dieseZellen anreichert, die dann später erneut zu einem Tumorrezidiv he-ranwachsen, der dann aber resistentgegen Chemotherapie ist. UllrichsArbeitsgruppe erforscht deshalb zur-zeit intensiv Mechanismen, dieApoptose verhindern. „Möglicher-weise ergibt sich daraus ein Weg, wieman in Tumorzellen die Selbstmord-programme wieder in Gang setzenkann“, hofft er.
Einen Schritt weiter ist bereits dieStrategie, das Wachstum von Tumo-
ren zumindest zu behindern. For-scher wissen heute, dass bis aufBluttumoren jede bösartige Ge-schwulst ab einem Durchmesser vonetwa einem Millimeter neue Blutge-fäße benötigt, um sich mit ausrei-chend Sauerstoff für das Wachstumzu versorgen. Tumoren müssen des-halb in der Lage sein, Hormone frei-zusetzen, die das Einwachsen neuerBlutgefäße stimulieren, in der Spra-che der Forscher: Sie induzieren An-giogenese. Diese Hormone wirkenvor allem auf Endothelzellen, siesind die Pioniere der Gefäßbildung.Auch der Prozess, Blutgefäße wach-sen zu lassen, wird in Endothelzellenüber rezeptorvermittelte Signalkas-kaden in Gang gehalten. Axel Ullrichhat bereits vor einigen Jahren denRezeptor identifiziert, der diesenVorgang steuert.
DER THERAPIE
EINEN SCHRITT VORAUS
Auch daraus entwickelte sich eineTherapieidee: Nämlich Hemmstoffezu entwickeln, die Tumorwachstumbehindern sollen, indem sie die Wu-cherungen von der Blutversorgungabschneiden. Aus Ullrichs Arbeitensind zwei so genannte Anti-Angio-genese-Substanzen hervorgegangen,die nach Tierversuchen derzeit imvon Ullrich mitgegründeten US-Un-ternehmen Sugen in mehreren Studi-en gegen verschiedene Krebsartenerprobt werden. Allerdings geht derMartinsrieder Wissenschaftler nichtdavon aus, dass die Anti-Angioge-nese zum Allheilmittel gegen Krebswerden kann. „Wir können einenTumor auf diese Weise nicht ganzzerstören“, sagt er. Das Abschneidenvon der Blutversorgung lasse imgünstigsten Fall den Tumor auf eineGröße schrumpfen, in der er auchohne eigene Blutversorgung überle-ben kann, aber es eliminiere ihnnicht völlig. Und man müsse sichSorgen machen, dass ein kleiner Restdann Wege findet, um auch dieseTherapie zu umgehen.
Wegen ihrer Wandlungsfähigkeitsind Tumoren den herkömmlichenTherapien oft einen Schritt voraus.Therapien töten immer nur den Teil
FASZINATION Forschung
Im Labor züchtet das Team von Prof. Axel Ullrich Krebszellen auf einer Sicherheitswerkbank.

66 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
WISSEN aus erster Hand
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 67
Stammzellen: Stammkapitaleiner neuen Medizin?
ZELLbiologie
Zu Beginn ein Zitat aus einem Beitrag, den Bundeskanzler
Schröder vor kurzem für die SÜD-DEUTSCHE ZEITUNG verfasst hat. Unterdem Titel „Erst kommt das Wissen“war dort zu lesen: „Die Entschlüsse-lung des menschlichen Genoms unddie Legalisierung des therapeuti-schen Klonens in Großbritannien ha-ben uns drastisch vor Augen geführt,dass Gentechnik keine Utopie mehr
ist sondern Teil unserer Gegenwart.Unsere Gesellschaft hat sich bislangeiner redlichen Diskussion der Chan-cen und Risiken gentechnischer Ver-fahren nicht gestellt. Denn die damitzusammenhängenden Fragen rührenans Innerste unseres Selbstverständ-nisses. Wir haben hier über Dinge zuentscheiden, die sich im Kraftfeldzwischen Denkbarkeit und Machbar-keit, Verantwortbarkeit und Verant-
Am 15. Februar dieses Jahres tagte der Wissenschaftliche Rat der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin.
Auf dem Programm dieser Sitzung standen auch zwei Referate zum Thema Stammzellen und therapeutisches
Klonen. Zunächst bot PROF. PETER GRUSS, Direktor am Göttinger MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR
BIOPHYSIKALISCHE CHEMIE, einen Überblick über den Stand der Forschung und den möglichen Einsatz
von Stammzellen in einer künftigen „regenerativen Medizin“. Den zweiten Vortrag hielt Prof. Rüdiger Wolfrum,
Direktor am Heidelberger Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht: Hier
ging es um die gesetzlichen Grundlagen und Schranken der wissenschaftlichen Arbeit mit Stammzellen und
deren therapeutischer Nutzung. Der nachfolgende Beitrag stellt eine gekürzte Fassung des Referats von
Prof. Gruss dar. Im nächsten Heft der MAXPLANCKFORSCHUNG wird der Vortrag von Prof. Wolfrum zu lesen sein.
zu tun: Zum einen mit der Prolifera-tion dieser Zellen, bei der gleichar-tige, undifferenzierte Tochterzellenentstehen, und zum anderen mit demProzess der Differenzierung, bei deraus einer Stammzelle eine Zelle mitvöllig anderen, neuen Eigenschaftenhervorgeht.
Zunächst zu dem aus heutigerSicht erkennbaren Therapiepotenzial,das in Stammzellen steckt. JederMensch, und das ist kein revolu-tionäres Statement, stammt aus einer
wortlichkeit nicht zuletzt gegenüberkommenden Generationen bewe-gen.“
An späterer Stelle taucht der Be-griff „Teilhabe“ auf – und das bedeu-tet zunächst Selbstbestimmung undMitbestimmen. Das aber setzt Mit-wissen voraus – und darauf kommtes an: Nur eine Gesellschaft, die Be-scheid weiß, kann über derart schwerwiegende Zukunftsfragen befinden.
In diesem Sinne möchte ich hier diewissenschaftlichen Aspekte des The-mas „Stammzellen“ erläutern – inder Hoffnung, damit zu einer feste-ren Grundlage für die zukünftigeDiskussion in der Öffentlichkeit bei-zutragen.
Was sind Stammzellen? EinigeForscher haben auf diese Frage ein-mal überspitzt geantwortet und ge-sagt, man könnte auf Stammzellen
ein „Unschärfeprinzip“ anwenden,weil sie eigentlich nur durch ihreFunktion zu definieren und entdeck-bar sind. Grundsätzlich versteht manunter einer Stammzelle jede undiffe-renzierte Zelle eines Organismus, diesich selbst vermehren, aber auch rei-fere Tochterzellen hervorbringenkann.
Das heißt, man hat es mit zweiProzessen, mit zwei Zellfunktionen,
Beim therapeutischen Klonen überführt man den Kern etwa einer Hautzelle (1) in eine entkernte Eizelle (2 und 3),die sich dann zu teilen beginnt und einen Klon bildet (4). Es entsteht eine embryonale Blastozyste (5). Aus dieser Blastozyste gewinnt man in Gewebekultur bestimmte Zell-typen, etwa Muskel- oder Nervenzellen (6), die dann in den Körper des Patienten implantiert werden.
einzigen Zelle ab, aus der befruchte-ten Eizelle. Das heißt, dass das be-fruchtete Ei eine totipotente – eine„zu allem fähige“ – Zelle verkörpert.Und diese ursprüngliche Totipotenzbleibt in den Frühstadien der Säuger-entwicklung bis zum Acht-Zellen-Stadium erhalten, ehe sie dann mehrund mehr eingeschränkt wird.
Bis zum Acht-Zellen-Stadium desSäuger-Embryos könnte aus jedereinzelnen Zelle faktisch ein vollstän-diger Organismus hervorgehen. ImZug der weiteren Embryonalent-wicklung, während der so genanntenPräimplantations-Phase im Eileiter,lagern sich die Außenzellen dichtzusammen, und es bildet sich – alsdas letzte Stadium der Präimplanta-tion – eine so genannte Blastozyste.An einer Stelle dieser Blastozyste lagert sich ein Verband von zehn
Mitbestimmen setzt Mit-wissen voraus, so Prof.Peter Gruss in seinemReferat über Stammzel-len und therapeutischesKlonen: „Nur eine Ge-sellschaft, die Bescheidweiß, kann über derartschwer wiegende Zu-kunftsfragen befinden.“
FOTO
S: W
OLF
GAN
GFI
LSER
, G
RAFI
K: M
PI F
ÜR
BIO
PHYS
IKAL
ISCH
ECH
EMIE

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 69
system diese Zellen nicht angreiftund abstößt, da es durch die Blut-Hirn-Schranke praktisch „ausge-sperrt“ ist. Man könnte also Implan-tate aus jeder beliebigen Zell-Linieverwenden.
Anders allerdings, wenn man anden Ersatz von Organen und Gewe-ben außerhalb des zentralen Nerven-systems denkt: Dann kommt es zuImmunreaktionen, und man mussdie Abstoßung unterdrücken.
THERAPIE NACH
DEM „SCHEMA DOLLY“
Das therapeutische Klonen bötehier neue Wege. Es funktioniertzunächst wie bei Dolly: Man nimmtzum Beispiel eine Hautzelle undüberführt deren Kern in eine ent-kernte Eizelle. Diese Zelle beginntsich zu teilen und wächst zu einerBlastozyste, die man in Gewebekul-tur nimmt. Die Blastozyste wirddann aber nicht reimplantiert, son-dern in Gewebekultur dazu gebracht,bestimmte Zelltypen, also etwa Mus-kel- oder Nervenzellen, herzustellen.Und bei solchen, durch therapeuti-sches Klonieren gewonnenen Zellensind keine Abstoßungsreaktionen zuerwarten.
Wie lassen sich nun somatischeStammzellen – die ethisch weniger„belastet“ sind – einsetzen? Ein Bei-spiel bietet die Bauchspeicheldrüse,die auch für unser Labor von wis-senschaftlichem Interesse ist. DieBauchspeicheldrüse besteht zum ei-nen aus so genannten exokrinenZellen, die Enzyme produzieren, die
als „Magensäfte“ unsere Nahrungabbauen. Zum anderen birgt sie zweiZelltypen, die in den „Langerhans’-schen Inseln“ zu finden sind: die Be-ta-Zellen, die Insulin produzieren,und die Alpha-Zellen, die Glukagonerzeugen.
Wie man weiß, leiden etwa fünfProzent der Weltbevölkerung an Dia-betes, und diese Zahl steigt. Könn-te es gelingen, die körpereigenenStammzellen dazu zu bringen, neueInselzellen zu produzieren? Und:Gibt es im Pankreaskörper eigeneStammzellen? Die Antwort lautet„Ja“. Doch somatische Stammzellensind immer irgendwo in Nischenversteckt, in denen sie mit den um-liegenden Geweben und Faktoren inWechselwirkung treten. Das machtes schwer, somatische Stammzellenaufzuspüren und in den Griff zu be-kommen. Immerhin ist es uns abergeglückt, mithilfe bestimmter Ent-wicklungs-Kontrollgene Insulin pro-duzierende Zellen zu erzeugen. Wirstehen damit am Anfang einer Ent-wicklung, die vielleicht in eine The-rapie mündet: In die Möglichkeit, ge-zielt körpereigene Stammzellen aus-differenzieren zu lassen und darausentweder Insulin produzierende Be-ta-Zellen oder Glukagon produzie-rende Alpha-Zellen zu erhalten.
Parallel dazu ist es anderen Grup-pen gelungen, aus embryonalenStammzellen in Gewebekultur Insu-lin produzierende Zellen zu gewin-nen. Man kann sich also vorstellen,auf diesem Weg zu einer maßge-schneiderten Therapie von Diabetes
ZELLbiologie
68 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Zellen an, die innere Zellmasse –und aus diesen zehn Zellen ent-wickelt sich im Weiteren der voll-ständige Organismus eines Säugers.
Diese Zellen der inneren Zellmassebezeichnet man als embryonaleStammzellen: Sie können in vitro (inGewebekultur) praktisch unbegrenztvermehrt werden, vorausgesetzt,dass keine Differenzierung stattfin-det. Und darin unterscheiden sichdiese Zellen von den anderen, den sogenannten somatischen Stammzel-len: Man hat Faktoren entdeckt, dieihre Differenzierung in vitro verhin-dern. Setzt man diese Substanzendem Nährmedium zu und verhindertso die Ausdifferenzierung der Zellen,bleibt deren Pluripotenz erhalten.
Der frühe Embryo bietet noch einezweite Möglichkeit, mehr oder weni-ger pluripotente Stammzellen zu ge-winnen, und zwar die so genanntenprimordialen Keimzellen. Diese Zel-len sind weniger pluripotent als dieembryonalen Stammzellen; zu ihnenist hier nur zu bemerken, dass dieGesetzgebung in Deutschland gestat-tet, primordiale Keimzellen herzu-stellen, während die Produktion em-bryonaler Stammzellen untersagt ist.
Ein weiterer Weg, zu frühenStammzellen zu kommen, wurde anDolly aufgezeigt – dem wohl be-rühmtesten Schaf der Welt. Und die-ses Verfahren dokumentiert auch dasPrinzip des therapeutischen Klonens.Der Klon Dolly wurde erzeugt, indemman zunächst Eizellen eines Mutter-schafs entnahm und entkernte. Dasheißt, man hatte nur noch das Ei-plasma. Dann wurde aus Körperzel-len – in dem Fall aus Eutergewebe –jeweils der Kern entnommen und indie entkernten Eizellen eingeführt.Diese veränderten Eizellen ent-wickelten sich in vitro jeweils zu ei-ner Art frühem Embryo. Ein solcherEmbryo, einem Mutterschaf implan-tiert, lieferte schließlich das SchafDolly.
Das wissenschaftlich Revolutionä-re an Dolly ist der Nachweis, dass
das Zytoplasma der Eizelle den Kerneiner Körperzelle so umzuprogram-mieren vermag, dass dieser ZellkernTotipotenz erhält.
Damit zu den Stammzellen des er-wachsenen Körpers, zu den somati-schen Stammzellen. Im Organismusdes Menschen müssen permanentGewebe erneuert und Zellen ersetztwerden. Die Haut beispielsweise wirdalle vierzehn Tage einmal „runder-neuert“ – was nach einem Sonnen-brand durchaus hilfreich ist. Im Blutwerden innerhalb von vierundzwan-zig Stunden mehrere Milliarden Zel-len durch neue ersetzt. Wer einmaleinen Beinbruch hatte, der weiß, dassder Muskel degeneriert, doch danachwieder aufgebaut wird.
Weniger bekannt sind andere Phä-nomene, wie etwa die Möglichkeit,die Bauchspeicheldrüse teilweise zuregenerieren, oder die Tatsache, dassaus Stammzellen im Gehirn auch beiErwachsenen neue Nervenzellen ge-bildet werden.
GEWEBEERSATZ STATT
ORGANTRANSPLANTATION
Worin liegt der Unterschied zwi-schen embryonalen und somatischenStammzellen? Die embryonalenStammzellen besitzen eine Totipo-tenz oder Omnipotenz, die im Ver-lauf der weiteren Entwicklung einge-schränkt wird – zu einer Pluripotenzoder Multipotenz bei somatischenStammzellen, deren Funktion darinbesteht, bestimmte Gewebe, denensie angehören, zu regenerieren.
Wie kommt man auf diesenGrundlagen zu einer Therapie, undwas kann diese Therapie leisten?Weltweit stehen für Organtransplan-tationen zu wenig Spender zur Ver-fügung. Diesem Mangel ließe sichmit Gewebeersatz-Therapien abhel-fen, mit einer – lassen Sie mich dieseUtopie so nennen – „regenerativenMedizin“. Ein Beispiel dafür bietetMorbus Parkinson, eine Krankheit,an der fast ein Fünftel der Bevölke-rung über 60 Jahre leidet. Diese
Krankheit äußert sich zunächst in einer verlangsamten Motorik sowiein Ruhetremor, und im Weiteren ver-liert man die Fähigkeit, sich spontanund willentlich zu bewegen. Die Ur-sache liegt in einer fortschreitendenDegeneration bestimmter Nervenzel-len im Gehirn, die den BotenstoffDopamin produzieren, der für dieÜbertragung von Nervensignalenwichtig ist. Der Schwund dieser Zel-len lässt sich anfangs einigermaßenausgleichen, indem man eine Vor-läufersubstanz des Dopamins als Me-dikament verabreicht. Doch im wei-teren Verlauf des Leidens greift dieseTherapie nicht mehr.
Eine schwedische Gruppe hat Ge-webe aus den Gehirnen abgetriebe-ner Föten in das Gehirn eines Par-kinson-Patienten transplantiert. Unddiese Behandlung brachte Erfolg:Noch zehn Jahre nach der Übertra-gung produzierten die verpflanztenGewebe Dopamin.
Grundsätzlich ist embryonales Ma-terial also in der Lage, defekte Gewe-be zu ersetzen. Doch die ethische Be-wertung einer solchen Therapie istungeklärt – und deshalb sind Alter-nativen gefragt, die natürlich auchdiskutiert werden müssen.
Dazu gehören die embryonalenStammzellen, die alle Zellen des Kör-pers hervorbringen können. Wir ha-ben im Labor mit embryonalenStammzellen der Maus experimen-tiert und diese zu Muskel- oder Ner-venzellen ausdifferenzieren lassen.Und es gibt Substanzen, mit denenman aus embryonalen Stammzellengezielt Dopamin produzierende Ner-venzellen gewinnen kann. Diese Zel-len, das zeigten Tierversuche, kön-nen zur Therapie von Morbus Par-kinson eingesetzt werden. Das heißt,man könnte über embryonale Stamm-zellen zu „dopaminergen Neuronen“kommen und diese dann Parkinson-Kranken implantieren.
Dabei bietet die Verwendung vonembryonalen Stammzellen im Ge-hirn den Vorteil, dass das Immun-
WISSEN aus erster Hand
Oben: Das Klon-Schaf Dolly entstand aus ent-kernten Eizellen eines Mutterschafs, in die Ker-ne aus Euterzellen eingeführt wurden. Diese Eizellen entwickelten sich in vitro zu frühenEmbryonen – von denen einer, dem Mutterschafimplantiert, schließlich das Schaf Dolly lieferte.Unten: Die Entwicklung einer befruchteten Eizelle über Zweizeller, Vierzeller und Achtzellerzur Morula, dem „Maulbeerkeim“, und schließ-lich zur Blastozyste mit der (oben rechts) inneren Zellmasse – dem potenziellen Reservoirvon embryonalen Stammzellen.

70 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
des Typs I zu kommen – vorausge-setzt, dass es gelingt, die Inselzellenzu „verkapseln“ und so gegen dieAutoaggression seitens des Immun-systems (die häufigste Ursache vonDiabetes-Typ I) abzuschirmen.
Auch beim Diabetes-Typ II – so-fern ein solcher Patient Insulingabenbenötigt – ließe sich mittels verkap-selter Inselzellen helfen. Doch eine„elegantere“ und wissenschaftlichpräzisere Therapie bestünde darin,somatische Stammzellen der Bauch-speicheldrüse über Entwicklungs-Kontrollgene zur Differenzierungund endogenen Produktion neuer Inselzellen anzuregen. Dazu habenTierexperimente bereits viel verspre-chende Ergebnisse gebracht.
Das Ziel wäre, aus somatischenStammzellen nicht nur die Zellenhervorzubringen, für deren Produkti-on sie ursprünglich vorgesehen sind,sondern ihnen – über so genannteTransdifferenzierung und Dediffe-renzierung – eine größere Plastizitätzu verleihen. Dann ließe sich auskörpereigenen Stammzellen tatsäch-lich eine Vielzahl verschiedenartigerGewebe gewinnen. Das ist im Prinzipmachbar, experimentell indessenäußerst schwierig und aufwändig.Diesen Weg praktisch gangbar zumachen, wird einen ungemein hohenForschungsaufwand erfordern.
Anschließend noch ein Vergleichder verschiedenen Verfahren der
Stammzell-Therapie (siehe da-zu auch die Tabelle links). So-matische Stammzellen besitzennaturgemäß nur ein begrenztesDifferenzierungs-Potenzial.Und sie sind in vitro nurschwer zu kultivieren: Mankennt noch keine Faktoren, mitdenen sich ihre Differenzierungunterbinden ließe, sie verlierenin Kultur also ihren Stamm-zell-Charakter. Ihre gerichteteDifferenzierung für therapeuti-sche Zwecke erfordert ein de-tailliertes Verständnis der ein-schlägigen „Schaltprozesse“ –
von dem man noch weit entfernt ist.Studien zur Dedifferenzierung soma-tischer Zellen, also ihrer Rückver-wandlung in Zellen mit breiteremEntwicklungspotenzial, stehen erstam Anfang.
Daneben steht die pragmatischeAlternative, embryonale Stammzel-len zu verwenden. Diese Zellen sindpluripotent, und man kennt eineganze Reihe von Methoden, sie inGewebekulturen zu einer gerichtetenDifferenzierung zu bringen. Somati-sche Stammzellen und therapeuti-sche Klonierung sind immunologischneutral, embryonale Stammzellenhingegen provozieren Immunreak-tionen.
Somatische Stammzellen müsstenindividuell hergestellt werden, em-bryonale Stammzellen wären gene-rell verfügbar – und theoretisch wür-de eine einzige Stammzell-Linie, alsoein „geopferter Embryo“, ausreichen,Wissenschaft und Medizin auf unbe-grenzte Zeit mit embryonalenStammzellen zu versorgen.
Auch therapeutisches Klonen er-fordert die individuelle Herstellungvon Zellen. Und hier ist, wie auchbei somatischen Stammzellen, dasProblem der Reparatur eventuellerGendefekte noch nicht gelöst – dassich bei embryonalen Stammzellennicht stellt.
Noch nicht ausgelotet ist auch dasRisiko von Krebs. Geht man von em-
PROF. PETER GRUSS, geboren 1949, ist Direktor der AbteilungMolekulare Zellbiologieam Max-Planck-Institutfür biophysikalischeChemie in Göttingen.
Sein Forschungsgebiet, die Entwicklungsbio-logie der Säuger, lässt sich mit einer Frageumreißen: Welche Gene und Mechanismensteuern die zeitliche und räumliche „Cho-reographie“, nach der aus einer einzelnen,befruchteten Eizelle am Ende ein vielzelligerOrganismus mit allen seinen unterschied-lichen Geweben und Organen hervorgeht?
WISSEN aus erster Hand
bryonalen Stammzellen aus undtrennt diese nicht sauber von dendifferenzierten Zellen, kann das zuTumoren führen, die zwar im Prinzipgutartig sind, aber aus zahlreichenunterschiedlichen Subzelltypen be-stehen.
VERANTWORTBARKEIT
ALS VORAUSSETZUNG
So weit der grobe Überblick zumThema Stammzell-Therapie aus wis-senschaftlicher Sicht, ihren Möglich-keiten und ihren „handwerklichen“Problemen. Die ethischen Fragen, die diese Techniken aufwerfen, kannund wird die Wissenschaft nicht al-lein beantworten. In die Entschei-dung darüber, ob und inwieweit mandiese Möglichkeiten nutzen soll oderdarf, muss die Gesellschaft alsGanzes eingebunden werden. Dabeimüssen moralische, ethische undrechtliche Aspekte noch vor allenrein technischen oder finanziellenÜberlegungen rangieren. Denn dasgilt für die moderne Biologie undMedizin strenger als für jede andereWissenschaft: Machbarkeit muss injeden Fall auf Verantwortbarkeitgründen.
Oder anders gesagt: Der Eid desHippokrates, einst auf den individu-ellen Menschen – den einzelnen Pa-tienten – gemünzt, muss heute aufdas Wohl einer Gemeinschaft – dermenschlichen Gesellschaft – ausge-dehnt werden. �
STAMMZELLTHERAPIE: VERGLEICHENDE ASPEKTE
Eigenschaften
Probleme
Ressource
EthischerAspekt
SOMATISCHE EMBRYONALE THERAPEUTISCHESSTAMMZELLEN STAMMZELLEN KLONIEREN
multipotent
keine Immun-barriereIndividuelleHerstellungReparatur mögl.Gendefekte nötig
Identifizierung
Isolierung, Kultivierung
Zugänglichkeitzur Therapie
eigener Körper
pluripotent
Immunreaktion
generelleVerfügbarkeit
Krebsrisiko
Zellkultur
menschl. Embryowird einmalig„verbraucht“
totipotent
keine Immun-barriereIndividuelleHerstellungReparatur mögl.Gendefekte nötig
Krebsrisiko
eigener Körper+ fremde Eizellemenschl. Embryo wird generiert und„verbraucht“

„Wir können selbst unsere besten Leute nicht halten“
72 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
KONGRESSbericht
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 73
NACHWUCHSförderung
MPF: Was wurde versäumt in den vergangenen Jahren, warum studieren so wenige junge Leute Physik?
PROF. JULIUS WESS: Ein Grund ist, dass die Grundla-genforschung und auch die Physik gesellschaftlich ver-teufelt wurden. Viele Prominente betonen „Mathematikhabe ich nie verstanden aber seht, was aus mir gewordenist“. Damit wurde ein Klima geschaffen, in dem die Ak-zeptanz und die Begeisterung der Jugend unterlaufenwurde. Das ist aber ein internationales Phänomen undnicht auf den Westen beschränkt. Auch in den ehemali-gen Ostblockländern sind die Leute in die soft-scienceausgewichen, wo man mit weniger Aufwand vielleichtmehr verdienen oder ein größeres gesellschaftliches An-sehen erreichen kann. Die Politiker hätten die Pflicht ge-habt, dagegen zu steuern, aber Politiker folgen im Allge-meinen eher dem Trend, als dass sie Ziele setzen.
MPF: Ist das Physikstudium selbst zu unattraktivoder verdient man in der Wissenschaft zu wenig Geld?
WESS: Das Physikstudium ist schon sehr schwierig. Und dann gab es eine Phase, in derdie Industrie viele Leute entlassenund keinen Nachwuchs auf Vorrateingestellt hat. PROF. KLAUS SIBOLD: Wenn Siesehen, dass diplomierte oder promo-vierte Physiker keine Stelle finden,so wie Anfang bis Mitte der neunzi-ger Jahre, dann zögern Sie auch,junge Menschen für das Physik-Stu-dium zu werben.
MPF: Wann verlieren Sie IhrenNachwuchs hauptsächlich? Vor dem Studium, also schon inder Schule, oder erst nach dem Diplom an die Industrie?
WESS: In erster Linie nach dem Stu-dium. Wenn es um die Lebensent-scheidung geht. Ein Absolvent fragtsich: Kann ich es mir leisten, vonZweijahresstelle zu Zweijahresstellezu gehen und bis ich 40 bin diesenForschungsdruck auszuhalten? Oderversuche ich es in der Industrie, woich finanziell besser gestellt bin? Ge-rade auf unserem Gebiet, der theore-tischen Physik, habe ich bis zur Pro-motion kein Problem mit Nach-wuchswissenschaftlern. Doch dannkommen die entscheidenden Fra-gestellungen.
MPF: Was können die Wissenschaftler selbst tun, um die Attraktivität der Forschung zu erhöhen?
WESS: Mit unserem jährlichen Workshop in Bayrisch-zell führen wir die jungen Leute an die Grundlagenfor-schung heran. Wir konfrontieren sie mit der aktuellenSpitzenforschung. Und das funktioniert auch.SIBOLD: In Leipzig haben wir bereits jetzt wesentlichmehr Doktoranden als Diplomanden. Das heißt, wennman einigermaßen attraktive Forschung anbietet, machtsich das sofort bemerkbar. National, und wenn man dieMittel hat, auch international.
MPF: Der Workshop in Bayrischzell richtet sich ja speziell an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Wie funktioniert das Konzept?
WESS: Wir bringen Themen zusammen, die nebenein-ander liegen und sich teilweise überlappen. ProminenteWissenschaftler werden eingeladen – und eben die jun-gen Wissenschaftler. Und die Vortragenden werden gebe-ten, auf einem Niveau zu referieren, bei dem auch diejungen Leute mitdenken und mitdiskutieren können. Siebauen ihre Vorträge so auf, dass nicht alles bei allen vo-rausgesetzt wird. Das ist nicht nur wichtig, um den Nach-
wuchs einzubeziehen. Es ermöglichtauch den interdisziplinären Aus-tausch. So arbeiten wir an drei Tagensehr intensiv. Und durch die lockereund wenig offizielle Atmosphäre ler-nen wir uns auch persönlich kennen.Wir entdecken die Denkstrukturendes anderen und entwickeln ein ge-genseitiges Verständnis für die un-terschiedlichen Fragestellungen undHerangehensweisen.
MPF: Die Attraktivität der Forschung müssten Sie aber auchweiter nach unten ausstrahlen, damit wieder mehr Studenten
und Diplomanden zum Physik-Studium kommen.
SIBOLD: Das ist ein wirklich schwieriges Problem. Undes gibt tatsächlich ein paar hausgemachte Ungereimthei-ten, die sich im Laufe der Jahre eingeschlichen haben.Zum Beispiel die schlechte Ausbildung der Lehrer. Sehroft sind nicht die Qualifiziertesten in die Schulen gegan-gen, sondern eher die Unqualifiziertesten. Das muss manjetzt versuchen auszugleichen, beispielsweise durchLehrerfortbildung. Außerdem suchen wir Kontakte zuden Schulen. Das ist etwas, was im Osten recht gut ge-lingt. Hier werden schon die Schüler vertraut mit derUniversität, mit den Problemen, der Atmosphäre und mitdem Typ der Anforderungen. Aber auch hier müssten wirnoch viel mehr machen. WESS: Wir sind auch selber schuld, dass die Lehreraus-bildung nicht so optimal gelaufen ist. Diesen Schadenmüssen wir jetzt wieder gut machen.
MPF: Welche Gründe, außer den unsicheren befristeten Stellen, gibt es noch, warum der Nachwuchs der Wissenschaft den Rücken kehrt?
SIBOLD: Es ist nicht gerade einfach, von den Kursvor-lesungen im Studium den Übergang zur Forschung zu
Wie können grundlegende
theoretische Ansätze aus der
Quantenfeldtheorie, der String-
theorie und der Theorie der nicht kommu-
tativen Räume zusammengeführt werden?
Darum ging es vom 31. März bis zum 2. April
in Bayrischzell. Traditionell stand dieser
Frühjahrs-Workshop unter dem Motto
„Nachwuchs trifft sich mit Spitzenforschern“.
Organisiert haben ihn – wie schon seit fast
20 Jahren – PROF. JULIUS WESS vom
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR PHYSIK und
PROF. EBERHARD ZEIDLER vom MAX-
PLANCK-INSTITUT FÜR MATHEMATIK IN
DEN NATURWISSENSCHAFTEN. Die beiden
Max-Planck-Direktoren wollen damit junge
Wissenschaftler in die Spitzenforschung ein-
beziehen. Dabei sind sie ebenso engagiert wie
der Leipziger Universitätsprofessor KLAUS
SIBOLD, der gemeinsam mit Zeidler die so
genannte mitteldeutsche „Physik-Combo“ ins
Leben gerufen hat; in ihr werden Studenten
aus Halle, Leipzig und Jena zusammengefasst
und hören vom sechsten
Semester an gemeinsam
Spezialvorlesungen. MAX-
PLANCKFORSCHUNG sprach mit
Sibold und Wess über aktuelle
Probleme der Nachwuchs-
förderung in der Physik.
Prof. Julius Wess
Prof. Klaus Sibold
FOTO
S: W
OLF
GAN
GFI
LSER

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 75
wenn man den Leuten mit 40 sagen muss: Daswar’s jetzt, ihr habt brav gearbeitet, aber wirkönnen nichts mehr für euch tun.
MPF: Hat das Jahr der Physik geholfen, Studenten zu werben?
SIBOLD: In Zahlen kann man das nicht unmit-telbar ausdrücken. Aber ich habe das Gefühl,dass sich die Stimmung durchaus verbessert hat.WESS: Es wird überall gesagt, dass es was ge-holfen hat. (lacht)
MPF: Das klingt nicht so überzeugt?
SIBOLD: Was wirklich hilft, ist, dass jetzt wiederPhysiker von der Industrie gesucht werden.
MPF: Und die gehen Ihnen für die Wissenschaft verloren.
SIBOLD: Das ist der Punkt. Wir können im Au-genblick selbst unsere besten Leute nicht halten.Die gehen zu Banken, Versicherungen und Un-ternehmensberatungen. Und das ist ein echtesProblem. WESS: Und wir tun uns schwer damit, den Leu-ten zuzureden, es bleiben zu lassen. Denn dieKarriere als Wissenschaftler ist im Augenblickso unsicher, dass man es niemandem zumutenmag. Es ist ja gut, dass die Leute auch in andereBereiche gehen. Solange gesichert ist, dass diesehr guten Leute auch an der Universität oder inanderen Forschungsinstituten und in der Aus-bildung bleiben. Und da ist es momentan kri-tisch. Wenn das Niveau an den Universitätenerst einmal zurückgeht, ist das ein Trend, dersehr schwer umzudrehen ist.
MPF: Sehen Sie diesen Trend schon?
SIBOLD: Den gibt es immer und überall. Aber inLeipzig sind gerade beim Aufbau des MPI fürMathematik in den Naturwissenschaften sehrviele junge Leute mit Spitzenfunktionen betrautworden. Wir hoffen, dass wir in der nächstenZeit so attraktiv sein werden, dass wir diese Leu-te auch halten können.WESS: Diesbezüglich sehe ich ein neues Pro-blem auf uns zukommen. In der Öffentlichkeitwird gefordert, dass wir Wissenschaftler ausdem Ausland anwerben sollen. Ich befürchte,dass wir es dabei versäumen werden, unsere ei-genen Spitzenkräfte zu halten. Und ich bin nichtsicher, dass wir beispielsweise aus den USA stetsdie absolute Spitze bekommen.
DAS INTERVIEW FÜHRTE INA HELMS
74 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
schaffen. Gerade hierfür sind solche Veranstaltungen wieder Workshop in Bayrischzell unglaublich wichtig.
MPF: Warum ist das so schwierig?
WESS: In den letzten Jahren sind große Fortschritte in der Forschung gemacht worden, und damit ist dieSpezialisierung weiter vorangeschritten. Das kann nichtso schnell ins Grundlagenstudium eingearbeitet werden.Bevor Physiker ein Thema als Doktorarbeit erfolgreichbearbeiten können, müssen sie zu dem, was sie in derUniversität, in den Vorlesungen gehört haben, noch sehrviel dazulernen. Das funktioniert zwar innerhalb einesInstituts, wo man Seminare anbieten kann. Aber esgehört auch die Konfrontation mit anderen Wissen-schaftlern von außerhalb unbedingt dazu.SIBOLD: Das war auch eine unserer Hauptideen, die zurGründung der „Leipzig-Halle-Jena-Combo“ geführt hat.Studenten der drei Universitäten hören ab dem sechstenoder siebten Semester gemeinsam Spezialvorlesungen.Die Veranstaltungen finden an drei Wochenenden im Se-mester mit jeweils drei Vortragenden statt. Damit wirdgewährleistet, dass die Studenten in der eben angespro-chenen schwierigen Spezialisierungsphase über den Tel-lerrand hinausblicken und auch sehen, was an den Nach-bar-Unis gemacht wird. In der Phase der Spezialisierungzum Diplom und zur Promotion möchten wir damit einmöglichst breites Themenspektrum und möglichst vieleAnregungen anbieten. Eine Universität alleine könntedas nicht leisten.
MPF: Glauben Sie, dass die Schaffung von Juniorprofessuren und die Abschaffung der Habilitation geeignete Mittel sind, um junge Wissenschaftler zu fördern?
WESS: Zum Thema Habilitation gibt es so viele Meinun-gen wie es Professoren oder Habilitanden gibt. Nur durchdie Abschaffung werden junge Wissenschaftler nochlange nicht selbstständiger. Und dieJuniorprofessur mit einem Anstel-lungsmodus von fünf Jahren ist eineKatastrophe. Die Leute haben fünfJahre ihres Lebens oder noch mehrin eine hohe Spezialisierung inves-tiert und dann sagt man ihnen, jetztmach’ was anderes. Für normale An-forderungen sind sie dann zu spezia-lisiert.
MPF: Das sind sie aber auch,wenn sie von einer befristeten Assistentenstelle in die nächstewechseln.
WESS: Ja, man muss den Leuten eine Zukunftsperspektive bieten, die
nicht nur eine Entschei-dung zwischen allesoder nichts zulässt.SIBOLD: Abzusehen istauch, dass diese Junior-professuren nicht zu-sätzlich geschaffen wer-den. Wir bekommenkein größeres Budgetund nicht mehr Plan-stellen. Sie werden ab-gezogen von den Pro-fessuren, die wir schonhaben. Ein Juniorpro-fessor wird eingestelltin Hinblick auf die Pensionierung eines „Seminar“-Pro-fessors. Was wir eigentlich brauchen, ist ein Programm,mit dem tatsächlich mehr junge Leute früher als bishereingestellt werden, aber auf Dauer. Und nicht mit derUnsicherheit, dass sie danach gehen müssen. Wir brau-chen Möglichkeiten, diese Leute zu halten. Also im End-effekt mehr Stellen.WESS: Stellen, die nicht erst mit der C3-Professur an-fangen, das wäre zu teuer. Aber Stellen, von denen dieLeute leben können.SIBOLD: Früher gab es zum Beispiel den AkademischenRat. Der hatte eine Dauerstelle. Ein solcher Mitarbeiter hatsehr viel Lehre gemacht oder sich um die experimentelleAusstattung gekümmert. Diese Stellen wurden beseitigtmit Argumenten, die ich nie verstanden habe. Dabei wa-ren sie sehr vernünftig auch als Parkstellen für junge Leu-te, die eben noch keine Professur bekommen konnten,aber wenigstens die Sicherheit einer Dauerstelle. Mit demRisiko, dass die Industrie gute Leute wegkauft.
MPF: Erscheinen die Fragestellungen in der theoretischen Physik heute vielleicht auch zu realitätsfern, um attraktiv zu sein?
WESS: Das glaube ich nicht. Ich be-obachte eher einen großen Kampfbei Leuten, die sich Hoffnung auf ei-ne Wissenschaftlerkarriere gemachthaben und dann an dem Punkt ste-hen, wo sie in die Industrie gehenund etwas anderes tun müssen. Diemeisten würden viel lieber in derGrundlagenforschung bleiben. Na-türlich gibt es auch Leute, die nichtqualifiziert genug sind. Dies im jun-gen Alter festzustellen ist sehrschwer. Es kann jemand sehr gutsein. Trotzdem kann er vielleichtkein führender Wissenschaftler wer-den, der eine neue Linie verfolgt. DerPunkt, dies festzustellen, muss früherkommen. Es ist ein Verbrechen,
KONGRESSbericht
Prof. Klaus Sibold
Prof. Julius Wess

76 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
KONGRESSbericht
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 77
Heißes Leben imVerborgenen
MIKROorganismen
Zellkernlose Mikroorganismen,die Bacteria und Archaea, sind
mit dem bloßen Auge nicht sichtbarund können sowohl an Vulkanen beiTemperaturen von mehr als 100 GradCelsius als auch in kilometerdickenEisschichten der Antarktis leben.„Allenfalls Schlagzeilen über neueKillerbakterien oder Fäkalkeime imMünchner Bier oder in Badeseenrücken sie ins Zentrum des öffent-lichen Interesses”, sagte Prof. Karl-Heinz Schleifer von der TechnischenUniversität München in seinemEröffnungsvortrag. Kaum jemandkäme darauf, dass diese Lebewesenmehr als die Hälfte der auf der Erdevorkommenden Biomasse ausma-chen, unentbehrlich zur Herstellungvieler Therapeutika, Medikamenteund Genussmittel sind und bereitsvor mehr als 3,5 Milliarden Jahrenauf der Erde gelebt haben. Selbst dergesunde menschliche Körper ist vollvon ihnen: Zehn bis hundert Malmehr Bakterien als eigene Zellenträgt jeder Mensch Tag für Tag mitsich herum.
Zellkernlose Mikroorganismen(Prokaryoten) gibt es überall dort, wodie physikalischen und chemischenGegebenheiten prinzipiell die Exis-tenz von Leben erlauben. Umgebenvon riesigen Drücken, absoluter Dun-kelheit und auch mal ohne Sauerstoff– in jeder dem Menschen noch so le-bensfeindlich erscheinenden ökologi-schen Nische tummeln sie sich. Vielesim Reich der Prokaryoten liegt je-doch noch im Dunkeln, da Bakterienund Archaeen nicht anzusehen ist,
wer sie sind, woher sie kommen oderwie sie leben. Mehr als 99 Prozent aller in der Umwelt vermuteten Bak-terien wurden bisher noch nicht imLabor gezüchtet. Das wäre jedochnotwendig, um sie ausgiebig unter-suchen zu können. Ein Grund fürdiese Schwierigkeiten: Mikroorganis-men leben in der Natur oft in engerKooperation mit anderen Arten undbenötigen Wachstumsbedingungen,die im Detail noch nicht verstandensind. „Wir haben momentan höchs-tens ein Prozent aller existierendenBakterienarten erfasst”, sagte PD Dr. Rudolf Amann vom Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobio-logie. Zum Vergleich: Von den Höhe-ren Pflanzen sind bereits mehr als 80, bei Wirbeltieren mehr als 90 Pro-zent beschrieben.
DEN LEBENDEN FOSSILIEN
AUF DER SPUR
In den vergangenen Jahren habenmolekularbiologische Methoden da-zu beigetragen, mehr über die großeVielfalt der Mikroorganismen he-rauszufinden. „Eine Schlüsselstel-lung nimmt dabei die vergleichendeAnalyse der ribosomalen Ribonukle-insäuren, kurz rRNA, und ihrer Geneein”, so Amann. Mit molekularbiolo-gischen Tricks können Wissenschaft-ler diese als genetische Fingerab-drücke aus den meisten Lebensräu-men gewinnen und Mikroorganis-men identifizieren, ohne sie vorherzüchten zu müssen. Ein Beispieldafür ist ein Konsortium aus Bakteri-en und Archaeen, das ohne Sauer-
„Unendlich groß ist die Rolle des unend-
lich Kleinen in der Natur”, schrieb der
französische Mikrobiologe Louis Pasteur
bereits vor mehr als hundert Jahren.
Daran hat sich bis heute nicht viel
geändert. „Die Bedeutung der Mikro-
organismen für die Umwelt” hieß das
Symposium, zu dem die Kommission für
Ökologie der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften am 30. April nach Mün-
chen eingeladen hat.
stoff mit Sulfat als OxidationsmittelMethan oxidiert. „Lebende Fossilien”nennt Dr. Wolfgang Ludwig von derTechnischen Universität Münchendie rRNA-Moleküle beziehungsweiseihre Gene heutiger Lebewesen.
„rRNA-Gene wurden im Laufe derEvolution der Organismen nur in ei-nigen Stellen, den variablen Berei-chen, verändert. Andere Stellen sindseit sehr langer Zeit gar nicht modi-fiziert worden”, erläuterte der Wis-senschaftler. Somit codieren dieseGene in den wenig von Veränderun-gen betroffenen Bereichen Informa-tionen zu früheren, länger zurücklie-genden evolutionären Ereignissen.Die variablen Bereiche tragen dage-gen Informationen zum späterenevolutionären Geschehen. Mithilfebestimmter Software-Werkzeuge undSequenz-Datenbanken können For-scher der stammesgeschichtlichenEntwicklung der Mikroorganismenauf die Spur kommen.
Inmitten von Vulkanausbrüchen,giftigen Schwefelschwaden, Blitzenund heißer Lava entwickelten sichmöglicherweise vor mehr als 3,5
Nördlich von Island lebt in hundert Meter Tiefe Ignicoccus islandicus. Das Archaebakterium wächst mit elementarem Schwefel und Wasserstoff zur Energiegewinnung und produziert Schwefelwasserstoff.
FOTO
S: R
EIN
HAR
DRA
CHEL
, UN
IVER
SITÄ
TRE
GEN
SBU
RG
Rauch auf dem Meeresgrund: Ein„Black-Smoker“, wie er zum Beispiel auf dem MittelatlantischenRücken zwischen Europaund Amerika in einerTiefe von etwa 3600Metern anzutreffen ist.
Pyrolobus fumarii heißt der derzeitige „Temperatur-Weltrekordler“ unter den Mikroorganismen; sein Temperaturmaximum beträgt 113°C, sein Minimum liegt bei 90°C. Das Bild ganz rechts zeigt die Rekonstruktion des Oberflächenreliefs der Zelle. Das Archaebakterium Pyrodictium abyssi
sowie das extrazelluläre Netzwerk aus langen Eiweißröhren, das die Zellen in eingroßes Netz einbindet.

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 79
zum Beispiel das Gas Kohlendioxid.Im globalen Kohlenstoff-Kreislaufwird anorganisch gebundener Koh-lenstoff in Biomasse umgewandeltund diese vorwiegend durch Bakteri-en wieder zu Kohlendioxid abgebaut.Sulfat reduzierende Bakterien setzenin Meeressedimenten rund die Hälfteder verwertbaren Biomasse in Koh-lendioxid um. „Die biochemischenLeistungen von Bakterien beeinflus-sen somit global wichtige biogeo-chemische Kreisläufe und das Klima-geschehen auf der Erde”, erklärteProf. Friedrich Widdel vom BremerMax-Planck-Institut für marine Mi-krobiologie.
Könnten bestimmte Mikroorganis-men wie die Cyanobakterien als„Kohlendioxid-Fänger” dazu beitra-gen, den Gehalt an Kohlendioxid inder Atmosphäre zu reduzieren? ZurBeantwortung der Frage haben Wis-senschaftler in Experimenten Teiledes Ozeans mit Eisen „gedüngt”. Nor-malerweise gibt es dort nur sehr wenig Eisen, was das Wachstum derMikroorganismen begrenzt. Einestärkere Vermehrung von Cyanobak-terien und Algen im Ozean hätte zurFolge, dass große Mengen freienKohlendioxids in die Lebewesen ein-gebaut und für lange Zeit der At-mosphäre entzogen würden. ErsteErgebnisse scheinen die Überlegun-gen zu bestätigen. Widdel dazu: „DieErforschung der Meeresorganismenliefert daher nicht nur Informationenüber das Stoffgleichgewicht im Meerund zwischen Meer und Atmosphäre,sondern ermöglicht auch Aussagendarüber, wie sehr der Mensch in glo-bale Stoffkreisläufe eingreift.”
Eine große Anzahl von Mikroorga-nismen lebt in enger Gemeinschaft(Symbiose) mit Pflanzen und Tieren,die für beide Partner profitabel ist.Jeder Partner liefert Stoffe, die derandere alleine nicht produzierenkann. Einige Tausend Meter tief aufdem Meeresgrund, in den zentralenTälern der Mittelozeanischen Rü-cken, haben Wissenschaftler heißeQuellen entdeckt, die mit Temperatu-ren von mehr als 300 Grad aus Spal-ten im Meeresboden hervorschießen.Der gewaltige Druck in dieser Tiefe
bewirkt, dass Wasser selbst bei sohohen Temperaturen nicht ver-dampft. Die heißen Flüssigkeitenenthalten viel Schwefelwasserstoff,der für Tiere normalerweise giftig ist.Für einige Bakterien ist diese nachfaulen Eiern stinkende Verbindungjedoch ein Leckerbissen, der ihnendie Bindung von Kohlendioxid zuorganischem Material ermöglicht.Rund um die heißen Quellen lebenTiere, von denen viele mit Schwefel-bakterien vergesellschaftet sind. „Inder absoluten Finsternis der Tiefseebeherbergen meterlange mund- unddarmlose Röhrenwürmer symbionti-sche Mikroorganismen und versor-gen sie über ein hoch entwickeltesBlutgefäßsystem mit Schwefelwas-serstoff, Sauerstoff und Kohlendio-xid”, berichtete Prof. Jörg Ott, Insti-tut für Ökologie und Naturschutz,Universität Wien.
SYMBIOSEN
IN HÜLLE UND FÜLLE
Die Bakterien finden sich im Wurmnur in speziellen Organen, dem Tro-phosom. In einem vom Sonnenlichtunabhängigen Prozess, der Chemo-synthese, oxidieren sie dort den vomBlut des Wurmes herantransportier-ten Schwefelwasserstoff zu Sulfatund reduzieren Kohlendioxid zu Bio-masse. Im Gegensatz zur Photosyn-these, bei der grüne Pflanzen Lichtals Energiequelle benötigen, gewin-nen die Bakterien hier ihre Energiedurch Oxidation anorganischer Ver-bindungen. Die Symbiose ist so ef-fektiv, dass Röhrenwürmer mit diehöchsten Wachstumsraten aufwei-sen, die man von wirbellosen Tierenbisher kennt. Ähnliche Gemeinschaf-ten fanden Forscherteams um JörgOtt auch im Seichtwasser in nahezuallen Sandböden des Meeres. Dortgrenzt eine wenige Millimeter dünnesauerstoffhaltige Oberflächenschichtan eine schwefelwasserstoffhaltigeSedimentlage.
Genau an der Grenze zwischenbeiden Schichten leben mikroskopi-sche Fadenwürmer, deren Haut mitSchwefelbakterien überzogen ist. Diebeweglichen Würmer kriechen imSediment umher und transportieren
MIKROorganismen
78 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
wicklungsgeschichtlich zweigen diehyperthermophilen Organismen häu-fig tief im rRNA-Stammbaum desLebens ab, was auf einen heißen Ur-sprung des Lebens verweist”, meinteStetter. Theoretisch könnten derarti-ge Organismen sogar auf anderenPlaneten existieren, denn sie sindnicht auf Sonnenlicht angewiesenund haben minimale Ansprüche anihre Nahrung. Ohne Mikroorganis-men wäre der vollständige Abbauvon organischen Stoffen in anorga-
rien auch die hartnäckigsten Struk-turen: Abgestorbene Pflanzen undTiere zersetzen sie im Nu – selbst Erdöl wird langsam aber kontinuier-lich verspeist. Da molekularer Sauer-stoff durch die Wassersäule nur be-grenzt nachgeliefert werden kannund der Transport im Sediment nurnoch über Diffusion verläuft, kommtes im Sediment schnell zu einer voll-ständigen Aufzehrung des Sauer-stoffs. Die Bakterien leben dann vonalternativen, anaeroben Abbaupro-
KONGRESSbericht
Die Körperoberfläche des marinen Nematoden Eubostrichus topiarius ist mit regelmäßig angeordneten bogenförmigen Bakterien von etwa 30 µm Länge bedeckt, die dem Wurm dasAussehen eines gedrehten Seiles geben. Auf der geringelten Kutikula von Laxus oneistusstehen aufrechte stäbchenförmige Bakterien dicht an dicht. Die hohe Ordnung wird durchdie ungewöhnliche Längsteilung der Stäbchen aufrechterhalten.
Milliarden Jahren die ersten Lebewe-sen der Erde. „Das waren paradiesi-sche Bedingungen für hyperthermo-phile, also Hitze liebende Organis-men”, sagte Prof. Karl Otto Stettervon der Universität Regensburg. Eruntersucht „kochfeste” Bakterienund Archaeen, die an Temperaturenzwischen 80 und 113 Grad optimalangepasst sind; einige überleben so-gar stundenlanges Kochen bei 121Grad. Das sind Temperaturbereiche,in denen Zellbausteine wie Nukle-insäuren, Ribosomen und Enzymenormalerweise innerhalb von Sekun-den zerstört werden.
Nicht so bei den hyperthermophi-len Organismen. Je nach Art wach-
sen sie bei Temperaturen unter 60 bis80 Grad erst gar nicht. Zusammenmit anderen Faktoren macht sie be-sonders die Zusammensetzung ihrerZellmembran resistent gegen Hitze.Eine wichtige hitzestabilisierendeRolle spielen auch spezielle Eiweißein der Zelle. Temperatur-Spitzenrei-ter ist Pyrolobus fumarii, dessen Zel-len sich selbst bei Temperaturen über113 Grad unbekümmert teilen. „Ent-
nische Substanzen nicht möglich. Esgibt keine natürlichen Verbindun-gen, die nicht von Mikroorganismenumgewandelt werden können. „Ortdes Geschehens ist meist der Bodenan Land oder das Sediment im Was-ser, denn dort leben rund 95 Prozentaller Mikroorganismen”, sagte Prof.Bernhard Schink von der UniversitätKonstanz. Bereits in einer Tiefe voneinigen Millimetern knacken Bakte-
zessen. Als Endprodukte entstehenvor allem Schwefelwasserstoff undMethan, die wiederum von anderenMikroorganismen verwertet werdenkönnen.
SCHALTSTELLEN FÜR
GLOBALE STOFFKREISLÄUFE
Bakterien leben im offenen Ozeanoft als „Hungerkünstler” mit er-staunlich geringen Konzentrationenvon Nährstoffen. Dennoch bildenoder verbrauchen sie weltweit jähr-lich Milliarden von Tonnen natürli-cher Kohlenstoffverbindungen, wie
REM
FO
TOS:
M. B
RIG
HT
Die Grafik zeigt die Analyse des Verdauungssekrets einer Schmetterlingslarve (Heliothis virescens) mit Fettsäurekonjugaten der Aminosäure Glutamin. Die Konjugate dienen vermutlich als Emulgatoren zur Verdauung der Nahrung; einige von ihnen wirken als Auslöser der pflanzlichen Duftproduktion.
PD Dr. Rudolf Amann während seines Vortrags.
Im Gespräch vertieft (von links): Prof. Gerhard Drews, Universität Freiburg,PD Dr. Rudolf Amannvom Bremer Max-Planck-Institut fürmarine Mikrobiologieund Prof. HeinrichNöth, Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Prof. Wilhelm Boland vom MPI für chemische Ökologie, Jena.
Dialog unter Kollegen: Prof. Jörg Ott, Institut für Ökologieund Naturschutz,Universität Wien,und Prof. Karl-HeinzSchleifer vom Lehr-stuhl für Mikrobiolo-gie, TU München.
Prof. Friedrich Widdel vom MPI für marine Mikrobiologie, Bremen.
GRA
FIK:
MPI
FÜ
RCH
EMIS
CHE
ÖKO
LOG
IE, J
ENA
FOTO
S: W
OLF
GAN
GFI
LSER

eine Wespe den Weg zum Pflanzen-schädling und vertilgt ihn. Eine ent-scheidende Rolle bei diesen Prozessenspielen Bakterien, die im Darm vonInsekten leben; denn sie produzierendie verräterischen Substanzen, aufdie Pflanzen mit der Herstellung vonDuftstoffen reagieren.
Die Mikroorganismen bauen dieseAuslösestoffe, vorwiegend Ami-nosäurekonjugate von Fettsäuren,nicht ohne fremde Hilfe: Das Insektliefert die Aminosäure Glutamin, dieFettsäure stammt aus der pflanzli-chen Nahrung und die Bakterienknüpfen die Peptidbindung. DieseSubstanzen können so spezifischeDuftmuster auslösen, dass Wissen-schaftler einzelne Raupenarten an-hand des Geruchs unterscheidenkönnen. „Die Beteiligung von Mikro-organismen an der Biosynthese vonderartigen Verbindungen im Darmvon Insekten macht deutlich, dassbei der Interaktion von Pflanze undInsekt auch die Ebene der Mikroor-
ganismen berücksichtigt werdenmuss”, sagte Prof. Wilhelm Bolandvom Max-Planck-Institut für chemi-sche Ökologie in Jena.
KEIN LEBEN OHNE
MIKROORGANISMEN
Mikroorganismen haben vor lan-ger Zeit die Voraussetzung für dieEntstehung von Tieren und Pflanzengeschaffen, indem sie freien Sauer-stoff produzierten. Sie beeinflussenglobale Stoffkreisläufe, können jedenatürliche Verbindung abbauen undsind auch an der Kommunikationzwischen Pflanzen und Tieren betei-ligt. Durch Kombination aus mole-kular- und mikrobiologischen Me-thoden wollen Wissenschaftler inZukunft noch mehr über die Funkti-on und Bedeutung der Mikroorga-nismen für die Umwelt erfahren.Karl-Heinz Schleifer: „Ohne unserekleinen Freunde wäre das Leben aufder Erde so wie wir es heute kennennicht möglich.” ARND PRILIPP
MIKROorganismen
80 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
dabei ihren Bakteriengarten zwi-schen Oberfläche und tieferenSchichten. Sie versorgen so ihreBakterien mit dem für die Chemo-synthese notwendigen Schwefelwas-serstoff und Sauerstoff. Der gegen-seitige Nutzen beider Partner liegtdarin, dass die Bakterien alle Stoffebekommen, die sie zum Wachstumbenötigen und der Wurm sich regel-mäßig an ihnen satt frisst.
Eine symbiotische Gemeinschaft,in der ein ausgeklügeltes Wechsel-spiel verschiedener Bakterien eineentscheidende Rolle spielt, hat Dr.Nicole Dubilier vom Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobio-logie entdeckt: Hier versorgen ein
ge Substanzen wie Ammonium oderNitrat aus dem Boden konsumieren.Besser haben es da viele Mikroorga-nismen, die den in Hülle und Füllevorhandenen Stickstoff direkt ausder Luft nutzen können. BiologischeStickstofffixierung heißt dieser bio-chemische Prozess, in dem sie dengasförmigen Stickstoff reduzierenund in Verbindungen umwandeln,mit denen sie ihren Bedarf an demlebenswichtigen Element decken.
Moderne Reissorten kooperierennormalerweise nicht mit Stickstofffixierenden Bakterien. Anders ist eszum Beispiel beim Zuckerrohr: Hierübernehmen Bakterien bereits 50 bis70 Prozent der Stickstoffversorgung.
Stickstofffixierung, Nitrogenase, pro-duzieren. Eine Reihe von Genen sor-gen dafür, dass Nitrogenase gebildetwird. Ein Gen davon haben die For-scher im Labor mit einem fremdenGen gekoppelt, das aus einer Tiefsee-qualle stammt. Dieses Gen hat einesehr praktische Eigenschaft. Wird esaktiv, dann sorgt es für die Produkti-on von Eiweißen, die grün-bläulichleuchten.
Mithilfe dieses „Reportergens”können die Wissenschaftler heraus-finden, ob in den Wurzeln Nitrogen-ase gebildet wird. Denn das Quallen-gen wird dann automatisch aktiv,und die Wurzeln beginnen zu leuch-ten. Barbara Reinhold-Hurek: „Wir
KONGRESSbericht
ÖKOLOGIE IM BRENNPUNKT
Die Kommission für Ökologie der Baye-rischen Akademie der Wissenschaftenwurde im Jahr 1986 gegründet. Ihr Zielist es, aktuelle oder möglicherweise ak-tuell werdende Probleme ökologischerArt aufzugreifen und zu diskutieren so-wie die betreffenden Mitarbeiter in derBayerischen Staatsregierung und in denStaatsministerien zu beraten. Zu diesemZweck veranstaltet die Kommission derÖkologie jährlich ein bis zwei Rundge-spräche, bei denen anerkannte Expertenaus den Gebieten der Wissenschaft, Ver-waltung, Politik und Industrie den aktu-ellen Kenntnisstand in dem jeweiligenFachgebiet vermitteln. Die Fachleute bie-ten – wenn möglich – Lösungsvorschlägefür bestehende Probleme und diskutierensie mit den eingeladenen Gästen. Sowohldie Referate als auch die Diskussionenwerden in der Reihe „Rundgespräche der Kommission für Ökologie“, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, veröffent-licht und sind im Buchhandel zu beziehen.
Weitere Informationen im Internet unter www.badw.de oder per E-Mail:
Sulfat reduzierendes und ein Schwe-fel oxidierendes Bakterium einenmarinen Wurm.
TIEFSEEQUALLE BRINGT
GRAS ZUM LEUCHTEN
Die atmosphärische Luft enthältmehr als 75 Prozent gasförmigenStickstoff, den Tiere und Pflanzenzum Beispiel zum Aufbau von le-benswichtigen Eiweißen benötigen.Sie können den Stickstoff jedochnicht aus der Luft konsumieren. Tieremüssen stickstoffreiche Nahrungfressen und Pflanzen stickstoffhalti-
„Eine direkte symbiotische Bezie-hung zwischen einer Reisart undStickstoff fixierenden Bakterien alsnatürlicher Düngelieferant wäre ide-al”, sagte Prof. Barbara Reinhold-Hurek von der Universität Bremen.Sie untersucht das Zusammenwir-ken von Bakterien und Pflanzen inWurzeln einer Grasart aus Pakistan:dem Kallargras. Mit molekularbiolo-gischen Methoden konnte die For-scherin tief im Wurzelgewebe derPflanze verborgene Bakterien derGruppe Azoarcus nachweisen, diedas Schlüsselenzym der biologischen
wollen mehr über die molekularenZwiegespräche zwischen Bakterienund Pflanze erfahren. Denn wennBakterien an Kultursorten von Reiseine ähnliche Symbiose leistenkönnten, wie wir sie bei Kallargrasgesehen haben, bräuchten Reisbau-ern in Zukunft viel weniger Stick-stoffdünger.”
Mikroorganismen sind für Pflanzennicht nur als Düngelieferant nützlich,sondern auch an der Interaktion zwi-schen Pflanzen und Insekten betei-ligt. Beißt ein Insekt in eine Pflanze,löst sein Speicheldrüsensekret überinterne Signalkaskaden bei der Pflan-ze die Produktion bestimmter Duft-stoffe aus. Von den Gerüchen an-gelockt, findet dann zum Beispiel
Sulfid oxidierende Bakterien (grün) und Sulfat reduzierende Bakterien (rot) in der Kutikula(„Haut“) eines marinen Wurms (links). Konsortium von Archaebakterien (rot) und Sulfat reduzieren-den Bakterien (grün), das ohne Sauerstoff mit Sulfat als Oxidationsmittel Methan oxidiert (Mitte).Verschiedene Populationen nitrifizierender Bakterien aus einem Abwasser-Biofilm (rechts).
@
FOTO
: DR.
NIC
OLE
DU
BILI
ER, M
PI F
ÜR
MAR
INE
MIK
ROBI
OLO
GIE
FOTO
: DR.
AN
TJE
BOET
IUS,
MPI
FÜ
RM
ARIN
EM
IKRO
BIO
LOG
IE
FOTO
: DR.
ARM
ING
IESE
KE, M
PI F
ÜR
MAR
INE
MIK
ROBI
OLO
GIE

82 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
FORSCHUNG & Gesellschaft
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 83
Schimpansen eine Reihe inzwischenklassischer Experimente entwarf. Mitseinem amerikanischen Kollegenund Zeitgenossen Richard Yerkes,dessen Forschungszentrum in Atlan-ta noch heute eine der weltweitführenden Institutionen ist, gilt erals Mitbegründer einer wissenschaft-lichen Beobachtung von Menschen-affen. Aus dieser amerikanischenHochburg der Primatenforschung istProf. Dr. Michael Tomasello vor vierJahren nach Leipzig gekommen undleitet nun als Direktor zusammen mitDr. Josep Call das Wolfgang-Köhler-Zentrum am Leipziger MPI. Ihnenund ihren Mitarbeitern dient dieMenschenaffenanlage quasi als For-
Für die einen ist es das „Wolfgang-Köhler-Zentrum für Primaten-
forschung“, die anderen sprechen von „Pongoland“: DAS MAX-PLANCK-
INSTITUT FÜR EVOLUTIONÄRE ANTHROPOLOGIE und der Zoo Leipzig
haben kürzlich gemeinsam die weltweit größte Menschenaffenanlage
eingeweiht, die Erlebnispark und Forschungsstätte in einem ist.
Das Besondere daran: Zoobesucher können den Verhaltensforschern
zuschauen, wie sie mit den Tieren spielerische Experimente machen.
Padana genießt das Spektakelvor der Glasscheibe. Selbst Er-
wachsene gehen in die Knie vor ihr,wandern mit ihren Fingern dieScheibe entlang, um mit Entzückenzu registrieren, dass Padana sich aufdas Spielchen einlässt und von innendie Bewegungen mit ihrer haarigenHand nachfährt. Innen, außen –schwer zu sagen, auf welcher Seiteeigentlich das Gehege ist und werhier mit wem spielt. Klar ist aber,wer bestimmt, wann Schluss ist. Un-vermittelt bricht Padana immer wie-der den Kontakt ab, trollt sich, turntlässig ein bisschen durch die Seile,baumelt und hält dann inne, um zuschauen, was ihre Anhängerschar tut.
Die schwitzt in erster Linie. Feuch-te Hitze macht sich in allen Winkelnder fast 20 Meter hohen Tropenhallebreit; gute 30 Grad Celsius zeigt dasThermometer an. Die Gesichter derBesucher glänzen leicht. Zwar herr-schen auch draußen frühlingshafteTemperaturen, aber nur wenige ha-ben sich bislang getraut, eindeutigAbschied von ihrer Winterkleidung
zu nehmen. So gilt es die Affenhitzeauszuhalten, die im Herzstück vonPongoland das ideale Klima fürOrang-Utans, Bonobos, Schimpansenund Gorillas schafft; unter einemtransparenten Foliendach, dessenhoher Lichteinfall vergessen lässt,dass man eigentlich drinnen ist.Pongoland – das ist der Name fürdas weltweit größte Menschenaffen-areal in einem Zoo. Rund 30.000Quadratmeter des 124 Jahre altenLeipziger Tierparks wurden zumnatürlich und artgerecht gestaltetenLebensraum für die haarige Men-schenverwandtschaft. Die Bezeich-nung Pongo stammt aus dem Ango-lanischen und bezeichnet alle viergroßen Menschenaffenarten.
Die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts dagegen ehren mitdem Namen des Primatenfor-schungszentrums den Verhaltens-psychologen Wolfgang Köhler. DerDeutsche gründete Anfang des 20.Jahrhunderts eine anthropologischeForschungsstation auf Teneriffa, woer zum Studium der Kognition von
Zum Affenschachins Pongoland
Evolutionäre ANTHROPOLOGIE
schungscamp und es komplettiertdas Institut, das sich seit seinerGründung im Jahr 1997 in vier Ab-teilungen von einem interdiszi-plinären Ansatz her mit der Evolu-tion des Menschen – und damit auchmit seinen nächsten Verwandten –beschäftigt. Die Anlage ist eingebet-tet in eine Landschaft, die den Ein-druck vermittelt, sich in freier Naturzu bewegen. Gitter und Kachelwändesucht man vergebens; statt der inZoos früher üblichen Badezimmerar-chitektur finden sich nun überallechte, üppige Vegetation und Klet-terbäume. Die Tiere leben in Innen-und Außengehegen mit natürlichenBöden, von denen der Besucher nur
durch Wasser- und Trockengräben,an einigen Stellen durch Panzer-glasscheiben getrennt ist. Für dasAreal hat die Max-Planck-Gesell-schaft rund 30 Millionen Mark Bau-kosten aufgewendet.
DAS LUSTPRINZIP
BESTIMMT DIE ARBEIT
Die Investition wird sich bezahltmachen: Denn nur, wenn sich dieMenschenaffen in einem möglichstnatürlichen Lebensraum wohl füh-len, können die Wissenschaftler er-warten, dass sie artgerechtes Verhal-ten zeigen – und bei den angestreb-ten Verhaltensexperimenten koope-rieren. „Und darauf sind wir ange-
wiesen“, sagt ForschungskoordinatorJörg Noack. Das Lustprinzip ist sozu-sagen bestimmender Faktor bei derArbeit mit den Tieren. Dabei sei es inder Regel nicht schwer, die Affenvon den Kletterbäumen zu lockenund zur Teilnahme an einem „Spiel-chen“ zu animieren.
So jedenfalls sieht es für die Besu-cher aus. Doch hinter dem „Spiel“stehen weit reichende wissenschaft-liche Überlegungen: Wie nehmenMenschenaffen die physische Weltum sich herum wahr, wie empfindensie ihr soziales Umfeld? Auf diesezentrale Fragestellung lässt sich dasForschungsinteresse von Tomasellound seinen Kollegen fokussieren. Die
Auf Holzstegen gelangen die Zoobesucher durch die Außengehege der weltgrößten Menschenaffen-anlage zur Tropenhalle. In dem lichtdurchfluteten Bau mit dem transparenten Foliendach sind die Innen-gehege und Versuchsräume des Wolfgang-Köhler-Zentrums für Primatenforschung untergebracht.
FOTO
: ARM
INH
. KÜ
HN
E

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 85
Evolutionäre ANTHROPOLOGIE
84 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Wissenschaftler interessieren sichdafür, wie die Tiere knifflige Proble-me lösen, zum Beispiel Werkzeugebenutzen und verstecktes Futter su-chen. Und wie fit sind Menschen-affen in Mathematik? Haben sie eineVorstellung von Mengenbegriffen?In der Kommunikation spielt vor al-lem die Gestik eine wichtige Rolle.Jungtiere müssen erst lernen, wie sie andere Gruppenmitglieder zumSpielen auffordern oder ihre Mutterum Nahrung bitten. Aber wie sichdiese Fähigkeit entwickelt, ist nochunklar. Lernen die Menschenaffendas, indem sie das Verhalten ihrerArtgenossen imitieren?
Durch einseitig durchsichtigeScheiben in versteckten Beobach-tungsnischen des Primatenhauseskönnen die Zoobesucher den Wis-
senschaftlern quasi über die Schulterschauen und zusehen, wie sie bei-spielsweise Affenschach spielen. Jo-sep Call gilt als Erfinder dieser Grup-pe von Experimenten, für die in denhauseigenen Werkstätten ein speziel-ler Tisch gebaut wurde. „Besonders“ist vieles im Primatenhaus. Denn mitnormalen Maßstäben scheitert manschnell, vor allem, was die Kraft derAffen angeht und ihren Spaß amTüfteln und Ausprobieren. Das hatauch eine Stahlbaufirma zu spürenbekommen, deren rustikale Kletter-stangen den „Affen-TÜV“ nicht be-standen haben. Auch die Tierwaageim Pflegetrakt hat der Orang-Utan-Mann Bimbo schnell etwas aus demGleichgewicht gebracht. Kein Wun-der also, dass auch die Wissenschaft-ler Abstand halten. Bei allen Experi-
menten sind sie durch Panzerglasund Gitter von den Tieren getrennt.
KÖNNEN AFFEN
GEDANKEN LESEN?
In Ruhe können sie beobachten,wie sich die Affen beim „Schach“ be-gegnen: Wie kooperieren und kon-kurrieren sie? Machen sie sich Ge-danken über die Gedanken des ande-ren? Weintrauben stehen dabei imMittelpunkt – sie liegen greifbar fürzwei Tiere mit unterschiedlich ho-hem Rang. Doch eine der Trauben istfür das ranghöhere Tier nicht zu se-hen. Greift der Unterlegene zu? Hater durchschaut, dass sein Konkurrentgar nicht reagieren kann? Wenn ja,würde das heißen, dass sich ein Affein seinen Artgenossen hineinverset-zen kann. Von Schimpansen weiß
FORSCHUNG & Gesellschaft
Es ist dieser Blick, mit dem sie ihre mensch-lichen „Artgenossen“ anschauen und der jenenklarmacht, dass da irgendetwas Verwandtestatsächlich besteht. Roman Wittig weiß, wiefasziniert die Besucher im Zoo von Affen undbesonders von Schimpansen sind. Doch ermöchte nicht, dass es nur bei der Bewunde-rung für die intelligenten Tiere bleibt. Denn:In der freien Natur sind Schimpansen bedroht.„Wie alle Menschenaffen sind sie in ihrenafrikanischen Ursprungsländern das Ziel vonBusch- und Trophäenjägern – ohne Rücksichtauf bestehende Vorschriften des Arten-schutzes“, sagt Wittig. Er ist Doktorand in derAbteilung Primatologie am Max-Planck-Insti-tut für evolutionäre Anthropologie. DessenLeiter, Prof. Christophe Boesch, hat gemein-sam mit seiner Frau Hedwige die Wild Chim-panzee Foundation (WCF) ins Leben gerufen.Sie will die wild lebenden Schimpansen undderen Lebensraum, den tropischen RegenwaldAfrikas, aktiv schützen.Es ist nicht zuletzt die jahrzehntelange wis-senschaftliche Arbeit, die Boesch veranlassthat, sich persönlich einzusetzen. Wer, wie derSchweizer, einen Großteil der Forschung ander Elfenbeinküste betreibt, ist ganz für dieTiere eingenommen. Die Anwesenheit einer in-ternationalen Primatologengemeinschaft, diein Langzeitprojekten Schimpansenpopulatio-nen in Tansania, Uganda, Guinea und eben ander Elfenbeinküste beobachtet, gewährleisteteinen gewissen Schutz. Doch wo er fehlt, sinddie Affen schonungsloser Verfolgung ausge-setzt; manche Arten stehen kurz vor der Aus-rottung. Und wo keine Affen mehr sind, gibtes auch nichts mehr zu erforschen. Gebiete in den anderen gut 20 Ländern Afrikas zu finden, in denen ebenfalls Schimpansen ver-mutet werden, weil es Berichte über kurzzei-tige Forschungsaufenthalte gibt, ist darum ein Ansatzpunkt der WCF. Zwar ist die Jagd auf geschützte Tierarten in weiten Teilen Afrikas verboten. „Aber wiewollen Sie große Waldgegenden lückenlos aufWilderer kontrollieren? Das ist unmöglich“,meint Wittig. Die Jäger profitierten vom Bauimmer neuer Straßen, mit denen große Holz-baufirmen die Wälder erschließen. Oft trans-portierten die Firmenlastwagen sogar die Jäger samt Beute. Nicht nur das Fleisch derAffen ist für die Jäger interessant, Schimpan-senbabys sind auch als Kuscheltiere gefragt.Gefahr droht den Tieren freilich genausodurch die Abholzung der Wälder für den Ex-port von Tropenholz, durch Krankheiten der
Menschen, die zum Beispiel als Touristen im-mer näher an die wild lebenden Tiere heran-rücken und durch Fallen, die für andere Tierebestimmt sind.Zwei Projekte hat sich die Wild ChimpanzeeFoundation vorgenommen, mit deren Hilfezunächst die lokale Bevölkerung aufgeklärtwerden soll. „Wir müssen den Einheimischenklarmachen, welche Schätze diese Tiere mit-samt ihrem Lebensraum bedeuten und Infor-mationen über ihre Lebensweise weitergeben“,sagt Wittig. Dies soll im Kontext afrikanischerKultur geschehen. So ist eine afrikanischeTheatergruppe beauftragt, ein Stück zur The-matik zu schreiben, mit dem man dann durchDörfer nahe bedrohter Schimpansengebieteziehen kann. In Schulen möchte man die Kin-der animieren, das Stück aufzunehmen, es miteigenen Ideen zu erweitern, um es dann selbstvorzuführen. Ferner ist an eine Broschüre (Newsletter) gedacht, in der Geschichten überSchimpansenfamilien veröffentlicht werden,die die Wissenschaftler rund um Boesch ausihrer Forschung im Taï-Nationalpark an derElfenbeinküste kennen. Der Leipziger Zoo alsjüngstes Mitglied der Foundation hat sich vor-genommen, diesen Newsletter zu produzieren.Mit dem Zoo verbindet die Wissenschaftlerum Boesch auch eine Zusammenarbeit vor Ort.Zwar sehen Primatologen die Affen am lieb-sten in ihrer natürlichen Umgebung, doch be-trachten sie die Orang-Utans, Schimpansen,Bonobos, Gorillas und Gibbons in Pongolandals Botschafter ihrer wilden Artgenossen.Wenn die Lebensbedingungen für Tiere inmenschlicher Obhut so gut wie möglich ge-staltet würden und man nie aufhöre, sie zuverbessern, dann könnten umfassende Infor-mationen über ihre Lebensweise dazu beitra-gen, dass Menschen sich engagieren, glaubtWittig. Unter dieser Prämisse haben die Wis-senschaftler des Max-Planck-Instituts daranmitgewirkt, Schautafeln sowie Tast- undRiechstationen zu entwerfen, an denen dieZoobesucher in Leipzig Wissenswertes erfah-ren können. Außerdem waren sie an der Pro-duktion von zwei Videos über Affen beteiligt,die ebenfalls im Zoo zu sehen sind.
SUSANNE BEER
Weitere Informationen:WILD CHIMPANZEE FOUNDATION
c/o Max-Planck-Institut für evolutionäre AnthropologieInselstr. 22-26, 04103 LeipzigTel.: 0341/9952-139oder http://www.wildchimps.org
man, dass sie besonders differen-zierte Gedankengänge bewerkstelli-gen können. Doch wie sich die ande-ren Menschenaffenarten verhalten –darüber ist noch wenig bekannt. ImLeipziger Zoo haben Tomasello, Callund Kollegen nun Gelegenheit,Orang-Utans, Bonobos und Gorillasin ihre Studien einzubeziehen undmiteinander zu vergleichen.
Aber auch der Frage, wie fit Men-schenaffen in Mathematik sind, wol-len die Forscher im Leipziger Zoonachgehen. Dazu werden Piktogram-me verwendet, auf denen Nahrungs-mittel in unterschiedlicher Mengeabgebildet sind. Entscheiden sie sichfür das Bild mit einer Banane oderbevorzugen sie jenes, das die ganzeStaude zeigt? „Die Ergebnisse sollendas bereits vorhandene Wissen über
DIE WILD CHIMPANZEE FOUNDATION (WCF)Und über allen thront der Chef: Orang-Utah-Mann „Bimbo“ (rechts) imponiert durch Zurückhaltung und Größe. Der Rest des Clans turnt durchs Innengehege, das mit Sandboden und Kletterbäumen möglichst natürlichen Lebensraum geben will.
FOTO
S: S
USA
NN
EBE
ER
@

86 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Verhalten und Wahrnehmung unse-rer nächsten Verwandten ergänzenund helfen, das Leben der Affen inmenschlicher Obhut so angenehmwie möglich zu gestalten“, sagt JörgNoack. Darum sollen die Studienauch nicht den Lebensrhythmus derTiere beeinträchtigen. Sie müssennicht auf ihre gewohnte Nahrungverzichten, im Gegenteil: Sie könnensich sogar zusätzliche Leckerbissen,die nur selten auf dem Speiseplanstehen, verdienen.
AUFZUCHTSTATION
FÜR SCHIMPANSENBABYS
Und bisweilen ziehen sich die Ver-haltenspsychologen auch weit zu-rück. Das Außengehege ist von Platt-formen am Dach des Primatenhausesper Videokamera zu beobachten. Je-denfalls dann, wenn das Laub derBäume nicht zu dicht wird. Sonstmüssen die Forscher darauf hoffen,dass die Affen Eichenblätter als Er-gänzung zum Speiseplan entdeckenund kräftig zulangen.
Neben der Verhaltensforschungvon Affen, dem Vergleich der einzel-nen Arten untereinander sowie mitder Entwicklung von Menschenkin-dern wollen Tomasello und Kollegenauch ihre Kenntnisse über die Ein-gliederung von Schimpansenjungenin bestehende Tiergruppen weiterge-ben.
In einer speziellen Aufzuchtstationsollen darum Tiere, die von ihrenMüttern verstoßen werden, auf das
Leben mit Artgenossen vorbereitetwerden. Zwar obliegen Haltung undPflege der Affen grundsätzlich demZoo, doch auch hier wird das Maß an Kooperation deutlich, mit dem die Partner arbeiten. Gemeinsam hat man die Tierpfleger ausgesucht,die nun Englisch üben, um eine konstruktive Zusammenarbeitmit ausländischen Kollegen undGastwissenschaftlern zu gewährleis-ten. Und weil die Interessen gleich-rangig sind, werden die laufendenKosten geteilt: Strom, Wasser, Pflege,tierärztliche Betreuung. Alles wirdhalbiert – selbstverständlich auch dieRechnung für Bananen.
Solange aber noch nicht alle Men-schenaffen die Eingewöhnungsphasein ihren Quartieren abgeschlossenhaben, weil sie – teilweise über daseuropäische Erhaltungszuchtpro-gramm vermittelt und aus anderenZoos kommend – erst noch die Qua-rantäne hinter sich bringen müssen,solange sind die Affen noch viel un-ter sich. Tierpfleger und Wissen-schaftler sieht man aber immer wie-der am Gehege ihrer Schützlinge stehen und die sich neu bildendenGruppengefüge studieren.
Derweil kokettiert Padana ausihrem neuen Zuhause heraus weitermit den Besuchern. Das kleineOrang-Utan-Kind ist ziemlich ver-spielt und lenkt die Sympathien derBesucher im Gehege der cognac-farbenen Menschenaffen ausnahms-los auf sich, weil die eigentlichenStars der Gruppe mehr Abstand hal-ten. Der imposante Bimbo, Chef desClans, thront im toten Geäst derKletterbaumkonstruktion und nur abund zu lässt er sich zu kurzen, un-spektakulär ruhigen Kletterpartienhinreißen. Sie vermitteln eine Ah-nung von seiner Kraft, wenn er, 120Kilogramm Gewicht einarmig amSeil hängend, mühelos hält.
Und Kila ist fast gar nicht zu ent-decken. Das immerhin ein Jahr alteOrang-Utan-Mädchen ist noch so
FORSCHUNG & Gesellschaft
DAS MAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR EVOLUTIONÄRE
ANTHROPOLOGIE
In dem 1997 gegründeten Max-Planck-Institut arbeiten Psychologen,Primatologen, Linguisten und Genetikerinterdisziplinär zusammen; sie wollendie Entwicklungsgeschichte des Men-schen nachzeichnen. Wann haben Menschen im Lauf der Evolution welcheFähigkeiten erworben und wieder ver-loren? Antworten darauf sollen in vierAbteilungen gesucht werden. Die In-stitutsleitung ist international besetztmit Direktoren aus der Schweiz, Ameri-ka, Schweden und Großbritannien.Während im Wolfgang-Köhler-Prima-tenforschungszentrum das Verhaltenvon Affen in menschlicher Obhut er-forscht wird, untersucht die Abteilungdes Primatologen Prof. ChristopheBoesch die Evolution von sozialen Sys-temen und Intelligenz bei frei lebendenMenschenaffenpopulationen. Dass derVerwandtschaftsgrad zwischen Men-schen und Schimpansen so niedrig nichtsein kann, beweist schon die Erbmasse:Sie stimmt zu 98,4 Prozent überein.In der Abteilung für evolutionäre Ge-netik unter Prof. Svante Pääbo werdenDNS-Sequenzen, die Transskriptions-muster und andere zelluläre Prozessevon Menschen und Menschenaffen verglichen. Sind es also die restlichen1,6 Prozent, die uns zum Menschen machen? Ein besonderes Merkmal desHomo sapiens ist das Vermögen, Spra-che als effektives Kommunikations-mittel zu nutzen. Die Wissenschaftlerder Abteilung Linguistik um Prof. Bernard Comrie untersuchen die Diver-sität der menschlichen Sprache und die ihr zugrunde liegenden historischenProzesse. Die Forscher interessieren sich dafür, welche Eigenschaften allen Sprachen gemein sind und wie sichSprachen unterscheiden. Spracher-werbsstudien mit Kindern sind fernerauch in der Abteilung von Prof. MichaelTomasello, der Verhaltens- und Ent-wicklungspsychologie, angesiedelt.
klein, dass es sich im Haarkleid seiner Mutter verstecken kann. Nurselten schaut das kleine Köpfchenmit der Punkfrisur heraus. Da wer-den die Verhaltenspsychologen wohldie Videokamera mit dem stärkstenTeleobjektiv zücken müssen.
SUSANNE BEER
Per Kopfhörer lernen Zoobesucher im Primatenhaus, wie es klingt, wenn Affen miteinander „sprechen“. Dafür haben die Wissenschaftler Schimpansenrufe in der Wildnis aufgenommen.
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 87
NEU erschienen
Beim Rollen-spiel an Streitkultur gewinnen
Deutschland im Jahr 2025.Meinhausen hat ein wertvolles
Gut: den „Grünen Grund“, ein 50Hektar großes Areal. Die Stadtmöchte dieses Gelände verkaufen,und es gibt dafür auch schon Inte-ressenten. Sechs Unternehmen ausder Lebensmittelbranche bewerbensich darum; auf dem Grundstückwollen sie einen modernen Produkti-onsbetrieb bauen. Aber wer be-kommt den Zuschlag? Jetzt gilt es,Überzeugungsarbeit zu leisten. Alsoreisen die Firmenvertreter nachMeinhausen und stellen den Stadträ-
vor geraumer Zeit erfunden hatteund das an dänischen Schulen mitt-lerweile sogar Bestandteil des Lehr-plans ist. Um es auch deutschenSchulen anbieten zu dürfen, musstendie Produzenten etliche Hürdenüberwinden und unter anderem einoffizielles Gutachten vom Institut fürPädagogik der Naturwissenschaftenin Kiel einholen.
FUTURE FOOD ist eine Kombinati-on aus Brett- und dem oben be-schriebenen Debattenspiel. Es wen-det sich an Jugendliche ab 15 Jahreund soll sich sowohl für den Einsatzim Biologie- als auch im fächerüber-greifenden Unterricht oder bei Pro-jektwochen eignen. Das Brettspiel istein Wissensspiel mit Fragen zur Bio-logie. Für die MaxPlanckForschunghaben Schülerinnen und Schüler desLK 12 am Germeringer Max-Born-Gymnasium das Spiel ausprobiert
ter Lernaspekten wären auch Fragenmit stärkerem Bezug zum Lehrplaninteressant. Die Tester schlagen vor,das Spiel bei einer Neuauflage mitverschiedenen Sets von Fragenkar-ten auszustatten, die sich dann auchaltersgruppenspezifischer einsetzenlassen.
Aus der Sicht des betreuenden Leistungskurslehrers Dr. GottfriedSchroll bietet FUTURE FOOD vor al-lem auch eine Möglichkeit, mehr Ab-wechslung in den Schulalltag zubringen. Schließlich lebt ein didak-tisch ausgewogener Unterricht vondem Einsatz verschiedener Methoden– und das ist nicht nur Frontalunter-richt, sondern das sind auch malGruppenarbeit, praktische Übungen,Referate oder eben ein Spiel. Geradeim Debattenteil von FUTURE FOODlernen die Jugendlichen nicht nur,die richtigen Fragen zu stellen, sie
Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe des Leistungskurses Biologie am GermeringerMax-Born-Gymnasium haben zusammen mit ihrem Kurslehrer, Dr. Gottfried Schroll, das vom MPIfür Züchtungsforschung mitentwickelte Brett- und Debattenspiel FUTURE FOOD getestet.
ten ihre Projekte vor – das Rollen-spiel beginnt. Während die „Firmen-vertreter“ ihr Unternehmen am bes-ten verkaufen müssen, sollen die„Kommunalpolitiker“ nach ausgiebi-ger Diskussion und Anhörung derverschiedenen Standpunkte ent-scheiden, welches Unternehmen sicham „Grünen Grund“ ansiedeln darf.
Dieses Debattenspiel ist Teil vonFUTURE FOOD. Für den deutschenSprachraum entwickelt hat es dasMax-Planck-Institut für Züchtungs-forschung zusammen mit dem Köln-PUB (Publikum und Biotechnologiee.V.) und dem aid (Auswertungs- undInformationsdienst für Ernährung,Landwirtschaft und Forsten e.V.).Vorlage war ein Spiel zu Ökologieund Biotechnologie in der Lebens-mittelproduktion, das das „Experi-mentarium“ in Kopenhagen bereits
und kritisch unter die Lupe genom-men. Fazit unserer Tester: Sehr kurz-weilig und hilfreich zur Überprüfungdes eigenen Wissens. Insbesondereder Debattenteil von FUTURE FOODhat den Gymnasiasten viel Spaß ge-macht: „Man ist gefordert, sein vor-handenes Wissen mal wirklich ein-zusetzen.“ – „Man denkt über Dingeneu nach.“ – „Man setzt sich mit an-deren Sichtweisen bewusster ausein-ander.“ Und: „Man stellt in der Dis-kussion sehr schnell fest, wo die ei-genen Defizite liegen.“
Beim Wissensteil hätten sich dieSchülerinnen und Schüler allerdingsmehr Fragenkarten gewünscht –schon nach wenigen Spielrundenwar der Kartenstapel erschöpft. Un-
haben wunderbar Gelegenheit, sichin Streitkultur zu üben. Eine guteDiskussion fußt auf fundiertemSachwissen; denn wer nichts weiß,muss alles glauben. Das Spiel jeden-falls weckt den Wunsch, mehr vonden komplexen Zusammenhängen inunserer Umwelt zu verstehen.
CHRISTINA BECK
Wer Lust bekommen hat, FUTURE FOOD selbst auszuprobieren, kann es unter der Bestellnummer 108-3658 bei aid-Vertrieb DVG, Birkenmaarstraße 8 in 53340 Meckenheim oder per Telefax (02225/926118) und E-Mail ([email protected]) bestellen. Der Einzelpreis beträgt 60 Mark.
FOTO
S : C
HRI
STIN
ABE
CK

88 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
FORSCHUNG & Gesellschaft
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 89
Im Jahr der Lebenswissenschaften zeigt die Max-Planck-Gesellschaft im Rahmen von
„Wissenschaft im Dialog“ vom 12. bis 17. September im Neubau des Deutschen Technikmuseums
eine Multimedia-Ausstellung über die kleinste Einheit des Lebens. Beim Wissenschaftssommer
Berlin 2001 erwartet die Besucher eine spannende und informative Reise in DIE VIRTUELLE
ZELLE. Darüber hinaus gibt es das Projekt „vCell“ auch im Internet unter www.vCell.de.
Exkursion ins Reich der Zelle
Jahr der LEBENSWISSENSCHAFTEN
Die lebenswichtigen Konstrukti-onspläne sind in einer mehrere
Milliarden Jahre alten, verschlüssel-ten Sprache niedergeschrieben. Akri-bisch werden die codierten Texte vonExperten in lesbare Anleitungenübersetzt. In fein abgestimmten Ar-beitsschritten fügen Architekten undBauarbeiter anschließend die Einzel-teile zu den unterschiedlichstenFunktionseinheiten zusammen.
Ein ausgeklügeltes Transportsys-tem bringt die fertigen Werkstückean den jeweiligen Einsatzort. DieFertigungshalle, in der sich dieses gigantische und zugleich faszinie-rende Szenario abspielt, ist winzigklein und misst gerade einmal weni-ge Millionstel Meter im Durch-messer: die Zelle.
In der molekularbiologischenRauminstallation „virtuelle Zelle“(vCell) besteht die Gelegenheit,vom 12. bis 17. September imDeutschen Technikmuseum inBerlin Vorgänge, die dem mensch-lichen Auge normalerweise verbor-gen bleiben, nicht nur zu beobach-ten, sondern sie interaktiv und spie-lerisch zu erleben. Die begehbarenZellräume widmen sich im vorläu-figen Ausstellungskonzept den The-men Genomforschung, Chromoso-men, Zelle als Proteinfabrik, Gesund-heit und Zellkern. Der Eingangsbe-reich entführt die Besucher multime-dial in den „Kosmos Zelle“.
Mit „vCell. die virtuelle Zelle“ willdie Max-Planck-Gesellschaft einenEinblick in aktuelle, innovative Wissenschaftssthemen ermöglichen,mit denen sich die Grundlagen-forschung auseinandersetzt. Dievirtuelle Zelle eröffnet spektakuläreEindrücke von Zellstrukturen und Funktionen, siezeigt die Basissowie Zusam-menhänge undKonsequenzenmoderner zell-biologischerForschung.Wissenschaft-ler der
Max-Planck-Gesellschaft ste-hen den Besuchernständig für Fragen zur Verfügungund erstellen in einem eigens eingerichteten molekularbiologischenLabor auf Wunsch sogar einen gene-tischen Fingerabdruck.Im Zentrum der „vCell“ stehen The-men aus der Spitzenforschung; so
werden die Besucher zum Beispielüber Genomforschung sowie übermodernste Methoden der Medika-mentenentwicklung informiert. Die„vCell“ zeigt außerdem die Ergebnis-se der Forschung zu Krankheiten wie Krebs, AIDS oder der TBC-Infektion. Mit spannenden Features
wie dem „Chromosomen-schach“ werden For-
schungsinhalte begreifbar ge-macht. Bereits im Vorfeld der Aus-stellung entsteht im Internet dasProjekt „vCell.de“, eine virtuelle
Plattform rund um die Zelle. Hierwird das weltweit verfügbare Wissenüber die Mikrowelt der Zelle mit an-schaulichen Texten, Grafiken, Video-und Audio-Beispielen in vielfältigerForm der Öffentlichkeit – vor allemSchülern und Lehrern präsentiert.
Jeder Interessierte kann in der„vCell“ eine virtuelle Reise durch dieZelle unternehmen. Ein ausgefeil-tes Navigationssystem unterstütztdabei an jeder Stelle die inhaltlicheund räumliche Orientierung und ermöglicht eine individuelle Nut-zung der Informationen. Sowohl bei„vCell.de“ als auch in der Raumin-stallation im Deutschen Technikmu-seum Berlin steht Interaktivität imMittelpunkt der Ausstellungspla-nung. Der Dialog mit der Wissen-schaft wird auf vielen Ebenen umge-setzt, ob beim direkten Gespräch mitrenommierten Fachleuten, bei Live-FO
TOS:
JÜ
RGEN
BERG
ER, M
PI F
ÜR
ENTW
ICKL
UN
GSB
IOLO
GIE
Die virtuelle Zelle – eine Multimediaaus-stellung der Max-Planck-Gesellschaft imWissenschaftssommerBerlin bietet eine nichtnur virtuelle Reisedurch die kleinste Ein-heit des Lebens: Zellenzum Anschauen undBegreifen in der vCell.
DIE ZELLE – BAUSTEIN DES LEBENS
Schaltungen in Forschungslabors aufder ganzen Welt oder bei Diskus-sionsforen im Internet. Aus der„vCell“ soll außerdem eine CD-ROMhervorgehen und – in Zusammenar-beit mit dem ZDF – ein Film entste-hen, der auch im „Zellkern-Kino“ zusehen sein wird. Die Internet-Platt-form „vCell.de“ ist zudem Grundlagefür weitere Präsentationen zu Lehr-oder Informationszwecken. Die„vCell“ wird gemeinsam mit derMultimedia-Agentur S+P Media AGtechnisch hochwertig realisiert.
Für die fachliche Qualität der vir-tuellen Zelle stehen renommierteWissenschaftler der Max-Planck-Ge-sellschaft: Prof. Stefan Kaufmann,Direktor am Max-Planck-Institut fürInfektionsbiologie, ebenso wie Prof.Christiane Nüsslein-Volhard, Direk-torin am Max-Planck-Institut fürEntwicklungsbiologie, und Prof.Hans Lehrach, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Gene-tik. Alle biologisch-medizinischenMax-Planck-Institute unterstützendas Projekt mit Ideen aus ihren For-schungsgebieten und aktuellem Bild-material. Das Deutsche Museum inMünchen entwickelt gemeinsam mitden Ausstellungsmachern Exponate,das Forschungsinstitut für Moleku-lare Pharmakologie und die Verlags-gruppe Georg von Holtzbrinck sindals Partner ebenfalls an der Umset-zung beteiligt. BEATRICE FROESE
GENOMSTATION
CHROMOSOMENPARK
PROTEINSTATION
GESUNDHEIT
ZELLKERN

Don Zagier
90 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1 2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 91
STAUDT-Preis
In Don Zagiers hellem Arbeitszim-mer biegen sich Regale unter
Büchern und Manuskripten. DerTisch ist unter Papierbergen kaumnoch als solcher erkennbar, Manu-skripte liegen sogar auf den Stühlen.In Zagiers Bücherregal finden sichWerke über „Elliptische Kurven“ und„Modulfunktionen“ und Ordner mitder Aufschrift „Ramanujan-Pro-blems“. Aber bei weitem nicht allenBänden sieht man an, was drin steht:Die Rücken schmücken kyrillischeund japanische Schriftzeichen, einschmalerer Band, noch einer der ver-ständlichsten, trägt den Titel „Delaatste Stelling van Fermat“. Stimmt,auch das stand im „Express“: Zagierspreche neun Sprachen fließend undverstehe noch mehr, habe mit 13Abitur gemacht, mit 16 sein Diplom,bekam mit 19 seinen Doktorhut auf-gesetzt und habilitierte sich mit 23Jahren – und sei also überhaupt soeine Art Wunderkind, dessen größteLiebe die Mathematik ist.
„Das mit den Sprachen ist etwasübertrieben“, sagt Zagier. „Natürlichspreche ich Deutsch und Englisch,auch Französisch und Niederlän-disch, weil ich in Amerika und Ut-recht und auch in der Schweiz gelebtund gearbeitet habe. Russisch undItalienisch verstehe ich immerhinganz gut. Das ist es eigentlich auchschon. Aber Sprachen interessierenmich. Zum Beispiel lese ich in der U-Bahn gerade einen japanischen
galen. Man sieht es an den unzähli-gen, mit Zeichen übersäten Notizzet-teln auf seinem Schreibtisch. „So ar-beite ich“, sagt Zagier, „viele meinerKollegen können im Kopf großeTheoreme aufstellen und durchden-ken. Ich dagegen muss immer rech-nen. Ich verbringe ganze Nachmitta-ge damit, Stöße von Papier mitRechnungen und Überlegungen zufüllen. Das können schon mal 100Blätter an einem Nachmittag sein.Erst dabei sehe ich, ob eine Idee gutwar oder nicht.“
BAHNBRECHENDE ARBEITEN
ZUR ZAHLENTHEORIE
Gute Ideen: Davon hat Zagierschon eine ganze Menge gehabt.Sein Gebiet ist die Zahlentheorie,sein Handwerkszeug der ausgefuch-ste Umgang mit elliptischen und sogenannten Modulfunktionen, insbe-sondere mit Jacobi-Formen – dassind im Prinzip Mitteldinge zwischenelliptischen Funktionen und Modul-funktionen, „die auch in der Physik
eine große Rolle spielen, zum Bei-spiel in der Stringtheorie, in der statistischen Mechanik und der kon-formen Feldtheorie.“ Zagier redetschnell, wenn er sich für ein Themabegeistert.
Also der Reihe nach. Modulfunk-tionen sind mathematische Gebilde,die auch beim lange gesuchten Be-weis des letzten Fermatschen Satzeseine außerordentlich wichtige Rollegespielt haben und daher – nicht zu-letzt durch Simon Singhs bekanntesFermat-Buch, das sich lange auf denSachbuch-Bestsellerlisten hielt – alseine der wenigen Errungenschaftenwirklich „esoterischer“ Mathematikeine gewisse öffentliche Aufmerk-samkeit fanden. Wenn man so will,bewegt sich auch Zagier im Dunst-kreis der „Fermat-Mathematik“. MitErfolg: Im Mai dieses Jahres bekamer für seine bahnbrechenden Arbei-ten zur Zahlentheorie den mit120.000 Mark dotierten Karl-Georg-Christian-von-Staudt-Preis überreicht– und das ist nur eine der vielen
Zur PERSON
Don Zagier Das „Bonner Superhirn“ ist nicht leicht zu finden. Es residiert
in einem historischen Gebäude mitten in der Fußgängerzone der
Bonner Innenstadt, dem MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR MATHEMATIK.
Das Haus war einmal die Bonner Hauptpost, gegenüber stehen
imposante Reste eines alten römischen Gemäuers, ein Café um die Ecke hat trotz des kalten Wetters
Mitte April bereits Tische draußen. Aber wer ist das „Bonner Superhirn“? Dahinter steckt der
Mathematiker PROF. DON ZAGIER, neben anderen Koryphäen wie Gerd Faltings, Günter Harder
und Yuri Manin einer der vier Direktoren des Bonner Instituts. Ausgedacht hat sich den „Titel“ eine
Reporterin der Zeitung „Kölner Express“, die vor einiger Zeit ein Porträt über Zagier verfasst hat.
DER STAUDT-PREIS Am 11. Mai bekam der Mathematikerund Direktor am Bonner Max-Planck-Institut für Mathematik, DonZagier, in der Aula des Erlanger Schlosses den mit 120.000 Mark do-tierten Staudt-Preis überreicht. Diese renommierte Auszeichnung fürherausragende deutsche Mathematiker, die sich durch zukunftsweisen-de Arbeiten auf dem Gebiet der theoretischen Mathematik hervorge-tan haben, ist benannt nach Karl Georg Christian von Staudt, der von1835 bis zu seinem Tod im Jahr 1867 den Lehrstuhl für Mathematikan der Universität Erlangen innehatte. Gestiftet wurde der Preis vonder 1986 ins Leben gerufenen „Otto-und-Edith-Haupt-Stiftung“, diesich auch die Förderung der wissenschaftlichen Arbeit am Mathema-
tischen Institut und die Einrichtung einer Gastprofessur im zweijäh-rigen Turnus zum Ziel gesetzt hat. Otto Haupt war als Inhaber desLehrstuhls für Mathematik in Erlangen von 1921 bis 1953 einer derNachfolger von Christian von Staudt; er starb 1988 im Alter von 101 Jahren und hinterließ der Stiftung ein beträchtliches Vermögen.Der in Rothenburg ob der Tauber geborene Patriziersohn von Staudtverlieh der Mathematik – insbesondere der Geometrie – wichtige Impulse, die bis heute fortwirken. Er studierte bei dem berühmten Mathematiker Karl Friedrich Gauß in Göttingen und wirkte nach seiner Promotion 1822 in Erlangen zunächst als Gymnasiallehrer inWürzburg und Nürnberg. Bereits als Gauß-Schüler tat sich von Staudt
Roman.“ Zagier zieht ein kleinesBändchen aus der Sakkotasche, großwie ein Reclam-Heftchen. Nur ja-panische Schriftzeichen. „WildeSchafsjagd“ von Haruki Murakami,sehr schön, fast ein Krimi. Auch einwenig sozialkritisch, kann ich sehrempfehlen“, sagt Zagier. Dann zeigter auf eine Reihe handschriftlicherNotizen im Buch: „Natürlich kannich das noch nicht fließend lesen, ichmuss noch viel nachschlagen.“ Wo-her dieser Spaß an fremden Spra-chen? „Vielleicht, weil meine Elternund ich so viel herumgekommensind. Mein Vater hatte im Laufe sei-nes Lebens fünf Staatsbürgerschaf-ten inne. Das ist meines Wissens Re-kord.“ Zagier lächelt wieder. Er selbstwurde in Heidelberg geboren und istin Amerika aufgewachsen.
Dass Don Zagier Mathematiker ist,sieht man nicht unbedingt an demgroßen Computer, der unter seinemSchreibtisch steht – eine Sun Work-station – und auch nicht unbedingtan den vielen Büchern in seinen Re-
durch Arbeiten auf dem Gebiet der Angewandten Mathematik hervor. So er-langte er zum Beispiel durch seine Berechnungen von Planeten- und Kometen-bahnen früh die Anerkennung seiner Fachkollegen. Von Staudts wissenschaft-liches Hauptwerk ist die „Geometrie der Lage“, die er 1847 publizierte – zwölfJahre nach seiner Berufung auf den ersten ordentlichen Lehrstuhl für Mathe-matik in Erlangen; damit schwenkte er im Alter von 37 Jahren auf seine eigentliche Gelehrtenlaufbahn ein. Mit „Geometrie der Lage“ wurde Christianvon Staudt zu einem der Wegbereiter der modernen nicht-euklidischen Geometrie, also jenes Werkzeugs, dessen sich später Albert Einstein bei derErschaffung seiner Relativitätstheorie bediente.Der Staudt-Preis wird im dreijährigen Turnus verliehen. Bisher gibt es erst vier
Preisträger: 1991 wurde Hans Grauert in Würdigung seiner wegweisenden Arbeiten zur komplexen Analysis ausgezeichnet; im Jahr 1994 folgte StefanHildebrandt, der für sein wissenschaftliches Gesamtwerk über Variationsrech-nung, über die Theorie der nicht-linearen partiellen Differentialgleichungenund die Theorie der Minimalflächen geehrt wurde. Im Jahr 1997 verlieh die „Otto-und-Edith-Haupt-Stiftung“ den Preis an Martin Kneser für seineBeiträge zur Theorie der quadratischen Formen und zur Arithmetik der algebraischen Gruppen. Don Zagier erhielt den Preis nun für seine bahnbre-chenden Arbeiten zur Zahlentheorie, die alte und neue Probleme mit Metho-den aus vielen mathematischen Disziplinen lösen und die Entwicklung der Zahlentheorie in den vergangenen Jahren wesentlich geprägt haben.
FOTO
S: R
UTH
ALBU
S

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 93
die Gleichung des Pythagoras erin-nert, also noch nicht gelöst? „Nein.Und ich rechne auch nicht damit,dass dieser Knoten noch zu meinenLebzeiten durchschlagen wird. Aberaus der Tatsache, dass ich Ihnen eineLösung für die 382 präsentierenkonnte, sehen Sie, dass wir Mathe-matiker durchaus schon einiges ver-standen haben“, sagt Zagier.
Der Schlüssel zur Lösung liegt ineinem ganz anderen Bereich der Ma-thematik, und Don Zagier gehörte zudenen, die ihn vor nicht langer Zeitschon ein kleines bisschen herumge-dreht haben. Hier liegt auch der Zu-sammenhang mit Fermats berühm-tem Problem, und hier kommen auchdie elliptischen Funktionen, die Mo-dulfunktionen und die Jacobi-Funk-tionen, mit denen sich Zagier so gutauskennt, ins Spiel.
Was sind das für eigenartige Funk-tionen? Im Prinzip solche, die nichtnur eine einfache Periodizität in einer Richtung aufweisen – wie zumBeispiel die Funktionen sin(x) undcos(x) – sondern in verschiedenenRichtungen periodisch sind. Wäh-rend trigonometrische Funktionenwie Sinus und Cosinus eine einfachePeriodizität haben (es gilt zum Bei-spiel sin(t+2π) = sin(t) für jedes t),weisen elliptische Funktionen einezweifache Periodizität sehr einfacherArt auf: Sie erfüllen für zwei unab-hängige Zahlen A und B die Glei-chungen f(x+A) = f(x) und f(x+B) = f(x). Ein Schachbrettmuster kannman sich als besonders einfache elliptische Funktion vorstellen, dienur zwei Werte annehmen kann:schwarz oder weiß.
Die Modulfunktionen schließlichhaben ebenfalls eine Periodizität(oder Symmetrie) in zwei oder meh-reren Richtungen. Diese verschiede-nen Symmetrien haben aber einekompliziertere Beziehung zueinan-
der, sie „kommutieren nicht“, wie derMathematiker sagt (Abb. 1). Und washat das mit dem Kubikfaktorproblemzu tun? Jetzt wird’s etwas mathema-tisch, aber der Clou folgt sofort: Dio-phantische Gleichungen wie zumBeispiel x3+y3 = 13 kann man durchelliptische Funktionen parametrisie-ren – das bedeutet, stark vereinfacht,„zeichnen lassen“. Ein einfacheresBeispiel macht klar, was gemeint ist:Die Gleichung x2 + y2 = 1 beschreibtbekanntlich einen Kreis. Aber einPunkt, der sich mit den Koordinatenx = sin(t) und y = cos(t) mit steigen-dem t durch ein Koordinatensystembewegt, bewegt sich dabei ebenfallsüber eine „Kreisbahn“, die mit demdurch die Kreisgleichung beschriebe-nen Kreis deckungsgleich ist – so wiedie Überlagerung zweier Sinus-schwingungen auf dem x- und y-Eingang eines Oszilloskops Kreiseund Ellipsen auf der Mattscheibe er-gibt. Die Kreisgleichung lässt sich al-so durch trigonometrische Funktio-nen parametrisieren.
Ganz analog funktioniert dies mitden diophantischen Gleichungen derZahlentheoretiker und elliptischenFunktionen. Dass das geht, wissendie Mathematiker übrigens schonseit Mitte des 19. Jahrhunderts. Ganzneu und geradezu bahnbrechend istindes die Erkenntnis, dass man hier-
zu aber auch auf Modulfunktionenmit ihren komplexen Symmetrienzurückgreifen kann. Das konnte erstvor kurzem Andrew Wiles, der „Be-zwinger“ von Fermats letztem Satzbeweisen – und genau dieser Beweiswar auch der eigentliche Schlüssel,mit dem er dieses Jahrtausendprob-lem letztlich gelöst hat. Damit habendie Mathematiker eine bedeutendeBrücke zwischen zwei eigentlich weitvoneinander entfernten Bereichender Mathematik geschlagen, dennnun können sich Zahlentheoretiker,die bei diophantischen Problemenwie dem Zagiers nicht weiterkom-men, stattdessen an Modulfunktio-nen versuchen – und aus deren Ver-halten Rückschlüsse auf ihre Zahlen-rätsel ziehen. Und über Modulfunk-tionen weiß man eine ganze Menge.
FESTE BRÜCKEN
FÜR MATHEMATIKER
Kann Don Zagier genauer er-klären, wie man von seinen Modul-funktionen zur Lösung der oben ge-nannten Zahlenrätsel kommt? „Dazumüssten Sie leider vorher fünf JahreMathematik studieren“, sagt der Ma-thematiker, aber man sieht ihm an,dass er es trotzdem gerne erklärenmöchte. So greift er wieder zumBlock, zeichnet ein paar Kurven undsagt: „In den 60er-Jahren haben die
STAUDT-Preis
92 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Auszeichnungen für Don Zagier.Worum genau dreht sich seine Ar-
beit? Zagier nimmt einen Bleistiftund erklärt. „Nehmen Sie diese ein-fache Frage: Welche Zahlen sindSummen von zwei Kubikzahlen?Schauen wir uns zum Beispiel die 35an:
35 = 27 + 8 = 3×3×3 + 2×2×2 = 33 + 23
Das war einfach. Bei der 7 ist esschon etwas kniffliger: 7 = 8 + (-1) = 2×2×2 + (-1)×(-1×(-1))
= 23 + (-1)3
Sie sehen, wir lassen auch negati-ve Zahlen zu. Aber jetzt betrachtenSie die 13:
13 = 351/27 = 343/27 + 8/27 = (7×7×7)/(3×3×3) + (2×2×2)/(3×3×3)
= (7/3)3 + (2/3)3 “Zagier lässt den Stift kurz sinken.
„An diesem Beispiel erkennen Sie,dass wir uns die Frage gleich nochein wenig interessanter gemacht ha-ben: Wir beschränken uns nicht aufganze Zahlen, sondern erlaubenauch Brüche ganzer Zahlen als Lö-sung. Doch trotz dieses Zugeständ-nisses ist die Zerlegung der 13 schonnicht mehr ganz so einfach. Undmanche Zahlen lassen sich über-haupt nicht auf diese Weise zerle-gen.“
Tatsächlich ist die Frage, wie manLösungen in ganzen oder in Bruch-zahlen einer unbestimmten Glei-chung ausfindig macht, eine der äl-testen, mit der sich Mathematiker
je beschäftigt haben – und zugleichimmer noch eine der aktuellsten.Über sie haben schon die Griechengegrübelt, kurz nachdem es einemMathematiker namens Diophant vorrund 1700 Jahren zum ersten Malgelungen war, algebraische Glei-chungen in einem einfachen syste-matischen Symbolismus zu formu-lieren. Diese Frage hat es offenbar insich: Diophants Schriften warenjahrhundertelang verschollen. Alsman sie – mehr als 1200 Jahre nachseinem Tode – wieder entdeckte, wa-ren sie ihrer Zeit immer noch voraus.Heute ist man natürlich weiter; den-noch gehören die Probleme der dio-phantischen Analysis zu den span-nendsten Fragen der „reinen“ Mathe-matik.
Könnte man die Lösung diophan-tischer Gleichungen wie der obenskizzierten nicht von einem Compu-ter herausfinden lassen? „Nein. Ein-mal abgesehen davon, dass dieser’brute force’-Ansatz keine richtigeMathematik wäre, weil wir dannvielleicht herausfinden können, wel-che Zahlen sich zergliedern lassen,aber immer noch nicht wüssten, wel-che Regel dahintersteckt. Aber Com-puter wären mit dieser Suche auchvöllig überfordert“, sagt Zagier. „Nehmen Sie einmal die 382. Die
Zahl sieht harmlos aus, aber um sieals Summe zweier Kubikzahlen dar-zustellen, brauchen Sie zwei Brüchemit einem 52-stelligen Nenner, näm-lich 8 122 054 393 485 793 893 167719 500 929 060 093 151 854 013194 574. Die Zähler sind noch grö-ßer. Da würden selbst die schnellstenheutigen Rechner um Größenord-nungen länger rechnen, als das Uni-versum existieren würde.“
VERBLÜFFENDE FRAGEN, DIE SPASS MACHEN
Allmählich ahnt man, warum Za-gier von dieser zunächst verblüffendeinfachen Frage fasziniert ist. Wa-rum ist es bei der 7 so leicht und beider 382 so schwierig, eine Lösung zufinden? Und warum gibt es zum Bei-spiel bei der 5 überhaupt keine?Warum machen die Zahlen das? Za-gier: „Die Auswahl der Probleme, mitdenen man sich beschäftigt, ist eineArt Kunst. Ähnlich wie ein Musikerbei der Komposition einer Melodieim Prinzip aus den unendlich vielenmöglichen Melodien auswählt, sowählen wir Mathematiker aus denzahllosen offenen Fragen, die es gibt,die aus, an denen wir etwas lernenkönnen. Oft merkt man erst auf denzweiten Blick, was hinter einer Fragesteckt. Dass sie uns weiterbringenkann. Dann machen sie Spaß. Dashier ist so eine.“
Dann ist diese simpel aussehendeAufgabe, die sogar ein bisschen an
Zur PERSON
Abb. 1: Trigonometrische Funktionen haben eine „ein-fache“ Periodizität – wie das Band unten. Das Kachel-muster aus Fischen und Booten (links) ist dagegen inzwei Richtungen periodisch wie eine elliptische Funktion.Modulfunktionen schließlich zeigen eine noch komple-xere Symmetrie – wie zum Beispiel das Arrangement aus
Engeln und Teufeln (rechts). Trotz ihrer Komplexität weißman heute sehr viel über Modulfunktionen. Und seit vor
wenigen Jahren der Beweis für Fermats berühmten letztenSatz gelungen ist, können sie sogar zum Schlüssel für wichtige
mathematische Rätsel aus dem Reich der Zahlentheorie werden.
Exkursionen zu den spannendsten Fragen der „reinen“ Mathematik: Computer sind hier überfordert.

2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 95
plötzlich alles nicht mehr so sicher.Das heißt: Die Zahl kann dann zer-legbar sein, muss aber nicht.
Aber: „Immer, wenn man bisherbei Zahlen nachgesehen hat, derenL-Funktion auf eine mögliche Lö-sung hinweist, hat man bisher aucheine gefunden“, sagt Zagier. Das isttrotz aller Abneigung der „brute-Force-Computer-Mathematik“ ge-genüber ein starker Hinweis darauf,dass die BSD-Vermutung auch hiermit ziemlicher Wahrscheinlichkeitgilt. Der Bonner Mathematiker dazu:„Es ist nämlich eine interessante Iro-nie der Natur, dass Zahlen, deren L-Funktionen Nullstellen in höherenAbleitungen haben, besonders ein-fach zergliedert werden können. EinBeispiel ist die 657. Die zu dieserZahl gehörende L-Funktion hat eineNullstelle zweiter Ordnung.“ Zagierstartet ein kleines Programm undtippt die 657 ein. Tatsächlich: InSekundenbruchteilen ist der Bild-schirm voller Ergebnisse – keines hat52 Stellen. Hier nur zwei davon:
657 = (17/2)3 + (7/2)3 oder 657 = (163/19)3 + (56/19)3
„Das heißt: In genau den Fällen, indenen es für uns schwierig wird,wird es für den Computer wiederleicht. Wir wissen nämlich, dass esimmer dann, wenn es eine Zerle-gungsmöglichkeit gibt, immer gleichunendlich viele weitere geben muss.Also keine oder gleich unendlichviele. Verschwindet die L-Funktionan ihrer Nullstelle mehrfach, zumBeispiel an einem Sattelpunkt, gibtes gewissermaßen mehr als nur eineunendliche Menge an Lösungen,“sagt Zagier. Ein schwacher Trost –hinter dem allerdings wieder eineAufgabe steht, die Spaß macht, weilsie sich anfühlt, als hätte sie eine Lö-sung, an der man etwas lernen kannüber das verrückte Verhalten der
STAUDT-Preis
94 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
beiden englischen MathematikerBirch und Swinnerton-Dyer einenach ihnen benannte Vermutungaufgestellt, die inzwischen zu denberühmtesten ungelösten Problemender Mathematik gehört – und übri-gens eines der sieben ist, auf derenLösung der Amerikaner Landon ClayPreise von jeweils einer MillionDollar ausgesetzt hat. Diese Vermu-tung nun impliziert, dass man mit-hilfe der Theorie der Modulfunktio-nen jeder natürlichen Zahl n durcheine einfache Berechnung eine wei-tere Zahl zuordnen kann, die folgen-de Eigenschaft hat: Wenn sie gleichNull ist, dann kann man n in zwei
Kubikzahlen zerlegen. Wenn sienicht gleich Null ist, ist n gemäß un-serer obigen Fragestellung nicht zer-legbar.“
Die Mathematik dahinter ist weni-ger abstrakt, als man vermuten wür-de. Um zu erklären, worum es geht,reicht ein kleines Blatt Papier (Abb.2). Eine Zahl einer anderen zuordnen– das gelingt zum Beispiel mit Funk-tionen, wie man sie im Prinzip ausder Schule kennt. Zagier zeichnet eine an die Tafel – im Hörsaal desInstituts, einem Raum, in dem voretlichen Jahrzehnten noch 400 Tele-fonistinnen Verbindungen hergestellthaben. „Das ist eine Funktion, diewir L(s) nennen. Für jede diophanti-sche Gleichung wie zum Beispiel diebereits genannte x3+y3 = 13 kannman so eine Funktion aufstellen.Wenn L(s) an der Stelle 1 nicht Nullwird, hat die dazugehörige Glei-chung keine Lösung, und Sie könnendie dazugehörige Zahl n nicht inzwei Kubikzahlen zerlegen.“ Das haben bereits die Fermat-PioniereCoates, Wiles und Kolyvagin bewie-sen. Von Don Zagier und seinemamerikanischen Kollegen BenedictGross kam hingegen gewissermaßendas Gegenstück: der Beweis, dass diezu L(s) gehörende Zahl n zerlegtwerden kann, wenn die L-Funktiondie s-Achse schneidet, das heißt, ander Stelle 1 eine endliche Steigunghat. Der Beweis ist 96 eng beschrie-bene Druckseiten lang; die zentraleFormel in diesem Beweis – zugleichdie längste – erstreckt sich über einehalbe Seite.
Mit der L-Funktion können dieZahlentheoretiker jetzt also eine Ta-belle aufstellen: Jede ganze Zahl n(es geht um die Gleichung x3+y3 = n)erhält durch die Brücke zwischen derTheorie der Modulfunktionen undder Zahlentheorie ihre zugehörigeFunktion L(s), und wenn die an der
Stelle 1 keine Nullstelle hat, ist nnicht in Kubikzahlen zerlegbar. Beider 6 steht in dieser Tabelle aller-dings so eine Null (6 = (17/21)3+(37/21)3), auch bei der 7 – und der382 mit ihren monströsen gebroche-nen Kubikfaktoren. Das macht dieArbeit der Zahlentheoretiker zugege-benermaßen leichter. Auch um dievertrackten Kubikzahlen zu finden,in die sich die solcherart „enttarn-ten“ Zahlen zerlegen lassen, hat Za-gier eine Teillösung parat. Sie hat zutun mit so genannten Heegnerpunk-ten und Formeln, die ebenfalls überhalbe Seiten gehen und gleichfallsziemlich komplex sind, aber siefunktioniert: Es gibt inzwischen so-gar eine Hand voll Programme, dieanhand dieser Formeln in Sekunden-bruchteilen die Kubikfaktoren einereinmal als zerlegbar identifiziertenZahl ausdrucken – wie diesen Bruchmit dem 52-stelligen Nenner.
„INTERESSANTE
IRONIE DER NATUR“
Null oder nicht null – damit solltedoch alles klar sein, oder? Nein,nicht unbedingt. Dass die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung trotzallem immer noch nicht voll bewie-sen ist, hat mit dem Begriff „Null-stelle“ zu tun. Und das Problem istso vertrackt, dass es das Rennen umdie Lösung des Kubikfaktoren-Rät-sels durchaus noch eine Weile offenhalten dürfte. Denn: „Nullstelle derL-Funktion“ kann bedeuten: Schnitt-punkt mit der s-Achse (endliche Stei-gung) oder Nullstelle höherer Ord-nung (Tangente, Sattelpunkt). „Wirkonnten die Birch-Swinnerton-Dyer-(BSD)-Vermutung leider bislang nurfür den einfachen Fall eines Schnittsmit der s-Achse beweisen“, sagt Zagier. Das bedeutet: Zeigt die L-Funktion also einen Sattelpunkt odereine Nullstelle höherer Ordnung, ist
Zur PERSON
L(s)
1 s
L(s)
1 s
L(s)
1 s
Zahlen und die erstaunliche Komple-xität, die sich dahinter verbirgt.
Wie bemerkt man denn, dass manbei derart anspruchsvollen Rechnun-gen und Überlegungen, wie sie hin-ter einem solch komplexen Beweisstehen, auf dem richtigen Weg ist?Wie kommt man auf gute Ideen?Oder: Wie kommen diese Ideen zueinem? Springen die einen an, unterder Dusche, am Schreibtisch, in derU-Bahn? Sind die morgens einfachda? „Nein. Diese Ergebnisse sind dasResultat harter Arbeit.
Ich brauche zum Beispiel immerkonkrete Anlässe für meine Arbeiten,häufig Probleme, mit denen zumBeispiel Kollegen zu mir kommen,daher gibt es unter meinen Veröf-fentlichungen eine ganze Reihe, dieich mit anderen geschrieben habe.So habe ich als Mathematiker imLaufe der Jahre viele Erfahrungengesammelt. Wenn Sie viel arbeiten,haben Sie auch viele Erfolge undEinsichten, auf die Sie dann bei derLösung neuer Probleme zurückgrei-fen können. Und viele Dinge siehtman dann irgendwann einfach. Ichhabe zum Beispiel neulich einen al-ten Brief von mir gefunden, in demich einer Kollegin bei einem Beweisgeholfen habe. Ich wundere michheute, mit welcher Naivität ich da-rangegangen bin, wie ich die Be-
weiskette Schritt für Schritt exaktaufgeschrieben habe. Heute würdeich viele Schritte gar nicht mehr er-wähnen. Meine Studenten leiden danatürlich manchmal ein wenig drun-ter“, sagt Zagier.
WOHER KOMMEN
ALL DIE GUTEN IDEEN?
Also wirklich nichts als Schweißund Tränen? „Natürlich hat manschon mal Geistesblitze, aber eigent-lich funktioniert das schon anders.Wenn ich zum Beispiel merke, dasseine Idee in eine Sackgasse führt,verfolge ich sie doch erst einmalweiter. Später erkenne ich dann, wodas Problem lag, und kann es beimnächsten Mal umgehen. So arbeiteich mich allmählich an die Lösungheran.
Und irgendwann merkt man dann,dass die Zusammenhänge klarerwerden, dass man auf dem richtigenWeg ist: Und dann plötzlich liegt al-les vor einem. Die Dinge werden ein-fach, wenn man sich der Lösungnähert – von zwei vermeintlichenLösungen ist die einfache häufig diebessere“, sagt Zagier. „Das ist durch-aus eine ästhetische Kategorie. Ma-thematik ist in diesem Sinne tatsäch-lich mehr Kunst als harte Wissen-schaft. Die Suche kann allerdingsJahre dauern.“ ❿
Abb. 2: Die L-Funktion verrät, ob sich die Gleichungx3+y3 = n lösen lässt. Zu jedem n gehört eine eigene L-Funktion. Hat sie bei s = 1 eine einfache Nullstelle, istdie dazugehörige diophantische Gleichung lösbar. DerBeweis für diese Aussage ist 96 eng beschriebene Druck-seiten lang und funktioniert mit Modulfunktionen.
„Mathematik ist manchmal mehr Kunst als harte Wissenschaft.“
Keine Nullstelle:
Keine Lösung
Einfache Nullstelle:
Es gibt immer eine Lösung
Nullstellehöherer Ordnung:
Existenz einer Lösungwird vermutet, ist aber nicht sicher

96 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Und in diesen Jahren kreist bei Za-gier fast alles nur um Mathematik.Tagsüber, abends: Er ist ein echterBerufener. So macht es ihm zum Bei-spiel Spaß, mit Freunden nach Feier-abend Sätze wie Eulers berühmteFormel
1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + ... = π2/6zu diskutieren, so wie andere sichüber neue Kinofilme unterhalten.Oder einen alten Satz von Fermat,der voraussagt, welche Primzahlensich in zwei Quadratzahlen zerlegenlassen. Mit Beweisen für diesen Satzkönnte man mittlerweile zwar schonein Buch füllen, aber Zagiers ist derbislang kürzeste. Wichtig sei es eben,sagt Zagier, als Mathematiker nichtständig bloß große Theoreme zu wäl-zen, sondern sich auch mal – durch-aus spielerisch – mit kleineren Auf-gaben zu beschäftigen. Schließlich,so kommt es einem in den Sinn, hatauch Mozart nicht pausenlos guteMusik geschrieben, sondern sichauch mit Lappalien auseinanderge-setzt – und daraus vielleicht Inspira-tion für seine großen Werke gezogen.
Also doch kein Überflieger? Hoch-schulreife mit 13, mit 24 jüngsterProfessor Deutschlands? Kein Genie?„Nein, sicher nicht.“ Don Zagierlächelt wieder, und er wirkt über-haupt nicht verlegen. Und wenn er
seinen Lebenslauf erzählt, wirkt dertatsächlich weitaus weniger spekta-kulär als unter einer dicken Über-schrift. So war Don Zagier zunächstsogar ein schlechter Schüler – in derSchule schlicht unterfordert, wie vie-le Hochbegabte. Eines Tages schlu-gen seine Lehrer vor, er solle viel-leicht ein Jahr überspringen – inAmerika damals die absolute Aus-nahme. „Meine Eltern haben michdas entscheiden lassen, und ich habeja gesagt.“ Das half: Der Unterrichtbegann Spaß zu machen, und fürZagier geriet das Überspringen ir-gendwann zum Sport. „Ich wollte sehen, wie weit man das treibenkann. Dabei wurde mir allerdingsnichts geschenkt: Ich musste nichtnur alle Prüfungen bestehen, son-dern auch alle Kurse besuchen, andenen man teilnehmen musste, auchdie der Jahre, die ich übersprungenhabe.“ Hat er deshalb auf etwas ver-zichten müssen? „Nein, ich habe einganz normales Leben geführt. Ichhatte eine Freundin, ich war Eislau-fen. Gut, ich hatte etwas wenigSchlaf. Aber ich hatte auch Unter-stützung durch meine Kommilito-nen. Das hat mir sehr geholfen.“
NACH ZWEI JAHREN
DAS DIPLOM – AUS HEIMWEH
Und das Studium – sein Diplomhielt er schließlich bereits im Altervon 16 in der Hand? „Da hatte ich eseilig. Meine Eltern zogen in dieSchweiz, gerade als ich meine Schulebeendet hatte. Weil ich so jung war,konnte ich in Europa nicht studieren.Also ging ich zurück ans MIT inCambridge, Massachusetts, und be-eilte mich – aus Heimweh.“ Die Pro-motion in Oxford schließlich – mit19, endlich in Europa, endlich wiederin der Nähe der Eltern – hatte mitdrei Jahren Dauer eine fast normaleSpanne. „Hier habe ich im ersten
Jahr so gut wie nichts geschafft: Ichhatte das Studium wohl doch etwaszu schnell durchgezogen, der Stoffsaß noch nicht so recht, das mussteich dann nacharbeiten. Später habeich dann meinen Doktorvater ge-wechselt und bin nach Bonn gekom-men“ – zu Friedrich Hirzebruch, demgenialen Mathematiker und Grün-dungsdirektor des Bonner MPI fürMathematik. Hier habilitierte er sichdann mit 23 Jahren, wurde mit 24Jahren Professor und folgte seinemMentor nach dessen Emeritierung als geschäftsführender Direktor desMax-Planck-Instituts für Mathema-tik nach.
Eine beeindruckende Vita. Aber esstimmt: Wer sich noch einmal in Zagiers Arbeitszimmer umsieht, imBücherregal, in den Stößen eng be-schriebener Notizzettel, der erkenntbald, dass dieser brillante Lebenslaufvielleicht wirklich nicht so wichtigist. Zwar hat Zagier von 1990 bis2001 auch in Utrecht und Bonn ge-lehrt, und von Mai 2001 an wird ereinen Teil seiner Zeit als Professoram renommierten Collège de Franceverbringen. Er war und ist also vielauf Reisen. Aber wer Zagier zuhört,wie er von seiner Arbeit erzählt, undvon dem „Spaß, den eine neue Auf-gabe machen muss“, der erkennt,dass er in gewisser Weise inzwischenangekommen ist, nachdem er undseine Familie so viel unterwegs wa-ren. Und dass er vielleicht sogar im-mer schon zu Hause gewesen ist,egal, wo er war, ob in Amerika, Ox-ford, in der Schweiz oder in Bonn –weil seine Liebe tatsächlich der Ma-thematik gehört. Und dann verlässtman Zagiers Arbeitszimmer mit demsicheren Gefühl: Auch wenn es ihmnicht gelingen sollte, die endgültigeLösung für sein Zerlegungsproblemzu finden – die Suche danach wirdihm Spaß machen. STEFAN ALBUS
Zur PERSON
Zu Hause in der Welt der Zahlen: Professor Don Zagier vor dem neuen Institutsgebäude in der Bonner Innenstadt.
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 97
INSTITUTEProf. Franz Emanuel Weinert, emeri-tiertes Wissenschaftliches Mitglied undehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung,München, ist am 7. März überraschendim Alter von 70 Jahren gestorben. Ergalt als international führender For-scher auf den Gebieten der Lern- undEntwicklungspsychologie. Darüber hin-aus engagierte sich Weinert aber auchim Wissenschaftsmanagement und wirktein der Max-Planck-Gesellschaft 15 Jahreals Senatsmitglied. Von 1990 bis 1999 hat-te Weinert zudem das Amt des Vizepräsi-denten der Max-Planck-Gesellschaft inne.
Weinert wurde 1980 zum Wissenschaft-lichen Mitglied des Max-Planck-Instituts fürSozialwissenschaften berufen und war ab1981 Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für psychologische Forschung inMünchen, das er gemeinsam mit seinen Kol-legen und Mitarbeitern zu einer weltweit an-gesehenen Forschungsstätte ausgebaut hat.Als Honorarprofessor lehrte er an den Univer-sitäten Heidelberg (seit 1981) und München(seit 1983), außerdem war er Vizepräsidentder Deutschen Forschungsgemeinschaft von1980 bis 1986 und Präsident der DeutschenGesellschaft für Psychologie (1984-1986).Nach der Wiedervereinigung Deutschlandshat Weinert als Vorsitzender der Max-Planck-Präsidentenkommission „Geisteswissenschaft-liche Zentren“ den Aufbau der Geistes- undSozialwissenschaften in den neuen Bundes-ländern maßgeblich mitgestaltet. Schwerpunkte der wissenschaftlichen ArbeitWeinerts waren die kognitive Entwicklung,insbesondere die Entstehung individueller In-telligenz-, Motivations- und Persönlichkeits-unterschiede im Verlauf des menschlichen Le-bens. Zusätzlich setzte er sich mit der Ver-knüpfung von Regelhaftigkeiten der kog-nitiven Entwicklung, Mechanismen des Ler-nens und den Optimierungsmöglichkeiten desLehrens auseinander. Für diese Arbeiten hatdie Arthur-Burkhardt-Stiftung für Wissen-schaftsförderung im Stifterverband für diedeutsche Wissenschaft Weinert 1998 mit dem„Arthur Burkhardt Preis“ ausgezeichnet.
Zum Gedenken an Franz Emanuel Weinert dokumentie-ren wir nachfolgend die Rede von Hubert Markl, Präsi-dent der Max-Planck-Gesellschaft:
„Ich hätte mir sehr gewünscht, dies nicht erleben zu müs-sen; nicht als jemand, der sich Franz Emanuel Weinert
seit Jahrzehnten eng und herzlich verbunden gefühlt hat;nicht als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, in der erseit 20 Jahren gewirkt und in der er so viel Gutes bewirkt hat. Mir ist, als sei es erst gestern gewesen, dass wir ihm am
22. September 1998 anlässlich seiner Emeritierung für alles Geleistetedankten und ihm eine lange, endlich von vielen Pflichten erleichterte,gute Zukunft an der Seite seiner lieben Frau wünschten. Alt-PräsidentHorst Fuhrmann, der bewährte Fuhrmann der Bayerischen Akademie derWissenschaften, lud deren seit 1984 besonders prominentes Mitglied so-gar noch herzlich ein, doch künftig in der Akademie numquam otiosus,also weiter nach Kräften tätig zu sein. Nun hat ihn ein grausames Schick-sal so kurz danach schon zur ewigen Ruhe gerufen. Der Tod, der doch - da er allem, was lebt, gewiss bevorsteht - die natür-lichste Tatsache der Welt ist, ist zugleich die schrecklichste Zumutung,die das Leben für jeden von uns bereithält; ein unfassbar endgültig tren-nender Schnitt, der zerreißt, was so lange bewährt zusammengefügt war.Er ist die Gewissheit jedes Lebens und dennoch eine Wahrheit, die manmit Schmerzen ertragen, aber nur unter dem Zwang des Schicksals hin-nehmen kann. Mir ist, als sei mit dem Tod von Franz Emanuel Weinert auch ein Stückmeines eigenen Lebens der letzten Jahrzehnte dahingegangen, so engwar er mehrmals mit dem, was mein Leben bestimmte, verbunden. Vorallem aber hinterlässt sein Tod bei mir das bestürzende Gefühl einesgroßen Verlustes, von dem man nicht weiß, wie er sich ausgleichen lassensoll. Ich hatte zweimal über mehrere Jahre hin das Privileg, mit ihm zu-sammenzuarbeiten: zuerst, als wir gemeinsam Vizepräsidenten der Deut-schen Forschungsgemeinschaft waren und dann, als er mir in den erstenJahren meiner Amtszeit als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, wie-derum als Vizepräsident, mit Rat und Tat zur Seite stand. Wer die Erfah-rungen solcher Zusammenarbeit mit ihm machen durfte, der konnte im-mer wieder nur bewundern, wie sich in diesem Manne unermüdlicherFleiß, wissenschaftliche Neugier, glänzende Formulierungsgabe, nüchter-ne Rationalität, unbestechliches Qualitätsbewusstsein, weise abwägendeUrteilskraft, kompromisslose Ehrlichkeit, Bescheidenheit und makelloseRedlichkeit mit einer tiefen Menschlichkeit verbanden, wie sie nur demgegeben ist, der die Menschen kennt, und der sie vielleicht gerade des-halb liebt, weil er sich nicht in ihnen täuscht.Man mag darin viele Eigenschaften des erstklassigen Fachmanns der wis-senschaftlichen Psychologie und Pädagogik, des Menschenverstehensund der Menschenführung erkennen wollen. Aber wer nur genügendPsychologen und Pädagogen kennen gelernt hat, weiß: Das war nicht nurhöchste professionelle Qualifikation, die Franz Emanuel Weinert ver-körperte, das war vor allem der Mensch Weinert, der bestes Können indem Feld seiner weit gespannten wissenschaftlichen Interessen mit den
NACHRUF Zum Tod von Franz Emanuel Weinert
aktuell
FOTO
: WO
LFG
ANG
FILS
ER

„Mit dem unerwarteten und viel zu frühen Hinscheiden von TyllNecker hat Deutschland am 29. März 2001 einen seiner Besten
verloren. Freie, demokratische Gesellschaften leben von dem Engage-ment gerade der tüchtigsten Frauen und Männer für das gemeinsameWohl der ganzen Gemeinschaft. Tyll Necker hat dieses Engagement einLeben lang beispielhaft gelebt und verwirklicht. Der eindrucksvolle Er-folg seines unternehmerischen Handelns war für ihn niemals Selbst-zweck, sondern allenfalls ein Teil eines viel umfassenderen menschlichenund gesellschaftlichen Auftrags: zu verantwortlicher Lebensführung alsMitglied eines Volkes, einer durch Kultur und Geschichte verbundenenGemeinschaft von Menschen, die wiederum in der Gemeinschaft mit al-len anderen Nationen ihrer Vergangenheit eingedenk die Aufgaben derGegenwart meistern und den Weg in eine gute Zukunft bahnen muss.Tyll Necker hat sein aktives Leben immer im Bewusstsein solcher Verant-wortung geführt, er hat seine Kräfte dabei niemals geschont und sich sosehr für das eingesetzt, was ihm wichtig war, dass zu fürchten ist, seinfrüher Tod könnte der höchste Preis sein, den er für solchen Einsatz ent-richtet hat. Ein Mann von untadeligem Charakter, von selbstloser Be-scheidenheit verbunden mit furchtloser Geradlinigkeit, ein Bürger, demfür den Dienst an seinem Land keine Last zu schwer war; ein Mensch mitjener selbstsicheren Gelassenheit, die nicht aufzutrumpfen braucht, weilsie sich ihrer Sache sicher ist; seinen Freunden ein einfühlsam bedachterRatgeber, und immer von jener gewinnenden Herzlichkeit, die jedenfröhlich stimmen musste, der mit ihm in entspanntem Kreis zusammen-sein durfte. An solchen Menschen hat kein Volk einen Überfluss, sie sindebenso wertvoll wie selten und umso wertvoller je seltener sie sind. Ei-nen wie ihn zu verlieren macht uns alle, die wir betroffen und trauerndzurückbleiben, ärmer und füllt uns mit dem bangen Bewusstsein einesVerlustes, der sich nicht leicht ausgleichen lässt, obwohl das weiterströ-mende Leben darauf nicht lange Rücksicht zu nehmen pflegt. Aber alle,die Tyll Necker näher begegnen durften, wird immer wieder das Gefühldieses Verlustes erfüllen, das durch gute Erinnerungen eher vertieft alsgemindert wird. Er war ein im klassisch-republikanischen Sinne vir pro-batus, einer jener bewährten, trefflichen Männer, auf die ein Land ange-wiesen ist und auf die es sich vorbehaltlos verlassen kann.Für den rastlos tätigen Unternehmer Tyll Necker, für einen solchenMann des praktischen Handelns, war es gar nicht selbstverständlich,dass er sich auch zu Grundlagenforschung und erkenntnissuchenderWissenschaft hingezogen fühlen sollte. Vielleicht nicht wirklich „hinge-zogen“ zu jenen manchmal doch reichlich weltvergessen versponnenenEgozentrikern der reinen Erkenntnissuche, denen die Lösung eines wis-senschaftlichen Problems alles, die sich daraus ergebenden Konsequen-zen aber häufig wenig bedeuten; aber – und das war eben auch TyllNecker – doch offenbar höchst neugierig darauf, was das Neue, das die-se Forscher entdecken, vielleicht zur Lösung jener Probleme beitragenkönnte, die ihm noch weit wichtiger waren als die Rätsel der Erkenntnis,nämlich die Probleme des praktischen Daseins. Tyll Necker hatte eineklare und tiefe Einsicht in die Bedeutung, die neues Wissen und besseresKönnen durch wissenschaftliche Forschung und technische Entwicklungfür das tagtägliche Leben seiner Mitmenschen haben und in ständigweiterwachsendem Maße haben werden. Bildung durch und für Wissen-schaft, Kreativität durch originelle Forschung, Vermittlung eines besse-ren Verständnisses unserer Wirklichkeit durch qualifizierte Lehre, Förde-rung erfinderischer Wissensnutzung im Wettbewerb der besten Köpfeund Gruppen von Menschen – all dies waren für ihn die Erfolgsvoraus-setzungen einer modernen Leistungsgesellschaft und zugleich Herzens-anliegen eines Menschen, der nur zu deutlich und voller Ungeduld er-kannte, wie groß die ungelösten Probleme menschlicher Zukunft, wienotwendig neue, bessere Einsichten und Handlungsmöglichkeiten zu de-ren Lösung sind. Ich erinnere mich an viele intensive Gespräche mit Tyll Necker – im Vor-
stand des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft, in Beratungs-runden der Bundesregierung, im Senat, dem er seit 1990 angehörte undinsbesondere seit 1996 als Mitglied des Verwaltungsrates der Max-Planck-Gesellschaft, und schließlich als deren Vizepräsident seit 1999.Dabei fragte er mich immer wieder eindringlich danach, was die Wissen-schaft, was insbesondere Forscher in Max-Planck-Instituten gezielt dazubeitragen könnten, um ganz neue Antworten auf drängende Fragenmenschlicher Lebenspraxis heute und in der Zukunft zu finden. Von al-ternativen Wegen der Energieversorgung bis zu innovativen Lösungeninternationaler Rechtsordnungen, von der verantwortlichen Nutzunggenetisch modifizierter Nutzpflanzen bis zur Aufklärung der Ursachenhistorischer Entwicklungen, von der rationalen Fortentwicklung der So-zialversicherungssysteme durch internationalen Vergleich bis zur Epide-miologie von Infektionskrankheiten – bedrückend zu wissen, dass erselbst einer davon zum Opfer fiel.Immer war sein Fragen weit offen für neue Antworten, nie war es ihmgenug, nur über den Stand des Wissens belehrt zu werden – soweit ichdafür im Einzelnen überhaupt ein kompetenter Gesprächspartner seinkonnte. Stets wollte er möglichst genau erfahren, was hier und jetzt zutun notwendig wäre, am liebsten von den besten Fachleuten, mit denener bei Besuchen in unseren Instituten das intensive Gespräch suchte –eine ganze Liste solcher Besuche hatte er sich für die nächste Zeit vor-genommen.Unvergesslich ist mir ein letztes solches Gespräch vor wenigen Wochenüber die Ursachen und Gefahren der neuartigen, durch Prionen hervor-gerufenen neurodegenerativen Erkrankungen. Wie so oft war es ihm einAnliegen, dass auch die Forschung in Max-Planck-Instituten dazu den ihrmöglichen Beitrag leisten möge; er drängte auf rasches, zielbezogenesForschen und Handeln und fragte nach aussichtsreichen Vorhaben undden dafür notwendigen Mitteln. Wir gerieten dabei in ein kleines Wech-selgespräch aus unterschiedlichen Perspektiven, in dem er den oft gehör-ten Bewertungstopos der „Versündigung an der Natur“ aufgriff, der sichjene schuldig gemacht hätten, die Tiernahrung aus Rinderleichen wiederan natürlicherweise pflanzenfressende Rinder verfütterten.Als ich ihm in Anspielung auf das berühmte Wort Talleyrands antwortete,dabei handele es sich meines Erachtens um Schlimmeres als eine Sünde,nämlich um einen eklatanten Fehler des Handelns auf unzureichend ge-prüfter Wissensgrundlage, gab er mir mit der ganzen Weisheit prakti-scher Lebenserfahrung lächelnd zurück, ich möge zwar in der Sachedurchaus Recht haben, aber doch auch bedenken, dass man Menschenvielleicht leichter lehren könnte, sich nicht zu versündigen, als keine wis-senschaftlich-technischen Dummheiten zu machen, die sie zumeist dochnicht verstünden. Ich glaube, das war der ganze Tyll Necker, der nicht nurwissen wollte, was die Fakten sind, sondern was in Kenntnis der Fakten zutun ist, um dafür zu sorgen, dass ein gesellschaftliches, ökonomischesund vor allem auch moralisches Problem gelöst werden kann.Seine zugewandte Offenheit für die Wissenschaft, seine Freude an neu-en Erkenntnissen, die nüchterne Weisheit seines abwägenden Urteils,sein blitzgescheiter Witz, sein fröhliches Lachen – all das wird derganzen Max-Planck-Gesellschaft, seine freundschaftliche Zuwendungund sein kluger Rat werden deren Präsidenten heute und künftig sehrfehlen. Wir alle werden den großmütigen und charmanten, den warm-herzigen und urteilssicheren Freund der Wissenschaften Tyll Necker sehrvermissen, wir fühlen dies zu dieser Gedenkstunde ganz besonders. Ichwerde mich immer dankbar an seinen Rat und seine Unterstützung erin-nern, die er mir stets gewährte, und lasse sein menschenfreundlich fröh-liches Lachen in mir fortklingen. Deutschland hat einen seiner Bestenverloren; das gilt für die Wissenschaft Deutschlands und für die Max-Planck-Gesellschaft in besonderem Maße. Sie fühlt sich ihm dankbarverpflichtet und wird ihre Aufgaben so zu erfüllen suchen, dass er seineFreude daran hätte, wenn er noch unter uns weilte.“ �
INSTITUTE aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 99
INSTITUTE aktuell
98 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
NACHRUF Zum Tod von Tyll Necker
herausragenden Gaben eines lauteren Charakters verband, wie man ihnnur bei wenigen Menschen findet, die beispielgebend sind und die unsalle dadurch am meisten helfen und bereichern können. Franz Emanuel Weinert war ein zu Recht international höchst angesehe-ner Erforscher der menschlichen Psyche und ihrer Entwicklung. Unbe-einflusst von den Strömungen des Zeitgeistes hat er vor allem in lang-wieriger, mühevoller Forschungsarbeit gemeinsam mit seinen Mitarbei-terinnen und Mitarbeitern erkennbar zu machen gesucht, wie angebore-ne Anlagen und Entwicklungsbedingungen bei der Entfaltung menschli-cher Fähigkeiten zusammenwirken. Die Einsichten, die daraus - empirisch belegt - folgten, waren nicht im-mer populär, geschweige denn politisch opportun. Er hat sie ebenso un-bestechlich gegen ideologische Voreingenommenheit von links wie vonrechts mit den rationalen Argumenten der Wissenschaft vertreten undhat damit Respekt und Ansehen von allen Seiten erworben. Er hat so vor allem auch Theorie und Praxis pädagogischer Arbeit nach-haltig verändert, in der Förderung Benachteiligter genauso wie in derFörderung Hochbegabter. Es schmerzt freilich zu wissen, dass sich vielesaus diesen Forschungsergebnissen, was er in den kommenden Jahrennoch weiter mit einmaligem Kenntnisreichtum und vielseitiger Erfah-rung erkennend und vermittelnd zu vertiefen erhoffte, wegen seines all-zu frühen Todes nun nicht mehr von ihm lernen lässt. Aber was er anabgeschlossenem wissenschaftlichem Oeuvre hinterlässt, zeugt umfas-send von großer gedanklicher Reife und unermüdlicher Schaffenskraft.Die vielen Auszeichnungen und Ehrungen, die Ehrendoktorate und Ho-norarprofessuren bezeugen die Achtung und Wertschätzung, die erdafür erfuhr.Andere können die so gewürdigten wissenschaftlichen Leistungen FranzEmanuel Weinerts weit kompetenter darstellen, als mir dies möglich ist.Aber ich möchte doch nicht versäumen, aus meiner Sicht ganz beson-ders auf seine wissenschaftsfördernden und wissenschaftsorganisato-rischen Leistungen hinzuweisen. Man kann ohne zu übertreiben feststel-len, dass sich die psychologische und pädagogische Forschung an deut-schen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in den letzten Jahr-
zehnten nicht so fruchtbar und nach den besten internationalen Stan-dards hätte entwickeln können, wenn nicht Herr Weinert unermüdlichund selbstlos in Forschungsförderungsorganisationen und Stiftungendafür gearbeitet hätte. Es gibt nur wenige Forschungskommissionen aufdiesem Gebiet, in denen sein zielbewusster und weise abwägender Ein-fluss nicht direkt oder indirekt spürbar geworden wäre. Zum Nutzen derganzen Gesellschaft, denn es gibt keinen Forschungsbereich, der uns allegemeinsam mehr angeht als die Bedingungen bei der Entwicklung vonFähigkeiten heranwachsender Generationen. Dass sich seit 1990 mit dem Aufbau für die Geistes– und Sozialwissen-schaften in der ehemaligen DDR ein ganz neues, Tatkraft und Augenmaßgleichermaßen forderndes Feld eröffnete, war für Franz Emanuel Wei-nert wieder nur ein neuer unabweisbarer Auftrag, dem er als Vizepräsi-dent der Max-Planck-Gesellschaft von 1990 bis 1999 unter Aufbietungall seiner Kräfte entsprach – ohne Aufhebens davon zu machen. In die-sem Jahrzehnt hat er sich nicht nur bleibende Verdienste für Bildung,Wissenschaft und Forschung im vereinten Deutschland erworben, diezurecht durch hochrangige Auszeichnungen wie den Bayerischen Ver-dienstorden und das Bundesverdienstkreuz gewürdigt wurden. Er hat indieser Zeit – ohne je darüber zu klagen - seine Gesundheit wohl bis überdie Grenzen des Zuträglichen hinaus so sehr beansprucht, dass man fastfürchten muss, dass er nun auch deshalb einer Krankheit erliegen mus-ste, der weder seine eigene Widerstandskraft noch ärztliche Kunst Herrzu werden vermochten.Mit seinem Tod verliert die Max-Planck-Gesellschaft, verliert die deut-sche Psychologie und die gesamte deutsche Wissenschaft einen heraus-ragenden Gelehrten und einen Mann, dessen Klugheit, Weisheit und Ur-teilskraft, aber auch dessen Humor und Menschlichkeit niemanden, derihm begegnete, unberührt und unbeeinflusst ließen.Ein solcher Abschied ist schwer und tut weh. Das Einzige, was denSchmerz darüber lindern kann, sind die vielen guten Erinnerungen anFranz Emanuel Weinert, die uns ihm gegenüber mit bleibender Dankbar-keit erfüllen. Wir werden ihn niemals vergessen; er wird mit seinen wis-senschaftlichen Werken fortleben, als sei er mitten unter uns.“ �
Die Max-Planck-Gesellschaft trauert um ihren Vizepräsidenten Dr. Tyll Necker: Er ist am 29. März unerwartet im Alter von 71 Jah-ren gestorben. Der ehemals geschäftsführende Gesellschafter derHAKO-Werke GmbH & Co, Bad Oldesloe, und frühere Präsident desBundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), war seit 1990 Senator, ab 1996 Mitglied des Verwaltungsrats und des Vorstands,seit 1999 Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft und leitetezuletzt als Vorsitzender die Senatskommission zur Vorbereitung derWahl des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft.
Tyll Necker wurde 1930 in Berlin geboren. In Göttingen und Hamburgstudierte er Philosophie und Wirtschaft, wollte wie sein Vater Journalistund Ökonom werden. Während des Studiums jobbte Necker als Werk-student in dem damals kleinen Flüchtlingsunternehmen Hans Koch &Sohn. Er verliebte sich in die Tochter des Firmengründers, Karin Koch,heiratete sie und trat wenig später in den Betrieb ein. 1960 wurde derDiplom-Volkswirt Mitgeschäftsführer und -gesellschafter und schließ-lich geschäftsführender Gesellschafter. Heute ist die HAKO-Gruppe eingroßes mittelständisches Unternehmen, das vor allem Kehr- und Reini-gungsmaschinen produziert. Fast 2000 Mitarbeiter sorgten 1999 fürknapp 600 Millionen Mark Umsatz.
Bereits Anfang der achtziger Jahre begann Tyll Necker sich auch politisch zu engagieren.Zunächst wirkte er als Präsident im VerbandDeutscher Maschinen- und Anlagenbau, ehe er1987 an die Spitze des Bundesverbandes derDeutschen Industrie gewählt wurde, der Vertre-tung von 80 000 privaten Industrieunternehmen.Bis 1990 und von 1992 bis 1994 prägte er die Politik der deutschenWirtschaft. In Stellungnahmen zu aktuellen gesellschaftspolitischenThemen sprach er sich beispielsweise für die Flexibilisierung des Ar-beitsmarktes oder eine Lockerung des Ladenschlussgesetzes aus. SeineUnternehmerkollegen mahnte er, den Umweltschutz im Betrieb nicht zu vernachlässigen. Necker engagierte sich gleich nach dem Mauerfall1989 in der DDR, war Aufsichtsrat einiger ehemaliger Volkseigener Betriebe ehe sie privatisiert wurden. Er schaltete sich in die Debatte umdie Zukunft Ostdeutschlands ein, befürwortete früh eine Währungs-union mit der DDR, kritisierte jedoch später die Modalitäten ihrer Ein-führung.
Zum Gedenken an Tyll Necker dokumentieren wir nachfolgend dieRede von Hubert Markl, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft:
FOTO
: WO
LFG
ANG
FILS
ER

enzym verdaut (also wiederum inTeilstücke zerlegt), gelelektropho-retisch aufgetrennt und die Re-striktionsmuster aller BACs mit-einander verglichen. Fingerprintsnennen die Wissenschaftler dieseDNA-Restriktionsmuster. Überlap-pende BACs führen zu ähnlichenMustern und lassen sich so wiederzu größeren DNA-Strängen (sogenannten contigs) zusammen-setzen.Parallel dazu wird die Gruppe vonDr. Stephan Schuster am MPI dieEnden der BACs sequenzieren.Diese Sequenzen dienen der Ver-ankerung der contigs auf derGen- bzw. Radiation-Hybrid-Kar-te. Die Verankerung wird durchdie Gruppe von Dr. Robert Geislersowie Dr. Yi Zhou und Dr. LeonardZon an der Harvard MedicalSchool vorgenommen. Alles zu-sammen dient dann dem SangerCentre als Gerüst bei der Zusam-mensetzung der Zebrafischse-quenzdaten. Das Sanger Centrewird alle Sequenzdaten für jeder-mann zugänglich im World WideWeb veröffentlichen und parallelzum Projekt ständig aktualisieren.Die dazugehörige Karte des Zeb-rafischgenoms wird vom TübingerMax-Planck-Institut für Entwick-lungsbiologie ebenfalls ins Inter-net gestellt. Die Auswertung derSequenzierungsdaten erfolgt inZusammenarbeit mit den Grup-pen von Dr. Stephan Schuster amMax-Planck-Institut und von Dr.Lederer am Rechenzentrum derMax-Planck-Gesellschaft in Gar-ching. Die vollständig annotierteSequenz des Zebrafischgenomswird für Ende 2003 erwartet.Der Wellcome Trust, die größtebiomedizinische Stiftung Groß-britanniens, fördert die Arbeit am Sanger Centre. Die Herstel-lung, Verarbeitung und Veran-kerung der künstlichen Bakte-rienchromosomen (BACs) in denbeiden Arbeitsgruppen am Max-Planck-Institut für Entwicklungs-biologie wird unterstützt durchForschungsmittel des Deutschen Humangenom-Projekts, den National Institutes of Health inden USA und der Max-Planck-Gesellschaft. �
INSTITUTE aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 101
Der Entschlüsselung desmenschlichen Genoms sowiedes Genoms der Maus, des Fadenwurms C. elegans undder Fliege Drosophila soll jetztdie Entschlüsselung des Ge-noms eines weiteren wichtigenModellorganismus folgen: desZebrafisches Danio rerio. Dafürhaben sich das Sanger Centrein Cambridge/UK sowie Ar-beitsgruppen am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbio-logie in Tübingen, des Nether-lands Institute for Develop-mental Biology und der Har-vard Medical School zusam-mengeschlossen. Den Haupt-anteil der Sequenzierung mit-tels „shotgun-Technik“ über-nimmt das Sanger Centre. DieTübinger Max-Planck-Wissen-schaftler haben im Vorfeld be-reits eine grobe Genkarte erar-beitet. Die Kenntnis des Zebra-fischgenoms wird wesentlich
dazu beitragen,die Funktion ver-schiedener Geneaufzuklären, un-ter anderem jenerGene, die bei derOrganentwick-lung und beimHerausbilden ein-facher Verhal-tensmuster eineRolle spielen. DasProjekt hat im Januar 2001 be-gonnen und sollEnde 2003 abge-schlossen werden.
In den Labors der Biologen istder Zebrafisch seit Jahren einerder beliebtesten Modellorganis-men, wenn es darum geht, diegenetischen Grundlagen der Em-bryonalentwicklung von Wirbel-tieren aufzudecken. Wegen ihrergeringen Größe und der großenAnzahl an Nachkommen sind Zebrafische einfach zu haltenund zu züchten. Es dauert nurwenige Tage, bis sich aus einembefruchteten Ei ein vollständig
ausgebildeter Organismus ent-wickelt. Ein weiterer Vorteil desZebrafisches ist, dass die Fisch-larven während ihrer frühen Entwicklung durchsichtig sind.Innere Organe, wie das Herz oder das Gehirn, können so amlebenden Organismus untersuchtwerden. Mit 1,7 Milliarden Bau-steinen ist das Zebrafischgenomzudem nur halb so groß wie dasdes Menschen. In den vergangenen Jahren ha-ben die Forscher damit begon-nen, gezielt Mutationen in Zebrafischen zu erzeugen, die jeweils zu einer abnormalen Embryonalentwicklung führen.So wurde 1993 im Labor vonProf. Christiane Nüsslein-Volhardam Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie ein großangelegtes Mutageneseprojektdurchgeführt, aus dem mehr als1000 Zebrafischmutanten her-vorgegangen sind (Development123, Dezember 1996). Diese Fische zeigen die unterschied-lichsten Störungen – währendder Frühentwicklung, der Ausbil-dung der Organe oder bei einfa-chen Verhaltensmustern. Mit derSequenz des Zebrafischgenomskönnen die Wissenschaftler inZukunft die genetischen Defekte,die diesen Störungen zugrundeliegen, schneller identifizierenund verstehen.Ziel ist es nicht nur, die tatsäch-liche Lage der Mutationen undGene auf den Chromosomen zufinden. Die Wissenschaftler wol-len ferner Erkenntnisse darübersammeln, wie groß das jeweiligeGen ist und welche Funktion es besitzt. Dies kann zu einembesseren Verständnis auch dermenschlichen Entwicklung füh-ren und ist somit für die biome-dizinische Forschung insgesamtvon Bedeutung. Denn es ist of-fensichtlich mehr die Architektur(also das Zusammenspiel der Gene), die uns von anderen Lebewesen unterscheidet – undweniger der genetische Code.Das Sanger Centre, das auch
maßgeblich an der Sequenzierungdes menschlichen Genoms betei-ligt war, wird eine „shotgun“-Sequenzierung des Zebrafischge-noms durchführen. Dabei wird dasGenom in viele kleine Stücke zer-teilt. Die Basenfolge dieser Teil-stücke wird anschließend mit hohem Durchsatz in den Sequen-zierräumen des Sanger Centres in der Nähe von Cambridge ent-schlüsselt. Die DNA, die vom San-ger Centre verwendet wird, istvon den Tübinger Zebrafisch-Ex-perten bereitgestellt worden. Um die kleinen, sequenziertenTeilstücke gleichsam wie Puzzle-teile wieder in eine zusammen-hängende Genomsequenz , alsoein zusammengesetztes Puzzle, zu überführen, wird sich das San-ger Centre eine neue Genomkartenutzbar machen. Diese Karte desZebrafischgenoms wird von denForschern aus der Arbeitsgruppevon Dr. Robert Geisler am Max-Planck-Institut für Entwick-lungsbiologie zusammen mit den Kollegen aus dem Labor vonDr. Ron Plasterk am NetherlandsInstitute for Developmental Bio-logy erstellt. Für diese sogenann-te physikalische Karte muss dasGenom des Zebrafisches in klei-nere Fragmente zerlegt werden.Diese Teilstücke werden anschlie-ßend in so genannte BACs (bac-terial artificial chromosomes =künstliche Bakterienchromoso-men) eingebaut, in denen sie sichleichter vermehren und bearbei-ten lassen. Im Weiteren werdendiese BACs durch ein Restriktions-
INSTITUTE aktuell
100 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Prof. Dr. Haim Harari, Präsident desWeizmann Institute of Science, Israel,wird mit der Harnack-Medaille aus-gezeichnet. Das beschloss der Senatder Max-Planck-Gesellschaft ein-stimmig bei seiner Sitzung am 23.März in München auf Vorschlag vonPräsident Hubert Markl. Die Max-Planck-Gesellschaft würdigt damitHararis 13-jähriges erfolgreichesWirken als oberster Repräsentant derführenden israelischen Forschungsor-ganisation. Die Ehrung wird im Rah-men der Hauptversammlung derMax-Planck-Gesellschaft im Juni inBerlin vorgenommen.
Harari habe dazu beigetragen, die seit30 Jahren bestehende Kooperationstra-dition zwischen der Max-Planck-Gesell-schaft und dem Weizmann-Institut er-folgreich fortzuführen und die Zusam-menarbeit den Erfordernissen einerwettbewerbsorientierten und sich inter-nationalisierenden Wissenschaft anzu-passen, erläuterte Präsident Markl:„Auch dass ein gewisser ,Normalisie-rungseffekt´ - soweit dies aufgrund derhistorischen Gegebenheiten überhauptmöglich war - in den Beziehungen ein-trat, ist Harari zu verdanken.“ Mit sei-nem Engagement bei der Einrichtunggemeinsamer Nachwuchsgruppen amWeizmann-Institut und an Max-Planck-Instituten habe er zudem in jüngsterZeit die Zusammenarbeit der Organisa-tionen ausgebaut und vertieft.Das Weizmann-Institut ist Israels Zent-rum für außeruniversitäre Grundlagen-forschung in den Naturwissenschaftenund wurde 1934 gegründet. Es umfasst18 Forschungsabteilungen in fünf Fa-kultäten, die auf einem zentralen Cam-pus in Rehovot in rund 50 Institutsge-bäuden vereinigt sind. Die Max-Planck-Gesellschaft fördert durch ihre Tochter-gesellschaft, die Minerva-Stiftung, dieForschungskooperationen mit demWeizmann-Institut. Neben einem Sti-pendienprogramm unterstützt die Stif-tung einzelne Projekte und unterhält sogenannte Minerva-Forschungszentrenin Israel. Das Weizmann-Institut stehtim Mittelpunkt des Netzwerks von isra-elischen und deutschen Wissenschaft-lern, welches von gegenseitigem Ver-ständnis, von exzellenter Forschungs-
arbeit und vielfach auch von persön-lichen Freundschaften geprägt ist.Prof. Dr. Haim Harari wurde 1940 in Jerusalem geboren. Er studierte Physikan der Hebräischen Universität seinerHeimatstadt, wo er anschließend auchpromovierte. Sein Interesse für deutscheKultur und für eine Zusammenarbeitmit der deutschen Wissenschaft grün-det sich auf einen Gastaufenthalt amMax-Planck-Institut für Physik (Wer-ner-Heisenberg-Institut) München inden 70er-Jahren. Zu diesem Zeitpunktwar er bereits Inhaber einer Professurfür Hochenergie-Physik am Weizmann-Institut. Seit 1988ist er dessen Präsi-dent und hat es inden vergangenenJahren zu einer inder ganzen Welthoch angesehenenEinrichtung derSpitzenforschungausgebaut.Seine beruflichen Ambitionen verbandHarari stets mit bildungs- und wissen-schaftspolitischem Engagement, vor al-lem auch auf dem Gebiet der Lehre undder Heranführung der Jugend an dieNaturwissenschaften. Als Vorsitzendereines Komitees, das die vom israelischenParlament global für Hochschulen be-willigten Mittel verteilt, nahm er langeZeit Einfluss auf Entwicklungen in derWissenschaftslandschaft Israels. GroßesInteresse zeigte Harari auch nach derWiedervereinigung an der Entwicklungder Wissenschaften in der früheren DDR bzw. den neuen Bundesländern. Er besuchte dort neu gegründete Max-Planck-Institute und Universitäten. Seine Analysen waren ein wichtiger Beitrag zur Meinungsbildung in derMax-Planck-Gesellschaft.Die 1924 gestiftete Harnack-Medailleist die höchste Auszeichnung, die dieMax-Planck-Gesellschaft zu vergebenhat. Sie wird nur selten und nur für be-sondere Verdienste verliehen (in Fort-setzung der Tradition der Kaiser-Wil-helm-Gesellschaft, zu deren Grün-dungsvätern der Theologe und Wissen-schaftspolitiker Adolf von Harnackgehörte und deren erster Präsident er19 Jahre lang war). �
HARNACK-MEDAILLE
Prof. Haim Harari ausgezeichnetENTWICKLUNGSBIOLOGIE
Fischen nach Genen
Weitere Informationen erhalten Sie von:Max-Planck-Institutfür Entwicklungs-biologie, Tübingen DR. ROBERT GEISLER
Tel.: 07071/601-443 Fax: 07071/601-384E-Mail: [email protected] sowieDR. STEPHAN SCHUSTER
Tel.: 07071/601-440 Fax: 07071/601-442 E-Mail: [email protected]
@
Chromatogrammeines DNA-Sequenzgels. Die verschiede-nen Basen haben unterschiedlicheFarben. Ihre Abfolge auf dem Gel entspricht ihrer Reihenfolgeim Genom.
Entwicklungssta-dien des Zebrafi-sches. Zebrafischeentwickeln sichsehr schnell. Sodauert es nur 48Stunden, bis auseinem befruchte-ten Ei ein kleinerFisch schlüpft(Bild in vierterZeile von oben).
Nach fünf Tagenschwimmen dieLarven bereitsfrei im Wasserund suchenselbstständigFutter (Bild inunterster Zeile).
ABB.
: ARB
EITS
GRU
PPEN
AMM
PI F
ÜR
ENTW
ICKL
UN
GSB
IOLO
GIE
FOTO
: WEI
ZMAN
NIN
STIT
UTE
OF
SCIE
NCE

INSTITUTE aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 103
INSTITUTE aktuell
102 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
der Blutgerinnung und der Regu-lation von Thrombosen widmen.Peter Carmeliet (41) aus Belgiengilt als einer der weltweit führen-den Forscher auf dem Gebiet derAngiogenese und hat eine Profes-sur an der medizinischen Fakultätder Universität Leuven inne. In Leuven studierte er bereits Medizin und hat dort auch seineDoktorarbeit angefertigt. An-schließend ging er 1990 als Gast-wissenschaftler in die USA, wo ersich als Postdoc am Whitehead Institute (MIT) mit der Etablierunggendefizienter Mäuse für Protea-sen (das sind bestimmte Enzyme)und Protease-Inhibitoren der Blut-gerinnung beschäftigte. Zurück inLeuven hat Carmeliet die Funktionendothelialer Wachstumsfaktorenuntersucht. Ferner konnte er dieBedeutung bestimmter Proteasenund das therapeutische Potenzialbestimmter Protease-Inhibitorenfür den Heilungsverlauf eines Infarktes im Mausmodell klären.Die dritte Abteilung wird gemein-sam mit der Universität Münstereingerichtet, von der eine erheb-liche finanzielle Beteiligung er-wartet wird. Der Forschungsbe-reich soll einen Schwerpunkt inder Hämatopoese/zellulären Im-munologie erhalten. Ein interes-santer Aspekt könnte hierbei dieUntersuchung von Stammzellensein, die an Reparaturprozessenzum Beispiel nach einem Herzin-farkt beteiligt sind. Ferner soll dieEntwicklung des lymphatischenSystems, das noch weitgehend un-klar ist, beleuchtet werden. Alsweiteres Gebiet ist die angeboreneImmunität im Visier; hierbei gehtes um die Biologie myeloider Zel-len und deren Funktion in der Immunabwehr.Mit dem neuen Max-Planck-In-stitut für vaskuläre Biologie steigtdie Zahl der in allen Bundeslän-dern angesiedelten Einrichtungender Max-Planck-Gesellschaft auf 79. Der Gesamtetat der Max-Planck-Gesellschaft ist für daslaufende Jahr 2001 mit rund 2,4Milliarden Mark veranschlagt. �
Mit rund 12 Millionen Mark Start-finanzierung hat die Scienion AG An-fang April am WissenschaftsstandortBerlin-Adlershof im Südosten derStadt die Arbeit aufgenommen. Nachder Wita Proteomics AG (1992) undder inzwischen börsennotierten GPCBiotech AG (1997) ist Scienion be-reits die dritte Ausgründung, die aufTechnologien aus dem Max-Planck-Institut für molekulareGenetik in Berlin-Dahlem basiert.
Die Wissenschaftler Dr. Holger Eickhoff,Martin Horn und Dr. Wilfried Nietfeldaus der Abteilung von Prof. Dr. HansLehrach konnten gemeinsam mit demindustrieerfahrenen Dr. Sebastian Del-brück (vormals Wissenschaftler amMax-Delbrück-Centrum für molekulareMedizin) sowie der Unternehmensbera-terin Heike Feldkord ein Konsortium ausdrei namhaften und im Biotechnologie-markt erfahrenen Venture-Capital-Ge-sellschaften für die Finanzierung ge-winnen: Als Investoren betätigen sich 3i plc, Peppermint Financial Partnersund die IBB Beteiligungsgesellschaft.Zusätzlich erfolgt eine Ko-Finanzierungdurch die tbg Technologie-Beteili-gungs-Gesellschaft der Deutschen Aus-gleichsbank. Garching Innovation berietund betreute das Gründerteam in derKonzeptions- und Gründungsphase.Standbein von Scienion ist eine neueGeneration von Biochips, an deren Ent-wicklung Holger Eickhoff am Max-Planck-Institut für molekulare Genetikals Erfinder maßgeblich beteiligt war.Diese Biochip-Technologie soll Genfor-schern zukünftig helfen, den Ursachenvon Krankheiten nachzuspüren, umdann Medikamente zu entwickeln.
Mit ihrem zum Patent angemeldetenKnow-how möchte Scienion sowohlgrundlagenorientierte akademischeEinrichtungen als auch anwendungsori-entierte Großunternehmen als Kundengewinnen. Die Biochips wird Scienionkombiniert mit Microarray-Komplettlö-sungen anbieten. Kunden können zwi-schen zugehöriger Hardware (Arrayer,Hybridisierungskammern), unterschied-
lichen Microarraysund der Möglichkeit,Serviceleistungen inAnspruch zu nehmen,
wählen. Für die Zukunft strebt Scieniondie Entwicklung von integrierten, kom-plemetären Diagnostikprodukten an.Aufgrund der Expertise des Gründer-teams und der Unterstützung durch einen mit Prof. Hans Lehrach, Prof. Detlev Ganten und Prof. Jens Reichhochkarätig besetzten Beirat möchtedas Unternehmen schon bald mit demProduktionsprozess beginnen. „Spätes-tens Ende dieses Jahres bringen wir daserste Produkt auf den Markt“, glaubtVorstandsvorsitzender Eickhoff. ErsteKooperationen gebe es bereits mit zwei Unternehmen: der BochumerPROT@GEN sowie der britischen Genetix Ltd. Auch die Erzeugnisse vonPROT@GEN basieren zu einem Teil auf Know-how und Technologie desMax-Planck-Instituts für molekulareGenetik. Der Markt für Biochips ist enorm großund stark wachsend. Nach Schätzungender US-Unternehmensberatung Frost & Sullivan beziffert sich das Marktpo-tenzial auf mehrere Milliarden Dollar.Scienion will sich im Wettbewerb vorallem durch die hoch innovative, vonder Max-Planck-Gesellschaft lizenzierteTechnologie sowie durch die Expertisedes Gründerteams positionieren. Ein Erfolg versprechendes Unterfangen:Die Technologie wurde bereits im Dezember 2000 mit dem Innovations-preis des Landes Berlin/Brandenburgausgezeichnet. �
AUSGRÜNDUNG Scienion AG in Berlin
Am WissenschaftsstandortBerlin-Adlershof hat sichdie Scienion AG niederge-lassen. Das Unternehmen ist bereits die dritte Aus-gründung des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik in Berlin-Dahlem.
FOTO
: SCI
ENIO
N
Der Senat der Max-Planck-Ge-sellschaft hat auf seiner Sitzungam 23. März in München - vor-behaltlich der Sicherstellung derFinanzierung - beschlossen, einMax-Planck-Institut für vas-kuläre Biologie (Gefäßbiologie)in Münster zu gründen. Es wirdsich der Erforschung der biolo-gischen Grundlagen der Ent-wicklung und Funktionsweisedes Blutgefäßsystems und seinerErkrankungen widmen. AlsGründungsdirektoren sollen dieProfessoren Peter Carmeliet(Leuven/Belgien) und DietmarVestweber, derzeit Direktor amMax-Planck-Institut für physio-logische und klinische Forschung(Bad Nauheim), berufen werden.Das Institut soll im Endausbaumit drei Abteilungen und etwa90 bis 100 Mitarbeitern for-schen; für die Unterbringungwird ein Neubau benötigt, fürden 75 bis 80 Millionen Mark zu veranschlagen sind.
Weltweit einzigartige Möglichkei-ten für die molekularbiologischeForschung - das erhofft sich dieMax-Planck-Gesellschaft in Müns-ter, wo mit dem Schwerpunkt vas-kulärer Biologie ein Forschungs-gebiet etabliert wird, das eng ander Nahtstelle zur angewandtenMedizin liegt. So stehen beispiels-weise Grundlagen der Entstehungvon Entzündungsreaktionen, Fragen der Immunüberwachung,des Tumorwachstums sowie zu Er-krankungen der Herzkranzgefäßeim Mittelpunkt geplanter For-schungsvorhaben. Zentraler Be-standteil der Arbeit wird es sein,zunächst die Gene zu identifizie-ren, die die molekularen Prozessebei der Entstehung des Systemsvon Blutgefäßen (Angiogenese),des Herzens (Kardiogenese) undder Blutzellen (Hämatopoese)steuern. Außerdem sollen dann die Funktionen der einzelnen Genenäher erforscht werden. Dazu
werden transgene Mäuse verwen-det, die über die Errichtung desInstituts hinaus den Bau umfang-reicher Tierstallkapazitäten nötigmachen.Die Max-Planck-Gesellschaft gehtvon 75 bis 80 Millionen Mark Bau-kosten aus. Daran will sich dasLand Nordrhein-Westfalen mit 25Millionen Mark Sonderzuweisungbeteiligen. Die Planungen derMax-Planck-Gesellschaft sehenlangfristig die Schaffung von 90bis 100 Stellen in dem Institut vor.Insgesamt werden jedoch doppeltso viele Menschen dort tätig sein,weil zusätzlich Doktoranden re-krutiert und Gastwissenschaftlereingesetzt werden. Die Entscheidung für Münstersteht in engem Zusammenhangmit bereits bestehenden Koopera-tionen von Prof. Vestweber mitder Universität Münster. Diese hatihre biomedizinische Forschung inden letzten Jahren zum Beispieldurch die Schaffung des Zentrumsfür Molekularbiologie der Entzün-dungen und des InterdisziplinärenZentrums für Klinische Forschungsowie durch Neuberufungen er-heblich verstärkt, vor allem auchim Bereich der vaskulären Biolo-gie. Das geplante Max-Planck-In-stitut komplettiert so eine inDeutschland einzigartige Konzen-trierung auf die Erforschung desvaskulären Systems. Die Ressour-cen des Instituts könnten auf brei-ter Ebene am Ort mitgenutzt wer-den. Außerdem besteht auchdurch den Fachbereich Biologieder Universität mit jährlich 270Studenten eine hervorragende Ba-sis für biologisch-medizinischeGrundlagenforschung.Das Gründungskonzept sieht dieEinrichtung von drei Abteilungenim Institut vor: Eine Abteilung sollsich unter Leitung von Prof. Vest-weber der „Zellbiologie des En-dothels“ (das ist die innere Zell-schicht der Blutgefäße) widmen.Für die Leitung des zweiten Be-reichs, „Vaskuläre Medizin“, ist dieBerufung von Prof. Peter Carme-
liet (Leuven/Belgien) in Aussichtgenommen. Eine dritte Abteilungwird in Kooperation mit der Uni-versität Münster die „Hämatopoe-se/zelluläre Immunologie“ zumForschungsgegenstand haben.Der Arbeitsbereich von Prof. Vest-weber befasst sich mit den mole-kularen Mechanismen der Wande-rung von Leukozyten, den Ab-wehrzellen des Immunsystems.Mittelpunkt des Forschungsinter-esses sind die Entstehung von Ent-zündungsreaktionen (also wie Leu-kozyten in Infektionsherde oderanders geschädigte Gewebe ein-dringen) sowie die Grundlagen derImmunüberwachung (also wieLymphozyten im Körper patrouil-lieren). Dem Endothel, der innerenZellschicht der Blutgefäße, kommtin diesem Prozess eine aktiv steu-ernde Rolle zu, die besonders un-ter die wissenschaftliche Lupe ge-nommen werden soll.Dietmar Vestweber (45) ist Pro-fessor an der Universität Münsterund seit Juli 1999 Direktor amMax-Planck-Institut für physiolo-gische und klinische Forschung inBad Nauheim; er arbeitet mit sei-ner Forschungsabteilung bereitseng mit der Universität in Münsterzusammen. Nach einem Studiumder Biochemie hat Vestweber amFriedrich-Miescher-Laboratoriumder Max-Planck-Gesellschaft inTübingen seine Dissertation ange-fertigt. Danach ging Vestweber alsPostdoc in die Schweiz, wo er sichan der Universität Basel habilitier-te. Anschließend übernahm er dieLeitung einer Nachwuchsgruppeam Max-Planck-Institut für Im-munbiologie in Freiburg, bevor er1994 einen Ruf als Professor derUniversität Münster annahm.Die Abteilung von Prof. Carmelietsoll das Gebiet der Angiogenesebearbeiten. Schwerpunkt ist dabeidie Neubildung des kardio-vas-kulären Systems, also die Ausbil-dung von Herz und Blutgefäßen imEmbryo. Aber auch die Angiogene-se im erwachsenen Organismuswird untersucht. Prof. Carmelietsoll sich dabei auf Erstellung undAnalyse transgener Mausmodellekonzentrieren. Darüber hinaus wirder sich dem Gebiet der Hämostase,
NEUGRÜNDUNG Max-Planck-Institut für vaskuläre Biologie

INSTITUTE aktuell
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 105
INSTITUTE aktuell
104 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
Ein Nanometer ist ein milli-onstel Millimeter – eine un-vorstellbar kleine Messein-heit. Die Nanotechnologiestößt in die Welt vor, in dersich Atome und Moleküle be-wegen. Dort werden die Ei-genschaften der mikroskopi-schen oder besser nanoskopi-schen Organisation von Ma-terie bestimmt. Wer den Na-nometerbereich beherrscht,kann Material gezielt mit ge-wünschten Eigenschaftenausstatten. Solche intelligen-ten Werkstoffe eröffnen mit-telfristig ein unübersehbaresMarktpotenzial, deswegengehört die Nanotechnologiezu den zukunftsträchtigstenWissenschaftsdisziplinen. Ihr widmet sich das neue„Forschungszentrum für multifunktionelle Werkstoffeund miniaturisierte Funkti-onseinheiten“, dessen Finan-zierung durch eine Förderzu-sage des Bundesforschungs-ministeriums nun bis 2003gesichert ist.
Freude löste diese Nachrichtbei den beteiligten Wissen-schaftlern der UniversitätMainz und dem Max-Planck-Institut für Polymerforschungaus. Sie arbeiten eng zusam-men und werden auch in deman der Universität angesiedel-ten neuen Projekt kooperieren.Insgesamt 18 Millionen MarkAnschubfinanzierung hat derBund zugesagt. Das Geldstammt aus den Verkaufserlö-sen der UMTS-Lizenzen, die un-ter anderem zur Verbesserungder universitären Infrastrukturverwendet werden, so derrheinland-pfälzische Wissen-schaftsminister Prof. Dr. JürgenZöllner. Er sei zuversichtlich,dass es mit dem Forschungs-zentrum gelingen werde, inter-national sichtbar Akzente zusetzen. Bis zu 45 hoch qualifi-
zierten wissenschaftlichen Ar-beitskräften werde es darüberhinaus ein innovatives Arbeits-feld mit guten beruflichen Per-spektiven bieten.Schon jetzt verfügt man inMainz über eine hohe Dichtean nanotechnologisch arbei-tenden Wissenschaftlerinnenund Wissenschaftlern, die guteForschungsbedingungen vor-finden: Die exzellente appara-tive Infrastruktur und dergroße Stab an ausgezeichnetenWissenschaftlern im dortigenMax-Planck-Institut für Poly-merforschung korrespondierenbestens mit den universitärenArbeitsgruppen, deren Aus-stattung Zöllner aufgrund von Sonderprogrammen derLandesregierung für internatio-nal konkurrenzfähig hält. Und auch UniversitätspräsidentProf. Josef Reiter ist stolz: Das in Mainz vorhandene For-schungspotenzial reiche auf-grund der guten Zusammenar-beit von der Herstellung orga-nischer Materialien über dieManipulation von Proteinen bis hin zur Erzeugung anorga-nischer Nanostrukturen. Diessei ebenso einzigartig wie dieenge Verflechtung von Syn-these, Analytik und theoreti-scher Beschreibung. Das neue Forschungszentrumwill nun mit Blick auf die An-wendung neue Grundlagen le-gen, auf denen neue „nano-strukturierte“ Materien ent-wickelt werden könnten. WieProfessor Klaus Müllen vomMax-Planck-Institut für Poly-merforschung berichtet, sindFortschritte in den Schlüssel-technologien für zukünftigeMärkte, das heißt im Bereichder Informations- und Kom-munikationssysteme, eng andie Entwicklung neuer Werk-stoffe gekoppelt. Dies zeige dasBeispiel hoch integrierter Com-puterchips: Hier seien bereits
Größenordnungen von 100 Nanometern in der Entwick-lung. Die fortschreitende Mi-niaturisierung elektronischerBauelemente erfordere in derForschung neue Strategien zurMikrostrukturierung von Werk-stoffen, da konventionelle Methoden kaum Spielraum zueiner weiteren Reduzierung derAbmessungen bieten würden.Denn: „Im Extremfall sollen so-gar einzelne Moleküle als elek-tronische Bauelemente dienen“,sagte Müllen bezüglich der er-reichbaren Miniaturisierung.Die Entwicklung der For-schungsarbeiten bleibt nichtden Wissenschaftlern alleinüberlassen. Ein externes Bera-tungsgremium begleitet vonBeginn an die Tätigkeit desneuen Zentrums. Es besteht ausje drei renommierten Vertreternder deutschen Industrie undeuropäischer Forschungsein-richtungen. Die Vertreter derPraxis können bereits bei derEntwicklung von Fragestellun-gen industrierelevante Sicht-weisen einbringen. Durch die-sen frühzeitigen Austauschzwischen Wissenschaft undWirtschaft soll es gelingen, dieUmsetzung von Forschungser-gebnissen in die Praxis bereitsin der Entwicklungsphase mitzu berücksichtigen. Die auslän-dischen Berater sollen außer-dem den Austausch neuesterForschungsergebnisse auf inter-nationaler Ebene gewährleisten.Dass diese internationale Ver-netzung wichtig ist, haben Uni-versität und Max-Planck-Insti-tut schon lange erkannt. Beideverfügen über ein enges Ge-flecht von internationalen Kon-takten auch weit über Europahinaus. Und bereits bestehendeIndustriekooperationen um-fassen alle größeren mit derMaterialforschung konfrontier-ten Industrieunternehmen inDeutschland. �
KOOPERATION
Forschung in der NanoweltSeit Anfang Februar ziert die kostbare Nanosims-Ionenmikrosonde das eigensfür sie neu eingerichtete Laboratorium in der Abtei-lung Kosmochemie des Max-Planck-Instituts für Chemiein Mainz. Das weltweit zweiteGerät dieser Art ist ein Se-kundärionenmassenspektro-meter (SIMS) der französi-schen Firma Cameca, die beider Festlegung der Spezifi-kationen und Geräteeigen-schaften sowie dem Designund den abschließendenTestmessungen eng mit demMainzer Institut und dem Laboratory for Space Scien-
ces an der Wa-shington Univer-sity in St. Louis –an das vor kurz-em das andere Instrument ging –zusammengear-beitet hat. „Mit der Hilfe derNanosims-Ionen-mikrosonde kön-nen wir nun zum
ersten Mal Meteoritenmate-rie und interstellare Staub-partikel im Größenbereichvon weniger als 100 Nano-metern (Millionstel einesMillimeters) untersuchen.Wir hoffen, auf diese Weiseviele offene Fragen in derKosmochemie und Astrophy-sik beantworten zu können“,sagt Dr. Peter Hoppe, Leiterder SIMS-Arbeitsgruppe.
Bei der Sekundärionenmassen-spektrometrie wird die festeProbe mit einem Primärionen-strahl, zum Beispiel mit Cäsi-um- oder Sauerstoffionen be-schossen. Die so erzeugten Se-kundärionen werden massen-spektrometrisch analysiert, wo-bei ein dreidimensionales Bildder Element- und Isotopenzu-sammensetzungen einer Probegewonnen wird. Die SIMS-Me-thode findet eine breite An-
wendung in Kosmochemie, Geochemie und Geologie. Inden vergangenen Jahren wur-den insbesondere präsolareKörner, die älter sind als dasSonnensystem selbst und sichdirekt aus Auswurfmaterial vonSternen (Sternenstaub) gebil-det haben, untersucht. Die Iso-topenanalysen an präsolarenStaubkörnern, die in primitivenMeteoriten gefunden wurden,liefern Aussagen über die stel-lare Evolution und die Ele-mentbildung durch kernphysi-kalische Prozesse im Innern vonSternen, das Kornwachstum inSternatmosphären und die ga-laktische chemische Evolution.Die Messungen mit bisherigenIonenmikrosonden waren aufPartikel mit Durchmesserngrößer als 0,5 Mikrometer(Tausendstel eines Millimeters)beschränkt; das heißt auf ver-gleichsweise große, nicht re-präsentative Körner. Denn diebeobachteten Durchmesserpräsolarer Mineralien, wie Dia-mant oder Siliziumkarbid, vari-ieren zwischen einigen Nano-metern und einigen Mikrome-tern. Die neue Nanosims-Sondeermöglicht eine räumliche Auf-lösung bis zu 30 Nanometer beieiner hohen Nachweisempfind-lichkeit der Sekundärionen. Eskönnen simultan bis zu sechsIsotope gemessen werden.Hoppe: „Damit wird nicht nurein repräsentativeres Bild derIsotopenzusammensetzung vie-ler präsolarer Mineralphasengewonnen. Wir können auchgezielt nach kleinen präsolarenStaubkörnern suchen, um da-mit eventuell bis heute nichtnachweisbare präsolare Mine-ralphasen, wie Silikate, zu fin-den. Die Isotopenmessungenwollen wir auch auf neueastrophysikalisch relevanteElemente, wie Ele-mente der Eisen-gruppe, ausdehnen.“ Mit der neuen Sondeist eine Vielzahl weiterer
KOSMOCHEMIE
Blick zum UrsprungFO
TOS:
MPI
FÜ
RCH
EMIE
/KO
SMO
CHEM
IE
Messungen in der AbteilungKosmochemie geplant. So sol-len die Kometenmaterie –wahrscheinlich das ursprüng-lichste Material in unseremSonnensystem und daher be-sonders reich an präsolarenStaubkörnern – und auch heu-tiger interstellarer Staub unter-sucht werden. Ein Vergleich vonheutigem interstellarem Staubmit solchem aus Meteoritenund Kometen, der vor der Bil-dung des Sonnensystems, alsovor 4,6 Milliarden Jahren ent-standen ist, kann wichtige Erkenntnisse über die galakti-sche chemische Evolution lie-fern. Die Nanosims-Sondekönnte ferner zu einer verläss-lichen Altersbestimmung an direkt gesammeltem Mars-gestein beitragen.Weitere wichtige Anwendun-gen sind auch im Bereich derGeochemie und Atmosphären-chemie geplant: Die hohe Auf-lösung dieses Gerätes ermög-licht es, wichtige Fragen zu Dif-ferentiation und Evolution derErde zu beantworten. Wesent-liche Fortschritte in der Atmo-sphärenforschung sind darüberhinaus durch die Untersuchungchemischer Reaktionen, die an der Oberfläche von feinen
Aerosolpartikeln statt-finden, zu erwarten. �
Präsolarer Staub:Der Weg vomStern ins Labor.
Weitere Informationen erhalten Sie von: DR. PETER HOPPE
Max-Planck-Institut für Chemie, MainzTel.: 06131/305-244Fax: 06131/305-483E-Mail: [email protected]
Dr. Peter Hoppevom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie vor derNanosims-Ionen-mikrosonde, einemneuartigen Sekun-därionenmassen-spektrometer.
Rasterelektro-nenmikroskop-aufnahme einespräsolaren Silizi-umkarbidkorns aus dem Murchi-son-Meteoriten.Dieses Relikt einesfernen Sterns hateinen Durchmesservon weniger als einem Mikrometerund ist mehr als4,57 MilliardenJahre alt.
@

STANDorte
2 / 2 0 0 1 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 107
INSTITUTE aktuell
106 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 2 / 2 0 0 1
MAXPLANCKFORSCHUNG
wird herausgegeben vom Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeitder Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Vereinsrechtlicher Sitz: Berlin.ISSN 1616-4172
Redaktionsanschrift: Hofgartenstraße 8, 80539 München Tel. 089/ 2108-0 (-1276) Fax 089/2108-1207E-Mail: [email protected]: http://www.mpg.de.
Verantwortlich für den Inhalt:Dr. Bernd Wirsing (-1276)
Leitender Redakteur:Helmut Hornung (-1404)
Biologie, Medizin:Dr. Christina Beck (-1306) Walter Frese (-1272)
Chemie, Physik, Technik: Eugen Hintsches (-1257) Helmut Hornung (-1404)
Geisteswissenschaften:Susanne Beer (-1342)
Online-Redaktion:Dr. Andreas Trepte (-1238)
Gestaltung: Rudi Gill DTP-Operating: Franz Pagel Senftlstraße 1, 81541 MünchenTel. 089/448 21 50E-Mail: [email protected]
Litho: kaltnermediaDr.-Zoller-Str. 1 86399 Bobingen
Druck+Vertrieb:Druckhaus Beltz Tilsiter Straße 17 69502 Hemsbach
Anzeigen: Brigitte Bell Verlagsgruppe Beltz Postfach 100154 69441 Weinheim Tel. 06201/6007-380 Fax 06201/18 46 84
Für Mitarbeiter der MPG ist einemTeil der Auflage die Mitarbeiterzeit-schrift MAXPLANCKINTERN beigefügt:Dr. Christina Beck (-1306/Redaktion)Carin Gröner (-1231/Personalien)
MAXPLANCKFORSCHUNG will Mitar-beiter und Freunde der Max-Planck-Gesellschaft aktuell informieren. DasHeft erscheint in deutscher und eng-lischer Sprache (MAXPLANCKRESEARCH)jeweils in vier Ausgaben pro Jahr. DieAuflage beträgt zurzeit 25.000 Exem-plare. Der Bezug des Wissenschafts-magazins ist kostenlos.
Alle in MAXPLANCKFORSCHUNG ver-tretenen Auffassungen und Meinun-gen können nicht als offizielleStellungnahme der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Organe interpretiert werden.
MAXPLANCKFORSCHUNG wird auf chlor-frei gebleichtem Papier gedruckt.Nachdruck der Texte unter Quellen-angabe gestattet. Bildrechte können nach Rücksprache erteilt werden.
Die Max-Planck-Gesellschaft zurFörderung der Wissenschaften unter-hält 79 Forschungsinstitute, in denenrund 11.000 Mitarbeiter tätig sind,davon etwa 3100 Wissenschaftler.Hinzu kamen im Jahr 2000 rund 6900
Stipendiaten, Gastwissenschaftler und Doktoranden. Der Jahresetat um-fasste insgesamt 2338 MillionenMark; davon stammten 2209 Millio-nen Mark aus öffentlichen Mitteln.
Die Forschungsaktivität erstreckt sich überwiegend auf Grundlagen-forschung in den Natur- und Geistes-wissenschaften. Da die Max-Planck-Gesellschaft ihre Aufgabe vor allemdarin sieht, Schrittmacher der For-schung, insbesondere in Ergänzung zu den Hochschulen zu sein, kann sienicht in allen Forschungsbereichentätig werden. Sie versucht daher, ihreMittel und Kräfte dort zu konzentrie-ren, wo besondere Forschungsmög-lichkeiten erkennbar sind.
Die Max-Planck-Gesellschaft ist einegemeinnützige Organisation des pri-vaten Rechts in der Form eines einge-tragenen Vereins. Ihr zentrales Ent-scheidungsgremium ist der Senat, indem eine gleichwertige Partnerschaftvon Staat, Wissenschaft und sach-verständiger Öffentlichkeit besteht.
NIEDERLANDE
� NijmegenITALIEN
� RomSPANIEN
❍ AlmeriaFRANKREICH
❍ GrenobleBRASILIEN
❍ Manaus
Forschungseinrichtungen derMax-Planck-Gesellschaft
� Institut/Forschungsstelle� Teilinstitut/Außenstelle❍ Sonstige Forschungs-einrichtungen
druckt: „Ich glaube, diese Ausstel-lung würde der chinesischen Be-völkerung die gute Chance bie-ten, Wissenschaft in einer ganzneuen Form kennen zu lernen.“Der Weg durch den Science-Tun-nel führt von den kleinsten Bau-steinen der Materie (eine Dimen-sion in Femtometern, 10-15 m) bis zu den größten Strukturen imUniversum (1025 m). Beim Gangdurch den Science-Tunnel sollenmöglichst viele Besucher spekta-kuläre Einblicke ins Innere undÄußere der Welt erhalten und dieGrenzen von Raum und Zeit er-fahren. Denn neues Wissen wirdheute vorwiegend bei der Erfor-schung von Vorgängen gewon-nen, die wegen ihrer räumlichenDimensionen oder ihrer Ge-schwindigkeit für den Menschenohne aufwändige technischeHilfsmittel nicht wahrnehmbarsind. „Die Entdecker von heutesind nicht mehr wie ChristophKolumbus mit dem Segelschiffunterwegs, um neue Kontinentezu finden. Nach Neuland suchtman heute mit kompliziertesterTechnik wie Hochleistungsmi-kroskopen oder gigantischen Te-leskopen. Diese ,Welten’ liegenjenseits der Alltagserfahrungender Menschen, und sind ihnendeshalb häufig fremd“, sagt Dr.Andreas Trepte, Projektleiter desScience-Tunnels bei der Max-Planck-Gesellschaft.Der Science-Tunnel bietet viel-fach noch unveröffentlichtes, op-tisch eindrucksvolles Bild- undVideomaterial aus der Spitzenfor-schung in Deutschland, speziellaus Max-Planck-Instituten, aberauch aus Universitäten und ande-ren Forschungseinrichtungen. Inmehr als zwei Dutzend Videopro-jektionen und Hunderten von
Einzelaufnahmen schauen die Be-sucher den Wissenschaftlern ge-wissermaßen über die Schulterund erkennen die Herausforde-rungen, denen sich die Forscherheute stellen: von der Suche nachden innersten Bestandteilen derMaterie oder den Bausteinen desLebens über die Erforschung derUrsachen von Krankheiten oderder Funktion des Gehirns bis hinzu den Problemen des mensch-lichen Zusammenlebens und derZukunft der Biosphäre unserer Erde und des Universums. DieFaszination dieser wissenschaftli-chen Suche nach Erkenntnis willdie Max-Planck-Gesellschaft vorallem auch jungen Menschen vorAugen führen. Trepte: „Wir versu-chen, die Besucher mitzunehmenin jene Welten, von deren Exi-stenz wir alle zwar wissen, dieuns aber trotzdem nicht so ganzgeheuer sind. Ich glaube, für vieleMenschen ist eine solche Ausstel-lung die einzige Gelegenheit undvielleicht auch ein wichtigerGrund, mit diesen Welten einmaldirekt in Kontakt zu kommen.“Den Eindruck der Bilder verstärktein „Science-Sound“, der speziellzu jedem Themenbereich desScience-Tunnels komponiert wur-de. Für die Präsentation in Chinamusste der Tunnel in eine „Wan-derfassung“ umgebaut und alleTexte in chinesische Schriftzei-chen übersetzt werden. Auf demWasserweg gelangte die Ausstel-lung nach China; die verwende-ten Übersee-Container dientenals mobile Werkstätten für dasAufbauteam, das sich aus siebendeutschen und zwölf chinesi-schen Technikern zusammensetz-te. Verantwortlich für diese Arbeiten war die Agentur Archi-MeDes aus Berlin. �
Der Science-Tunnel ist seit 29. April im China Science andTechnology Museum in Pekingzu sehen. Bis zum 31. Augustwerden in der Multimedia-Aus-stellung, die in die Welt der aktuellen Forschung führt, biszu einer Million Besucher er-wartet. Die Max-Planck-Gesell-schaft präsentierte den rund170 Meter langen Science-Tun-nel bereits im Themenpark Wis-senschaft der EXPO 2000 inHannover. Mit Ausstellungsbe-ginn in Peking starten auch zweineue Internet-Seiten.
Die Suche nach Wissen ist so altwie die Menschheit. Seit jeher fra-gen Menschen nach dem Ursprungder Welt, der Entstehung des Le-bens, der Zukunft des Universums.Seitdem suchen Wissenschaftlerund Forscher systematisch nachAntworten auf diese Grundfragen,nach Antworten, die ein besseresVerständnis unseres Daseins undeinen vernünftigen Umgang mitder Natur ermöglichen. Anders alsim Abendland hat im chinesischenDenken stets die Synthese, die Be-zogenheit zum Ganzen, dominiert.Ein Aspekt, der auch im Science-Tunnel nicht zu kurz kommt, weilin der Ausstellung analytischeSpitzenleistungen aus der mo-dernsten Forschung bezogen aufdas Wissen über die ganze Weltdargestellt werden.Die Ausstellung versucht einenBrückenschlag zwischen einer inskleinste Detail vordringendenwestlichen Wissenschaft und einerfernöstlichen ganzheitlichenDenktradition. Der Präsident derChinese Academy of Sciences, Pro-fessor Lu Yongxiang, zeigte sichnach dem Besuch des Science-Tunnels auf der EXPO tief beein-
AUSSTELLUNG Science-Tunnel auf Tournee in China Im Pekinger China Scienceand TechnologyMuseum ist biszum 31. Augustder Science-Tunnel zu be-sichtigen. Bei der offiziellenEröffnung am29. April warenauch Zhou Guangzhao, Vizevorsitzender des NationalenVolkskongresses,und GerhardWegner, Vize-präsident derMax-Planck-Gesellschaft, anwesend.
FOTO
S: A
ND
REAS
TREP
TE
Der Science-Tunnel sowie vertiefende Infor-mationen im Internet unter:http://www.sciencetunnel.dehttp://2000plus.mpg.de
@

SCHLUSSlicht
Bilder aus der Wissenschaft:Ob mit intrazellulärer Injektion oder per Maus-klick am Computer – die Forscherinnen und Forscher der Max-Planck-Institute erwiesen sichbeim Fotowettbewerb zum Jahr der Lebens-wissenschaften als begabte Lichtbildner. Heraus-gekommen sind grüne Spaghetti, blaue Fantasie-schwämme und rote Blitze im Blaupunktnebel.Die Siegerfotos des von der Max-Planck-Gesell-schaft ausgerufenen internen Wettbewerbs sindseit 19. Juni im Foyer der Münchner General-verwaltung am Hofgarten zu sehen.