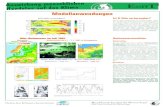MPF_2002_3 Max Planck Forschung
Transcript of MPF_2002_3 Max Planck Forschung

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 1/43
0MaxPlanckForschungMaxPlanckForschungDas Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft
B20396F3/2002
SCHWERPUNKT
Pflanzenforschung
SCHWERPUNKT
Pflanzenforschung
ESSAY
Spicken
erwünscht
METEOROLOGIE
Rascher
Rechner rafft
das Klima
ESSAY
Spicken
erwünscht
METEOROLOGIE
Rascher
Rechner rafft
das Klima
NEUROPSYCHOLOGIE
Wie Sprache aufdie Nerven geht
NEUROPSYCHOLOGIE
Wie Sprache aufdie Nerven geht

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 2/43
32
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 32 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
INHALT
FORSCHUNG aktuell
Bakterien als Baumeister . . . . . . . . . . 4Im Norden grünt es grüner . . . . . . . . . 6Erinnerungen sind bunt . . . . . . . . . . . 8Rätselhafte Eisenfabrik im Universum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Eine neue Waffe gegen Seuchen . . . 11Der Netzhautbeim Rechnen zusehen . . . . . . . . . . 12Gendefekt bringt Mäusean die Flasche . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Nanoröhrchen aus Teflon . . . . . . . . . 15Nach Glasnostlichten sich die Wolken . . . . . . . . . . 16
ESSAY
Spicken erwünscht . . . . . . . . . . . 18
SCHWER punkt:
PFLANZENFORSCHUNG
Blei im Blatt? . . . . . . . . . . . . . . . 22 „Lösungen aus der Region
für die Region“ . . . . . . . . . . . . . . 28 Ein Pilz schlaucht die Abwehr . . . 32 Immunsystem baut auf
molekulare Fertigteile . . . . . . . . . 40
FASZINATION Forschung
Meteorologie:Rascher Rechner rafft das Klima 46
WISSEN aus erster Hand
Neuropsychologische Forschung: Wie Spracheauf die Nerven geht . . . . . . . . . . . 52
WISSENSCHAFTSgeschichte
Ägyptologie: Zaubersprüchegegen Plagegeister . . . . . . . . . . . 58
FORSCHUNG & Gesellschaft
Bildungsforschung: Armutszeugnisfür das deutsche Schulsystem . . . 62
Zur PERSON
Fritz W. Scharpf . . . . . . . . . . . . . 68
NEU erschienen
Vernebeltes Denken . . . . . . . . . . . . . 72Biographie der Vernunft . . . . . . . . . 73Descartes’ Irrtum . . . . . . . . . . . . . . . 73
INSTITUTE aktuell
Peter Gruss übernimmtPräsidentschaft . . . . . . . . . . . . . . . . 74Hubert Markl verabschiedet sich . . . 75Zehn Nationen unter einem Dach . . 76Natur und Kultur des Wollens . . . . . 77Blaue Blitze aus dem Kosmos . . . . . 78Plastizität in Hirn und Mark . . . . . . 80Pilotprojekt fördert Ausgründungen 82
M AXPLANCK INTERN macht sichselbstständig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
STANDorte
Forschungseinrichtungender Max-Planck-Gesellschaft . . . . . . 83Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Im FOKUS
Blau schimmert der Rote Planet . . . 84
PFLANZENFORSCHUNG war immer schon auch anwendungsorientiert: Unter
der Überschrift „Blei im Blatt?“ auf SEITE 22 werden Untersuchungen an Pflanzen
vorgestellt, die Schwermetalle anreichern und mit denen sich in Zukunft vielleicht die
Entsorgungsprobleme für schwermetallverseuchte Böden lösen lassen. In dem darauf
folgenden Interview auf SEITE 28 äußert sich Wolfgang Rohde vom Max-Planck-Insti-
tut für Züchtungsforschung zu den Zielen des in Mexiko gestarteten CIMbios-Projekts.
Mit dem Artikel „Ein Pilz schlaucht die Abwehr“ auf SEITE 32 rücken die Strategien
von Pflanzenparasiten in den Blickpunkt. Der ergänzende Kurzbeitrag (SEITE 38) zeigt,
wie diffizil diese sein können. Und der Bericht „Immunsystem baut auf molekulare
Fertigteile“ (SEITE 40) offenbart, dass es in der „grünen“ und der „roten“ Forschung,
insbesondere auf molekularer Ebene, mittlerweile so viele Gemeinsamkeiten gibt, dass
sich ein Blick zu den Nachbardisziplinen zukünftig noch mehr lohnen könnte.
Schwerpunkt Pflanzen forschung
VERSTÄNDNIS: In ihremöffentlichen Vortrag aufder MPG-Hauptversammlung
in Halle erklärte Prof. Angela Friedericivom MPI für neuropsychologischeForschung, auf welche Weise unserGehirn Sprache verarbeitet.
52 PLAGE: Insekten spielenin der Kulturgeschichteeine wichtige Rolle.
Das Forscherehepaar Prof. Hermannund Dr. Anna Levinson – früher amMPI für Verhaltensphysiologie –wurden vor allem in Ägypten fündig.
58 DURCHGEFALLEN: Auserster Hand berichten wirüber die Hintergründe und
Ergebnisse der PISA-Studie, an der32 Staaten teilgenommen haben. Feder-führend auf deutscher Seite war unter an-derem das MPI für Bildungsforschung.
62 SCHARFBLICK: Prof. FritzW. Scharpf, Direktor am MPIfür Gesellschaftsforschung,
gehört zu den renommiertesten Sozial-wissenschaftlern Europas. Seine Analysenfinden bei Kollegen und Politikerngleichermaßen Beachtung.
68
2222
BIOMAX:Was den Menschen vomAffen unterscheidet,versuchen die Forscher amMax-Planck-Institut fürevolutionäre Anthropologieherauszufinden.
40402828 32
SUPERRECHNER: Mit einemneuen Hochleistungscomputergehen Forscher am MPI für
Meteorologie daran, das „System Erde“nachzubauen und das Zusammenspiel vonAtmosphäre, Ozean und kontinentalerBiomasse zu modellieren.
46
ZUM TITELBILD:Pflanzenforschungkeimt auf – wiedieser Maissprösslingbildhaft verdeutlicht.FOTO: WOLFGANG FILSER
KULTURSCHOCK:Um das deutscheSchulsystem ist esschlecht bestellt.Die PISA-Wissen-schaftlerinDr. Petra Stanatvom MPI für Bildungsforschung plädiertdaher für einen Blick über den Gartenzaun,um von anderen zu lernen.
18

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 3/43
Meter breiten Strukturen. Diesebestehen aus dichten Mattenvon Mikroorganismen, die imInneren durch kalkartige Aus-fällungen von Karbonaten ge-stützt werden. Das Karbonatentsteht ebenso wie Schwefel-wasserstoff als Abfallproduktaus der Oxidation von Methanmit dem im Meerwasser reich-lich vorhandenem Sulfat.Die das Riff bildenden Mikroor-ganismen im Schwarzen Meersind Verwandte der vor zweiJahren entdeckten kleinen Zell-klumpen aus Archaea und Bak-terien. Auch die Schwarzmeer-Bewohner sind in der Lage,große Mengen von Methanmit Sulfat umzusetzen undals Kohlenstoffquelle für ihr
Wachstum zu nutzen. Dieszeigen die Untersuchungen derForscher von der UniversitätHamburg, die in typischen Bio-massebestandteilen der Archa-ea und Bakterien einen hohenGehalt an Kohlenstoff aus demMethan nachweisen konnten.Dass diese mikrobiellen Mattenenorme Mengen an Methanund Sulfat umsetzen, konntenKatja Nauhaus und Tina Treude,Doktorandinnen am Max-Planck-Institut für marine Mik-robiologie, schon an Bord desrussischen ForschungsschiffsRV Logachev messen. Und dieebenfalls am Max-Planck-Insti-tut arbeitenden Postdocs Dr.Katrin Knittel und Dr. ArminGieseke waren dann in der La-ge, das Rätsel um die Identitätder Mikroorganismen zu lösen:
Mit einer direkten Färbungder Zellen durch spezifischeGensonden konnten sie zeigen,dass Mikrokolonien von Met-han fressenden Archaea undSulfat reduzierenden Bakteriendichte Matten bilden, die vonkleinen Adern durchzogen sind.Diese winzigen Kanäle unter-stützen vermutlich den Aus-tausch der Nährstoffe undStoffwechselprodukte undmünden in größere Höhlenund Freiräume im kalkigenInneren der Riffstrukturen.Doch was haben die riesigenBakterienriffe mit der Erdge-schichte zu tun? Sie sind dererste lebende Beweis dafür,dass organische Materie im ir-dischen Geosystem auch ohne
Sauerstoff und pflanzliche Bio-masse auf chemosynthetischemWeg entstanden ist und sichabgelagert hat. Bereits seit lan-gem diskutieren Wissenschaft-ler, ob Methan in der frühenGeschichte des Lebens vor eini-gen Milliarden Jahren eine Rol-le als Nährstoff und Energie-träger gespielt haben könnte.Die bisherige Theorie besagtnoch immer, dass nur Sauer-stoff atmende Mikroorganis-men in der Lage sind, Methaneffizient zu nutzen. Doch Sau-erstoff entstand erst nach derEntwicklung und Ausbreitungvon pflanzlichem Leben, wiewir es heute kennen. Die AWI-Wissenschaftlerin Prof. AntjeBoetius, Mitautorin der SCIENCE-Studie, vermutet deshalb:„Vielleicht waren die Urein-wohner der Erde während einerlangen Periode der Erdge-schichte solche Mikroorganis-men, wie wir sie im Schwarzen
Meer gefunden haben: EineSymbiose von Zellen, die ohneSauerstoff mit Methan alsNährstoff wachsen können.“Diese Mikroorganismen wärendas fehlende Glied in der Ket-te eines erdgeschichtlich sehrfrühen Methankreislaufs. Die-ser hätte dann aus vier Stufenbestanden: 1. Bakterielle Fixie-rung von Kohlendioxid mittelsSonnenlicht ohne Sauerstoff-bildung (anaerobe Photosyn-
these); 2. Zersetzung von pho-tosynthetischer Biomasse durchFermentierer; 3. Bildung vonMethan durch methanogeneArchaea; 4. Veratmung desMethans ohne Sauerstoff durchMethan fressende (methano-trophe) Archaea.Ein interessanter, weil weit-
gehend unerforschter Lebens-raum, in dem der Umsatz vonMethan eine große Rolle spielt,ist die tiefe Biosphäre, die biszu mehreren Kilometern unter-halb des Meeresbodens immernoch Spuren von Leben auf-weist. Weitere extreme Stan-dorte für Methan fressendeMikroben, wie Schlammvulkaneauf dem Meeresgrund, Perma-frostböden in der arktischenTundra oder das Eis in den Po-larregionen, untersuchen ver-schiedene Arbeitsgruppen amAlfred-Wegener-Institut fürPolar- und Meeresforschung.Diese und andere Projekte zumglobalen Methankreislauf wer-den im Rahmen des aktuellenSchwerpunktprogramms „Geo-technologien – Gashydrate imSystem Erde“ des Bundesfor-schungsministeriums und derDeutschen Forschungsgemein-schaft gefördert, das Ende2000 begann und schon im er-
sten Jahr viele neue Erkennt-nisse über die Rolle von Erdgasin der Umwelt erbracht hat. ●
FORSCHUNG aktue
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 5
Riesige, bis zu vier Meterhohe Riffe aus Mikroorga-nismen, die sich von Methanernähren, haben Wissen-schaftler des Bremer Max-Planck-Instituts für marineMikrobiologie, der Univer-sität Hamburg und des Al-fred-Wegener-Instituts(AWI) in Küstengewässerndes Schwarzen Meeres ent-deckt (SCIENCE, 9. August2002). Die Matten bestehenhauptsächlich aus extremdichtgepackt lebenden Ar-chaea und Sulfat reduzieren-den Bakterien, die in Sym-biose poröse Stütz-Struktu-
ren aus Kalziumkarbonat so-wie beträchtliche Mengenan Biomasse produzieren.Diese Entdeckung ist vongrundsätzlicher Bedeutungfür unser Verständnis derfrühen Erdgeschichte und derEntstehung der Biosphäre.
Der Blick aus dem TauchbootJAGO auf eine Landschaft vonSäulen, Hügeln, Knollen undanderen Riff-Strukturen bietet
wenig Ähnlichkeit mit dem Bildeines Stückchens des Riffs un-ter 1000facher Vergrößerungim Mikroskop, das eine engeLebensgemeinschaft von zweiunterschiedlichen Zelltypen –Bakterien und Archaebakterien– zeigt. Aber tatsächlich han-delt es sich hier um Einzeller,die gerade einmal einen tau-sendstel Millimeter groß wer-den und doch in der Lage sind,enorme Mengen von Methanzu Kohlendioxid (CO2) zuveratmen und dabei riesigeMengen an organischer Masseaufzubauen.Seit mehr als 30 Jahren haben
Wissenschaftler weltweit ver-sucht, Mikroorganismen zufinden, die Methan ohneSauerstoff umsetzen können.Methan ist ein wesentlicherBestandteil des Erdgases, daswir als fossilen Brennstoff nut-zen. Es ist auch ein wichtigesTreibhausgas und entsteht ingroßen Mengen an Land – vorallem in Reisfeldern und Kuh-mägen – sowie in den Ozeanentief unter dem Meeresboden.
4 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
Erst vor zwei Jahren ist es einerArbeitsgruppe aus Mikrobiolo-gen, Molekularökologen undBiogeochemikern am Max-Planck-Institut für marine Mi-krobiologie in Bremen gelun-gen, eine solche Lebensformoberhalb von Gashydratlagernim Meer aufzuspüren (MAX-PLANCKFORSCHUNG 4/2000,S. 5 f.). Damals handelte essich ebenfalls um eine Sym-biose aus Archaea und Bakte-rien, die zusammen als winzigeZellklumpen zu Tausenden inmethanreichen Meeresbödenvorkommen und inzwischenweltweit an gasreichen Stand-
orten gefunden wurden.Auch im Bodenwasser desgrößten sauerstofffreien Mee-resbeckens der Welt, demSchwarzen Meer, gibt es genü-gend Methan. Im Westen derHalbinsel Krim fanden die For-scher mithilfe des U-BootsJAGO jetzt in einer Wassertiefevon 230 Metern ein riesigesRiff. Gasblasen durchströmenkontinuierlich die teilweise biszu vier Meter hohen und einen
MARINE MIKROBIOLOGIE
Bakterien als BaumeisterEine verwandte
Symbiose ausMethan fressen-den Mikroorga-nismen. In gas-hydrathaltigen
Sedimenten ausdem Kontinental-hang vor Oregon
(USA) entdecktenForscher die klei-
nen Aggregateaus Archaebak-terien (rot) und
Sulfat reduzieren-den Bakterien(grün) zuerst.
Dieser Dünn-tt eines Riffsm Schwarzeneer wurde fürdie Epifluor-szenz-Mikro-kopie doppeltngefärbt, undwar mit einerot-fluoreszie-
renden RNA-de, die gegenne spezifischeuppe von Ar-aea, gerichtetund mit einergrün-fluores-renden RNA-
onde, die einespezifische
Gruppe vonulfat reduzie-den Bakterien
anzeigt. Derweiße Balkenspricht einem
fünfzigstelMillimeter.
F O T O S : M P I F Ü R M A R I N E M I K R O B I O L O G I E
/ G H O S T D A B S ,
U N I V E R S I T Ä
T H A M B U R G
Ein Blick aus demTauchboot JAGOzeigt das von Gas-blasen umströmteBakterienriff.Einige der Riff-strukturen sindvier Meter hochund einen Meterbreit. Sie bestehenfast ausschließ-lich aus Methanfressenden Mikro-organismen sowieaus durch denMethanumsatzausgefälltem Kalk.
F O T O S : M P I F Ü R M A R I N E M I K R O B I O L O G I E
/ G E O M A R ,
K I E L
An Bord derRV Logachevwerden Probenaus Stücken deBakterienriffsentnommen,um verschiedeExperimente zuStoffumsatz unzur Beschaffen
heit der Bakterien und Archaauszuführen.
Weitere Informationenerhalten Sie von:
DR. MANFRED SCHLÖSSER
Max-Planck-Institutfür marine Mikrobiologie, BremenTel.: 0421/2028-704Fax: 0421/2028-790E-Mail: [email protected]
@

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 4/43
Satellitendaten der vergan-genen 20 Jahre haben ge-zeigt, dass der Nordender Erde immer grüner wird.Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Biogeo-chemie Jena unter Leitungvon Prof. Colin Prentice, vomPotsdam-Institut für Klima-folgenforschung, der LundUniversität in Schweden, derBoston University und demLaboratoire des Sciences duClimat et de l’Environnementin Paris haben mit einemneuen globalen Ökosystem-Modell gezeigt, dass die ver-
stärkte Aktivität in der Vege-tation durch die Klimaerwär-mung erklärt werden kann(SCIENCE, 31. Mai 2002).
Vor einigen Jahren veröffent-lichten Dr. Ranga Myneni undseine Kollegen von der BostonUniversity einen Artikel inder Fachzeitschrift NATURE undberichteten – auf der Basisvon Satellitenbeobachtungen –über eine verstärkte Vegetati-onsaktivität in der borealenRegion der Erde (Taigawälderund Tundra). Diese Ergebnissestießen damals bei vielen Wis-senschaftlern auf Skepsis, dadie Daten wegen instrumentel-ler Unterschiede bei den Satel-liten nur schwer für langfristi-ge Trendaussagen genutzt wer-den können. Das BostonerTeam überarbeitete daraufhinden Datenbestand unter Einbe-ziehung möglicher Unwägbar-keiten, doch der Trend einer
verstärkten Vegetationsakti-vität blieb und wurde sogar mitder Zeit und neuen Daten im-mer deutlicher.Eine mögliche Ursache für dasverstärkte Grün im Norden waroffensichtlich: Aus den Auf-zeichnungen der Wetterstatio-nen in den nördlichen Ländernergibt sich eine stetige Erwär-mung (etwa 0,4 Grad Celsiuspro Jahrzehnt), die heute allge-mein dem zunehmenden Treib-
hauseffekt zugeschrieben wird.Diese Erwärmung dürfte dieverstärkte Vegetationsaktivitätin den nördlichen Breitengra-den ausgelöst haben. Doch eswar nicht einfach, die Datender Wetterstationen mit denSatellitenbeobachtungen zuverbinden, um herauszufinden,ob es tatsächlich einen quanti-tativen Zusammenhang zwi-schen der stärkeren Vegetationund der höheren Temperaturgibt. Auch wenn computerba-sierte numerische Modelle desphysikalischen Klimas seit dreiJahrzehnten benutzt werden,
um mögliche Konsequenzendes Treibhauseffekts zu analy-sieren, wenden die Forschererst seit kurzem vergleichbareglobale Modelle auf das Öko-system Erde an.Ein Schwerpunkt der Global-Ecology-Arbeitsgruppe vonColin Prentice am Max-Planck-Institut für Biogeochemie inJena ist die Entwicklung einesglobalen Ökosystem-Modellsder Erde. Unter Leitung vonPrentice hat ein Konsortiumdas so genannte LPJ-Modellentwickelt – benannt nach denOrten der drei beteiligten Ar-beitsgruppen (Martin Sykes inLund, Wolfgang Cramer inPotsdam, Colin Prentice in Je-na). Grundidee dieses Modellsist es, Wissen aus ganz unter-schiedlichen Fachgebieten wieder Pflanzenphysiologie undBiophysik sowie der terrestri-schen Ökologie und Hydrologiezu integrieren und mit mög-
lichst vielen Messdaten –einschließlich Satellitenbeob-achtungen – zusammenzu-führen. Dabei wollen die For-scher die Interaktion der ver-schiedenen Prozesse im Öko-system auf unterschiedlichenZeitskalen (von Minuten bis zuJahren) abbilden.Die in SCIENCE veröffentlichtenErgebnisse sind die Frucht einerengen Kooperation zwischendem LPJ-Konsortium einerseits
und der Forschungsgruppe inBoston andererseits. Bindegliedzwischen diesen Gruppen warDr. Wolfgang Lucht vom Pots-dam-Institut für Klimafolgen-forschung mit seinen engen Verbindungen zu Forschungs-gruppen im Bereich der Fern-erkundung. Diese Kooperationmachte es möglich, Monat fürMonat Klimabeobachtungender gesamten borealen Zonezu nutzen. Hierbei fanden dieWissenschaftler heraus, dassdie Veränderung des Blatt-flächenindexes (des Verhältnis-ses der gesamten Blattfläche
zur Bodenfläche) während je-der Wachstumsperiode und –am wichtigsten – von einerSaison zu nächsten erstaunlichgut mit den Satellitendatenübereinstimmte.Zwei Jahrzehnte Satellitenbe-obachtungen belegen, dassder Frühling in dieser Regioninzwischen etwa eine Wochefrüher einsetzt, und dass diemaximale Vegetationsdichteim Sommer zugenommen hat.Die Modellrechnungen zeigen,dass diese Trends quantitativauch mit den Erwartungenübereinstimmen, die sich ausder gemessenen globalen Er-wärmung in dieser Zeit erge-ben. Dass sich die Ergebnisseaus beiden völlig unabhängi-gen Informationsquellen derartgleichen, ist darauf zurückzu-führen, dass der über die Fer-nerkundung gemessene Trendreal ist und durch die Klimaver-änderung verursacht wurde.
Mit dem LPJ-Modell ist es auchmöglich, Sensitivitätsstudienvorzunehmen, um die Haupt-ursache für einen gegebenenEffekt zu isolieren. Die Wissen-schaftler stellten fest, dass dasverstärkte Wachstum der Ve-getation eindeutig durch diehöhere Temperatur hervorge-rufen wurde und nicht durchphysiologische Effekte wieschnelleren Pflanzenwuchs auf-grund höherer Kohlendioxid-
RSCHUNG aktuell
6 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
BIOGEOCHEMIE
Im Norden grünt es grüner
Konzentrationen oder durchdie Zunahme von Regen undSchneefällen, die mit der Tem-peraturerhöhung einhergehen.Ein bedeutendes Ereignis un-terbrach diesen Trend für kurzeZeit: die Eruption des VulkansMount Pinatubo auf den Phi-lippinen im Jahr 1991. Derlangsame Niedergang von vul-kanischem Aerosol führte 1992und 1993 zu einer durch-schnittlichen Abkühlung um0,5 bis 1 Grad Celsius pro Jahr– und zu spektakulären Son-nenuntergängen in den nördli-chen Breitengraden. Auch indiesem Fall hatten die Satelli-tendaten angezeigt, dass derTrend zu einer verstärkten Ve-getationsaktivität sich nichtfortsetzte. Doch wiederum be-zweifelten viele Forscher einen
Zusammenhang zwischen derTemperaturveränderung unddem Wachstum der Vegetation,da sich das vulkanische Aerosolin der Atmosphäre auf dieLeistung der Satelliten-Mess-instrumente ausgewirkt hatte.Das LPJ-Modell zeigte auch indiesem Fall die gleichen Ergeb-nisse wie die Satellitenbeob-achtungen: einen kurzzeitigenRückgang des Trends, der sichdann prompt fortsetzte, als die
vulkanische Ascheniedergegangen war.Der Ausbruch desPinatubo hatte nocheinen anderen Effekt,der die Wissenschaft-ler, die an der Erfor-schung des irdischenKohlenstoffkreislaufsarbeiten, außerordent-lich überraschte: DieZunahme des Kohlen-dioxid-Anteils in derAtmosphäre war plötz-lich für zwei Jahre ge-bremst. Noch habendie Klimaforscher kei-ne vollständige Er-klärung dafür, da andiesem Effekt mögli-cherweise auch die
gemäßigten und tropi-schen Klimazonen be-teiligt waren. Doch diefranzösischen Partner
vom Laboratoire des Sciencesdu Climat et de l’Environne-ment in Paris benutzten neues-te mathematische Methoden,um kleinste Unterschiede inden Kohlendioxid-Konzentra-tionen zu analysieren, die vonden verschiedenen Messstatio-nen in der ganzen Welt be-obachtet wurden. Diese Unter-suchungen lassen Rückschlüsseauf die regionalen Quellen unddas Absinken von Kohlendioxidüber dem Land und auf See zu.Die Resultate der französischenForscher zeigten, dass währendder beiden „Pinatubo-Jahre“die Landgebiete in den nördli-chen Breitengraden wesentlichmehr Kohlendioxid als sonstaufgenommen haben.Auch das LPJ-Modell kam zudiesem Ergebnis. Was war die
Ursache? Zwar verkürzte sich indieser Zeit die Vegetationszeit,und die Photosynthese derPflanzen ging zurück; doch diekühleren Vegetationszeitenführten dazu, dass abgestor-benes organisches Materiallangsamer abgebaut wurdeund mehr Kohlenstoff in derErde verblieb. Dies war der do-minierende Effekt in den nörd-lichen Breitengraden, der zueiner Abschwächung der glo-
balen Kohlendioxid-Wachs-tumsrate in diesen Jahrenbeitrug.Diese Ergebnisse eröffnen einneues „Zeitalter“ für Ökosys-tem-Modelle, deren Qualitätwesentlich abhängt von einerengen Zusammenarbeit zwi-schen Feldforschung und Ar-beitsgruppen mit theoreti-schem Schwerpunkt. BisherigeModelle hatten sich zumeistdarauf konzentriert, die Aus-wirkungen von zukünftigenKlimaänderungen vorherzu-sagen, wobei es zwischen denverschiedenen Modellen großeUnterschiede gab. Deshalbbenötigen diese Modelle einebessere Evaluierung, das heißtden systematischen Vergleich
zwischen Vorhersagen undrealen Messungen.Zudem haben die ResultateBedeutung über die Wissen-schaft hinaus: Die Forscherhaben mit ihrem neuen Modellgezeigt, dass sich die Biosphäreaufgrund von Klimaverände-rungen tatsächlich wandelt,was höchstwahrscheinlich diedirekte Konsequenz menschli-cher Aktivitäten besonders inden industrialisierten Ländernist. Die globale Erwärmung unddie verstärkte Vegetationsakti-vität in den nördlichen Breiten-graden werden – falls sie sichweiter fortsetzen – ganz unter-schiedliche Auswirkungen ha-ben: So wird sich einerseits dasPotenzial der Land- und Forst-wirtschaft im nördlichen Kana-da und in Sibirien vergrößern,während andererseits im arkti-schen Ökosystem die Fauna undFlora und damit die Lebens-grundlagen der dort ansässigen
Ureinwohner durch das Vor-dringen neuer Arten aus demSüden gefährdet werden. ●
Weitere Informationenerhalten Sie von:
PROF. DR. COLIN PRENTICE
Max-Planck-Institutfür Biogeochemie, JenaTel.: 03641/64-3774Fax: 03641/64-3775E-Mail: [email protected]
FORSCHUNG aktue
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 7
@
Oben: Monatliche Abweichung des Blattflächenindexes (LAI)vom Langzeitdurchschnitt in der globalen borealen Zone, be-stimmt aus Satellitendaten und simuliert mit dem LPJ-Modell.Der Blattflächenindex ist das Verhältnis der gesamten Blattflächezur Bodenfläche. Unten: Jährliche Abweichung des Frühlings-beginns vom Langzeitdurchschnitt in der globalen borealen Zone,
bestimmt aus Satellitendaten und simuliert mit dem LPJ-Modell.Die gestrichelte Line zeigt den Verlauf eines LPJ-Modells,in dem nur die Temperatur von Jahr zu Jahr verändert wurde.
G R A F I K : M P I F Ü R B I O G E O C H E M I E

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 5/43
Ein Bild sagt mehr als tau-send Worte – und ein Farb-bild sagt noch einiges mehr.Denn Bilder behalten wirdann besser im Gedächtnis,wenn sie natürliche Farbenhaben und nicht schwarz-weiß sind. Das zeigt die Ar-beit von Dr. Felix Wichmannvom Max-Planck-Institutfür biologische Kybernetikin Tübingen und Karl Gegen-furtner, früher ebenfalls amMax-Planck-Institut und jetzt Professor an der Justus-Liebig-Universität in Gießen(JOURNALOF EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY : Learning, Me-mory and Cognition, Vol. 28,Nr. 3, Mai 2002).
Aus Untersuchungen zur visu-
ellen Wahrnehmung war schonseit langem bekannt, dass imGehirn von Primaten Nerven-zellen des visuellen Kortex auf Licht verschiedener Wellenlän-gen unterschiedlich reagieren.Psychophysische Experimentezur Farbwahrnehmung habensogar schon Newton undGoethe ausgeführt. Doch trotzder Vielzahl dieser Versucheund Befunde über das feinefarbliche Unterscheidungsver-
mögen des Menschen oder dieFarbkonstanz unter verschiede-nen Beleuchtungen waren Er-gebnisse rar, die eine entspre-chende Rolle von Farbe bei dervisuellen Kognition – also demErkennen von Objekten – nahelegten: Farbe ist zwar hübschanzusehen, scheint aber für dieObjekterkennung als solchenicht wichtig zu sein.In einer Serie von fünf Expe-rimenten haben die TübingerWissenschaftler nun gezeigt,dass Farbe einen nachweisba-ren Einfluss auf das mensch-liche Gedächtnis für natürlicheSzenen hat. Im ersten Experi-ment bekamen die Versuchs-personen Bilder verschiedenerKategorien präsentiert: grüneWiesen und Wälder aus der
Umgebung Tübingens, Blumen,eher karge Landschaften ausUtah sowie urbane Szenen mitAutos, Häusern und Menschen.Die Bilder waren entweder far-big oder schwarz-weiß (Abb. 1)– an die Farbfotos konntensich die Versuchspersonendeutlich besser erinnern. Umauszuschließen, dass dieserGedächtnisvorteil auf Kontrast-oder Aufmerksamkeitsunter-schieden beruht, machten die
Wissenschaftlerden Versuch in ver-schiedenen Varia-tionen – immermit demselbenResultat. In einemweiteren Experi-ment zeigten dieForscher „Falsch-farben-Bilder“.Diese Aufnahmen,wie zum BeispielAbbildung 2, besit-zen an jedem Punktdieselbe Helligkeitwie Fotos in natür-lichen Farben. Er-
gebnis: Falschfar-ben-Bilder behan-delt unser Gehirngenauso wieschwarz-weiße.
Es scheint, als ob sich dasmenschliche Gedächtnis durchEvolution und Entwicklungan die Farben der natürlichenUmwelt angepasst hat. Bilder,die zu sehr von der natürlichenNorm abweichen, werdenoffenbar nicht so gut gespei-chert. Dabei ist der Farbvorteil
natürlicher Bilder nicht einfach
dadurch zu erklären, dass far-bige Fotos mehr Information,also mehr Bits besitzen; dennFalschfarben-Bilder enthaltengenauso viele Bits wie natür-lich gefärbte Bilder. ●
RSCHUNG aktuell
8 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
Wie kommt das Eisen in dieWelt? Den Theorien derAstrophysiker zufolge wird esim Inneren von massereichenSternen erbrütet und – wenndiese als Supernovae explo-dieren – ins All geschleudert.Dort vermischt es sich mitMaterie, aus der wiederumneue Sterne entstehen. Auchunsere Sonne enthält alsStern einer späteren Genera-tion einen gewissen Eisenan-teil. Prof. Günther Hasingerund Dr. Stefanie Komossavom Max-Planck-Institut fürextraterrestrische Physik in
Garching sowie Dr. NorbertSchartel von der Europäi-schen RaumfahrtagenturESA ist jetzt eine erstaunli-che Entdeckung gelungen:Spektralbeobachtungen mitdem RöntgenobservatoriumXMM-Newton ergaben,dass der Quasar APM08279+5255 etwa drei Malmehr Eisen birgt als heute imSonnensystem vorhanden ist.Den Quasar sehen wir zueiner Zeit, da das Universum
erst rund 1,5 Milliarden Jah-re alt war; die Sonne dage-gen entstand etwa neun Mil-liarden Jahre nach dem Ur-knall. Das heißt: In dem jun-gen Quasar existierte bereitsmehr Eisen als in unseremviel älteren Sonnensystem.Entweder gibt es eine bisherunbekannte, jedoch effizien-tere Art der Eisenproduktion,oder das Universum war zudem Zeitpunkt, als der Qua-sar sein Licht aussandte, we-sentlich älter als bisher an-genommen (APJ LETTERS Vol.573, L77, 10. Juli 2002).
Der Quasar APM 08279+5255ist eines der leuchtkräftigstenObjekte im gesamten Univer-sum. Er strahlt über eine Billiar-de (1015) Mal mehr Energie abals unsere Sonne. Nur deshalbkönnen wir trotz seiner großenEntfernung noch intensiveStrahlung von ihm auffangen.Diese Leuchtkraft speist sichhauptsächlich aus dem „Ab-sturz“ von Materie in ein gigan-tisches Schwarzes Loch im
Quasarzentrum. Das gasförmigeMaterial heizt sich stark auf und sendet Röntgenstrahlenaus – quasi als „letzten Hilfe-schrei“, bevor es in demSchwarzen Loch verschwindet.Ein Teil der eingefangenen Ma-terie wird jedoch durch denstarken Lichtdruck des Zentral-objekts wieder nach außen ge-blasen. Bei APM 08279+5255sehen wir das Schwarze Lochzufällig durch den Schleierder ausströmenden Materie.Zusätzlich verstärkt eine sogenannte Gravitationslinsedas Licht des Quasars.
Diese Eigenschaften machenAPM 08279+5255 zu einemhervorragenden Laboratorium,um mittels Röntgenstrahlen dieBedingungen im frühen Uni-versum und in unmittelbarerNähe supermassereicherSchwarzer Löcher zu untersu-chen. Bei der Analyse des mitdem europäischen SatellitenXMM-Newton aufgefangenenRöntgenlichts fanden GüntherHasinger, Stefanie Komossaund Norbert Schartel heraus,
FORSCHUNG aktue
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 9
BIOLOGISCHE KYBERNETIK
Erinnerungen sind bunt
Abb. 1: Dietbilder – ein-arbig, einmalchwarz-weiß.
EXTRATERRESTRISCHE PHYSIK
Rätselhafte Eisenfabrik im Universum
Die „Delle“ imSpektrum desQuasars APM08279+5255(XMM-NewtonFoto links)stammt von deElement Eisen.Ähnlich wieMediziner mittRöntgenstrahleunsere Knochedarstellen können, weil sie füRöntgenstrahluundurchlässig und daher dunerscheinen, sindie ausströmenden Eisenwolkeundurchlässig die Röntgenstrlen, die im Zen
trum des Quasentstehen: Beifür Eisen charateristischen „Asorptionsenerg(Pfeil) fehlt einTeil des Röntgelichts.
Abb. 2:Beispiel fürein Falschfarben-Bild (das Fotoin Abb.1, rechtsoben, zeigtdasselbe Motivin natürlichenFarben).
F O T O U N D G R A F I K : E S A / M P I F Ü R E X T R A T E R R E S T R I S C H E P H Y S I K
F O T O S : M P I F Ü R B I O L O G I S C H E K Y B E R N E T I K
Weitere Informationen erhalten Sie von:DR. FELIX A. WICHMANN
Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik, TübingenTel: 07071/601-554 Fax: 07071/601-552E-Mail: [email protected]
@

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 6/43
ss die aus dem Zentrum desasars strömende Materieoße Mengen Eisen enthält.s der „Delle“ im Quasarspek-m konnten die Forscher
hließlich den Anteil diesesements im Quasarzentrum –d damit im frühen Univer-m – messen. Das Eisenheint weit gehend „allein auf eiter Flur“ zu sein, das heißt:dere chemische Elemente,e zum Beispiel Sauerstoff,achen sich kaum bemerkbar.ist das Eisen-Sauerstoff-rhältnis etwa drei- bis fünf al so hoch wie in unseremnnensystem.des schwere Element, ausm Planeten wie unsere Erded auch wir selbst bestehen,
urde in früheren Jahrmilliar-n in Sternen erzeugt. Diest auch für das Eisen, das be-nders in einem speziellen Typn Supernova („Typ I“) produ-rt wird: Supernovae sind
assereiche Sonnen, die amde ihres Lebens in giganti-hen Explosionen die in ihremneren erzeugten Elemente inn interstellaren Raum blasen.
n Teil dieses „Sternenstaubs“rd zur Bildung neuer Sternerbraucht, ein anderer vonhwarzen Löchern in denntren der Galaxien aufgeso-n. Da aber Sterne, die alsp-I-Supernova enden, sehrnge leben (ungefähr einelliarde Jahre), sind großeengen an Eisen im früheniversum äußerst bemerkens-
ert. Die Eisenhäufigkeit istshalb so wichtig, weil sie
ne Art „kosmische Uhr“ dar-ellt: Seit dem Urknall vornd 15 Milliarden Jahren wer-
n sämtliche chemische Ele-ente – außer den leichtestene Wasserstoff und Helium –oben beschriebenen Prozess
oduziert. Beim Eisen dauerts eine geraume Zeit: Mindes-ns eine Milliarde Jahre mus-n vergehen, um zum Beispiel
e bei unserer Sonne gefunde-n Verhältnisse zu „erbrüten“.
mso erstaunlicher, dassn so junges Objekt wie APM279+5255 bereits einen
deutlich höheren Eisengehaltaufweist als unser wesentlichälteres Sonnensystem. Entwe-der gibt es eine effizientereArt, Eisen zu erzeugen – quasieine Art kosmische „Eisenfa-brik“ –, oder das Universum istbei einer Rotverschiebung vonz = 4, wie si e der Quasar be-sitzt, bereits viel älter als bisherangenommen.Was bedeutet dieses „z“? DasLicht, das die Astronomen vonweit entfernten Objekten emp-fangen, war lange Zeit unter-wegs. Daher ist ein Blick ingroße Entfernungen auch im-mer ein Blick in die Vergangen-heit des Universums: Teleskopeähneln Zeitmaschinen. Der Vor-stoß in die größten Distanzen
ermöglicht einzigartige Ein-blicke in die Frühphase desWeltalls. Während der Zeit, inder das Licht einer fernen Ga-laxie den weiten Weg zur Erdedurchläuft, expandiert der ge-samte Raum – und damitwächst auch der Abstand zwi-schen Wellentälern und -ber-gen des Lichts. Diese „Deh-nung“ führt zu größeren Wel-lenlängen, also zu einer Rot-verschiebung (z) des Lichts, undgilt als Maß für die Entfernungeiner Galaxie oder eines Qua-sars und damit für deren Alter:Je höher der „z“-Wert einesObjekts, desto größer sein Ab-stand und desto geringer seinAlter. In der Entfernung desQuasars APM 08279+5255(z = 3,91) hatte das Weltall ge-rade einmal etwa ein Zehntelseines jetzigen Alters von rund15 Milliarden Jahren; das Qua-sarlicht stammt also aus derKinderstube des Kosmos.
Die neuen Beobachtungenzeichnen ein extremes Bild fürden Innenbereich von APM08279+5255: Es muss einwahres „Feuerwerk“ an Super-novae im Zentrum des Quasarsgegeben haben, um so vielEisen zu erzeugen. Nicht nurdas. Um die hohe Leuchtkraftvon APM 08279+5255 und denhohen Materieausfluss aus demQuasarzentrum aufrechtzuer-halten, müssen jährlich sehr
RSCHUNG aktuell
0 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
Ununterbrochen findet inunserem Körper ein Kampf zwischen Krankheitserregernund dem Immunsystem statt.Die erste Abwehrfront gegensolche Eindringlinge sindweiße Blutzellen, die Mikro-organismen aufnehmen undeliminieren. Prof. ArturoZychlinsky, Direktor am Ber-liner Max-Planck-Institut fürInfektionsbiologie, und YvetteWeinrauch, New York Uni-versity School of Medicine,haben jetzt herausgefunden,wie es den weißen Blutzellenmithilfe des Enzyms Elastase
gelingt, die krankmachendenWaffen von Bakterien lahmzu legen (NATURE, 2. Mai2002). Mit diesem Wissenlassen sich neuartige Antibio-tika gegen gefährliche Infek-tionskrankheiten wie Ruhroder Typhus schneidern.
Weiße Blutzellen (Leukozyten)nehmen in den menschlichenKörper eindringende Bakterienauf. In der Zelle gelangen dieBakterien in ein membranum-schlossenes Kompartiment, dieso genannte Vakuole, in der siedurch giftige Substanzen ab-getötet werden. Dieser Abwehr-mechanismus ist auch dieGrundlage dafür, dass unserOrganismus in der Regel mitkleinen Wunden oder mildenInfektionen fertig werden kann.Doch manchmal werden wirvon Bakterien infiziert, die mithoch entwickelten Waffen aus-gestattet sind: Sie greifen die
weißen Blutzellen an, die unseigentlich verteidigen sollen.Das ist zum Beispiel bei Dysen-terie (Ruhr) der Fall, einer le-bensbedrohlichen Form vonblutigem Durchfall, den dasBakterium Shigella verursacht.Dysenterie ist eine schwer wie-gende Erkrankung, die jedesJahr Millionen von Todesopfernfordert, insbesondere unter Kin-dern in Entwicklungsländern.Shigella nutzt krankheitsver-
mittelnde Proteine, ummenschliche Zellen zu beein-flussen. Mithilfe dieser Proteinekann Shigella in kürzester Zeitin jede beliebige Körperzelleeindringen und aus dem „Ge-fängnis“ innerhalb der Zellen,das heißt der Vakuole, entkom-men. Bei der Untersuchungdieses Mechanismus stießenWeinrauch und Zychlinsky auf den folgenden Widerspruch:Wenn Shigella aus der Vakuoleder Abwehrzellen „fliehen“kann, in der das Bakteriumeigentlich getötet werden soll,dann müssten Shigella-Infek-
tionen eigentlich immer tödlichverlaufen. Doch glücklicher-weise erholen sich die meistenMenschen nach einer akutenRuhr-Infektion wieder.Die Forscher vermuteten dieLösung dieses Widerspruchs ineinem bestimmten Typ vonweißen Blutzellen, den neutro-philen Granulozyten: Zum ei-nen treten diese Blutzellen beiShigella-Infektionen in großerZahl auf, zum anderen sind siemit Waffen ausgerüstet, dieBakterien töten können, wenndiese in eine Vakuole einge-sperrt sind. In Zusammenarbeitmit Jerry Weiss, der jetzt an derIowa University arbeitet, fan-den Zychlinsky und Weinrauchzu ihrer Überraschung heraus,dass Shigellen – anders als inanderen Zellen – in neutrophi-len Blutzellen tatsächlich in Vakuolen eingeschlossen blei-ben und sich nicht daraus be-freien können.
Warum bleibt Shigella in den Vakuolen der neutrophilenBlutzelle? Auf der Suche nachder Antwort entdeckten dieForscher einen Mechanismus,mit dem die neutrophilenBlutzellen nicht nur Shigella,sondern auch andere Infek-tionserreger entwaffnen.Neutrophile Blutzellen produ-zieren nämlich das EnzymElastase, das mit einer beein-druckenden Effizienz krank-
heitsvermittelnde Proteineerkennen und zerstören kann.Dazu gehören auch die Prote-ine, die Shigella für die Fluchtaus der Vakuole benötigt. Auf diese Weise halten die neutro-philen Blutzellen Shigella solange gefangen, bis andere Ab-wehrmechanismen mobilisiertsind, die das Bakterium zer-stören. Hingegen können neu-trophile Blutzellen mit deakti-vierter Elastase Shigellen nichtin der Vakuole zurückhalten,sodass die Bakterien den An-griff überleben und als Siegerhervorgehen. Dies zeigten
Tests, die gemeinsam mit SteveShapiro von der HarvardMedical School durchgeführtwurden. Hierbei stellten dieForscher außerdem fest, dassElastase nicht nur die krank-heitsvermittelnden Proteinevon Shigellen zerstören kann,sondern auch die von Salmo-nellen und Yersinien, den Erre-gern von Typhus und Pest.Arturo Zychlinsky sieht wichti-ge Anwendungsmöglichkeitenseiner Forschungsergebnisse:„Noch haben wir eine Reihevon Fragen nicht beantwortet,wie zum Beispiel: Wie wird dieElastase rechtzeitig bereitge-stellt? Wie kann sie die krank-heitsvermittelnden von norma-len Proteinen eines Bakteriumsunterscheiden? Trotzdem er-möglicht unsere Entdeckungbereits jetzt die Entwicklungeiner neuen Generation vonAntibiotika, die darauf ab-zielen, krankheitsvermittelnde
Proteine von Infektionserre-gern zu neutralisieren, stattwie bisher ohne Unterschied jeden Mikroorganismus.“ ●
Weitere Informationenerhalten Sie von:
PROF. ARTURO Z YCHLINSKY
Max-Planck-Institut fürInfektionsbiologie, BerlinTel.: 030/28460-300Fax: 030/28460-301E-Mail: [email protected]
FORSCHUNG aktue
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 11
@
INFEKTIONSBIOLOGIE
Eine neue Waffe gegen Seuchen
Menschliche neu-trophile Blutzellen,
die von Shigella-Bakterien infiziert
sind. Shigella-Bakterien sind
zehn Mal kleinerals eine neutro-phile Blutzelle.
Deshalb ist in denBildern nur jenerTeil der neutro-philen Zellen zu
sehen, in dem sichdas Shigella-Bak-
terium befindet.Der Buchstabe „S“steht für Shigella,
„N“ für neutro-phile Blutzelle.
Im Bild oben istdas Protein Elas-
tase aktiv und dasShigella-Bakte-
rium in einer Vakuole einge-
schlossen. Hinge-gen wurde in der
Zelle im Bild untenElastase deakti-
viert – das Bakte-rium ist der Va-
kuole „entflohen“.
F O T O S : M P I F Ü R I N F E K T I O N S B I O L O G I E
viele Sonnenmassen an Ster-nenstaub verschluckt und zumTeil wieder hinausgeblasenwerden.Doch selbst eine besondershohe Rate an Supernovae kann– wegen der langen Lebens-dauer der Sterne, die als Super-novae enden – nur schwer er-klären, warum so früh in derEntwicklung des Universums soviel Eisen erzeugt wurde. Wahr-scheinlich benötigen wir außer-dem mehr Zeit, also ein größe-res Alter des frühen Univer-sums, und können auf dieseWeise unabhängige Hinweiseauf die Existenz der kürzlichentdeckten KosmologischenKonstanten ableiten – einermysteriösen „Dunklen Energie“,
die das Universum heute nochauseinander zu treiben scheint.Die mithilfe von XMM-Newtonan APM 08279+5255 gemach-ten Beobachtungen liefernwichtige neue Informationenfür das Verständnis der Ele-mentsynthese und die chemi-sche Entwicklung des frühenUniversums, für die neuen ver-einheitlichten Modelle der Geo-metrie der bei verschiedenenAktivitätsformen von Quasarenausströmenden Materie undschließlich für die Messung vonParametern wie der Kosmologi-schen Konstante. Während heu-te mit XMM-Newton nur ganzwenige, besonders helle Einzel-objekte wie APM 08279+5255studiert werden können, hoffendie Wissenschaftler mit XEUS,dem künftigen großen Rönt-genobservatorium der ESA,routinemäßige „Röntgen-Reihen-Untersuchungen“ anvielen schwächeren Objekten
vorzunehmen und damit diehier aufgeworfenen Fragen zubeantworten. ●
Weitere Informationen erhalten Sie von:PROF. GÜNTHER HASINGER, Max-Planck-Institut
für extraterrestrische Physik, GarchingTel.: 089/30000-3402 Fax: 089/30000-3569E-Mail: [email protected]
DR. STEFANIE KOMOSSA, Max-Planck-Institutfür extraterrestrische Physik, GarchingTel.: 089/30000-3577 Fax: 089/30000-3569E-Mail: [email protected]
@

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 7/43
Die Netzhaut oder Retina,die als „Projektionsschirm“den Augenhintergrund aus-kleidet, arbeitet nicht nurals Detektor, sondern auchals hoch spezialisierter Pro-zessor zur Bildverarbeitung:Die Retina analysiert abge-bildete Szenen und gewinntdaraus zeitliche, räumlicheund farbliche Informationen,die dann über den Sehnervan die visuellen Zentren imGehirn laufen. Bisher war nurwenig darüber bekannt, in-wieweit eine lokale Signal-verarbeitung bereits in den
Dendriten – faserig verästel-ten Fortsätzen – der retina-len Nervenzellen (Neuronen)stattfindet. Wissenschaftlerndes Max-Planck-Instituts fürmedizinische Forschung inHeidelberg sowie der Univer-sity of Washington in Seattleist es nun mit einem neuenbildgebenden Verfahren ge-lungen, die lebende, licht-empfindliche Retina mit ho-her Auflösung sichtbar zumachen und ihre Mechanis-men der Informationsverar-beitung zu untersuchen. Mitdieser „Multiquanten-Mikro-skopie“ entdeckten die For-scher, dass Bereiche in einund derselben Nervenzelleweit gehend unabhängigvoneinander auf unterschied-liche Bewegungsrichtungenreagieren können – dass siealso mehrere Richtungsde-tektoren in sich vereinen(NATURE, Advanced Online Pu-
blication, 4. August 2002).
Mit ihrem Experiment sind dieMax-Planck-Forscher ThomasEuler und Winfried Denk inZusammenarbeit mit Peter B.Detwiler von der University of Washington in Seattle derLösung eines klassischen Pro-blems der Retinaforschung ei-nen bedeutenden Schritt nähergekommen. Bereits 1964 hat-ten Wissenschaftler der Cam-
bridge University Neuronen inder Netzhaut gefunden, die nurdann antworten, wenn sich einim Auge abgebildetes Musterin eine bestimmte Richtungbewegt. Damals ahnte nie-mand, dass es fast 40 Jahredauern würde, jene Nerven-zellen zu identifizieren, welchedie dafür notwendigen neuro-nalen Berechnungen leisten.Die von den Cambridge-For-schern beschriebenen Zellengehören zu den Ausgangszellender Retina und werden als„richtungsselektive Ganglien-zellen“ bezeichnet: Sie antwor-
ten stark, wenn sich ein Reiz ineine bestimmte Richtung be-wegt, zeigen aber praktischkeine Reaktion, wenn derselbeReiz mit derselben Geschwin-digkeit in die Gegenrichtungläuft. Das bedeutet: Das Gehirnerhält bereits von dieser Zell-population Informationen dar-über, wohin ein Objekt imSichtfeld wandert. Die Fragewar also: Wie und wo stellt dieRetina die dazu notwendigenBerechnungen an? Sind es die
Ganglienzellen selbst, die ausrichtungsunspezifischen Ein-gängen ein Richtungssignal er-rechnen, oder erhalten dieGanglienzellen bereits von an-deren Neuronen richtungsspe-zifische Signale?In ihrer jetzt in NATURE veröf-fentlichten Studie konzentrier-ten sich die Heidelberger For-scher auf einen bestimmten Typvon Retina-Nervenzellen, dieihrer charakteristischen Gestaltwegen auch „Starburst“-Ama-krinzellen genannt werden.Diesen Zelltyp, der Signale andie richtungsselektiven Gang-
lienzellen weiterleitet, hatteman schon länger im Verdacht,die Richtungsberechnungenvorzunehmen. Allerdings zeigendie am Zellkörper elektrischabgeleiteten Reizantwortenkeinerlei Richtungsselektivität,das heißt: Die Zellen sind nichtrichtungsselektiv. Doch vieleAmakrinzellen haben keinedefinierte „Ausgangsleitung“,also kein Axon; sie empfangenmit ihren Fortsätzen, denDendriten, Eingangssignale,
RSCHUNG aktuell
12 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
NEUROBIOLOGIE
Der Netzhaut beim Rechnen zusehen
Multiquanten-mikroskopischeAufnahmen von„Starburst“-Zellen:Bild rechts mitGewebe, Bild linksmit einem derverwendeten Licht-reize in einerFotomontage.
F O T O S : M P I F Ü R M E D I Z I N I S C H E F O R S C H U N G
verarbeiten diese und gebendas Resultat dieser Berechnungwiederum über dieselbenFortsätze weiter – unter ande-rem an die richtungsselektivenGanglienzellen.Die Dendriten von Nervenzel-len sind oft so dünn, dass sieelektrophysiologischen Mes-sungen mit Mikroelektrodennicht ohne weiteres zugänglichsind. Um die durch Kalziumvermittelten biochemischenSignale, die der Kommunikati-on zwischen Nervenzellen die-nen, in den Dendriten zu mes-sen, verwendeten die Max-Planck-Forscher daher eineneue optische Methode: dieMultiquanten-Mikroskopie, dieauf einem gepulsten Infrarot-
Laser aufbaut. Dessen Licht,obwohl millionenfach intensi-ver als direkte Sonneneinstrah-lung, ist für unser Auge un-sichtbar, weil es nicht von denlichtempfindlichen Sehpigmen-ten in den Photorezeptorzellender Retina absorbiert wird.Das normalerweise zur Anre-gung der Indikatorfarbstoffebenötigte sichtbare Licht wür-de die äußerst empfindlicheRetina binnen Sekunden er-blinden lassen. Die extrem kur-
zen, aber sehr intensiven Licht-pulse des Infrarot-Lasers brin-gen Farbstoffindikator-Mo-leküle, die zuvor in die zu un-tersuchenden Zellen injiziertwurden, in einem nichtlinearenProzess der Multiquanten-Ab-
sorption zum Fluoreszieren. ImGegensatz zur konventionellenKonfokal-Mikroskopie wird beider Multiquanten-Mikroskopie jedes Farbstoffindikator-Mole-kül statt mit einem kurzwelli-gen, energiereichen Photon mitzwei langwelligen Photonenniedriger Energie angeregt.Dieses langwellige Licht (Infra-rot) stimuliert die Photorezep-toren praktisch nicht, und des-halb bleibt die Lichtempfind-lichkeit der Retina erhalten.So ist es erstmals möglich, die
Retina mit Lichtmustern zureizen und gleichzeitig dieAntworten ihrer Neuronenoptisch aufzuzeichnen.Mit dieser Technik konnten dieForscher Änderungen der Io-nenkonzentration in den Aus-gangskontakten (Synapsen) der„Starburst“-Amakrinzellen mithoher zeitlicher und räumlicherAuflösung messen. Dabei fan-den sie, dass verschiedene Be-reiche innerhalb ein und dersel-
FORSCHUNG aktue
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 13
SchematischeDarstellung einerSäugernetzhautim Vertikalschnitt.
Rekonstruktioneiner richtungsselektiven Gan
lienzelle (A; Debild in B). DieDendriten der verzweigen siczwei Ebenen uwurden nachtrlich unterschieeingefärbt. DaSchema (C) zeidie Lage der Zeund ihrer Dendin der Seitenanund verdeutlicdie FarbkodierDer weiße BalkA und B entspr20 tausendstelMillimetern.
ben „Starburst“-Zelle weitge-hend unabhängig voneinanderreagieren können und dabei je-weils unterschiedliche Bewe-gungsrichtungen bevorzugen.Somit sind also bereits ihredendritischen Ausgangssignalerichtungsselektiv, doch jederDendrit reagiert auf eine ande-re Richtung optimal. Das er-klärt auch, warum das elektri-sche Signal im Zellkörper un-spezifisch erscheint – die Sig-nale aus den Dendriten mittelnsich. Mit anderen Worten: Jede„Starburst“-Zelle vereint meh-rere Richtungsdetektoren in
sich. ●
Weitere Informationenerhalten Sie von:
DR. THOMAS EULER
Max-Planck-Institut fürmedizinische Forschung,Heidelberg,Abteilung Biomedizinische OptikTel.: 06221/486-320Fax: 06221/486-325E-Mail: [email protected]
@
A B B . :
M P I F Ü R M E D I Z I N I S C H E F O R S C H U N G + B I O F O R U M
1 2 / 0 1 ,
S .
8 9 0 - G I T V E R L A G

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 8/43
Klinische und epidemiologi-sche Untersuchungen habengezeigt, dass stressempfind-liche Menschen, wenn sieerhöhtem Stress ausgesetztsind, suchtkrank werdenkönnen. Mit ihrer in SCIENCE
(2. Mai 2002) publiziertenArbeit bestätigen Wissen-schaftler um Prof. FlorianHolsboer vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie inMünchen nicht nur diese Un-tersuchungsergebnisse, son-dern deuten dadurch auchauf neue Möglichkeiten, wiedurch Medikamente, die ent-
weder auf das Stresshormon-oder das Glutamat-Systemgerichtet sind, der Entwick-lung von stressinduziertemAlkoholmissbrauch vorge-beugt werden kann. FürMenschen mit genetischverursachter Veränderungder Stressregulation könntedies eine therapeutischeHilfe werden.
Die Entwicklung von Alkoholis-mus lässt sich sowohl auf ge-netische Ursachen als auch auf Umwelteinflüsse zurückführen.Ein besonders wichtiger Um-weltfaktor ist der Stress – undzwar nicht nur in Bezug aufAlkoholmissbrauch, sondernauch bei anderen psychischenErkrankungen, wie zum Beispiel
Angststörungen, Depressionund posttraumatischen Stress-erkrankungen. Für die Entwick-lung und die Ausprägung derAlkoholkrankheit spielt die ge-netische Disposition der Be-troffenen eine wichtige Rolle.Dieser Zusammenhang giltinteressanterweise auch fürLabormäuse.Mithilfe molekularbiologischerTechniken ist es Wissenschaft-lern am Max-Planck-Institutfür Psychiatrie gelungen, einMausmodell zu erzeugen, beidem die zentrale Schaltstellefür die Stressreaktion gestört
ist. Die Tiere reagieren daherunter Stressbedingungen mitverstärktem Alkoholkonsum.Wird der Organismus einerStresssituation ausgeliefert,setzt er vermehrt ein Eiweiß-molekül frei, das Corticotropinfreisetzende Hormon CRH. Die-ses Molekül steuert nicht nurdie hormonelle Stressantwort,sondern koordiniert ebenfalls
eine ganze Reihevon Verhaltenswei-sen, die geeignetsind, die Stress-situation zu bewäl-tigen. Im Gehirnbindet CRH in ver-schiedenen Regio-nen, die für emo-tionales Verhaltenwie Angst relevantsind. Zu den Re-zeptoren, die dasHormonsignal auf-nehmen, gehörtder „Corticotropin-
Releasing HormoneRezeptor Typ 1“.Wird dieser Rezep-
tor in einer Knockout-Mausausgeschaltet, ist die zentraleStressreaktion gestört. Dievon den Münchner Wissen-schaftlern entwickelte Knock-out-Maus besitzt einen Defektin genau jenem Gen, das dieBauanleitung für den CRH-Rezeptor Typ 1 trägt.Die Forscher am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie (IngeSillaber, Gerhard Rammes,Stephan Zimmermann, BeatriceMahal, Walter Zieglgänsberger,Wolfgang Wurst, Florian Hols-boer und Rainer Spanagel)haben ihren Knockout-MäusenAlkohol zu trinken angeboten.In ihren Untersuchungen tran-ken die Mäuse, bei denen diezentrale Regulation der Stress-antwort gentechnisch gestörtwar, zunächst die gleiche Men-ge Alkohol wie die genetischintakten Tiere aus der Kontroll-gruppe. Wurden die Knockout-Mäuse jedoch wiederholt für
kurze Zeit einer stressvollen Si-tuation ausgesetzt, so reagier-ten sie im Gegensatz zur Kon-trollgruppe über fünf Monatehinweg mit einer kontinuierlichverstärkten Aufnahme von Al-kohol. Offensichtlich ist ein in-taktes zentrales Stresssystemerforderlich, um das Risiko zumAlkoholismus, das nach wieder-holter Stresserfahrung ent-steht, erfolgreich zu reduzierenoder auszuschließen.Parallele Untersuchungen er-gaben, dass ein weiterer Rezep-tor im Gehirn (NR2B), an denGlutamat bindet, in bestimm-ten Hirnregionen der von denMax-Planck-Wissenschaftlernentwickelten Knockout-Mäuseerhöht ist; dieser Rezeptor istsensitiv für Alkohol. Die For-scher vermuten daher, dass dieErhöhung des Glutamatrezep-tors in den Knockout-Mäusenzur stressinduzierten Steige-rung des Alkoholkonsums
dieser Tiere beiträgt. ●
RSCHUNG aktuell
14 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
FORSCHUNG aktue
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 15
Nanoröhrchen mit Durch-messern von einigen wenigenbis zu mehreren hundertNanometern ließen sich bis-her nur aus einer begrenztenAnzahl von Materialien, etwaKohlenstoff, herstellen. In-teressante Materialien mitvorteilhaften Eigenschaften –beispielsweise Polytetrafluor-oethylen (Teflon), Leucht-polymere, Copolymere oderMaterialmischungen mitdefinierter Zusammenset-zung – waren zur Produktionungeeignet. Chemikern undPhysikern des Max-Planck-
Instituts für Mikrostruktur-physik in Halle und desInstituts für PhysikalischeChemie der Philipps-Univer-sität Marburg ist es jetztgelungen, ein universelleinsetzbares Verfahren zuentwickeln, mit dem Nano-röhrchen (Nanotubes) auseiner Vielzahl von Stoffenoder Stoffmischungengeformt werden können(SCIENCE, 14. Juni 2002).
Zur Produktion der Nanoröhr-chen verwendeten die Forscherkleine Plättchen aus Silizium-oder Aluminiumoxid, die vonhoch geordneten Strukturenaus winzigen Poren durchzogensind. Diese Poren wurden durchSelbstorganisation, Lithogra-phie oder durch Kombinationbeider Methoden erzeugt.Werden flüssige Polymere oderLösungen, die Polymere ent-halten, in Kontakt mit diesen
Porenstrukturen gebracht, bil-det sich ein etwa 20 Nanome-ter (milliardstel Meter) dünnerFilm auf den Porenwänden.Durch Kühlen oder Verdampfendes Lösungsmittels erstarrt die-ser Film und bildet Nanoröhr-chen. Deren Gestalt und Ab-messung wird durch Form undGröße der Poren bestimmt, dasheißt die verwendeten Poren-strukturen wirken als „Schablo-nen“. Wird nun das Material,
aus dem die Porenstruktur be-steht, selektiv entfernt, bleibendie Nanotubes zurück. Je nachverwendeter Porenstruktur sinddie Röhrchen alle gleich groß.Auf diese Weise ist es sogarmöglich, hoch geordnete An-ordnungen zueinander paralle-ler Nanotubes herzustellen.Erstmals erzeugten die Wissen-schaftler Nanotubes aus Po-lytetrafluorethylen (Teflon) –einem Polymer, das wegenseiner besonderen Eigenschaf-ten bisher nur schwer imNanometer-Bereich struktu-riert werden konnte, aber ein
großes Anwendungspotenzialbesitzt. Im Prinzip können jetztNanoröhrchen aus praktisch jedem als Schmelze oder ausLösung verarbeitbaren Polymerproduziert werden, beispiels-weise auch aus Polystyrol oderPolymethylmethacrylat.Ein großer Vorteil der neuenMethode: Den verwendetenPolymeren lassen sich auch an-dere Stoffe beimischen und so-mit Komposit-Nanoröhrchenherstellen. Deren Wände kön-nen zum Beispiel aus einer Mi-schung aus Polystyrol und Pal-ladium bestehen, einem Metall,das in der Katalyse, der Senso-rik und in Brennstoffzellen vongroßer Bedeutung ist. Die neueMethode eröffnet eine Vielzahlvon Anwendungsmöglichkei-ten. So könnten poröse Mate-rialien durch innere Beschich-tungen spezielle Funktionenerhalten, um zum Beispiel alsdurchstimmbare photonische
Kristalle in der integrierten Op-tik oder als spezielle Träger-platten (Arrays) mit Millionenvon Mikrokavitäten in derkombinatorischen Chemie ein-gesetzt zu werden.Auf diese Weise polymerbe-schichtete Porenstrukturen die-nen wegen ihrer Biokompatibi-lität eines Tages vielleicht dazu,die Blut-Hirn-Schranke zu ana-lysieren. Diese blockiert denÜbertritt der meisten Substan-
zen, also auch von pharmazeu-tischen Wirkstoffen, ins Gehirn.Im Rahmen eines vom Bundes-forschungsministerium geför-derten Projekts zur Nanobio-technologie unter Leitung derUniversität Münster bringendie Wissenschaftler dazu le-bende Zellen auf polymerbe-schichtete Porenstrukturen auf und untersuchen den Wirk-stofftransport durch diese Zel-len in die darunter befindli-chen Poren. ●
Weitere Informationenerhalten Sie von:
DR. RALF WEHRSPOHN
Max-Planck-Institut fürMikrostrukturphysik, Halle/SaaleTel.: 0345/5582-726Fax: 0345/5511223E-Mail: [email protected]
MARTIN STEINHART
Institut für Physikalische Chemieder Philipps-Universität, MarburgTel.: 06421/28-22362Fax: 06421/28-28916E-Mail: [email protected]
@
NEUROBIOLOGIE
Gendefekt bringt Mäuse an die Flasche
MIKROSTRUKTURPHYSIK
Nanoröhrchen aus Teflon
Abb. oben: Nanröhrchen-Arraaus Polystyrolin verschiedene
VergrößerungeDie Röhrchenhaben einenDurchmesservon etwa 400Nanometern.Abb. unten: einzelne PolystyroNanoröhrchen.
Weitere Informationenerhalten Sie von:
DR. INGE SILLABER
Max-Planck-Institut fürPsychiatrie, MünchenTel.: 089/30622-641Fax: 089/30622-569E-Mail:[email protected]
@
F O T O S : M P I F Ü R M I K R O S T R U K T U R P H Y S I K
Stress erhöhtkoholkonsum
n Mäusen mit
geschaltetemzeptor Typ 1.
G R A F I K U N D F O T O : M P I F Ü R P S Y C H I A T R I E

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 9/43
mittleren Temperatur auf derErde in den nächsten Jahrzehn-ten angeht, noch immer einenerheblichen Spielraum auf. Unddeshalb kamen Graßl und Krü-
ger auf den Gedanken, die Aus-wirkungen der Wende auf dieWolken über Mitteleuropa an-hand eines Vorher-Nachher- Vergleichs zu untersuchen – inder Hoffnung, auf diese Weiseerstmals konkrete, das heißtauf Messungen basierendeZahlen über den Einfluss desindirekten Aerosol-Effekts auf den Strahlungshaushalt amErdboden zu gewinnen.Diese Hoffnung gründete auf der Tatsache, dass mit denmassiven Industrie-Emissionen,die bis 1989 aus dem„Schwarzen Dreieck“ in denHimmel quollen, auch erhebli-che Mengen an so genannten Vorläufergasen in die Atmos-phäre gelangten: an Schwefel-dioxid und Stickoxiden, ausdenen über chemische Reak-tionen in der Luft Aerosoleentstehen. Dazu kam als wei-tere ergiebige Aerosolquelleein beträchtlicher Ausstoß an
kohlenstoffhaltigen Ruß- oderAscheteilchen. Die Menge die-ser „Aerosol-Saaten“ sank nachder Wende binnen wenigerJahre drastisch – allen vorandie Emission von Schwefel-dioxid, dem mengenmäßigbedeutendsten Vorläufergas:Sie fiel zwischen 1988 und1998 – bezogen auf Gesamt-europa – fast auf die Hälfte.Diese sprunghafte Drosselunganthropogener Aerosolquellen,
so vermuteten Graßl und Krü-ger, sollte sich über den indi-rekten Aerosol-Effekt auch auf die Wolken über Mitteleuropaausgewirkt haben. Um dasfestzustellen, zogen die Ham-burger Klimaforscher Messda-ten mehrerer amerikanischerSatelliten heran, die mittelsempfindlicher Spektrometerdas Reflexionsvermögen derWolken auch über Mitteleuro-pa über Jahre hinweg erfassthatten. Diese Daten liefertenzwei Langzeit-Messreihen, vondenen die eine den Zeitraumvon 1985 bis 1989, die anderedie Jahre 1996 bis 1999 über-deckte. Und diese beiden Mess-reihen wurden dann – jeweilsgesondert für winterliche und
sommerliche Perioden – hin-sichtlich der Rückstrahlkraftder Wolken analysiert und ver-glichen.Der Blick aus dem Weltraum,vermittelt über die Satelliten,lieferte erstmals differenzierteEinblicke in das komplizierteWechselspiel zwischen Aeroso-len und Wolken. Er offenbarteein in Bezug auf die von obengemessene „Strahlkraft“ derWolken sowohl räumlich alsauch zeitlich hoch variablesMuster. So zeichneten sichEmissionszentren wie städti-sche Ballungsräume oderIndustrieregionen währendder Wintermonate generelldurch ein deutlich verminder-tes Rückstrahlvermögen aus –eine Folge der vermehrtenRuß- und Aschepartikel, diedas einfallende Licht in Wolkenabsorbieren. Im Sommer hin-gegen traten Emissionszentrendurch verstärkte Rückstrah-
lung hervor, bedingt durchden dann überwiegenden„Tröpfcheneffekt“, das heißtdurch die Bildung von immermehr und immer kleinerenWassertröpfchen innerhalb derWolken.Diese und andere Detailbefun-de belegten zunächst grund-sätzlich, dass in den Wolkenüber Mitteleuropa der indirekteAerosol-Effekt tatsächlichwirksam ist. Außerdem aber
offenbarte sich im Vorher-Nachher-Vergleich der beidenMessreihen, was Graßl undKrüger vermutet hatten – der„Gorbatschow-Effekt“: Im Mit-tel ist das Rückstrahlvermögender Wolken über Mitteleuropain den Jahren nach 1989 um2,8 Prozent gesunken, unddementsprechend hat sich derStrahlungsfluss auf dieseRegion um etwa 1,5 Watt proQuadratmeter verstärkt.Das heißt, dass der ehedemdurch die Aerosole aus denIndustrie-Emissionen des„Schwarzen Dreiecks“ gebrem-ste, anthropogene Treibhausef-fekt jetzt stärker auf Mitteleu-ropa durchschlägt. Oder andersausgedrückt: dass der politi-
sche Klimawandel dem anthro-pogen bedingten Klimawandelfreie Bahn geschaffen hat.Für Graßl bedeutete dieser Be-fund keine Überraschung. Dennals Spezialist für Aerosole hater schon vor gut zwei Jahr-zehnten darauf hingewiesen,dass Maßnahmen zur Luftrein-haltung derart „perverse“Folgen haben können. Damitwar er damals auf erhebliche Vorbehalte und auch Kritikgestoßen. Nun, da er sich be-stätigt sieht, meint er: „Nurwer alle Ursachen der Klima-änderungen gemeinsam an-packt, nämlich Emissionsmin-derungen durchsetzt, beimlanglebigen Kohlendioxid undden kurzlebigen Gasen wieSchwefeldioxid sowie beimRuß, dämpft den raschenKlimawandel ohne erneuteSchräglage.“ ●
Weitere Informationenerhalten Sie von:
PROF. HARTMUT GRASSL
Max-Planck-Institut fürMeteorologie, HamburgTel.: 040/41173-226Fax: 040/41173-350E-Mail: [email protected]
DR. OLAF KRÜGER
Meteorlogisches Institut derUniversität HamburgTel.: 040/41173-348Fax: 040/41173-350E-Mail: [email protected]
FORSCHUNG aktue
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 17
Seit dem Ende des KaltenKriegs steigen die Tempera-turen in Mitteleuropa nochrascher: So kann man zusam-menfassen, was Prof. Hart-mut Graßl, Direktor am Ham-burger Max-Planck-Institutfür Meteorologie, und Dr.Olaf Krüger vom Meteorolo-gischen Institut der Univer-sität Hamburg jüngst auseiner fast zwanzigjährigenSatelliten-Messreihe heraus-gefiltert und in der Zeit-schrift GEOPHYSICAL RESEARCH
LETTERS (Oktober 2002)veröffentlicht haben.
Die Wissenschaftler selbst spre-chen von einem „Gorbatschow-Effekt“ – den Graßl so umreißt:„Nach 1989 sind die Wolkenüber Mitteleuropa, vom Welt-raum aus gesehen, dunkler ge-worden. Das bedeutet, siestreuen nicht mehr so viel Son-nenlicht wie früher in denWeltraum zurück, sondern las-sen vermehrt Strahlung zumErdboden durch. Und deshalbwird es jetzt unter den Wolkenwärmer.“ Diese Änderung derRückstreufähigkeit der Wolkenist Folge der umweltpolitischenSäuberungswelle, die nach demFall des Eisernen Vorhangs inder DDR, in Tschechien und Po-len anlief: In jener Region, vor-dem als „Schwarzes Dreieck“berüchtigt, wurden nach derWende unzählige Industriean-lagen und Kraftwerke stillge-legt oder saniert, die bis dahinals sprichwörtliche Dreck-
schleudern gewaltige Mengenan Schadstoffen in die untereAtmosphäre gepumpt hatten.Dieses „Großreinemachen“ er-weist sich nun, nach mehr alseinem Jahrzehnt, als eine ArtGroßversuch zu einem bislangnur theoretisch fassbaren, da-bei aber hochaktuellen Prob-lem der Klimaforschung – undzwar zum so genannten indi-rekten Aerosol-Effekt. Als Ae-rosole bezeichnet man feine
Tröpfchen oder feste Teilchenmit Durchmessern zwischen ei-nem hundertstel und einemzehntausendstel Millimeter, diein der Luft schweben und sichso einige Stunden, aber auchbis zu mehreren Wochen in derAtmosphäre halten und vertei-len. Diese Schwebeteilchen be-einflussen den Strahlungshaus-halt und damit das Klima inBodennähe auf zweierlei Wei-se: zum einen direkt, indem sieLicht, aber auch Wärmestrah-lung streuen oder absorbieren,und zum anderen indirekt, in-dem sie auf die Bildung von
Wolken, auf deren optische Ei-genschaften und Lebensdauereinwirken. Vor allem der zweite, also derindirekte Aerosol-Effekt, machtdie winzigen Schwebeteilchenzu einem gewichtigen Faktorim Klimasystem – zugleich aberzu einem Unsicherheitsfaktorin Klimamodellen, da sich derEinfluss der Aerosole auf dieWolken bislang nur anhandtheoretischer Berechnungenabschätzen lässt.Das liegt zunächst daran, dassam i ndirekten Aerosol-Effektzwei konkurrierende Mechanis-men beteiligt sind. So wirkenAerosole oberhalb einer gewis-sen Größe einerseits als Kon-densationskeime für Wasser-dampf und bestimmen dabeisowohl die Zahl als auch dieGröße der gebildeten Wasser-tröpfchen. Je mehr Aerosole sieenthält, umso mehr und umsokleinere Tröpfchen entstehen
in einer Wolke – was wiederumderen Rückstrahlvermögen er-höht: Die Wolke streut dannmehr Sonnenlicht zurück inden Weltraum, und am Erdbo-den wird es kühler. Andererseitswirken Aerosole – insbesonderesolche, die aus dunklen Ruß-oder Aschepartikeln entstehen– auch als Strahlenfallen. Sieabsorbieren Licht und heizendadurch die Wolken auf. Daskann so weit gehen, dass ruß-
geschwängerte Wolken regel-recht weggekocht werden undsich auflösen.Zu diesem schwer kalkulierba-ren Doppelspiel kommt noch,dass sich der Aerosol-Mix derunteren Atmosphäre aus zahl-reichen Quellen speist: sowohlaus natürlichen, wie etwa ausder Salzgischt der Ozeane, aus Vegetationsbränden oder Vul-kanen, als auch aus anthropo-genen Emissionen von Indus-trie, Hausbrand oder Verkehr.Dementsprechend schwankenArt und Konzentration derAerosole räumlich wie zeitlich
innerhalb weiter Bereiche –und auch deshalb lässt sich derindirekte Aerosol-Effekt in Kli-mamodellen bislang nur globalund pauschal veranschlagen:So gehen die Wissenschaftlerderzeit davon aus, dass er ins-gesamt kühlend wirkt und denStrahlungsfluss in die untereAtmosphäre global um bis zuzwei Watt pro Quadratmetermindert. Damit würde er demzusätzlichen, anthropogenenTreibhauseffekt – den man ge-genwärtig mit einem um 2,5bis 3 Watt pro Quadratmetererhöhten Strahlungsfluss ver-anschlagt – entgegenwirkenund ihn deutlich bremsen.Wirklich sicher sind sich dieForscher über das Ausmaß die-ser Bremswirkung allerdingsnicht. Deshalb weisen Klima-modelle, was den Anstieg der
RSCHUNG aktuell
16 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
METEOROLOGIE
Nach Glasnost lichten sich die Wolken
@
Wolken bremsenden Strahlungs-
fluss in die untereAtmosphäre und
spielen eine wich-tige Rolle im
Klimageschehen.
Industrie-Emis-sionen beein-flussen den Aero-sol-Gehalt derAtmosphäreund damit denStrahlungsflussam Erdboden.
F O T O S : O K A P I A ,
M Ü N C H E N

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 10/43
SAY
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 19
BILDUNGS forschu
Es ist etwas stiller geworden um PISA (siehe auchden Artikel auf Seite 62 dieser Ausgabe). Die Unter-
schiede zwischen den Bundesländern, die PISA-E im Junizu Tage gebracht hat, sind weniger ins Zentrum des
Wahlkampfs gerückt als man vor wenigen Monaten viel-leicht noch erwartet hätte. Dies mag mit der Erkenntniszu tun haben, dass letztlich keins der Länder der Bundes-republik international in der ersten Liga spielt. Trotz der erheblichen Differenzen in den Ergebnissen innerhalbDeutschlands überwiegen vor der Folie des internationa-len Vergleichs doch die Gemeinsamkeiten.
Die Befunde des internationalen Vergleichs weisendarauf hin, dass es in Deutschland weniger gut gelingtals in anderen Industriestaaten, Schülerinnen undSchüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen op-timal zu fördern. Dies gilt insbesondere für leistungs-schwächere Schüler, für Schüler aus bildungsfernen Fa-milien und für Schüler mit Migrationshintergrund. Aber auch im oberen Leistungsbereich werden Spitzenleistun-gen nur von relativ wenigen erzielt. Die Gruppe der kompetenzstärksten Schülerinnen und Schüler ist inDeutschland viel kleiner als in erfolgreicheren OECD-Staaten. Genau genommen ist dies vielleicht der überra-schendste Befund. Aufgrund der Gliederung des Schulsystems nach der
Grundschule werden in Deutschland die Schülerinnenund Schüler in deutlich homogeneren Gruppen unter-
richtet als in Staaten, die keine äußere Differenzierungkennen. In den Gymnasien hat man es also mit einer Gruppe von Jugendlichen zu tun, die vergleichsweisegünstige Lernvoraussetzungen mitbringen. Dennochentsprechen die mittleren Leistungen der zehn ProzentBesten in Deutschland lediglich dem Durchschnitt der entsprechenden Schülergruppe in den OECD-Staateninsgesamt. In Staaten wie Finnland, Australien oder Ka-nada, in denen alle Schülerinnen und Schüler auch inder Sekundarstufe I noch gemeinsam zur Schule gehen,liegen die Leistungswerte der zehn Prozent besten Schü-lerinnen und Schüler bedeutsam höher. Einen deutliche-ren Hinweis darauf, dass in Deutschland Schule und Un-terricht insgesamt – auch für die Leistungsstärksten – zuwenig auf individuelle Förderung ausgerichtet sind,kann es kaum geben.
Innerhalb der Bundesländer wiederholt sich das für die Bundesrepublik im internationalen Vergleich identi-fizierte Befundmuster, wenn auch in unterschiedlicher
Ausprägung. Vereinzelt wird in Bayern und Baden- Württemberg der OECD-Durchschnitt erreicht oder überschritten, aber von den Ergebnissen der erfolg-reichsten Staaten sind auch diese Länder weit entfernt.In allen Ländern der Bundesrepublik ist eine große Leis-tungsstreuung zu verzeichnen und ein vergleichsweisegroßer Anteil potenzieller Risikoschüler. Auch die Kopp-lung zwischen familiärer Herkunft und Kompetenz-
Spickenerwünscht
I L L U S T R A T I O N : A N D R E J B A R O V - C
/ O .
C L A U D I A S C H Ö N H A L S
Vier Buchstaben haben im Frühsommer hier zu Lande für einen „Kultur-
schock“ gesorgt: PISA. Denn die Ergebnisse dieses „Programme for International
Student Assessment“, das den Bildungsstand von Schülerinnen und Schülern
in 32 Staaten untersucht, gaben der jungen Generation in der Bundesrepublik
schlechte Noten. Was ist zu tun? Ein Patentrezept hat auch DR. PETRA
STANAT vom Berliner MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG
nicht. Aber die Wissenschaftlerin, die die deutsche Beteiligung an PISA
koordiniert hat, plädiert für einen Blick über den Gartenzaun, um von den
erfolgreicheren Nachbarn für die Schule zu lernen.

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 11/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 21
urteilungen gegeben. Insbesondere in Finnland wird wei-terhin viel in die frühe Förderung von Kindern investiert.Hier benötigen zum Beispiel Kindergärtnerinnen undKindergärtner seit etwa zehn Jahren einen tertiären Ab-schluss, der an der Universität Helsinki auch eine Ausbil-dung in fachbezogener Didaktik beinhaltet. Aber Anregungen für das Nachdenken über das eigene
Schulsystem kann man selbstverständlich nicht nur inFinnland und Schweden sammeln. Die Videostudie, dieim Rahmen der „Third International Mathematics andScience Study“ (TIMSS) durchgeführt worden ist, zeigtbeispielsweise, dass man vom Mathematikunterricht inJapan, der in seinen besten, in Deutschland nicht anzu-treffenden Beispielen in vielerlei Hinsicht vorbildlich ist,einiges lernen kann. Und auch didaktische Ansätze, diebeispielsweise mit dem angelsächsischen „Literacy“-Konzept oder der Idee der „Realistic Mathematics Educa-tion“ des niederländischen Freudenthal-Instituts verbun-den sind, werden von der Fachdidaktik in Deutschland
mit Interesse rezipiert und diskutiert.Der Blick über den Gartenzaun sollte sich allerdings
nicht nur auf die gelungenen Aspekte konzentrieren,sondern auch unerwünschte Merkmale im Auge behal-ten. Denn es sind nicht zuletzt problematische Entwick-lungen, aus denen man lernen kann und lernen sollte.Bevor man daher etwa einen neuen Gründünger oder ei-ne neue Pflanzenfolge im eigenen Garten einführt, tutman gut daran, sich die Erfahrungen, die andere damitgemacht haben, genau anzusehen, um negative Neben-effekte zu antizipieren und dagegen vorzubeugen.
Ein Merkmal, das viele der erfolgreicheren PISA-Staa-ten gemein haben, ist eine im Vergleich zu Deutschlandstärker ergebnisorientierte Systemsteuerung, und es istnahezu unstrittig, dass sich auch das deutsche Schul-system in diese Richtung bewegen sollte. Als Teil dieser Entwicklung haben die Kultusminister der Länder auf ihrer Plenarsitzung am 23. und 24. Mai 2002 vereinbart,bundesweit verbindliche Standards einzuführen. Umdiese Standards zu konkretisieren, sollen Beispielaufga-ben entwickelt werden, die einen Eindruck davon geben,welche Anforderungen von den Schülerinnen undSchülern bewältigt werden sollten. Die Einhaltung der Standards, so der Beschluss weiter, soll in den Ländernmit geeigneten Verfahren überprüft werden. Mit solchen
Verfahren haben andere Bildungssysteme bereits lang- jährige Erfahrungen. In Staaten wie Australien, Finn-land, den Niederlanden, Schweden oder den USA wirdregelmäßig auf nationaler oder regionaler Ebene ge-prüft, ob Schulen das, was sie erreichen sollen, auchtatsächlich erreichen. Oberflächlich scheinen diese Sys-teme also etwas sehr Ähnliches zu tun. In der Umset-zung bestehen jedoch einige Unterschiede, die zu analy-sieren sich lohnt.
Mit der Einführung einer stärker ertragsorientiertenSteuerung überträgt man die Definitionsmacht dafür, wasin Schulen gelehrt und gelernt wird, in hohem Maße an
Vorgaben im Unterricht umsetzen zukönnen. Teaching to the Test wird inden USA als Teil eines allgemeinerenProblems der unzulänglichen Übe-reinstimmung zwischen Unterrichts-zielen, Unterrichtsmaterialien, Krite-rien für die Bewertung individueller Schülerleistungen im Unterricht undstandardisierten Leistungstests dis-
kutiert. Diese Erfahrungen sollte man sich genau anse-hen, um zu vermeiden, dass ähnliche Probleme auch hier entstehen.
Die Umstellung des Systems auf eine stärkere Ergebnis-orientierung wirft eine Reihe weiterer Fragen auf. Einewichtige Frage ist beispielsweise, wie genau die Ergeb-nisse landesweiter Leistungstests auf Schulebene genutztwerden sollen. Sollen sie ausschließlich den Behördenund den jeweiligen Schulen zur Verfügung stehen (wiezum Beispiel in Finnland), oder soll auch die Öffentlich-
keit Zugang zu den Informationen erhalten (wie inSchweden oder Großbritannien)? Was soll mit Schulengeschehen, in denen die Standards nicht erreicht werden?
Welche zusätzliche Unterstützung werden sie erhalten?Inwieweit und in welcher Form soll gegebenenfalls Druck ausgeübt werden? Auch bei der Beantwortung dieser Fra-gen dürfte es aufschlussreich sein, die international be-reits existierenden Modelle genau zu studieren, um ihreEffekte einschließlich der unerwünschten Nebenfolgen zu
verstehen.Beim Blick über den schulischen Gartenzaun lassen
sich also vielfältige Anregungen für die Erneuerung deseigenen Systems schöpfen. Dabei will jedoch wohl über-legt sein, welche Konsequenzen die Umsetzung solcher
Anregungen für andere Elemente des Systems bezie-
BILDUNGS forschu
20 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
erwerb ist insbesondere in den alten Ländern im inter-nationalen Vergleich sehr eng. Die Unterschiede zwi-schen den Ländern, die sich an den Rändern der Lei-stungsverteilungen befinden, sind jedoch keineswegstrivial. Differenzen, die bis zu eineinhalb oder zweiSchuljahren entsprechen, können erhebliche Mobilitäts-probleme aufwerfen. So ist es bei einem Umzug einer Familie etwa von Bremen nach Bayern nicht unwahr-scheinlich, dass Kinder, die in Bremen mittlere bis guteLeistungen erzielten, Schwierigkeiten haben werden,schulisch den Anschluss zu finden, und sie möglicher-weise sogar eine Klasse wiederholen müssen.
Dennoch: Die Standards für die Weiterentwicklungder Schulen in den Ländern liegen nicht innerhalb, son-dern außerhalb der Bundesrepublik. Folgerichtig wird an
verschiedenen Stellen daran gearbeitet, die schulischenSysteme der erfolgreicheren Staaten zu studieren. Beidiesen Aktivitäten scheint oft die Hoffnung mitzuspie-len, man könnte einige gemeinsame Merkmale ausfindig
machen, auf die der Erfolg der Systeme zurückzuführenist, um diese anschließend zu importieren. Diese Hoff-nung wird jedoch schon aus methodischen Gründenkaum einzulösen sein. Die Anzahl der Staaten ist zuklein, die Anzahl relevanter Faktoren zu groß und die
Wechselwirkungen zwischen ihnen sind zu komplex, alsdass die spezifischen und kombinierten Effekte dieser Merkmale isoliert werden könnten.
Der Blick über den Gartenzaun kann also keinePatentrezepte liefern, er eröffnet jedoch die Möglichkeit,
SAY
die Standards und die Tests. Die Er-fahrungen anderer Staaten weisendarauf hin, dass dies unterschiedlichwünschenswerte Folgen haben kann.Ein zentrales Thema der Bildungs-diskussion in den USA ist das Pro-blem des „Teaching to the Test“. Zur Sicherung von Standards werden inden Bundesstaaten verschiedeneTests eingesetzt, von denen für die Schulen sowie teilwei-se auch für die einzelnen Lehrkräfte viel abhängen kann.Der Unterricht wird daher offenbar nicht selten darauf reduziert, die Schülerinnen und Schüler auf die Tests vor-zubereiten. So zitierte beispielsweise eine amerikanischeKollegin einen Lehrer mit den Worten: „I have to stopteaching now and prepare my students for the test.“
In anderen Staaten scheint „Teaching to the Test“ da-gegen weniger zum Problem geworden zu sein. Dies ist
vermutlich vor allem auf die Konzeption der Aufgaben
zurückzuführen. Ein Großteil der PISA-Items wurde bei-spielsweise von einer Institution entwickelt, die auch für die nationalen Schulleistungserhebungen in den Nieder-landen zuständig ist (CITO). Bei diesen Aufgaben geht esnicht primär darum, Wissen abzufragen, sondern die fle-xible Anwendung von Kenntnissen und Fertigkeiten inanwendungsbezogenen Kontexten zu erfassen. Es istkaum möglich, gezielt für solche Tests zu üben. Im Ideal-fall setzen die Aufgabenstellungen nämlich voraus, dassdie Inhalte tatsächlich verstanden worden sind. Sofern esgelänge, solche verständnisorientierten Tests zu konstru-ieren, wäre Teaching to the Test sogar wünschenswert. Auch in Schweden scheinen die nationalen Leistungs-
standserhebungen nicht dazu zu führen, dass sich dasLehren und Lernen innerhalb der Fächer auf den Erwerbeinfach abfragbaren Wissens konzentriert. Die PISA-Er-gebnisse zumindest weisen darauf hin, dass Schülerin-nen und Schüler in Schweden recht gut darauf vorberei-tet sind, Aufgabenstellungen zu bewältigen, die inneuartige Kontexte eingebettet sind. Hier scheinen dieTests allerdings die Schwerpunktsetzung zwischen denFächern in unerwünschtem Maße zu beeinflussen. Soberichten schwedische Kolleginnen und Kollegen vonder Sorge, dass sich das Lehren und Lernen in den Schu-len des Landes zunehmend auf die drei Fächer verengthat, auf die sich die nationalen Tests beziehen – auf dieFächer Schwedisch, Englisch und Mathematik. Um die-ses Spektrum zu erweitern, werden daher nun auch Testsin zusätzlichen Fächern zur Verfügung gestellt.
Die Qualität der Standards und der Tests wird also ent-scheidend bestimmen, ob das, was die Länder der Bun-desrepublik mit der geplanten Veränderung erreichenwollen, auch tatsächlich erreicht wird. Die Entwicklungs-arbeit, die hier geleistet werden muss, ist keineswegs tri-
vial. Auch ist es nicht damit getan, anspruchsvolle Stan-dards zu definieren und intelligente Tests zu konstru-ieren. Lehrkräfte benötigen Unterstützung, um die neuen
cht auf Patentrezepte hoffen
Es spricht nichts für eine schulische Monokultu
Biotope zu entdecken, die das Nachdenken über die Ge-staltung des eigenen Gartens bereichern können. Es regtschon die Phantasie an, zu erleben, wie wenige FragenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zentralen Schul-
verwaltung in Schweden über ihre Schulen beantwortenkönnen. Eine der häufigsten Antworten, die man in sol-chen Gesprächen erhält, lautet: „Das liegt in der Ent-scheidung der Gemeinde oder der Schule.“ Auch der ge-ringe Umfang der Lehrplanvorgaben in manchen Staa-ten ist aus deutscher Sicht äußerst eindrucksvoll – inSchweden zum Beispiel umfassen die Lehrpläne für alleFächer der Jahrgangsstufen eins bis neun zusammennur knapp hundert Seiten. Hier wird also nicht mit über-bordenden Stoffsammlungen gearbeitet, sondern an-hand von Beschreibungen zentraler Kompetenzdimen-sionen und Leistungsstandards.
Schon bei einem kurzen Besuch schwedischer oder fin-nischer Schulen wird deutlich spürbar, dass Unterrichtdort sehr stark auf individuelle Förderung ausgerichtetist. So scheint es in Schweden üblich zu sein, dass Lehr-kräfte für ihre Schülerinnen und Schüler individualisier-te Wochenpläne ausarbeiten. Leistungsrückmeldungenwerden bis zur achten Klassenstufe nicht anhand vonNoten, sondern in Form von differenzierten verbalen Be-
hungsweise für das System als Ganzes haben könnte.Man muss schon sehr genau hinsehen, um die Funkti-onsweise des nachbarlichen Gartens mitsamt der Schwachstellen, die man besser nicht importieren sollte,zu verstehen. Der Blick über den Zaun macht aber auchdeutlich, dass es sehr unterschiedlichen Systemen gelin-gen kann, gute Erfolge zu erzielen. Die institutionellenund kulturellen Bedingungen, unter denen Schulen in
Australien, Finnland, Kanada, Japan oder Schweden ar-beiten, sind sehr verschieden. Dies gilt in abgeschwäch-tem Maße auch für die Länder innerhalb der Bundesre-publik Deutschland. Die Herausforderungen, die Berlin,Hessen oder Sachsen-Anhalt zu bewältigen haben, un-terscheiden sich deutlich, und nichts spricht dafür, dasseine Monokultur angebracht wäre, um diese Heraus-forderungen zu bewältigen. Unter einem Dach bundes-weit verbindlicher Standards könnten auch innerhalbDeutschlands verschiedenartige Biotope kultiviert wer-den, die zum Blick über den Gartenzaun einladen. ●

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 12/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 23
„Menschenund Tiere
können weglaufen –Pflanzen nicht“, sagt Ute
Krämer. „Diese mangelndeMobilität ist wahrscheinlich eine
der Ursachen dafür, dass Pflanzeneine erstaunliche Anpassungsfähigkeit
an ihre jeweilige Umgebung entwickelthaben, um zu überleben.“ Die Forscherin ist
unterwegs zu ihrem Arbeitsplatz auf dem Wis-senschaftscampus Golm, auf dem – neben ande-
ren hochkarätigen Forschungseinrichtungen – auchdas Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphy-
siologie untergebracht ist. „Das biochemische Instrumen-tarium, das die Pflanzen dabei einsetzen, scheint allerdings
in vielerlei Hinsicht dasselbe zu sein wie beim Menschen“, er-klärt sie. Es sind diese Parallelen zwischen der roten und der grü-
nen Biochemie, die die junge Forscherin faszinieren.„Metal Homeostasis“ steht auf dem Türschild neben den Laborräu-
men der Arbeitsgruppe, die Ute Krämer seit ungefähr zwei Jahren leitet.Im Rahmen ihrer Forschungen versuchen ihre Mitarbeiter und sie, Pflanzen
22 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
HWER punkt
F O T O : C L E D W Y N M E R R I M A N
/ P R O F .
D R .
J . A N D R E W
C .
S M I T H ,
O X F O R D U N I V E R S I T Y
PFLANZEN forschu
Um schwermetallverseuchte Flächen zu entgiften, kann man die
Böden abtragen, bei hohen Temperaturen verschmelzen und
mithilfe von Ionentauschern umständlich reinigen – oder
demnächst vielleicht einfach Pflanzen aussäen, die
in der Lage sind, Schwermetalle aufzunehmen und
anzureichern. Wieso einige Pflanzen solche
Metalle auf ihrem Ernährungsplan stehen
haben und wie man unter Umständen
ihren Appetit darauf noch steigernkann, damit befasst sich die junge
Biochemikerin DR. UTE
KRÄMER am MAX-
PLANCK-INSTITUT
FÜR MOLEKULARE
PFLANZEN-
PHYSIOLOGIE
in Golm bei
Potsdam.
Blei im Blatt?
Abb. 1: Rasterelektronen-mikroskopische Aufnahme
der Blattoberfläche von Alyss
lesbiacum. Die Pflanze gehözu ein Nickel-Hyperakkumu
latoren – und ist eine vonetwa 300 Arten.

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 13/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 25
PFLANZEN forschu
24 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
HWER punkt
fach als ökologische Nische auserko-ren. In Gegenden mit starker geolo-gischer Aktivität sind hohe Nickel-konzentrationen im Boden keine Sel-tenheit. Zumindest in Europa gehtman davon aus, dass Pflanzen, diezunächst auf nicht-metallreichenBöden gediehen, aber generell zur Metallakkumulation oder -toleranzfähig waren, auf nickelreiche Ser-pentinböden zurückgedrängt wur-den. „Die Frage, ob sie ihre Metall-toleranz ursprünglich auf metallhal-tigen Böden erworben haben, istallerdings noch offen“, sagt Krämer.Doch diese Unsicherheit hin oder her – fest steht, dass Organismen miteinem ausgeprägten Metallhunger Gold wert sind – denn die Sanierungschwermetallverseuchter Böden istein Milliardenmarkt. Bereits vorfünf Jahren wanderten zweistelligeDollar-Milliardenbeträge in das Ge-schäft mit der Bodenentgiftung.
DER WEG IN
DIE „ZELLMÜLLHALDE“
Wie schaffen es diese Pflanzen,sich Metalle in eigentlich giftigenDosen einzuverleiben? Sicher ist,dass hinter der pflanzlichen Metall-anreicherung ein außerordentlichkomplexer Prozess steht: Zunächsteinmal müssen die Pflanzenwurzelndie Metalle überhaupt aus dem Bo-
den herauslösen. Oft liegen sie dortin einer gebundenen Form vor, inder sie für Pflanzen nicht so ohneweiteres zugänglich sind. ManchesGewächs, das sich zum BeispielNickel auf seinen Speiseplan gesetzthat, haben die Wissenschaftler des-halb in Verdacht, Säuren oder andereChemikalien ans Erdreich abzuge-ben. Diese sollen ihm helfen, sich dieMetallionen aus dem Boden verfüg-bar zu machen. Die meisten Pflanzenhaben schließlich auch Wege gefun-den, um zum Beispiel unlösliches Ei-sen (III) zu Eisen (II) zu reduzieren:Diese löslichere Form lässt sich dannleichter aufnehmen.
Sind die Metalle erst einmal in der Wurzel, müssen sie auf die anderenPflanzenorgane verteilt werden. WiePflanzen die aufgenommenen Metal-le in ihr Leitungswerk, das Xylem,einspeisen, ist noch nicht bekannt.Es gibt jedoch Hinweise darauf, dassdie Metallionen zuvor in spezielleMoleküle verpackt werden, die denTransfer ins Xylem und wahrschein-lich auch in die Vakuole erleichtern.Bei der Vakuole, die ausschließlich inPflanzenzellen vorkommt, handelt essich um einen wassergefüllten Spei-cherraum, quasi eine „zelluläre Müll-halde“. Sind an dieser „Müllablage-rung“ Membrantransporter beteiligt?Und wenn ja, welche? Wie arbeiten
Appetit zu machen – auf Schwerme-talle. Damit gehören die Wissen-schaftler zu einem kleinen aber fei-nen Zirkel engagierter Forschergrup-pen, die in jüngster Zeit überall auf der Welt ihre Arbeit aufgenommenhaben und bereits eine Menge in-teressanter Ergebnisse präsentierenkönnen: etwa die Erkenntnis, dassPflanzen und höhere Organismenwie eben Säugetiere bei der Aufnah-me und Verarbeitung von Metallenmit der Nahrung – vereinfacht ge-sprochen – das gleiche Besteck be-nutzen. Nur die einen vielleicht et-was eleganter als die anderen.
Aber der Reihe nach. Wieso sollteman Pflanzen Appetit auf Nickel,Zink & Co. machen? Diese Frage hat
sich die Natur schon vor sehr langer Zeit gestellt. Und beantwortet. „Mankennt bislang rund vierhundertPflanzenarten, die auf stark metall-haltigen Böden gedeihen und Metal-le sogar in ihren Blättern akkumulie-ren, also anreichern“, sagt Krämer.Etwa drei Viertel dieser vierhundertso genannten Hyperakkumulatorenhaben sich dabei auf das MetallNickel spezialisiert (Abb. 1), andere –wie das Untersuchungsobjekt Arabi-
dopsis halleri in Krämers Gewächs-haus – haben eine Vorliebe für Zink entwickelt (Abb. 2). Es gibt sogar Ver-treter, die nicht einmal vor Cadmiumzurückschrecken. Der Metallhunger einiger dieser Pflanzen geht so weit,dass sie bis zu fünf Prozent ihresTrockengewichts in Metall anlegenkönnen. Diese ungewöhnliche Eigen-schaft haben sie sogar Bakterien vor-aus, die in nahezu jeder anderenDisziplin die Stoffwechselweltmeister dieses Planeten sind. MetalltoleranteBakterien können zwar in schwerme-tallverseuchten Medien leben, rei-chern aber Metalle in ihrem Innerennicht in solchen Ausmaßen an.
Inwieweit die Pflanzen von ihrenungewöhnlichen Ernährungsgewohn-heiten profitieren, ist noch nicht ab-schließend geklärt. „Es kann sein,dass sie sich durch hohe Metalldosen
vor Fressfeinden oder Pilzbefallschützen. Vielleicht haben sie me-tallreiche Böden aber auch nur ein-
diese Membrantransporter? Wie er-kennen sie jene Metalle, auf die sichder pflanzliche Stoffwechsel einge-stellt hat, und wie sortieren sie dieanderen aus? Wieso gehen tolerantePflanzen an den hohen Metalldosennicht zugrunde?
„Tatsächlich ist über die Detailsdieser Vorgänge noch nicht allzu vielbekannt. Es handelt sich hier um einsehr komplexes Netzwerk, das nochauf seine Entschlüsselung wartet“,sagt Ute Krämer. „Und obwohl manbereits zahlreiche Hyperakkumulato-ren kennt, sind ideale, schnell wach-sende Kandidaten mit hoher Biomas-se zur Entgiftung von Böden bis jetzteher selten. Hier besteht noch einenormer Forschungsbedarf.“ Undgenau davon konnte die junge Bio-chemikerin (Abb. 3), die mit 26 Jah-ren an der Universität Oxford beiJ. Andrew C. Smith am Departmentof Plant Sciences promoviert unddanach in den USA geforscht hat,eine Reihe von Experten Ende 1999überzeugen. Versehen mit einer Aus-zeichnung und entsprechenden Mit-teln aus dem vom Bundesfor-schungsministerium ausgerichtetenBioFuture-Wettbewerb hat sie nundie Möglichkeit, ihre Ideen fünf Jah-re lang mit einer eigenen Arbeits-gruppe weiterzuverfolgen. Für ihreStandortwahl war das offene Ar-
beitsklima am Golmer Max-Planck-Institut vor den Toren der Stadt Pots-dam, unweit des Parks Sanssouci,ausschlaggebend.
HEFEZELLEN
ALS VORKOSTER
Um sich auf ihrem Arbeitsgebietzunächst einmal einen Überblick zu
verschaffen, setzten Krämer und ihr Team an den Beginn ihrer Untersu-chungen ein gehöriges Maß an Fleiß-arbeit: Zunächst fingen die Wissen-schaftler gewissermaßen die Protein-baupläne ab, die aus den Zellkernen
von Arabidopsis halleri an die Pro-teinfabriken der Zelle, die Riboso-men, geschickt werden. Die in diesenso genannten Boten-RNAs (mRNA;engl. messenger-RNA) enthaltenengenetischen Informationen brachtenKrämer und ihre Kollegen – zunächstohne Kenntnis des Inhalts – in Hefe-zellen ein (Abb. 4). Die manipuliertenHefezellen wurden dann auf zinkhal-tige Nährmedien gesetzt. Jetzt folgteaufmerksames Beobachten: Zeigt sicheine der Kolonien aus genetisch ver-änderten Hefezellen unbeeindruckt
von der Metalldüngung oder hälttrotz des Metalls im Nährmediumlänger durch, so sind die Wissen-schaftler einen gehörigen Schrittweiter; denn diese robusten Zellenkönnten dann eines der Gene tragen,
das auch für die ungewöhnlicheToleranz von Arabidopsis halleri ver-antwortlich ist.
Welche Funktion die so ermitteltenGenkandidaten haben, ist schon et-was schwieriger herauszufinden –auch wenn die Golmer Biochemiker für diese Arbeit das Rad nicht völligneu erfinden mussten. Arabidopsis
halleri ist nämlich eng verwandtmit der klassischen Modellpflanzein den Labors der grünen Gentechni-ker, der unscheinbaren Ackerschmal-wand Arabidopsis thaliana (Abb. 5).Und der Vorteil ist: Deren geneti-scher Bauplan liegt seit wenigenJahren in Gänze entschlüsselt auf den Schreibtischen der Pflanzenge-netiker. Zwar gibt es nicht zu über-sehende Unterschiede zwischen bei-den Arten: Beide „gleichen“ sich inpuncto Aussehen etwa wie Radies-chen und Kresse – also kaum. Der „Zinkfresser“ Arabidopsis halleri hatdarüber hinaus zwei mal acht stattzwei mal fünf Chromosomen. Den-noch sind die kodierenden Sequen-zen in den Genomen beider Pflan-zen, also die Genomabschnitte, die
Anleitungen für die Herstellung vonProteinen beinhalten, zu ungefähr 95 Prozent identisch. So lassen sichin Genkarten jene Gene, die im Hefe-
versuch als potenzielle Kandidatenfür die Metalltoleranz der Arabidop-
Abb. 2: Arabidopsis halleri, eine nahe Verwandte der vollständig sequenziertenAckerschmalwand, Arabidopsis thaliana,ist von Natur aus auf Lebensräume ein-gestellt, vor denen die meisten anderenPflanzen kapitulieren müssen: So gedeihtsie zum Beispiel auf einem ehemaligenMinengelände (Abraumhalde) im Harz,das mit Cadmium verseucht ist.
Abb. 3: Seit dem Jahr 2000 leitetUte Krämer eine BioFuture-Nachwuchs-gruppe am Max-Planck-Institutfür molekulare Pflanzenphysiologie.
Abb. 4: Hefezellen ( Saccharomyces cerevisiae )unter dem Mikroskop. In die Vakuolenmembrander Zelle rechts unten sind pflanzliche, miteinem grün fluoreszierenden Molekül gekoppelteZink-Transporterproteine eingebaut.
Abb. 5: Arabidopsis thaliana ist das herkömmliche Modellsystem in der Pflan-zenforschung. Ihre Genomsequenz liegt bereits vollständig entschlüsselt vor.Durch Vergleiche von Gensequenzen anderer Pflanzenarten mit den Informa-tionen aus der Arabidopsis-Gendatenbank können die Forscher viel lernen.
F O T O S : U T E K R Ä M E R ,
M P I F Ü R M O L E K U L A R E P F L A N Z E N P H Y S I O L O G I E
/ C A R S T E N L .
B E R G M A N N
F O T O S : A N N E - G A R L O N N D E S B R O S S E S - F O N R O U G E
/ C H R I S T I A N
K R A C H , M
P I F Ü R M O L E K U L A R E P F L A N Z E N P H Y S I O L O G I E
/ J O S E F B E G S T E I N ,
G A B I

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 14/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 27
sammenhang mit der erhöhten Me-tallakkumulation ließe sich dannletztlich nicht bestätigen. Die bisheri-gen Versuche haben uns also ledig-lich einen Hinweis auf einen interes-santen Gen-Kandidaten geliefert. Wir müssen jetzt im Detail untersuchen,ob und wie dieses Protein überhauptam Metalltransport beteiligt ist undwelche Zusammenhänge zwischender Sequenz und der Affinität, der Geschwindigkeit und der Selektivität,mit der Metalle transportiert werden,bestehen. Nach Möglichkeit wollenwir dabei auch klären, was das Feh-len der beiden Bruchstücke in der
Aminosäurekette des Arabidopsis
halleri-Proteins im Detail bewirkt.“Darüber hinaus untersucht die
Zweiunddreißigjährige derzeit zumBeispiel auch, ob der erhöhte Histi-dingehalt Nickel akkumulierender Pflanzen (Abb. 7) etwas mit deren
Appetit auf dieses Metall zu tun hat.So scheint das Histidinmolekül dasNickel komplett einzuhüllen und istin der Lage, den Transport diesesMetalls ins Xylem zu beschleunigen.Bislang ist noch kein Protein be-kannt, das diesen Job übernehmenkönnte. Auch beim Menschen sindHistidin und ähnliche Moleküle für den Zinktransport förderlich. Zudemkonnte gezeigt werden, dass das Hi-
stidin durch „Einpacken“ die Giftig-keit des Nickels in der Pflanze herab-setzen kann. Auch dieses Prinzipscheint weit verbreitet zu sein: Kup-fer etwa kommt in Zellen ohneschützende Proteinhülle überhauptnicht vor. Und in vielen Pflanzenscheinen kurze Peptide aus schwefel-haltigen Aminosäuren als eine Art„Fliegenfänger“ für gewisse Schwer-metallionen zu fungieren. Pflanzen-mutanten, die diese kurzen Peptidenicht herstellen können, reagierenauf erhöhten Cadmiumkonzentratio-nen in der Petrischale extrem emp-findlich; das konnten andere For-schungsgruppen zeigen. Ob es auchin Arabidopsis halleri Moleküle mit
vergleichbarer Funktion gibt, die
Zink „einhüllen“, ist eine weitereFrage, der Ute Krämer in Zusammen-arbeit mit anderen Gruppen am Ins-titut nachgehen möchte.
ENTGIFTEN DURCH
SÄEN UND MÄHEN
Bei der Erforschung der Metall-Hyperakkumulation stehen die For-scher tatsächlich noch am Anfang(Abb. 6). Aber die Mühe lohnt sich:
Wenn das komplexe Netzwerk ersteinmal durchschaut ist, könnte esnämlich möglich sein, schnell wach-sende Pflanzen mit hoher Biomassezu züchten, die sich noch besser auf die Aufnahme und Anreicherung
von Nickel, Zink, Cadmium oder Quecksilber verstehen.
Rezeptideen gibt es in der Biotech-Szene genug: So könnte man denMetallzufluss in die Pflanze unter Umständen steigern, wenn man die
Anzahl der maßgeblichen Transport-proteine oder der Metallbindungs-stellen erhöht, wie es Arabidopsis
halleri womöglich vorführt. Wennman die Selektivitäten der Memb-rantransporter durch cleveres Designändert, könnte man zum Beispiel dieKonkurrenz zwischen chemisch ähn-lichen Metallen wie Cadmium undZink verringern und damit die Cad-miumaufnahme verbessern – oder gar ganz andere Metalle in diePflanze einschleusen. Wem es ge-lingt, die Metall-Transportraten von
den Wurzeln ins Xylem zu erhöhen,der könnte damit vielleicht den An-teil der Schwermetalle, die in den
Wurzeln gespeichert werden, verrin-gern. Damit würden letztlich mehr Metalle im Mähdrescher landen. Undauch an das Wohlergehen der Pflan-zen wird in den Bio-Think-Tanks ge-dacht: So könnte die verstärkte Bio-synthese von „Hüllmolekülen“ wieHistidin die neuen pflanzlichen Hy-perakkumulatoren – trotz erhöhter Metallkonzentrationen in der Zelle –
vor entsprechenden Vergiftungssym-ptomen schützen.
Wenn sich auch nur ein Teil dieser Vorschläge realisieren ließe – dannwäre das Entgiften verseuchter Bö-den bald eine Angelegenheit von
simplem und schonendem Säen undMähen. Kein Wunder, dass sich auchdie Europäische Union an diesenForschungsarbeiten sehr interessiertzeigt und Krämers Labor als Partner in zwei europäischen Verbundpro-
jekten zu diesem Thema fördert. Alles Zukunftsmusik? „Es ist noch
ein sehr langer Weg“, sagt Krämer und zieht die Tür des Gewächshauseshinter sich zu. Dahinter sieht mandie Felder, auf denen sich Getreideim Wind wiegt (Abb. 8), und denktan belastete Böden wenige Kilometer
von hier, die vielleicht einmal durchähnliche Felder saniert werdenkönnten. „Pflanzen können nichtweglaufen“ – letztlich sind wir Men-schen ja nur scheinbar mobiler alsPflanzen; denn einen neuen Plane-ten können wir uns in nächster Zeitauch nicht suchen. Warum also nicht
von Pflanzen lernen, die ihrer Stand-ortgebundenheit einige überraschen-de Fertigkeiten verdanken?
STEFAN ALBUS
PFLANZEN forschu
26 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
sis halleri identifiziert wurden, mitDNA-Sequenzen von Arabidopsis
thaliana vergleichen. Dieser Ver-gleich erlaubt dann Rückschlüsse auf die Funktionen der Proteine – soferndiese bei Arabidopsis thaliana be-reits bekannt sind. „Natürlich hatauch dieser Ansatz einen Haken,denn nahe verwandte Gene könnensich durchaus deutlich unterscheidenund obendrein unterschiedliche Auf-gaben übernehmen“, sagt Krämer.
PROTEINE ENTSORGEN
METALLMÜLL
Bereits in einer ersten Versuchsrei-he gab es einen möglicherweise be-merkenswerten Treffer: Manche der Hefekolonien, die auf den metallver-
seuchten Nährmedien gut wuchsen,besaßen nun ein Gen, dessen SequenzÜbereinstimmungen mit einem Genaus der Arabidopsis thaliana-Daten-bank zeigte. Interessanterweise istdieses Gen auch bei der „gewöhnli-chen“, metallempfindlichen Acker-schmalwand in irgendeiner Form ander Verarbeitung der Metallionen be-teiligt. Bei dem Protein, zu dem dasgefundene Gen quasi die Blaupausedarstellt, scheint es sich um ein Mit-glied der so genannten „Cation-Dif-fusion-Facilitator“-Familie (CDF) zuhandeln. Möglicherweise transportiertdieses Protein Metallionen im Aus-tausch mit Protonen aktiv durch die
Vakuolenmembran. Der Clou dabei:Diese CDF-Familie hat in der bekann-ten Ackerschmalwand rund 13 ver-schiedene, einander mehr oder weni-ger stark ähnelnde Mitglieder. Im Ver-gleich zu ihrem engsten Verwandtenfehlen dem gefundenen CDF-Proteinaus Arabidopsis halleri jedoch anzwei Stellen in der Aminosäurenkettekleine Bruchstücke. Und es wird nochinteressanter: Das neu identifizierteGen kommt in der metallverdauenden Arabidopsis halleri offenbar mindes-tens drei Mal vor und wird zudemdeutlich öfter abgelesen, das heißt:Die Zelle zieht den Bauplan für diesesspezielle Protein öfter aus der Schub-lade, sprich dem Zellkern.
Nun ist bekannt, dass alle Organis-men auch für ihren alltäglichen
HWER punkt
Stoffwechsel auf Metalle angewiesensind. Zink-Ionen zum Beispiel, auf die sich Arabidopsis halleri speziali-siert hat, spielen bei der Herstellung,Speicherung und dem Abbau mehre-rer menschlicher Hormone – etwaInsulin – eine wichtige Rolle. Darü-ber hinaus ist dieses Metall auch einunabdingbarer Bestandteil von En-zymen, wie zum Beispiel der Alko-holdehydrogenase. Die Aufnahmeund Verteilung dieser Spurenelemen-te muss also auch in ganz gewöhnli-chen Zellen geregelt werden. Und soüberrascht es eigentlich nicht, dassalle Lebewesen – nicht nur die bei-den Arabidopsis-Arten in KrämersGewächshaus – verblüffend ähnlicheEnzyme und Transportproteine auf-weisen, die den Metallstoffwechselin der Zelle übernehmen. Bei höhe-ren Organismen werden diese Ele-mente durch eine ausgeklügelte Gen-Maschinerie aktiviert und gesteuert.
Anders als Einzeller müssen Pflan-zen und Tiere die Ionen ja aktiv anihre Zielorte transportieren. Das setzteine ausgefeilte Logistik voraus.
Betrachtet man diesen komplexen Verteilungsfahrplan nun im Licht der Überexpression des in Arabidopsis
halleri gefundenen Gens, liegt der Verdacht nahe, dass Metall-Hyperak-kumulatoren womöglich lediglich
ihren metallverarbeitenden Stoff-wechsel ein wenig anders justiert ha-ben. Die dezente Umgestaltung deseinen oder anderen Ionentranspor-ters könnte diesen mit geänderter Selektivität auf Metallionen reagie-ren lassen, sodass er zum BeispielCadmium statt Eisen in die Vakuolepumpt; indem sie bestimmte Trans-porter einfach häufiger herstellen,erhöhen die Zellen womöglich auf simple Weise die Effizienz gewisser Teile ihres metallverarbeitenden Sys-tems. Verhält es sich bei dem CDF-Protein aus Arabidopsis halleri ähn-lich? Hat die Pflanze durch denEinbau mehrerer modifizierter CDF-Proteine in die Vakuolenmembranschlicht die Öffnung zu ihrem Me-tall-Mülleimer vergrößert?
„Hier muss man mit Schlussfolge-rungen zum gegenwärtigen Zeit-punkt noch äußerst vorsichtig sein“,sagt Krämer. „Bis jetzt kennen wir le-diglich den Phänotyp, also das Er-scheinungsbild in Hefe – diese Zellensind in der Lage, auf einem mit Me-tallen angereicherten Nährmediumzu wachsen. Aber wir kennen nochnicht die Biochemie, die hinter die-sem Phänomen steckt. Es ist durch-aus vorstellbar, dass das CDF-Proteinin Hefe Eigenschaften hat, die es inder Pflanze nicht aufweist. Ein Zu-
Abb. 6: Junge Hoffnungsträger: Mithilfe von Metall-Hyperakkumu-latoren lassen sich vielleicht einmal metallbelastete Böden entgiften.Bisher wachsen zum Beispiel Zink anreichernde Pflanzen allerdings nochnicht schnell genug, obwohl manche schon von Natur aus bis zu fünf
Prozent ihres Trockengewichts in diesem Metall anlegen können.
Abb. 7: Der Nickel-Hyperakkumulator Alyssum lesbiacum;hier eine kleine Pflanze
in Hydrokultur.
Abb. 8: Blick über ein Weizenfeld. F O T O S : U T E K R Ä M E R ,
M P I F Ü R M O L E K U L A R E P F L A N Z E N P H Y S I O L O G I E
/ M P G - A R C H I V
F O T O : S T E F A N A L B U S

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 15/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 29
PFLANZEN forschu
MPF: Herr Prof. Rohde, wie kamen
Sie zu CIMbios?
PROF. WOLFGANG ROHDE: Seit 1994koordiniere ich internationale EG-Projekte mit Entwicklungsländern inSüdostasien, Afrika und Zentralame-rika sowie seit 1999 bilaterale Projek-te mit Mexiko und Kuba. In diesenRegionen – speziell auf den Philippi-nen, in Tansania und Mexiko – habenwir im Rahmen der Programme be-reits wissenschaftliche Symposienund Laborkurse abgehalten. Darüber hinaus bin ich seit2001 für den Deutschen Akademischen Austauschdienstals Kurzzeitdozent an meinem kubanischen Partnerinsti-tut in Havanna tätig und halte dort Vorlesungen über Biochemie und Molekularbiologie der Pflanzen, über Phytopathologie und Biotechnologie. Im selben Jahr,also 2001, begann dann das CIMbios-Programm. Aufeinem ersten Symposium am CICY in Merida wurdenallgemeine Grundlagen in den Biotechnologien undder Bioinformatik vermittelt. Im November wird es inMexiko wieder ein Symposium geben, das in ein drei-
28 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
HWER punkt
F O T O S : M P I F Ü R Z Ü C H T U N G S F O R S C H U N G
CIMbios – hinter diesem Akronym verbirgt sich eine besondere Art von „grüner“ Ent-
wicklungshilfe: Das CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN (CICY)
in Merida, Mexiko, das Aachener FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR MOLEKULARBIOLOGIE
UND ANGEWANDTE ÖKOLOGIE (IME) sowie das Kölner MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR
ZÜCHTUNGSFORSCHUNG (MPIZ) haben sich zusammengeschlossen, um in Lateinamerika
und der Karibik deutsches Know-how auf den Gebieten Biotechnologie und Bioinformatik
zu verbreiten und damit den unterentwickelten Regionen Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten.
MAXPLANCKFORSCHUNG sprach mit CIMbios-Koordinator PROF. WOLFGANG ROHDE vom
Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung über Aufgaben und Ziele des Projekts.
wöchiges Fortbildungsprogramm für Studenten und junge Wissenschaftler aus Lateinamerika und der Karibik eingebettet ist.
MPF: Wie ist CIMbios strukturiert?
ROHDE: Auf deutscher Seite kooperie-ren das Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung (MPIZ) und dasFraunhofer Institut für Molekularbio-
logie und Angewandte Ökologie (IME).Dritter im Bunde ist das Centro de Inves-
tigacion Cientifica de Yucatan in Mexiko (CICY). DiesesInstitut wurde vor zwanzig Jahren gegründet und gehörtheute auf dem Gebiet der Pflanzenforschung zu denherausragenden wissenschaftlichen Einrichtungen Latein-amerikas. Weil sich die beiden deutschen Institute vor-züglich ergänzen – das MPIZ betreibt Grundlagenfor-schung, die Arbeiten am IME sind vorwiegend anwen-dungsorientiert – kann unser mexikanischer Partner vonbeiden profitieren.
MPF: Ihr Motto lautet „In der Region für die Region“.
Was meinen Sie damit?
„Lösungenaus der Region
für die Region“
ROHDE: Den Hochtechnologieländern wird ja immer wieder vorgeworfen, den Bedürfnissen der Entwicklungs-länder nicht gerecht zu werden. Unser Ansatz ist einanderer: Die in den Entwicklungsländern lebenden Men-schen kennen die Probleme und Bedürfnisse am besten.Daher können Lösungen nur gemeinsam und vor Ort ent-wickelt werden. Wir verstehen das Konzept „in der Re-gion für die Region“ übrigens als Pilotprojekt, das überallauf der Welt Schule machen könnte.
MPF: Spielt bei CIMbios das Centro de Investigacion
Cientifica de Yucatan die entscheidende Rolle?
ROHDE: Das CICY ist einmal unser Partner in wissen-schaftlichen Projekten. Darüber hinaus dient es als regio-nales Zentrum in Lateinamerika und der Karibik für denTransfer von praktischer Expertise und neuen Entwick-lungen auf den Gebieten der Biotechnologie und Bioin-formatik. Die Erfahrung aus früheren Projekten hat ge-zeigt, dass sich aus kombinierten Workshops und Labor-kursen in relativ kurzer Zeit regionale Netzwerke bildenkönnen, aus denen sich dann weitere nationale Koopera-tionen ergeben. Ziel ist es, eine langfristige Partnerschaftin der Biotechnologie und Bioinformatik zu etablieren,
wobei der Wissenstransfer über das CICY laufen soll. Zudiesem Wissenstransfer gehört außerdem der Austausch
von Forschern zwischen allen drei CIMbios-Partnern. Da-durch werden in den Schwellenländern Forscher undTechniker ausgebildet, die wiederum die Kontinuität desProgramms garantieren sollen. Indem wir die am CICY
vorhandenen Strukturen und Infrastrukturen nutzen, er-sparen wir uns zum Beispiel den Bau und die Erhaltungneuer Labors für die praktischen Kurse. Die Verknüpfung
von Theorie und Praxis bietet maßgeschneiderte Lösun-gen für regionale Probleme. Auf dem Gebiet der Pflan-zenforschung und Landwirtschaft, auf dem die drei inCIMbios eingebundenen Institute tätig sind, liefert dasCICY ein Beispiel, wie Wissen und Erfahrung aus der Grundlagenforschung in die wirtschaftliche Praxis über-führt werden können.
MPF: Können Sie ein Projekt konkret beschreiben?
ROHDE: Mit PROPLANTA, einem Speziallabor für dieMikropropagation von Agavepflanzen, hat das CICY amInstitut ein Biotechnologie-Unternehmen gegründet, dassich die langjährigen Erfahrungen der CICY-Wissenschaft-ler in der Gewebekultur – eine der wichtigsten Biotechno-
Prof. Wolfgang Rohde vom Max-Planck-
Institut für Züchtungsforschung.
Die Kokospalme ist in vielen Anbauländern entlang des Äquators ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Doch „Lethal Yellowing“ bedroht die Pflanze –wie in dieser Plantage auf Jamaika. Allerdings wachsen dort auch gezüchtete Maypan-Hybriden, die gegen diese Krankheit offenbar resistent sin

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 16/43
30 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
logien – zu Nutze macht. Während jährlichhunderttausende von Agavepflanzen ausdem Gewebekulturlabor in Plantagen für dieindustrielle Verwertung angepflanzt werden,zeigt ein weiteres Beispiel auf den Philippi-nen, dass auch Kleinbauern von der Gewe-bekultur-Biotechnologie direkt profitieren.So ist am Albay Research Center der Philip-pine Coconut Authority im südlichenLuzon mit internationaler Unterstüt-zung – unter anderem durch die Deut-sche Gesellschaft für Technische Zu-sammenarbeit – ein Zentrallabor für die Gewebekultur in Kokospalmenentstanden. Dort werden Kokospalmen
vom so genannten Makapuno-Phäno-
typ über die Gewebekultur vermehrt:Die Kokosnüsse dieser Kokosart sindmit gallertartigem Fruchtfleisch ge-füllt, das in der philippinischenSüßwarenindustrie verwendet wird.Der Verkauf dieser Nüsse sichert daher den Kleinbauern höhere Einkünfte. DieNüsse dieses Typs keimen jedochnicht. Neue Pflanzen müssen vielmehr nach der Isolierung der Embryonenüber die Gewebekultur vermehrt undherangezogen werden, bevor sie an dieKleinbauern abgegeben werden.
MPF: Im Gegenzug profitiert auch die deutsche For-
schungslandschaft?
ROHDE: Ja. Als ganz wichtiger Punkt erscheint mir dieRekrutierung von wissenschaftlichem Nachwuchs. Wir wollen die Bundesrepublik als Ausbildungsstandort dar-stellen, das heißt Studenten für ein Studium in Deutsch-land gewinnen – daher ist der Deutsche Akademische
Austauschdienst in das Projekt eingebunden – und junge Wissenschaftler für die Arbeit in oder die Zusammen-arbeit mit deutschen Instituten motivieren.
MPF: CIMbios fungiert als wissenschaftliche
Plattform ...
ROHDE: ... und als Schaufenster für wissenschaftlichesGerät „made in Germany“, das zum Beispiel in Bioinfor-matik-Kursen eingesetzt wird. Darüber hinaus soll CIM-bios auf internationaler Ebene, gemeint sind in dem FallDeutschland und Lateinamerika, das erfolgreiche „Bio-regio“-Modell des Bundesforschungsministeriums weiter-führen: Wissenschaft und Wirtschaft rücken näher zu-sammen und erschließen neue Märkte durch die Kombi-nation von Grundlagenforschung und finanziellen Res-sourcen in Start-up-Unternehmen. Das Max-Planck-
Institut für Züchtungsforschung und dasFraunhofer-Institut für Molekularbiologieund Angewandte Ökologie haben darin be-reits eine gewisse Erfahrung, von der dasCentro de Investigacion Cientifica de Yuca-tan sicherlich profitieren wird.
MPF: Lassen Sie uns abschließend über
Geld reden. Wer finanziert CIMbios?
ROHDE: Zurzeit behelfen wir uns miteiner Mischfinanzierung, wobei dasInternationale Büro in Bonn mit etwa15000 Euro pro Jahr den größten Zu-schuss leistet. Einzelne Vortragendesind in der Lage, ihre Teilnahme amInternationalen Symposium aus Pro-
jekten zu finanzieren. Auch die dreiInstitute und der Consejo Nacional deCiencia y Tecnologia in Mexiko leis-ten einen finanziellen Beitrag. Aber Sie können sich vorstellen, dass ein
vierwöchiges Programm, das sich auseiner Woche Vorlesung über die Bio-technologien, einem internationalenSymposium von drei bis vier TagenDauer und zweieinhalbwöchigenpraktischen Kursen in Biotechnologie
und Bioinformatik zusammensetzt, einenwesentlich höheren Finanzbedarf hat.Leider passt CIMbios von seiner Struktur
her nicht in existierende Programme der verschiedenenmöglichen Geldgeber. Vor allem wollen wir Studentenund jungen Wissenschaftlern der Region durch Vergabe
von Stipendien die Teilnahme am CIMbios-Programm er-möglichen und ihnen die Gelegenheit geben, sich in per-sönlichen Gesprächen mit Wissenschaftlern der verschie-denen Fachrichtungen über Deutschland als Ausbildungs-standort und wissenschaftliche Partner zu informieren.
Auch wollen wir ein wenig zur Modernisierung der Infra-struktur beitragen, die ja nicht nur für CIMbios, sondernauch für die regionale Ausbildung von Studenten und
Wissenschaftlern dient. Während zum Beispiel das CICY aus eigenen Mitteln Labors für die praktischen Kurse um-gebaut hat, fehlen uns noch spezielle Geräte – die wir auch über wissenschaftliche Projekte einwerben wollen –sowie Computer. Ich würde mir wünschen, dass wir miteinem größeren Etat ausgestattet werden und im Lauf der Zeit möglichst umfassend deutsche Wissenschaftler ausUniversitäten und außeruniversitären Institutionen zu
Wort kommen lassen können.DAS INTERVIEW FÜHRTE HELMUT HORNUNG
Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter:
http://www.mpiz-koeln.mpg.de/~rohde/CIMbios.html
HWER punkt
In Workshops und Laborkursen vermittelndeutsche Forscher am CICY in Mexikoihr biotechnologisches Know-how.
Bessere Leistung. Besserer Preis
Besser jetzt.

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 17/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 33
Besonders appetit-lich sehen die
Maiskolben nicht aus. Dort,wo normalerweise ordentlich
aufgereiht die gelben Körner sit-zen, wuchert etwas, das eher an miss-
gebildete Hühnereier erinnert. Aber wieso oft, ist auch das offenbar nur eine Frage
der Perspektive: In Mexiko – und seit ein paar Jahren auch in den schicken New Yorker Szene-Res-
taurants – gelten die deformierten Maiskolben als Delikatesse.Unter dem Namen Cuitlacoche sind sie sogar im Handel erhältlich. „Meinen Ge-schmack treffen sie nicht unbedingt“, sagt Regine Kahmann. Für die Direktorinam Max-Planck Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg gibt es an-dere Gründe, sich für missgebildeten Mais zu interessieren. Denn die Ursacheder Missbildung ist eine weit verbreitete Pflanzenkrankheit: Ustilago maydis
32 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
HWER punkt
F O T O S : W O L F G A N G F I L S E R
PFLANZEN forschu
Ein Pilz schlauchtdie Abwehr
Zwischen Pflanzen und
ihren Schädlingen findet ein
permanenter Wettkampf statt –
und auf der Suche nach der jeweils
geeignetsten Verteidigungs- oder
Überwindungsstrategie kennt der Einfalls-
reichtum der Natur kaum Grenzen. In der Abteilung
von PROF. REGINE KAHMANN am Marburger
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR TERRESTRISCHE
MIKROBIOLOGIE versuchen die Forscher, den Grund-
zügen dieser organismischen Interaktion auf die Spur
zu kommen. Der Pilz Ustilago und seine Wirtspflanze,
der Mais, stehen dabei im Zentrum ihres Interesses.
Der Pilz Ustilago maydis
löst bei Maispflanzeneine Wucherung im
Bereich der Kolben aus.
Ein Pilz schlauchtdie Abwehr

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 18/43
Pheromon-Wechselwirkung
Saprophytisches Wachstum
Signale aus der Umwelt
• pathogene Entwicklung• sexuelle Entwicklung• Kernfusion• Sporenbildung
Parasitäres Wachstum
Filamentöses Wachstum• Dikaryon
Pflanzensignale
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 35
nach dem, was die Forscher über Ustilago und andere Schädlinge wiedas Bakterium Pseudomonas syrin-
gae wissen (siehe Kasten Seite 38),haben Pflanzenparasiten nicht nur
Wege gefunden, diese Abwehr zuüberwinden, sondern sind oft sogar in der Lage, sie für ihre eigenenZwecke auszunutzen. „Der Pilz ma-nipuliert seinen Wirt zu seinem Vor-teil“, sagt Kahmann.
DUFTSIGNALE
ZUR PARTNERFINDUNG
Allerdings hinterlässt diese Anpas-sung auch Spuren im Lebenswandeldes Parasiten: Ohne den Mais könnteUstilago seinen Fortpflanzungszy-klus nicht vollenden. Viele Pilzen
vermehren sich auf zwei Weisen:Zum einen ungeschlechtlich durcheinfache Zellteilung, zum anderengeschlechtlich durch „Paarung“.
Allerdings haben verschiedene Pilzeeine Vielzahl von Spielarten diesesgrundlegenden Lebenszyklus ent-wickelt. Ustilagos Infektionszyklusbeginnt mit einer Pilzspore – einer ineine robuste Hülle eingepackten Ein-zelzelle, die allerdings einen doppel-ten Chromosomensatz besitzt. DieSpore ist klein genug, um durch dieLuft transportiert zu werden. Wennsie dort, wo sie gelandet ist, genü-gend Nährstoffe findet, keimt dieSpore aus und produziert Nachkom-men mit einfachem Chromosomen-satz, die sich ähnlich wie Hefezellenteilen. Auf dem Blatt einer Mais-pflanze sind solche so genanntenSporidien ständig auf „Brautschau“,also auf der Suche nach einempotenziellen Fortpflanzungspartner.Um andere Pilzzellen anzulocken,sondert die Zelle ein Pheromon ab –und „schnuppert“ selber ständignach Lockstoffen eines Artgenossen(siehe Schemazeichnung).
Zwei Einzelzellen kommen alsPartner in Betracht, wenn der Rezep-tor, also die „Pheromon-Antenne“des einen auf das Pheromonsignaldes jeweils anderen Partners abge-stimmt ist. Damit wird quasi Inzucht
vermieden, nur genetisch verschie-dene Sporen können miteinander fu-
sionieren. Die Zellen beginnen nun,einen Fortsatz in Richtung des Part-ners wachsen zu lassen. Treffendiese Ausläufer aufeinander, so ver-schmelzen die beiden Zellen zu einer einzigen neuen Zelle. Aber das isterst das Vorspiel der sexuellen Fort-pflanzung. Die Zellkerne, die dasErbgut enthalten, bleiben in der neu-en Zelle vorerst getrennt.
Mit der Verschmelzung der Zellenändert sich das Verhalten des Pilzesdrastisch: Statt sich zu teilen, ent-wickelt sich aus den zigarrenförmi-gen Einzelzellen ein schlauchartigesFilament, das auf der Oberfläche der
Maispflanze wächst. Während diesesFilament an der Spitze wächst, ziehtsich das Zytoplasma aus den hinte-ren Teilen zurück, sodass hier einleerer Schlauch entsteht. „Wir ver-muten, dass Ustilago in dieser Phaseauf der Suche nach einer Schwach-stelle ist, an der er in das Innere der Maispflanze eindringen kann“, sagtRegine Kahmann. Wenn er eine sol-che Stelle gefunden hat, gibt es of-fenbar nicht viel Gegenwehr – ein-mal in ein Maisblatt, einen Stängel
PFLANZEN forschu
34 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
(Maisbrand) heißt ein Pilz, der diePflanze unter anderem dazu bringt,statt eines Kolbens eine Wucherungzu bilden. Obwohl Ustilago essbar istund keine große ökonomische Bedeu-tung als Schädling hat, ist er den-noch in der Pflanzenschädlingsfor-schung einer der wichtigsten Modell-organismen.
ZUGRIFFSRECHTE FÜR
MAX-PLANCK-FORSCHER
Die Gründe sind ganz praktischer Natur: Der Pilz lässt sich problemlosin Labor und Gewächshaus züchtenund untersuchen. „Mit Ustilago kön-nen wir in wenigen Monaten eine
Vielzahl von Experimenten machen,die mit anderen Pilzen Jahre dauernwürden“, sagt Kahmann, die seit1984 an dem Pilz forscht. Ihre Hoff-nung ist, an diesem Modell Detailsder Wechselbeziehung zwischen Pa-thogen und Pflanze aufklären zukönnen. „Wir gehen davon aus, dasswir vieles von dem, was wir beiUstilago lernen, auch auf andere,der Forschung schwerer zugäng-liche Pflanzenkrankheiten übertragenkönnen“, sagt Kahmann. Und dashofft nicht nur die Marburger Biolo-gin – auch für die Hersteller von
Pflanzenschutzmitteln ist der Pilz eininteressantes Forschungsobjekt.
Ustilago ist zwar ein eher harm-loser Repräsentant einer Gruppe vonPilzen, die Getreide wie Mais, Reisund Weizen infizieren. Doch ver-wandte „Rost“-Erkrankungen verur-sachen jährlich Ernteausfälle vonmehreren Milliarden Euro. Der Che-miekonzern Bayer hat aus diesemGrund das gesamte Erbgut des Pilzesentschlüsseln lassen: Etwa 20 Millio-nen Buchstaben enthält das Genom,schätzungsweise 7000 Gene haben
darin Platz. Kahmanns Gruppegehört zu den wenigen weltweit, de-nen Bayer im Rahmen einer Zusam-menarbeit Zugriff auf diese Gen-Datenbank eingeräumt hat. Aller-dings: „Das Exklusivrecht ist durch-aus ambivalent“, sagt Kahmann. Vie-le Fragen kann ihr Team nun zwar schon mit wenigen Mausklicks be-antworten – früher hätte es wochen-langer Experimente bedurft. Dochweil die Datenbank geheim ist, wer-den andere Forscher eher davon ab-gehalten, an Ustilago zu arbeiten: „Esgibt so viele interessante Ansätze, dieman verfolgen sollte. Eine Forscher-gruppe alleine kann das unmöglichschaffen“, bedauert Kahmann.
Ustilago ist ein Beispiel, wie per-
fekt Parasiten sich an ihren Wirt an-passen können. Der Pilz ist ein alter Begleiter des aus Südamerika stam-menden Maises: Wo es den einengibt, gibt es auch den anderen. Ei-gentlich verfügen Pflanzen durchausüber wirksame Abwehrmaßnahmengegen Krankheiten. Sie schützen sichdurch eine dicke Zellwand, darüber hinaus oftmals auch mit wachsigenOberflächen. Zudem haben sie che-mische Abwehrsysteme entwickelt,die – wie die Wissenschaftler in den
vergangenen Jahren zeigen konnten– auch eine genetische Basis haben(siehe Artikel auf Seite 40). Doch
HWER punkt
Im Zentrum des Forschungsinteresses steht der Pilz Ustilago und sein Wirt,der Mais: Hier werden einer jungen Maispflanze Pilzzellen injiziert.
t 2000 leitet Regine Kahmann die Abteilung „Organismische Interaktionen“Marburger Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie.
Schematische Darstellung des Lebenszyklus’und der verschiedenen morphologischen Stadienvon Ustilago maydis.
I L L U S T R A T I O N : R O H R E R

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 19/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 37
nächsten Wirt übertragen werden. Wie steuert der Pilz die Übergängezwischen diesen Lebensphasen undden entsprechenden Verhaltenswei-sen? Woran erkennt er, in welcher Umgebung er sich befindet? Wiesetzt er die Signale aus seiner Um-welt in Veränderungen seines Stoff-wechsels und in gerichtete Bewegun-gen um?
NEU PROGRAMMIERT: VON
DER SPORE ZUM ZELLTUNNEL
Vorerst konzentriert sich RegineKahmanns Gruppe auf jene Verhal-tensänderungen, die nach der Ver-schmelzung zweier Zellen ablaufen:Die Zellen hören auf sich zu teilen,stattdessen beginnen sie durch den
selbstverlegten Chitintunnel zu krie-chen. „Wir wollen wissen, waswährend dieser Umstellung im Inne-ren der Pilzzelle geschieht“, sagtJörg Kämper. Seine Forschungsar-beiten konzentrieren sich auf dieSteuerung des Pilzverhaltens. Der
Wissenschaftler weiß bereits, dasssich das Umschalten in der Zellpro-grammatik auch am Erbgut ablesenlässt: Gene sind dort die Bauvorlagefür Enzyme und andere Proteine, dieder Pilz in seinen verschiedenen Le-bensphasen benötigt.
Bevor die Gene jedoch in Proteineübersetzt werden können, muss qua-
PFLANZEN forschu
36 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
HWER punkt
si eine DNA-Blaupause in Form einer so genannten Boten- oder mRNA (engl. messenger -RNA) angefertigtwerden. Je mehr Enzyme eines be-stimmten Typs der Pilz nun braucht,desto mehr Abschriften des Gens,also mRNA-Transkripte, lassen sichin der Regel auch in der Zelle nach-weisen. Es sind einige hundert Gene,die nach der Verschmelzung derbeiden Zellen ihre Aktivität ändern,und die Kämper und seine Kolle-gen durch Vorher-Nachher-Verglei-che identifizieren konnten. Etwa 50
davon werden sehr schnell aktiv.„Das könnten Schlüsselgene für dieRegulation der pathogenen Entwick-lung sein“, vermutet Kämper. DieGruppe hat mittlerweile damit be-gonnen, die Funktion einiger dieser Gene aufzuklären. „Das ist der müh-samere Teil der Arbeit“, sagt Kämper,„weil es für jedes einzelne Gen eineReihe langwieriger Experimentebraucht.“ Eine Strategie ist es bei-spielsweise, das Gen zu zerstörenund anschließend das Verhalten der manipulierten Pilzzellen mit norma-len Zellen zu vergleichen.
Für Gero Steinberg gehört diese Art langwieriger Analysen seit Jah-ren zum Alltag. Sein Fachgebiet sindso genannte Motorproteine – jeneMoleküle, die im Inneren der ZelleLasten von A nach B transportierenund das Zytoskelett organisieren.Zellen sind von einem Geflecht ausProteinfasern durchzogen. Diese Fa-sern gleichen einem Schienenwerk,an dem sich die Mini-Motoren mitihrer Fracht entlangbewegen. Diemolekulare Analyse von Motorpro-teinen hat in den vergangenen Jah-ren vor allem aufgrund methodischer
Weiterentwicklungen einen enormen Auftrieb erfahren: Nachdem die
Die Marburger Forscher – hier Jörg Kämper – betreibenMaisanbau auf dem Dach ihres Institutsgebäudes.
Das so genannte Spitzenwachstum von Pilzhyphen ermöglicht derPilzzelle erst das Eindringen und Durchwachsen von Substraten undstellt die Voraussetzung für die Neubesiedelung von Lebensräumendar und damit auch für die pathogene Entwicklung vieler Pilzerre-ger. Was genau passiert bei diesem Vorgang? Winzige membran-umhüllte Bläschen, die Vesikel, werden entlang zellinterner Schie-nenstränge zur Wachstumsregion transportiert. Dort verschmelzensie mit der sich ausdehnenden Plasmamembran und entleeren dabeiihren Inhalt nach außen. Durch diesen Verschmelzungsprozess er-hält die Wachstumsregion den notwendigen Materialnachschub.
Welches Ausmaß die zugrunde liegenden Transportprozesse haben,machen Schätzungen an schnell wachsenden Hyphen des Brot-schimmels Neurospora crassa deutlich: Innerhalb von einer Minutesollen hier etwa 38000 Vesikel mit der Hyphenspitze fusionieren.Für die enorme Transportleistung sind vor allem Eiweißkomplexeverantwortlich, die ihre Last unter Energieverbrauch entlang derZytoskelettschienen bewegen. Aufgrund der Analogie zu techni-schen Transportsystemen werden sie auch molekulare Motoren ge-nannt. Durch genetische Versuchsansätze ist es den Marburger For-schern um Gero Steinberg (unteres Bild) gelungen, ein Molekül zu
identifizieren, das maßgeblich in die Logi-stik des zellinternen Schienenverkehrs ein-gebunden ist und dessen Fehlen zu (tempe-raturabhängigen) Wachstumsdefekten desPilzfadens führt: Anfärbungen mit Chitin(rot) und anderen Zellwandglucanen (blau)lassen die Zellwanddefekte gegenüber dernormalen Hyphe (im Bild oben) deutlichwerden.
Generell muss die Zelle sicherstellen, dassein Transportvesikel auf seinem Weg zurWachstumsregion nicht frühzeitig mit an-deren Membranen verschmilzt. Membranre-zeptoren auf den Vesikeln, so die Arbeitshy-pothese der Wissenschaftler, wechselwirkendaher mit ihren Gegenstücken auf der Ziel-membran und ermöglichen auf diese Weiseeine kontrollierte Membranfusion. Der vonden Wissenschaftlern identifizierte Rezep-tor Yup 1 ist in der Membran der schnellbeweglichen Vesikel lokalisiert und ermög-licht ein bis dato unbekanntes Membran-recycling: Diese Vesikel, die man auch alsEndosomen bezeichnet, sammeln nämlichüber ihre „Yup-Kennung“ die nach innenwandernden Vesikel auf, um sie zur Wachs-tumsregion zu transportieren. Das bedeutet,dass Exo- und Endocytose, also der aus-wärts und der einwärts gerichtete Trans-portverkehr, über dieses Rezeptormolekülmiteinander gekoppelt sind. Für das Spit-zenwachstum, so die Erkenntnis der Max-Planck-Wissenschaftler, nutzt die Pilzzelleoffensichtlich nicht nur neu gebildete
Vesikel, sondern greift auch auf bereitsvorhandenes, recyclingfähiges Membran-material zurück. CHRISTINA BECK
Membranrecycling im Mikromaßstab
Wie Mohnkuchen sehen die scheibenförmig aufgeschnittenenMaistumore aus – sie enthalten massenhaft schwarze Pilzsporen.
oder eine Blüte eingedrungen, wach-sen die Pilzfäden schnell zu einemdichten Geflecht heran, das sich ausdem Pflanzengewebe mit Nährstof-fen und Wasser versorgt. Dieses Ge-flecht stellt die eigentliche pathoge-ne Form des Pilzes dar.
Da die Maispflanze die Nahrungs-zufuhr für den Pilz sicherstellt, kannUstilago kein Interesse daran haben,
seinen Wirt umzubringen. Statt-dessen scheint er, so vermuten die
Wissenschaftler, Hormonsignale der Pflanze nachzuahmen und löst auf diese Weise jene Gewebewucherun-gen aus, die beispielsweise einenMaiskolben auf das Vielfache seiner normalen Größe aufquellen lassen. Indiesem Stadium der Infektion hatsich der Pilz im Mais millionenfach
vermehrt. Doch nach wie vor habenalle Zellen zwei getrennte Zellkerne.Erst später verschmelzen die beidenKerne und vollenden so die Paarung.
Anschließend erfolgen Zellteilungen,die Fäden fragmentieren und aus denBruchstücken entstehen neue Sporen.Der Tumor seinerseits vertrocknetund zerfällt, die Pilzsporen könnenfreigesetzt und vom Wind auf den
F O T O S : W O L F G A N G F I L S E R
/ G E R O S T E I N B E R G

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 20/43
AEQUORIA
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 39
sein Verhalten ändert: Transportwegewerden quer durch die Zelle neu ver-
legt, Lasten von einem Ende ans an-dere verschoben. Auch das Auswach-sen des Pilzfadens auf der Oberflächeder Maispflanze basiert auf dem ge-richteten Transport von Organellenentlang des Zytoskeletts: An der Spitze des Pilzfadens kommt es, ähn-lich wie beim axonalen Wachstum
von Nervenzellen, zu einem Ver-schmelzen winziger Membranbläs-chen mit der eigentlichen Plasma-membran (siehe Kasten Seite 36).
STEUERUNG DES INTERNEN
SCHIENENVERKEHRS
Das gezielte Blockieren der Moto-ren führt daher nicht ganz unerwar-tet zum Verlust der Fähigkeit, eineMaispflanze zu infizieren. „Das zeigt,wie wichtig der molekulare Trans-port für die Funktion der Pilzzelleist“, sagt Steinberg. Solche Experi-mente sind es denn auch, die mögli-cherweise Ansätze für die Entwick-lung neuer Pflanzenschutzmittel lie-
fern. Wenn es gelingt, den Maschi-nenpark der Pilzzellen gezielt durcheinen Hemmstoff zu blockieren,könnte dies ein Weg sein, Pflanzen
vor einer Infektion zu schützen. „Dasist das spannende und unberechen-bare an Grundlagenforschung“, sagtKämper, „aus jeder Erkenntnis kanneine ganz praktische Anwendungentstehen.“ KLAUS KOCH
38 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
Engländer Andrew und Hugh Huxley in den fünfziger Jahren des vergan-genen Jahrhunderts nachweisenkonnten, dass im Muskel zwei Protei-ne für Bewegung sorgen – das eine,Myosin, ist der eigentliche Motor, dasandere, Aktin, bildet langgestreckteKetten, an denen sich Myosin ent-lang hangeln kann – haben die For-scher mittlerweile in vielen Organis-
men mehr als hundert verschiedenebiologische Motoren entdeckt. Sie al-le gehören drei Bautypen an: NebenMyosin sind Kinesin und Dynein imZellinneren unterwegs wie Lokomoti-
ven in einem Rangierbahnhof.„Ustilago verwendet dieselben
Bautypen,“ erklärt Steinberg. Er willherausfinden, welche Lasten die Mo-toren im Inneren der Zelle transpor-
tieren und welche biologischen Auf-gaben damit verknüpft sind. „Motor-proteine arbeiten quasi wie Lokomo-tiven – welche Last angekoppeltwird, kann von Zelle zu Zelle, aber eben auch von Situation zu Situationunterschiedlich sein“, sagt Steinberg.Erste Experimente zeigen, dass in je-der Phase im Lebenszyklus des Pilzesauch der wimmelnde Maschinenpark
HWER punkt
Pseudomonas syringae sollte eigentlich nicht besonders anspruchsvoll sein,was Temperaturen angeht. Das Bakterium lebt auf der Oberfläche von Pflan-zen und muss deshalb mit jedem Wetter zurechtkommen. Trotzdem hat derKeim, den Landwirte als Auslöser von Bakterienbrand fürchten, ein empfind-liches Gespür für Wärme: Bei hohen Temperaturen vermehrt sich das Bakte-rium, ohne den Pflanzen weiter zu schaden; wenn das Thermometer jedochunter 20 Grad Celsius fällt, zeigt Pseudomonas seinen wahren Charakter –es beginnt, die Pflanzen verstärkt zu infizieren (Abb. 1). Die Fachleute spre-chen deshalb auch von „Kaltwetter“-Bakteriosen. Bisher beschränkte sich dasWissen auf die phytopathologische Beschreibung dieses Phänomens.
Matthias Ullrich, bis August 2002 Leiter einer Selbständigen Nachwuchs-gruppe am Marburger Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologieund mittlerweile C4-Professor an der International University in Bremen,hat in den vergangenen Jahren die Regula-tionsmechanismen entschlüsselt, anhandderer Pseudomonas syringae Temperaturän-derungen erkennen kann. Diese Fähigkeitmacht für das Bakterium nämlich durchausSinn: „Wenn es kühler ist, etwa am Morgen,ist die Chance größer, dass die Pflanze miteinem Feuchtigkeitsfilm bedeckt ist, der esdem Keim erleichtert, eine Schwachstellezum Eindringen auf der Pflanzenoberflächezu finden“, sagt Ullrich.Einen deutlichen Einfluss hat die Temperaturauf die Bildung eines bakteriellen Giftstoffs:Coronatin (COR) wird von den Bakterien ingroßen Mengen nur freigesetzt, wenn eskühl wird (Abb. 2). Es löst dann in den ober-irdischen Pflanzenteilen eine Chlorose aus,erkennbar an den typischen braunen undgelben Flecken auf den Blattoberflächen(Abb. 3). Die Substanz ist ein Beispiel dafür,wie gut sich der Parasit an seinen Wirt an-gepasst hat: Sie ähnelt nämlich einem Hor-
mon aus dem pflanzlichen Stoffwechsel, dasdie Pflanzen zu ihrer Verteidigung benutzen, wenn sie die Infektion eines Pil-zes bemerken. „Vermutlich lockt Pseudomonas syringae die Pflanze mit derFreisetzung von Coronatin auf eine falsche Fährte“, sagt Ullrich. „Wenn sichdie Pflanze bei ihrer Abwehr auf einen vermeintlichen Pilz als Gegner kon-zentriert, fällt die Abwehr gegen die Bakterien entsprechend schwächer aus.“Dieser Temperatur-regulierte Virulenzfaktor COR hat die Forschergruppeschließlich auf die Spur eines neuartigen bakteriellen Thermometers ge-bracht. Die letzten Experimente fehlen noch. Doch nach dem, was Ullrichweiß, trägt Pseudomonas eine mehrfach gewundene Proteinschlange in sei-ner Zellhülle, von der je nach Temperatur mal eine Windung mehr, mal eineWindung weniger ins Innere der Zelle hineinragt. Das könnte der Schalterfür eine Signalkette sein, die das bakterielle Infektionsprogramm startet.
KLAUS KOCH
Ein Thermometer für Bakterien
Mithilfe eines Kreuzungstests können dieWissenschaftler feststellen, ob bestimmteUstilago-Stämme zusammen infektiös sind:Kompatible Stämme bilden auf Aktivkohleein weißes Filament, inkompatible Stämmeerscheinen eher durchsichtig. Nur die kom-patiblen Stämme sind in der Lage, wennsie gemischt werden, Pflanzen zu infizieren.
A B B . :
M A T T H I A S U L L R I C H
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 21/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 41
„Cinderella goes to Ball“, titel-te das renommierte Magazin
N ATURE im vergangenen Jahr. MitCinderella, also dem Aschenputtel,war die so genannte angeborene Im-munantwort gemeint: eine Entzün-dungsreaktion – die Wissenschaftler sprechen genauer von einer inflam-matorischen Reaktion –, durch die In-fektionen in ihrem Frühstadium kon-trolliert werden. Jeder hat sie vermut-lich schon einmal selbst erfahren. Sie
verursacht Rötungen und Schwellun-gen um eine infizierte Wunde herumsowie im fortgeschrittenen Stadium
Wundschmerz und Fieber. Mit derar-tigen Reaktionen soll die rasche Ver-breitung der Krankheitskeime im Kör-per gebremst werden. Lange Zeitwurde die angeborene Immunantwort
lediglich als evolutionärer Rück-schritt angesehen, nicht mehr als eine„quick-and-dirty“-Operation im Vor-feld der exquisiten und komplexenadaptiven Immunantwort. Diese ver-fügt über ein großes Repertoire anRezeptoren, wie Immunglobuline undT-Zell-Rezeptoren, die viele mikrobi-elle Antigene erkennen können. Während Untersuchungen zum
adaptiven Immunsystem die ganze Aufmerksamkeit und allen Glanz auf sich zogen, führten Forschungsarbei-ten auf dem Gebiet der angeborenenImmunantwort eher ein „Aschenput-tel-Dasein“. Der kleinen FruchtfliegeDrosophila – dem Modellorganismusschlechthin – ist es zu verdanken,dass das Aschenputtel nun endlichzum Ball darf.
40 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
HWER punkt
F O T O S : J A N E P A R K E R ,
M P I F Ü R Z Ü C H T U N G S F O R S C H U N G
PFLANZEN forschu
In der Abteilung vonDR. PAUL SCHULZE-LEFERT
amMAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR ZÜCHTUNGSFORSCHUNG in Köln stehen Fachbücher der Humanmedizin neben
solchen der Pflanzenbiochemie – und das hat seinen Grund: Denn in den vergan-
genen zehn Jahren sind Wissenschaftler auf immer mehr Gemeinsamkeiten bei den
zellulären Programmen in Pflanzen und Tieren gestoßen. Die Arbeitsgruppenleiter wie
DR. JANE PARKER und DR. RALPH PANSTRUGA haben sich darangemacht, die
Schlüsselprozesse pflanzlicher Immunität zu identifizieren. Ihre Ergebnisse erlauben
einen interessanten Brückenschlag von der „roten“ zur „grünen“ Biochemie.
Seit einigen Jahren beginnen dieForscher zu begreifen, dass die ange-borene Immunität durchaus ein sehr wirkungsvolles Instrument bei der Krankheitsabwehr ist. Bereits in denersten Stunden nach einer Infektionermöglicht sie es dem Organismus,zwischen vollkommen verschiedenenKlassen von pathogenen, also krank-heitserregenden, Bakterien, Virenund Pilzen zu unterscheiden. „Das istein ganz heißes Forschungsfeld“, zi-
tierte N ATURE einen namhaften ame-rikanischen Wissenschaftler. EineMolekülfamilie ist dabei besondersin den Fokus der Wissenschaftler gerückt – die so genannten Toll-like-Rezeptoren (TLR). Sie spielen beiSäugetieren eine zentrale Rolle beim
Auslösen der angeborenen Immun-antwort. (Der erste TLR wurde 1997an der amerikanischen Yale Univer-sity entdeckt.) Ihren Namen habendie TLR in Bezug auf einen nahe ver-wandten Rezeptor erhalten – eben
jenen Toll-Rezeptor, den die Forscher zum ersten Mal bei Drosophila iden-tifizierten.
Im Gegensatz zu Wirbeltieren be-sitzen Wirbellose kein adaptives Im-munsystem. Auf Pilzinfektionen rea-gieren sie mit der Aktivierung einesSignalwegs, der über den Toll-Rezep-tor läuft und die Produktion antimi-krobieller Verbindungen auslöst, diedem Eindringling wahrlich nichtschmecken. Das Immunsystem vonSäugetieren arbeitet etwas anders: Esproduziert zunächst Cytokine, diedann die beschriebenen Entzün-dungsreaktionen auslösen. Die Tatsa-che, dass TLR und Toll strukturell wiefunktionell sehr ähnlich sind, sprichtdafür, dass sie Teil eines sehr alten
Verteidigungsmechanismus sind, der im Lauf der Evolution ganz offen-sichtlich erhalten geblieben ist.
Nun haben nicht nur tierische,sondern auch pflanzliche Organis-
Die Infektion mit einem Pathogen löst eineResistenzantwort aus, die im Bild links zum program-mierten Zelltod führt; im Bild rechts konnte dasPathogen dagegen erfolgreich eindringen (zu erken-nen am dunkelblau angefärbten Infektionspfad).
ImmunsystemImmunsystembaut auf molekulareFertigteile

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 22/43
pelt werden. Die beiden Segmente ge-ben den Proteinen ihren Namen: NB-LRR-Proteine lautet die wissenschaft-liche Bezeichnung für diese Protein-klasse. Und auch für diese Segmenteder pflanzlichen R-Proteine gibt es
wiederum molekulare Verwandte imInneren tierischer Zellen: die so ge-nannten NOD-Proteine, die vermut-lich im Zusammenspiel mit den ander Zelloberfläche befindlichen Toll-Rezeptoren maßgeblich angeboreneImmunantworten kontrollieren.
R -GENE – DIE BASIS
PFLANZLICHER IMMUNITÄT
„Offensichtlich nutzt die Natur nach dem Prinzip eines Lego-Bau-kastens die gleichen molekularenBausteine in Pflanzen und Tieren,um Rezeptoren zu konstruieren, dieParasiten sowohl an der Zellober-fläche als auch im Zellinneren er-kennen“, sagt Paul Schulze-Lefert.
Während das menschliche Genommit ungefähr zehn NOD-Varianten
jedoch eher spärlich ausgestattet ist,gibt es in Pflanzen für die analoge
Gruppe der NB-LRR-Gene mehr als150 Varianten – ein deutlicher Hin-weis auf eine ausgefeiltere Rolle der Fremderkennung im Inneren pflanz-licher Zellen.
Das Augenmerk der Max-Planck-
Forscher richtet sich auf die zellin-ternen Signalketten. Gibt es auchhier Übereinstimmungen mit jenenSignalketten, die bei Säugetierenoder bei Drosophila geschaltet wer-den? Wie können Pflanzen eine sogroße Vielfalt molekularer Struktu-ren von Parasiten erkennen? In der Modellpflanze Arabidopsis sind rund100 R-Genorte, verteilt über alleChromosomen, bekannt – eine rechtgeringe Zahl verglichen mit der na-hezu astronomisch großen Zahlmöglicher Bindungspartner auf Sei-ten der Pathogene. Die Forscher spe-kulieren daher, ob R-Proteine mögli-cherweise verschiedene Avr-Proteineerkennen können. Fest steht, dass in-nerhalb einer Pflanzenart von einemGen verschiedene Allele (also leicht
veränderte Genkopien) existieren, diefür entsprechend geringfügig verän-
derte R-Proteine kodieren. Auch daswürde eine Anpassung an verschie-dene Avr-Proteine erlauben.
Ein mechanistisches Modell er-scheint den Forschern derzeit aller-dings besonders reizvoll: die so ge-
nannte „guard“-Hypothese (sieheSchemazeichnung). Danach könntenR-Proteine als molekulare Wächter eingebunden in größere Protein-Komplexe indirekt das Erkennen des
Avirulenzsignals sicherstellen. Der „Wächter“ löst dann eine zelluläreReaktionslawine aus, die eine Verän-derung des pH-Wertes in den extra-zellulären Zwischenräumen, die Akti-
vierung von Proteinkinasen und dieProduktion von Stickoxiden sowieanderen reaktiven Sauerstoff-Ver-bindungen einschließt. Diese zellu-läre Umprogrammierung scheint eineder wirksamsten Abwehrwaffen despflanzlichen Immunsystems zu seinund führt in vielen Fällen zum Selbst-mord der angegriffenen Zellen.
In den Kölner Labors trifft mannicht nur auf das Standardmodell Arabidopsis, auch Kulturpflanzen wiedie Gerste haben hier ihren Platz. DasSystem Mehltau/Gerste ist schließlicheines der am besten untersuchten Pa-thogen/Wirtssysteme – und das hatin erster Linie ökonomische Gründe:In Gebieten mit maritimen Klima wie
PFLANZEN forschu
42 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
men mit Krankheitserregern zukämpfen. Tatsächlich gibt es sogar
pathogene Mikroorganismen, wie dasBakterium Pseudomonas aeruginosa,die den Menschen ebenso befallenwie die in den Forschungslabors sobeliebte Modellpflanze Arabidopsis.Dieser „universelle“ Krankheitserre-ger kann sehr effektiv die Oberflächesowohl pflanzlicher als auch tieri-scher Zellen besiedeln und schaltetdabei die unterschiedlichsten Über-wachungsstrategien der jeweiligen
Wirtsorganismen aus. Während tieri-sche Organismen in der Regel über ein mit Körperflüssigkeit versehenesKreislaufsystem verfügen, in demwichtige, die Abwehr aktivierendeSignalmoleküle zirkulieren können,muss bei Pflanzen jede Zelle in der Lage sein, auf einen eindringendenKrankheitskeim zu reagieren.
VON DER „ROTEN“ZUR „GRÜNEN“ BIOCHEMIE
Die pflanzliche Abwehr basiertzunächst auf Reaktionen, die hoch-gradig lokal an der Infektionsstelleselbst ablaufen. Dazu gehört bei-spielsweise der Zelltod, das heißt, dieangegriffene Zelle startet ein Selbst-tötungsprogramm, um dem Schäd-ling auf diese Weise die Überlebens-grundlage – also den Nährstoffzu-gang – zu entziehen. Ausgehend vondiesem lokalen Infektionsort werdendann im weiteren Verlauf Prozesseaktiviert, die sich über die ganzePflanze ausbreiten und zu einer lang
anhaltenden und erhöhten Immu-nität gegen Folgeinfektionen führen.Pflanzen müssen also über mobileSignale verfügen, die in allen Zellendiese erworbene Immunität nach ei-ner Primärinfektion aktivieren.
Mit der „gene-for-gene“-Hypothe-se wurde bereits in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhun-derts eine Vorstellung entwickelt vonden grundsätzlichen Mechanismen,die dabei wirksam sind. Die Hypo-these besagt, dass es eine direkte
Wechselwirkung zwischen Genpro-dukten des pflanzlichen Wirtsorga-nismus und des Schädlings gebenmuss. Doch erst seit Beginn der neunziger Jahre kennen die Forscher tatsächlich die molekularen Baustei-ne der Pflanzenresistenz: Es sind sogenannte Resistenz-Gene, kurz R-Gene genannt. Sie erkennen patho-gene Organismen – allerdings nur dann, wenn diese ihrerseits über einspezifisches Avirulenz-Gen (avr -Gen) verfügen. Sind die korrespon-dierenden R- und avr -Gene in Wirtund Pathogen präsent, aktiviert diePflanze sehr wirksame Resistenz-reaktionen. Ist jedoch eins von bei-den Genen inaktiv oder fehlt sogar,dann kann der Schädling die Pflanzeinfizieren, und es kommt zum Aus-bruch der entsprechenden Pflanzen-krankheit. Diese von R-Genen ver-mittelte angeborene Immunantwortbei Pflanzen spielt für die Abwehr
von Schädlingen eine wichtige Rolle.Pflanzliche R-Gene haben – und
das ist besonders erstaunlich – dasPotenzial, Immunitätsreaktionen ge-gen tatsächlich alle wichtigen Patho-genklassen zu aktivieren. Das Spek-
trum reicht von Bakterien über Vi-ren, Pilze und Fadenwürmer bis hinzu Schadinsekten. Diese Parasitenwerden von der Pflanze unabhängigdavon erkannt, ob sie während ihresLebenszyklus in pflanzliche Zellen
eindringen oder nur die Zellober-fläche berühren. Weltweit haben die Forscher in
ihren Labors viele R-Gene in Kultur-und Modellpflanzen identifiziert. Er-staunlicherweise entsprechen diesenR-Genen nur fünf verschiedene Klas-sen von Proteinen, trotz der Breite anPathogenen und der Vielzahl von Ef-fektormolekülen (das sind von denPathogenen stammende Signalmo-leküle, die das entsprechende Infek-tionsprogramm starten). Die meistenR-Gene kodieren dabei für eine struk-turell besonders herausragende Pro-teinklasse – und an dieser Stellekommt wieder der Toll-Rezeptor vonDrosophila ins Spiel: Ein Segmentdieser Proteinklasse zeigt nämlich
verblüffende strukturelle Überein-stimmungen mit Toll. Darüber hinausbesitzen diese Proteine weitere funk-tionell wichtige Segmente wie eineNukleotidbindungsstelle (kurz NB) –in der Regel werden hier ATP- oder GTP-Moleküle gebunden – sowie eineRegion, in der besonders viele Bau-steine der Aminosäure Leucin anein-ander gereiht sind. Wissenschaftler bezeichnen solche Abschnitte in der
Aminosäurekette eines Proteins alsleucine rich repeat (kurz LRR). Insolchen Regionen finden bevorzugt
Wechselwirkungen mit anderen Pro-teinen statt. Auf diese Weise könnenexterne Signale an die entsprechen-den zellinternen Signalketten gekop-
HWER punkt
m Kölner Max-Planck-Institut für Züchtungsforschunght sich Planzenschale an Pflanzenschale. Im Mittelpunktbeiten von Jane Parker (rechtes Bild) steht – wie bei solen Pflanzenforschern – die Modellpflanze Arabidopsis.
Die „guard“-Hypothese: Trifft ein von einem Krankheits-erreger stammendes Virulenzsignal auf sein Zielmolekül ider Pflanzenzelle, so kommt es in der Regel zu einer Infetion (im Schema links). Um dies zu verhindern, sollten difür die Resistenzausprägung verantwortlichen R-Proteineihrerseits an das Zielmolekül binden. Diese Verknüpfungkann innerhalb eines Proteinkomplexes (im Schema rechoben) erfolgen oder aber erst, nachdem der Virulenzfaktan das Zielmolekül gebunden hat (im Schema unten rech
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 43
Im Labor ist Team-work angesagt:Michael Bartsch undShigeyuki Betsuyakubereiten Arabidopsis-Keimlinge (links)für einen Versuchs-ansatz vor.
F O T O S : C H R I S T I N A B E C K
A B B . :
J A N E P A R K E R

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 23/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 45
unerschwinglich für arme Länder, verursacht mit zunehmender Dauer zunehmend potenzielle ökologischeSchäden, und er ist auch nur von
vorübergehender Wirksamkeit. Gera-de der Mehltaupilz hat mit einer ver-
blüffenden Regelmäßigkeit Variantenerzeugt, die bisher noch jede neuentwickelte fungitoxische (für Pilzegiftige) Verbindung nach wenigenJahren wirkungslos gemacht hat –zum Leidwesen der Landwirte. DieEntwicklung dauerhaft resistenter Kultursorten ist daher ein wichti-ges langfristiges Züchtungsvorha-ben. Und hier treffen sich die Zieleder Grundlagenforschung und der praktischen Nutzanwendung.
Bei der Suche nach neuen undwirksamen Strategien zur Bekämp-fung von Pflanzenkrankheiten bie-ten R-Gene eventuell einen Ansatz-punkt. Vielleicht lassen sich neuarti-ge R-Gene konstruieren, die be-stimmte Pathogen-Verbindungen ins
Visier nehmen. „Allerdings könnenR-Gene nicht so einfach von einer Pflanzenart auf die andere übertra-gen werden“, sagt Jane Parker. ImGegensatz zu den stark konservier-ten Signalmolekülen, die weiter „stromabwärts“ in der Signalketteliegen, wie EDS1, RAR1 oder SGT1,sind die variablen Rezeptormolekülenämlich so ausgeklügelt in das Über-wachungssystem eingebunden, dassihre Übertragung in entfernter ver-wandte Pflanzenarten zum Funkti-onsverlust führt. Über die konser-
vierten Signalmoleküle ließen sichunter Umständen jedoch verschiede-ne Signalwege gezielt schalten. Auf diese Weise könnte man die Abwehr
gegen bestimmte Pathogene wie denMehltau verstärken, indem man dieBalance zwischen den verschiedenenSignalpfaden verschiebt. In der Ar-beitsgruppe von Jane Parker stehendeshalb diese pflanzlichen Schlüssel-
regulatoren im Zentrum des Interes-ses. Die Forscher möchten wissen,wie auf biochemischer Ebene die ausder Pathogen-Erkennung resultieren-den Signale umgewandelt werden,um das pflanzliche Abwehrsystem zuaktivieren (siehe Kasten).
SONDERWEGE
IM PFLANZENREICH
Wie viel „rote“ Biochemie stecktdenn nun eigentlich in den „grünen“Pflanzen? Oder gibt es biochemischeSonderwege? Ralph Panstruga undseine Mitarbeiter scheinen einemsolchen Sonderweg auf die Spur ge-kommen zu sein: Das Protein mitdem kryptischen Kürzel MLO spieltbei Mehltauinfektionen eine ent-scheidende Rolle. Obwohl die Funk-tion dieses Proteins noch nicht voll-ständig verstanden ist, könnte esdem Pilz als molekularer Anker undEingangstür in die pflanzliche Zellewährend der Pathogenese dienen.Entsprechend sind Gerstensorten miteinem Defekt im MLO-Gen dauerhaftwiderstandsfähig gegenüber allen
Varianten des Mehltaupilzes – siebilden ja entweder kein oder zumin-dest nur ein in seiner Funktion ge-störtes MLO-Protein aus.
Panstruga und seine Mitarbeiter haben sich die Wirkungsweise desProteins genauer angeschaut. Auf-grund struktureller Übereinstim-mung mit tierischen Hormonrezepto-
ren und der Tatsache, dass das Pro-tein wie diese in der Zellmembran
verankert ist, hatten die Wissen-
schaftler zunächst angenommen,dass MLO im Inneren der Pflanzen-zelle auch ähnliche biochemischeReaktionen auslöst. Genau das konn-ten sie aber bei ihren Experimentennicht bestätigen. Der herkömmlicheSignalweg über so genannte G-Pro-teine wird hier nicht eingeschlagen.Die Forscher entdeckten jedoch, dassstattdessen ein in Tieren und Pflan-zen konservierter Kalziumsensor, dasCalmodulin, entscheidend zur Funk-tion von MLO beiträgt.
Nachdem die Genome der bedeu-tenderen pflanzlichen und tierischenKrankheitserreger sequenziert sind,haben die Wissenschaftler damit be-gonnen, die molekulare Basis ihrer Pathogenität zu entschlüsseln (vgl.
Artikel auf Seite 32: „Ein Pilz tunneltdie Abwehr“). Umgekehrt sind auchdie Genome vieler tierischer wiepflanzlicher Modellorganismen mitt-lerweile bekannt. Das nährt die Hoff-nung, dass es in den kommendenJahren gelingen sollte, neue undwirksame Strategien bei der Bekämpfung von Krankheiten zuentwickeln – und zwar sowohl beiPflanzen als auch bei Tieren. Und
vielleicht schauen dann nicht nur diePflanzenforscher in die Fachbücher der Humanmedizin, sondern umge-kehrt auch Infektionsbiologen undHumanmediziner in das ein oder an-dere Fachbuch zur „grünen“ Bioche-mie. CHRISTINA BECK
PFLANZEN forschu
44 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
ter grau bestäubt erscheinen. Seit Be-ginn des vergangenen Jahrhundertskonnten mehr als 100 Allele zahlrei-cher Resistenzgene in diesem Systemidentifiziert werden.
Diese wurden im Zuge der Gerste-züchtung in mehr als 700 Sorteneingesetzt. Tatsächlich werden allediese Gene jedoch durch virulente
Arten von E. graminis innerhalb von vier bis fünf Jahren überwunden, so-bald die neuen Gerstesorten ingroßem Maßstab angebaut werden.Ursache ist vor allem, dass der Pilzsich sehr schnell anzupassen vermagund durch Mutation immer wieder neue Varianten entwickelt, die sichrasch in Europa verbreiten. Darüber hinaus sind Kulturpflanzen generell
sehr empfindlich. Züchtung zielt jadarauf ab, genau jenes Organ zu ma-ximieren, das dem Menschen alsNahrung dient. Dieser Züchtungser-folg hat jedoch seinen Preis – er geht
auf Kosten anderer, in den Wildfor-men ursprünglich vorhandener Ei-genschaften. Eine der wichtigstennatürlichen Eigenschaften ist dieKrankheitsresistenz. Ihr mehr oder weniger starker Verlust im Verlauf
der Züchtungsgeschichte wird heutein der Regel soweit wie möglichdurch chemischen Pflanzenschutzausgeglichen, der jedoch erheblicheNachteile haben kann: Er ist nahezu
HWER punkt
In tierischen wie pflanzlichenZellen geht es zu wie in einemStellwerk: Signalwege werdenaktiviert, indem Haltesignalevon „Stopp“ auf „Weiterfahrt“umgeschaltet werden. Unddurch geschickte Weichenstel-lung lässt sich auch die Ziel-richtung verändern oder den
jeweiligen Gegebenheitenanpassen. Erst ein solches„Stellwerk“ ermöglicht es einerPflanze, ihre zellulären Ant-worten auf die Vielfalt der
Signale abzustimmen, die aus der Umwelt auf sie eintreffen. DieseFähigkeit ist tatsächlich überlebensnotwendig. Denn die Pflanzemuss in der Lage sein, Abwehrmechanismen auf einen bestimmtenStress hin wirksam zu aktivieren, ohne dadurch in anderen Berei-chen verwundbar zu werden. Darüber hinaus muss sie ihre einmal
aktivierte Abwehrmaschinerie fein einstellen können, damit nichtzu viele Energiereserven verbraucht werden, die ansonstenin Wachstum und Reproduktion einfließen.Die Arbeitsgruppe von JaneParker hat Gene bei der Modell-pflanze Arabidopsis identifiziert,die die Bauanleitung für sogenannte „key regulators“, alsoSchlüsselregulatoren, tragen.Sie sind Bestandteil eines Netz-werks, über das die Resistenzgegenüber verschiedenen mikro-biellen Krankheitserregernkontrolliert wird.
Dabei ist die Resistenz in verschiedenen Arabidopsis-Ökotypendurch die An- oder Abwesenheit eines bestimmten R -Gens bereitsunterschiedlich ausgeprägt. So kommt es bei der Arabidopsis-Linieim Bild links oben nach Einimpfen von Peronospora parasitica zukeiner Infektion, während die Infektion im darunter abgebildetenÖkotyp erfolgreich verläuft. Die Untersuchung von Arabidopsis-Mutanten, die Defekte in einem oder mehreren Kontrollgenen tra-gen, hat den Max-Planck-Wissenschaftlern interessante Aufschlüs-se über die Signalhierarchien bei der Abwehr von Pathogenen gelie-fert. Vor allem zwei Kontrollelemente – die Forscher bezeichnensie als EDS1 und PAD4 – sind wichtig für die durch R -Gene vermit-telte Erkennung bestimmter Krankheitserreger und darüber hinausfür die Ausprägung einer grundlegenden Widerstandsfähigkeit,der Basalresistenz. Die Wissenschaftler möchten herausfinden,wie diese Lipase-ähnlichen Proteine auf molekularer Ebene arbei-ten, das heißt, mit welchen anderen Kontrollelementen sie inner-halb der Zelle wechselwirken. Eds1-Mutanten verfügen über keinegrundlegende Immunabwehr und sind deshalb hochgradig empfind-lich für Pilzinfektionen. Während Wildtyp-Pflanzen (unten links)
nur bedingt Pilzwachstum und Sporulation zulassen, zeigen dieBlätter immundefekter Pflanzen einen starken Pilzbefall (das Bild-paar zeigt Pilzstrukturen unter dem Mikroskop nach Anfärbung
mit einem Fluoreszenzfarbstoff). Ein Vergleich mit anderen Pflanzenspezies,insbesondere den Nutzpflanzen Gersteund Reis, lässt vermuten, dass die bio-chemischen Kontrollnetzwerke währendder Evolution über die Artgrenzen hin-weg erhalten geblieben sind und somitmögliche Ansatzpunkte darstellenkönnten, um die natürlicherweise vor-handene Krankheitsresistenz vonPflanzen zu verstärken. CHRISTINA BECK
Im Stellwerk der Pflanzenzelle
Nordeuropa, Japan und der mediter-ranen Küste ist der durch den PilzErysiphe graminis bei der Gerste aus-gelöste Mehltau eine überaus zerstö-rerische Blattkrankheit. Die Ernteaus-fälle können in Europa bis zu 20 Pro-zent, in Nordafrika sogar bis zu 30Prozent betragen. Die Verbreitungder Sporen dieser „Echten Mehltau-pilze“ (es gibt tatsächlich auch„Falsche Mehltaupilze“) erfolgt mitdem Wind. Kommen die Sporen auf ein Blatt zu liegen, so entwickelt sichdaraus in wenigen Tagen ein weißesPilzgeflecht auf der Blattoberseite.Die Pilzfäden bilden so genannteHaustorien, hoch spezialisierte Saug-fortsätze, die in die äußeren Zellendes Blatts eindringen und der Pflanze
Nährstoffe entnehmen. Dadurchwelkt das Blatt und fällt schließlichab. Die reichlich ausgebildeten Spo-renbehälter lassen die befalleneBlattoberfläche anfänglich weiß, spä-
Die mit Mehltau infizierten Arabidopsis-Kulturenwerden streng getrennt von den nicht-infiziertenKulturen herangezogen.
F O T O S : J A N E P A R K E R
F O T O S : C H R I S T I N A B E C K

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 24/43
METEOROLOGSZINATION Forschung
Rascher Rechnerrafft das KlimaMit einem am 10. September offiziell eingeweihten
neuen Supercomputer gehen Forscher am Hamburger
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR METEOROLOGIE demnächst
daran, das „System Erde“ nachzubauen. Dieses erweiterteModell soll sämtliche physikalischen und biogeochemischen
Prozesse in der Atmosphäre, im Ozean, in der kontinentalen
Biosphäre und in den Eismassen berücksichtigen.
F O R O : D K R Z
46 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
Im vergangenen Februar haben Mit-arbeiter der Firma NEC begonnen,den neuen Supercomputer zu instal-lieren. Dutzende Kilometer Kabelsind inzwischen verlegt, die erstenacht Rechnereinheiten („Rechenkno-ten“) vom Typ NEC SX6 mit je achtCPUs bereits in Betrieb. Im Vergleichzum alten System steht den Hambur-ger Klimaforschern damit schon jetztdie 40-fache Rechenleistung zur Ver-fügung. Im August 2002 folgtenweitere acht Knoten. Bis Sommer 2003 wird der Vollausbau – 24 Kno-ten – erfolgt sein. Insgesamt wird der Supercomputer dann mit maximal1,5 Teraflops hundert Mal mehr Re-chenleistung bieten als der bisher
verwendete vom Typ CRAY 90.„Als langfristiges Ziel wollen wir
damit ein umfassendes Erdsystem-Modell entwickeln“, sagt Guy Bras-seur. Ein solches Modell beschreibtsämtliche physikalischen und biogeo-chemischen Prozesse in der Atmo-sphäre, im Ozean, in der kontinen-
„Gemessen an der effektivenRechenleistung der Compu-
ter, die heute im Einsatz sind, habenwir in Hamburg bald den drittgröß-ten Rechner der Welt“, sagt Guy Brasseur, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Dort ist vor kurzem ein neuer Höchstleistungs-rechner in Betrieb gegangen ist, des-sen dritte Ausbaustufe im Frühjahr 2003 erreicht sein wird. Zwar mussBrasseur zugeben, dass bis zu diesemZeitpunkt auch andere Forscher-gruppen beim Wettlauf um Teraflopsund Pentabytes nachgerüstet habenwerden und der Hamburger Rechner dann wohl doch etwas weiter untenauf der weltweiten Hitliste der Super-computer landen wird. Aber dies tutder Aufbruchstimmung unter dendeutschen Klimaforschern keinen Ab-bruch. Sieben Jahre lang wartetendie Wissenschaftler darauf, dass ihrwichtigstes Arbeitsgerät– der Rechner am Deutschen Klimarechenzentrum(DKRZ) – zeitgemäß erneuert würde.
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 47
Blick in eines der vierroboterbetriebenenDatensilos des DKRZ:Jedes dieser Silos bietet6000 Stellplätze fürMagnetband-Kassetten,die jeweils bis zu 200Gigabytes fassen.

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 25/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 49
METEOROLOG
48 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
SZINATION Forschung
wird. Dies würde sicherlich auch daseuropäische Klima verändern.
Einen schwachen, aber durch Be-obachtungen nachgewiesenen Ein-fluss auf das Klima Europas habenEl-Niño-Ereignisse. Es handelt sichdabei um die stärksten natürlichenKlimaschwankungen auf Zeitskalen
von einigen Monaten bis zu mehre-ren Jahren. Sie haben ihren Ur-sprung im tropischen Pazifik, beein-flussen aber das Klima auf der ganzen Welt. Regionale Effekte kön-nen Wissenschaftler mit heutigen,weltweiten Klimamodellen allerdingsnur näherungsweise untersuchen.Denn für exakte Berechnungenbräuchten die Forscher auch in die-sem Fall höhere Auflösungen. Auch
hier mussten sich Latif und seineHamburger Kollegen deshalb in der
Vergangenheit damit begnügen, dieEffekte El Niños auf Europa mit ei-nem regionalen Modell zu berech-nen. „Dabei zeigte sich, dass sichcharakteristische Wetterphänomenein El-Niño-Jahren leicht verschie-ben“, sagt Mojib Latif. So ziehen vie-le Tiefdruckgebiete nicht wie meistüblich über Nordeuropa, sondernüber Südeuropa hinweg. In El-Niño-Jahren regnet es in England undSkandinavien demnach seltener, inden Mittelmeerländern dagegen häu-figer als in „normalen“ Jahren. Mitdem neuen Supercomputer wollendie Klimaforscher solche regionalenEffekte genauer untersuchen, indemsie den Einfluss El Niños mit hochauflösenden, weltweiten Modellenberechnen. Auf diese Weise wollensie auch die Wettervorhersage in El-Niño-Jahren verbessern. Außer höhere Auflösungen wird
der neue Supercomputer die Mög-lichkeit bieten, mehr Variable in dieSimulationen einzubeziehen. Bei-spielsweise wurde die Zusammenset-zung der Atmosphäre in Klimamo-dellen bisher nicht interaktiv berech-net, sondern vorgegeben. Die dazunotwendigen Daten stammten ausBeobachtungen oder wurden mithilfebiogeochemischer Modelle separatberechnet. Ohne Zweifel bestehen je-doch starke Wechselwirkungen etwa
zwischen der Biosphäre, der Atmo-sphäre und dem Klima, die bei dieser
Vorgehensweise nur unzureichendberücksichtigt werden. Gegenwärtignehmen Wissenschaftler beispiels-weise an, dass Pflanzen in einemwärmeren Klima mehr gasförmigeKohlenwasserstoffe produzieren. Diesführt unter anderem zu einer erhöh-ten Ozonbildung und damit zu einer größeren Schadstoffbelastung in denerdnahen Luftschichten. Wird dasbodennahe Ozon dann in höhereSchichten transportiert, agiert es alsklimawirksames Treibhausgas. Ande-rerseits hat dies Rückwirkungen auf die Menge und die Zusammenset-zung der Kohlenwasserstoff-Emis-sionen der Pflanzen. Und wie beein-
flusst dies wiederum das Klima?
MOZART AUF DER SPUR
VON SPURENGASEN
Um solche Fragen eindeutig beant-worten zu können, müssen die Exper-ten so genannte Chemietransportmo-delle an globale Klimamodelle kop-peln. Die Hamburger Max-Planck-Forscher sind beispielsweise an der Entwicklung von MOZART beteiligt,dem „Model of Ozone and RelatedTracers“. Es beschreibt die Emission
von Spurengasen auf der Erde, derenchemische Umwandlung sowie Abla-gerungs-, Auswaschungs- und Trans-portprozesse. Typischerweise rechnetMOZART mit 50 bis 100 chemischenKomponenten, die etwa 200 verschie-dene Reaktionen miteinander einge-hen können. Die räumliche Auflö-sung beträgt in der Horizontalenrund 200 Kilometer, in der Vertikalengibt es 30 bis 90 Schichten mitHöhen von 30 bis 250 Kilometern.Dies bedeutet, dass MOZART die At-mosphäre mit bis zu einer halbenMillion Gitterpunkten darstellt.
Bei Zeitschritten von 10 bis 30 Mi-nuten muss ein Computer zur Simu-lation eines Jahres deshalb bis zufünf Billionen chemische Gleichun-gen lösen; dazu kommt die Berech-nung des Transports der einzelnenStoffe und der physikalischen Pro-zesse in der Atmosphäre. SinnvolleKlimaberechnungen beleuchten je-
doch häufig mehrere Jahrzehnteoder Jahrhunderte. Deshalb sind dieHamburger Forscher auch bei der Kopplung von MOZART an ein Kli-mamodell auf den neuen Höchstleis-tungsrechner angewiesen.
Auch Erich Roeckner hat Pläne für die Nutzung des neuen Supercompu-ters. Er erforscht unter anderem, wie
Aerosole das Klima beeinflussen.Diese mikroskopisch kleinen Teil-chen bestehen aus einer stabilenSuspension fester oder flüssiger Par-tikel in Luft. Sie können Strahlungabsorbieren, emittieren und streuenund dienen als Reaktionsmedium, indem sich wichtige Prozesse der At-mosphärenchemie abspielen. Viele
Aerosole, zum Beispiel sulfathaltige,die unter anderem bei der Verbren-nung von Kohle entstehen, reflektie-ren das Sonnenlicht, begünstigen die
Wolkenbildung und verringern damitdie Temperatur der Atmosphäre und
Latif. Er und seine Kollegen wissenseit langem, dass der Ozean einenwesentlichen Einfluss auf das Klimahat. Vor etwa zehn Jahren begannensie deshalb, Modelle des Ozeans mitdenen der Atmosphäre zu koppeln.Dabei stießen sie allerdings stets auf das Problem, dass die Klimaprogno-sen für die ersten zehn bis zwanzigJahre unrealistisch waren – Exper-ten sprechen hier von einer Klima-drift. Um dieses zu verhindern, bau-en sie so genannte Flusskorrekturenins gekoppelte System ein. Dies sindzeitlich konstante Größen, die den„Arbeitspunkt“ des gekoppelten Mo-dells stabilisieren, die Dynamik desSystems aber nicht verändern. Einer der Gründe für die Klimadrift ist die
schlechte Darstellung der ozeani-schen Zirkulation in den grob auflö-senden Modellen. „Betrachtet manbeispielsweise Satellitenbilder desGolfstroms, sieht man Wirbel, diesich nur über wenige Kilometer er-strecken“, sagt Latif. Bei einer Auf-lösung im Hundert-Kilometer-Be-reich „fallen“ diese Feinheiten quasidurch die Gittermaschen und blei-ben deshalb weitgehend unberück-sichtigt. Um sie angemessen simu-lieren zu können, bräuchten die
Wissenschaftler Modelle mit einer horizontalen Auflösung von ein biszwei Kilometern.
Dies wird auch der neue Hambur-ger Supercomputer nicht leisten.„Aber wir werden damit immerhinauf eine Auflösung von rund 50 Kilo-metern kommen und auf die Fluss-korrektur verzichten können“, soMojib Latif. Vorab haben er und seineKollegen ein regionales Modell für den Atlantik berechnet. „Bei einer
Auflösung von etwa 20 Kilometernentstanden dabei tatsächlich Tempe-ratur- und Strömungsstrukturen wiebeim Golfstrom.“ Mit hoch auflösen-den Ozean-Atmosphäre-Modellenwollen die Hamburger Wissenschaft-ler Langzeitberechnungen anstellen,die unter anderem klären sollen, ob –wie von einigen Forschern vorherge-sagt – der Golfstrom bei der zu er-wartenden Erhöhung der globalenDurchschnittstemperaturen abreißen
talen Biosphäre und in den Eismas-sen, die die Erde bedecken. Zusätzlichberücksichtigt es alle Wechselwirkun-gen und Austauschprozesse zwischendiesen einzelnen Komponenten – wieden Austausch von Energie und Was-ser, aber auch den von Kohlenstoff,Stickstoff oder Schwefel. Und letzt-lich soll ein Erdsystem-Modell auchdie Aktivitäten des Menschen erfas-sen und Aussagen darüber treffen,wie der Mensch die Umwelt und das
Weltklima beeinflusst. Bisher könnenForscher solche Fragen nur annähe-rungsweise beantworten. Denn esgibt weltweit keinen einzigen Com-puter, der so leistungsfähig wäre, dasser das komplexe System Erde rea-litätsgetreu modellieren könnte. Wis-
senschaftler mussten sich deshalb inder Vergangenheit stets auf Teilberei-che beschränken.
Mit dem neuen Supercomputer wollen die deutschen Klimaforscher bei der Modellierung des Gesamtsys-tems Erde wesentliche Fortschritteerzielen. Eine Alternative zur Arbeitam Computer gibt es für sie nicht.„Wir können die Erde nicht in einReagenzglas stopfen und damit Ver-suche machen“, sagt Mojib Latif,Forschungsgruppenleiter am Ham-burger Max-Planck-Institut für Me-
teorologie. „Deshalb müssen wir per Rechner ein möglichst genaues Ab-bild der Wirklichkeit schaffen.“ Ähnlich wie ein Chemiker im La-
bor testet, wie sich beispielsweise dieGeschwindigkeit einer Reaktion un-ter verschiedenen Bedingungen än-dert, ermitteln Klimaforscher amComputer, was geschieht, wenn etwadie Kohlendioxidkonzentration inder Atmosphäre steigt. Modelle, diesie dazu verwenden, durchziehendie Erdatmosphäre mit einem drei-dimensionalen Gitter.
HUNDERT TAGE RECHNEN
FÜR HUNDERT JAHRE
Typische Gitterabstände betragenrund 300 Kilometer in der Horizon-
talen und einen Kilometer in der Vertikalen. Für jeden der dadurchentstehenden „Räume“ berechnet der Computer ein lokales Klima. Trotzdes relativ groben Rasters benötigtendie Forscher mit ihrem alten Rechner rund hundert Tage, um das Klima für hundert Jahre zu simulieren. Der neue Supercomputer wird die Re-chenzeiten wesentlich verkürzen. Alternativ können die Forscher
Klimamodelle mit einer höherenräumlichen Auflösung verwenden.„Dadurch werden zum Beispiel ge-koppelte Ozean-Atmosphäre-Model-le wesentlich realistischer“, betont
Simulation des Golfstroms mit einem hochauflösenden Ozeanmodell: Warmes Wasser ist rot,kaltes ist blau dargestellt; die Pfeile gebenRichtung und Geschwindigkeit der Strömung an.
ebruar begannen die Arbeiten zur InstallationNEC SX-6-Höchstleistungsrechners am DKRZ.
F O T O : D K R Z
G R A F I K : M P I F Ü R M E T E O R O L O G I E - R E I M E R

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 26/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 51
dagegen wesentlich träger. Bei Oze-anmodellen verwenden die Forscher deshalb in der Regel Auflösungen
von einem Tag an der Oberfläche biszu einem Monat im tiefen Ozean.Bei der Modellierung der riesigenEisschilde und der marinen Sedimen-te kommen sie mit Jahren bis Jahr-zehnten aus, denn das Systembraucht mehrere zehn- bis hundert-tausend Jahre, um sich auf eineStörung einzustellen. „Aufgrund die-ser verschiedenen Zeitskalen müssenfür die Kopplung der einzelnen Mo-delle spezielle mathematische Verfah-ren verwendet werden“, so Mikolaje-wicz. „Mit dem neuen Computersys-tem wollen wir dann ein Erdsystem-Modell entwickeln, das nur von ei-
nem einzigen externen Parameter an-getrieben wird, nämlich von der sich
verändernden Sonneneinstrahlung.“
ERST DIE VERGANGENHEIT,DANN DIE ZUKUNFT
Der Ozeanograph interessiert sichdabei vor allem für Klimaphänome-ne, die weit in der Vergangenheit lie-gen: „Wir wollen mit dem gekoppel-ten Modell den Übergang zwischender letzten Eiszeit und der Warmzeitsimulieren.“ Einerseits wollen dieForscher damit wesentlich detaillier-ter als bisher untersuchen, was da-mals auf der Erde geschah. Anderer-seits dienen solche extremen Klima-schwankungen auch als Prüfstein für ihre Modelle. „Wenn ein Klimamo-dell Ereignisse aus der Vergangen-heit korrekt reproduziert, haben wir keinen Grund, daran zu zweifeln,dass unsere Vorhersagen für die Zu-kunft richtig sind“, betont MojibLatif. Auch Erich Roeckner wehrtsich gegen die Behauptung von Kri-tikern, Klimaprognosen seien grund-sätzlich ungenau. „Die mathemati-schen Gleichungen, die wir für einphysikalisches Klimamodell heran-ziehen, haben wir nicht für unsereZwecke erfunden – sie sind seitNewtons Zeiten bekannt.“ Dennochgibt er zu, dass die Berücksichtigunggerade vieler biologischer Prozesseschwierig ist: „Wie lassen Sie bei-spielsweise im Modell einen Baum
wachsen?“ Außerdem reagieren Mo-delle häufig empfindlich auf kleineStörungen der Anfangswerte. Auchdamit begründen Kritiker ihre Zwei-fel an der Glaubwürdigkeit der Si-mulationen. Mit dem neuen Compu-ter wollen die Klimaforscher deshalbso genannte Ensemble-Rechnungenanstellen. Die Modellrechnungenwerden dazu viele Male wiederholt –
jeweils mit leichten Variationen, dieletztlich statistische Aussagen über die Güte der Ergebnisse liefern.
Dass die deutschen Klimaforscher jahrelang auf den neuen Supercom-puter warten mussten, liegt vor al-lem an dessen Kosten. Finanziertwird die gut 34 Millionen Euro teure
Anschaffung jetzt vom Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung;die Betriebskosten teilen sich die Ge-sellschafter des Deutschen Klima-rechenzentrums (DKRZ). Dies sindneben der Max-Planck-Gesellschaftdie Universität Hamburg, das Alfred-
Wegener-Institut für Polar- undMeeresforschung in Bremerhavenund das Forschungszentrum Geest-hacht (GKSS). Von der gesamten Re-chenzeit wird den Mitarbeitern desHamburger Max-Planck-Instituts für Meteorologie ein Viertel zur Verfü-gung stehen. Die mit den Modellenproduzierten Daten landen in einem
Archivspeicher, der aus einem robo-tergestützten Online-Bandlager be-steht, das maximal fünf Pentabytefassen kann – das sind immerhinfünf Millionen Gigabyte.
„Der neue Rechner wird in einemMonat so viele Daten produzieren
wie der alte während seiner gesam-ten Betriebsdauer von sieben Jah-ren“, sagt Joachim Biercamp vom
Deutschen Klimarechenzentrum. Er organisiert gemeinsam mit seinenKollegen die Installation und denBetrieb des neuen Supercomputers.Eine von Biercamps Hauptaufgabenwird es dabei wohl sein, die Wissen-schaftler zu absoluter Disziplin zuermahnen. Denn durch ineffektiveProgrammierung würde ein Großteilder Rechenleistung des neuen Super-computers verschwendet. Und Er-gebnisse, die nicht absolut vor-schriftsgemäß in der neuen Daten-bank abgelegt werden, drohen in der riesigen Datenflut schnell unterzuge-hen. UTE HÄNSLER
METEOROLOG
50 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
der Erdoberfläche. Rußhaltige Aero-sole dagegen erwärmen die Atmo-sphäre und kühlen die Erdoberfläche.
Dadurch verringern sich die Ver-dunstungs- und Niederschlagsmen-gen. „Mit dem neuen Hochleistungs-rechner wollen wir diese Prozessegenauer untersuchen, indem wir einrelativ aufwändiges Aerosolmodellmit einem Klimamodell koppeln“,sagt Roeckner. Bisher wurden ver-einfachte Modelle mit maximal fünf Komponenten verwendet. In Zukunftsollen nicht nur verschiedene Aero-soltypen, sondern auch Größenklas-sen und Teilchenzahlen berücksich-tigt werden, sodass die Gesamtzahlder Komponenten auf 25 steigenwird. Roeckner: „Die meiste Rechen-zeit werden wir dabei für Transport-prozesse brauchen, die chemischenUmwandlungen lassen sich ver-gleichsweise schnell simulieren.“
Die Hamburger Forscher wollenmithilfe des neuen Supercomputersnoch einen weiteren wichtigen Teilder Biogeochemie der Erde an ihreKlimamodelle koppeln: den Kohlen-stoff- oder C-Kreislauf. „Kopplungheißt in diesem Fall, dass sich die
Vegetation bei einer Klimasimulationin Abhängigkeit vieler Umweltpara-meter entwickelt und nicht mehr –wie bisher – als Konstante vorgege-ben wird“, sagt Erich Roeckner. Aber auch der Ozean spielt beim C-Kreis-lauf eine wichtige Rolle. Denn er kann Kohlendioxid aufnehmen oder abgeben, beispielsweise je nach Tem-peratur oder Strömungsverhältnissen.
In der Vergangenheitgab es bereits erste Ver-suche, den C-Kreislauf mit Klimamodellen zukoppeln. So stelltenfranzösische Forscher einen Vergleich an zwi-schen Klimasimulatio-nen mit vorgegebenenKohlendioxid-Konzen-trationen und solchenmit gekoppelten Model-len. Sie fanden dabeikeine fundamentalenUnterschiede.
Zu einem ganz ande-ren Ergebnis kamen englische Wis-senschaftler. Mit gekoppelten Model-len errechneten sie deutlich höhere
Kohlendioxidwerte. Denn sie beob-achteten positive Rückkopplungsef-fekte, die in Zukunft vor allem dazuführen sollen, dass der Regenwaldimmer weniger Kohlendioxid aufneh-men wird. Während die Landober-fläche – also der Erdboden und die
Vegetation – heute noch mehr Koh-lenstoff aufnimmt als sie abgibt, wä-re dies laut englischer Berechnungen
vom Jahr 2050 an umgekehrt. „An-gesichts der Diskussionen um denanthropogenen Treibhauseffekt istdies ein hoch brisantes Ergebnis“, be-tont Roeckner. „Mit dem neuen Com-putersystem wollen wir dazu beitra-gen, den Widerspruch zwischen denfranzösischen und englischen Be-rechnungen zu klären.“ Die Hambur-ger Forscher wollen dazu auch neueModelle für den C-Kreislauf ent-wickeln, indem sie zum Beispiel dieRolle des Ozeans genauer beleuchten.„Es gibt hier keinen Königsweg“, be-tont Roeckner, „aber wir werden um-so genauere Ergebnisse erzielen, jemehr Prozesse wir in die Berechnun-gen einbeziehen.“
Mit der Wechselwirkung zwischenatmosphärischer Chemie und demKlima beschäftigt sich auch MartinSchultz. Er untersucht vor allem dieBiomasseverbrennung. „Die Verbren-nung von Pflanzenmaterial sorgt für einen erheblichen Anteil der welt-weiten Luftverschmutzung und be-einflusst deshalb direkt und indirekt
unser Klima“, sagt der Hamburger Max-Planck-Forscher. „Außerdemändert sich dadurch die Zusammen-setzung der bestehenden Vegetation– und dies hat natürlich Rückwir-kungen auf den Kohlenstoffkreislauf und das Klima.“
Schultz und seine Kollegen wollendeshalb unter anderem ein Vegetati-onsmodell, das am Max-Planck-In-stitut für Biogeochemie in Jena ent-wickelt wurde, an ein physikalischesKlimamodell koppeln und damit Spu-rengas-Emissionen berechnen. Dazumüssen sie zunächst grundlegendeFragen beantworten – zum Beispiel,wie viel brennbare Materie es in den
verschiedenen Ökosystemen auf der Welt gibt, unter welchen Bedingun-
gen wie viel davon brennt, und wel-che Spurengase und Aerosole dabeientstehen. Eine große Hilfe sind Da-ten, die zum Beispiel die Sensorendes neuen Satelliten Envisat liefern.Maßgebliche Unterstützung bei derenmathematischer Interpretation erhal-ten die Klimaforscher von dem Feu-erökologen Johann Georg Goldam-mer vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. „Mit dem neuenHochleistungscomputer werden wir einzelne Prozesse viel genauer alsbisher simulieren können“, sagtSchultz. Ziel ist es, die Emissionenaus der Biomassenverbrennung für beliebige Klimaszenarien vorhersa-gen zu können. Auch dies soll letzt-lich zur Entwicklung eines umfassen-den Erdsystem-Modells beitragen.
JEDES TEILSYSTEM
HAT „SEINE“ ZEIT
„Ein wesentliches Problem stellendabei allerdings die unterschiedli-chen Zeitskalen der Teilsysteme dar,die zu dem Erdsystem-Modell gekop-pelt werden sollen“, erklärt Uwe Mi-kolajewicz, ebenfalls Mitarbeiter amHamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie. So verändern sich bei-spielsweise chemische und physikali-sche Prozesse in der Atmosphäre ver-gleichsweise schnell; Atmosphären-modelle arbeiten deshalb stets mit ei-ner zeitlichen Auflösung von unter einer Stunde. Der Ozean verhält sich
SZINATION Forschung
Die photochemische Bildung von Ozon infolge der Vege-tationsbrände um Sydney zur Jahreswende 2001/2002:Die Visualisation des Chemie-Transport-Modells MOZART-2gibt höhere O3-Pegel in Rot, niedrigere in Blau wieder.
Die einzelnen Komponenten des Klimas verändernund beeinflussen sich wechselseitig innerhalb sehrunterschiedlicher Zeitskalen.
Mittels so genannter Ensemble-Vorhersagen –mehrerer Simulationen unter jeweils leicht verändertenAnfangszuständen – lassen sich Prognosen deutlichverbessern: Das zeigen diese Berechnungen zur Abweichder Oberflächentemperatur des tropischen Pazifiksvom Mittelwert während eines El-Niño-Jahres.
G R A F I K E N : M P I F Ü R M E T E O R O L O G I E
/ D K R Z

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 27/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 53
NEUROPSYCHOLOGISCHE Forschu
52 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
SSEN aus erster Hand
Wie Sprache auf die Nerven geht„Sie ist ziemlich alt und hat verschiedene Formen; sie kann zärtlich sein und
auch ärgerlich, sanft und brutal; sie kann die Liebe erklären, aber auch den Krieg.
Wir alle kennen sie – und doch irgendwie nicht so richtig. Wir begegnen ihr
täglich – und doch: Müssten wir sie beschreiben, täten w ir uns schwer. Sie kommt
zu uns und wird ein Teil von uns – und doch wissen wir nicht wie.“ Mit diesem
Rätsel, es meint die Sprache, leitete PROF. ANGELA FRIEDERICI, Direktorin am
Leipziger MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR NEUROPSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG,ihren öffentlichen Vortrag im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung
der Max-Planck-Gesellschaft in Halle ein. Lesen Sie im Folgenden, was man heute
über die neuronalen Hintergründe des Sprachverstehens weiß.
Die Sprache hat Philosophen und andere Denker be-schäftigt. Doch der Naturwissenschaft schien sie
nicht zugänglich – bis vor ungefähr 140 Jahren Paul Bro-ca, ein französischer Neurologe und Anthropologe, denersten Nachweis dafür erbrachte, dass Sprache wie andereFormen des Geistes an Materie gebunden ist. Broca be-
richtete über einen Patienten, der keine Sprache mehr produzieren konnte, außer einer einzigen Silbe: „tan“.Dieser Patient war sehr wohl in der Lage, einfache Fragenzu verstehen, und er signalisierte das mit jeweils bejahen-den oder verneinenden Betonungen von „tan“.
Zwei Jahre später starb dieser Patient. Die Autopsie er-gab eine Läsion des Gehirngewebes in der linken Hemi-sphäre – und zwar am Fuß der dritten Stirnhirnwindung.Der Zufall wollte es, dass das Originalgehirn des Patientenhundert Jahre später in einem Anatomie-Institut in Pariswiederentdeckt wurde. Das Gehirn zeigt die beschriebeneLäsion in der dritten Stirnhirnwindung (Abb. 1 a). Interes-santerweise hatte Broca das Gehirn in seiner Gänze erhal-ten und es nicht wie sonst üblich zur genaueren Untersu-chung seziert – als hätte er geahnt, dass mehr als hundertJahre später eine Methode entwickelt würde, die es er-laubt, das Gehirn in seiner inneren Struktur zu betrachten,ohne es zu zerteilen: die Computertomographie. Sie zeigteine große Schädigung des Gehirns im vorderen Teil der linken Hemisphäre; der Defekt ist weit größer, als man vonder Außenbetrachtung annehmen würde (Abb. 1 b).
Die ursprüngliche Außensicht auf die Hirnläsion veran-lasste Paul Broca, im unteren Teil der dritten Stirnhirnwin-dung den Sitz der Sprachproduktion zu sehen; noch heutebezeichnet man dieses Gebiet in der linken Hirnhälfte alsBroca-Areal. Einige Jahre später, 1874, beschrieb der Bres-lauer Neurologe Carl Wernicke eine Reihe von Patienten,die Sprache wohl produzieren, aber nicht verstehen konn-ten. Diese Patienten wiesen Läsionen in der oberen Win-dung des Temporallappens auf. Fortan galt diese Hirnregi-on als die Region des Sprachverstehens. Diese Aufteilungentsprach lange Zeit dem Stand des Wissens (Abb. 2).
Heute jedoch können wir die neuronalen Grundlagender Sprache genauer spezifizieren. Dazu haben drei Fak-toren beigetragen: Da ist zunächst die grundlegendeTheoriebildung bei Sprache und Sprachverarbeitung; die-se Theorien beschreiben zum Teil sehr genau, was wir un- F
O T O : W O L F G A N G F I L S E R
/ A B B . :
M P I F Ü R N E U R O P S Y C H O L O G I S C H E F O R S C H N U N G tersuchen wollen – nämlich die Sprache und deren ein-
zelne Komponenten. Zweitens haben sich so genanntebildgebende Verfahren rasant entwickelt; mit ihnen lässtsich die Hirnaktivität während einer kognitiven Aufgabedarstellen – und zwar sowohl hinsichtlich der Frage, wel-che Hirnareale während einer mentalen Tätigkeit aktiv sind, als auch bezüglich der Frage, wie die verschiedenenHirnareale in der Zeit zusammenarbeiten. Der dritte und
vielleicht wichtigste Faktor jedoch heißt Interdisziplina-rität: Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen – denGeisteswissenschaften und den Naturwissenschaften – ar-beiten eng zusammen, um der Natur des Geistes und der Natur der Sprache auf die Spur zu kommen. Von diesem
Abenteuer soll hier berichtet werden.
Abb. 1a Abb. 1b
Abb. 2

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 28/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 55
NEUROPSYCHOLOGISCHE Forschu
54 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
SSEN aus erster Hand
Einige werden fragen: Kann man denn das, was wir un-ter Sprache verstehen und was vielleicht eher Assoziatio-nen wie „Goethe“ oder „Schiller“ hervorruft, mit natur-wissenschaftlichen Methoden untersuchen? Man kann –nämlich dann, wenn man nicht Gedichte interpretierenwill, sondern die biologischen Grundlagen der menschli-chen Fähigkeit, Sprache zu verstehen, untersucht.
Was sind nun die Prozesse, die beim Hören und Verste-hen von Sprache ablaufen, vom akustischen Input bis zudem Moment, in dem eine Interpretation für das Gesagtegefunden wurde? Ein Schema dieser Abläufe zeigt Abbil-dung 3. Zunächst muss das System eine akustisch-phone-tische Analyse des Gesagten vornehmen. Dann werdenweitere Informationen herausgefiltert, und zwar auf zwei
Wegen: Innerhalb eines Verarbeitungspfades erfolgtzunächst der Zugriff auf Wortkategorie und Erstellungder syntaktischen (grammatischen) Struktur, dann erstder Zugriff auf die Semantik (Bedeutung). In der Phasedes semantischen Zugriffs werden thematische Rollen
vergeben: Es wird festgelegt „wer tut was wem“. Danachwird das Gesagte interpretiert.
Neben der syntaktischen und der semantischen Informa-tion enthält gesprochene Sprache aber auch noch prosodi-sche Information: Information also über den Tonhöhen-
verlauf. Der Volksmund nennt das „Satzmelodie“. Diesewird in einem zweiten Pfad verarbeitet. Prosodie kann
Diese Daten belegen, dass verschiedene Anteile des Gy-rus temporalis superior spezifisch und abhängig von syn-taktischen und semantischen Prozessen aktiviert werden.Der vordere Anteil des Gyrus ist vor allem bei der Verar-beitung syntaktischer Aspekte aktiv, der mittlere Anteilhingegen bei der Verarbeitung semantischer. Der hintere
Anteil des Gyrus scheint bei beiden Prozessen gleicher-maßen aktiviert zu werden, spielt also bei der Integration
von Semantik und Syntax eine Rolle.Syntaktische und semantische Bedingungen unterschei-
den sich darüber hinaus in der Aktivierung frontaler Area-le. Die syntaktische „Verletzungsbedingung“ aktiviert imGegensatz zur semantischen zusätzlich das frontale linkeOperculum, das nahe dem Broca-Areal liegt. Diese und ei-ne Reihe ähnlicher Untersuchungen im fMRT zeigen, dassdie verschiedenen Prozesse – primär auditorische, syntak-tische oder semantische – von unterschiedlichen Hirnarea-
len unterstützt werden. Interessant ist, dass nicht jeweilsnur ein Areal für semantische oder syntaktische Prozessezuständig ist, sondern ein Prozess jeweils gleichzeitig ein
Areal im Temporal- und im Frontallappen aktiviert, diebeide ein spezifisches Mini-Netzwerk bilden. Klar zu un-terscheiden sind in der linken Hemisphäre das Netzwerk für syntaktische Prozesse (in Abb. 6 rot markiert) und für semantische Prozesse (orange). Die frontalen Anteile desMini-Netzwerks werden häufig erst dann deutlich aktiv,wenn semantische und syntaktische Prozesse einen höhe-ren Aufwand erfordern, das heißt, wenn die Sätze komple-xer sind als im geschilderten Experiment.
Damit kennt man jene Hirnareale, in denen die Verar-beitung von syntaktischen und semantischen Merkmalenabläuft. Was aber sind die zeitlichen Parameter? Wirdsyntaktische Information – wie das Modell sagt – in der Tat vor der semantischen Information verarbeitet? Zur Klärung dieser Frage benutzen wir das Verfahren der er-eigniskorrelierten Hirnpotenziale (EKP); es erlaubt einezeitliche Auflösung im Millisekundenbereich. Da aus demfortlaufenden EEG (Abb. 7 oben) wegen der relativ gro-ßen Hintergrundaktivität des Gehirns bei Präsentationeinzelner Stimuli (hier mit „S“ bezeichnet) nur wenig spe-zifische Hirnaktivität zu erkennen ist, wird die Gehirnak-tivität in Bezug auf eine Reihe von Stimuli einer be-stimmten Klasse gemittelt. Diese Mittelung liefert eine in-terpretierbare Gehirnkurve – das ereigniskorrelierte Hirn-potenzial (Abb. 7 unten).
Das verwendete Stimulusmaterial im EKP-Experimentwar identisch mit jenem im vorhin beschriebenen Experi-ment: Es umfasste korrekte, semantisch inkorrekte undsyntaktisch inkorrekte Sätze. Die Hirnantworten auf se-mantisch und auf syntaktisch fehlerhafte Satzbedingun-gen unterscheiden sich deutlich. Die Hirnantwort auf dasletzte Wort im semantisch fehlerhaften Satz ist für eineElektrode („Cz“) in der oberen Hälfte von Abbildung 8dargestellt. Die durchgezogene Linie zeigt die korrekte
Bedingung, die gepunktete die inkorrekte. Beide Kurvenlaufen bei ungefähr 400 Millisekunden auseinander undkommen bei etwa 700 Millisekunden wieder zusammen.Diese negative Komponente wird gemäß ihres zeitlichen
Auftretens N400 genannt. Das Gehirn reagiert also auf den semantischen Fehler im Satz.
Der untere Teil von Abbildung 8 zeigt die Differenzzwischen der korrekten und der semantisch inkorrektenBedingung in ihrer Topographie, gemessen an den über die Kopfoberfläche verteilten Elektroden. Negativität ist
ebenfalls die Struktur eines Satzes signalisieren. So erlaubtsie zum Beispiel, zwischen Aussagesatz und Frage zu un-terscheiden, oder zeigt an, ob etwas traurig oder fröhlichgesagt wurde. Alle diese Informationen verarbeitet das Sys-tem in kürzester Zeit, von Wort zu Wort in weit weniger als einer Sekunde – genauer gesagt: in 600 Millisekunden.
Um herauszufinden, wie das Gehirn das bewältigt,müssen zunächst zwei Fragen geklärt werden: WelcheGehirnareale unterstützen die Satzverarbeitung, insbe-sondere syntaktische, semantische und prosodische Pro-zesse? Und wie werden diese verschiedenen Teilprozessezeitlich koordiniert? Zur Klärung stehen heute verschie-dene Verfahren zur Verfügung, mit denen sich die Akti-
vität des „arbeitenden“ Hirns registrieren lassen. Da istzum einen die Methode der ereigniskorrelierten Hirnpo-tenziale: Dabei wird mittels der Elektroenzephalographie(EEG) das Summenpotenzial von einer großen Anzahl
synchron aktiver Neuronen registriert. Die Zeitauflösungdieses Verfahrens liegt bei einer Millisekunde, doch istseine räumliche Auflösung auch bei der Verwendung ei-ner größeren Zahl von Elektroden recht ungenau.
Die andere Methode, die funktionelle Magnetresonanz-tomographie (fMRT), bietet dagegen eine hervorragenderäumliche Auflösung von ungefähr zwei Millimetern, istaber in ihrem zeitlichen Auflösungsvermögen weniger gut. Die fMRT erfasst die Sauerstoffpegel des Bluts undzeigt deren Veränderung während neuronaler Aktivität.Mit der Kombination beider Verfahren können wir die mitder Sprachverarbeitung verbundene Hirnaktivität räum-lich und zeitlich recht genau beschreiben.
Zunächst zu der Frage, wo im Gehirn syntaktische undsemantische Prozesse ablaufen. Dabei haben wir mithilfeder funktionellen Kernspintomographie eine Reihe vonExperimenten angestellt (Abb. 4). In einem dieser Versu-che präsentierten wir Sätze, die entweder korrekt waren(„Die Gans wurde gefüttert“), oder die einen semanti-schen, also einen Bedeutungsfehler, enthielten („Das Li-neal wurde gefüttert“) oder einen syntaktischen, also ei-nen Fehler der Grammatik („Die Kuh wurde im gefüttert“).
Mit solchen fehlerhaften Sätzen kann man testen, obdas Gehirn unterschiedlich auf die zwei Fehlertypen rea-giert – auf semantische oder syntaktische Information.Für die semantisch korrekte und inkorrekte Satzbedin-gung (Abb. 4) zeigen sich deutliche Aktivierungen imoberen Gyrus des Temporallappens. Die Unterschiede zwi-schen der korrekten und semantisch inkorrekten Bedin-gung sind im hinteren und mittleren Anteil des oberenGyrus des Temporallappens am größten. Für die syntakti-sche Bedingung (Abb. 5) findet man vor allem im mittle-ren Anteil des oberen Gyrus des Temporallappens eineweniger starke Aktivierung. Der vordere Anteil des Gyrustemporalis superior zeigt dagegen eine deutliche Aktivie-rung. Hier ist der Unterschied zwischen der korrekten undsyntaktisch inkorrekten Bedingung am größten.
Abb. 3
Abb. 4
Abb. 5
Abb. 6
Abb. 7

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 29/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 57
erkennen, da alle Inhaltswörter durch Pseudowörter er-setzt waren. Die Daten belegen eine dominante Involvie-rung der rechten Hemisphäre bei der Verarbeitung proso-discher Information (Abb. 12).
Das funktionale Gehirnmodell stellt die Verarbeitunggesprochener Sprache wie folgt dar (Abb. 13): Homologe
Areale im superioren Gyrus des Temporallappens und iminferioren Gyrus des Frontallappens der linken und der rechten Hemisphäre sind aktiviert. Syntax und Semantik werden in domänen-spezifischen Mini-Netzwerken verar-beitet – und zwar vor allem in der linken Hemisphäre –,Prosodie dagegen vornehmlich in der rechten. Es ist zu
vermuten, dass linke und rechte Hemisphäre in Echtzeitzusammenwirken, um eine effektive Verarbeitung gespro-chener Sprache zu sichern. Wie aber werden Syntax und Semantik mit der Proso-
die zusammengeführt? Dazu bietet man Versuchsperso-
nen Sätze mit einer so genannten inkorrekten Prosodie,wie beispielsweise: „Peter verspricht, Anna zu arbeitenund das Büro zu putzen“ (anstatt „Peter verspricht Anna,zu arbeiten und…“ oder „Peter verspricht, Anna zuentlasten und…“). Tatsächlich reagiert das Gehirn auf derart irreführende Informationen zunächst mit einer N400-Antwort als Zeichen dafür, dass es das unpassende
Verb „arbeiten“ – statt des richtigen Verbs „entlasten“ –syntaktisch nicht in den Satz integrieren kann. Dannaber folgt eine P600-Komponente als Ausdruck einesKorrekturprozesses – und so wird der Satz am Ende doch
verstanden.Schwieriger ist es, die Interaktion zwischen Semantik
und Prosodie aufzudecken. Dazu verwendet man Sätzemit emotional positiv oder negativ gefärbten Wörternund trägt diese Sätze mit jeweils passender oder unpas-sender emotionaler Stimmfärbung vor. Dabei zeigt sich –anders als bei allen anderen Experimenten – ein Unter-schied zwischen Männern und Frauen: Männerhirne rea-gieren auf die unpassende Information langsamer alsFrauenhirne, die auf prosodisch emotionale Informatio-nen sehr früh ansprechen – schon nach 200 Millisekun-den. Darin könnte ein Grund für manche Missverständ-nisse zwischen Frauen und Männern liegen.
Doch ungeachtet dieses interessanten Aspekts lässt sich
insgesamt für alle Gehirne feststellen: Der Weg vomakustischen Input führt über räumlich getrennte Mini-Netzwerke; jeweils gesondert verarbeiten sie spezifischeInformationen des Gehörten und verständigen sich bin-nen einer Sekunde über den Inhalt. Das gilt für reife Ge-hirne. Wie aber lernen Kinder von der Geburt bis zum Al-ter von sechs Jahren, Sprache zu verstehen? Dieser Zu-sammenhang zwischen Sprachentwicklung und Hirnent-wicklung wird an 250 Kindern erforscht. Diese Kinder sind derzeit gerade ein Jahr alt, und es gibt darüber nochnicht viel zu berichten. Das fordert noch Geduld – eineder Tugenden, die jeder Wissenschaftler braucht. ●
NEUROPSYCHOLOGISCHE Forschu
56 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
orange kodiert, und man erkennt, dass die N400 sich über den hinteren Teil des Kopfes ausbreitet.
Die syntaktische Verletzung (gepunktete Linie in Abb. 9oben links), evoziert eine sehr frühe Hirnantwort, die umdie 160 Millisekunden einsetzt. Diese Komponente habenwir ELAN (Early Left Anterior Negativity) genannt. Untenlinks zeigt Abbildung 9 die Topographie für diese Kompo-nente: Sie tritt nur anterior auf und ist links etwas stärker als rechts. Das bedeutet, dass syntaktische Information inder Tat früher als semantische Information verarbeitetwird. Diese Verteilung weist auf die Aktivität spezifischer Hirnareale für die syntaktische Verarbeitung im Gegen-satz zur semantischen hin. Syntaktische Fehler rufen einezweite, spätere Komponente hervor: eine Positivierung
um die 600 Millisekunden, daher P600 genannt (Abb. 9oben rechts). Unten rechts in Abbildung 9 ist die Vertei-lung dieser Komponente über den Kopf dargestellt. Sie istdeutlich verschieden von der frühen syntaktischen Kom-ponente ELAN.
Diese Daten belegen ein präzises zeitliches Zusammen-spiel von syntaktischen und semantischen Prozessen, dassich in drei Phasen gliedert (Abb. 10): Zunächst wirdschnell und automatisch eine syntaktische Struktur er-stellt (ELAN), dann werden lexikalisch-semantische In-halte abgerufen und integriert (N400). Ist beides ohneProbleme möglich, kann die Botschaft interpretiert wer-den. Treten aber Probleme auf, geht das System in eineKorrekturphase (P600) mit dem Ziel, eine adäquate Inter-pretation zu finden. Aus diesen zwei Experimenten lässt sich der Weg vom
auditorischen Input innerhalb der linken Seite des Mo-
dells bezüglich seiner neuronalen Aspekte beschreibenund das räumlich präzise, jedoch zunächst statische Hirn-aktivitätsmodell nun in seinem zeitlichen Ablauf spezifi-zieren (vgl. Abb. 6). Zunächst wird die akustische Infor-mation im primären auditorischen Kortex bilateral verar-beitet, dann erfolgt die schnelle syntaktische Verarbei-tung in einem temporal-frontalen Netzwerk und danachdie semantische in einem anders verteilten temporal-frontalen Netzwerk. Die erfolgreiche Integration dieser
verschiedenen Informationstypen ist Voraussetzung für die Interpretation.
Ein zusätzliches Experiment im Magnetenzephalogra-phen (MEG) mit insgesamt 148 Kanälen belegte, dassschon der frühe syntaktische Prozess das temporal-fron-tale Netzwerk aktiviert. Es wurden dieselben Stimuli wiein den vorangegangenen Versuchen verwendet, und dieQuellen der Hirnaktivität im frühen Zeitfenster um die160 Millisekunden individuell für fünf Probanden er-rechnet. Interessanterweise zeigten sich für dieses früheZeitfenster zwei Quellen: ein temporaler und ein fronta-ler Dipol. Dies bedeutet, dass das definierte Mini-Netz-werk schon in der frühen Phase der syntaktischen Verar-beitung aktiv ist.
Damit kommen wir zur Verarbeitung prosodischer In-formation (vgl. rechte Seite des Modells in Abb. 3). Die
Frage, wo im Gehirn prosodische Information verarbeitetwird, wurde mittels funktioneller MRT untersucht. Um dieProsodie getrennt von Semantik und Syntax zu analysie-ren, wurde die spektrale Information aus einem normalengesprochenen Satz herausgefiltert (Abb. 11 oben). Erhal-ten blieb der Tonhöhenverlauf (Abb. 11 unten). Die spezi-fische Aktivierung für die Prosodie wird deutlich im Ver-gleich der Hirnaktivierung zwischen den gefilterten Sät-zen – die nur prosodische Information enthielten – undnormal gesprochenen Sätzen, die neben der prosodischenauch spektrale Information transportierten; in ihnen war
jedoch nur eine syntaktische Struktur und kein Inhalt zu
SSEN aus erster Hand
PROF. DR. ANGELA D. FRIEDERICI ist Direktorinund wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für neuropsychologische For-schung in Leipzig. Sie forscht auf dem Gebietder Neurobiologie der Sprache und untersuchtFragen des Sprachverstehens, der Sprachver-arbeitung und der Bildgebung von kognitivenProzessen. Frau Friederici ist Professorin an derUniversität Leipzig und hält mehrere Honorar-
professuren inne. Zudem ist sie Direktorin am Zentrum für Kogni-tionswissenschaft. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet,beispielsweise erhielt Angela Friederici im Jahr 1997 den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis.
Abb. 8
Abb. 9
Abb. 10
Abb. 11
Abb. 12
Abb. 13
– syntaktische Sprache

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 30/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 59
ÄGYPTOLOG
58 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
SSENSCHAFTSgeschichte
Zaubersprüchegegen Plagegeister
Die Beziehung zwischen Menschen und Insekten hat eine
lange (Wissenschafts-) Geschichte. Die Insektenforscher
PROF. HERMANN und DR. ANNA LEVINSON, früher am MAX-
PLANCK-INSTITUT FÜR VERHALTENSPHYSIOLOGIE in Seewiesen
tätig, untersuchen auch die kulturgeschichtliche Bedeutung
der Insekten, die zwischen religiöser Verehrung und Schädlings-
abwehr schwankt. Fündig wurden die Wissenschaftler
als Erstes im alten Orient und besonders bei den Ägyptern.
mittel vor Insektenfraß schützen?Bei den alten Ägyptern gibt es für dieses Problem des Vorratsschutzesdie ersten Nachweise. Unabhängig
von Mumifizierung und Grabbei-gaben wurde der Vorratsschutz einwichtiges Thema, seit die Menschendes alten Orients begannen, Getreidemengenmäßig anzubauen (um 4000
v. Chr.) sowie Vorräte für Zeiten der Knappheit zu speichern (seit etwa2500 v. Chr.).
Der erste Schutz vor Schädlingen,den sich die alten Ägypter einfallenließen, war ein mythologischer: Dieschädlichen Tiere sollten durch ab-schreckende Zeichnungen und Zau-bersprüche, die in den Grabkammernangebracht waren, verscheucht wer-den. Das Aufspießen oder Bedrohen
von Mistkäfern, Rüsselkäfern oder Schaben allerdings sei – so Hermannund Anna Levinson – nur symbo-lisch gemeint, weil sämtliche Tiere inder Glaubenswelt der alten Ägypter als gleichberechtigte Wesen der Schöpfung anerkannt waren und de-ren Tötung als schwere Sünde galt.
„Bleibe fern von mir du, der du Kiefer hast, die nagen!“
Dieser Spruch aus dem ÄgyptischenTotenbuch zeigt die Angst der alten
Ägypter vor Insekten, die Mumienund deren essbare Grabbeigabenfressen. Nach altägyptischem Glau-ben war der Tod nur eine Über-gangsphase zu einem Weiterleben imJenseits – seit der Regierungszeit desKönigs Djoser bis zum Ende der Rö-mischen Zeit (etwa 2667 v. Chr. bis395 n. Chr.) wurde in Ägypten der Körper von Herrschern und anderenPersönlichkeiten mumifiziert. MitBeschwörungssprüchen, die entwe-der an die Grabwände geschriebenoder als Papyri der Mumie beigege-ben wurden, sollte der Körper der
Verstorbenen geschützt werden. Diegesammelten Sprüche bilden das
Ägyptische Totenbuch.Den mumifizierten Menschen gab
man reichlich Nahrungsmittelvorrätein das Grab mit, die die Toten imJenseits ernähren sollten. Wie aber lassen sich mumifizierte und lebendeMenschen sowie deren Nahrungs- A
B B . :
S P I X I A N A
Vignetten aus demÄgyptischen Totenbuch:die Verwarnung vongrabschändenden Tieren.
Rationeller war da schon der Vor-ratsschutz für Getreide, der lautÜberlieferung um 1600 vor Christusdurch Jakobs Sohn Josef erfundenwurde. Die Genesis, der Koran unddie Josefsgeschichte im Sefer Ha-
jaschar („Buch des Rechtschaffenen“)berichten, dass Josef, der Vorsteher der Nahrungsmittellager in Ägypten,landesweit große Kornspeicher er-richten und diese mit dem Getreidedes Ernteüberschusses füllen ließ.Hier kam erstmals die Aufbewahrung
von ungedroschenem Getreide alswirksamer Vorratsschutz zum Ein-satz: „Was Ihr dann erntet, das be-wahrt in den Ähren auf – ohne es zudreschen ...“, steht in der 12. Suredes Korans. Das „Buch des Recht-schaffenen“, ein venezianischer Bi-belkommentar aus dem 17. Jahrhun-dert, berichtet, dass die Böden der Speicher mit dem Erdstaub der Fel-der, auf denen das Getreide gewach-

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 31/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 61
ÄGYPTOLOG
60 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
SSENSCHAFTSgeschichte
sen war, bestreut werden sollten. Die Ackererde des Niltals war in trocke-nem Zustand ein feiner, äußerst haft-barer Staub. Dies ist eine erstaunlichmoderne Erkenntnis: StaubförmigeMineralien sind meist tödlich für zahlreiche Schadinsekten, weil siederen Wasserhaushalt stören und dieInsekten dadurch austrocknen. Die
vorratsschädlichen Insekten werdenauch von feinem Erdstaub ver-scheucht, weil der Staub ihre Sinnes-haare empfindlich reizt. Auch anderewarmblütige Tiere „kennen“ diesenEffekt: So wälzen oder „baden“ sichHunde und Spatzen in trockenemSand, um sich von parasitischen In-sekten und Milben zu befreien.
Auch der lebende Mensch ver-
suchte sich vor parasitischem Unge-ziefer zu schützen, das ihm das Le-ben schwer machte. Herodot berich-tet in seinen Historien über denMückenschutz, den die alten Ägypter
erfunden hatten: Die oberhalb der Sumpfgebiete wohnenden Menschenerbauten luftige Türme, auf denensie schlafen können, da die Stech-mücken wegen der Winde kaum indie Höhe fliegen können. Die Be-wohner der Sumpfgebiete dagegenhaben ein anderes Verfahren: „Jeder-mann“, so Herodot, „nimmt in der Nacht das Netz, das ihm am Tagezum Fischfang dient. Er windet esum das Bett, in dem er schlafen will,kriecht hinein und schläft ungestörtdarunter. Wenn er nur – in sein Ge-wand oder sein Bettuch gehüllt –schliefe, so würden die Mückendurchstechen; durch das Netz aber
versuchen sie es gar nicht.“Halb der Hygiene, halb der Ele-
ganz dürfte der Salbkegel gedienthaben, den die Ägypterinnen bei Fei-erlichkeiten auf ihrem Kopf trugen:Im Laufe des Abends schmolz der Salbkegel, parfümierte und fettete
das Haar und die Kopfhaut ein. Dieaus Rinder- oder Schaftalg herge-stellten Salbkegel enthielten ätheri-sche Öle und viel Myrrheharz, die dieKopfläuse vertreiben. Solche Salbke-
gel waren seit der 18. Dynastie (etwa1550 bis 1295 v. Chr.) in Gebrauch.
Allerdings wehrten sie das Ungezie-fer nur vorübergehend ab – sogar anden Haaren von Mumien fand mannoch Eier von Kopfläusen, die trotzdes eifrigen Gebrauchs von Kämmenmit doppelter Zinkenreihe nicht be-seitigt werden konnten.
Die Ernteverluste durch Schädlingemüssen während der Zeit des NeuenReichs (ca. 1550 bis 1069 v. Chr.) sehr
groß gewesen sein, wie man an der Klage eines Bauern sieht: „Der Wurmhat die Hälfte der Nahrung genom-men, das Nilpferd die andere. Es hat
viele Mäuse auf dem Feld gegeben,und die Heuschrecken sind niederge-fallen. Das Vieh hat gefressen, unddie Spatzen haben gestohlen. DenRest, der auf der Tenne liegt, habendie Diebe geraubt.“
PROPHETISCHE ZEUGEN
FÜR BIBLISCHE PLAGEN
Besonders für die verheerenden Wirkungen einfallender Heuschre-ckenschwärme im alten Orient gibtes viele Dokumente. Am bekannte-sten ist das zweite Buch Mose, nachdem Gott zehn Plagen über Ägypten
schickt, um die Freilassung derHebräer aus dem Niltal zu beschleu-nigen. Der biblische Ausdruck für
Wanderheuschrecke „arbeh“ ähneltdem hebräischen Wort „harbeh“
EIN KÄFER ROLLT
DEN SONNENBALL
In der Zeitschrift SPIXIANA habenHermann und Anna Levinson vom Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologieeine vierteilige Abhandlung „Insekten alsSymbole göttlicher Verehrung und Schäd-linge des Menschen“ publiziert. Zentralist das Kapitel „Kulturgeschichtliche Be-deutung der heiligen Käfer in Altägyp-ten“. Die Schnellkäferart Lanelater noto-
donta beispielsweise, die sich bei Gefahrtot stellt und danach wieder „aufer-steht”, war wohl wegen dieser Eigen-schaft der Kriegsgöttin NEITH geweihtund wurde ab der Protodynastischen Zeitbis Ende der fünften Dynastie (etwa3200 bis 2345 v. Chr.) göttlich verehrt.Dungkugel rollende und Dung speichern-de Käferarten galten lange Zeit (von zirka2345 bis 343 v. Chr.) als Offenbarung
des Morgensonnengottes CHEPRI sowiedes Schöpfergottes ATUM, welche dieAuferstehung beziehungsweise die Welt-erschaffung symbolisierten. Die Dung-kugel rollenden Käfer – so der altägyp-tische Glaube – holten den Sonnenballvon der Unterwelt herauf und rolltenihn über das Himmelsgewölbe.Der 120 Seiten starke Band (SPIXIANA,Supplement Nr. 27) ist zum Preis von30 Euro zu beziehen über Dr. JulianeDiller, Zoologische StaatssammlungMünchen, Münchhausenstraße 21,81247 München (Fax: 089/8107-300,E-Mail: [email protected]),oder den Verlag Dr. Friedrich Pfeil,Wolfratshauser Straße 27,81379 München (Fax: 089/7242772,E-Mail: [email protected]).
(=viel), womit das massenhafte Auf-treten der Insekten betont wird.
„Sie bedeckten die Oberfläche desganzen Landes, die davon verdun-kelt wurde, und fraßen alle Feldge-wächse und Baumfrüchte, die der Hagel übrig gelassen hatte, sodass inganz Ägypten nichts Grünes an denBäumen und kein Kraut auf demFelde übrig blieb.“ (Exodus 10, 15) Von einer Heuschreckenplage in
Palästina zur Zeit der späteren Pro-pheten zeugt eine Stelle im Buch desPropheten Joel: „... denn ein Volk isteingefallen in mein Land, stark undungezählt. Seine Zähne sind wieZähne eines Löwen, ein Gebiss hates wie eine Löwin.“ Auch die ver-schiedenen Larvenstadien der Heu-
schrecken kennt der Prophet – dieälteren Larven fressen, was die jün-geren Larven übrig gelassen haben! Aus Nordmesopotamien ist auf ei-
nem bemalten Tonziegel dargestellt,
Abb. 2: Teilansicht eines Festmahls auf einem thebanischen Wandgemäldeaus der 18. Dynastie (etwa 1400 v. Chr.): oberägyptische Damen mit je einem Salbkegelzum Entlausen und Parfümieren des Kopfhaares.
Links: Assyrischer Tonziegel aus Kalat Schergat in Mesopotamien (ca. 745 bis 727 v. Chr.): Ein Würdenträger fleht seinen Gott ASSURum Abwendung von Heuschreckenplagen an. Rechts: CHEPRI, der Gott des Sonnenaufgangs und der Weltschöpfung in Gestalt eines Mannesmit dem Skarabäus als Kopf. Wandgemälde im Vorraum des Felsengrabs der Königin NEFERTARI (ca. 1279 bis 1213 v. Chr.).
Heuschreckenspeise im altenAssyrien: zwei Speisenträger mit
Wüstenheuschrecken, aufgereihtan Fleischspießen, wie sie ander Tafel des assyrischen KönigsSanherib (705 bis 681 v. Chr.)serviert wurden. Zeichnung nacheinem Sockelrelief, das in derRuine des Königspalastes vonNinive gefunden wurde.
wie ein Würdenträger den Gott ASSUR, den assyrischen National-gott, um Schutz vor Heuschrecken-plagen anfleht. Mehrere assyrischeKönige ließen im 7. und 8. Jahrhun-dert vor Christus die Schäden, die dieHeuschrecken anrichteten, auf Ton-tafeln verzeichnen.
Nur ein schwacher Trost kannes bei solchen periodisch auftreten-den Schäden sein, dass Wanderheu-schrecken auch essbar sind: Aus As-syrien kennt man eine Darstellung,wie Heuschrecken an Fleischspießenan der Tafel des assyrischen KönigsSanherib (705 bis 681 v. Chr.) ser-
viert wurden. Das massenhafte Auf-treten, die Leichtigkeit, sie zu sam-meln und zu rösten, der hohe Nähr-
wert (etwa 18 Prozent Eiweiß und5 Prozent Fett) und der Wohlge-schmack der Heuschrecken machtensie im alten Orient zu einem belieb-ten Nahrungsmittel GOTTFRIED PLEHN

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 32/43
62 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
„Non vitae sed scholae discimus“,schrieb Seneca einst – in Zeiten, da
Bildung noch ein Privileg der Elite war. Erstin der Neuzeit drehte man die Devise um: DieSchule sollte die Kinder für das Leben ausbil-den und befähigen, aktiv am wirtschaftlichenund gesellschaftlichen Geschehen teilzuneh-men. Doch wie PISA zeigte, sind Schulen inDeutschland darin weniger erfolgreich als in
vielen anderen Ländern. Fast ein Viertel der Jugendlichen in Deutschland kann zwar
Wörter und Sätze entziffern, ist aber nicht inder Lage, mit längeren Texten, Tabellen oder anderen Informationsangeboten umzugehen.Ein Armutszeugnis nach fast neun JahrenSchulbesuch und rund 8 600 Stunden Unter-richt. Denn diese Jugendlichen werden ver-mutlich dauerhaft zu den Verlierern der Ge-sellschaft zählen.
PISA steht für „Programme for Internatio-nal Student Assessment“ und ist das bislanggrößte internationale Forschungsprojekt, dasden Bildungsstand der nachwachsenden Ge-neration untersucht. 32 Staaten haben daranteilgenommen. Federführend für die deutscheSeite waren ein nationales Konsortium sowie
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung inBerlin um Prof. Jürgen Baumert. Die deutscheBeteiligung an der internationalen Studie ko-ordinierte Dr. Petra Stanat, und die Fäden für die nationale Erweiterungsstudie PISA-E hieltDr. Cordula Artelt in der Hand.
Die beteiligten Forscher an den verschiede-nen Einrichtungen haben in den vergangenen
vier Jahren eine Herkulesarbeit geleistet undunter enormem Zeitdruck die Studie voran-gebracht. Dazu kam im letzten Jahr der
Ansturm der Medien und die notwendigeÖffentlichkeitsarbeit: zahlreiche Interviews,Einladungen zu Rundfunkdiskussionen undzu Fernsehauftritten, aber auch viele Vor-tragsanfragen und Anrufe von engagiertenEltern oder Lehrern, die mehr Informationenwollten. Die Mitarbeiterinnen im PISA-Sekre-tariat konnten einen Teil der Anfragen selbstbeantworten, leiteten aber auch viele Briefean die Experten weiter, unter anderem auchsolche, in denen die Absender ihre persönli-chen Erklärungen für das PISA-Debakel aus-führten. „Manche dieser Zuschriften warendurchaus inspirierend“, sagt Cordula Artelt.
Die PISA-Forscher haben überwiegend er-freuliche Erfahrungen mit dem öffentlichen
RSCHUNG & Gesellschaft
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 63
BILDUNGS forschu
Interesse gemacht. Dass die Ergebnisse vonPISA und PISA-E so ausführlich und so diffe-renziert in vielen Medien diskutiert würden,hatten sie gar nicht erwartet. Schulbildung istnach PISA nicht mehr ein kleines Thema für die Familienseite, sondern auf die Titelseitengerutscht und hat zeitweilig den Wahlkampf beherrscht. Entscheidende Persönlichkeitenaus Wirtschaft und Politik haben sich mitPISA beschäftigt.
Die PISA-Aufgaben testen weniger lehr-planabhängiges Schulwissen, sondern so ge-nannte Basiskompetenzen wie Lesekompe-tenz und die mathematische oder naturwis-senschaftliche Grundbildung. Die Lesekompe-tenz bildet dabei die Grundvoraussetzung für
den Erwerb von Fähigkeiten in anderen Be-reichen, zum Beispiel auch mathematischer und naturwissenschaftlicher Art. Die Testauf-gaben wurden auf der Grundlage authenti-scher Materialien wie literarischer, darstelle-rischer oder argumentativer Texte, aber auchZeitungsausschnitten, Fahrplänen oder Ge-brauchsanweisungen aus den PISA-Teilneh-merländern entwickelt, übersetzt und auf kul-turelle Übertragbarkeit geprüft. In typischenLesekompetenz-Aufgaben geht es darum, In-formationen aus einem Text zu ziehen, sie inZusammenhang mit anderweitig erworbenenKenntnissen zu setzen und kritisch zu verar-beiten. Die mittlere Lesekompetenz im OECD-Durchschnitt entspricht dem Skalenwert 500
Armutszeugnisfür das deutsche
SchulsystemViel ist geschrieben worden über PISA, viel ist hineininterpretiert worden in
die Ergebnisse. MAXPLANCKFORSCHUNG berichtet aus erster Hand über die Hinter-
gründe dieses größten internationalen Forschungsprojekts, das den Bildungs-
stand der nachwachsenden Generation untersucht und an dem 32 Staaten
teilgenommen haben. Federführend für die deutsche Seite waren ein nationales
Konsortium sowie Wissenschaftler am MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR
BILDUNGSFORSCHUNG in Berlin um D IREKTOR PROF. JÜRGEN BAUMERT.
Abb. 1: Schüler-anteile auf und
unter Kompetenz-stufe I in 14 Län-
dern der Bundesre-publik im Vergleichmit einer Auswahl
aus 23 Staaten.
G R A F I K E N : M P I F Ü R B I L D U N G S F O R S C H U N G

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 33/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 65
BILDUNGS forschu
durchschnittliche Lesekompetenz von Jugend-lichen aus den beiden oberen Dienstklassendeutlich höher als jene von Jugendlichen ausder Arbeiterschicht. Besonders in Bremen undGroßstädten erstreckt sich der Unterschied auf zwei Kompetenzstufen (Abb. 2). Das ist we-sentlich dramatischer als in allen anderen der teilnehmenden OECD-Staaten.
In Deutschland hängt die schulische Lauf-bahn eng von der Herkunft ab: Jedes zweiteder Kinder aus der Oberschicht besucht einGymnasium, und nur jedes zehnte geht auf eine Hauptschule. Von den Arbeiterkinderngelangt dagegen nur jedes zehnte auf einGymnasium, während fast die Hälfte auf ei-ner Hauptschule ist. Selbst bei gleicher ko-gnitiver Kompetenz bleibt der Schichtvorteilbestehen: Ein Facharbeiterkind hat bei glei-cher kognitiver Grundfähigkeit eine drei Malgeringere relative Chance, ein Gymnasiumstatt einer Realschule zu besuchen als einKind aus einer Akademikerfamilie.
Die Bildungserfolge der einzelnen Bundes-länder sind dabei sehr unterschiedlich. Zwi-schen dem Norden und dem Süden der Repu-blik herrscht ein Leistungsgefälle, das im Ex-tremfall zwischen Bayern und Bremen oder Bayern und Brandenburg eineinhalb bis zweiSchuljahren entspricht. Doch selbst der Spit-zenreiter Bayern liegt mit einer durchschnitt-lichen Lesekompetenz von 510 Punkten nur
wenig über dem OECD-Durchschnitt, und Ba-den-Württemberg hält gerade mit dem kana-dischen Schlusslicht mit, der relativ struktur-schwachen Provinz New Brunswik (Abb. 3).
Bremen und einige der neuen Bundesländer schneiden verhältnismäßig schlecht ab: Hohe
Arbeitslosigkeit wie in Bremen oder Sachsen- Anhalt und die damit oft zusammenhängen-de Verunsicherung der Eltern gehen mitschwachen Leistungen der Schülerinnen undSchüler einher. Schulen in Deutschland kön-nen diese und andere ungünstige Startbedin-gungen der Schüler offenbar nicht genügendkompensieren. Förderungsangebote, die auf die Schüler individuell zugeschnitten sind,stehen benachteiligten Kindern in der Regel
64 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
RSCHUNG & Gesellschaft
und damit der Kompetenzstufe III. Auf dieser Kompetenzstufe können die Lesenden mitkonkurrierenden Informationen umgehen undetwas komplexere Texte verstehen. Die nied-rigste Stufe der Lesekompetenz (Stufe I, Ska-lenwert 335 bis 407) genügt dagegen gerade,um einfache, kurze Texte zu verstehen, in de-nen wenige Informationen klar herausgestelltsind – etwa einen Artikel in der Boulevard-presse. Wirkliche „Expertenleser“ (Kompe-tenzstufe V, Skalenwert über 625) können mit
völlig fremden Texten hoher Komplexität et-was anfangen und verstehen feine sprachlicheNuancen. Expertenleser lesen in der Regelgerne und viel. Doch Lesen als Hobby ist beiJugendlichen in Deutschland wenig verbrei-tet. Vor allem Jungen aus den unteren sozia-len Schichten lesen in Deutschland fast niezum Vergnügen und zählen überproportionalhäufig zu der Problemgruppe, die nur die ein-fachsten Texte erfassen kann.
Deutschlands Jugendliche liegen mit 484Punkten unter dem OECD-Durchschnitt von500 und befinden sich zwischen der zweitenund dritten Kompetenzstufe. Besonders beun-ruhigend ist die Tatsache, dass in den deut-schen Ländern viele Jugendliche (deutsch-landweit 23 Prozent, in Bremen 36, in Bayern19 Prozent) lediglich die erste Kompetenz-stufe erreichen oder sich sogar darunter be-finden, während finnische oder kanadische
Schulen weniger als ein Zehntel der Jugend-lichen auf diesen untersten Kompetenzstufenzurückgelassen haben.
Die Fähigkeit des verstehenden Lesens wirdin Deutschland in der Regel ab der Sekundar-stufe vorausgesetzt und nicht mehr explizitgefördert. Dabei merken Lehrerinnen undLehrer oft nicht, welche Schülerinnen undSchüler noch Probleme mit dem Lesen und
Verstehen haben. Auf eine Befragung nachschwachen Lesern unter ihren Schülernkonnten sie nur ungefähr ein Zehntel der Ju-gendlichen nennen, die im PISA-Test unter der ersten Kompetenzstufe blieben.
In Finnland scheint es den Schulen wesent-lich besser zu gelingen, die schwächerenSchüler zu fördern und gleichzeitig viele Ju-gendliche auf ein sehr hohes Niveau zu brin-gen: Fast ein Fünftel der finnischen Jugend-lichen zählt zu den Expertenlesern; in
Deutschland erreichen diese Stufe nur neunProzent der Schülerinnen und Schüler (Abb.1).
Zusätzlich zu den PISA-Testaufgaben bear-beiteten die Schüler auch einen Standardtestzur Messung ihrer kognitiven Grundfähigkeitund füllten einen Fragebogen aus, in dem sienach ihrer Herkunft, ihren Einstellungen unddem sozialen Umfeld gefragt wurde. Die Ju-gendlichen gaben außerdem an, wie wohl siesich in der Schule fühlen, ob die Lehrer An-
teil an ihnen nehmen und wie viel Interessedie Eltern für ihre schulischen Erfahrungenaufbringten. Die PISA-Studie erfasst damit
viele verschiedene Merkmale und Fähigkeiten von Jugendlichen, und die Daten lassen sichnach unterschiedlichen Gesichtspunkten aus-werten. Aus den Ergebnissen können die
Wissenschaftler beispielsweise den Einflussder sozialen Stellung der Eltern, der kogniti-
ven Leistungsfähigkeit oder der Lesekompe-tenz herausrechnen; und auch, wie stark ein-zelne Faktoren die Leistungen der Schüler und Schülerinnen beeinflussen, kann quanti-tativ ermittelt werden.
Die erworbenen Kompetenzen hängen inDeutschland stärker von der sozialen Her-kunft der Schüler ab als beispielsweise in denUSA. 40 Prozent der Kinder von ungelernten
Arbeitern bleiben hier zu Lande auf der un-tersten Kompetenzstufe zurück und habendamit kaum eine Chance auf eine bessereQualifikation. In allen Bundesländern liegt die
Abb. 2: MittlereLesekompetenz von
15-Jährigen ausFamilien der oberen
und unterenDienstklasse und der
Arbeiterschicht.
TESTRITUALE
Als Testleiter für die einzelnen Schulen wurden Stu-dierende eingestellt, die keine privaten Kontakte zuden Schulleitern hatten und zuvor geschult undschriftlich zur Geheimhaltung verpflichtet wurden.Sie verwendeten ein vorgefertigtes Skript, nach demsie vollkommen neutrale Anweisungen zur Bearbei-tung der Tests gaben. Nach Abschluss der Testswurden die Lösungen, die zum Teil aus ausführlichenschriftlichen Begründungen bestanden, von geschul-ten „Kodierern“ anhand eines detaillierten Kriterien-katalogs bewertet. Aus den kodierten Testergebnissenund den Angaben in den anderen Fragebögen wurdendie Rohdatensätze hergestellt. Die Wissenschaftlerin-nen und Wissenschaftler sicherten mit aufwändigenstatistischen Verfahren, dass die Testergebnisse inter-national vergleichbar sind.Allen Teilnehmern und auch den Schulen selbst wurdeAnonymität garantiert. Die Schulbehörden und Kul-tusministerien erhalten nur eine verschlüsselte Rück-meldung über die Leistungen der einzelnen Schul-typen, die keine Identifikation einzelner Schulenzulässt. Die Schulen selber bekommen auf Wunsch die
Ergebnisse der PISA-Tests der Neuntklässler an ihrerEinrichtung. „Bei den Schulrückmeldungen handelt essich natürlich nicht um eine Schulevaluation, aber siekönnen einer Schule schon Hinweise auf möglicheProblembereiche geben“, sagt Petra Stanat.
Erworbene Kompetenzen hängenstark von der sozialen Herkunft der Schüler ab.
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Thüringen
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Hessen
Saarland
Rheinland-Pfalz
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Niedersachsen
Schleswig-Holstein
Baden-Württemberg
Kompetenzstufe
ArbeiterschichtObere und untere Dienstklasse
Bremen
Schüler aus Großstädten
600550500450400350300
I II III IV V
650
Zwischen Nord und Süd herrscht einerhebliches Leistungsgefälle.
PISA IN ZAHLEN
An der internationalen Vergleichsstudie PISA nahmenim Frühsommer 2000 rund 180000 fünfzehnjährigeSchülerinnen und Schüler aus 32 Ländern teil, darun-ter rund 5000 Schüler aus 219 deutschen Schulen(internationale Stichprobe). In Deutschland haben
jedoch knapp 50000 Jugendliche an 1 479 Schulendie PISA-Tests mitgeschrieben. Dies geschah aufBeschluss der Kultusministerkonferenz, die mit derPISA-Erweiterungsstudie erstmals ein realistischesBild der Schullandschaft in Deutschland zu gewinnenhoffte.Rund 12,7 Millionen Kinder und Jugendliche besu-chen zurzeit deutsche Schulen, knapp eine Milliondavon ist etwa 15 Jahre alt. Die PISA-Stichprobeist sehr groß, um der Vielfalt an insgesamt siebenSchulformen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium,Gesamtschule, berufsbildende Schule, Schule mitmehreren Bildungswegen und Sonderschule) inDeutschland gerecht zu werden.

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 34/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 67
BILDUNGS forschu
man kann sich leicht vorstellen, wie es um dieMotivation eines 15-jährigen bestellt ist, der in der siebten Klasse mit 12-jährigen Mit-
schülern sitzen muss. Fast ein Drittel der Kin-der besucht eine niedrigere Klassenstufe als esihrem Lebensalter entspricht.
„Wir müssen vor allem lernen, wieder mitheterogenen Schülergruppen umzugehen“,sagt Baumert. Früher hätten die Volksschul-lehrer diese Kunst verstanden, wenn sie in ei-ner Dorfschule mehrere Altersstufen gleich-zeitig betreuen mussten. Doch der fragend-entwickelnde Unterrichtstil, der an deutschenSchulen vorwiegend praktiziert wird, istdafür nicht sehr gut geeignet. Denn der Leh-rer ist auf die passenden Antworten der
66 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
RSCHUNG & Gesellschaft
nicht zur Verfügung, um Defizite aufzuarbei-ten (Abb. 4).
Eindrucksvoll zeigt sich aber auch im Bun-desvergleich, dass ein niedriges Gesamtniveaugerade die schwächeren Schülerinnen undSchüler um Lebenschancen bringt: So befin-den sich beispielsweise in Bremen etwa einFünftel der deutschen Jugendlichen und fast45 Prozent der Jugendlichen mit Migrations-geschichte in der Risikogruppe der schwachenLeser, während in den Bundesländern, in de-nen die Mittelwerte höher sind, auch die Kin-der ausländischer Eltern deutlich bessere Lei-stungen erzielen. Schwache Schüler scheinen
von einem insgesamt leistungsstarken Systemzu profitieren. Wie die Daten zeigen, hängtdie Benachteiligung der Kinder mit ausländi-schen Eltern allerdings vor allem mit ihrer Le-sekompetenz zusammen. Denn: Vergleichtman Jugendliche mit gleicher Lesekompetenz
miteinander, gehen Kinder mit Migrationshin-tergrund ebenso häufig auf ein Gymnasiumwie ihre deutschen Mitschüler (Abb. 5).
Im Musterland Bayern erwerben die Ju-gendlichen auch auf den Hauptschulengrundlegende Fähigkeiten, während aus denHauptschulen in den schwachen Ländern be-sonders viele „Risikokinder“ hervorgehen.Dennoch regiert auch in Bayern nicht aus-schließlich das Leistungsprinzip – der Gym-nasialbesuch ist sogar in besonders hohemMaß von der sozialen Schicht abhängig. Bei
gleicher kognitiver Leistungsfähigkeit habenKinder von Akademikern in Bayern einesechs Mal höhere relative Chance, ein Gym-nasium zu besuchen als gleich intelligenteKinder von Facharbeitern.
„Es geht einfach nicht, dass wir ein Viertelder Jugendlichen auf den Arbeitsmarkt ent-lassen und wissen, dass sie nicht gut genugausgebildet sind“, sagt Jürgen Baumert,Direktor am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Die wichtigste Aufgabeder anstehenden Bildungsreformen sieht der
Erziehungswissenschaftler jetzt in der Siche-rung einer Sockelqualifikation für alle. GeradeKinder aus ungünstigen Verhältnissen sind
auf eine frühzeitige Förderung in den Basis-kompetenzen durch die Schulen angewiesen,um sich im Leben behaupten zu können.Eltern und Schulen gingen mit der Lebenszeitder nachwachsenden Generation in Deutsch-land nachlässig um, kritisiert Baumert. Kinder werden in Deutschland häufig vom Schulbe-such zurückgestellt und später eingeschult,schwache Schüler nicht versetzt. Eine gezielteFörderung für diese Kinder gibt es dagegenkaum, allein die Zeit oder die Wiederholungder Klasse soll es richten – eine Illusion, denn
Abb. 3: MittlereLeseleistung für14 Länder derBundesrepublik im
Vergleich mit achtkanadischen Provin-zen und ausgewähl-ten OECD-Staaten.
Abb. 4: In Deutsch-land hängen die
Leistungen der Ju-gendlichen extrem
stark von ihrem fa-miliären Hinter-
grund ab. Die Schulemit ihren verschie-
denen Einflussmög-lichkeiten, die hier
schlagwortartig auf-gezählt sind, kann
ungünstige Startbe-dingungen nicht
genügend auffangenund mildert dahernicht die sozialen
Diskrepanzen.
Eltern und Schulen gehen mit der Lebenszeitder Nachwachsenden nachlässig um.
Schüler angewiesen, um zu seinem Unter-richtsziel zu kommen, und hat keine Zeit, umauf abweichende fehlerhafte Antworten ein-zugehen oder nach den Ursachen der Miss-
verständnisse zu forschen. Auch die beson-ders klugen Antworten sind in einem solchenUnterricht störend, weil sie vorgreifen. Wennder Unterricht aber nicht gut vorangeht, wer-den die Fragen immer leichter und suggesti-
ver, bis es den Schülern fast peinlich wird,sich zu melden. Solche Beobachtungen der Choreographie des Unterrichts stammen ausder TIMS-Video-Studie, die ebenfalls amMax-Planck-Institut für Bildungsforschungausgewertet wurden.
Eine Reform der Lehrerbildung steht schonauf der Tagesordnung, und viele Schrittewerden diskutiert. Dennoch sei es eine Illusi-on, dass Bildungspolitik alles nach Beliebensteuern könne, sagt Baumert. Auch das ge-
sellschaftliche Klima den Schulen gegenüber muss sich in Deutschland ändern. In Finn-land herrscht ein Konsens über die Wichtig-keit der Schulen, insbesondere der Grund-schulen. Grundschullehrer zählen zu den an-gesehensten Berufsgruppen der Gesellschaft.Und sie engagieren sich in der Regel auchganz persönlich für ihre Schülerinnen undSchüler: „Wir brauchen jeden, und da könnenwir es uns nicht leisten, Kinder einfachzurückzulassen“, sagte einer der finnischenLehrer. Das Gleiche gilt für Kinder inDeutschland. ANTONIA RÖTGER
BremenMecklenburg-Vorpommern
Schüler aus Großstädten
Schleswig-Holstein
Hessen
Niedersachsen
Thüringen
Saarland
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Brandenburg
Sachsen-Anhalt
unter Kompetenzstufe I(beide Eltern inDeutschland geboren)
auf Kompetenzstufe I(beide Eltern inDeutschland geboren)
Prozent der Schüler
Baden-Württemberg
unter Kompetenzstufe I(mindestens ein Eltern-
teil im A uslan d ge bore n)
auf Kompetenzstufe I(mindestens ein Eltern-
teil im Au slan d ge bore n)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Abb. 5: Anteil derNeuntklässler, deren
Lesekompetenz dieerste Kompetenz-stufe nicht über-schreitet, mit undohne Migrations-
hintergrund inverschiedenen
Bundesländern.

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 35/43
Fritz W. Scharpf
68 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2 3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 69
GESELLSCHAFTS forschuPERSON
Fritz W. Scharpf sehr viel weiter – deshalb ist dort dieBeschäftigungsquote höher.“
Seine Analysen finden Beachtung,aber Scharpf versteht sich nicht alsPolitikberater, sondern als Grundla-genforscher, wie es der Ausrichtungdes Max-Planck-Instituts entspricht.Sein Verhältnis zur Politik formulierter zurückhaltend: „Als Wissenschaft-ler können wir die Ursachen von Pro-blemen und die Wirksamkeit einge-setzter Maßnahmen untersuchen underklären.“ Zugleich könne gerade die
vergleichende Poltikforschung zeigen,welche institutionellen Bedingungenin welchen Ländern die Durchsetzungeffektiver Lösungen erschweren oder erleichtern. Zur Aufgabe der Sozial-wissenschaft gehöre es auch, die Er-gebnisse ihrer Forschung so darzu-stellen, dass sie von der Öffentlichkeit
verstanden und von den politischHandelnden und ihren Beratern auf-genommen werden können. „Wennwir gefragt werden, geben wir auchunseren Rat. Aber das ist eher seltenund gehört nicht zu unserem eigent-lichen Geschäft. Im Prinzip ist esSache der Politik, ob und wann sie
von unseren ForschungsergebnissenGebrauch machen will.“
EUROPA HAT
NOCH KEINE IDENTITÄT
Unzählige Minister und siebenKanzler, von Adenauer bis Schröder,hat der Politologe kommen und ge-hen sehen. Für Willy Brandt empfander wohl die meiste Sympathie, aber sein wissenschaftliches Interessegalt immer den von der Person desKanzlers unabhängigen besonderenSchwierigkeiten des Regierens imdeutschen Föderalismus. Nach vier Jahren sei „Rot-Grün“ blockiert, aber „Schwarz-Gelb“ käme vermutlichauch nicht viel weiter. Deshalb hielteer für die nächsten vier Jahre einegroße Koalition für die beste Option.So wie 1966, als der Sozialdemokrat
Karl Schiller ein fertiges Konzept für eine neue Wirtschaftspolitik vorlegenkonnte, und die Regierung stark ge-nug war, um sich gegen Bedenkenträ-ger in allen Lagern durchzusetzen.„Eine Große Koalition ist manchmaldie einzige Möglichkeit, über Vetopo-sitionen hinwegzugehen und Still-stand zu überwinden“, sagt Scharpf.
Gibt es noch andere Auswege ausder Blockade? Die Erfahrung lehre,dass auch akute Krisen den Wider-stand gegen Veränderungen über-
winden können. Erst auf dem Höhe-punkt der BSE-Krise und der Maul-und Klauenseuche habe die Bundes-regierung ihre Agrarpolitik geändertund ein Verbraucherschutzministeri-um eingerichtet. Auch die Hartz-Kommission habe ihre Chance erstnach dem skandalösen Fehlverhaltender Arbeitsämter erhalten. „Deutsch-land braucht immer wieder Katastro-phen und Skandale, um Reformenmöglich zu machen“, so das ernüch-ternde Fazit des Politologen.
Wie sieht er selbst seinen For-schungsgegenstand, die Politik?
Wenn man von den besonderenSchwierigkeiten der deutschen Ver-fassung absieht, glaubt Scharpf durchaus an ihre Gestaltungskraft,betont aber zugleich deren Grenzenunter den Bedingungen der interna-tionalen wirtschaftlichen Verflech-tung und globaler Kapitalmärkte. Die„demokratische Zivilisierung des dy-namischen Kapitalismus“ sei schwie-riger geworden. Die Nationalstaatenallein seien weniger als früher in der Lage, das kollektive Schicksal ihrer Bürger zu gestalten. Aber auch dieEuropäische Union verfüge nochnicht über Institutionen, die in der Lage wären, die Folgeprobleme der wirtschaftlichen Integration zu be-wältigen.
Scharpf ist überzeugter Europäer.Die Chancen und Risiken der weite-ren Integration schätzt er dennoch
Er wurde vor zwei Jahren als erster Europäer mit dem hoch an-
gesehenen Johan-Skytte-Preis für Politikwissenschaft ausgezeichnet –
aber schon vorher zählte PROF. FRITZ W. SCHARPF, Direktor am
Kölner MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR GESELLSCHAFTSFORSCHUNG,
zu den renommiertesten Sozialwissenschaftlern in Europa, dessen
Analysen bei Kollegen und Politikern Beachtung finden.
F O T O S : W O L F G A N G F I L S E R
Profilierungssucht ist ihm fremd.Schnelle Kommentare zur Ta-
gespolitik oder 30-Sekunden-State-ments in den Wahlstudios der Fern-sehsender überlässt Fritz W. Scharpf lieber anderen. Der Direktor desMax-Planck-Instituts für Gesell-schaftsforschung in Köln gehört zu
jenen Vertretern seines Fachs, die je-des Wort sorgfältig abwägen. Wer mit ihm ins Gespräch kommt, erlebt
einen nachdenklichen Wissenschaft-ler. Oberflächlichkeit mag er gar nicht, ebenso wenig die Reduzierungdes Politischen auf Personen oder Pa-rolen. Gelegentlich bricht Scharpf mitten im Satz ab und beginnt nocheinmal neu, um seinen Gedanken zupräzisieren und druckreif zu formu-lieren.
Scharpfs Reformvorschläge, etwazur Bekämpfung der Massenarbeitslo-sigkeit, haben in jüngster Zeit einigeResonanz gefunden. Er selbst weiß,
dass seine Ideen nicht gerade populär sind bei denen, die Wahlen gewinnenwollen. Zum Beispiel sein – radikalanmutendes – Plädoyer für höhereEinkommenssteuern. Fast alle Par-teien versprechen Steuersenkungen,aber Fritz Scharpf hält die Senkunggerade dieser Steuer angesichts der enormen Ausgabenbelastungen für ökonomisch unvernünftig. Stattdes-sen fordert er eine Senkung der So-zialabgaben, um Arbeit attraktiver zumachen und mehr Jobs zu schaffen.Bereits zwei Jahre vor der Hartz-Kommission schlug Scharpf in einemBeitrag für die Zeit vor, die niedrigenEinkommen von Sozialabgaben zubefreien, um damit den Dienstleis-tungssektor anzukurbeln.
Doch statt mit Zauberformeln wieder „Ich-AG“ zu operieren, verweistder 67-jährige Wissenschaftler lieber auf die Ergebnisse seiner großen ver-gleichenden Untersuchung der Erfol-ge und Misserfolge in der Beschäfti-gungs- und Sozialpolitik von zwölf Industriestaaten während der ver-gangenen drei Jahrzehnte. Sie hatgezeigt: „Unser Defizit liegt nicht inBereichen, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind, sondernbei den Dienstleistungen in den Be-reichen Bildung, Gesundheit, Haus-halte und Freizeit, die lokal angebo-ten und konsumiert werden. Da sinddie Schweden oder Dänen, aber auchdie Schweizer, Holländer und Briten

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 36/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 71
GESELLSCHAFTS forschu
70 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
PERSON
vorsichtig ein. Sein jüngstes Buch„Regieren in Europa: effektiv unddemokratisch?“ ist auch eine Fehler-analyse der europäischen Politik.Der Forscher richtet hier den Fokusauf die mangelnde Legitimität undProblemlösungsfähigkeit europäi-scher Herrschaftsstrukturen. SeineKernthese: Europa ist noch weit ent-fernt von einer politisch belastbarenkollektiven Identität. Der Beitrittneuer Mitgliedsstaaten aus Osteuro-pa werde das Problem noch ver-schärfen. Erfolge habe die Unionzwar bei der Schaffung eines ge-meinsamen Markts und einer Ein-heitswährung vorzuweisen, aber siesei noch nicht reif für Mehrheitsent-scheidungen in Fragen der Beschäf-
tigungs-, Sozial- oder Bildungspoli-tik, welche die Interessen und Le-benspläne der Bürger unmittelbar berühren. Daran ändere es auchnichts, dass die Kompetenzen desEuropäischen Parlaments durch die
Verträge von Maastricht und Ams-terdam beträchtlich erweitert wur-den. „So lange eine starke kollektiveIdentität fehlt, können unpopuläreEntscheidungen auch nicht durchMehrheitsvoten des EuropäischenParlaments legitimiert werden“, sagtScharpf. Mit anderen Worten: Euro-pa muss erst enger zusammenwach-sen, bevor Brüssel die nationalen Re-gierungen wirksam entlasten könnte.
Fritz Scharpf ist ein überaus viel-seitiger Forscher – promovierter Voll-
jurist und gelernter Politik- und Ver-waltungswissenschaftler, im Verfas-sungsrecht ebenso zu Hause wie inder politischen Ökonomie. Seine
Bücher und Aufsätze, fast immer zu-erst auf Englisch publiziert, werdeninternational wahrgenommen, dieListe seiner Veröffentlichungen istlang. Über Entscheidungsprozesse inder deutschen Ministerialbürokratiehat er geforscht, über den deutschenFöderalismus und die europäische In-tegration, über die Krisenpolitik sozi-aldemokratischer Länder in den sieb-ziger Jahren, über die Anwendungs-möglichkeiten der Spieltheorie in der empirischen sozialwissenschaftlichenForschung – und zuletzt über Anpas-sung hoch entwickelter Sozialstaatenan die Herausforderungen der ökono-mischen Globalisierung.
„AMERIKANISCHE LITERATUR
FÖRMLICH AUFGESOGEN
“ Aus einer bildungsfernen Gärtner-
familie in Schwäbisch Hall stam-mend, war Scharpfs Weg in die Wis-senschaft nicht vorgezeichnet. AlsStudent der Rechtswissenschaft undPolitikwissenschaft in Tübingen undFreiburg hatte er eigentlich eine Kar-riere im Staatsdienst anstreben wol-len. Dass es anders kam, hatte mitseinem Umweg in die VereinigtenStaaten zu tun. Aufgewachsen in der amerikanischen Zone, hatte er alsTeenager „die amerikanische Litera-tur förmlich aufgesogen“, wie er sagt.
Als Fulbright-Stipendiat konnte er dann 1955/56 Politikwissenschaft ander Yale University studieren. Einesehr humane, liberale Gesellschafthabe er damals an der amerikani-schen Ostküste kennen gelernt. „Diesoziale Ungleichheit schien überwun-den. Auch die Arbeiter hatten einSelbstbewusstsein, das man sich inDeutschland nicht vorstellen konnte.“
Nach dem ersten juristischen Staats-examen kehrte er für ein weiteres Stu-dienjahr zurück und erwarb in Yale1961 den Master of Law. Den Beginnder Präsidentschaft von John F. Ken-nedy erlebte Scharpf als „eine Periode,in der man glauben konnte, dass diePolitik die Welt vernünftig gestaltenkann“. Entscheidend für seinen Weg indie Wissenschaft war dann 1964 das
Angebot einer zweijährigen Assistenz-professur an der Yale Law School, wo
er amerikanisches und vergleichendes Verfassungsrecht lehrte. „Ich hätte in Amerika bleiben können“, sagt der Forscher über diese wichtige Lebens-phase. Doch die Rufe auf Lehrstühlein Yale und in Chicago schlug eraus, um sich in Freiburg zu habilitie-ren: „Ich dachte, ich gehöre nachDeutschland.“
Schon in seiner von Arnold Berg-straesser und Horst Ehmke betreutenFreiburger Promotionsarbeit über die„Political Question Doctrine“ desSupreme Court hatte er die Vorzügedes amerikanischen Verfassungs-rechts analysiert, in dem die Richter die Verantwortung des demokratischlegitimierten Gesetzgebers bei be-stimmten „politischen Rechtsfragen“
respektieren müssen. Sein darauf ge-stützter Aufsatz im Y ALE L AW JOURNAL
ist inzwischen ein Klassiker, der inden Vereinigten Staaten noch immer zur Pflichtlektüre für Juristen zählt.
Wie aktuell das Thema bei uns ist,zeigt sich an der Diskussion über die
jüngsten Entscheidungen der Karls-ruher Richter zu Fragen wie der
Wehrpflicht oder der Zuwanderung.Sein Habilitationsvorhaben, einebreiter angelegte, vergleichende Un-tersuchung über das Verhältnis vonPolitik und Justiz in den VereinigtenStaaten und in der Bundesrepublik,fand allerdings ein vorzeitiges Ende,als ihn 1968 der Ruf auf einen Lehr-stuhl im Fachbereich Politikwissen-schaft an der neu gegründeten Uni-
versität Konstanz erreichte.Obwohl damit ein Wechsel von der
Rechtswissenschaft zur Politikwis-senschaft notwendig wurde, zögerteer nicht, denn mit dem Ruf war der
Auftrag verbunden, an der Reform-universität einen für Deutschlandneuartigen verwaltungswissenschaft-lichen Studiengang zu entwickeln. InKonkurrenz zur juristischen Ausbil-dung für den höheren Verwaltungs-dienst basierte das Konstanzer Pro-gramm auf einem interdisziplinärensozialwissenschaftlichen Grundstudi-um unter Einbezug der Politikwissen-schaft, der Rechtswissenschaft, der
Wirtschaftswissenschaften und der Soziologie. Das neue Konzept war
Instituts hat sich nach der Emeritie-rung von Mayntz in der Partner-schaft mit Wolfgang Streeck bruchlosfortgesetzt. Scharpfs eigene Arbeitenam neuen Institut galten zunächstden theoretischen Grundfragen ei-ner politikwissenschaftlichen Analy-se des Verhältnisses zwischen gesell-schaftlichen Problemen und staatli-cher Politik und den methodischen
Voraussetzungen, unter denen spiel-theoretische und verhandlungstheo-retische Modelle in der empirischenPolitikforschung eingesetzt werdenkönnen. Zusammen mit RenateMayntz formulierte Scharpf auf die-ser Grundlage den inzwischen weit-hin akzeptierten Ansatz des „akteur-zentrierten Institutionalismus“.
Von diesen methodischen Arbei-ten profitierten die gleichzeitig in
Angriff genommenen Analysen der europäischen „Mehrebenenpolitik“ebenso wie Scharpfs wichtigstes em-pirisches Projekt der vergangenenJahre: die internationale Vergleichs-studie zur Beschäftigungs- und Sozi-alpolitik unter den Bedingungen der Globalisierung in zwölf hoch ent-wickelten Sozialstaaten. Die Max-Planck-Gesellschaft bedachte diesesProjekt mit einer finanziellen Start-hilfe. Auf der Hauptversammlung imJuni 2000 in München trug Scharpf die Ergebnisse der Studie vor, dieunter dem Titel „Welfare and Work in the Open Economy“ in zwei Bän-den bei der Oxford University Presserschien. Beachtung fand das Projektnicht zuletzt deshalb, weil dadurchdie charakteristischen Defizite der kontinentaleuropäischen Sozialstaa-ten im Vergleich sowohl zu den an-gelsächsischen als auch zu den skan-dinavischen Ländern genau identifi-ziert und erklärt werden konnten.
Inzwischen zählt Scharpf, Mitgliedder British Academy und der Ameri-can Academy of Arts and Sciences,zu den renommiertesten Sozialwis-senschaftlern in Europa. Im Septem-ber 2000 wurde ihm eine besondereEhre zuteil: Er erhielt als erster Eu-ropäer den Johan-Skytte-Preis für Politikwissenschaft der UniversitätUppsala. Dass die prestigeträchtige,
mit 400000 Kronen (etwa 40000 Eu-ro) dotierte Auszeichnung mit demDiplomaten und Prinzenerzieher Jo-han Skytte (1577 bis 1645) verknüpftist, freut den Preisträger auch wegen
der Beziehung zum eigenen Kon-stanzer Reformprogramm: Der enge
Vertraute von König Gustav Adolphgründete 1622 einen Lehrstuhl für Rhetorik und Regierungskunst, ge-dacht als Kaderschmiede für hoheBeamte, der heute als älteste Profes-sur für politische Wissenschaft gilt.
Die Schweden sind aber nicht dieeinzigen, die Scharpfs Verdienstewürdigen. Am 7. November diesesJahres wird der scheidende Direktor des Kölner Max-Planck-Instituts denmit 15 000 Euro dotierten Schader-Preis erhalten. In der Begründungheißt es, Scharpf werde für sein „vor-bildliches Engagement“ im wissen-schaftlichen Dialog mit der Politik geehrt.
Ein paar Monate noch, dann mussFritz Scharpf sein Direktorenbüro imneuen Institutsgebäude in der Kölner Innenstadt räumen, weil er mit 68Jahren die Altersgrenze erreicht hat.
Was er dann tun wird? So genauweiß er das noch nicht, aber lang-weilig dürfte es ihm kaum werden.
Alte Leidenschaften wie die Fotogra-fie will er neu für sich entdecken.
Ausnahmsweise will er erst einmalkein neues Buch schreiben. Statt täg-lich in sein Institut zu fahren, kanner sein Haus auf einer Anhöhe zwi-schen Köln und Bonn genießen.„Dort oben ist die Luft auch viel bes-ser als in der Stadt“, sagt Scharpf lächelnd. CHRISTIAN MAYER
von Anfang an erfolgreich. „Unsere Absolventen hatten auch später nieProbleme auf dem Arbeitsmarkt“,sagt Scharpf, der seiner alten Univer-sität auch heute noch als Honorar-professor verbunden ist.
Im Jahr 1973, als die Aufbaupha-se in Konstanz abgeschlossen war,wechselte der nunmehrige Politik-wissenschaftler ans Berliner Wissen-schaftszentrum, wo er einen Schwer-punkt der international vergleichen-den Policy-Forschung aufbaute. Dortamtierte er bis 1984 als Direktor desInternationalen Instituts für Manage-ment und Verwaltung. Bereits inKonstanz, von wo aus er (schon da-mals zusammen mit Renate Mayntz)Organisationsuntersuchungen in der
Ministerialverwaltung des Bundesdurchführte, hatte der Wissenschaft-ler enge Kontakte zur Politik – wassich in Berlin fortsetzte, wo etwa das
Arbeitsministerium und die Gewerk-schaften zu den Abnehmern der For-schungsergebnisse des Instituts zähl-ten. Doch an einem Sprung in die Po-litik hatte Scharpf, seit 1959 SPD-Mitglied, kein Interesse. Horst Ehmke,sein akademischer Mentor und später der Kanzleramtsminister und For-schungsminister von Willy Brandt,hätte den jungen Wissenschaftler wohl gerne nach Bonn geholt.
SCHARPF UND MAYNTZ –EIN STARKES TEAM
Das Jahr 1984 brachte dann er-neut eine Zäsur. „Ich wollte nunwieder selbst forschen und nicht nur die Forschung anderer anleiten undunterstützen“, sagt er. So schlugScharpf einen Ruf an das Europäi-sche Hochschulinstitut in Florenzaus und arbeitete zwei Jahre lang aneinem Ein-Mann-Projekt über dieKrisenpolitik sozialdemokratischer Regierungen in den siebziger Jahren.
Im Jahr 1986 kam dann das Ange-bot von Renate Mayntz, mit ihr zu-sammen das neue Max-Planck-Insti-tut für Gesellschaftsforschung inKöln aufzubauen. Der durch mehrerepositive Evaluierungen und durch diesteilen akademischen Karrieren vieler Mitarbeiter bestätigte Erfolg dieses

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 37/43
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 73
NEU erschien
Biographie
der Vernunft
Lorraine Daston: WUNDER, BEWEISE UNDTATSACHEN. Zur Geschichte der Rationa-lität, 186 Seiten, Fischer-Taschenbuch-
Verlag, Frankfurt/M., 2001, 14,90 Euro.
Das Buch von Lorraine Daston,
Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Wis-senschaftsgeschichte, ent-hält vier Aufsätze, vondenen drei bisher nur auf Englisch vorlagen, denText der Antrittsvorlesungan der Berliner Hum-boldt-Universität und einealle Texte verbindendeEinleitung. Diese stelltdie Aufsätze als „Versuchezu einer Biographie der
Athene“ vor – der griechischen Göt-tin der Vernunft (zugleich die Göttindes Krieges). Daston schreibt eine Ge-schichte der „Tatsachen“, der „Evi-denz“ und der „Objektivität“. Der Ge-danke, dass Tatsachen irgendwannentstanden sind und es eine Zeit gab,zu der es noch keine Tatsachen gab,sei zunächst „haarsträubend“.
Ebenso provokativ sei die Behaup-tung, dass sich wissenschaftliche Ob-
jektivität erst im 19. Jahrhundert eta-bliert habe. „Diese verstörten undempörten Reaktionen“, so schreibtDaston, „auf die bloße Vorstellung, eskönne eine Geschichte der Tatsachenoder der Objektivität geben, zeigen,wie tief diese Kategorien in unseren
Arten des Wissens verwurzelt sind.
72 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
U erschienen
und Schrecken versetzt. „Für Frauenunter 50 scheint die Mammographienicht nützlich zu sein, sondern nur Nachteile mit sich zu bringen“, resü-miert Gigerenzer. Ganz Ähnlichesgilt für den Test auf den HIV-Virus,wenn man zu keiner Risikogruppegehört: Falsch-positive Tests sinddann so häufig, dass es immer wie-
der Fälle von Personen gibt, die nacheinem positiven HIV-Test Selbstmordbegangen oder ihren Arbeitsplatzund ihre Wohnung verloren haben –obwohl (möglicherweise) der Testschlicht falsch-positiv war. Gigeren-zer schildert einige dieser dramati-schen Fälle.
Im letzten Kapitel entwirft GerdGigerenzer einen „Lehrplan“, wieklares Denken vermittelt werdenkann. Er beginnt mit Franklins Ge-setz (siehe Motto), um die Illusionder Gewissheit zu zerstören. Der zweite Schritt: die Unwissenheit über Risiken überwinden. Gigerenzer zeigtam Beispiel der US-amerikanischenTabakverbände, wie Wirtschaftsver-bände die öffentliche Meinung be-einflussen. Drittens: Risiken ver-ständlich mitteilen. Hier schlägt der
Autor verbesserte Lehrpläne vor undhat auch computergestützte Lernpro-gramme parat. Darüber hinaus ent-hält das lesenswerte Buch unter an-derem Erläuterungen zum kompli-zierten Verhältnis zwischen Arzt undPatient, evolutionsbiologische Be-gründungen, warum unser Verstandso ist wie er ist, und einiges über „vernebeltes Denken“ im Gerichts-saal. GOTTFRIED PLEHN
Vernebeltes
Denken
Gerd Gigerenzer: DAS EINMALEINS DERSKEPSIS – Über den richtigen Umgang mitZahlen und Risiken, 406 Seiten,Berlin Verlag, Berlin 2002, 22 Euro.
... in dieser Welt ist nichts gewiss,
außer dem Tod und den Steuern.
BENJAMIN FRANKLIN
Dieses Motto stehtam Anfang des
Buchs. Gerd Gigerenzer,Direktor am Max-Planck-Institut für Bil-dungsforschung, be-schreibt eindrucksvoll,wie wesentlich dieFähigkeit zum statisti-schen Denken für die all-tägliche Einschätzung
von Risiken ist – und wie wenig ent-wickelt unsere Fähigkeiten dazu im
Allgemeinen sind. Viele Beispieleaus medizinischen Testverfahren(AIDS-Test, Brustkrebs-Screening,genetischer Fingerabdruck) zeigendie Unsicherheiten, die hinter diesenTestverfahren stehen – und die häu-fig auch von den Experten, die sieanwenden, nicht richtig verstandenwerden.
Allein die Art und Weise der Dar-stellung ist allerdings nach Gigeren-zer schon die halbe Lösung des Pro-blems. Dazu ein Beispiel: Wie zuver-lässig ist das Screening auf Brust-krebs bei einer 40-jährigen Frau?„Die Wahrscheinlichkeit, dass eineFrau Anfang 40 Brustkrebs hat, be-
trägt ungefähr 1 Prozent. Wenn sieBrustkrebs hat, dann liegt die Wahr-scheinlichkeit, dass das Mammo-gramm positiv ist, bei 90 Prozent.
Wenn sie keinen Brustkrebs hat,dann beträgt die Wahrscheinlichkeit9 Prozent, dass der Test dennoch po-sitiv ausfällt. Mit welcher Wahr-scheinlichkeit also hat eine Frau
(Anfang 40), deren Mammogrammpositiv ist, tatsächlichBrustkrebs?“
Das ist die Darstel-lungsweise in der ver-wirrenden Form, in der
Wahrscheinlichkeiten an-gegeben werden – GerdGigerenzer spricht häufig
von „vernebeltem Den-ken“, das in der Folgeentsteht. Um die richtige
Antwort zu erhalten,müsste man das Bayes’sche Theoremkennen und anwenden. Jetzt diegleichen Daten ohne Nebel, nämlichdargestellt in natürlichen Häufigkei-ten: „Stellen Sie sich 100 Frauen vor.Eine von ihnen hat Brustkrebs, undihr Mammogramm wird wahrschein-lich positiv ausfallen. Von den übri-gen 99 Frauen, die keinen Brustkrebshaben, werden 9 ebenfalls positiv getestet; also sind insgesamt 10Mammogramme positiv. Wie viele
von den insgesamt 10 positiv gete-steten Frauen haben tatsächlichBrustkrebs?“
Tatsächlich ist jetzt alles sonnen-klar: Von 10 Frauen hat nur eineKrebs, die anderen werden durch dasfalsch-positive Testergebnis in Angst
Descartes’
Irrtum
Wolf Singer: DER BEOBACHTER IM GEHIRN.Essays zur Hirnforschung, 238 Seiten,Suhrkamp, Frankfurt/M., 11 Euro.
Dieses Taschenbuch ist ein Rund-umschlag: In den Essays geht
Wolf Singer, Direktor am Frankfurter Max-Planck-Institut für Hirn-forschung, der Geschichte der Hirnforschung nach sowie der Frage „Was ein Mensch wannlernen kann“ und wie sich dasGehirn entwickelt. Der Beitrag„Der Beobachter im Gehirn“schildert seine eigene Entste-hungsgeschichte. Allerdings:Den Beobachter, den Descar-tes annahm und der so ein-leuchtend erscheint, gibt esnicht. Gleich welche sensorischen Sys-teme man betrachtet – ob Seh- oder Hörsystem – immer entsteht ein Netz-werk an beteiligten Hirnarealen ohneein Konvergenzzentrum, in dem alleszusammenläuft.
In den anderen vier Texten weitetSinger das Feld noch mehr aus. ZweiTitel lauten: „Neugier als Verpflich-tung – Warum der Mensch unentwegtweiterforschen muss“, „Für und wider die Natur – Was weiß die Wissen-schaft, und was darf sie wissen?“ Da-rüber hinaus geht es um einen Ver-gleich zwischen der Struktur der Stadtund des Gehirns und um neurobio-logische Anmerkungen zur Kunst.
Wahrlich eine Tour d’horizon.GOTTFRIED PLEHN
Daher vermengen wir Tatsachen mitErfahrung an sich und Objektivitätmit jeglicher Wissenschaft, die diesesNamens würdig ist. Der Ausgangs-punkt für eine Geschichte dieser grundlegenden Kategorien ist dieIdee, dass Tatsachen nur eine be-stimmte Art und Weise sind, Erfah-rung zu sieben und zu analysieren –
Alternativen dazu sind beispielsweise Aristoteles´ Einzelheitenoder Galileis Gedankenex-perimente –, und dass Ob-
jektivität nur eine vonmehreren verschiedenenepistemischen Tugendenist – Wahrheit, Gewissheitund Genauigkeit sind an-dere. Sobald ein begriffli-cher Raum für andereMöglichkeiten eröffnet ist,wird eine Geschichte der
Tatsache oder der Objektivität oder anderer epistemologischer Kategoriendenkbar.“
Die Titel der vier Aufsätze lauten:„Wunder und Beweis im frühneuzeit-lichen Europa“, „Die kognitiven Lei-denschaften: Staunen und Neugier im Europa der frühen Neuzeit“,„Angst und Abscheu vor der Einbil-dungskraft in der Wissenschaft“,„Objektivität und die Flucht aus der Perspektive“ und schließlich „Diemoralischen Ökonomien der Wissen-schaft“. Bei der Lektüre zeigt sich,wie sehr Emotionen und Werte mitder Unternehmung „Wissenschaft“
verbunden sind – eine gleicher-maßen interessante wie erstaunlicheErkenntnis. GOTTFRIED PLEHN

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 38/43
Seine letzte große program-matische Rede zum Thema„Freiheit, Verantwortung,Menschenwürde: WarumLebenswissenschaften mehr
sind als Biologie“ hatte Hu-bert Markl bereits im Juni2001 auf der Hauptver-sammlung in Berlin gehalten.So überließ der scheidendePräsident auf der Hauptver-sammlung in Halle die Bühneseinem Nachfolger und zogunter dem Motto „Den Wan-del gestalten, das Bleibendeerhalten“ eine Bilanz seinersechsjährigen Amtszeit.
In der Ära von Hubert Marklwurden 153 Forscherinnen undForscher zu WissenschaftlichenMitgliedern der Max-Planck-Gesellschaft berufen und damitrund die Hälfte aller Leitungs-positionen in den Institutenneu besetzt. Unter den Neube-rufenen sind neun Frauen – zuBeginn von Markls Amtszeitgab es lediglich zwei Direkto-rinnen. Trotz dieser Steigerungbleiben in der Max-Planck-Gesellschaft Wissenschaftlerin-
nen in Leitungspositionen un-terrepräsentiert. Um dem ent-gegenzusteuern, hat die Max-Planck-Gesellschaft seit 1997 jährlich drei bis fünf zusätz-liche C3-Stellen für Wissen-schaftlerinnen bereitgestellt.Dieses Sonderprogramm zeigtWirkung: Bei C3-Positionen hatsich der Anteil von Frauen von6 Prozent im Jahr 1997 auf19 Prozent erhöht – Ende 2001waren 42 von 227 C3-Positio-
nen mit Forscherinnen besetzt.Strukturelle Einschnitte be-stimmten die Entwicklung inden alten Bundesländern: DasFöderale Konsolidierungspro-gramm hat der Max-Planck-Gesellschaft die Einsparungvon mehr als 1100 Stellen imWesten auferlegt. Dennochkonnte die Max-Planck-Gesell-schaft ihr Entwicklungspoten-zial auch in den alten Bundes-ländern durch Neugründungenstärken. Den Aufbau Ost hatMarkl erfolgreich vollendet:In den fünf neuen Bundeslän-dern gibt es heute 18 Institute,
ein Teilinstitut und eine For-schungsstelle. Dort sind unterder Leitung von 54 Direktorenetwa 600 Wissenschaftler so-wie ungefähr 1000 nichtwis-senschaftliche Mitarbeiter an-gestellt. Diese Entwicklungspiegelt sich im Budget: Wäh-rend der vergangenen sechsJahre der Amtszeit Markls istder Haushalt der Max-Planck-Gesellschaft – ohne das Max-Planck-Institut für Plasmaphy-sik – von 736 Millionen Euroim Jahr 1996 auf 935 MillionenEuro (2002) gewachsen.Ein markantes Zeichen setzteHubert Markl anlässlich der50. Wiederkehr der Gründungder Max-Planck-Gesellschaft:Er beauftragte eine Kommissi-on unabhängiger Historiker,die Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Natio-nalsozialismus umfassend zu
erforschen. Anlässlich einesvon dieser Präsidentenkommis-sion veranstalteten Symposi-ums bekannte sich Markl am7. Juni 2001 in Berlin zur histo-rischen Verantwortung derMax-Planck-Gesellschaft fürdie Schuld, die eine Reihe vondamals an Kaiser-Wilhelm-Instituten tätigen Wissen-schaftlern auf sich geladenhatte. An Stelle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft batHubert Markl Überlebende derZwillingsversuche in Auschwitzum Verzeihung für das Leid,das den Opfern dieser Verbre-
chen im Namen der Wissen-schaft zugefügt worden war:Kein Forschungsziel rechtfer-tige die Missachtung vonMenschenwürde und Men-schenrechten.Ein weiterer Schwerpunktwährend Markls Amtszeit wa-ren die Umsetzung der im Jahr1999 ausgesprochenen Emp-fehlungen der internationalenKommission zur Systemevalua-tion der Deutschen Forschungs-gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft; dazugehört unter anderem die Emp-fehlung, die Zusammenarbeitmit Universitäten zu verstärken.Die Kommission stand unter derLeitung von Sir Richard Brook,der Markl mit einer vor demWissenschaftlichen Rat gehal-tenen Laudatio bei der Haupt-versammlung in Halle persön-lich verabschiedete. ●
INSTITUTE aktu
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 7574 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
Peter Gruss lenkt seit Junioffiziell die Geschicke derMax-Planck-Gesellschaft.Auf der Festversammlung inHalle erhielt der 53-Jährigeaus den Händen seines Vor-gängers Hubert Markl dieAmtskette. Darüber hinausernannte der Senat HerbertJäckle (Direktor am Max-Planck-Institut für biophysi-kalische Chemie, Göttingen),Kurt Mehlhorn (Direktor amMax-Planck-Institut für In-formatik, Saarbrücken) undRüdiger Wolfrum (Direktoram Max-Planck-Institut fürausländisches öffentlichesRecht und Völkerrecht, Hei-delberg) zu neuen Vizepräsi-
denten und verlängerte dieAmtszeit des bereits amtie-renden vierten Vizepräsiden-ten Günter Stock (Vorstands-mitglied der Schering AG,Berlin) bis zum Juni 2005.
In seiner Antrittsrede forderteder neue Präsident für denHaushalt der Max-Planck-Ge-sellschaft finanzielle Planungs-sicherheit mit angemessenen,auf mehrere Jahre festge-
schriebenen Steigerungsraten.Derzeit fehlten die erforderli-chen finanziellen Spielräumefür neue Vorhaben. Peter Grussbetonte außerdem die Notwen-
digkeit, die gesetzlichen Rah-menbedingungen für Wissen-schaft und Forschung inDeutschland internationalwettbewerbsfähig zu machen.In diesem Zusammenhang be-fürwortet er die durch dasneue Stammzellgesetz geschaf-fene Möglichkeit, menschlicheembryonale Stammzellen unterbesonderen Voraussetzungenaus dem Ausland einzuführen.Jedoch verhindere die Stich-tagsregelung, direkte therapeu-tische Anwendungen zu ent-wickeln, weil die vor dem 1. Ja-nuar 2002 erzeugten Stamm-zellen noch mit Mauszellenverunreinigt seien. Die Forde-rung, sich rein auf die For-schung an somatischenStammzellen zu beschränken,lehnte Gruss unter Hinweis auf die im Grundgesetz garantierteForschungsfreiheit ab.Darüber hinaus hält der neuePräsident die Einführung eines
forschungsspezifischen Tarif-rechts für notwendig, um denweltweit besten Wissenschaft-lerinnen und Wissenschaftlerneine leistungsgerechte und in-ternational wettbewerbsfähigeBezahlung bieten zu können.Bedeutende Universitäten inden USA könnten Spitzenfor-schern in manchen Fällendeutlich höhere Nettogehälterbezahlen als die Max-Planck-Gesellschaft. „Wenn es darum
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
Peter Gruss übernimmt Präsidentschaft
geht, die besten Köpfe zu ge-winnen, lautet die Devise: mit-bieten können.“Zu seinen vorrangigen politi-schen Zielen zählt Gruss auch
die Mitwirkung der Max-Planck-Gesellschaft an einer in-ternational wettbewerbsfähi-gen Schul- und Hochschulaus-bildung. Die Förderung des wis-senschaftlichen Nachwuchsessei eine zentrale Aufgabe.19 International Max PlanckResearch Schools seien in die-sem Zusammenhang bereits ge-gründet, weitere 7 beschlossen.Leistungsfähige Kooperationenund Netzwerke müssten ebensomit den anderen außeruniver-sitären Forschungseinrichtun-gen und der Industrie ausge-baut werden. Nur so könntendie für eine erfolgreiche Ent-wicklung von Wissenschaft undWirtschaft wichtigen „kriti-schen Größen“ erreicht werden.Dies gelte insbesondere für diebiomedizinische Forschung mitihren Netzwerken biowissen-schaftlicher Arbeitsgruppenaus Universitäten, außeruni-versitären Forschungseinrich-
tungen und Industriepartnern(„Clustern“).Schließlich möchte der neuePräsident den Dialog zwischenWissenschaft und Öffentlich-keit weiter verstärken: „Wirmüssen die Menschen davonüberzeugen, dass Investitionenin die Wissenschaft unabding-bar sind, wenn es darum geht,unsere Zukunft zu meisternund den Fortschritt zu bewälti-gen“, sagte er. ●
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
Hubert Markl verabschiedet sich
die Amtskettegelegt: Peter
russ, der neuePräsident derMax-Planck-Gesellschaft.
Rückschau auf sechs Jahre Amts-
zeit: der schei-dende Präsident
Hubert Markl.
Hubert Markl,
GeneralsekretäBarbara Bludaund Peter Grus(von links nachrechts) auf derAbschiedsverantung in der Geralverwaltung Max-Planck-Gschaft in Münc
F O T O S : W O L F G A N G F I L S E R

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 39/43
INSTITUTE aktu
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 77
Die offizielle Einweihung sei-ner Institutsgebäude in Hallehat das Max-Planck-Institut
für ethnologische Forschungim Juni gefeiert. Den Festvor-trag mit dem Titel „The re-turn of the native“ hielt Prof.Adam Kuper von der BrunelUniversity, Großbritannien.Die Baumaßnahmen am Insti-tut dauerten etwa 15 Monateund kosteten rund 6 Millio-nen Euro. Bereits im Dezem-ber vergangenen Jahres hat-ten die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter den Neubau unddie renovierte „Riedelsche Villa“ bezogen.
Unter der Leitung seiner Grün-dungsdirektoren Prof. GüntherSchlee und Prof. ChristopherHann befasst sich das Max-Planck-Institut für ethnologi-sche Forschung mit der verglei-chenden Untersuchung sozialerWandlungsprozesse. Hierbeisteht der Gegenwartsbezug im Vordergrund. Die am Institutgegebenen Möglichkeiten des
internationalen wissenschaftli-chen Vergleichs ermöglichenein innovatives Programm, dasunter anderem auch Beiträgezur ethnologischen Theorie-bildung leisten soll.Die derzeit 61 Mitarbeiter kom-men aus mehr als zehn ver-schiedenen Ländern. Der natio-nale Grenzen überschreitendewissenschaftliche Dialog wirddurch ein umfangreiches Gäste-programm gefördert, das neben
dem Wissenschaftsaustauschauch das Ziel hat, eine engeKooperation mit Forschern ausden jeweils untersuchten Re-gionen aufzubauen. Zudemverfügt das Max-Planck-Insti-tut über eine auch öffentlichzugängliche Spezialbibliothekmit einem Bestand von mehrals 7 500 Monografien auf Deutsch, Englisch, Russisch,Französisch und in einigen an-deren Sprachen sowie von etwa1500 Zeitschriftenbänden.Das Institut gliedert sich inzwei Abteilungen und eine Pro- jektgruppe: Die Abteilung
„Konflikt und Integration“ wirdvon Günther Schlee geleitet.Ein wichtiges Forschungsgebietist die Konstruktion, Bedeutungund Vermittlung von Identitä-ten. Im Zentrum steht die Ana-lyse von Selbst- und Fremdbe-schreibungen, die Entstehungs-bedingungen von Identitäten inder friedlichen oder gewaltsa-men Auseinandersetzung mitanderen Gruppen. WichtigenRaum nehmen auch die Be-schreibung und Analyse vonKonfliktlösungsmechanismenein. Diese Forschungsprojektekonzentrieren sich vor allemauf das östliche und westlicheAfrika, wo es insbesondere umdie komplexen Beziehungenzwischen bäuerlicher und pas-toraler Bevölkerung geht.Darüber hinaus stellen Wissen-schaftler dieser Abteilung aberauch vergleichende Untersu-chungen im zentralasiatischenRaum an.
Forschungsschwerpunkt dervon Christopher Hann geleite-ten Abteilung „Postsozialisti-sches Eurasien“ ist Besitz undEigentum. In den vergangenenJahren hat dieses Thema vor al-lem durch den weltweiten „Ex-port“ der neoliberalen Ideologiean Bedeutung gewonnen. Aus-gehend von Privatisierungspro-zessen in den postsozialisti-schen Ländern werden die Aus-wirkungen der neuen Ideologie
auf den sozialen Zusammenhaltvon Gemeinschaften und auf ihre wirtschaftliche Effizienzhin untersucht. Schwerpunktist künftig auch die Rolle derReligion in der Gesellschaft.Die Projekte dieser Abteilungreichen von Ostdeutschland bisnach Nord- und Ostrusslandsowie China. Sie konzentrierensich auf den Zerfall der ehemalssozialistischen Institutionen inder Landwirtschaft und der
Politik. Hinzu kommen verglei-chende Studien in Afrika undAustralien sowie empirischeund theoretische Arbeiten über„kulturelles Eigentum“.Zudem besteht am Institut eineProjektgruppe „Rechtspluralis-mus“, die von den ProfessorenFranz und Keebet von Benda-Beckmann geleitet wird. Sie be-schäftigt sich mit dem Entste-hen und der gesellschaftlichenBedeutung von komplexennormativen Systemen – und
hierbei insbesondere mit denWechselwirkungen und Ver-schmelzungen von Gewohn-heitsrecht, religiösem Rechtsowie staatlichem und interna-tionalem Recht. Besonderes Au-genmerk gilt bislang vernach-lässigten Themen in der Rechts-anthropologie wie die zuneh-mende Bedeutung von Religionund religiösem Recht sowiedie transnationale Dimensionvon Rechtspluralismus. ●
STITUTE aktuell
76 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR ETHNOLOGISCHE FORSCHUNG
Zehn Nationen unter neuem Dach
Alt und Neuegnen sich inen GebäudenMax-Planck-ituts für eth-logische For-
hung in Halle.Ein Hai/om-Mann in Nord-namibia schmie-det Speerspitzen
aus zurückge-lassenen Armee-beständen.
Welche Rolle kommt der Ideeeines willentlich handelndenSelbst zu? Haben wir einenfreien Willen? Oder ist derWille vollständig durch neu-ronale Aktivität und dieEntwicklungsgeschichte einesIndividuums determiniert?Inwiefern kann man von ei-nem willentlich handelndenSelbst als kognitiver Illusionoder einer sozialen Konstruk-tion sprechen? Solche Fragensind Gegenstand eines vonder VolkswagenStiftung mit750 000 Euro geförderten,mehrjährigen Projekts am
Münchner Max-Planck-Insti-tut für psychologische For-schung über Natur und Kul-tur des Wollens. In dessenRahmen fand im Juni ein er-stes interdisziplinäres Sympo-sium statt zum Thema „Onthe Social Significance of theWill: Questioning Folk Psy-chology, Law, and ForensicMedicine“.
Schon zu Beginn des Jahreshat sich die Arbeitsgruppe un-ter der Leitung von Prof. Wolf-gang Prinz vom Max-Planck-Institut für psychologische For-schung konstituiert. Neben denMitarbeitern Dr. Till Vierkantund Dr. Bettina Walde gehörenihr auch Wissenschaftler derUniversität Basel (Prof. SabineMaasen), der Universität Dres-den (Prof. Thomas Goschke)und der Universität München(Prof. Wilhelm Vossenkuhl) an.Sie wollen dem Phänomen der
Willenshandlungen nachgehensowohl durch handlungstheo-retische und experimentelleUntersuchungen zur Rolle undEntstehung des Wollens alsauch durch wissenssozio-logische und ethische Unter-suchungen zum wollendenSubjekt.Nicht nur in den Kognitions-und Sozialwissenschaften,sondern auch in der als post-modern bezeichneten Welt
steht heute das Selbst,das einen Willen artiku-liert und damit Hand-lungen auslöst und be-gründet, zunehmend zurDisposition. Stattdessenwird es als Produkt neu-ronaler und kognitiverAktivitäten, historischerNarrative und sozialerPraktiken betrachtet. InAlltags- und Rechtsdis-kursen geht es aber nachwie vor um ein Selbst,dem wir Willens- und Entschei-dungsfreiheit zubilligen und Verantwortung und Schuld zu-
schreiben. Im Mittelpunkt desersten Symposiums stand des-halb die Rolle der Willenshand-lungen im Kontext von Rechts-system und Medizin. Es wurden juristische Verfahren, Methodenund Theorien zur Zuschreibungvon Verantwortung und Schulderläutert sowie das gerichtsme-dizinische Begutachtungswesendargestellt.Namhafte Wissenschaftler –unter ihnen Prof. Hans-JörgAlbrecht (Max-Planck-Institutfür ausländisches und interna-tionales Strafrecht, Freiburg),Prof. John B. Davies (Centre forApplied Social Psychology,Glasgow), Prof. Klaus Günther(Institut für Rechtswissenschaf-ten der Universität Frankfurt),Prof. Norbert Nedopil (Psychia-trische Klinik der UniversitätMünchen) – diskutierten dieFunktion und Signifikanz desWillens unter historisch-philo-sophischen, kriminologischen,
sozialwissenschaftlichen undpsychiatrischen Blickpunkten.Dr. Henrik Walter (Psychiatri-sche Klinik der Universität Ulm)machte auf der Grundlage neu-er neurobiologischer Erkennt-nisse deutlich, in welcher WeiseGehirnverletzungen und psy-chotische Zustände mit Abnor-malitäten der Gehirnfunktioneneinhergehen. Von besonderer Relevanz wardabei die Frage, welche Art
und welches Ausmaß anpathologischen Veränderungender Gehirnfunktionen hinrei-
chend sein könnten, um bei derbetreffenden Person von ver-minderter Verantwortlichkeitzu sprechen. Denn der Über-gang von normaler Gehirn-funktion hin zu eindeutig pa-thologischen Veränderungenist graduell. An diesem Punktstellt sich in sehr drastischerWeise die Frage nach den Aus-wirkungen auf unser Rechts-system.Insgesamt zeigte sich, dassdas Recht, aber auch die foren-sische Medizin, auf das Kon-zept des freien Willens bezie-hungsweise das der vermin-derten Schuldfähigkeit nichtverzichten können: Darüberartikuliert sich die Zurechnungvon Verantwortung, Schuldund Strafe – letztlich auch dieLegitimität von staatlicherMachtausübung. Unbestrittenbasieren Taten auf neuronalenund kognitiven Aktivitäten,die ihrerseits determinierte
und determinierende Prozessesind. Der freie Wille scheint jedoch nicht in diesem Bereichangesiedelt zu sein: Eher schonlässt er sich als soziale Kons-truktion beschreiben. Er ist zu-gleich Produkt und Vehikelvon rechtlichen, aber auchmoralischen, politischen, kurz:gesellschaftlichen Diskursen, indenen Individuen ihr Verhalteneinander sozial erwartbar undzurechenbar machen. ●
INTERDISZIPLINÄRES FORSCHUNGSPROJEKT
Natur und Kultur des Wollens
F O T O S : M P I F Ü R E T H N O L O G I S C H E F O R S C H U N G

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 40/43
INSTITUTE aktu
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 79
tungszeiten von nur einer hun-dertmillionstel (!) Sekunde. DasAkronym HESS spielt auf denösterreichischen Physiker Vik-tor Franz Hess (1883 bis 1964)an, der in zehn Ballon-Aufstie-gen zwischen 1911 und 1913die Kosmische Strahlung ent-deckte und dafür im Jahr 1936den Nobelpreis für Physik er-hielt.Im Gegensatz zu einem kon-ventionellen Fernrohr liefertein Tscherenkow-Teleskop kei-ne direkten Bilder eines Him-melsobjekts, sondern zeichnetnur die Luftschauer in der Erd-atmosphäre auf. Um daraus dasAbbild einer Gammaquelle zuerzeugen, kombiniert bei derHESS-Anlage ein Computer bis
zu vier Aufnahmen und be-stimmt die Position sowie dieEnergie des Luftschauers. Er-gebnis ist ein Punkt auf einerHimmelskarte. Aber erst vieleauf diese Weise produziertePunkte ergeben schließlich dasBild einer Galaxie oder einesSupernovarests. Gammastrah-lung ist nicht thermisch, dasheißt, sie wird – anders alssichtbares Licht – nicht inheißen Himmelskörpern wieder Sonne erzeugt. Vielmehrentsteht sie unter außerge-wöhnlichen physikalischenBedingungen, wie sie beiSternexplosionen, in derNachbarschaft von SchwarzenLöchern oder im Zentrumaktiver Milchstraßensystemeherrschen. Das Fischen nachGammaquanten ist langwierig,
weil sie in einer wesentlichniedrigeren Rate auf die Erdeprasseln als zum Beispiel opti-sche Photonen. Daher müssendie Teleskope für mehrere
Stunden auf ein und denselbenOrt am Firmament gerichtetsein – mitunter betragen dieBeobachtungszeiten einigetausend Stunden. Um dasschwache blaue Leuchten auf-zeichnen zu können, wird HESSin mondlosen Nächten betrie-ben. Pro Nacht können dieAstronomen bis zu einem Dut-zend unterschiedlicher Objekteanvisieren. Erfassen alle vierTeleskope einen Blitz gleichzei-tig, ist eine stereoskopischeBeobachtung („StereoscopicSystem“) möglich. Dazu bildendie Instrumente – die übrigenswetterfest und durch keiner-lei Kuppel oder Gebäudegeschützt sind – die Eckeneines Quadrats mit 120 MeterKantenlänge.HESS soll die Empfindlichkeit
der bisher existie-renden Tscheren-kow-Teleskopeverzehnfachen.
Dabei steht dieAnlage „im friedli-chen Wettbewerbmit ähnlichen Ein-richtungen in Aus-tralien, in den USAund auf den Kana-rischen Inseln“, wiePeter Gruss, Präsi-dent der Max-Planck-Gesell-schaft, betont.HESS sei ein schö-
nes Beispiel „effizienter inter-nationaler wissenschaftlicherArbeit“. Das Konzept für dasProjekt entstand im Jahr 1996am Heidelberger Max-Planck-
Institut für Kernphysik. Die in-ternationale Kooperation wur-de im Januar 1998 begründet.Eineinhalb Jahre später standdie Farm Göllschau im Kho-mas-Hochland von Namibiaals Standort fest. Dort began-nen im August 2000 die Bau-arbeiten. Im Mai 2002 war dasErste der vier Teleskope fertiggestellt, das jetzt offiziell ein-geweiht wurde. Die übrigendrei befinden sich derzeitnoch im Rohbau.Auf dem zehn Quadratkilome-ter großen Gelände, das dieMax-Planck-Gesellschaft voneinem Farmer gepachtet hat,entstanden neben den Tele-skopen ein Kontrollzentrum,Werkstätten sowie ein Wohn-gebäude für Wissenschaftlerund technisches Personal.HESS ist für die Region außer-ordentlich wichtig: Partner sindunter anderem die UniversitätNamibia in Windhuk und die
Potchefstroom-Universität inSüdafrika. Und die namibischeRegierung hat sogar eineBriefmarke mit dem Motivdes HESS-Experiments heraus-gegeben. ●
Das Projekt im Internet:www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/
HESS.html
STITUTE aktuell
78 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
@
Ein neues Fenster zum Welt-all öffnet sich in Namibia:Dort, auf der 1800 Meterhoch gelegenen Farm Göll-schau, wurde am 3. Septem-ber 2002 das Erste von vierTeleskopen des HESS-Experi-ments offiziell eingeweiht.Dieses „High Energy Stereo-scopic System“ soll in zweiJahren komplett sein und dieenergiereiche Strahlung vonGalaxien oder Supernova-Überresten ergründen. Dabeiregistrieren die wabenförmigaufgebauten Spiegel schwa-che Lichtblitze, die beim
Eindringen der kosmischenGammaquanten innerhalbder Erdatmosphäre entste-hen. An HESS beteiligen sichmehr als 70 Wissenschaftleraus Deutschland, Frankreich,England, Irland, Tschechien,Armenien, Namibia und Süd-afrika. Die Bundesrepublikist vertreten durch das Max-Planck-Institut für Kernphy-sik in Heidelberg, die Hum-boldt-Universität Berlin, dieRuhr-Universität Bochum,die Universitäten Hamburgund Kiel sowie die Landes-sternwarte Heidelberg.Max-Planck-Gesellschaftund Bundesforschungsminis-terium haben für das Projektzusammen 6 Millionen Euroaufgewendet und tragendamit rund drei Viertel derGesamtkosten von 7,6 Mil-lionen Euro.
Angesichts der jahrtausende-
langen Geschichte der Astro-nomie zählen Beobachtungenim „Gammafenster“ des Spek-trums zu den jüngsten Zweigender Himmelsforschung. Denndieses extrem energiereicheLicht wird einerseits von derErdatmosphäre verschluckt, an-dererseits lässt es sich mit kon-ventionellen Linsen oder Spie-geln nicht bündeln. SpezielleDetektoren in Satelliten undHöhenforschungsraketen regis-
trieren Gammastrahlen mitEnergien bis zu einigen zehnMilliarden Elektronenvolt. Fürdie Erfassung von Strahlungmit noch höheren Energien –bis zu einer Billion Elektronen-volt – aus den Herzen aktiverGalaxien oder von den Restenexplodierter Sterne sind dieseInstrumente ungeeignet.Um diesen interessanten undbisher wenig erforschten Spek-tralbereich dennoch zu studie-ren, bedienen sich die Astrono-men eines Tricks, der ihnen so-gar gestattet, „auf dem Boden“zu bleiben: Ein Gammateilchenaus dem Universum dringtzwar nicht bis zur Erdober-fläche vor; aber fliegt es inner-halb der irdischen Atmosphärean einem Atomkern vorbei,kann es sich spontan in ein
Elektron und in dessen Antiteil-chen, in ein Positron, verwan-deln. Auf seiner Reise durch dieLuft gelangt das Paar in dieFelder weiterer Atomkerne,wobei wieder ein Gammaquantentsteht, das dann erneut auf Atomkerne trifft. Auf dieseWeise erzeugt ein einziges kos-misches Gammateilchen quasiim „Schneeballsystem“ eineKaskade von etwa tausend Se-kundärpartikeln.
Innerhalb dieser Luftschauerentsteht Tscherenkow-Strah-lung: Weil sich das Teilchenschneller bewegt als es derLichtgeschwindigkeit in Luftentspricht, kommt es zu einem„optischen Überschallknall“ –einer Stoßwelle, die für einigemilliardstel Sekunden blauesLicht in Flugrichtung aussen-det. Das geschieht in rund zehnKilometern Höhe. Auf demBoden beleuchtet ein solcher„Tscherenkow-Scheinwerfer“eine Fläche von ungefähr 250Metern Durchmesser. Das blaueLicht ähnelt einer Meteorspur,ist für die Beobachtung mitbloßem Auge allerdings vielzu schwach; dazu müsste dieNetzhaut eine Million Malempfindlicher sein.Hier kommt HESS ins Spiel:
Jedes Teleskop besitzt einenDurchmesser von 12 Metern,wobei jeweils 380 runde Ein-zelspiegel eine Licht sammeln-de Fläche von 108 Quadratme-tern bilden. Im Brennpunkt desTeleskops sitzt eine elektroni-sche Kamera mit 960 Foto-röhren, die in einem Rahmenvon 1,4 Meter Durchmessermontiert sind. Die Kamera,deren Elektronik in Frankreichgebaut wurde, erlaubt Belich-
GAMMA-EXPERIMENT HESS
Blaue Blitze aus dem Kosmos
Auf den erstenBlick gleicht dasHESS-Teleskop mitseinen 380 Einzel-spiegeln einemInsektenauge.
Grund zur Freudehatten (von links)Prof. Werner Hof-mann, Direktor amMax-Planck-Insti-tut für Kernphysik,
Nahas Angula,Erziehungsministervon Namibia, und
Dr. Rob Adam,Staatssekretär im
Wissenschafts-ministerium von
Südafrika, über dieEinweihung desersten der vier
HESS-Teleskopeauf der Farm Göll-schau in Namibia.
Von der aktiveGalaxie Cygnudem kleinen Pin der Bildmittschießen Matestrahlen über v
hunderttausenLichtjahre in dRaum und fächsich in giganti„Plumes“ auf.
F O T O S : M P I F Ü R K E R N P H Y S I K
( 2 ) / N R A O ( 1 )

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 41/43
Merzenich widerlegen konnte.Seine Untersuchungen führtenzu immer klareren Vorstellun-gen, wie Plastizitätsvorgängein der Hirnrinde beitragen, unddamit zu einer verfeinertenRepräsentation komplexer sen-sorischer und auch motorischerSignale während der kindlichenEntwicklung. Und sie zeigten,dass das Gehirn lebenslang dieFähigkeit zu plastischen Verän-derungen behält – viele wäh-rend der Kindheit eingetreteneFehlentwicklungen lassen sichdeshalb später durch intensivesTraining korrigieren.Darüber und über die auf die-sen neurophysiologischen Er-kenntnissen basierenden Thera-pieerfolge berichtete Merze-
nich bei der Verleihung desZülch-Preises im Kölner Gürze-nich. „Und sie wachsen doch –die Nervenfasern im verletztenRückenmark“, lautete der Titeldes Festvortrags von MartinSchwab. Damit ist zugleich seinForschungsgebiet umschrieben:die Untersuchung von Nerven-wachstumsfaktoren. Verletzun-
gen des Rückenmarks unter-
brechen die Nervenbahnen,welche die Nervenzentren desRückenmarks mit dem Gehirnverbinden. Durch diese Unter-brechung können weder Bewe-gungsimpulse aus dem Hirnan das Rückenmark vermitteltwerden – was zur Quer-schnittslähmung führt –, nocherreichen in Gegenrichtungdie über sensorische Nerven andas Rückenmark weitergegebe-nen Empfindungen aus dem
Körperbereich das Gehirn.Da die Nervenfasern desRückenmarks und des Gehirnskeine Fähigkeit zum Nach-wachsen haben, bleibt eineQuerschnittslähmung lebens-lang bestehen.Das ist eigentlich erstaunlich,denn in den peripheren Nervenaußerhalb von Rückenmarkund Gehirn wachsen verletzteNervenfasern durchaus nach –zum Beispiel nach dem Wieder-annähen von abgetrenntenFingern oder nach Nervenquet-schungen. Schwab und seineMitarbeiter postulierten des-halb die Existenz von spezifi-schen Wachstumshemmstoffenin Rückenmark und im Gehirn.In biochemischen und zellbio-
logischen Experimenten gelangihnen tatsächlich der Nach-weis, dass vor allem in der My-elinhülle der Nervenfasern vonSäugetieren (einschließlich vonMenschen) sehr wirksameWachstumshemmstoffe vor-handen sind.Einen dieser äußerst aktivenHemmstoffe – ein großes,neuartiges Membraneiweiß –konnten die Wissenschaftlerreinigen und molekularbiolo-gisch charakterisieren. DasEiweiß, Nogo-A genannt, weistzwei spezifische Stellen auf,mit denen es mit Rezeptorenauf wachsenden Nervenfasernin Wechselwirkung tritt und soderen Wachstum stoppt. DieBedeutung des Hemmstoffsbewies ein Test: Pflanzte manMäusen ein Nogo-A-Gen inperiphere Nerven ein, so konn-ten sie Verletzungen dieserNerven nur noch schlechtreparieren.
In weiteren Versuchen spritz-ten die Forscher rückenmarks-oder gehirnverletzten Rattenzwei Wochen lang Antikörpergegen Nogo-A und andereWachstumshemmstoffe in dieGehirnflüssigkeit. Als Folgewurde ein verstärktes Aus-sprossen von Nervenfasernbeobachtet, das zum Teil inein Nervenwachstum übergroße Teile des Rückenmarksüberging. Die Lauf- und Bewe-
gungsfähigkeiten der so be-handelten Tiere verbessertensich stark. Die Antikörpergabensetzten aber nicht nur die Re-generation verletzter Nerven-fasern in Gang, sondern stimu-lierten auch eine Neubildungvon Nervenschaltkreisen.„Unsere Experimente zeigen,dass die alte Vorstellung vomerwachsenen Gehirn undRückenmark als starres, kaumzur Reparatur fähiges Organ-system revisionsbedürftig ist“,sagte Schwab in seinem Fest-vortrag. Denn durch temporäreUnterdrückung endogenerWachstumshemmstoffe könnenregenerative und plastischeProzesse im erwachsenen Zen-tralnervensystem ausgelöstwerden, die letztlich zu einer
Erholung vitaler Verhaltens-weisen und Funktionen führen.„Die starken Ähnlichkeitendieses grundlegenden biologi-schen Mechanismus bei Ver-suchstieren und Menschen“,so der Wissenschaftler ab-schließend, „lässt die Hoffnungaufkeimen, dass neue thera-peutische Strategien fürrückenmarks- und gehirnver-letzte Patienten entwickeltwerden können.“ ●
INSTITUTE aktu
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 81
Der Hals- und OhrenarztProf. Michael Merzenich,Keck Center for IntegrativeNeuroscience, Universityof California, San Francisco(USA), und der Neurowissen-schaftler Prof. MartinSchwab, Institut für Hirn-forschung, Universität Zürich(Schweiz), teilen sich dendiesjährigen Zülch-Preis inHöhe von 50000 Euro.Merzenich bekommt dieAuszeichnung in Anerken-nung „seiner bahnbrechen-den Forschungsarbeiten zurRolle der postläsionellen
Reorganisation im adultenNervensystem“, Schwab we-gen „seiner herausragendenArbeiten über die Plastizitätund Regeneration des Ner-vensystems nach traumati-scher Schädigung“. Die Lau-dationes hielten Prof. Hans-Joachim Freund, UniversitätDüsseldorf, und Prof. GeorgW. Kreutzberg, Max-Planck-Institut für Neurobiologie,Martinsried. Die von derMax-Planck-Gesellschafttreuhänderisch geführte Ger-trud-Reemtsma-Stiftung hatden Zülch-Preis im Septem-ber zum 13. Mal vergeben.
Michael Merzenich erlangteerstes internationales Ansehendurch seine Erfahrungen mitertaubten Menschen, die dasvon ihm mitentwickelte künst-liche Innenohr eingesetzt beka-men. Patienten mit einem sol-chen „Cochlea-Implantat“
hören anfangs nur ein Durch-einander von Geräuschen. DerGrund: Das künstliche Organnimmt über ein außerhalb desKörpers angebrachtes MikrofonTöne und Geräusche aus derUmgebung auf und wandelt siein elektrische Signale um. ÜberDrähte werden diese dem Hör-nerv zugeführt, der sie zumGehirn weiterleitet. Die vomImplantat ausgehende Impuls-folge stimmt allerdings weder
in der zeitlichen noch in derräumlichen Ordnung mit jenerFolge überein, die ein viel emp-findlicheres natürliches Innen-ohr generiert. Das Gehirn ver-mag die künstlich erzeugtenund via Hörnerv bei ihm ein-treffenden Impulse nicht ein-zuordnen und deutet sie des-halb als dumpfes Geräusch.Merzenich arbeitete mit diesenPatienten und machte dabei ei-ne verblüffende Beobachtung:Das Gehirn verfügt offenbarüber genügend Plastizität, umsich bei entsprechendem Trai-ning so umzuorganisieren, dass
es die neuen Signale entziffernkann – eine damals völlig neueErkenntnis. Das Training be-stand darin, dass Merzenichdie Chochlea-Implantat-Trägerbat, eine Liste von Wörtern ge-meinsam mit ihm laut vorzu-lesen. Nach einigen Wiederho-lungen nahmen die Patientenkein dumpfes Geräusch mehrwahr, sondern hörten die ein-zelnen Wörter. Das Verfahrenwurde dann auf gemeinsamgesprochene Sätze und ganzeTexte ausgedehnt. Der erhoffteErfolg stellte sich nach einigenMonaten ein: Die so trainiertenPatienten gewannen ihr Hör-vermögen zurück und konntenzumindest normale Sprachewieder verstehen.Die mit dieser Plastizität desHirns einhergehenden neuro-biologischen Veränderungenuntersuchten Merzenich undseine Mitarbeiter an Tiermo-dellen. Beispielsweise trainier-
ten sie Affen, zwei nahe bei-einander liegende Töne unter-scheiden zu lernen. Die Folge:Das für die Wahrnehmung die-ses Frequenzbereichs zuständi-ge Hirnrindenareal wuchs. Zuähnlichen Ergebnissen kamendie Forscher, wenn sie den Tast-sinn untersuchten: Bei Affen,denen man beigebracht hatte,mit den Spitzen von Zeige-,Mittel- und Ringfinger ver-schiedene Vibrationsfrequen-
zen zu unterscheiden, ver-größerte sich der diese Fingerrepräsentierende Hirnrinden-bereich deutlich.Das war ein völlig unerwarteterBefund. Ende der dreißigerJahre des vergangenen Jahr-hunderts hatten Wissenschaft-ler bei Gehirnsondierungen anPatienten entdeckt, dass derTeil der Großhirnrinde, der fürdie Verarbeitung von Tastemp-findungen zuständig ist, einelandkartenähnliche Repräsen-tation der Körperoberflächeenthält. Allerdings ist sie nichtproportional zu dieser Ober-
fläche. Lippen und Hände lie-fern dem Menschen weitauswichtigere Tastempfindungenals etwa der Rücken. Entspre-chend ist dem Rücken nur we-nig Hirnrinde zugeordnet,während für Lippen und Händeviel größere Areale zur Verfü-gung stehen. Anhand der soidentifizierten Bereiche wurde
STITUTE aktuell
80 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
ZÜLCH-PREIS 2002
Plastizität in Hirn und Mark
Prof. MichaelMerzenich,University ofCalifornia.
Prof. MartinSchwab, Uni-
versität Zürich.
später das sensorische „Rinden-
männchen“ konstruiert: EinWesen mit winzigem Körper,aber riesengroßen Lippen undHänden, das man über die ent-sprechenden Abschnitte derHirnrinde zeichnete. Die For-scher nahmen damals an, dassdie Form dieses (und des moto-rischen) Rindenmännchens, dasheißt die Funktion der einzel-nen Hirnrindenareale, von Ge-burt an unveränderlich festge-legt ist – eine Vorstellung, die
DIE GERTRUD-REEMTSMA-STIFTUNG
wurde 1989 von Gertrud Reemtsma in Gedenkenan ihren verstorbenen Bruder, den NeurologenProf. Dr. Klaus Joachim Zülch, ehemaliger Direktorder Kölner Abteilung für allgemeine Neurologiedes Max-Planck-Instituts für Hirnforschung,Frankfurt, mit dem Ziel gegründet, die Erinnerungan das Lebenswerk ihres Bruders wachzuhaltenund besondere Leistungen in der neurologischenGrundlagenforschung anzuerkennen und zu fördern.Gertrud Reemtsma war schon Ende der dreißigerJahre mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnfor-schung in Berlin-Buch in Verbindung gekommen:Klaus Joachim Zülch, der dort als Neuropathologeund Neurologe mit dem Begründer der deutschenNeurochirurgie, Prof. Dr. Wilhelm Tönnis, zusam-menarbeitete, holte seine Schwester als Sekretärinan das Institut.Nach dem Krieg war Gertrud Reemtsma einegroße Förderin der Max-Planck-Gesellschaft – undzwar nicht nur seit 1964 als Förderndes Mitglied,sondern auch über finanzielle Zuwendungen für die
von ihrem Bruder geleitete Kölner Forschungsab-teilung. Anfang 1996 verstarb sie im achtzigstenLebensjahr in Hamburg.
F O T O S : M P G - A R C H I V

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 42/43
STANDo
3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 83
Ausgründungenwerden als ein Erfolgversprechender Wegdiskutiert, die Er-kenntnisse der mitöffentlichen Mittelngeförderten gemeinnützigenForschungseinrichtungenzu verwerten. Um Technolo-gietransfer zu fördern und zuunterstützen, gründete dasBundesministerium für Bil-dung und Forschung (BMBF)in einem Pilotprojekt den„Fonds zur Erleichterungvon Existenzgründungen ausForschungseinrichtungen“
(EEF-Fonds).
Der EEF-Fonds soll es For-schungseinrichtungen erlau-ben, mithilfe von Personal-kosten- und Sachmittelzu-schüssen in einer Höhe von biszu 141000 Euro den mit Aus-gründungen verbundenen Ver-änderungen besser zu begeg-nen. Antragsberechtigt sind
Forschungsinstituteder Hermann-von-Helmholtz-Gemein-schaft Deutscher For-schungszentren (HGF),der Wissenschaftsge-
meinschaft Gottfried WilhelmLeibniz (WGL), der FraunhoferGesellschaft (FhG) und derMax-Planck-Gesellschaft(MPG). Die Vorbereitung derAntragstellung läuft über dieTechnologietransferstellen der jeweiligen Forschungseinrich-tung. Für Projektanträge ausden Instituten der Max-Planck-Gesellschaft ist die Garching
Innovation behilflich.Ein Gutachterausschuss, dem je zwei Vertreter der MPG, derFhG und der WGL sowie drei Vertreter der HFG und einGastvertreter des BMBF an-gehören, nimmt die Begutach-tung des Verwertungskonzeptsund der rechtsverbindlichen Vereinbarungen vor. Nach posi-tiver Begutachtung erfolgt die
formale Antragstellung mitdem elektronischem Antrags-system („easy“). Anträgemüssen jeweils bis zu zehnArbeitstage vor der nächstenGutachterausschusssitzungeingereicht werden. ●
Weitere Informationenerhalten Sie von:
Garching Innovation GmbHTechnologien aus derMax-Planck-GesellschaftASTRID WEIHERMANN /ULRICH MAHR / DR. JÖRN ERSELIUS
Hofgartenstr. 880539 MünchenTel.: 089/290919-0
Fax: 089/290919-99E-mail: [email protected]: www.garching-innovation.mpg.de
Aktuelle Informationenzu den EEF-Fonds finden Sieim Internet unter:www.eef-fonds.deNächster Abgabeterminfür die Begutachtung:15. Dezember 2002
STITUTE aktuell
82 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2
TECHNOLOGIETRANSFER
Pilotprojekt fördert Ausgründungen
@
NIEDERLANDE
● NimwegenITALIEN
● Rom● FlorenzSPANIEN
● AlmeriaFRANKREICH
● GrenobleBRASILIEN
● Manaus
Forschungseinrichtungen der
Max-Planck-Gesellschaft
● Institut/
Forschungsstelle● Teilinstitut/ Außenstelle❍ SonstigeForschungs-einrichtungen
MAXPLANCKFORSCHUNG
wird herausgegeben vom Referatfür Presse- und Öffentlichkeitsarbeitder Max-Planck-Gesellschaft zurFörderung der Wissenschaften e.V.
Vereinsrechtlicher Sitz: Berlin.ISSN 1616-4172
Redaktionsanschrift:Hofgartenstraße 8, 80539 MünchenTel. 089/ 2108-0 (-1232)Fax 089/ 2108-1405E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.mpg.de.
MAXPLANCKFORSCHUNG will Mitarbeiter und Freunde der Max-Planck-Gesell-schaft aktuell informieren. Das Heft erscheint in deutscher und englischerSprache (MAXPLANCKRESEARCH) jeweils in vier Ausgaben pro Jahr.Die Auflage der MAXPLANCKFORSCHUNG beträgt zurzeit 31000 Exemplare(MAXPLANCKRESEARCH: 8000 Exemplare).Der Bezug des Wissenschaftsmagazins ist kostenlos.MAXPLANCKFORSCHUNG wird auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.Nachdruck der Texte unter Quellenangabe gestattet. Bildrechte können nachRücksprache mit der Redaktion erteilt werden.Alle in MAXPLANCKFORSCHUNG vertretenen Auffassungen und Meinungenkönnen nicht als offizielle Stellungnahme der Max-Planck-Gesellschaft undihrer Organe interpretiert werden.
Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften unterhält80 Forschungsinstitute, in denen rund 11200 Mitarbeiter tätig sind, davonetwa 3100 Wissenschaftler. Hinzu kamen im Jahr 2001 rund 7900 StipendiatenGastwissenschaftler und Doktoranden. Der Jahresetat umfasste insgesamt1245 Millionen Euro; davon stammten 1186 Millionen Euro aus öffentlichenMitteln. Die Forschungsaktivität erstreckt sich überwiegend auf Grundlagen-forschung in den Natur- und Geisteswissenschaften. Die Max-Planck-Gesell-schaft sieht ihre Aufgabe vor allem darin, Schrittmacher der Forschung zu sein.Die Max-Planck-Gesellschaftist eine gemeinnützige Organisation desprivaten Rechts in der Form eines eingetragenen Vereins. Ihr zentralesEntscheidungsgremium ist der Senat, in dem eine gleichwertige Partnerschaftvon Staat, Wissenschaft und sachverständiger Öffentlichkeit besteht.
Verantwortlich für den Inhalt:Dr. Bernd Wirsing (-1276)
Leitender Redakteur:Helmut Hornung (-1404)
Biologie, Medizin:Dr. Christina Beck (-1306)
Chemie, Physik, Technik:Helmut Hornung (-1404)
Geisteswissenschaften:Susanne Beer (-1342)
Schlussredaktion:
Walter Frese (-1272)
Redaktionsassistenz:Kerrin Hintz (-1232)
Bilddokumentation:Manuela Gebhard (-1287)
Online-Redaktion:Dr. Andreas Trepte (-1238)
Gestaltung: Rudi GillDTP-Operating: Franz PagelMitarbeit: Jürgen SchröderSenftlstraße 1, 81541 MünchenTel. 089/448 21 50 · Fax 48 47 52
E-Mail: [email protected]
Litho: kaltnermediaDr.-Zoller-Str. 1, 86399 Bobingen
Druck+Vertrieb:Druckhaus BeltzTilsiter Straße 17, 69502 Hemsbach
Anzeigen:Brigitte Bell
Verlagsgruppe BeltzPostfach 100154, 69441 WeinheimTel. 06201/6007-380Fax 06201/6007-393
E-Mail: [email protected]
IN EIGENER SACHE
MaxPlanck intern
macht sich
selbstständig
Mitarbeiter der Max-Planck-Gesellschaftwerden ihre Mitarbeiterzeitschrift, die bislangeiner Teilauflage der MAXPLANCK-FORSCHUNG
beigeheftet war, in dieserAusgabe vergeblich suchen:
Nachdem das Magazin seine„Shuttle-Funktion“ für die1999 neu entwickelten Seitenerfüllt hat, wird MAXPLANCK-INTERN jetzt abgekoppelt underscheint künftig als eigen-ständiges Produkt.
Nach den durchweg positiven Reak-tionen aus Reihen der Leserinnenund Leser erhofft sich die Redaktionvon dieser Abkopplung vor allemeine noch stärkere Wahrnehmung in
den Instituten und Einrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft. Mussten die Leserinnen undLeser MAXPLANCKINTERN bislang in der „richtigen“,also mit INTERN versehenen Ausgabe der MAX-PLANCKFORSCHUNG aufspüren, soll künftig jedeMitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ein eigenesINTERN-Exemplar bekommen. Nur so, das ist dieÜberzeugung der Redaktion, kann der Ansprucheiner wirklichen Mitarbeiterzeitschrift eingelöst
werden. Nichts ändern wird sichan dem bewährten Konzept vonMAXPLANCKINTERN: Es berichtet
weiterhin über Personalien undRufannahmen, informiert mitUnterstützung der jeweiligenInstituts-Pressebeauftragtendarüber, was an den Institutenpassiert, transportiert Nach-richten aus der Generalver-waltung und greift Hinter-grundthemen auf. In derersten eigenständigen Ausga-be findet sich eine ausführ-liche Dokumentation zurJahresversammlung. ●

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung
http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 43/43
Im FOKUS
Blau schimmert der Rote Planet und verrät im Boden verborgenes Wassereis: Große Mengen lagern im Polargebiet bis zum südlichen60. Breitengrad (unten). Dort ist der Marsboden in 20 bis 60 Zentimetern Tiefe vereist. Die Karte stammt von der amerikanischen Raumsonde „MarsOdyssey“, die damit zum ersten Mal größere Mengen an Wassereis fand, und zeigt den Himmelskörper im Licht von „epithermischen Neutronen“.Der Fluss dieser atomaren Teilchen ist umso geringer, je mehr Wasserstoff im Boden steckt. Die Farben geben an, ob die Detektoren viele (rot) oderwenige (blau) Neutronen registriert haben. Bevor „Mars Odyssey“ dem Roten Planeten so erfolgreich unter die Haut schaute, erarbeiteten Wissen-schaftler am Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie um Dr. Johannes Brückner in praktischen Versuchen und am Computer die Grundlagen für dieMessungen. Der Mars scheint für Forscher der Max-Planck-Gesellschaft überhaupt ein fruchtbares Feld zu sein: Dr. Konrad Dennerl vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching hat mit dem US-Weltraum-Observatorium „Chandra“ kürzlich erstmals Röntgenlicht vomRoten Planeten nachgewiesen. Ursache für dieses Fluoreszenzleuchten sind Wechselwirkungen des energiereichen Anteils der Sonnenstrahlung mitden Partikeln der Kohlendioxid-Atmosphäre des Mars. KARTE: UNIVERSITY OF ARIZONA & LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY