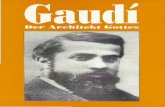Musik und Medien Gunter Reus Ruth Müller-Lindenberg...
Transcript of Musik und Medien Gunter Reus Ruth Müller-Lindenberg...
-
Die Notengeber
Gunter ReusRuth Müller-Lindenberg Hrsg.
Gespräche mit Journalisten über die Zukunft der Musikkritik
Musik und Medien
-
Herausgegeben vonH. Schramm, Würzburg, Deutschland
Musik und Medien
-
Die Buchreihe „Musik und Medien“ thematisiert die (massen)medial vermittelte und interpersonale Kommunikation über Musikereignisse, musikalische Aktivitäten, Musiker/innen, Musik(produkte) und die an der Entwicklung/Komposition, Verbreitung und Vermarktung von Musik(produkten) beteiligten Akteure und In teressensgruppen. Schriften dieser Reihe beschäftigen sich in erster Linie mit den kulturellen, gesellschaftlichen, historischen, ökonomischen, rechtlichen, ordnungs und bildungspolitischen, technischen und medialen Kontextbedingungen, unter denen sich Kommunikation über Musik entwickelt und ausgestaltet, sowie mit den Erscheinungsformen, Wandlungen, Potenzialen und Wirkungen dieser Kommunikation. Im Zentrum der Buchreihe stehen vor allem systematisierende Überblickswerke zum Wandel der Präsentation und Repräsentation von Musik(angeboten) in den audiovisuellen Medien sowie deren Produktion, Nutzung, Wirkung und Wertschöpfung unter den Bedingungen einer zunehmenden Medienkonvergenz. Neben den Überblickswerken können auch thematisch fokussierte Schriften, vor allem sehr gute Dissertationen (mit mind. „magna cum laude“ bewertet), beim Reihenherausgeber eingereicht werden: [email protected].
Herausgegeben vonHolger SchrammCampus Hubland NordUniv Würzburg,Inst MenschCompMedWürzburg, Deutschland
-
Gunter Reus · Ruth Müller-Lindenberg(Hrsg.)
Die NotengeberGespräche mit Journalisten über die Zukunft der Musikkritik
-
HerausgeberProf. Dr. Gunter ReusHannover, Deutschland
Prof. Dr. Ruth MüllerLindenbergHannover, Deutschland
Musik und MedienISBN 9783658159344 ISBN 9783658159351 (eBook)DOI 10.1007/9783658159351
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Springer VS © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen und MarkenschutzGesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist Teil von Springer Nature Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Die Anschrift der Gesellschaft ist: AbrahamLincolnStr. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
-
Inhalt
Einleitung.............................................................................................................. 7
Interviews
Birgit Fuß............................................................................................................ 35
Maurice Gajda .................................................................................................... 43
Volker Hagedorn ................................................................................................ 53
Robert Helbig...................................................................................................... 63
Britta Helm ......................................................................................................... 75
Markus Kavka..................................................................................................... 83
Albert Koch ........................................................................................................ 93
Peter Korfmacher.............................................................................................. 105
Harald Mönkedieck .......................................................................................... 115
Andreas Müller ................................................................................................. 125
Falk Schacht ..................................................................................................... 137
Dirk Schneider .................................................................................................. 149
Ruben Jonas Schnell ......................................................................................... 159
Claus Spahn ...................................................................................................... 167
Christiane Tewinkel.......................................................................................... 177
Albrecht Thiemann ........................................................................................... 189
Thomas Venker................................................................................................. 197
Rainer Wagner .................................................................................................. 207
-
Einleitung
1. Ein Blick zurück Die Zukunft der Musikkritik beginnt mit deren Vergangenheit. So unterschied-lich und teils einander widersprechend die Aussagen der in diesem Buch ver-sammelten Interviews mit Musikjournalistinnen und -journalisten sind – für fast alles lassen sich Wurzeln auf dem heterogenen Feld „Geschichte der Musikkri-tik“ finden. Über Fragen des ästhetischen Urteils, über die Aufgaben des Musik-journalismus, über seinen möglichen oder auch erwünschten Einfluss auf Kom-ponisten, Ausführende, das Publikum, über die Professionalität der Schrei-benden, ihren literarischen Anspruch, über Objektivität und Subjektivität, ja „Wahrheit“ hat es von Anfang an mehr oder weniger ausgesprochen Standortbe-stimmungen, Abgrenzungen, Meinungsverschiedenheiten, Übereinkünfte gege-ben. „Von Anfang an“ soll hier heißen: nicht schon in der Antike, etwa in Platons Staat, sondern ab dem Zeitpunkt, zu dem die kritische Auseinandersetzung mit Musik sich in publizistischen Formen artikulierte, also etwa seit Beginn des 18. Jahrhunderts: Damals erschienen die ersten deutschsprachigen, vom frischen Wind der Aufklärung beflügelten Zeitschriften, die schon das Wort „Kritik“ im Titel trugen: 1722 in Hamburg Johann Matthesons Critica Musica und 1737 Johann Adolph Scheibes Critischer Musicus, in Berlin 1749 Friedrich Wilhelm Marpurgs Der critische Musikus an der Spree und 1754 die Historisch-kritischen Beyträge zur Aufnahme der Musik etc. Mit dem Mut zur Vergröberung kann man für die seither vergangenen drei Jahr-hunderte als Abfolge von Leitbegriffen die Entwicklung von der Werkkritik zur Aufführungs- und schließlich zur Medienkritik entwerfen. Leitbegriffe sind es in dem Sinne, als sie sich parallel zum Musikleben entwickeln: Einer Musikkritik im eigentlichen Sinne des Wortes standen zu Beginn lediglich die gedruckten
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017G. Reus und R. Müller-Lindenberg (Hrsg.), Die Notengeber,Musik und Medien, DOI 10.1007/978-3-658-15935-1_1
-
8 Einleitung
Partituren, so überhaupt vorhanden, zur Verfügung; später dann die Aufführun-gen, die in einem sich ausdifferenzierenden öffentlichen Konzertwesen und der sich ebenfalls öffnenden Sphäre der Hofoper rasch an Zahl zunahmen; schließ-lich Tonträger verschiedener Art – von der Vinyl-Schallplatte über das Musikvi-deo zur CD, die im 21. Jahrhundert zunehmend von Streaming-Diensten und käuflichen Audio-Files abgelöst werden, mit schwer abzuschätzenden Konse-quenzen für Verbreitung, Rezeption und Bewertung. Scheint sich hier kaum noch eine Klammer für die gesamte Zeitspanne finden zu lassen – zu sehr differieren die Gegenstände, die mit „Musik“ bezeichnet wer-den –, so lässt sich doch ein gemeinsamer Nenner formulieren: Es geht im Wort-sinne des griechischen Verbums κρίνω (scheiden, trennen, streiten, urteilen) um Auswahl von Musik und Urteil über Musik mit den Mitteln der Sprache. Was dann in den einzelnen Phasen des Musikjournalismus jeweils die Kriterien für das Urteil waren – der Bogen reicht von „wahr und falsch“ über „falsch und richtig“, „schön und hässlich“ bis hin zu (moralisch) „gut und schlecht“ – und welche sprachlichen Mittel jeweils für geeignet gehalten wurden, dies unterliegt großen Schwankungen. Die Grundfragen bleiben dennoch dieselben. Oder fast: Denn die Antworten sind selbstverständlich ohne Berücksichtigung der jeweili-gen Medien unvollständig, werden von ihnen beeinflusst, so wie sie diese prä-gen. So hat beispielsweise Tadday (1993) argumentiert, dass der Diskurs über Musik sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen von Kultur-Tages-zeitungen ausdifferenzierte, weil er unterschiedlichen sozialen Systembe-dingungen unterlag: Der auf professionellem Niveau geführte Fachdiskurs fand in Fachzeitschriften statt, während die täglich verfügbaren Zeitungen dem Be-dürfnis nach Information über ästhetische Ereignisse entgegenkamen, einem Bedürfnis, das letztlich auf Gruppenbildung zielte. Wenn man sich über den letzten Opernskandal austauschen konnte, dann stiftete das eine soziale Identität, ohne dass man deshalb selber die Vorstellung besucht haben musste. Dieses Ziel war mit einem Fachjournal nicht zu erreichen. Denkt man den Gedanken – die Wechselbeziehung zwischen der Textsorte Mu-sikkritik und dem sie verbreitenden Medium – weiter bis in Gegenwart und Zu-kunft hinein, dann scheinen die Folgen, die die (vorerst?) teilweise Verlagerung von Musikjournalismus ins Internet hat und haben wird, kaum absehbar. In die-ser Rahmung wird plausibel, weshalb es in Fragen des ästhetischen Urteils so unterschiedliche, ja disparate Antworten gab und gibt.
-
Einleitung 9
In der Frühzeit der Musikkritik im neuzeitlichen Sinne machten sich die Spezia-listen ganz buchstäblich ans Werk: Musikkritik war Kritik an Werken. Die Tex-te, veröffentlicht etwa in Zeitschriften wie den oben genannten, bedienten sich eines Fachvokabulars, präsentierten Notenbeispiele und widmeten sich oft Spe-zialproblemen der Komposition. Deutlich lag der Akzent auf der satztechnischen Korrektheit der Kompositionen, aus der ästhetische Urteile sich wie von selbst ergaben. Die Richtschnur gab eine normative Poetik des Komponierens vor, wie das Beispiel Marpurgs zeigt: Über die „Claviervariationen“ eines Hamburger Organisten schreibt er mit der ganzen Autorität des Fachmanns, der weiß, was richtig und was falsch ist: „Der im lezten Tacte der ersten Clausel des Hauptsat-zes bey c befindliche Vorhalt mit d hätte besser wegbleiben können.“ (Histo-risch-kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, Bd. 1, Berlin 1754, S. 53) Allerdings ist einzuschränken, dass wirkliche Kritiken eher die Ausnahme als die Regel waren, weil die Zeitschriften sich überwiegend theoretischen Debat-ten, zum Beispiel derjenigen über den Vorrang der italienischen oder der franzö-sischen Musik, widmeten. An einem Meilenstein der Musikkritik, der berühmten Rezension E.T.A. Hoff-manns zu Beethovens Fünfter Symphonie (1810), lässt sich zeigen, dass einer-seits diese Poetik um 1800 noch intakt war, dass jedoch andererseits das ästheti-sche Urteil sich nicht mehr allein aus dem Befund „richtig oder falsch“ speiste: E.T.A. Hoffmann urteilte aus romantischem Geist, bemühte die Wucht des Ein-drucks, den die Musik auf ihr Publikum mache. Bedeutsamer und zukunftsträch-tiger noch: Die Sprache seiner Rezensionen knüpfte direkt bei den Dichtern der Romantik an, verwendete Metaphern, Vergleiche und narrative Module, wie man sie bis dahin fast nur aus der Schönen Literatur kannte: „So öffnet uns auch Beethovens Instrumental-Musik das Reich des Ungeheueren und Unermessli-chen. Glühende Strahlen schiessen durch dieses Reiches tiefe Nacht, und wir werden Riesenschatten gewahr, die auf- und abwogen, enger und enger uns einschliessen, und alles in uns vernichten, nur nicht den Schmerz der unendli-chen Sehnsucht, in welcher jede Lust, die, schnell in jauchzenden Tönen empor-gestiegen, hinsinkt und untergeht, und nur in diesem Schmerz, der, Liebe, Hoff-nung, Freude in sich verzehrend, aber nicht zerstörend, unsre Brust mit einem vollstimmigen Zusammenklange aller Leidenschaften zersprengen will, leben wir fort und sind entzückte Geisterseher.“ (In: Kunze 1987, S. 101)
-
10 Einleitung
Diese umfangreiche, mit Notenbeispielen und Kommentaren zur Kompositions-technik versehene Rezension erschien in einer Fachzeitschrift, der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung. Drei Jahre später jedoch veröffentlichte E.T.A. Hoffmann sie nochmals, und zwar in der Zeitung für die elegante Welt, mit einer bezeichnenden Änderung: Der gesamte musikanalytische Teil fiel weg. Den Lesern einer Tageszeitung gab man also die romantischen Ideen für das Musikerlebnis mit auf den Weg; eine Diskussion kompositorischer Einzelheiten ersparte man ihnen. Gerade an der gut dokumentierten zeitgenössischen Beethoven-Kritik lässt sich zeigen, dass unterschiedliche, sogar disparate Kriterien koexistieren konnten: So bemängelt 1805 ein unbekannter Rezensent in der Berlinischen Musikalischen Zeitung den Beginn der Ersten Symphonie: „Dergleichen Freiheiten und Eigen-heiten wird niemand an einem genialischen Künstler wie Beethoven tadeln, aber ein solcher Anfang passt nicht zur Eröfnung eines grossen Concerts in einem weiten Operntheater.“ (In: Kunze 1987, S. 22). Scheint es hier noch eine objek-tive Beurteilungsinstanz zu geben, so schimmert doch schon die Überzeugung durch, dass das Genie sich seine Regeln selber gebe. Allerdings geriet auch diese Instanz ins Wanken: In der eigentlich konservativen Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung bekannte 1816 ein Kritiker angesichts einiger für ihn kaum erträglicher Stellen in der Klaviersonate op. 90 freimütig, dass „es sonach der Zeit anheim gestellt werden muss, ob sie sich an dergleichen Züge gewöhnen (…) will“ (in: Kunze 1987, S. 267). Es dürfte den Musikgelehrten des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts nicht leicht gefallen sein, von der Werkkritik zur Aufführungskritik überzugehen. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass es zu dieser Zeit zahlreiche Konzertkritiken gab, die, obwohl sie doch über konkrete Ereignisse berichteten, in keiner Weise auf die Aspekte der Aufführung eingingen, etwa auf das Können der Vortragen-den, Einzelheiten der Besetzung, Aufnahme durch das Publikum und anderes mehr. Das Vokabular dafür musste sich erst entwickeln und einbürgern. Die großen Virtuosenauftritte in den Musik-Hauptstädten des 19. Jahrhunderts, in Paris, Wien, Berlin und London, gaben den Anlass dazu. Über die Spielweise des berühmten Geigers Paganini schrieb 1829 die Allgemeine musikalische Zei-tung: „(D)er Bogen wird sehr lang und frey, in perpendiculöser Richtung, mit weiter Zurückbiegung des rechten Arms, und überaus grosser Oeconomie des Strichs geführt; der Ton ist nicht sehr stark, doch voll, weich und schön, beson-
-
Einleitung 11
ders im piangendo, dolente und smorzando; die Intonation bleibt goldrein in den schwersten Sprüngen; unfehlbare Sicherheit und höchste Präcision bezeichnet den Meister.“ (Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung, Nr. 16, 1829, S. 257) Zugleich schuf Robert Schumann, hochspezialisiert als Pianist und als Kompo-nist, mit seiner Neuen Zeitschrift für Musik seit 1834 ein Forum für einen Musik-journalismus, der nichts weniger beanspruchte als „eine junge, dichterische Zeit vorzubereiten“, wie es im ersten Heft des Jahrgangs 1835 hieß. Interessanterwei-se änderte Schumann die „junge, dichterische Zeit“ in „eine neue poetische Zeit“ um, als er 1854 dieses Editorial in seine Gesammelten Schriften aufnahm. Der Anspruch von Musikjournalismus und -kritik griff nach dem gesellschaftlichen Ganzen und tat es in dichterischen Formen. Diese Vorstellung von Musik als einem die Gesellschaft verändernden Element oder, bescheidener gesprochen, als einer Kraft, die in die Gesellschaft hineinwirkt, wie sie aus ihr heraus ent-steht, ging nicht mit dem 19. Jahrhundert unter. Theodor W. Adorno war es, der 1967, nach einer finsteren Phase der Gleichschaltung von Musikkritik während des nationalsozialistischen Regimes, postulierte, Musik sei immer auch soziale Tatsache. „Für den Kritiker ist unablässig die Reflexion auf soziale Tatsachen, etwa auf Probleme des gegenwärtigen Musiklebens, den Festspielbetrieb, das Verhältnis von Repertoire und Stagione, die Krisis des Solisten und ungezählte andere Momente dieser Art notwendig.“ (Adorno 1968, S. 16) Dies brachte ihm den erbitterten Widerstand H. H. Stuckenschmidts, eines im Nachkriegsdeutsch-land maßgeblichen Musikkritik-Theoretikers, ein: „Ich finde den katastrophalen Verfall des Kunsturteils und besonders der Musikkritik darin begründet, dass die Kritiker sich der bequemen Prozedur verschrieben haben, Kunsterscheinungen – ob es stimmt oder nicht – als sozial bedingt zu erklären.“ (In: Hamm 1969, S. 86) Derselbe Adorno war es freilich auch, der forderte, Kritik müsse auf den „Wahr-heitsgehalt“ der Kunstwerke zielen und sei deshalb letztlich nur philosophisch bestimmbar (Adorno 1968, S. 12). An diesem Diktum wird deutlich, wie sehr der Cultural turn unsere Perspektive verändert hat: Heute erscheint die von Adorno angenommene „Wahrheit“ der Werke mehr als ein Glaubensinhalt denn als eine gesicherte Tatsache. Ohnehin steht die Aufführungskritik, zu der hin sich der Schwerpunkt bereits im 19. Jahrhundert verlagerte, auf weniger gesi-chertem Grund als die verschriftlichte Partituranalyse und -beurteilung: Es geht ja bei einem Konzert um etwas Einmaliges, um ein unwiederholbares Ereignis.
-
12 Einleitung
Jeder Reflex trägt immer auch das Signum der individuellen Rezeption, der subjektiven Wahrnehmung. Dass dies jedoch nicht zur völligen Beliebigkeit führen muss, haben linguisti-sche Studien zur Musikkritik deutlich gemacht: So arbeitete Gabriele Böheim an fünf österreichischen Tageszeitungen heraus, dass es bevorzugte Metaphern und Bildfelder gebe, die mit signifikanter Häufigkeit in Musikkritiken auftreten: „Am häufigsten belegt sind Vergleichsstrukturen aus dem Bereich ‚unbelebte Natur‘, etwas weniger häufig aus den Bereichen ‚belebte Natur‘, ‚Mensch‘, ‚Krieg‘, ‚Sport‘, ‚Zirkus‘, ‚Gastronomie‘ und ‚Bekleidung/Stoff‘.“ (Böheim 1987, S. 221). Es ist eine plausible Hypothese, dass diese Vergleichsreservoirs sich jeweils mit dem Medium, der historischen Situation, dem musikalischen Gegenstand verän-dern: In Besprechungen von Heavy-Metal-Musik wird man wohl kaum Natur-metaphern als zentrale Verbalisierungsstrategie finden; und falls doch, dann stehen sie gewiss nicht an erster Stelle wie etwa im österreichischen Feuilleton der 1980er Jahre, haben jedenfalls in einer globalisierten Welt Konnotationen, die 1980 noch nicht absehbar waren. Die Rede über Musik ist nicht primär ge-prägt von der „Sache an sich“, sondern gehorcht Diskursen, die kulturell, histo-risch und medial geprägt sind. Eine neuere soziologisch-textlinguistische Arbeit sucht deshalb den Urgrund der Verbalisierung nicht so sehr in Sprechkonventionen, sondern sehr allgemein in der Emotionalität von Musik (Holtfreter 2013). In der Tat zieht sich die Über-zeugung, dass Musik Gefühle ausdrücke und hervorrufe, als gemeinsamer Nen-ner durch das Rezensionswesen. Das schafft freilich Komplikationen für den verbalen Austausch über diese Phänomene. Schon früh wurden die Schwierig-keiten beim Sprechen über Musik erkannt: Einen Notentext nach allen Regeln der Kompositionskunst zu beschreiben und zu erklären – das war noch nicht problematisch. Sinnliche Eindrücke aber und emotionale Zustände zu verbalisie-ren, das trieb den Rezensenten schnell an die Grenzen seiner Sprache. Der Un-sagbarkeitstopos im Bezug auf die Wirkungen von Musik taucht ja bereits als Bestandteil von Musikbeschreibungen im empfindsamen Roman vor 1800 auf. Hier rationales „Zergliedern“ (um einen Begriff des 18. Jahrhunderts zu verwen-
-
Einleitung 13
den), dort der Versuch musikalischen Ausdruck zu versprachlichen: Das sind die beiden Pole, um die sich einerseits die Notentexterklärer, andererseits die Auf-führungsevozierer versammeln. Oft genug wechseln Musikkritiken von der einen Position in die andere über und weisen dabei auf eine tiefe Kluft. Niemand hat dies prägnanter auf den Punkt gebracht als der Komiker Heinz Erhardt, als er über den Musikkritiker schrieb: „Morgen werden wir dann lesen, ob es uns gefallen hat.“ Denn dass etwas nachgewiesenermaßen gut gemacht ist und gut vorgetragen wird, heißt noch nicht, dass es auch gefällt. Andererseits ist das Gefallen ein angreifbares Kriterium, das zeitweise unter Trivialismusverdacht gestellt wurde. Das lässt sich an einem etwas skurrilen Beispiel aus dem 19. Jahrhundert de-monstrieren: Das „Gebet einer Jungfrau“ der polnischen Komponistin Tekla Bądarzewska-Baranowska war ein Jahrhunderterfolg. In einer Zeit, in der die sogenannte Salonmusik aus einleuchtenden soziokulturellen Gründen Hochkon-junktur hatte, stellte dieses nicht allzu schwer zu spielende Klavierstück offenbar den Inbegriff des Marktgängigen dar. Ohnmächtig stand eine Kritik, für die es sich – unter der Maßgabe „differenziert = gut, einfach = schlecht“ – um eine miserable Komposition handelte, der Tatsache gegenüber, dass das sehr, sehr viele Käufer nicht zu interessieren und der Beliebtheit des kleinen Charakter-stücks keinen Abbruch zu tun schien. Dieser Sachverhalt für sich wäre noch nicht weiter bemerkenswert. Auffällig ist jedoch der aggressive Affekt in der ästhetischen Bewertung, ein Affekt, der selbst vor menschenverachtenden Äuße-rungen nicht zurückschreckt. So findet sich im Musikalischen Conversations-Lexikon von Hermann Mendel (1870) die folgende Passage: „[Tekla B.] war jedoch nicht befähigt, etwas den seichtesten Dilettantismus Überragendes zu Tage zu fördern. […] Ein frühzeitiger Tod, im J. 1862 zu Warschau, verhinderte sie, die Welt mit weiteren demoralisierenden Producten einer Aftermuse zu überschwemmen.“ Offensichtlich fühlten die Kunstrichter sich von einem Erfolg bedroht, der nach ihren Kriterien gar nicht hätte eintreffen dürfen. Freilich dürfte dieses Dilemma, die Koppelung von ästhetischer mit ethischer Qualität, den Musikjournalistinnen und -journalisten des 21. Jahrhunderts nicht mehr im Wege stehen; es zog sich aber lange durch das Denken derer, die über Musik urteilten. So kam noch 1965 eine Dissertation zu dem Ergebnis, dass schlechte Musik „minderwertig, sentimental-verlogen, kitschig, geschmacklos-
-
14 Einleitung
billig“, vor allem aber „geistig nichtssagend“ sei (Eggli 1965, S. 1), und Carl Dahlhaus konstatierte 1985, im Begriff gute bzw. schlechte Musik seien „kom-positionstechnische, ästhetische, moralische und soziale Momente“ miteinander verquickt (Dahlhaus 1985, S. 88). Dem rein subjektiven Bewerten von Musik schob der einflussreiche Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick (1825-1904) mit seiner Schrift Vom Musikalisch-Schönen einen Riegel vor: Mit der Aussage, „tönend bewegte Formen“ seien Inhalt der Musik (und damit auch deren Bewertungsgrundlage), wandte er sich scharf gegen die Beliebigkeit eines Wahrnehmungssubjektivismus als Aus-gangspunkt für eine ästhetische Beurteilung (vgl. Hanslick 1965). Diese Ex-tremposition (die Hanslick in seinen Kritiken übrigens nicht durchhielt) taugt bis heute dazu, ein Paradigma zu charakterisieren, das auch aus einigen der hier vorgelegten Interviews noch aufscheint. Es wurde erbittert darum gestritten, zumal Hanslick für sich in Anspruch nahm, mit dem Kriterium der formalen Stimmigkeit zugleich auch die Schönheit des Kunstwerks zu definieren. Wäh-rend heute die auf Kunstregeln beruhende Aussage, etwas sei schön, weitgehend abgelöst ist durch den Satz „Das gefällt mir“, war das Kunstschöne in der zwei-ten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Richtgröße noch halbwegs intakt. Allerdings konstatierte Karl Rosenkranz bereits 1853 in seiner Ästhetik des Hässlichen, dass sich in der Musik „mit der dieser Kunst eigenen subjectiven Innerlichkeit die Möglichkeit des Hässlichen“ steigere (Rosenkranz 1853, S. 50). „Schönheit“ oder nicht ist aktuell kein zentraler Streitpunkt mehr; wohl aber ist es nach wie vor die Frage, ob, pointiert formuliert, die schriftlich fixierte Struk-tur oder der reine Höreindruck das Kernkriterium für die Beurteilung ausmachen solle. Es liegt auf der Hand – und zeigt sich auch in den Interviews –, dass die Antwort auf diese Frage stark vom Genre abhängt, auf die sie sich jeweils be-zieht. Die Ausschließlichkeit, mit der Hanslick über „die Musik“ reden konnte, beruhte ja darauf, dass nur das „Hochkultur“-Segment von Musik überhaupt kritikwürdig war; über populäre Musikbereiche wurde kein kritischer Diskurs ausgetragen – eine Tatsache, die sich in der Gegenwart drastisch verändert hat. Ein Fazit zu den hier skizzierten musikhistorischen Beobachtungen könnte lau-ten: Blickt man weniger auf die Gegenstände und Inhalte als vielmehr auf die Kriterien von Musikkritik, so gibt es einerseits einen festen Bestand, der in allen historischen Phasen in mehr oder weniger deutlicher Ausprägung auftritt; ande-
-
Einleitung 15
rerseits zeigt sich, was von Beginn an nur andeutungsweise vorhanden war, als das Differenzierungs- und Entwicklungspotenzial in Gegenwart und Zukunft. Je mehr unterschiedliche Medien an der Distribution von Musikkritik über vielfäl-tige und sehr unterschiedliche Segmente des Musiklebens beteiligt sind, desto stärker bestimmen die Spezifika der Medien ebenso wie diejenigen der diversen Musikgenres auch Ausrichtung und Innovation von Musikkritik. Es wird sich an weiteren Erfahrungen mit der „Schwarmintelligenz“ ebenso wie an der Entwick-lung des klassischen Feuilletons entscheiden, welche Rolle Professionalität künf-tig spielen und ob sie sich nicht neu definieren kann. 2. Zur Befragung Hat die Vergangenheit der Musikkritik eine Zukunft? Vielleicht ist ihre Rolle ja auch ausgespielt. Vielleicht wischt die Generation Smartphone bald schon weg, was einmal in den Journalen und frühen Tageszeitungen, in den Salons und Kaffeehäusern Bestandteil des Kampfes um kulturelle Emanzipation des Bürger-tums war. Vielleicht brauchen emanzipierte Mediennutzer von morgen die eben skizzierte publizistische Dienstleistung des Musikjournalismus, seine Metaphern und Analysen, seine poetischen Kühnheiten und seine richterlichen Zumutungen, sein subjektives Ringen um objektive Erkenntnis nicht mehr. Denn längst hält das Internet jede Art von Musik zu jeder Zeit bereit. Wenn aber alles verfügbar und von jedem unmittelbar selbst zu beurteilen ist, wozu dann noch auf Vermitt-lung und Urteile anderer zurückgreifen? Und wenn Vermittlung doch einmal gebraucht wird, finden sich in Microblogs, auf Datenplattformen aller Art und nicht zuletzt in den sozialen Netzwerken nicht-journalistische, oft von Musikern oder Industrie ausgestreute Informationen, Tipps und Empfehlungen, die ausrei-chend Halt und Orientierung zu geben scheinen (vgl. Leitmannstetter 2012; Krause und Weinacht 2009). Zudem ändert sich die Rezeption vor allem von Popmusik. Zwar produzieren Künstler heute mehr Alben denn je zuvor. Junge Hörer aber suchen online ver-fügbare Einzeltitel (vgl. Mühl 2012, S. 603f.), die sie sich gern zu persönlichen Playlists zusammenstellen. Der eigene Geschmack und die Suche nach der Ni-sche sind ihnen wichtiger als das Bedürfnis, sich zu einer stilistisch geschlosse-nen Jugendkultur zu bekennen. Diese „babylonische[n] Zersplittertheit“ der Sze-
-
16 Einleitung
ne (Klaus Fiehe, in Springer und Steinbrink 2005, S. 86) stellt eine Musikkritik in Massenmedien, die im Prinzip für alle da sein will, vor gewaltige Probleme. Vom Ende des Kulturjournalismus im Allgemeinen wie des Musikjournalismus im Besonderen raunen die Auguren auch immer wieder. Empirisch nachweisen lässt sich der Untergang auf der Angebotsseite freilich (noch?) nicht. Anders als vielfach behauptet, schrumpfen zum Beispiel die Feuilletons der Tageszeitungen nicht zusammen, sind Rezension und Kritik in ihrer traditionellen Rolle unange-fochten (vgl. Reus und Harden 2005; 2015). Musik ist in den Leitmedien des Kulturjournalismus der wichtigste Berichterstattungsgegenstand überhaupt (vgl. Reus 2015, S. 213). Gleichwohl steht der FAZ-Musikkritiker Wolfgang Fuhrmann gewiss nicht al-lein, wenn er „kalte[n] Wind“ zu spüren glaubt, der der Profession „aus dem demokratischsten aller Medien, dem Internet“ entgegenwehe (Fuhrmann 2012, S. 197). Historisch gebunden vor allem an Druckmedien und Hörfunk, sind die klassischen Orte des Gesprächs über Musik vom Beben der Medienlandschaft unmittelbar betroffen. Auflage und Umfang der Presse sinken seit Jahren kon-stant (vgl. z. B. Vogel 2014); dem Radio, einst als Musikvermittler bei Jugendli-chen besonders beliebt, hat das Internet in Nutzungsdauer und Reichweite bei der jungen Generation längst den Rang abgelaufen (vgl. Breunig und van Eime-ren 2015, S. 512). Können die Bastionen der Musikkritik unter diesen Umständen standhalten, oder stürzen sie in sich zusammen? Werden sie vielleicht sogar gefestigt aus den Erschütterungen hervorgehen? Entstehen neue Gebäude, die neuen Halt verspre-chen, und wo? Mit Fragen dieser Art beschäftigten wir uns vom Frühjahr 2014 bis Anfang 2015 in einem Projektseminar des Master-Studienganges Medien und Musik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Wir verfolgten die oben beschriebene historische Genese des Musikjournalismus und zeichneten seine Maximen nach. Wir analysierten die Veränderungen des Me-dienmarktes und ihre Folgen für die Rezeption von Musik wie für die Kulturbe-richterstattung. In einer Online-Befragung hatte eine frühere Projektgruppe des Studienganges Daten zur beruflichen Wirklichkeit und zum Selbstverständnis von Musikjourna-listen heute zusammengetragen (Reus und Naab 2014). Dabei hatte sich gezeigt,
-
Einleitung 17
dass Musikjournalisten vergleichsweise gelassen auf ihre berufliche Situation blicken. Sie zweifeln nicht an der Notwendigkeit ihrer journalistischen Spezial-disziplin und verstehen sich vor allem als Informationslieferanten mit hohem Autonomieanspruch. U- wie E-Musikjournalisten, Zeitungs- wie Onlinejourna-listen wiesen hierbei überraschende Gemeinsamkeiten auf. Auch diese Ergebnis-se und ähnliche Studien zu Musikkommunikatoren heute (vgl. Doehring 2011) griffen wir auf, um die Fragestellung unseres Projektes prognostisch zu vertiefen und weiterzutreiben: Kann und wird dieses Metier überleben und sich weiter-entwickeln? Welche Zukunft hat die Musikkritik? Experten, nämlich Musikjournalisten selbst, sollten Auskunft geben. Die Fragen, die wir an sie hatten, gruppierten wir zu vier Dimensionen: Wer ist der Musik-journalist/die Musikjournalistin der Zukunft? Wer ist das Publikum der Zukunft? Welche Themen und Formen bestimmen einen künftigen Musikjournalismus? Welche Verbreitungswege wird er finden? Damit hatte der Leitfaden sein Gerüst, mit dem die 18 Interviewerinnen und Interviewer in die Gespräche gingen. Rund 40 offene Unter- und Einzelfragen erlaubten eine variable Gesprächsgestaltung (Reihenfolge, Auswahl), denn die Interviews sollten an die Persönlichkeit und das von ihr vertretene Medium angepasst sein. Dennoch war mit diesem halb-standardisierten Verfahren garantiert, dass es in allen Interviews um dieselben Themenkomplexe ging und somit Vergleichbarkeit gegeben war. Zur Ge-sprächseröffnung stellten die Studierenden allen 18 Experten dieselbe Frage. Bei der Auswahl dieser Experten (der sogenannten Stichprobe) folgten wir den Kriterien der bereits zitierten Online-Befragung: Die befragten Journalistinnen und Journalisten mussten für ein herkömmliches Massenmedium oder eine Onli-ne-Redaktion arbeiten, regelmäßig über musikalische Ereignisse berichten, einer redaktionellen Kontrolle unterliegen und durften nicht im Auftrag von Musik-wirtschaft oder Künstlern handeln (vgl. Reus und Naab 2014, S. 110f.). Damit war das unüberschaubare Heer „privater“ Blogger ausgeschlossen. Die geringe Zahl von Frauen in unserer Stichprobe (drei von achtzehn) entspricht ihrem tatsächlichen Anteil von nur etwa 20 Prozent am Musikjournalismus ins-gesamt (vgl. Reus und Naab 2014, S. 118). Die Verteilung auf unterschiedliche Mediengattungen sowie die Spezialisierung der Befragten auf „U“- oder „E“-Musik (siehe dazu die Vorspänne zu den Interviews) kommt der Berufswirklich-keit des Musikjournalismus ebenfalls nahe (vgl. Reus und Naab 2014, S. 118-
-
18 Einleitung
120). Überproportional vertreten sind in unserer Stichprobe dagegen (auch ehe-mals) festangestellte Redakteure und Redakteurinnen, was damit zu tun hat, dass sie für uns über die Redaktionen leichter anzusprechen waren. Wie in allen qua-litativen Interviews dieser Art ist die Auswahl der Teilnehmer nicht repräsenta-tiv. Auf die Gespräche folgten Transkription und Dokumentation sowie die inhaltli-che Auswertung. Die Transkription der Mitschnitte geschah in zwei Stufen. Die erste Textfassung gab so exakt wie möglich den Wortlaut des Gesprächsverlaufs wieder, wie es einem wissenschaftlichen Interviewverfahren entspricht. Auf dieser Grundlage fertigten die Studierenden zweite Versionen an. Sie folgten nun den Gesetzen der Lesbarkeit und der Verständlichkeit. Ohne inhaltliche Aussagen zu verändern, wurden Sätze gekürzt, begrifflich entschlackt, umgebaut und umgestellt, so wie es in der Druckfassung journalistischer Interviews üblich ist. Diese zweiten Fassungen dokumentiert der vorliegende Band. Das Verfahren knüpfte an einen vor zwei Jahren in dieser Reihe veröffentlichten Gesprächsband an (Reus 2014). Es sollte wie das Projekt insgesamt den Teilnehmenden unter anderem vor Augen führen, wie eng verwandt das sozialwissenschaftliche Inter-view und das sorgfältig vorbereitete journalistische Interview sind. Diese Ein-sicht mag manche, in der Wissenschaft wie in der Praxis, überraschen. Einige Überraschungen hielt auch die Analyse der Interviews bereit. 3. Musikjournalismus der Zukunft – Ergebnisse im Überblick 3.1 Chancen und Gefährdungen „Er hat eine große Zukunft und eine große Gegenwart“, antwortet Ruben Jonas Schnell (ByteFM) auf unsere übergreifende Eingangsfrage nach der Zukunft des Musikjournalismus. „Mittelspersonen, die den Endnutzern relevante Zusammen-hänge aufzeigen“, werden für Schnell künftig „sehr wichtig“. Mit diesem frap-pierenden Optimismus steht er nicht allein – und mediale Unterschiede sind dabei nicht auszumachen: Der freie Hörfunkjournalist Dirk Schneider argumen-tiert ganz ähnlich. Peter Korfmacher (Leipziger Volkszeitung) spricht gar von einer „rosige[n] Zukunft“. „Auf jeden Fall eine Zukunft“ bescheinigt dem Metier auch Britta Helm (einst Visions), wenngleich unklar bleibe, „in welcher Form und in welchen Medien“. Ebenso drückt Rainer Wagner (Hannoversche Allge-
-
Einleitung 19
meine Zeitung) seine Zuversicht aus: „[Der Musikjournalismus] hat auf jeden Fall eine Zukunft […] als Berufung, vielleicht als Beruf.“ Trotz dieser Ein-schränkung rät der Zeitungsmann und E-Musikjournalist Wagner am Ende des Interviews jungen Menschen zu, den Beruf zu ergreifen: „Wenn Sie es wirklich wollen und sagen ,Das ist mein Ding!', dann machen Sie es auch. […] Bedarf besteht nach wie vor.“ Dass es Musikjournalismus, bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und not-wendigen Veränderungen, „weiterhin“, „immer“ und „nach wie vor“ geben werde, betonen der Hörfunkjournalist Andreas Müller, der ehemalige TV-Moderator Markus Kavka, Ex-ZEIT-Redakteur Claus Spahn und der ehemalige Intro-Chefredakteur Thomas Venker. Andere äußern sich zurückhaltender, stel-len aber die Zukunft ebenfalls nicht in Frage. Sie verweisen darauf, dass der Musikjournalismus „seinen Höhepunkt hinter sich“, gleichwohl „seine Balance gefunden“ habe, auch wenn das Berufsbild „weiter zerfasern“ werde (Maurice Gajda, Joiz). Dass er „lebenswichtig“ für die Kultur sei, allerdings seine „ver-moosten Formen“ überwinden müsse, mahnt der freie Journalist und Musiker Volker Hagedorn an. Und Albrecht Thiemann (Opernwelt) spricht immerhin vom „Überleben“ in einer Zeit, in der „die musikalische Grundbildung in der Breite der Gesellschaft nachgelassen hat“ und Medienentscheider keine „innere Bindung an klassische Musik und Musikkritik [mehr] haben“. Wenngleich es in einer Expertenbefragung nicht darum geht, Mehrheiten zu bestimmen und Prozentsätze zu berechnen, so fällt doch auf, dass lediglich drei Journalisten schwarz sehen, wenn sie nach vorn schauen. „Keine große Zukunft“ sieht dort Albert Koch (Musikexpress) und gibt sich „pessimistisch“. Auch Hör-funkmoderator Harald Mönkedieck sieht die Entwicklung „sehr kritisch“; Kultur werde „ökonomisiert“, „Fachjournalisten für Musik“ würden zu „Dienst-leister[n]“ und zur „bedrohte[n] Spezies“. Neben diesen beiden Vertretern genu-in musikjournalistischer Medien prophezeit ausgerechnet der Blogger Robert Helbig den Absturz (obwohl er im Gespräch dann doch Chancen und Möglich-keiten erkennt): „Insbesondere stellt sich die Frage nach der Finanzierung. Jour-nalisten müssen ja auch bezahlt werden. Aber die Musikwirtschaft bricht ein, die Verkaufszahlen sinken, und das reißt den Musikjournalismus mit in den Ab-grund.“
-
20 Einleitung
Helbig benennt damit ein Problem, um das alle wissen, wenngleich es nicht alle derart bedrohlich einordnen. Es ist nicht die vom Internet ermöglichte Jeder-mann-Musikkritik der Laienjournalisten und -blogger, die die Profis beunruhigt. Diese Konkurrrenz tun viele der Befragten fast als Marginalie ab: Zu gering erscheinen ihnen Reichweite, Qualität, Renommee, Sprachvermögen, Kontinui-tät oder Kompetenz. Zumindest glauben sie nicht, „dass Blogs den fundierten Journalismus ablösen werden“ (Schneider). „Es gibt tatsächlich einen Unter-schied zwischen Profis und Leuten, die eine Meinung haben“, weiß Andreas Müller. Und Britta Helm, Redakteurin beim Rolling Stone, sieht zwar „eine Handvoll guter Blogs“, vermutet aber auch, „die Leute haben langsam genug“. Andere sehen in Blogs durchaus eine Bereicherung (Korfmacher), wollen gar keinen Unterschied zwischen Journalisten und Laien gelten lassen (der Hip-Hop-Journalist Falk Schacht, auch Schnell) und wünschen sich geradezu die Stärkung und Professionalisierung von Musikblogs (Venker und die E-Musikkritikerin Christiane Tewinkel). Sorgen jedenfalls scheint die Blogosphäre keinem Befrag-ten zu bereiten – ein Befund, der sich auch bei unserer Online-Befragung ab-zeichnete (vgl. Reus und Naab 2014, S. 127). Anders die wirtschaftliche Schwächung von Musikindustrie und Musikmedien, die das Internet ebenfalls mit sich gebracht hat. Insgesamt sei „der Musikjourna-lismus finanziell aus den Fugen geraten“, weiß Thomas Venker. Die Erträge von Zeitungen und Zeitschriften sinken, Redaktionsetats werden gekürzt, Stellen abgebaut, und im Netz lässt sich künftig kaum mehr Geld mit Musikjournalis-mus verdienen – daran scheint es für die Befragten keinen Zweifel zu geben. Albrecht Thiemann spricht deshalb von einer „große[n] Ratlosigkeit“ im Berufs-stand der Musikkritiker. Die übrigen in unserem Band vereinten Journalisten teilen diese Ratlosigkeit, unabhängig davon, für welches Medium sie arbeiten. Befragt, wie sich der Musikjournalismus von morgen finanziere und welche neuen Geschäftsmodelle sich entwickeln könnten, äußern sich viele auffällig abwartend oder betonen, dass noch keine Lösung gefunden sei. Andere heben hervor, was sich als Modell gerade nicht bewährt habe. So begründet der Blog-ger Robert Helbig ausführlich, warum Bannerwerbung und die Kalkulation mit bloßen Klickzahlen „den Journalismus kaputt“ machten. Die Lösungsvorschläge, die einige schließlich konkret benennen, sind heterogen und beweisen auf ihre Weise, wie schwankend die Gewissheiten, wie ungewiss die Hoffnungen sind: Eine „Art Kulturpauschale“ etwa wünscht sich Christiane
-
Einleitung 21
Tewinkel, mit der „Stellen für Musikredakteure“ zentral finanziert werden könn-ten. Ganz ähnlich sieht Schacht eine „politisch eingeführte Mediensteuer“ als Möglichkeit. Auch Crowdfunding könnte für ihn ein gangbarer Weg sein. Dass Leser mit ihren Klicks auf einzelne Beiträge geringe Beiträge zahlen, hält Hage-dorn für sinnvoll, kann sich aber genauso gut Crowdfunding vorstellen. Der Zeitungsjournalist Wagner setzt ebenfalls auf Bezahlmodelle, während Thomas Venker „Branded Content“ befürwortet, also die Bindung journalistischer For-mate an Marken, die als Sponsoren auftreten. Sponsoring nennen auch Koch, Kavka und Schnell; Birgit Fuß glaubt aus der Sicht der Zeitschrift Rolling Stone hingegen, Anzeigen- und Vertriebserlöse reichten „immer noch“ aus, „um die Leute anständig zu bezahlen“. Schlechte Bezahlung und prekäre Beschäftigungsverhältnisse werden auch im-mer wieder genannt, wenn es um die Arbeitsbedingungen geht. Sie sind schon im Musikjournalismus der Gegenwart ein großes Thema. Nur etwa ein Drittel der Musikjournalisten heute hat einen Redakteursvertrag, und die Einkünfte der freiberuflich Tätigen sind deutlich niedriger als die der Festangestellten – jeder vierte „Freelancer“ muss sich mit Honoraren unter 1000 Euro pro Monat zufrie-dengeben (vgl. Reus und Naab 2014, S. 118f.). Um diese schwierige Situation wissen alle Befragten. Christiane Tewinkel fasst sie prägnant zusammen: „Eine Festanstellung ist kaum noch möglich. Im Moment ist es aber so, dass man von freiem Musikjournalismus allein überhaupt nicht leben kann.“ Dass sich die Situation in der Zukunft bessern werde, erwartet niemand – im Gegenteil: „Die Bedingungen für Musikjournalisten“, so sagt es Birgit Fuß, werden sich „gene-rell eher noch verschlechtern“. Von „Ausbeutung“ der Freien ist die Rede (Ha-gedorn); Spahn erinnert auch an die schlechte Bezahlung von Online-Journalisten. Korfmacher rechnet damit, dass „sich der Beruf in Zukunft immer mehr auf die Festangestellten fokussieren“ werde. Seine Kollegen sehen das anders und vermuten, dass Musikberichterstattung im Gegenteil noch mehr von den (billigeren) freien Journalisten getragen werde. „Den ,reinen' Musikjourna-listen“ aber werde es dann „fast nicht mehr“ geben (Gajda). Denn um zu überle-ben, müssten Freie – so die in unseren Interviews mehrfach ausgesprochene Empfehlung – bereit sein, „mehrgleisig“ (Thiemann) zu fahren, zusätzlich für andere Ressorts zu arbeiten (Gajda, Venker, Schneider) und andere Aufträge bis hin zu Marketing und PR zu akzeptieren (Thiemann, Spahn, Schacht), sofern sie das mit ihrem Berufsethos vereinbaren könnten. Für viele werde der Beruf viel-leicht zum „Hobby“ (Schacht) werden. Ganz ähnlich sagt es Albert Koch: „Der







![Robert Blossfeld, Potsdam · 2018. 8. 15. · Kakteen - Cacti - Cactées. Ce reus . Celsianus var. Bruennowii (Nt. 42) [Oreocereus, Pilocereus] Robert Blossfeld, Potsdam](https://static.fdokument.com/doc/165x107/6134681edfd10f4dd73bb5db/robert-blossfeld-potsdam-2018-8-15-kakteen-cacti-cactes-ce-reus-celsianus.jpg)