Änderungen durch die CLP-Verordnung (GHS) · PDF fileFür Produkte (früher...
Transcript of Änderungen durch die CLP-Verordnung (GHS) · PDF fileFür Produkte (früher...

Nr. 049 Ausgabe 07/2010 Fachausschuss-Informationsblatt
Aspirationsgefahr durch KSS? Änderungen durch die CLP-Verordnung (GHS)
Hinweis: Zu den Zielen der Fachausschuss- Informationsblätter siehe Fachausschuss- Informationsblatt Nr. 001
__
__
__
Dieses FA-Infoblatt dient als Handlungshilfe für KSS-Anwender und -Hersteller. Es zeigt die Änderungen von Einstufungskriterien und Kennzeichnung durch die CLP-Verordnung (GHS) sowie Wege für Gefähr-dungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen.
Gefahrstoffe können auf sehr unterschiedliche Art in den Körper gelangen. Ein besonderer Fall liegt vor, wenn ein vorher verschluckter Gefahrstoff in die Lunge gelangt - die sogenannte „Aspirationsgefahr“.
Das Verschlucken von Gefahrstoffen im Betrieb stellt aber die absolute Ausnahme dar. Und ohne Verschlu-cken kann keine Aspiration auftreten, d.h. diese Ge-fährdung ist in den meisten Fällen nicht vorhanden.
Nur bei den Tätigkeiten, in denen eine relevante Gefährdung des Verschluckens besteht ist die Aspirationsgefahr in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten und geeignete Schutzmaßnahmen umzu-setzen. Explizite Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit KSS sind im Abschnitt 6 der BGR-GUV-R 143 [3] beschrieben.
Das bedeutet im Gegensatz, dass ohne relevante Wahrscheinlichkeit des Verschluckens keine Kenn-zeichnung (z.B. an Anlagen oder in der Betriebs-anweisung) erfolgen muss.
1 Ausgangssituation: Aspirationsgefahr durch KSS?
Kühlschmierstoffe können den Menschen auf unterschied-liche Weise schädigen, im Vordergrund stehen Erkrank-ungen der Haut. Seltener sind Reizungen der Atemwege und sehr selten Erkrankungen durch Verschlucken von KSS.
Aspiration geschieht immer dann, wenn Gefahrstoffe ver-schluckt werden, das Verschlucken zu Erbrechen führt und die entstehende Mischung von Magensaft und (in unserem Falle) KSS in die Lunge gelangt. Das gleiche Problem kann aber auch nach dem Verschlucken von Hy-draulikflüssigkeiten und KW-haltigen Reinigern auftreten.
Der historische Hintergrund für die Kennzeichnung mit R 65 liegt in der Tatsache, dass Kinder haushaltsübliche „Lampenöle“ getrunken haben, weil diese in Aussehen und aromatischem Geruch an Fruchtsaft erinnerten.
Es gab eine ganze Reihe schwerer Vorfälle z.T. mit Todesfolge in Haushalten - betroffen waren ausschließlich Kinder!
Erkrankungs- oder gar Todesfälle aus Betrieben sind nicht bekannt.
Die „regulatorische“ Folge war dann im Jahre 1998 die 25. Änderungsrichtlinie (ATP) 98/98/EG der EG-Stoffrichtlinie
Inhaltsverzeichnis
1 Ausgangssituation: Aspirationsgefahr durch KSS?
2 Einstufungskriterien und Kennzeichnung und Änderung durch die CLP-Verordnung
3 Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen
4 „Kommunikation“
67/548/EWG [1], die zur entsprechenden Kennzeichnung geführt hat.
2 Einstufungskriterien und Kennzeichnung und Änderung durch die CLP-Verordnung
Die 25. ATP legte fest:
• Einzustufen sind flüssige Stoffe und Zubereitungen, die aliphatische, alizyklische und aromatische Kohlen-wasserstoffe zu ≥ 10 % enthalten und die bei 40 °C eine kinematische Viskosität von < 7 cSt (mm²/sec) aufweisen,
• Zu kennzeichnen ist mit R 65: Gesundheitsschädlich - Kann beim Verschlucken
Lungenschäden verursachen
Relativ schnell hat sich herausgestellt, dass diese für Lampenöle gedachte Kennzeichnung in riesigem Ausmaß KW-haltige Produkte betraf, Heizöl und Dieselkraftstoff sind die im größten Ausmaß gehandelten.
Es muss wiederholt werden: die erfolgte Kennzeichnung betraf fast ausschließlich einen anderen Personenkreis als den, der durch Lampenöl gefährdet war.
Fast auf den Tag genau 10 Jahre später wurde die CLP-Verordnung 1272/2008/EG [2] als Umsetzung der UN-GHS-Richtlinie erlassen. Es wurde festgelegt:

Fachausschuss-Informationsblatt Nr. 049 Ausgabe 07/2010 Seite 2 / 2 Aspirationsgefahr durch KSS? Änderungen durch die CLP-Verordnung (GHS)
Hinweis: Zu den Zielen der Fachausschuss- Informationsblätter siehe Fachausschuss- Informationsblatt Nr. 001
• Einzustufen sind flüssige Stoffe und Gemische, die Kohlenwasserstoffe zu ≥ 10 % enthalten und die bei 40 °C eine kinematische Viskosität von < 20,5 cSt (mm²/sec) aufweisen,
• Zu kennzeichnen ist mit H 304: Gefahr - Kann beim Verschlucken und Eindringen
in die Atemwege tödlich sein
(GHS 08)
(H = Hazard = Gefährdung)
Zur Frage des Inkrafttretens ist zu beachten:
Für Stoffe (auch für entsprechende Basisölschnitte) gilt der 01.12.2010,
Für Produkte (früher Zubereitungen, nach GHS Gemi-sche) gilt der 01.06.2015,
Im SDB muss im Punkt 3 die Einstufung für die ent-sprechende Stoffkomponente ab dem 01.12.2010 enthalten sein, ohne dass dies zur Kennzeichnung des Produktes führt.
Vor allem der letzte Punkt ist für die meisten Anwender schwer verständlich und es muss erläutert werden, warum z.B. ein Honöl zu 50 - 100 % aus einer eingestuften Kom-ponente besteht, aber als Produkt (noch) nicht gekenn-zeichnet werden muss.
Auf den ersten Blick scheint sich wenig geändert zu haben - das neue Gefahrenpiktogramm lässt die Lunge als betroffenes Organ erahnen.
Aber das Problem steckt im Detail. Die erhoffte bessere Darstellung der Gefährdung durch das Piktogramm hat dazu geführt, dass „GHS 08“ auch für atemwegs-sensibilisierende Stoffe, KMR-Stoffe aller Kategorien und spezifische Gefährdungen aller Organe angewendet werden soll.
Auch die sprachliche Änderung von „kann … Lungen-schäden verursachen“ auf „kann … tödlich sein“ stellt nur eine fachliche Klarstellung dar, keine größere Gefähr-dung. Es geht in beiden Fällen um ein Eindringen von Flüssigkeiten in die Lunge.
Das Einatmen von Gefahrstoffen, z.B. von KSS-Aerosol, kann in keinem Fall zur Aspirationsgefahr führen.
Zudem hat die Erhöhung der Viskositätsgrenze von 7 auf 20,5 cSt bei 40°C dazu geführt, dass ganz viele Stoffe und Produkte zu kennzeichnen sind, die vorher gänzlich kennzeichnungsfrei waren.
Sowohl Einkäufer wie auch alle betroffenen Beschäftigten sind über die erfolgten Änderungen und ihre Folgen geeignet zu informieren und zu unterweisen.
3 Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen
Bei der Gefährdungsbeurteilung muss über Einstufung und Kennzeichnung hinausgehend besonderes Augen-merk auf Tätigkeiten gelegt werden.
Tätigkeitsspezifisch muss ermittelt und beurteilt, ob und in welcher Weise eine Aufnahme in den Körper stattfindet.
4 „Kommunikation“ Die CLP-Verordnung erfasst im Bereich der Aspirations-gefahr eine weitaus größere Zahl von Produkten, Arbeits-plätzen und Tätigkeiten als bisher. Die Tatsache, dass bislang nicht eingestufte Produkte zukünftig gekenn-zeichnet werden müssen, bedarf einer Erklärung für alle Anwender.
Besonders problematisch kann die Tatsache werden, dass Produkte mit Aspirationsgefahr und KMR-Stoffe das gleiche Gefahrenpiktogramm erhalten.
Es muss kommuniziert werden, dass • eine Aspirationsgefahr nur vorliegt, wenn das
Symbol „GHS 08“ zusammen mit dem H-Satz 304 vorliegt,
• sonstige Gefährdungen, wie z.B. Sensibilisierung der Atemwege oder CMR-Wirkung zwar durch das gleiche Symbol, aber andere H-Sätze gekenn-zeichnet sind.
Eine tätigkeitsspezifische Gefährdungsbeurteilung ist ab-solutes Muss bei Anwendung entsprechend gekenn-zeichneter Produkte. In den meisten Fällen wird sich herausstellen, dass Produkte nicht verschluckt werden.
Aus diesem Grund kann in der Regel eine Aspirations-gefahr ausgeschlossen werden und eine Kennzeichnung von Anlagen ist nicht notwendig.
Literatur: [1] 67/548/EWG EG-Stoffrichtlinie, in Form der 98/98/EG; (25. ATP) ABl.
EG L 355/1 vom 30.12.1998 [2] „CLP-Verordnung“; EG-Verordnung 1272/2008/EG; ABl. EG L 353/1
vom 31.12.2008 [3] BGR-GUV-R 143: Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen, Stand: Mai
2009


![GHS-Unterweisung Unternehmer 11 2016.ppt ......Microsoft PowerPoint - GHS-Unterweisung_Unternehmer_11_2016.ppt [Kompatibilitätsmodus] Author u24rmk Created Date 11/28/2016 3:00:24](https://static.fdokument.com/doc/165x107/60abd7ad3fbca348763fd9b5/ghs-unterweisung-unternehmer-11-2016ppt-microsoft-powerpoint-ghs-unterweisungunternehmer112016ppt.jpg)



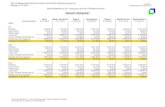



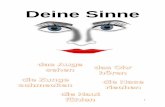

![GHS/ SoPäd – HF: 35 SWS (Module 1-6) GHS/ LF: 24 SWS (Module 1-4/5) [+ 1 Modul im FV]](https://static.fdokument.com/doc/165x107/56814f89550346895dbd4439/ghs-sopaed-hf-35-sws-module-1-6-ghs-lf-24-sws-module-1-45-1.jpg)






![Stadtteilkonferenz Süd Stand 01.06.2015 (2) [Schreibgeschützt]eservice2.gkd-re.de/selfdbinter320/DokumentServlet?dokumentenna… · - Anbindung an den Emscherpark Radweg, ... Masterplan](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5e9eb41e936e0b0cb87aa658/stadtteilkonferenz-sd-stand-01062015-2-schreibgeschtzt-anbindung-an.jpg)