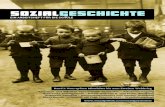Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen ...
Neuere Ergebnisse und Entwicklungen einer Sozialgeschichte der Medizin und des Gesundheitswesens in...
Transcript of Neuere Ergebnisse und Entwicklungen einer Sozialgeschichte der Medizin und des Gesundheitswesens in...
BerWissGesch 5,209-223 (1982)
Alfons Labisch/Reinhard Spree
Berichte zur WISSENSCHAFTSGESCHICHTE © Akadcmi~chc Ver!ag~gcsclbchaft I YK:?
Neuere Ergebnisse und Entwicklungen einer Sozialgeschichte der Medizin und des Gesundheitswesens in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert.
(Bericht über eine internationale Arbeitstagung im Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld, 25.-28.2.1982, unter der wissenschaftlichen Leitung von Alfons Labisch, Kassel, und Reinhard Spree, Berlin).
Themen aus der Geschichte der Medizin und des Gesundheitswesens werden in jüngster Zeit immer häufiger von Forschern unterschiedlichster Fachrichtung und mit divergierenden Fragestellungen, Methoden und Zielen behandelt. Als Beispiele seien genannt:
Medizinhistoriker, die mit klassischen philologischen Methoden teils historisch-empirische, teils historisch-pragmatische, das heißt auf Probleme des medizirtischen Handeins gerichtete Interessen verfolgen. Sozialhistoriker, die unter anderem im Zusammenhang mit dem wachsenden Interesse am Alltagsleben in der Geschichte beziehungsweise einer sogenannten Geschichtsschreibung von unten auf den Themenkreis Gesundheit/Krankheit aufmerksam wurden. Sie bearbeiten ihre Fragestellungen mit teils historischer, teils soziologischer Methodik und einer ebenso teils historisch-empirischen, teils theoretischen Zielsetzung. Medizinsoziologen schließlich, die - vornelunlich an aktuellen Problemen interessiert - die Entwicklungsdimension der von ilmen bearbeiteten Gegenstände erkannt haben und daher einen Bedarf an historischen Informationen im Rahmen bestimmter theorie- oder modellbezogener Fragestellungen entwickeln. Sie finden diese Informationen oft nicht vor und führen dann bisweilen, zumindest in Ansätzen, eigene historische Untersuchungen durch. Die Ziele dieser Untersuchungen sind teils pragmatisch auf gesundheitspolitische Probleme, teils systematisch auf theoretische Probleme ausgerichtet. Die Beispiele sollen dazu dienen, das Spektrum in seiner Spannweite anzudeuten. In
gleicher Weise hätte man Wirtschaftshistoriker, Demographen, Wissenschaftshistoriker, Epidemiologen oder Sozialmediziner anführen können.
Es dürfte einsichtig sein, daß die unter dem Oberbegriff "Sozialgeschichte der Medizin und des Gesundheitswesens" denkbaren Gegenstände, Fragestellungen und Methoden nur im interdisziplinären Zusammenhang befriedigend bearbeitet beziehungsweise gehandhabt werden können. Der Erfahrungsaustausch und die Zusanunenarbeit zwischen den Angehörigen der zu beteiligenden wissenschaftlichen Disziplinen scheint allerdings in der Bundesrepublik Deutschland ausbaubedürftig zu sein. Daß die einschlägigen Disziplinen hier so sehr gegeneinander abgeschottet sind, beruht teilweise auf wissenschaftsorganisatorischen Bedingungen, wie disziplinären Traditionen, teilweise aber auch darauf, daß Arbeitsergebnisse aufgrund abweichender Fragestellungen und Methoden nur schwer über Disziplingrenzen hinweg mitteilbar sind.
210 Alfom l,abisch/Reinhard Sprce
Angesichts des zunehmenden Interesses an historischen Untersuchungen zum Themenkreis Gesundheit und Krankheit wächst daher derzeit die Gefahr, daß die begonnenen Forschungsarbeiten im wesentlichen den Fragestellungen, Methoden und theoretischen Konzepten nur jeweils einer spezifischen Disziplin verpflichtet bleiben. Überdies dürfte es für die primär historisch arbeitenden Wissenschaftler ebenso von Bedeutung sein, sich den Fragen und historisch-soziologischen Forschungsdefiziten der Sozialmediziner zu stellen und damit die - oft leider nur verbal - geforderte Relevanz ihrer Arbeit zu überprüfen, wie es auf der anderen Seite für die Medizinsoziologen/Sozialmediziner von Belang ist, die historische Dimension ihrer theoretischen und praktischen sozialwissenschaftliehen Arbeit sowie frühergedachte und erprobte Problemlösungen kennenzulernen.
Die hier vorgetragenen Argumente waren die Begründung dafür, im Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld die oben im Titel genannte Arbeitsgemeinschaft durchzuführen. An der Tagung nal1men insgesamt 45 Wissenschaftler aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Großbritannien, aus den USA und schließlich aus der Bundesrepublik Deutschland teil. Sie vertraten die Fachgebiete Medizingeschichte, Medizinsoziologie, Sozialmedizin, Arbeitsmedizin, Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Neuere deutsche Geschichte, Wissenschaftsgeschichte und schließlich Ethnographie. Das Programm der Arbeitstagung umfaßt fünf thematisch voneinander abgegrenzte Sektionen. Zu diesen einzelnen Sektionen lagen insgesamt zehn Arbeitspapiere vor, die teils soeben publiziert worden waren, sich im Druck befanden oder vor dem Abschluß stehenden Dissertationen entstammten.
In der ersten Sektion wurden die Determinanten des Sterblichkeitsrückgangs in Deutschland seit der Mitte des 19. Jallfhunderts behandelt. Als Diskussionsvorlage diente das entsprechende Kapitel aus Reinhard Spree: Soziale Ungleichheit vor Krankheit und Tod. Zur Sozialgeschichte des Gesundheitsbereichs im deutschen Kaiserreich, Göttingen 1981 (S. 93-137). Kommentare hatten Robert A. Dickler, Frankfurt, und Robert W. Lee, Liverpool, abgefaßt. Spree betonte in seiner Einführung, daß er empirisch fundierte Überlegungen im Ral1men eines an McKeown angelehnten Konzepts, nicht jedoch eine strenge Kausalanalyse vorgelegt habe. Er glaube, daß die starke Ausweitung des personellen und sächlichen Angebots an professionell kontrollierten medizinischen Leistungen während des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts nur in geringem Maße zur gleichzeitig stattgefundenen Senkung der durchschnittlichen Sterblichkeit beziehungsweise zur Vergrößerung der Lebenserwartung beitragen konnte. Ärzte und die medizinische Wissenschaft förderten den gesundheitlichen Fortschritt weniger durch therapeutisches Wirken als vielmehr durch Initiativen und Beratungstätigkeit im Ral1men allgemeiner Assanierungs- und Hygienisierungskampagnen und -maßnahmen. Sie wurden zu Promotoren und Kontrolleuren im Ralunen staatlicher lnfrastrukturpolitik. Auch deren Beitrag zur Verlängerung des Lebens müsse allerdings -obwohl wahrscheinlich beachtlich- relativiert werden. Erreicht wurden durch derartige Maßnalunen primär städtische Bevölkerungsgruppen, hier vor allem Angehörige der neuen Mittelschichten (Beamte, Angestellte, freie Berufe und Facharbeiter). Der wichtigste übergreifende Faktor, der auch in ländlichen Regionen und bei ungelernten Land- wie Industriearbeitern wirksan1 wurde, dürfte die Verbesserung der Realeinkommens- und Ernährungssituation gewesen sein.
Dickler sprach in seinem Kommentar Probleme der Datierung von Entwicklungstendenzen irrfolge der Ungleichzeitigkeit und der Unbalanciertheit im medizinischen und sozialen Bereich an. Ferner betonte er, daß medizinische und ökonomische Entwicklung nicht getrennt betrachtet werden dürften. Es empfehle sich zum Beispiel, Veränderungen der Ernährungsweise und -qualität in dem betriebswirtschaftlich gestifteten Zusammenhang der Verpflegung in der Annee, in Hospitälern und in Werkskantinen zu untersuchen. Ein Spezialproblem schließlich, das hinsichtlich der Säuglingssterblichkeit bedeutsam sei,
Sozialgeschichte der Medizin 211
aber immer noch der Klärung harre, könne in der Übertragbarkeit von Tuberkulose durch Kuhmilch gesehen werden. Dem widersprachen Luckin und Seidler, die meinten, daß der Übertragung von Rindertuberkulose durch die Milch keine nennenswerte Bedeutung ftir die Säuglingssterblichkeit im späten 19. und ftiihen 20. Jahrhundert zukomme.
Lee sprach in seinem Kommentar besonders Probleme der Kausalanalyse an. Seiner Ansicht nach fehlten allzu viele Vorarbeiten auf lokaler und regionaler Ebene, deren Ergebnisse den von Spree auf hochaggregierter Ebene gewonnenen Schlüssen gegenübergestellt werden könnten. Ein Hauptproblem sei es, qualitative Variablen, die die Kausalität vermittelten, statistisch zu messen. In der anschließenden Plenumsdiskussion wurden diese Fragen -neben anderen- weiter verfolgt (so die Bedeutung bestimmter Todesursachen, der krankheitsspezifischen Morbidität, der Arbeits- und Lebensverhältnisse, der Assanierung, des Stadt-Land-Gegensatzes). Als besonders wichtig, aber auch schwer zu fassen, erwiesen sich Probleme der Mentalitätsgeschichte: Seit wann wird zum Beispiel im Überleben jedes geborenen Kindes ein Wert gesehen, der individuelle und/oder gesellschaftliche Anstrengungen erfordert? Welchen Beitrag zur Senkung der Sterblichkeit im allgemeinen, besonders aber auch der Säuglings- und Kindersterblichkeit leisteten bestimmte Lebensstile und deren Wandel? Umstritten war auch, wie weit der von Spree propagierte methodische Anspruch sinnvoll sei, theoretisch abgeleitete Vermutungen und Modelle mit "harten Daten" zu untermauern und zu prüfen. Rainer Müller, Bremen, wies darauf hin, daß man in der Epidemiologie immer weiter von sogenannten harten Daten (biochemisch oder medizinisch eindeutig interpretierbare und statistisch gesicherte Informationen) abkäme, um stattdessen auf Daten aus dem sozialen und psychologischen Bereich überzugehen, die typischerweise "weicher" seien. In diesem Sinne bewegten sich die moderne Epidemiologie und die historische Demographie beziehungsweise der von Spree vertretene Typ der Sozialgeschichte gegenläufig: Während die historische Demographie und Teile der Sozialgeschichte mit einem immer weiter verfeinerten statistischen Instrumentarium eine Epidemiologie an historischen Tatbeständen versuchten, um ihre Konzepte zu belegen, erschienen der modernen Epidemiologie gerade die statistischen Infonnationen über das heutige Krankheitsgeschehen und seine Ursachen als nicht mehr hinreichend, als nur vordergründig mit Erklärungskraft ausgestattet. Schließlich wurde mehrfach gefordert, den Zusan1menhang von Arbeitsbedingungen oder konkreten Arbeitsplatzverhältnissen einerseits, Morbiditäts- und Sterblichkeitsentwicklung andererseits zumindest seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch historisch zu untersuchen. Dies entspreche dem Vorschlag Lees, lokal oder auf bestimmte Arbeitsplatztypen eingegrenzte, vielleicht auch auf konkretisierte Wohnverhältnisse beschränkte Studien in Angriff zu nehmen, die geeignet erscheinen, globale Thesen, wie sie von Spree vorgelegt wurden, zu differenzieren und zu überprüfen, vor allem aber hinsichtlich des Kausalgefüges zu konkretisieren.
Die zweite Sektion hatte ärztliche Professionalisierung und Volksmedizin in Deutschland während des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zum Gegenstand. Hierzu lagen insgesamt vier Arbeitspapiere vor. Als erstes wurde ein Papier von Claudia Huerkamp diskutiert. (Dabei handelte es sich um die leicht überarbeitete Fassung ihres Aufsatzes ;{rzte und Professionalisierung in Deutschland, Überlegungen zum Wandel des Arztberufs im 19. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 6(1980), 349-382.) Kommentare lagen von Johanna Bleker, Berlin, und Ivan Waddington, Leicester, vor.Huerkamps Darstellung der Herausbildung einer modernen ärztlichen Profession in Deutschland ist stark geprägt durch das von Elliot Freidson entwickelte ProfessionalisierungsmodelL Als Besonderheiten des deutschen Falls arbeitet Huerkamp heraus:
Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert boten die unterschiedlichsten Gruppen von akademisch, halbakademisch, handwerklich oder gar nicht fom1ell ausgebildeten
212 Alfons Labisch/Reinhard Spree
Heilern gesundheitliche Leistungen an. Wichtige Vereinheitlichungsprozesse wurden stark durch die Medizinalreformen während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefördert, die nicht zuletzt auf staatliche Interessen zurückgingen. Die Entwicklung der medizinischen Wissenschaft seit den 1860er/70er Jahren, die Vergrößerung der Unterschiede in den Lebensbedingungen städtisch-industrieller und ländlicher Lebensräume, die Entwicklung der Krankenanstalten und schließlich die Herausbildung des modernen Krankenkassensystems stellten den um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen Einheitsstand der akademisch gebildeten Ärzte erheblich in Frage. Während industrielles Wachstum, Verstädterung und Realeinkommenssteigerungen einerseits, die Krankenkassenentwicklung, speziell seit dem übergang zum Sachleistungsprinzip (1892), andererseits dazu tendierten, den Markt für ärztliche Dienstleistungen erheblich auszuweiten, waren sie dennoch mit Prozessen verbunden, die die Ärzte als Bedrohung wahrnal1men: Gefährdung des Einkommens durch wachsende Zahlen von Medizinstudenten (sogenannte überfiillung des ärztlichen Standes), Gefährdung der Freiheit der Berufsausübung durch die Krankenkassen (Vertragsarzt-Systeme, pauschal interpretiert als drohende Sozialisierung des ärztlichen Standes). Im Abwehrkampf dieser bedrohlichen Tendenzen, besonders in der Auseinandersetzung mit den Krankenkassen, formierte sich die Ärzteschaft in Deutschland zur modernen Profession mit entsprechend straffer Organisation, die vor allem eines durchsetzen konnte: ein relativ hohes Maß an Autonomie hinsichtlich des Berufszugangs (Ausbildung usw .), der Standards der Berufsausübung (ärztliche Ethik, Standesehre) und hinsichtlich der Dominanz der im Berufsfeld stattfindenden Arbeitsteilung. Bereits in der Öffnungsphase der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit
das in der Medizinsoziologie entwickelte Theorem der Professionalisierung auf konkrete historische Prozesse übertragbar sei. Hierbei erschien es zunächst einmal grundsätzlich problematisch, theoretische medizinisoziologische Modelle in der Medizingeschichte anzuwenden. Johanna Bleker führte historische Begebenheiten und Fragestellungen aus der Geschichte der Medizin an, die unter dem Aspekt des Professionalisierungsmodells ftir sie schwer zu deuten wären. Ivan Waddington führte andererseits in seinem schriftlichen Kommentar aus, daß einige der von Claudia Huerkamp am deutschen Beispiel herausgearbeiteten Professionalisierungsdeterminanten sowohl im Lichte des Professionalisierungsmodells wie im Hinblick auf abweichende Erfahrungen in England möglicherweise eher Begleiterscheinungen oder zufällige Anstöße gewesen sein könnten. Er schlug eine andere Gewichtung der historischen Befunde vor.
In der weiteren Diskussion gewann unter dem Aspekt der Professionalisierung besonders die Frage nach der therapeutischen Effizienz der naturwissenschaftlich geprägten Medizin gegenüber der Laienmedizin Gewicht. Durch welche Aktivitäten oder Leistungen konnten die Ärzte das gesellschaftliche Umfeld so positiv beeinflussen, daß sie schließlich eine relativ hohe berufliche Autonomie erlangten? Wie konnten die Ärzte im späten 19. Jahrhundert eine wachsende Klientel gewinnen und sich vor allem auch eine hohe Wertschätzung durch staatliche Organisationen sichern, wenn ihre therapeutische Effizienz noch bis zum Ersten Weltkrieg so klein gewesen sein sollte, wie Huerkamp und auch Spree unterstellen? Unter Hinweis auf entsprechende Arbeiten aus den USA war man damit schließlich bei der Frage, welche gesellschaftlichen Interessenkoalitionen den Professionen zum Durchbruch verhalfen. Hier deutete sich eine gegenseitige Beeinflussung von Berufsinteresse und staatlichem Interesse (Stichwort ftir das 18. Jallfhundert: medizinische Polizey; für das späte 19. Jahrhundert: "Zwangssozialisation der Unsicherheiten", Assanierungs- und Infrastrukturpolitik) an. Der damit angesprochene Fragenkomplex wurde im Laufe der Tagung wiederholt aufgegriffen und weiter differenziert. Trotz
Sozialgeschichte der Medizin 213
vieler partieller und ad-hoc-Hypothesen blieb der Eindruck bestehen, daß in dieser Hinsicht ein beachtliches, auf mehreren Ebenen anzugehendes Forschungsdefizit bestehe.
Im zweiten Teil der Sektion 2 wurden Vorlagen von Ute Frevert und Barbara Duden diskutiert (Ute Frevert: Frauen und Ärzte im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Zur Sozialgeschichte eines Gewaltverhältnisses; Barbara Duden: Zur "Medikalisierung des Geburtsgeschehens" an der Wende zum 19. Jahrhundert; beide Papiere stehen im Zusammenhang mit noch nicht abgeschlossenen Dissertationen und werden in der vorgelegten Form nicht publiziert). Kommentare hatten Karin Hausen, Berlin, und Gerhard Baader, Berlin, vorgelegt. Ausgangspunkt der Diskussion war das von den Verfasserinnen entworfene Konzept, wonach sich die Geburt in der vormodernen Gesellschaft weitestgehend in der Welt der Frauen abspielte. Seit der Aufklärung wurde dieses Verhältnis zunächst einmal durch medizinisch geschulte Hebammen und schließlich durch männliche Ärzte sozusagen in den Bereich der Medizin überführt. Dieser Medikalisierung genannte Prozeß könne unter anderem als Ausdruck des Bestrebens von Männern gesehen werden, Frauen auch in ihren ureigensten Tätigkeitsbereichen zu dominieren. Unter dem Begriff der Medikalisierung wurden mehrere Problembereiche zugleich angesprochen: Familie als zentraler Ort der Gesundheitspflege und die Rolle der Frau darin; das Verhältnis Staat und Medizin im Absolutismus sowie die Rolle der Medizin in der bürgerlichen Emanzipationsbewegung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts; schließlich die Vernichtung von weiblichen Domänen sowie von Selbsthilfepotentialen durch die Medikalisierung.
Damit lag die Frage auf der Hand, die die Diskussion beherrschte: Was bedeutet eigentlich Medikalisierung? Hat der Begriff eine erkenntnisfördernde Funktion? Ist das Konzept nicht zu stark von den gegenwärtig beobachtbaren negativen Folgen einer Übermedikalisierung geprägt und deshalb für historische Studien problematisch? Werde nicht der emanzipatorische Charakter der frühen Medikalisierungsphasen unterschlagen? (Baader) Da die aktuelle Auseinandersetzung zwischen Männern und Frauen einerseits, zwischen Männern, Frauen und Ärzten andererseits, nicht zuletzt aber auch zwischen den Unterschichten und den als Agenten symbolischer Gewalt des Staates (als Vertreter bestimmter politischer Ideologien) fungierenden Ärzten unterschwellig auch die historische Diskussion beherrschte, fragte Esther Fischer-Hornberger, ob der Begriff Medikalisierung nicht in erster Linie als Zugriff des Staates und der seine ideologische Gestalt tragenden Gruppen auf die Unterschichten zu verstehen sei. Jolm Gabbay wies abschließend auf das Problem der Reifizierung des Begriffs Medikalisierung hin, der nur als erkenntnisleitende Kategorie, als heuristisches Konzept fruchtbar sei. Um angesichts der komplexen Fragen befriedigende Klärungen zu e-rlangen, seien zunächst einmal mehr Fallstudien erforderlich; ferner müsse die jeweilige zeitgenössische Vorstellung von und Reaktion auf Krankheiten herausgearbeitet werden, um die Rolle der Medizin in diesem Zusammenhang klären zu können.
Die Diskussionsvorlage für den dritten Themenkreis innerhalb der Sektion 2 stammte von Uta Ottmüller: Das Kind des ersten Lebensjahres - ein Außenposten; die Kindeswahrnehmung im agrarischen Lebenszusammenhang des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (das Papier ist Teil eines Promotionsvorhabens und wird in der vorliegenden Form nicht publiziert). Kommentare hatten Eduard Seidler, Freiburg, und Marie-France More!, Sceaux, vorgelegt. Ausgehend von der Tatsache, daß die physische und psychische Gesundheit eines Kleinkindes ganz wesentlich von der Struktur und Qualität der Interaktionen abhängig ist, durch die der Säugling beziehungsweise das Kleinkind in ihre soziale Umwelt integriert und am Leben erhalten werden, stellte Uta Ottmüller ein Konzept vor, mit Hilfe dessen historische Infom1ationen über Typen des Umgangs mit Säuglingen und Kleinkindern analysiert werden könnten. Wichtigstes Merkmal dieses Konzepts ist die Gegenüberstellung von Innen und Außen, wobei Innen gleichgesetzt wird mit ungestörter
214 Alfons Labisch/Reinhard Spree
Interaktion, das heißt gelingendem Dialog, während Außen gestörter Interaktion, das heißt mißlingendem oder "entgleisendem" Dialog entspricht. Ob das Kind in das Innen integriert werden kann, ob es körperlich und seelisch unbeschädigt in die Gesellschaft hineinwachsen kann, oder ob es zeitweilig, vielleicht sogar dauerhaft ins Außen abgedrängt wird und kurz- oder langfristig von Krankheit und Tod bedroht ist, hängt von einer Reihe von Bedingungen ab, die sehr schwer modellhaftund insofern allgemein zu fassen sind. Uta Ottmüller hat dazu einige Hypothesen entwickelt und anhand volkskundlichen Materials aus dem 19. und frü11en 20. Jahrhundert illustriert. Im Mittelpunkt des Papiers und auch der Diskussion darüber standen die Problematik angemessener "künstlicher" Ernährung von Säuglingen einerseits und das Phänomen des Wechselbalgs andererseits.
Auch bei dieser Arbeitsvorlage machte sich die Diskussion schnell an dem Punkt fest, inwiefern man moderne theoretische Konstrukte, beispielsweise solche der Entwicklungspsychologie, auf die Vergangenheit übertragen dürfe (Morel, Seidler). Weitere Diskussionspunkte waren die Romantisierung des Kindbildes, die Ideologie eines angeblichen mütterlichen Instinktes, die Ökonomie der Familiensituation mit der anschließenden Frage nach den Determinanten der Geburtenkontrolle und schließlich auch die regional äußerst unterschiedlichen Formen der Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern. Unter dem Aspekt des wertenden Begriffs Medikalisierung lag schließlich die Feststellung auf der Hand, daß es in der Vergangenheit zwar anders, aber offensichtlich auch nicht grundsätzlich besser war, besonders hinsichtlich der psychischen und physischen Gefährdung von Kleinkindern. Als besonderes Problem erwiesen sich- wie schon bei den vorhergehenden Arbeitspapieren - die Quellen: Wenn man das Problem der Medikalisierung richtig einschätzen möchte, sei es besonders wichtig, Nachrichten datüber zu erhalten, wie Menschen zu verschiedenen Zeiten die als Medikalisierung bezeiclmeten Prozesse erfahren, erlebt, durchlitten haben (Schenda).
Die dritte Sektion galt der Sozialgeschichte der Krankenversicherung in Deutschland. Hierzu gab es zwei Diskussionsvorlagen. Zunächst wurde ein Aufsatz von Ute Frevert diskutiert: Der Beitrag von Arzten und Krankenkassen zur Medikalisierung der deutschen Unterschichten vor Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung (veröffentlicht als Arbeiterkrankheit und Arbeiterkrankenkassen im Industrialisierungsprozeß Preußens (1840-1870) in: W. Conze/U. Engelhardt (l--Irsgg.): Arbeiterexistenz im 19. Jahrhundert. Stuttgart 1981). Die zentralen Thesen sind: Die während des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts entstandenen frühen Krankenkassen (teilweise anknüpfend an ältere Traditionen aus dem Handwerk) übten einen sozial integrativen Einfluß auf die Mentalität der Arbeiter (Entstehung eines medizinisch geprägten Gesundheitsbewußtseins) und deren Zeitbewußtsein aus (Disziplinierung, Einpassung in die Bedingungen des maschinengesteuerten Fabrikbetriebs). Konkreter könne ihre gesellschaftliche Funktion umschrieben werden als Vermittler ärztlicher Kontrolle über den "physischen Habitus" im Sinne Bourdieus. Andererseits hatten die frilllen Krankenkassen auch solidaritätsstiftende Wirkung, der ein gewisser politischer Wert im RalU11en der Entwicklung der Arbeiterbewegung zugemessen werden könne. Gerade dieses Element sei durch die gesetzliche Krankenversicherung weitgehend zerstört worden, während die sozialintegrativen Wirkungen eher verstärkt wurden.
In seinem Kommentar machte Gerhard Baader unter anderem deutlich, daß die erste Phase der Medikalisierung in den absolutistischen Staaten von der zweiten Phase der Medikalisierung seit der Mitte des 19. 1 ahrhunderts zu unterscheiden sei. Zwar gebe es strukturelle Tendenzen zur Anpassung und Kontrolle durch die Entwicklung von Krankenkassen, jedoch sei demgegenüber die weitgehende Übereinstimmung von Aufgaben der Krankenversicherung mit den emanzipatorischen Zielen der Arbeiterbewegung zu betonen. Auch die pauschal negative Bewertung der Aktivität von Ärzten durch Frevert relativierte Baader, indem er auf fortschrittliche Ärzte hinwies, die gegen Ausbeutung der
Sozialgeschichte der Medizin 215
Unterschichten und ftir soziale Reformen eingetreten wären. In der anschließenden Diskussion wurde auf den Gegensatz von Naturheilkunde und naturwissenschaftlicher Medizin hingewiesen, der seit den 1860er Jahren zunehmende Bedeutung erlangte. Die Unterschichten hatten eine starke Affinität zur Naturheilkunde, besonders auch zu deren nicht-approbierten, dem Unterschichtenmilieu nal1estehenden Vertretern, während sie den naturwissenschaftlich orientierten Ärzten fremd bis ablehnend gegenüberstanden. Dem trug die Konstruktion der Krankenkassen bis zur Novelle des Krankenversicherungsgesetzes von 1892 insofern Rechnung, als keine direkten gesundheitlichen Leistungen (therapeutische Maßnahmen) vermittelt wurden, sondern nur der Einkommensausfall zu einem Teil ausgeglichen werden sollte. Dem kranken Arbeiter stand es insofern frei, von wem er sich konkret helfen ließ. Das änderte sich während der 1890er J al1re mit dem Übergang zum Sachleistungsprinzip, durch das die Krankenkassen zu einer Schaltstelle der Vennittlung bestimmter medizinischer Leistungen wurden und insofern eine Steuerungsfunktion übernehmen konnten. Diese ging, wie Tennstedt ausfiihrte, weg von der Naturheilkunde, hin zu den approbierten, naturwissenschaftlich ausgerichteten Ärzten, weg besonders von Laienhilfe, hin zur Inanspmchnahme professioneller Dienste.
Luckin wies darauf hin, daß die genannten Veränderungen einer gewissen Gesundheitspolitik der Krankenkasse im Zusan1menhang zu sehen seien mit Veränderungen der Grundauffassung von Krankheitsursachen, -Übertragungs- und -verbreitungsmechanismen sowie von den notwendigen Gegenmaßnahmen. Die innerwissenschaftliche Durchsetzung der Keimtheorie der Krankheitsursachen auf der Basis der Erfolge von Bakteriologie und Mikrobiologie zeitigte seit den 1890er Jahren sowohl in England wie in Deutschland, wahrscheinlich in den meisten industrialisierten Ländern, gesellschaftliche Breitenwirkung. Um die Tragweite der Veränderungen zu begreifen, sei es wichtig, sich klarzumachen, daß - zumindest in England- vom frühen 19. Jahrhundert an eine weitgehende Übereinstimmung zwischen Ärzten und mittelständischen Reformgruppen hinsichtlich des die Gesundheitspolitik leitenden Konzepts bestanden habe. Es sei gekennzeiclmet gewesen durch eine bestimmte moralische Interpretation von Gesundheit, die weitgehend gleichgesetzt wurde mit Arbeitsfähigkeit, also vor allem mit der Fähigkeit und Bereitschaft, sich eigenverantwortlich durch Erwerbstätigkeit den Lebensunterhalt zu verdienen. Das sicherte zugleich für die Unternehmerschaft ein ausreichendes Arbeitskräfteangebot. Gesundheitspolitik war, diesem Konzept entsprechend, wesentlich auf moralische Erziehung der Unterschichten zu Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Sparsan1keit und Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, das heißt nicht zuletzt auf Anpassung an die moderne Fabrikdisziplin, ausgerichtet. Gesundheitspolitik sollte Hilfe zur Selbsthilfe sein, womit zugleich die gesellschaftliche Produktivität erhöht würde. In England fungierten als Medikalisiemngsinstanz dieser Politik die kommunalen Gesundheits-Beanlien. Die Bakteriologie habe, so Luckin, das moralische Konzept einer Gesundheitspolitik als Unterschichtenerziehung radikal verändert, indem eine naturwissenschaftlich fundierte, kausalanalytisch ausgerichtete Vorstellung von Krankheit und Gesundheit entwickelt und propagiert wurde, was eine gmndsätzliche Veränderung des ärztlichen Blicks zur Folge hatte. Nach Luckin habe es sich um den seltenen Fall einer politisch-gesellschaftlichen Wandlung infolge wissenschaftsimmanenter Fortschritte gehandelt.
Auf ein anderes Phänomen ging Karin Hausen ein. Die gesundheitspolitischen Entwicklungen im späten 19. Jahrhundert erschienen ihr durch ein interessantes Paradigma gekennzeichnet. Im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (besonders im Hinblick auf die Unfallversichemng) entwickelte sich ein ökonomisches Eigeninteresse mit nicht vorhergesehenen Konsequenzen: Um möglichst ökonomisch, das heißt aufgaben- und satzungskonform mit den Mitgliederbeiträgen umzugehen, strebten die Kassen einerseits Kontrolle über das Verhalten der Mitglieder an (sie dringen auf die Konsultation von
216 Alfons Labisch/Reinhard Spree
Ärzten im Krankheitsfall und auf die Einhaltung der entsprechenden therapeutischen Vorschläge; sie betreiben Gesundheitserziehung etc. ); datüber hinaus aber entfaltete sich ein Interesse an Abstellung oder zumindest Einschränkung der krankmachenden Arbeitsbedingungen. Weniger allgemeine Prävention, aber Unfallschutz am Arbeitsplatz sei so zu einem Gegenstand von Initiativen aus dem Umfeld der Krankenversicherung (einschließlich der Unfallversicherung) geworden. Wirkungen seien besonders am Design von Maschinen und industriellen Anlagen, also in der Teclmikgeschichte zu verfolgen. In ähnliche Richtung argumentierte Margot Jefferys, die auf den Beitrag der Arbeiterbewegung zur Medikalisierung der Unterschichten einging. Der Zwang zur beziehungsweise die Forderung nach Ökonomisierung der Mittelvetwendung, vor allem im Bereich der Krankenkassen (Engagement der Vertreter der Arbeiterbewegung in den Selbstverwaltungsgremien), aber auch in den kommunalen Gesundheitseinrichtungen (Engagement von Vertretern der Arbeiterbewegung in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik), förderte die Medikalisierung besonders dadurch, daß Ärzte zur Kontrollinstanz für eine sachlich angemessene Ressourcenverwendung wurden. In diesem Sinne unterstützte die Arbeiterbewegung Professionalisierungsbestrebungen der Ärzteschaft. In gewisser Weise genötigten Krankenkassen, Gewerkschaften und Ärzteschaft sich gegenseitig, standen jedoch andererseits in einem ständigen Konflikt. Insofern sei das Problem der sozialen Kontrolle, wie es Ute Frevert angesprochen habe, sehr komplex zu sehen.
Als zweite Diskussionsvorlage innerhalb der Sektion 3 diente ein Kapitel aus Florian Tennstedt: Sozialgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland. Vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg (Göttingen 1982, S. 135-220: Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik im Deutschen Kaiserreich. Konservative Herrschaft und liberalkapitalistischer Entwicklungsprozeß). Kommentare hatten Gerd Göckenjalm, Berlin, und Hartmut Kaelble, Berlin, vorbereitet. Tennstedt legte in seiner Einführung dar, daß er insbesondere beabsichtigt habe, das wechselseitige Verhältnis von Ärzten und Arbeiterbewegung aufzuhellen. Dabei habe er die vielfältigen sozio-ökonomischen und politischen Probleme der sogenannten inneren Reichsgründung soweit wie möglich berücksichtigt. Auch habe ihn interessiert, wie die verschiedenen Institutionen und die Bürokratie durch gleichlaufende Interessen miteinander verbunden gewesen seien. Die Entwicldung der Krankenkassen und die Gesundheitspolitik allgemein sehe er eingebettet in einen langfristigen Veränderungsprozeß politikleitender Wertmaßstäbe, wie ihn schon Luckin besonders am Beispiel Englands skizziert hatte: Der Wandel lasse sich charakterisieren durch den Übergang von einer christlich begründeten Sittlichkeit zur Leitidee einer säkularisierten Gesundheit, deren konkrete Analyse und gesellschaftswirksame Ausformung der Wissenschaft, speziell der Naturwissenschaft, überlassen werde. Die Entwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung müsse vor dem Hintergrund einer insgesamt verzögerten Arbeiterschutzpolitik und der dynamisierten, verwissenschaftlichten Beurteilungsstandards der Experten sowohl in der Politik wie in den staatlichen Bürokratien analysiert werden. In seinem Kommentar knüpfte Gerd Göckenjahn inhaltlich an die AusfiUuungen von Luckin und Tennstedt an, wenn er die gesundheitspolitischen Vorstellungen des Bürgertums in Deutschland eingebettet sal1 in ein ganzheitliches Konzept von "gutem moralischen Leben". Er verdeutlichte die Konsequenzen dieses Konzepts für die Professionalisierungsbestrebungen der Ärzteschaft. Der Arzt habe, solange dieses Konzept Gültigl(eit besaß, das heißt bis ins späte 19. Jahrhundert, nur eine Funktion neben anderen Berufen im Rahmen der bürgerlichen Öffentlichkeit wahrgenommen. Diese Situation müsse eher als Hindernis für Professionalisierungsbemühungen verstanden werden. Göckenjahn lehnte es deshalb ab, von einer ersten Medikalisierungsphase während des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts zu sprechen. Auch warnte er davor, der propagieften Peuplierungspolitik der absolutistischen Staaten nennenswerte Schubkraft für die Professionalisierung der Ärzteschaft in1 Sinne einer Zuerkennung von Amtsautorität anzunehmen. Nicht Bevölkerungsvermeh-
Sozialgeschichte der Medizin 217
rung, sondern Überbevölkerung sei das praktische Problem für die meisten Staaten bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen. Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts habe eine Auflösung der Vorstellung vom "ganzen Menschen" stattgefunden, wesentlich vorangetrieben durch die schon von anderen Diskutanten angesprochenen innerwissenschaftlichen Entwicldungen. In diesem komplex bestimmten Prozeß seien nun die besondere Funktion der Medizin und die neue Rolle des Arztes zu analysieren. Das gelte auch für eine Funktionsanalyse der Krankenkassenentwicklung.
Nach Kaelble war in Tennstedts Beitrag sowohl der sozio-ökonomische Hintergrund wie auch die Perspektive des Klienten (des Kranken) zu wenig berücksichtigt. Eine gewisse Akzentverschiebung in der politischen Analyse könne darin bestehen klarzumachen, daß die Entwicklung der gesetzlichen Sozialversicherung zwar Element konservativer Politik gewesen sei, daß sich jedoch die konservativen Intentionen in modernen Formen durchgesetzt hätten, deren Leistungsfähigkeit den konservativ geprägten staatlichen Rahmen überdauert habe. In der weiteren Diskussion wurde deutlich, daß sich selbst diejenigen Personengruppen, wie zunächst gegen die Institutionen der Sozialversicherung opponiert haben, heute weitgehend mit ihnen identifizieren. Diesem Umstand sei es im wesentlichen zuzurechnen, daß substantielle Reformen im Bereich von Krankenversicherung und Gesundheitswesen nahezu unmöglich geworden seien. Die englischen Kollegen wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß der Staat in Großbritannien nur sehr wenig Einfluß auf die Entwicklung des Gesundheitswesens genommen habe; die liberale Ideologie ftihrte hier vielmehr zu einer starken Betonung der freiwilligen Organisation. Auf dem Kontinent und in England hätten zwar ähnliche Prozesse gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung stattgefunden, jedoch unter deutlich unterschiedenen Bedingungen. Das betreffe auch die medizinischen und sozialpolitischen Einrichtungen, die trotz ähnlicher Funktionen unterschiedlich strukturiert seien. In England sei die typische Tendenz Dezentralisierung und Betonung der freiwilligen Leistung. In Deutschland dagegen dominiere Zentralisierung und offizielle Aufgabenstellung, staatliche Einbindung und starke Bürokratisierung des Leistungsangebots und des Zugangs zu den Einrichtungen.
Die Sektion 4 war überschrieben "Alternative Ansätze der Arbeitsmedizin im historischen Überblick". Hierzu lag ein Diskussionspapier von Paul Klein und Mitarbeitern vor: "Zur Entwicklung der Arbeitsmedizin in Deutschland bis zum Ende der Weimarer Republik". Den Kommentar hatte Alexander Schuller, Berlin, verfaßt Für die Autoren begründete Rainer Müller zu Eingang der Diskussion ihr Interesse an der Geschichte der Arbeitsmedizin. In der Praxis der Arbeitsmedizin und in der arbeitsmedizinischen Forschung gehe man typischerweise von einem sehr verkürzten medizinisch- und juristisch-kausalen Krankheitsmodell aus; dies werde besonders am Umgang mit den Berufskrankheiten deutlich. Es werde immer differenzierter diagnostiziert, ohne die krankmachenden Arbeitsbedingungen in die Analyse einzubeziehen. Darum leiste die Arbeitsmedizin kaum einen Beitrag zur ursächlichen Prävention. Stattdessen fördere sie bei demjenigen, der infolge einseitig oder übermäßig beanspruchender Arbeitsbelastungen krank werde, das Gefühl persönlichen Versagens, wenn nicht sogar persönlicher Schuld. Diese Art der Arbeitsmedizin leiste insofern einen Beitrag zur Verschleierung krank11eitsfördernder Kausalketten. In gewissem Sinne beschränke sie einen großen Teil ihrer Aktivität auf die sichere Identifizierung der Opfer. Im Gegensatz hierzu habe es früher in Deutschland eine Arbeitsmedizin gegeben, die von einem wesentlich breiteren Ansatz ausgegangen sei. Seinerzeit bestand auf wissenschaftlicher Ebene eine sehr enge Verbindung zur Sozialmedizin und über diese zu den Sozialwissenschaften, während es auf der Ebene der Durchsetzung von arbeitsmedizinischen Vorschlägen und Maßnahmen sehr enge Verbindungen zu den Krankenkassen und zu den Gewerkschaften gab. An diese Tradition wolle die Gruppe in gewisser Weise anknüpfen.
218 Alfons Labisch/Reinhard Spree
Schuller wies in seinem Kommentar darauf hin, daß in der Diskussionsvorlage die theoretischen Probleme seiner Meinung nach nicht richtig gehandhabt worden seien. Vor allem seien die Beziehungen zwischen Sozialstruktur und Bewußtsein diffus. Er schlug hierfür als Ansätze, die zu einer theoretisch klareren Strukturierung und Analyse beitragen könnten, die Psychoanalyse, das Streß-Modell und das Life-Event-Modell vor. Im übrigen sei Arbeitsmedizin sowohl in der älteren Variante, die zumindest teilweise in die Politik der Arbeiterbewegung eingebunden gewesen sei, als auch in der anderen Variante, die eher Unternehmerinteressen verpflichtet war, als gescheiterte Disziplin zu betrachten, die es nicht verstanden habe, ein eigenes, konsistentes Paradigma und eine eigenständige Methodologie zu entwickeln. Diese These relativierte Spree wiederum, indem er meinte, man müsse doch wohl die wissenschaftstheoretischen und soziologischen Komponenten der Entwicklung gerrauer untersuchen, die möglicherweise interessengeleitet verhindert hätten, daß sozialtheoretische Bezüge in der Medizin, besonders aber in der Arbeitsmedizin, systematisch verankert werden konnten. Einen weiteren Diskussionspunkt stellte der Ursachenbegriff in der Arbeitsmedizin dar, der zwischen medizinischer und juristischer Interpretation schillere. Hinsichtlich der Quellen für eine historische Rekonstruktion der Entwicklung der Arbeitsmedizin wies Spree darauf hin, daß leider das reichhaltige Material der Gewerbestatistik nur schwer verwertbar erscheine. Es setze im Prinzip zu punktuell (räumlich wie zeitlich) an, um systematische Vergleiche oder gar verallgemeinernde Folgerungen zuzulassen. Demgegenüber verwies Milles darauf, daß diese Quellen in ihrem jeweiligen Zusammenhang dennoch berücksichtigt werden könnten und als wichtige Materialgrundlage zu betrachten seien.
In der Sektion 5 wurde anhand zweier Papiere die Entwicklung der Gesundheitspolitik behandelt, und zwar um einen die kommunale Gesundheitsflirsorge, zum anderen das Kra11kenhauswesen, jeweils als Beispiel für kommunale Gesundheitspolitik. Beide Diskussionsvariagen stammten von Alfons Labisch. Im ersten Papier ("Das Krankenhaus in der Gesundheitspolitik der deutschen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg", veröffentlicht in: Jahrbuch Medizinische Soziologie 1/1981, 126-151) stellt Labisch dar, wie sich allmählich während des späten 19. Jahrhunderts innerhalb der Arbeiterschaft der Anspruch durchsetzte, das Krankenhaus zu einer Institution zu entwickeln, die im Krankheitsfalle die Arbeiter und ihre Familien ohne übermäßige finanzielle Belastungen und besonders ohne rechtliche Nachteile nach dem jeweils neuesten Stand medizinischer Entwicklung versorgen könnte. Dazu mußte das Krankenhaus einerseits seinen traditionellen Geruch als Armenanstalt abstreifen, die medizinisch ineffizient war und zugleich ihre Klientel politisch-rechtlich diskriminierte. Andererseits mußte die Idee eines kommunalen Krankenhauses, das, öffentlich subventioniert, seine Leistungen zu Krankenkassen-Tarifen und insofern für die Versicherten unentgeltlich anbot, durchgesetzt werden, und zwar nicht nur gegen Widerstände im kostenbewußten Bürgertum beziehungsweise bei seinen Vertretern in den kommunalen Parlamenten, sondern auch innerhalb der Arbeiterbewegung selbst. Lange Zeit propagierte eine starke Fraletion derselben als Gegenmodell die aus Mitteln der Krankenkasse beziehungsweise der Kommunen geförderte Haus- und Familienpflege im KrankheitsfalL Labisch rekonstruierte in seinem Papier die das Krankenhaus betreffende politische Diskussion innerhalb der SPD, besonders am Beispiel Berlins, sowie die praktischen Erfahrungen in der Berliner Krankenhauspolitik der Arbeiterbewegung, die maßgeblich die Zielsetzungen der parlamentarischen Diskussion beeinflußten.
In seinem schriftlichen Kommentar begrüßte Manfred Stürzbecher zunächst das Faktum, daß Labisch sich um eine sozialpolitische Analyse der historischen Krankenhausentwicklung bemüht habe. Allerdings bezweifelte er, daß mit einer Darstellung ausschließlich der sozialdemokratischen Kommunalpolitik bezüglich des Krankenhauses ein genügend differenziertes Bild der Bedingungen von Krankenhausentwicklung im späten Kaiserreich
Sozialgeschichte der Medizin 219
entworfen werde. Während bisher vor allem die bürgerliche Ideologie des Krankenhauswesens in der Literatur dargestellt worden sei, werde jetzt ein Gegengewicht mit den Argumenten der Sozialisten geschaffen. Wichtig wäre es jedoch, wenn es gelänge, die relative Bedeutung der verschiedenen Einflüsse auf die praktische Entwicklung des Krankenhauswesens einzuschätzen. Seiner Meinung nach fehlten dazu vor allem Aufarbeitungen von verfügbaren Quellenmaterialien, für die Stürzbecher einige Beispiele darstellte. Axel Hinrich Murken, Aachen, trug einen mündlichen Kommentar vor, in dem er unter anderem verdeutlichte, wamm der Ansatz einer Architekturgeschichte des Krankenhauswesens, der die neuere Literatur zur Krankenhausgeschichte dominierte, berechtigt und fruchtbar gewesen sei. Die Architekturgeschichte sei der Weg gewesen, der es zum ersten Mal erlaubte, einen objektivierbaren Blick in die bis dahin unerforschte Geschichte des Krankenhauswesens in Deutschland zu werfen. Angesichts der aktuellen Diskussion in der Bundesrepublik bedauerte Murken, daß Labisch in seiner Vorlage die Auseinandersetzung über Krankenhauspflege versus Hauspflege nur gestreift und die Gründe für das Unterliegen der Hauspflege-Fraktion nicht genügend geklärt habe.
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, daß wesentliche Aspekte der Krankenhausentwicklung in Deutschland sozialhistorisch bisher ungenügend erforscht sind. So ließ sich zwar rasch klären, von welchem Zeitpunkt an die Bevölkerung in welchem Ausmaß das Krankenhaus als Pflegeinstitution im Krankheitsfall akzeptiert hat, jedoch sind die Gründe dafür weitgehend unklar. Während offensichtlich das Krankenhaus schon während des friihen 19. Jahrhunderts zunehmend zugleich Ausbildungsfunktionen für medizinische Fachberufe, vor allem für die Ärzte übernommen habe, konnte nicht geklärt werden, von welchem Zeitpunkt an und aufgrund welcher Mechanismen dadurch einerseits die Effizienz therapeutischen ärztlichen Wirkens erhöht wurde, andererseits das Prestige sowohl der Ärzte als solcher wie des Krankenhauses als Institution in der Bevölkerung zunahm. Ebenfalls weitgehend unerforscht sind die konkreten Veränderungen der Zusammensetzung der Patientenschaft, und zwar in sozialer Hinsicht wie unter dem Gesichtspunkt der behandelten Krankheiten und der Entwicklung der strukturellen Bedingungen des Krankenhauses (etwa aus organisationssoziologischer oder betriebswirtschaftlicher Sicht). In diesem Zusammenhang stellte Tennstedt die Hypothese auf, die zunehmende Akzeptanz des Krankenhauses im späten 19. und friihen 20. Jahrhundert sei wesentlich als eine Folge der Erkenntnis anzusehen, daß die Wohnverhältnisse der Unterschichten pathogen seien. In der Bevölkerung, speziell in sozialpolitisch engagierten Kreisen, setzte sich die Vorstellung durch, daß zumindest Kranke aus den Privatwohnungen herausgenommen und ins Krankenhaus gebracht werden sollten. Aus der Sicht der Kommunalpolitiker stellte sich die Situation so dar, daß man die Finanzierung von Krankenhausban und -unterhalt sozusagen "im Griff hatte", dagegen keineswegs die Wohnungsfrage.
Im zweiten Teil der Sektion 5 diente als Diskussionsvorlage ein Arbeitspapier von Alfons Labisch: Entwicklungslinien des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland. Zur historischen Soziologie öffentlicher Gesundheitsvorsorge (erscheint in bearbeiteter Fassung in der Zeitschrift Das öffentliche Gesundheitswesen, 1982). Kommentare dazu gaben Stefan Leibfried, Bremen, und Paul Weindling, Oxford, ab. Ferner lag ein schriftlicher Kommentar von Manfred Stürzbecher vor. Labisch führte in seiner Einleitung aus, daß der eigentliche Gegenstand des Papiers die aktuelle Problematik individueller und gesellschaftlicher Gesundheitsvorsorge sei. Da mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst in der Bundesrepublik Deutschland ein System bestünde, dem hinsichtlich der Bekämpfung der noch vor wenigen Generationen vorherrschenden und als bedrohlich empfundenen Infektionskrankheiten von vielen Seiten Erfolg zugeschrieben werde, stelle er die historische Entwicklung des öffentlichen Gesundheitsdienstes aus der Sicht soziologischer
220 Alfons Labisch/Reinhard Spree
Theorien vor, um auf diese Weise zu neuen Ansätzen in der Diskussion über Modelle der Gesundheitsvorsorge zu kommen. Weindling betonte aus seiner Kenntnis der Aktenlage heraus, daß das Interesse des Staates an sozialer Kontrolle sehr groß gewesen sei: In diesem Sinne seien die Richtung und die Natur des staatlichen Einflusses auf das Gesundheitswesen noch im Detail zu untersuchen. Ansatzpunkte für die Forschung seien seiner Meinung nach:
Die Medizinal-Kollegien und andere halböffentliche Gruppierungen von Ärzten, die hinsichtlich ihrer Bedeutung und Leistungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst beziehungsweise für die kommunale Gesundheitspolitik, dabei aber auch hinsichtlich der sozialen Herkunft, beruflichen Ausbildung und Entwicldung, politischen Stellung und Einbindung ihrer Mitglieder, zu analysieren seien. Wichtig erschienen darüber Irinaus intermediäre Organisationen wie das Rote Kreuz und die Kampagnen zur Bekämpfung des Alkoholismus, der Tuberkulose, der Säuglingssterblichkeit, der Kurpfuscherei usw. Auffällig seien überlappende Mitgliedschaften und staatsnahe Aktivitäten oder Verflechtungen mit öffentlichen Bürokratien sowie Einflüsse auf die öffentliche Meinungsbildung. Besonders lohnend erscheine eine Untersuchung der Kampagne gegen die Geschlechtskrankheiten. Sie verspreche Auskünfte über die konkreten Verflechtungen bestimmter gesellschaftlicher Gmppen mit den politischen Eliten und ihre strategischen Zielsetzungen. Beachtlich sei der intendierte Zugriff auf Familie und Frauen sowie die Tatsache, daß mit dem Versuch einer Überwachung der Prostitution im großen Stil polizeiliche Kontrollen privater, intimer Aktivitäten sowie Zwangsbehandlungen etabliert wurden. Schließlich sei ein wichtiger Komplex, der bisher in Deutschland ungenügend bearbeitet erscheine, der Zusammenhang von Sozialhygiene, Bevölkerungspolitil< und Rassenhygiene. Von diesem Komplex gingen Impulse zur Strukturierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und seiner Leistungen aus, deren Tragweite über das Gesundheitswesen hinaus durch ihren Stellenwert in der nationalsozialistischen Bevölkerungs- und Rassenpolitik verdeutlicht werde. Nach Leibfried seien vor allem regionale und lokale Studien zum Gesundheitsdienst
notwendig. Bemerkenswert erscheine ihn, daß es beispielsweise in Berlin zu einer Verbindung von administrativen und Minoritätsinteressen gekommen sei: Die sozialhygienisch ausgebildeten Kommunalärzte seien zumeist Juden und zugleich Sozialisten oder Kommunisten gewesen; ihr Arbeitsgebiet wiederum habe sich primär auf gesellschaftliche Minoritäten und Randgruppen gerichtet. Ferner wies Leibfried darauf hin, daß es einen erheblichen Anteil von Ordnungspolitik beim Angebot sozialer Dienste gegeben habe, deutlich beispielsweise in der praktischen und administrativen Überschneidung von Armenpolitik und Sozialpolitil< mit der Gesundheitspolitik. Die anschließende Diskussion wurde beherrscht von mehrfach geäußerten Gefühlen des Unbehagens an einer öffentlichen Medizin, festgemacht unter anderem am Problem einer individuellen gegenüber einer kollektiven ethischen Orientierung der Ärzte. Gefragt wurde, ob nicht die Sozialhygiene mit ihren Ansprüchen letzten Endes totalitär in das individuelle Intimleben eingreife. Es wurde die These vertreten, daß die an zahlreichen biographischen Fällen belegte Entwicklung vom engagierten sozialreformerischen Arzt über das Engagement für Bevölkerungspolitik und Sozialhygiene zum Vertreter einer tendenziell faschistischen Rassenhygiene fast zwangsläufig und auf keinen Fall zufällig oder einmalig gewesen sei. Insofern sei der in der Bundesrepublik konstatierbare Zerfall und funktionale Erosionsprozeß des öffentlichen Gesundheitsdienstes eher zu begrüßen. Es gebe nur wenige Bereiche, in denen der potentiell totalitäre Zugriff des Staates auf das Individuum, die Tendenz zur Entmündigung derart naheliegend und - wie an historischen Beispielen zu zeigen ist - sogar quasi wissenschaftlich legitimierbar sei, wie im Bereich einer politischen
Sozialgeschichte der Medizin 221
Zielsetzungen untergeordneten Medizin, als die der öffentliche Gesundheitsdienst regelmäßig erscheine. Eben in dieser Perspektive sei auch die Ambivalenz des schon im Papier von Spree angesprochenen Prozesses der Medikalisierung der Unterschichten als "Zwangssozialisation" zu sehen, bei dem die Elemente des Fortschritts, der Emanzipation, der wachsenden Verfugung über Lebenschancen von Autoritäten, zunächst von Ärzten und Institutionen des Gesundheitswesens, später auch von Gurus oder Führern verschiedener ideologischer Provenienz, überkompensiert werden könnten.
Margot Jefferys wies darauf hin, daß der Niedergang des öffentlichen Gesundheitswesens in der Nachkriegszeit ein internationales Phänomen sei. Ihr erscheine beinal1e fraglich, ob es überhaupt jemals eine "große Zeit" des öffentlichen Gesundheitsdienstes gegeben habe. Ferner habe mit der zunehmenden Spezialisierung in Wissenschaft, Politik und Verwaltung ein Verlust von Aufgaben und Funktionen des öffentlichen Gesundheitsdienstes stattgefunden, der es dem darin tätigen Arzt heute schwermache, seine Rolle gegenüber neuen Professionen wie den Sozialarbeitern überhaupt noch zu definieren. In der Administration selbst stehe der Arzt nur an zweiter Stelle, ihm regelmäßig übergeordnet seien die Ingenieure des Gesundheitsmanagement, insbesondere die Techniker der Datenverwaltung, die im Bereich von Gesundheits- und Sozialpolitik eine ständig wachsende bedrohliche Bedeutung erlange. Andererseits sei auch gegenüber der Semi-Profession der Sozialarbeiter ein Funktions- und Prestigeverlust des Arztes als Gesundheitsbeamten beobachtbar. Dazu trügen ganz entscheidend Umstrukturierungen im Bereich der Klientel und Verschiebungen in den politikleitenden Wertsystemen bei. Gesellschaftliche Randgruppen, auf die sich politische Bestrebungen richteten, seien nicht primär durch gesundheitliche Merkmale definiert, allenfalls durch gesundheitsrelevante. Der Versuch einer aufgeklärten Politik gehe deshalb auch dahin, zunehmend den administrativen Zugriff auf die eigentlichen Ursachen und nicht auf die erst nachgelagerten gesundheitlichen Folgen zu richten. Diese Blickrichtung unterstützte Gabbay, indem er meinte, man müsse auch deutlich die Grenzen sehen, an die Ärzte in gesundheitspolitischer Absicht stießen. Zum Beispiel sei das gesellschaftlich zunehmend bewußter werdende Problem der Pollution offensichtlich ziemlich resistent gegenüber einem medikalisierenden, über Ärzte und Institutionen des Gesundheitswesens vorgetragenen Zugriff. Auch beim Kampf gegen andere Gesundheitsrisiken wie Rauchen, Trinken, Medikamentenmißbrauch, überhaupt gegenüber Suchtsymptomen erweise sich die Medizin beziehungsweise die öffentliche Gesundheitspolitik nicht mehr effizient. Das alles trage zum Prestigeverlust und zum Aufgabenentzug flir den öffentlichen Gesundheitsdienst bei.
Aus der Diskussion hatte sich ferner noch spontan eine sechste Sektion ergeben, deren Thema die Probleme, Methoden und Quellen einer Sozialgeschichte der Medizin "von unten" war. Schenda hatte die Frage aufgeworfen, ob sich eine Sozialgeschichte der Medizin "von unten", das heißt aus der Sicht und Erfahrungswelt der Betroffenen, vor allem der Unterschichten-Patienten, überhaupt schreiben lasse. Ferner stelle er die Frage, welchen Wert eine subjektive Geschichtsschreibung "von unten" haben könne. Seiner Meinung nach würde diese Art von Geschichtsschreibung zur Bildung von Hypothesen über gesundheitsrelevante Einstellungen und Verhaltensweisen beitragen können, ebenso zur Illustration, Differenzierung, Konkretisierung der mit sogenannten harten Daten gewonnenen Ergebnisse sozialstatistischer historischer Forschung. Als mögliche Quellen wurden genannt: die frühen Sozialenqueten (Engels; Villerme; Schnapper-Arndt und andere); medizinische Topographien und andere protokollarische Berichte über gesundheitsrelevante Volkssitten; Biographien und Autobiographien; volksmedizinische Berichte, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts in gröl~erer Zahl vorliegen; Reiseberichte; und ftir die jüngere Zeit: Texte aus der Oral History; Darstellungen aus dem Bereich der Ethnomedizin, die diachron interpretiert werden könnten nach dem Muster: Sitten und Gebräuche im Zu-
222 Alfons Labisch/Reinhard Spree
sammenhang mit Gesundheit und Krankheit in abgeschlossenen Teilen Süd- und Osteuropas könnten Indikatoren für entsprechendes Verhalten während des 18. oder 19. Jahrhunderts in den heutigen hochentwickelten Regionen Europas sein. Luckin wies auf die Tradition der History from Below in Großbritannien und auf das Organ dieser Richtung, die Zeitschrift History Workshop hin. Aus diesem Arbeitsverbund seien neue theoretische Ansätze zur englischen Geschichte hervorgegangen, die eine erhebliche Breitenwirkung und Anregungsfunktion entfaltet haben.
Fischer-Hornberger hob die erheblichen Methodenprobleme hervor. Der Patient sei in der Geschichte prinzipiell stumm. Wenn er - selten genug- rede, dann dringen über die Sprache, über die von ihm benutzten Begriffe (Krankheitsbezeichnungen, mitteilbare Sichtweisen von Unwohlsein und möglichen Ursachen) die Paradigmen der "Geschichte von oben" wieder ein, anders gesagt: Paradigmen, die die herrschende Sichtweise prägten. Dem sei nur schwer auszuweichen. Sie plädierte darüber hinaus für eine verstärkte Einbeziehung der eigenen Erfahrungen als Ausgangspunkt, Sensibilisierungsinstrument oder auch Korrektiv bei Quelleninterpretationen sowie auch bei der Quellensuche. Auch nach D. von Engelhardt ist die Subjektivität in der Medizingeschichte unbewertet; er erwähnte literarische und bildhafte Darstellungen, Hausväter-Literatur und letzten Endes auch bestimmte, sozusagen "gegen den Strich" zu lesende medizinische Texte aus der Vergangenheit. Marie-France-Morel berichtete abschließend ausführlich über die französische Geschlchtsschreibung "von unten", die bekanntlich von der Schule der "Annales" seit langem vorbildhaft entwickelt worden ist. Sie betonte, daß eine Geschichtsschreibung aus der Sicht des Kranken, des potentiellen Klienten, des Betroffenen notwendig interdisziplinär angelegt sein müsse. In Frankreich bisher systematisch ausgewertete Quellen seien etwa Berichte der Provinzärzte an das Collegium Medicinae Paris; Bdefwechsel von Privatpersonen, in denen über Krankheits- und Ärzteerfahrungen berichtet werde; Akten der Militärbehörden über die Ergebnisse von Reihenuntersuchungen innerhalb des Militärs (wie Rekrutenaushebungen) sowie -nicht zuletzt- die Oral History, die in Paris am Institut für Gegenwartsgeschlchte institutionalisiert sei. Als beispielhafte Themenkomplexe nannte sie langfristige Veränderungen der Ernährungssituation, die Geschichte des Körpers, die Geschichte der Geburtserfahrung, die Veränderung von Krankheitserfahrungen in verschiedenen Phasen des Lebenslaufs während bestimmter historischer Perioden.
Es bedürfte eigentlich keines Hinweises, daß die über einen Zeitraum von drei Tagen sehr intensiv geführte Diskussion hier nur in gröbsten Zügen wiedergegeben werden kann. Des weiteren dürfte deutlich geworden sein, daß auch während der Arbeitstagung viele Problembereiche nur angesprochen werden konnten; selten gelang es, einzelne Diskussionsstränge "bis zu einem Ende" zu verfolgen. Hier lag zugleich auch einer der Rauptkritikpunkte der Teilnehmer. Dies wurde indes insofern wettgemacht, als das wesentliche Ziel der Tagung offensichtlich erreicht worden ist, nämlich Wissenschaftler der verschiedensten Disziplinen, die jeweils spezifische Zugriffe auf Themen aus dem Bereich Gesundheit, Krankheit, Tod und Gesundheitswesen haben, in ein konstruktives Gespräch zu bringen. Sonst wäre die Bitte, an verschiedenen Punkten weiter diskutieren zu wollen, wohl nicht aufgetaucht; sie stand geradezu als Forderung im Zentrum der Abschlußdiskussion. War man sich auch einig, daß die vorgelegten Arbeitspapiere und Diskussionsergebnisse nicht im Zusammenhang publiziert werden sollten, so kristallisierte sich doch andererseits deutlich der Wunsch heraus, eine Tagung dieser Art in vergleichbarer Form zu wiederholen oder sogar in eine Sequenz von Gesprächsrunden einzubinden. Dazu wurden die folgenden Themenvorschläge gemacht:
Sozialgeschichte der Medizin 223
Die soziale Konstruktion medizinischen Wissens am Beispiel bestimmter Krankheitstheorien (wie Syphilis, Asthma oder Tbc); Sozialgeschichte bestimmter Krankheiten, speziell der größeren Epidemien im 18_, 19. oder 20. Jahrhundert (wie Cholera, Pocken, Typhus, Ruhr, Krebs, Neurosen, Pychosen, Unfalle); Krankheiten und Institutionen des Gesundheitswesens (vor allem Krankenhaus und Amtsarzt, aber auch Säuglingsfürsorge oder Säuglingsimpfstelle usw.) aus der Sicht der Patienten im 18., 19. und/oder 20. Jahrhundert; das Verhältnis zwischen Staat und Medizin in bestimmten Teilperioden der Neuzeit (wie im Ancien Regime; während des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts, Stichwort: Imperialismus; während des Faschismus); Krankheit und Familie beziehungsweise der Kranke in der Familie seit Beginn der Neuzeit.
Teilnehmer: Priv. Doz. Dr. G. Baader (Berlin), Rolf R. Behler (Bielefeld); Prof. Dr. J. Bleicer (Berlin), Dr. A. Gräfin zu Casteil (Bochum), Dr. R. Dieleier (Bremen), B. Duden (Berlin), Prof. Dr. D. v. Engelhardt (Heidelberg), Dr. R. J. Evans (Norwich), E. Fink (Berlin), Prof. Dr. E. Fischer-Hornberger (Bern), U. Frevert (Bielefeld), Dr. J. Gabbay (Cambridge), Dr. J. Geyer-Kordesch (Münster), G. Göckenjahn (Berlin), Dr. E. Göpel (Bielefeld), Prof. Dr. K. Hausen (Berlin), B. Huebert (Münster), C. Huerkamp (Gütersloh), Prof. M. Jefferys (London), Prof. Dr. H. Kaelble (Berlin), Dr. St. Kirchberger (Münster), Dipl.-Jur. P. Klein (Bremen), Prof. Dr. J. Kocka (Bielefeld), Prof. Dr. A. Labisch (Kassel), Dr. R. W. Lee (Liverpool), Prof. Dr. S. Leibfried (Bremen), Dr. B. Lucldn (Bolton/England), Prof. Dr. P. Lundgreen (Bielefeld), Dr. L. Machthau (Bremen), Prof. Dr. C. McClelland (München), Dr. D. Milles (Bremen), Dr. M.-F. More! (Sceaux/Frankreich), Prof. Dr. R. Müller (Bremen), Prof. Dr. A. H. Murken (Aachen), U. Ottmüller (Berlin), Priv.-Doz. Dr. J. Reulecke (Bochum), Prof. Dr. R. Schenda (Zürich), Prof. Dr. A. Schuller (Berlin), Prof. Dr. E. Seidler (Freiburg i. Br.), Prof. Dr. R. Spree (Berlin), Prof. Dr. Tennstedt (Kassel), I. Trostmann (London), Dr. IC.-D. Thomann (Frankfurt), Dr. P. Weindling (Oxford), Prof. Dr. R. Winau (Berlin).
Prof. Dr. Dr. Alfons Labisch Fb 4, Gesamthochschule Kassel Heinrich-Plett-Str. 40 D-3500 Kassel-Oberzwehren
Prof. Dr. Reinhard Spree Campestraße 7 D-1000 Berlin 27