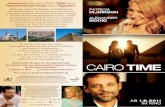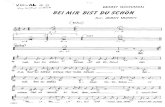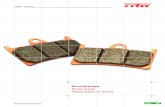Nordlicht_Jan-Feb_2012
-
Upload
jakob-wilder -
Category
Documents
-
view
214 -
download
2
description
Transcript of Nordlicht_Jan-Feb_2012
EinE Für AllE 116 117
nr. 1/2 | 2012 Offizielles Mitteilungsblatt der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein
NordlichtJanuar/Februar 2012 | 15. Jahrgang
a K T u E L L
serviceseit
en
ab seite 48
a K T u E L L
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
InhaLT
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 20122
Ab dem 1. März 2012 soll es eine bundesweit einheitliche Telefonnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst geben: die 116 117. Im Titelthema klären wir, was die Einführung der neuen Nummer insbesondere für den ärztlichen Bereitschafts-dienst in Schleswig-Holstein bedeutet, was sich ändert und was Sie und Ihre Patienten beachten müssen.
Die Arbeit der Prüfgremien wird selten geliebt und in der Ärzteschaft manchmal kontrovers diskutiert. Wir erklären Rolle und Arbeitsweise von Prüfungsstelle und Beschwerdeausschuss und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen des Prüfgeschäfts.
sEITE rubrIK/ThEma
Aus dem InhalthEfT 1/2 | 2012
2446
TITELThEma04 Ärztlicher Bereitschaftsdienst –
Was bringt die neue Nummer 116 117?
06 „Kaum Veränderungen“ – Interview mit Alexander Paquet, Leiter Notdienstabteilung
07 Fragen und Antworten zu 116 117
08 Auf Tour mit dem fahrenden Bereitschaftsdienst
12 nachrIchTEn KompaKTGEsundhEITspoLITIK
16 Kontroverse um Studienplätze – Braucht das Land weniger Medizinstudenten?
18Kongress Vernetzte Gesundheit – Minister Garg fürchtet finanziellen Wettlauf der Länder
19 Kolumne: Wahlkampf á la Holstein
20 Gastbeitrag Prof. Dr. Fritz Beske: „Das Leben auf Kredit hat seine Grenzen“
praxIs & KV22 Alles „safe“: Datensicherheit in der KVSH
24 Funktion und Arbeitsweise der Prüfgremien
28 Arzt und Werbung – Was geht und was geht nicht?
30 Aufgepasst beim Pharmamarketing – Ärzten droht das Strafrecht
32 AKR: Ein Gesetz und seine Wirkung
33 „Klug kodieren leicht gemacht“: Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
35 Sie fragen – wir antworten
36 Lehrpraxis: Mit Leidenschaft Landärztin
37 KBV Versorgungsmesse – Marktplatz für Innovationen
38 Moderatorentreffen in der KVSH
40 Übersichtlicher: Die neue Sammelerklärung
41 Nicht gerade einfach: Die Todesbescheinigung
42 Öffentliche Ausschreibung von Vertragspraxen
44 Aktuelles aus der Psychotherapie
45 Neues aus KVen und KBV
dIE mEnschEn Im Land46 Faszination Feuerstuhl
sErVIcE48 Sicher durch den Verordnungs-Dschungel
49 DMP: Schulungsberechtigung für Kinder und Jugendliche
04
Wertvolle Informationen für Sie und Ihr Praxisteam auf den mit einem grünen „ i“ markierten Seiten
Wie entspannt man sich am besten vom anstrengenden Praxisalltag? Allgemeinarzt Dr. Reimar Vogt aus Pahlen hat Spaß an schnellen Motorrädern und verbringt seine Freizeit des-halb am liebsten auf den großen Renn-Events des Nordens.
nordLIchT nr. 1/2 | 2012
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 3
Liebe Leserinnen und Leser,wird jetzt alles regional?
Nun ist es in Kraft, das allseits diskutierte Versorgungsstrukturgesetz, von Kassenseite auch gern als „Ärztebeglückungsgesetz“ bezeichnet. Wenn man einmal davon absieht, dass nach wie vor wesent-liche Vorgaben z. B. zur neuen Bedarfsplanung oder zur Ausgestaltung der sogenannten spezialfach-ärztlichen ambulanten Versorgung von der Bundesebene – speziell dem Gemeinsamen Bundesaus-schuss – kommen werden, kann man insgesamt das Fazit ziehen, dass die Bedeutung der regionalen Selbstverwaltung nach Jahren der Zentralisierung deutlich gestärkt wird. Verantwortung kehrt dahin zurück, wo sie hingehört und wo man landesspezifischen Besonderheiten sehr viel besser Rechnung tragen kann.
Eine Entwicklung, die einer wesentlichen Forderung der KVSH entspricht und auch von den Kassen-verbänden im Land prinzipiell begrüßt wird.
Besonders wichtig in diesem Kontext ist auch die (Rück-)Verlagerung der Entscheidungskompetenz des hochsensiblen Bereichs der Honorarverteilung in die Gremien der Selbstverwaltung der KV – spe-ziell der Abgeordnetenversammlung. Erste Diskussionen in den Ausschüssen unterstützen hierbei die Linie des KV-Vorstands, Änderungen nur mit Bedacht und schrittweise vorzunehmen.
Eine besondere Herausforderung wird darüber hinaus in der Aufgabe bestehen, dem sich abzeich-nenden Ärztemangel speziell im ländlichen Raum wirksam zu begegnen. Neben dem Ausbau des bereits initiierten Strukturfonds mit möglichen weiteren Anreizen finanzieller Natur gilt es, hier dem Wunsch unseres medizinischen Nachwuchses nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachzukommen.
Dabei können wir gerade in unserem Bundesland mit der inzwischen im sechsten Jahr bestehenden und bewährten Struktur des ärztlichen Bereitschaftsdienstes punkten. So sehen wir auch der bundes-weiten Einführung der neuen einheitlichen Bereitschaftsdienstnummer gelassen entgegen.
Eine unterhaltsame Lektüre wünscht IhnenIhre
von Dr. IngeBorg Kreuz, vorstanDsvorsItzenDe Der KvsH
E D I T O R I A L
TITELThEma
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 20124
Ä R Z T L I c H E R B E R E I T S c H A F T S D I E N S T
Am 1. März soll es losgehen: Dann ist der ärztliche Bereitschafts-dienst in ganz Deutschland unter einer einheitlichen Telefon-nummer erreichbar. Unter der Rufnummer 116 117 können sich die Bürger künftig außerhalb der Praxiszeiten an einen Bereit-schaftsarzt in ihrer Umgebung vermitteln lassen. Die Nummer ist kostenlos, egal ob sie aus dem Festnetz, per Handy oder über das Internet (Voice over IP) angerufen wird. Alle verwendeten Informationen von Anrufern werden unter strenger Einhaltung des Datenschutzes vertraulich behandelt.
Die Idee einer bundesweit einheitlichen Bereitschaftsdienstnum-mer kommt von der KV Brandenburg. Im Jahr 2006 stimmten in der Vertreterversammlung der KBV die Kassenärztlichen Ver-einigungen der anderen Bundesländer dieser Idee zu. Bislang gab es viele unterschiedliche Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst, oft sogar mehrere in einem Bundesland. Dies ändert sich nun: 116 117 ist künftig in nicht lebensbedrohlichen Situationen der direkte Draht zum Arzt. In Schleswig-Holstein gibt es bereits seit rund fünf Jahren eine landesweit einheitliche Num-mer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 01805 11 92 92. Diese wird zum Start der 116 117 nicht sofort abgeschaltet, sondern läuft so lange weiter, bis sich die neue Bereitschaftsdienstnum-mer etabliert hat (siehe auch Interview auf der Seite 6).
einfache nummer, technische Herausforderung Patienten, die die Telefonnummer 116 117 wählen, erreichen somit auch in Zukunft den für sie zuständigen ärztlichen Bereitschafts-dienst. Ein Berliner wird in der Leitstelle des Bereitschaftsdienstes der KV Berlin landen, ein Nürnberger im bayerischen callcenter, ein Kieler – wie bisher auch – in der Leitstelle der KVSH in Bad Segeberg. Was einfach klingt, stellt technisch eine hohe Herausforderung dar. Das fängt damit an, dass alle Anrufer der 116 117 auf lokale Tele-fonnummern des Bereitschaftsdienstes aufgeschaltet werden. In Schleswig-Holstein ist dies die bereits erwähnte 01805 11 92 92. Um sicherzustellen, dass der Patientenanruf zu dem korrekten Bereitschaftsdienstbezirk von Flensburg bis zur Zugspitze automa-tisch weitergeleitet wird, muss der Standort des Anrufers ermit-telt werden. Im Festnetzbereich wird zuerst über die Vorwahl versucht, den Standort ausfindig zu machen. Sollte dies zur Lokali-sierung allein nicht ausreichen, wird der Anrufer per Bandansage gebeten, seine Postleitzahl mitzuteilen. Danach geht die Suche weiter: Jetzt muss zum Standort des Anrufers der passende Bereit-schaftsdienst ermittelt werden. Dazu greift das System auf eine Datenbank zu, in der alle allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienste mit den entsprechenden Rufnummern hinterlegt sind.
Eine Nummer in sprechstundenfreien ZeitenUnter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 können Patienten künftig kostenlos den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen.
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit ein
heitlich
en Telefonnum
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit ein
heitli
chen
Tel
efon
num
mer
116
117
++
+ B
unde
swei
t ei
nhei
tlich
en Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einheitlich
en Telefonn
umm
er 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit e
inhei
tlich
en Te
lefo
nnum
mer
116
117
+++
Bu
nd
esw
eit
einh
eitl
iche
n Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit ein
heitlichen
Telefonnum
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit einheitl
ichen
Tel
efon
num
mer
116
117
+++
Bu
nde
swei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit ein
heitlichen
Telefonn
umm
er 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit e
inheitlich
en Te
lefo
nnum
mer
116
117
+++
Bun
des
wei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einh
eitlichen
Telefonn
umm
er 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit e
inheitli
chen
Tel
efon
num
mer
116
117
+++
Bu
nde
swei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einh
eitlichen
Telefonn
umm
er 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit e
inheitlich
en Te
lefo
nnum
mer
116
117
+++
Bu
nde
swei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fonnummer 1
16 117 +++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit einheitlichen
Telefonn
umm
er 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit e
inheitli
chen
Tele
fonn
umm
er 1
16 1
17 +
++ B
un
des
wei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einh
eitlichen
Telefonnum
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit einhei
tlich
en T
elef
onnu
mm
er 1
16 1
17 +
++ B
un
desw
eit
einh
eitl
iche
n Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit ein
heitlich
en Telefon
num
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit einhei
tlich
en Te
lefo
nnum
mer
116
117
+++
Bu
nde
swei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einheitlich
en Telefon
numm
er 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit e
inheitli
chen
Tele
fonn
umm
er 1
16 1
17 +
++
Bun
desw
eit
einh
eitl
iche
n Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einheitlich
en Telefon
num
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit einheitl
ichen
Tele
fonn
umm
er 1
16 1
17 +
++ B
un
desw
eit
einh
eitl
iche
n Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einh
eitlichen
Telefonn
umm
er 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit e
inheitli
chen
Tel
efon
num
mer
116
11
7 ++
+ B
un
desw
eit
einh
eitl
iche
n Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einheitlich
en Telefon
num
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit einheitl
ichen
Tele
fonn
umm
er 1
16 1
17
+++
Bun
des
wei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fo
nnummer 1
16 117
+++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit ein
heitliche
n Telefonnum
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit ein
heitli
chen
Tel
efon
num
mer
116
11
7 +
++ B
unde
swei
t ei
nhei
tlich
en Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit ein
heitlich
en Telefon
num
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit ein
heitli
chen
Tele
fonn
umm
er 1
16 1
17
+++
Bun
desw
eit
einh
eitli
chen
Tele
fo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einhe
itlichen
Telefonnu
mm
er 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit e
inheitlich
en Te
lefo
nnum
mer
116
117
++
+ B
unde
swei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fonn
ummer 116
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit ein
heitlich
en Telefonnum
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit ein
heitli
chen
Tel
efon
num
mer
116
117
++
+ B
unde
swei
t ei
nhei
tlich
en Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einh
eitlichen
Telefonnum
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit ein
heitli
chen
Tel
efon
num
mer
116
117
+++
Bun
desw
eit
einh
eitl
iche
n Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einh
eitlichen
Telefonn
umm
er 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit e
inheitli
chen
Tel
efon
num
mer
116
117
+++
Bu
nde
swei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einheitlich
en Telefon
num
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit einhei
tlich
en Te
lefo
nnum
mer
116
117
+++
Bu
nd
esw
eit
einh
eitl
iche
n Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit ein
heitlich
en Telefon
num
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit einhei
tlich
en Te
lefo
nnum
mer
116
117
+++
Bu
nde
swei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einheitlich
en Telefon
num
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit einheitl
ichen
Tele
fonn
umm
er 1
16 1
17 +
++ B
un
desw
eit
einh
eitl
iche
n Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einheitlich
en Telefon
num
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit einheitl
ichen
Tele
fonn
umm
er 1
16 1
17
+++
Bun
des
wei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fo
nnummer 1
16 117
+++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit ein
heitlich
en Telefon
num
mer 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesw
eit ein
heitli
chen
Tele
fonn
umm
er 1
16 1
17
+++
Bu
ndes
wei
t ei
nhei
tlich
en Te
lefo
nnummer 116 117
+++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit einh
eitlich
en Te
lefo
nnumm
er 116 117 +++ Bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 +++ Bundesweit
ein
heitli
chen
Tele
fonn
umm
er 1
16 1
17 +
++
Bu
ndes
wei
t ei
nhei
tlic
hen
Tele
fonnummer 1
16
TITELThEma
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 5
Im Bereich des Mobilfunks wird eine datenschutzrechtlich kon-forme Handy-Ortung durchgeführt. Ist der Aufenthaltsort des Anrufers ermittelt, werden der zuständige Bereitschaftsdienst, die diensthabende Bereitschaftsdienststelle und die dazugehörige Rufnummer aus einer Zuordnungstabelle bestimmt.
Im Idealfall wird jeder Anrufer automatisch an die für ihn zustän-dige Bereitschaftsdienststelle weitergeleitet. Geschieht dies nicht, weil der Anrufer zum Beispiel die Postleitzahl seines Aufenthalts-ortes nicht sofort parat hat, wird er mit einem zentralen Service-center verbunden. Mitarbeiter nehmen die Adresse des Anrufers auf und leiten ihn an den regionalen Bereitschaftsdienst weiter.
zukunftsmusikDie 116 117 ist als europaweite Nummer angelegt. In den kom-menden Jahren sollen sukzessiv weitere Mitgliedsländer der Euro-päischen Union diesen Service installieren. Folgende Vision steckt dahinter: Patienten können sich dann auch im Urlaub oder auf Geschäftsreisen im Ausland über den jeweiligen Bereitschafts-dienst ärztlichen Rat einholen.
MARcO DETHLEFSEN, KVSH
Se
rvice-CenterZe
ntraler Server
Rettu
ngsleitstelleBezirksstelle
Arzt/Leitstelle
Ortun
g des Anrufs
Ortu
ng nicht möglich
AnruferFestnetz/mobil/Voice over IP
116 117
KV-Callcenter
Anrufweiterleitung
Anrufweiterleitung
Der ärztliche Bereitschaftsdienst wird von allen Kassenärztlichen vereinigungen betrieben. Mit ihm ist sichergestellt, dass Patienten im Krankheitsfall auch außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten, also abends, an Feiertagen und am Wochenende, einen niedergelassenen arzt kontaktieren können. Der Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem notdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei notfällen wie Herzinfarkt oder schlaganfall müssen Patienten den rettungsdienst unter der nummer 112 anrufen.
i
TITELThEma
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 20126
Nordlicht: Was ändert sich nach der Einführung der 116 117 konkret in Schleswig-Holstein?
alexander Paquet: Mit der Einführung der 116 117 ergeben sich erst einmal keine Veränderungen für Schleswig-Holstein, da wir eine gut funktionierende Bereitschaftsdienststruktur vorhalten und schon im Jahr 2007 mit der 01805 - 11 92 92 eine landesweit einheitliche Rufnummer eingerichtet haben. Die 116 117 verbessert aber deutschlandweit die Erreichbar-keit des Bereitschaftsdienstes, der im Moment über sehr viele verschiedene Rufnummern erreicht werden kann. Die bekannte Rufnummer 01805 - 11 92 92 bleibt damit bestehen und kann von der Bevölkerung auch weiterhin wie gewohnt genutzt wer-den. Auch am Angebot unseres Bereitschaftsdienstes und an der bekannten Struktur gibt es keine Veränderungen.
Nordlicht: Wie erfolgt denn die Weiterleitung der „116 117-Anrufer“ in unser Bundesland?
Paquet: Die Vermittlung erfolgt über das „Intelligente Netz“, ein ausgeklügeltes technisches System, das im Hinter-grund der 116 117 abläuft: Wählt ein Patient zum Beispiel in Flensburg die sechsstellige Nummer, spürt das System in Sekundenschnelle über die Vorwahl auf, woher der Anruf genau kommt und verbindet ihn dann mit der Leitstelle des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Bad Segeberg. Dies alles geschieht in
der Regel automatisch. Der Anrufer bemerkt es nicht einmal. Kann der Standort des Anrufers nicht eindeutig ausfindig gemacht werden (z. B. bei Mobilfunkanrufen), wird er gebeten, seine Postleitzahl mitzuteilen. Danach erfolgt entwe-der die automatische Weiterleitung zu uns oder falls keine eindeutige Zuordnung möglich ist zum 116 117-Service-center der KBV. Die Mitar-beiter dort können den Patienten dann anhand seiner Adresse zu uns vermitteln.
Nordlicht: Was müssen die Ärzte, die Bereit-schaftsdienst leisten, nach der Umstellung beachten?
Paquet: Da die Leitstelle in Bad Segeberg mit ihren bekannten Rufnummern weiterhin besteht, ergeben sich keine Veränderungen für
die Ärzte. Der diensthabende Arzt im Fahrenden Dienst erreicht uns auf den bekannten Wegen.
Nordlicht: Welche Maßnahmen werden in der Leitstelle in die Wege geleitet, bevor die neue Nummer frei geschaltet wird?
Paquet: Die zentrale Leitstelle erleichtert uns die Integration der 116 117 in die bestehenden Strukturen. Wir müssen der KBV beispielsweise keine einzelnen Notdienstbezirke und deren kleinteiligen Strukturen bekannt geben – so wäre es vor der Umstrukturierung des Notdienstes gewesen – sondern müssen nur sicherstellen, dass alle 116 117-Anrufer an uns weiterge-leitet werden können. Nichtsdestotrotz stellt dies – insbeson-dere im technischen Bereich – eine Herausforderung für alle Beteiligten dar.
DAS INTERVIEW FüHRTE JAKOB WILDER, KVSH
„Die Auswirkungen sind überschaubar“Alexander Paquet, Leiter der Notdienstabteilung der KVSH, erklärt die wesentlichen Konsequenzen der Einführung der 116 117 auf die Struktur des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Schleswig-Holstein.
Ä R Z T L I c H E R B E R E I T S c H A F T S D I E N S T
InTErVIEw
Die „alte“ 01805-11 92 92 bleibtDie bekannte Rufnummer des ärztlichen Bereitschafts-dienstes in Schleswig-Holstein 01805-11 92 92 bleibt auch nach Einführung der 116 117 bestehen, bis das System für die neue Nummer stabil und zuverlässig funktioniert.
TITELThEma
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 7
Wann startet die neue Nummer für den Bereitschaftsdienst in Deutschland?Die bundesweit einheitliche Telefonnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst wird im Jahr 2012 eingeführt. Geplanter Starttermin ist der 1. März.
Wird die Bereitschaftsdienstnummer auch in anderen europä-ischen Ländern eingeführt?Bei der 116 117 handelt es in der Tat um eine europaweite Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Deutschland ist das erste Land, das diese Nummer einführt. Die Idee geht auf eine Initiative der deutschen Ärzteschaft zurück. Die Kas-senärztliche Vereinigung Brandenburg beantragte daraufhin im Jahr 2007 bei der Europäischen Union die 116 117 als euro-paweit einheitliche Bereitschaftsdienstnummer; die Reservie-rung erfolgte im November 2009. Weitere europäische Länder hatten sich bereit erklärt, die Einführung zu unterstützen, und wollen die Rufnummer ebenfalls einführen.
Was kostet der Anruf?Die Nummer ist für den Anrufer immer kostenfrei – egal, ob er vom Festnetz, vom Mobiltelefon oder über das Internet (Voice over IP) anruft.
Muss vor der Nummer 116 117 eine Vorwahl gewählt werden?Nein, die 116 117 ist eine sogenannte Kurzwahl-Nummer, ana-log beispielsweise zur Behördenrufnummer 115. Diese Num-mern sind deutschlandweit ohne Vorwahl zu erreichen – sowohl vom Festnetz als auch vom Handy aus.
Was ändert sich durch die einheitliche Bereitschaftsdienstnum-mer 116 117 für Ärzte?Patienten, die die 116 117 wählen, werden an den für sie zuständigen Bereitschaftsdienst weitergeleitet. Damit verbes-sert sich die Erreichbarkeit des Bereitschaftsdienstes erheblich, denn langes Suchen nach der richtigen Nummer bleibt den Patienten erspart. Am Angebot des ärztlichen Bereitschafts-dienstes selbst ändert sich durch die Einführung der Nummer jedoch nichts. Somit ändert sich mit der 116 117 auch nichts für den Arzt – es sei denn, die zuständige KV nimmt Änderungen an ihren Bereitschaftsdienst-Strukturen vor.
Ändern sich mit der Einführung der 116 117 die Bereitschafts-dienst-Bezirke?Nein, die Bereitschaftsdienst-Bezirke werden weiterhin von den KVen administriert – wie alle anderen Bereitschaftsdienst-Strukturen auch. Durch die Einführung der neuen Nummer ändert sich daran nichts.
Wer übernimmt die Anrufkosten für die 116 117?Die Anrufkosten müssen entsprechend der Auflage der Bundes-netzagentur für die 116 117 durch den Betreiber der Rufnum-mer (KV-System) getragen werden. In den Jahren 2011 und 2012 übernimmt die KBV die Kosten über die Umlage, danach werden die Kosten vom KV-System getragen.
Wer organisiert die 116 117?Die KBV übernimmt die technische Umsetzung der bundesweit einheitlichen Bereitschaftsdienstnummer: Sie organisiert die Weitervermittlung der Anrufer, welche die 116 117 wählen, bis diese den jeweils zuständigen Bereitschaftsdienst vor Ort errei-chen. Ab dem Punkt sind die KVen zuständig.
Wie erfährt die 116 117, unter welcher Rufnummer ich erreich-bar bin – und kann ich weiterhin den Dienst tauschen?Die Bereitschaftsdienstplanung inklusive Diensttausch und Ruf-nummernverwaltung wird in der Regel bereits heute durch die KVen geleitet. Die KV pflegt diese Information in eine bundes-weite Datenbank ein, auf die die 116 117 zugreift. Die Daten müssen stets aktuell sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Anrufer auch mit der Praxis verbunden wird, die Bereitschaftsdienst hat. Für die wenigen Bezirke, in denen bis-her keine Dienstinformation an die KVen geleitet wird, wurde seitens der 116 117 ein System implementiert, mit dem sich Ärzte auch direkt bei der 116 117 anmelden können. Rege-lungen zum Diensttausch sind weiterhin KV-intern festgelegt und bleiben in gewohnter Form bestehen.
Wer ist mein Ansprechpartner für die 116 117?Die bundesweit einheitliche Bereitschaftsdienstnummer funk-tioniert als Weiterleitung der Anrufer an den zuständigen ärzt-lichen Bereitschaftsdienst in der jeweiligen KV-Region. Auch zukünftig ist somit die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung der Ansprechpartner für Bereitschaftsdienst-Ärzte. Die bishe-rigen Ansprechpartner bleiben also bestehen. Anrufer der 116 117, die nicht automatisch an den lokalen ärztlichen Bereitschaftsdienst weitergeleitet werden können, gelangen erst in das zentrale 116 117-Service-Center. Wird dort bereits eine Vor-Diagnose erstellt?Nein, die 116 117 stellt lediglich die Weitervermittlung der Anrufer an den jeweiligen Bereitschaftsdienst vor Ort sicher. Sollte trotzdem ein Anrufer bereits dort seine Beschwerden schildern, können die Mitarbeiter des Service-centers reagie-ren: Der Großteil von ihnen ist medizinisch geschult und kann beispielsweise medizinische Notfälle sicher erkennen und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.
Werde ich durch die neue Nummer mehr Bereitschaftsdienste übernehmen müssen?Nein, die Einführung der neuen Nummer hat keine Auswir-kungen auf die Strukturen des Bereitschaftsdienstes und wird somit auch keinen Anstieg der Dienste bewirken.
QUELLE: KASSENÄRZTLIcHE BUNDESVEREINIGUNG (KBV)
Eine für alleFragen und Antworten zur 116 117
TITELThEma
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 20128
Die Nacht war kalt und der Frost hat Land-schaft und Häuser mit weißem Raureif überzogen. Die Windschutzscheiben des schwarzen Mazda von Dr. Ralf-Günter Wegers sind trotzdem eisfrei. Der Wagen,
mit dem er nun zu seinem Dienst auf-bricht, stand nachts gut geschützt im carport,
der zum kleinen Einfamilienhaus des Arztes am Schleswiger Stadtrand gehört. Wegers Frau winkt noch kurz zum Abschied und los geht die Fahrt in den Sonntagsdienst. Das Wetter ist für einen Arzt im Bereitschaftsdienst, der bei Wind und Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit über die Dörfer fahren muss, immer ein wichtiges Thema. In den beiden letz-ten Jahren machte der Schnee Wegers und seinen Kollegen oft schwer zu schaffen. An einem besonders extremen Tag, es war der 2. Weihnachtstag, fuhr er sich „irgendwo zwischen Jübek und Schuby“ auf einem abseits gelegenen Feldweg fest. Zum Glück kam zufällig ein Bauer mit seinem Trecker vorbei und zog das Arzt-Auto aus dem tiefen Schnee. Der Landwirt verzichtete sogar auf die ansonsten fälligen 20 Euro „Abschleppprämie“. „Für Sie ist das heute mal umsonst, Herr Doktor, weil Weih-nachten ist, war sein knapper Kommentar“, berichtet Wegers.
Immer wieder sonntags ...Dr. Ralf-Günter Wegers leistet seit vielen Jahren ärztlichen Bereitschaftsdienst, meistens am Sonntag. Wir haben den Allgemeinarzt einen Tag lang während seines Fahrenden Dienstes begleitet, der ihn kreuz und quer über die Landstraßen des Notdienstbezirks Schleswig führte.
SchleswigDie tiefstehende Sonne blen-
det während der Fahrt und Wegers lenkt seinen Mazda vorsich-
tig durch die noch menschenleere Schles-wiger Innenstadt. Nur einige Rentner mit
ihren Hunden sind schon unterwegs. Hinter den Fenstern sieht man schemenhaft die ersten Familien beim Frühstück. Wegers hatte sich um acht Uhr pünktlich bei der Leitstelle in Bad Segeberg angemeldet. Er ist nun bis acht Uhr am Mon-tag im Dienst. Bisher blieb sein Handy stumm. „Das wird aber sicher nicht so bleiben. Vielleicht ist wenigstens die Nacht ruhig“, hofft der Allgemeinmediziner. Der 49-Jährige übernimmt fast jeden zweiten Sonntagsdienst im Monat, sodass er im Jahr auf 25 bis 30 Dienste kommt.
Vor dem Eingang des ScHLEI-Klinikums MLK stehen frierend die ersten Raucher des Mor-gens. Drinnen ist nicht viel los. Nur wenige
Patienten schlurfen müde über die Flure. Wegers nimmt am Empfang die schwarze Not-
dienstasche entgegen, die sein Vorgänger dort für ihn hinterlegt hat und schaut kurz bei der diensthabenden Kollegin in der KVSH-Anlaufpraxis vorbei. Hier ist zwar seit neun Uhr geöffnet, Patienten waren aber bisher noch nicht da. Schleswig ist klein, die Kollegenschaft überschaubar. Man kennt sich und Wegers, der auch Notdienstbeauftragter im Bezirk ist, kommt ins Erzählen. Probleme, die Dienste untereinander auf-zuteilen, gibt es bisher noch nicht, zumal viele externe Poo-lärzte wegen der vergleichsweise guten Bezahlung auch die ungünstigsten Dienste gerne übernehmen. Wegers fällt aber auf, dass sich kreisweit nur zwei Frauen am fahrenden Dienst
START
Ä R Z T L I c H E R B E R E I T S c H A F T S D I E N S T
TITELThEma
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 9
Wegers parkt direkt in der kleinen Straße vor dem kleinen Reihenhaus aus den fünfziger Jahren. Er kennt die Gegend hier, denn nicht unweit liegt seine Praxis, die er zusammen mit einem Kollegen betreibt. Die Stra-ßennamen im ganzen Viertel klingen nach Pommern, Ostpreußen oder Schlesien. Hinter der Gardine bewegt
sich etwas. Der Arzt wird also bereits erwartet. Ein 69-jähriger Mann hat sich
eine Hüftprellung zugezogen. Also ein ver-gleichsweise rasch erledigter Fall. Nun schnell die nächste Adresse, die ihm von der Leitstelle durchgegeben wurde, in das Navi eingetippt: Wanderuper Straße in Jerrishoe. Die Fahrt Richtung Geest kann also weitergehen.
Jerrishoe
beteiligen. „Viele Frauen fahren nicht gerne nachts und die Einsatzzeiten sind ja auch alles andere als familienfreund-lich. Das kann in der Zukunft sicher zu einem Problem bei der Besetzung der Dienste werden, denn wir haben auch hier im Bezirk immer mehr Kolleginnen“, erklärt Wegers. Momentan laufe aber alles reibungslos und man könne fast immer auf individuelle Wünsche eingehen. Vor der Umstellung auf eine einheitliche Bereitschaftsdienstnummer sei der Notdienst dagegen oft eine Qual gewesen. „Da hat sich wirklich keiner drum gerissen. Man musste ja auch alle eingehenden Anrufe selbst koordinieren und sich dabei oft genug quasi zerreißen. Nun übernimmt Gott sei Dank die Leitstelle diese Aufgabe und ich fahre wirklich nur noch dorthin, wo ich wirklich gebraucht werde“, erklärt der dreifache Familienvater, der eigentlich aus Nordrhein-Westfalen stammt und während seiner Bun-deswehrzeit im Norden hängen blieb.
Plötzlich meldet sich das Dienst-handy mit unnachgiebigem Klin-
gelton. Es ist die Leitstelle. Wegers hört aufmerksam zu und macht sich schnell erste
Notizen: Name des Patienten, Adresse, erste Infor-mationen zum Krankheitsbild. „Nun müssen wir aber schnell los“, sagt er und schildert hinterm Steuer den ersten Fall des Tages. Eine Pflegerin rief in der Leitstelle an. Im „Pflegeheim zur Öhr“ in Schleswig muss eine hundertjährige, akut ver-wirrte alte Frau untersucht und behandelt werden. Wegers ahnt die besondere Problematik, als er seinen Wagen vor dem von der Kommune betriebenem Pflegeheim parkt.
Oft sind bei akuten Notfällen im Heim die Betreuungsverhältnisse unklar und der Arzt sitzt schnell zwischen den
Stühlen, egal wie er entscheidet. Auf der Station wird Wegers schon von zwei Pfle-
gerinnen erwartet. In ihrem Büro hängt ein Zettel, auf dem man die Geburtstage der Heim-
bewohner und ihr Lieblingsessen nachlesen kann. Die meisten alten Leute mögen Roulade mit Rotkohl am liebsten. Die Türen zu den Zimmern sind fast alle geschlossen. Aus einem Raum dringt Volksmusik nach draußen. Nur eine Zimmertür ist geöff-net. Eine alte Frau sitzt dort regungslos an einem ungedeckten Plastiktisch und blickt hinaus auf den Flur. Besuch ist nirgends zu sehen. Vielleicht ist das Wetter heute zu gut. über dem Bett stehen einige schön gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos. Sie zeigen eine junge Frau an der Seite eines Mannes im Sonntagsanzug. Wegers bespricht sich kurz mit den Pflegerinnen und beginnt dann mit der Untersuchung. Viel ausrichten kann er heute nicht. Er will abwarten, gibt der Patientin erst einmal ein Beruhi-
gungsmittel und informiert ihren Sohn über die weiteren Modalitäten. Er rät ihm in Zukunft die Betreuung für seine Mut-ter zu übernehmen. Inzwischen hat sich schon wieder die Leit-stelle gemeldet: Zwei neue Fälle, deren Details sich Wegers schnell notiert. Ein Fall in Schleswig, also direkt um die Ecke, einer weit draußen auf dem flachen Land.
TITELThEma
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201210
Wegers Bereitschaftsdienst ist been-det. Er ist schon wieder in seiner Praxis in der Memeler Straße und empfängt die ersten Patienten. Eine
ganz normale Arbeitswo-che nimmt ihren Anfang, aber der nächste Sonntag kommt bestimmt.
Fahrdorf
Der letzte Einsatz des Tages führt den Allgemeinmediziner spät in der Nacht in das Pflegeheim Danewerk. Eine Patientin klagt über unklare starke Schmerzen in
der rechten Hüfte, die trotz Morphingabe nicht aufhören wollten. Die Patientin war zudem erst vor kurzem an der Hüfte operiert worden. Wegers überweist sie deshalb noch in der Nacht ins Krankenhaus. Danach kann er sich schlafen legen. Die Leitstelle meldet sich nicht mehr.
Die nächste Fahrt führt entlang der Schlei nach Fahrdorf ins dor-tige DRK-Pflegeheim. Spaziergän-ger wandern rechts und links von
der Landstraße Richtung Haithabu und Noor; Ausflugstimmung überall.
In der Ferne kann man den Schleswiger Dom in der Nachmittagssonne funkeln sehen. Im DRK-Pflegeheim liegt ein Patient mit einem eitrigen Harn-wegsinfekt im Bett. Deshalb haben die Pflegerinnen den Bereitschaftsdienst angerufen. Wegers kennt sich aus, da er hier selbst mehrere Heimpatienten hausärztlich betreut und führt die nötige Behandlung des Kranken durch.
Havetoftloit
Die Landschaft wird wieder hügeliger und abwechslungsreicher. Die Fahrt führt über schmale Feldwege in das aufgeräumt wirkende kleine Neubaugebiet des Ört-
chens Havetoftloit zu einem großen Einfa-milienhaus mit gut gestutzter Lebensbaum-
hecke und frisch gestrichenem weißen Zaun. Vor dem Wendehammer am Ende der Straße liegen ein Kinder-fahrrad und eine kleine Schubkarre. Die Eltern des kleinen Jungen sind hocherfreut, den Arzt zu sehen. Der acht Jahre alte Junge klagt über akute Schmerzen in der Leiste. Wegers löst nach der entsprechenden Untersuchung mit wenigen Handgriffen die Blockade des kleinen Patienten, dem es schon nach kurzer Zeit wieder besser geht.
JAKOB WILDER, KVSH
Draußen jagt die immer flacher werdende Landschaft vorbei: Wiesen, noch weiß vom nächt-
lichen Raureif, winterlich kahle Waldstücke und abseits gelegene Gehöfte, beschienen von der gleißenden Winter-
sonne. „Natürlich muss man Lust aufs Autofahren haben und sich hier auf dem Land orientieren können“, sagt Wegers und beschleunigt auf
einer langen Geraden. Im überwiegend ländlich strukturierten Notdienstbezirk kommen schnell viele Kilometer zusammen. Viele Schleichwege kennt er von seinen privaten Touren auf dem Rennrad. „Pro Patient muss ich eine Stunde einplanen“, weiß Wegers aus Erfahrung. Fast wäre er am Haus des nächsten Patienten vorbei gefahren. Das Rentnerehepaar ist froh, dass er so schnell gekommen ist, um die Gürtelrose des Ehemannes zu behandeln. Die Tasse Kaffee und den Plausch nach der Behandlung lehnt Wegers nicht ab. Das gehört einfach dazu. Kaum wieder beim Auto angekommen, erreicht ihn der nächste Anruf der Leitstelle: Es geht wieder zurück Richtung Osten. Ein achtjähriger Junge klagt über Leistenschmerzen. Die Eltern machen sich Sorgen.
Ä R Z T L I c H E R B E R E I T S c H A F T S D I E N S T
TITELThEma
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 11
Was ist eigentlich so gut am ärztlichen Bereitschaftsdienst?
... und an welchen Stellen gibt es noch Verbesserungsbedarf?
Für Ärzte:In den letzten Jahren der alten Notdienststruktur in Schleswig-Holstein verkam der „Notdienst“ oftmals zu einer Art auf Wochenenden und Feiertage ausgelagerten Sprechstunde. Die originäre Funktion des Notdienstes (= Behandlungen, deren Aufschub bis zum nächsten Werktag nicht möglich ist) wurde von etlichen Patienten dahingehend pervertiert, von check-up-Forderungen bis hin zum „Zweitmeinungsverfahren“ wirklich alles, alles, alles an den Notdienstarzt heranzutragen. Solcher-art Begehrlichkeiten sind heute weitestgehend aus dem Not-dienst verschwunden.
Darüber hinaus gestattet es die heutige Organisation des Not-dienstes, nicht mehr jeden Arzt zur Dienstteilnahme heran-
ziehen zu müssen. Viele altgediente FachkollegenInnen sind zwar in ihrem Spezialgebiet echte Profis z. B. als Orthopäden, Gynäkologen oder Neurologen, haben aber den letzten Herz-infarkt oder eine Mittelohrentzündung beim Säugling zuletzt im Studium oder in der Assistenzarztzeit gesehen, geschweige denn nach aktuellen Qualitätskriterien behandelt. Insofern arbeiten heute im Notdienst die KollegenInnen, die dem – wie heißt es so schön? – „unselektierten Patientengut im Notdienst“ sicherlich durch ihre alltägliche Arbeit vollauf gewachsen sind.
Für Patienten:Die klassische (und manchmal auch bange) Frage eines erkrank-ten Patienten vor dem Wochenende war früher: „Wissen Sie, wer Notdienst hat?“ Heute kennt mittlerweile jeder Schleswig-Holsteiner die Anlaufpraxis in seiner Region und die Telefon-nummer 01805-11 92 92, um einen Hausbesuch oder eine Tele-fonberatung anzufordern. Dies gibt den Patienten Sicherheit.
Für das gesundheitswesen:Der Notdienst ist zu einer kalkulierbaren, verlässlichen Größe geworden. Dies gilt nicht nur für die den Dienst versehenden Kollegen, sondern auch für die Ärzte, die nicht am Notdienst teilnehmen möchten; dies gilt gleichermaßen für unsere Pati-enten wie auch für andere Organisationen des Gesundheitssy-stems wie Rettungsdienst, Krankenhäuser, Altenpflegeheime und ambulante Pflegedienste.
Außerdem ist ein großer Hemmnisfaktor für die Niederlassung junger Kollegen beseitigt worden, war doch gerade in länd-lichen Regionen die Arbeitsbelastung durch Notdienste oftmals enorm hoch.
DR. REIMAR VOGT, ALLGEMEINARZT, PAHLEN
Die Notdienststruktur hat sich ohne Zweifel bewährt und vieles ist im Laufe der Zeit besser geworden. Gerade in den ländlichen Regionen ist er zudem ein wichtiges Argu-ment, um Nachwuchs für die Praxen gewinnen zu können. Um den Dienst zukunfts-sicher zu machen, bedarf es meiner Ansicht einiger Anpassungen. Zu überdenken ist die jetzige Honorarstruktur und auch die Höhe des Honorars. Dies auch im Hinblick auf die zu erwartenden Engpässe bei der Besetzung der Dienste. Bereits jetzt gibt es in einigen Bereichen Schwierigkeiten bei der Feiertagsbesetzung. Wenn, wie es sich abzeichnet, vermehrt Praxen von Kollegen besetzt werden, die in Teilzeit tätig sind und zudem in größerer Entfernung zur Praxis (auch in Hamburg) wohnen, kann die Sicherung des Dienstes problematisch werden. Hier gilt es, rechtzeitig Lösungen zu schaffen, die es ermöglichen, dass auch weiterhin keiner zur Dienstteilnahme gezwungen wird.
DR. AxEL KLOETZING, ALLGEMEINARZT, HORST
sTaTEmEnT
sTaTEmEnT
nachrIchTEn KompaKT
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201212
E R N E N N U N G
Berufung von Vertragsärzten bzw. Psychotherapeutenals ehrenamtliche Richter der Sozialgerichtsbarkeit
Kiel – Die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landessozi-algerichts hat folgende Vertragsärzte mit Wirkung vom 1. Januar 2012 für die Dauer von 5 Jah ren zu ehrenamtli chen Richtern in Angele genheiten des Vertragsarz trechtes er nannt bzw. wie der ernannt:
am sozialgericht Kiel
Für die Dauer von 5 Jahren:
Dr. med. Ina Boeckel
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, 25541 Brunsbüttel
Dr. med. christiane schwerk
Fachärztin für Frauenheilkunde, 24103 Kiel
wieder ernannt wurden
am schleswig-Holsteinischen LandessozialgerichtFür die Dauer von 5 Jahren:
Dr. med. Otto Hauschild
Facharzt für Allgemeinmedizin, 24111 Kiel
Barbara Homann
Fachärztin für Allgemeinmedizin, 22889 Tangstedt
KLAUS-HENNING STERZIK, JUSTITIAR, KVSH
M E D I Z I N S T U D I U M
Änderung der Approbationsordnung
Berlin – Im Zentrum der vom Bundesgesundheitsministerium geplanten Neustrukturierung, die vom Bundeskabinett bereits gebilligt wurde, steht das Prak-tische Jahr (PJ). Das umstrittene „Hammerexamen“ soll künftig erleichtert werden, sodass sich die Studenten künftig voll auf das PJ konzentrieren können. Der schriftliche Teil des zweiten Abschnitts der ärztlichen Prü-fung soll dazu vor das PJ verlegt
werden. Statt bisher 20 sollen die angehenden Ärzte im PJ künf-tig bis zu 30 Fehltage (durch Krankheit oder Schwangerschaft) anrechnen lassen können. Darüber hinaus kann das PJ ab dem 1. Oktober 2013 auch in Teilzeit geleistet werden. Die Ausbil-dungszeit verlängert sich dann entsprechend. Das PJ soll zudem auch außerhalb der Lehrkrankenhäuser der Heimatuniversi-tät absolviert werden können, sofern die Kliniken die entspre-chenden Voraussetzungen erfüllen.
Mit der Änderung der Approbationsordnung will die Regierung außerdem die Allgemeinmedizin fördern. Dazu soll die Dauer des Blockpraktikums Allgemeinmedizin von einer auf mindestens zwei Wochen verlängert werden. Außerdem müssen die Univer-sitäten für das PJ-Wahlfach ab Oktober 2013 mindestens zehn Prozent und ab Oktober 2019 mindestens 20 Prozent aller Plätze für die Allgemeinmedizin reservieren. Die Neuregelungen sollen ab Frühjahr 2013 in Kraft treten. Der Bundesrat muss den Plänen allerdings noch zustimmen.
V E R S O R G U N G S S T R U K T U R G E S E T Z
Strengere Vorschriften für klamme KrankenkassenBerlin – Für finanziell angeschlagene Krankenkassen gibt es ab sofort strengere Vorschriften zugunsten ihrer Mitglieder. Bei einer drohenden Insolvenz müssen Kassen ihre Kunden künftig acht Wochen vor der Schließung informieren. Außerdem sind Kassen in Finanznot künftig verpflichtet, Mitglieder beim Wechsel zu einer anderen Kasse zu unterstützen. Dazu müssen sie eine Liste aller Krankenkassen vorlegen, unter denen die Mitglieder wäh-len können, erläutert das Bundesgesundheitsministerium. „Mit diesem Formular können Mitglieder einfach den Kassenwechsel vollziehen, ohne selbst eine Geschäftsstelle aufzusuchen“, heißt es. Andere Kassen sind wiederum verpflichtet, diese Kunden auf-zunehmen – Krankheit, Alter oder geringes Einkommen dürfen kein Ausschlusskriterium sein. Geregelt sind die Neuerungen im Versorgungsstrukturgesetz, das mit dem Jahreswechsel in Kraft getreten ist.
H A U T K R E B S S c R E E N I N G
Vertrag mit der HEK Bad segeberg – Die KVSH und die Hanseatische Krankenkasse (HEK) haben zum 1. Januar 2012 einen Vertrag über die Durch-führung eines ergänzenden Hautkrebsvorsorge-Verfahrens gemäß Paragraf 73c SGB V abgeschlossen. Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten, die von der KVSH eine Genehmi-gung zur Teilnahme am Vertrag erhalten haben, können die Vor-sorgeleistung alle zwei Jahre an Versicherten ab Vollendung des 18. Lebensjahres bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres unter der Pseudoziffer 99472A abrechnen. Die Vergütung der Leistung beträgt 22 Euro. In ihr enthalten sind die Information des Versi-cherten, eine Anamnese, körperliche Untersuchung, erstmalige Hauttypbestimmung sowie die vollständige Dokumentation der Leistung in der Patientenakte. Die Erbringung der Auflichtmikro-skopie gehört hingegen nicht zu den Vergütungsbestandteilen.
Sämtliche Vertragsunterlagen sowie den Teilnahmeantrag finden Sie unter:www.kvsh.de/Praxis/verträge/Hautkrebsscreening.
nachrIchTEn KompaKT
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 13
A M B U L A N T E S O P E R I E R E N
Neue Qualitätssicherungs- vereinbarungBad segeberg – Zum 1. Dezember 2011 ist oben genannte Vereinbarung in Kraft getreten. Die Vertragspartner haben Wert darauf gelegt, dass sich durch die neue Qualitätssicherungs- vereinbarung für alle Vertragsärzte, die bislang ambulante Operationen erbringen, nichts gegenüber dem schon bislang praktizierten Verfahren ändert.
Berechtigungen zur Durchführung und Abrechnung von Eingrif-fen nach Paragraf 115b SGB V entsprechend den Vorgaben der dreiseitigen Qualitätssicherungsvereinbarung nach Paragraf 115b SGB V vom 1. Oktober 2006 gelten als Genehmigungen im Sinne der neuen zweiseitigen Vereinbarung fort. Das bedeutet, dass alle Ärzte, die im Besitz einer Berechtigung zur Durchfüh-rung und Abrechnung ambulanter Operationen nach Paragraf 115b SGB V sind, keinen neuen Antrag zur Teilnahme an der neuen Vereinbarung stellen müssen.
Die Veröffentlichung der neuen Qualitätssicherungsvereinbarung erfolgte im Deutschen Ärzteblatt Heft 49 am 9. Dezember 2011.
H O N O R A R V E R E I N B A R U N G 2 0 1 1 / 2 0 1 2
Im Zeichen des Versorgungsstrukturgesetzes
Bad segeberg – Mit der Anwendung des Versorgungsstrukturge-setzes ab dem 1. Januar 2012 werden alle Leistungen außerhalb der MGV wieder unbegrenzt extrabudgetär vergütet. Damit wer-den die in 2011 gemäß GKV-Finanzierungsgesetz (FinG) begrenz-ten Leistungen (AOP, Belegärztliche Leistungen, Heimbesuche, neurologische Begleitleistungen) ab sofort wieder ohne Men-genbegrenzung vollumfänglich gezahlt.
Zudem wird die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) für das Jahr 2012 um 1,25 Prozent angehoben.
Die Ergänzungsvereinbarung für das 1. Quartal 2012 finden Sie auf der Homepage der KVSH unter www.kvsh.de im Download-bereich Verträge. Bei Bedarf senden wir Ihnen die Honorarver-einbarung in Papierform zu.
F A c H T A G U N G
Gesundheitsstandort Schleswig-Holstein auf dem Prüfstand
Kiel – Das Fritz Beske Institut für Gesundheits-System-Forschung lädt zur Fachtagung Gesundheit und Pflege in Schleswig-Holstein ein. In einem bundesweit einmaligen Projekt hatten Prof. Fritz Beske und Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg 19 Organisati-onen von Heilberufen bis hin zu Patientenverbänden gewinnen können, in einem Beirat gemeinsam die Versorgungssituation in Schleswig-Holstein zu analysieren, Defizite zu identifizieren und Vorschläge zur Versorgungssicherung zu erarbeiten. Diese Hand-lungsempfehlungen sollen nun auf der Fachtagung der Öffent-lichkeit vorgestellt und zur Diskussion gestellt werden. Die Ver-anstaltung ist öffentlich und findet am 3. März 2012 von 10 bis 14.30 Uhr in der Halle 400 in Kiel statt.
K R A N K E N K A S S E N
vdek-Landeschef Dietmar Katzer verabschiedet sich
Kiel – Der langjährige Leiter der vdek-Landesvertretung Schleswig-Holstein, Dietmar Katzer, ist zum Jahreswechsel aus seiner hauptamtlichen Tätigkeit beim Ersatzkassenverband aus-geschieden. Nach mehr als 40 Jahren im Berufsleben wurde er im Rahmen einer gesundheitspolitischen Veranstaltung zur Zukunft des deutschen Sozialversicherungssystems feierlich ver-abschiedet. Der gebürtige Sachse übernahm im Januar 2002 die Leitung der Landesvertretung des damaligen vdak/AEV in Schles-wig-Holstein. Dietmar Katzer bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben im Gesundheitswesen aktiv: Er bleibt der Selbstverwaltung der Gesetzlichen Krankenversicherung als Mit-glied im Verwaltungsrat der BARMER GEK und als Mitglied im Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes erhalten. Außerdem ist er alternierender Verwaltungsratsvorsitzender des MDK Nord, Vorsitzender der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Schleswig-Holstein und Vorstandsmitglied im Patientenombuds-verein. Die Aufgaben Dietmar Katzers im Ersatzkassenverband übernimmt bis auf Weiteres Armin Tank, der stellvertretende Leiter der vdek-Landesvertretung.
Dietmar Katzer, Leiter der vdek-Landesvertretung Schleswig-Holstein
und Thomas Ballast, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der
Ersatzkassen (vdek)
Versorgungsstrukturgesetz2012
FOTO
: V
DEK
nachrIchTEn KompaKT
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201214
B E R U F S V E R B Ä N D E
Radiologen starten Informationsinitiative
Berlin – Radiologen genießen in Deutschland einen sehr guten Ruf, ihr Leistungsspektrum ist jedoch weitgehend unbekannt. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Deutsche Röntgen-gesellschaft e.V. gemeinsam mit den Fachgesellschaften für Nuklearmedizin und Strahlentherapie im vergangenen Herbst in Auftrag gegeben hatte. So zeigte die Befragung, dass nur 37 Prozent aller interviewten Bürger die Röntgenaufnahme als eine radiologische Leistung identifizierten. Schnittbildverfahren wie die computertomografie oder die Magnetresonanztomo-grafie, gängige Leistungen vieler radiologischer Einrichtungen, wurden nur zu 13 Prozent mit dem Radiologen in Verbindung gebracht.
Die Deutsche Röntgengesellschaft e. V. hat daher gemeinsam mit ihren Partnergesellschaften ein Informationsangebot ins Leben gerufen, das sich an Patienten und die interessierte Öffentlich-keit richtet. Unter www.medizin-mit-durchblick.de werden Untersuchungs- und Behandlungsverfahren von Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie vorgestellt und technische Hintergründe erklärt. Ein weiterer Schwerpunkt der Initiative ist die Aufklärungsarbeit in den Wartezimmern: Broschüren infor-mieren über die Arbeit des Radiologen und die verschiedenen Bildgebungsmethoden. Eine Plakatserie fasziniert für radiolo-gische Bildwelten und unterstreicht die diagnostische Kompe-tenz des Radiologen – etwa wenn es um die schnelle Diagnose eines Schlaganfalls oder einer Bluthochdruckerkrankung geht.
K N A P P S c H A F T
Neue Vereinbarung zum Hautkrebs-ScreeningBad segeberg – Die KVSH hat mit der Knappschaft eine neue Vereinbarung über die Durchführung eines Hautkrebs- Screenings geschlossen, da die bisherige bundesweite Rege-lung zum 31. Dezember 2011 entfällt. Ab Januar 2012 können Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten mit entspre-chender Fortbildung und Genehmigung bei Versicherten der Knappschaft (bis zur Vollendung des 35. Lebensjahr) alle zwei Jahre ein Hautkrebs-Screening als Vorsorgeuntersuchung durch-führen. Ab dem 35. Lebensjahr greift die EBM-Regelung. Die Leistung mit der Abrechnungsziffer 99473D wird außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung mit 25 Euro bezahlt. Die bisher gültige Abrechnungsziffer 01745K entfällt zum 31. Dezember 2011. Der Vertragstext steht unter www.kvsh.de als Download zur Verfügung.
K N A P P S c H A F T
Änderungen HausarztvertragBad segeberg – Zum 1. Januar 2012 ändert sich der Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung mit der Knappschaft. Die Nach-verhandlungen auf Bundesebene haben u. a. dazu geführt, dass der Vertrag nun unbefristet über das Jahr 2011 hinaus fortgeführt wird. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass meist ältere und chronisch kranke Versicherte in diesen HzV-Ver-trag eingeschrieben sind. Die Weiterentwicklung zielt deshalb darauf ab, diesen Versicherten eine bessere Versorgung zu bie-ten. Konkret wird die Grundpauschale bei einem Arzt-Patienten-Kontakt auf vier Euro pro Quartal abgesenkt, zusätzlich aber als erstes Modul ein Medikationscheck (80 Euro bzw. 160 Euro mit Konsil) eingeführt.
Weitere Versorgungs- und Vergütungsmodule werden in Zukunft folgen. Den geänderten Vertragstext als Lesefassung finden Sie auf www.kvsh.de im Downloadbereich Verträge.
P R I V A T R E c H N U N G E N
Patienten zahlen oft nicht
Hamburg – Jeder zweite niedergelassene Arzte hat regelmäßig Zahlungsausfälle, weil Patienten Privatleistungen nicht beglei-chen. Jeder dritte Arzt hat sogar Verluste im vierstelligen Euro-Bereich. Das ergab die Studie „Ärzte im Zukunftsmarkt Gesund-heit 2011“ die die Gesellschaft für Gesundheitsmarktanalyse im Auftrag der Stiftung Gesundheit durchgeführt hat. Laut der Befragung hat knapp die Hälfte der Ärzte Ausfälle bei ein bis fünf Prozent der ausgestellten Rechnungen. Etwa jeder zehnte Arzt ist von Zahlungseinbußen bei mehr als fünf Prozent der Rechnungen betroffen. 5,5 Prozent der Ärzte beklagen laut der Stiftung Gesundheit einen jährlichen Zahlungsausfall von über 5.000 Euro. Etwa ein Viertel verliert jährlich zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Rund die Hälfte der Ärzte beziffert ihre jährlichen Außenstände im Volumen unter 1.000 Euro.
nachrIchTEn KompaKT
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 15
P A T I E N T E N I N F O R M A T I O N E N
Thema: Kreuzschmerz
Berlin – Unter www.versorgungsleitlinien.de/patienten/kreuzschmerzinfo stehen neue Informationen für Patienten bereit: Die ausführliche PatientenLeitlinie „Kreuzschmerz“ und die beiden Kurzinformationen „Akuter Kreuzschmerz“ und „chro-nischer Kreuzschmerz“ vermitteln in verständlicher Form, was Kreuzschmerzen sind, wie sie entstehen können und wie sie behandelt werden.
Diese Beschwerden gehören in Deutschland zu den am häu-figsten angegebenen Schmerzen überhaupt. Etwa drei von vier Deutschen sagen, dass sie mindestens einmal in ihrem Leben Kreuzschmerzen gehabt haben. Bei der Behandlung von Kreuz-schmerzen hat sich in den letzten Jahren ein Wandel vollzogen. Statt passiver Therapieformen, wie Schonen oder Bettruhe, wird heute eher das Gegenteil empfohlen, zum Beispiel Bewegung. Für Ärzte ist es oft nicht leicht, dies den Patienten zu vermit-teln. Die neu erschienene PatientenLeitlinie „Kreuzschmerz“ will deshalb sowohl Betroffene informieren, als auch Ärzte bei der Aufklärung ihrer Patienten unterstützen.
V E R Z I c H T S E R K L Ä R U N G E N
Fristen und GebührenBad segeberg – Bevor Ärzte oder Psychotherapeuten ihre ver-tragsärztliche oder -psychotherapeutische Tätigkeit beenden, muss dem Zulassungsausschuss eine Verzichtserklärung über-sandt werden. Nach den gesetzlichen Regelungen (Paragraf 28 Abs. 1 Ärzte-ZV) wird dieser Verzicht auf die Zulassung mit dem Ende des auf den Zugang der Verzichtserklärung beim Zulas-sungsausschuss folgenden Kalendervierteljahres wirksam. So entfaltet z. B. eine am 9. April eines Jahres beim Zulassungsaus-schuss eingegangene Verzichtserklärung erst zum 30. September ihre Wirkung.
Diese Frist kann auf Antrag durch den Zulassungsausschuss ver-kürzt werden, wenn der Vertragsarzt oder Vertragspsychothe-rapeut nachweist, dass die weitere Ausübung der vertragsärzt-lichen oder -psychotherapeutischen Tätigkeit für die gesamte Dauer oder einen Teil der Frist unzumutbar ist.
Bitte beachten Sie: Der Antrag ist kostenpflichtig. Die in die-sem Zusammenhang vorgeschriebenen Gebühren in Höhe von 120 Euro werden nach der Beschlussfassung angefordert.
PATIENTENINFORMATION
AKTIV GEGEN CHRONISCHEN KREUZSCHMERZ
LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT,
Sie haben seit längerem Kreuzschmerzen. Solche Be-schwerden können Ihren Alltag erheblich einschrän-ken. Eine ernste körperliche Erkrankung steckt zumGlück jedoch nur selten dahinter, und Sie könnenselbst viel tun, um Ihr Wohlbefinden zu steigern. Hiererfahren Sie, was chronischer Kreuzschmerz bedeu-tet, wie er entsteht und wie er behandelt wird.
DER GESUNDE RÜCKEN
Die menschliche Wirbelsäule besteht aus 33 knöcher-nen Wirbeln und den dazwischen liegenden, gummi-artigen Bandscheiben, die als eine Art Stoßdämpferdienen. Bänder aus festem Bindegewebe und die Rü-ckenmuskulatur stabilisieren und unterstützen dieseSäule. Im Alltag muss sie enormen Belastungen stand-halten: Die Wirbelsäule bildet nicht nur die stabileAchse des Körpers und trägt das Gewicht von Kopf,Armen und Rumpf. Sie muss zudem auch elastischsein, um Bewegungen wie Bücken, Strecken oderDrehen zu ermöglichen. Andauernde Belastungen wiegebeugtes Sitzen oder Fehlhaltungen, mangelnde Be-wegung oder Übergewicht können ihr Gleichgewichtjedoch stören. Dann kann es zu Schmerzen kommen.
DIE ERKRANKUNG
Kreuzschmerz ist ein Schmerz im Rückenbereich unter-halb des Rippenbogens und oberhalb der Gesäßfal-ten. Nacken- und Schulterbereich gehören nicht dazu.Diese Information richtet sich an Menschen mit nicht-spezifischen, seit Monaten andauernden Kreuzschmer-zen. Nichtspezifisch bedeutet, dass sich den Schmerzenkeine eindeutigen körperlichen Veränderungen oderErkrankungen zuordnen lassen, etwa Entzündungen,Tumore oder Schäden an den Bandscheiben. Bei mindestens 85 von 100 Menschen mit Kreuz-schmerzen sind die Beschwerden nichtspezifisch. Beiungefähr jedem Zehnten davon werden diese Schmer-zen chronisch.
WENN KREUZSCHMERZ CHRONISCH WIRD
Mediziner sprechen von chronischem Kreuzschmerz,wenn die Beschwerden länger als zwölf Wochen an-dauern. In der Regel wirken verschiedene Faktorenmit, wenn Kreuzschmerzen chronisch werden. Oft rea-giert der Körper, wenn Folgendes zusammen kommt:
■ akuter Schmerz
■ falsches Schonungsverhalten und
■ Probleme in Beruf und Familie
Gefährdet sind auch Menschen, die nicht auf Warn-signale ihres Körpers hören und sich oft überlasten.
DIE UNTERSUCHUNG
Die Basis für jede Untersuchung bildet Ihre Kranken-geschichte, die Ihr Arzt im Rahmen eines Gesprächeserhebt. Dabei möchte er möglichst viel über den Cha-rakter Ihres Kreuzschmerzes erfahren. Es kann sein,dass er Ihnen dafür spezielle Fragebögen aushändigt.Wundern Sie sich nicht, wenn er Sie auf Ihre familiäreund berufliche Situation anspricht. Bei der Entstehungchronischer Schmerzen spielen solche Aspekte einewichtige Rolle. Hinzu kommen die körperliche Unter-suchung und in bestimmten Fällen bildgebende Ver-fahren, etwa eine Röntgenaufnahme.
DIE BEHANDLUNG
Im Vordergrund der Behandlung stehen Maßnahmen,die Sie aktivieren und zu einer gesunden Lebensweisemotivieren – ganz nach dem Motto „Wer rastet, derrostet“. Alles, was Sie in eine passive Rolle treibt, etwaBettruhe, ist für Ihre Genesung eher hinderlich. Medi-kamente, zum Beispiel Schmerzmittel, sollen es Ihnenermöglichen, Aktivitäten im Alltag so gut es geht bei-zubehalten. Eine alleinige oder dauerhafte Behand-lung mit Medikamenten ist aber nicht sinnvoll.
Chronischer Kreuzschmerz
Ein Service des
Dezember 2011
Foto: © Robert Kneschke - Fotolia.com
H A U S A R Z T V E R T R Ä G E
KV-SafeNet-Verpflichtung um ein Jahr aufgeschoben
Bad segeberg – Die KVSH, der Hausärzteverband Schleswig-Holstein sowie die Betriebskrankenkassen, vertreten durch die ARGE-HzV, und die LKK haben sich darauf geeinigt, die Verpflich-tung zur Verwendung von KV-SafeNet in den Hausarztzentrierten Versorgungsverträgen, die zum 1. Oktober 2011 abgeschlos-sen wurden, um ein Jahr aufzuschieben. Die Verwendung von KV-SafeNet ist damit erst ab dem 1. Januar 2013 eine verpflicht-ende Voraussetzung. Dies gilt rückwirkend zum 1. Oktober 2011 sowohl für die bereits teilnehmenden Ärzte als auch für teilnah-meinteressierte Ärzte.
PATIENTENINFORMATION
PLÖTZLICH KREUZSCHMERZ– WAS KANN ICH TUN?
LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT,Sie haben seit kurzem Kreuzschmerzen und wollen
wissen, woher die Beschwerden kommen, wie man
sie behandelt und was Sie selbst dagegen tun können.
Eine erste wichtige Information für Sie lautet: Sie sind
nicht allein. Kreuzschmerzen gehören in Deutschland
zu den häufigsten Schmerzen überhaupt. Etwa drei
von vier Deutschen geben an, mindestens einmal in
ihrem Leben solche Beschwerden gehabt zu haben. DER GESUNDE RÜCKENDie menschliche Wirbelsäule besteht aus 33 knöcher-
nen Wirbeln und den dazwischen liegenden, gummi-
artigen Bandscheiben, die als eine Art Stoßdämpfer
dienen. Bänder aus festem Bindegewebe und die Rü-
ckenmuskulatur stabilisieren und unterstützen diese
Säule. Im Alltag muss sie enormen Belastungen
standhalten: Die Wirbelsäule bildet nicht nur die stabile
Achse des Körpers und trägt das Gewicht von Kopf,
Armen und Rumpf. Sie muss zudem auch elastisch
sein, um Bewegungen wie Bücken, Strecken oder
Drehen zu ermöglichen. Andauernde Belastungen wie
gebeugtes Sitzen oder Fehlhaltungen, mangelnde Be-
wegung oder Übergewicht können ihr Gleichgewicht
jedoch stören. Dann kann es zu Schmerzen kommen.DIE ERKRANKUNG
Kreuzschmerz ist ein Schmerz im Rückenbereich unter-
halb des Rippenbogens und oberhalb der Gesäßfal-
ten. Nacken- und Schulterbereich gehören nicht dazu.
Diese Information richtet sich an Menschen mit akuten
nichtspezifischen Kreuzschmerzen. Akut bedeutet,
dass die Beschwerden weniger als sechs Wochen be-
stehen. Nichtspezifisch heißt, dass sich den Schmer-
zen keine eindeutigen körperlichen Veränderungen
oder Erkrankungen zuordnen lassen, etwa Entzün-
dungen, Tumore oder Schäden an den Bandscheiben.
Bei mindestens 85 von 100 Menschen mit Kreuz-
schmerzen sind die Beschwerden nichtspezifisch.
Die Schmerzen sind oft belastend, manchmal sogar
beunruhigend und schränken den Alltag der Betroffenen
häufig ein. In den meisten Fällen sind sie aber harmlos
und bilden sich innerhalb kurzer Zeit gut zurück. DIE UNTERSUCHUNGWegweisend ist das Gespräch zwischen Ihnen und
Ihrem Arzt, in dem dieser grundlegende Informationen
zu Ihrer Krankengeschichte erfährt. Ebenso wichtig ist
die körperliche Untersuchung. Beides zusammen
reicht oft aus, um schwerwiegende Ursachen der Be-
schwerden auszuschließen. Die körperliche Untersuchung richtet sich nach den Er-
gebnissen des Gespräches. Ihr Arzt achtet dabei zum
Beispiel auf Haltung und Form der Wirbelsäule und
tastet die Rückenmuskulatur nach schmerzhaften
Stellen ab. Danach prüft er die Beweglichkeit, Muskel-
kraft, Empfindsamkeit und die Reflexe der Beine.
Wenn sich durch das Patienten-Arzt-Gespräch und die
körperliche Untersuchung keine Hinweise für einen
gefährlichen Verlauf oder andere ernste krankhafte
Veränderungen ergeben, sollen zunächst keine weite-
ren Untersuchungen durchgeführt werden.DIE BEHANDLUNG Die Beschwerden bei akuten nichtspezifischen Kreuz-
schmerzen bessern sich in der Regel nach kurzer Zeit
von allein. Die meisten Menschen, die zum ersten Mal
mit Kreuzschmerzen zum Arzt gehen, benötigen daher
lediglich ein Schmerzmittel und eine Beratung.
Der kurzfristige Einsatz von Schmerzmitteln soll es
Ihnen ermöglichen, Ihre Aktivitäten im Alltag so gut es
geht beizubehalten. Bettruhe oder Schonung sind für
Ihre Genesung eher hinderlich.
Akuter Kreuzschmerz
Ein Service des
Dezember 2011
Quelle: Françoise Fine
Z U L A S S U N G
Rückumwandlung von Anstellungsverhältnissen
Bad segeberg – Lange hat die KVSH gefordert, dass die Anstel-lung eines Arztes für eine Probezeit möglich sein sollte, um die-sen Arzt sodann in eine Praxis als Partner aufnehmen zu können. Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich das Vorhandensein einer entsprechenden Arztstelle, jedoch kann seit dem 1. Januar 2012 tatsächlich aus einem Anstellungsverhältnis eine Zulassung werden. Voraussetzung hierfür sind ein Antrag des Arbeitge-bers (Vertragsarzt oder Medizinisches Versorgungszentrum) auf Umwandlung der Angestelltenstelle in eine Zulassung sowie ein Zulassungsantrag des angestellten Arztes.
alles Weitere erfahren sie über Ihre ansprechpartner in der abteilung zulassung/Praxisberatung:Tyneke Grommes Tel. 04551 883 (462), Nicole Geue (303), Petra Fitzner (384), Evelyn Kreker (346), Daniel Jacoby (259), Karsten Wilkening (561)
GEsundhEITspoLITIK
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201216
M E D I Z I N I S c H E R N A c H W U c H S I N S c H L E S W I G - H O L S T E I N
Bildet Schleswig-Holstein zu viele Ärzte aus? Eindeutig ja, sagt der Landesrechnungshof in seinem „Hochschulbericht 2011“, vorge-legt im Dezember, und fordert erneut eine Reduzierung der Medi-zinstudienplätze.
Mehr als 200 Abiturienten haben 2010 in Kiel ein Medizinstudium aufgenommen, die Universität zu Lübeck konnte im vergangenen Jahr gut 190 neue Studierende mit dem Berufsziel Arzt begrüßen. Das kann sich, so die Auffassung des Rechnungshofs, das finan-ziell notorisch klamme Schleswig-Holstein nicht leisten und erin-nert nicht nur an seine Empfehlungen aus den Vorjahren, sondern auch an die Zielvereinbarungen des Landes mit den Hochschulen. Dort haben beide Seiten vereinbart, die Zahl der Studienanfän-ger im Studiengang Humanmedizin in Kiel und Lübeck auf jeweils 170 abzusenken. Ein Ziel, das auch durch Landtagsbeschlüsse bestätigt wurde. Bereits von 2000 bis 2007 wurde die Zahl der Studienplätze für Erstsemester um über 20 Prozent gesenkt.
Ein besonderer Dorn im Auge sind den obersten Rechnungsprü-fern die Studienkapazitäten im klinischen Studienabschnitt (ab 5. Semester), die deutlich höher liegen. Der Wissenschaftsrat, ein von Bund und Ländern getragenes Beratungsgremium, nannte in einem Gutachten zur Hochschulmedizin in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr bis zu 250 Plätze für Studienanfänger im kli-nischen Studienabschnitt in Kiel und bis zu 230 in Lübeck.
Der Rechnungshof fordert eine Angleichung an die Aufnahme-kapazitäten im vorklinischen Studienabschnitt und befindet sich in dieser Frage im Einklang mit der Landtagsmehrheit. Das Par-lament hat vor rund einem Jahr die Empfehlung an die Universi-täten beschlossen, die klinische an die vorklinische Aufnahmeka-pazität anzupassen – und damit die Zahl der Medizinstudienplätze in Schleswig-Holstein zu senken.
eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten des LandesDass den Empfehlungen und Beschlüssen des Rechnungshofs, des Landtages und der Landesregierung zum Abbau von Studien-plätzen im klinischen Ausbildungsabschnitt keine Taten folgten, ist weniger dem fehlenden politischen Willen geschuldet als der Komplexität der Materie. Denn die Zahl der Medizinstudien-plätze lässt sich weder in der vorklinischen noch in der klinischen Studienphase beliebig erhöhen oder reduzieren. Vielmehr errech-net sich ihre Zahl aus einer Vielzahl von Faktoren, die in der soge-nannten Kapazitätsverordnung des Landes festgelegt sind. Diese zu ändern ist für Schleswig-Holstein im Alleingang kaum möglich, da sich die Länder in einem Staatsvertrag verpflichtet haben, die Berechnung nach einheitlichen Kriterien vorzunehmen. So ist die Zahl der Studienplätze im klinischen Studienabschnitt u.a. von der Zahl der Betten und Ärzte am UKSH abhängig. Ein Abbau von Studienplätzen in diesem Abschnitt wäre zwar z. B. über eine Reduzierung der Zahl der UKSH-Betten möglich. Es besteht ein politischer Konsens, dass dies nicht gewollt ist. So bleibt Schleswig-Holstein in dieser Frage also zunächst im Wesentlichen, alternative Berechnungsmethoden zu entwickeln und für diese bei den anderen Ländern zu werben.
Forderung nach studienplatzabbau lässt künftigen versorgungsbedarf außer achtGrundsätzlicher ist ohnehin die Frage, ob die Streichung von Medi-zinstudienplätzen, so attraktiv dies mit Blick auf die Haushaltsnöte des Landes auch erscheinen mag, das richtige Signal in einer Zeit sein kann, in der in Schleswig-Holstein in den ländlichen Regionen ein Ärztemangel droht – keineswegs nur in den Praxen, sondern auch in den Kliniken.
Die Argumentation des Rechungshofes, weshalb gerade bei der Hochschulmedizin den Rotstift anzusetzen, ist denkbar einfach. Schleswig-Holstein bilde „überproportional“ viele Mediziner aus.
Weniger Ärzte braucht das Land? Landesrechnungshof fordert erneut Reduzierung der Medizinstudienplätze.
GEsundhEITspoLITIK
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 17
Während an den beiden schleswig-holsteinischen Uni versitäten insgesamt 3,8 Prozent aller Medizinstudenten in Deutschland ein-geschrieben sind, so der Rechnungshof in seinen „Bemerkungen 2009“, beträgt der Anteil der schleswig-holsteinischen Bevölke-rung an der Gesamteinwohnerzahl Deutschlands lediglich 3,45 Prozent. Hier aus folgern die Rech nungsprüfer die Notwendigkeit eines weiteren Abbaus der Stu dienplätze.
Zweifelhaft ist aber, ob der Anteil der Bevölkerung zwischen Nord und Ostsee an der Gesamtbevölkerung Deutschlands ein geeig-neter Maßstab zur Bestimmung der Zahl der Medizinstudienplätze sein kann. Die Frage, wie viel Ärzte in Schleswig-Holstein und darüber hinaus benötigt werden, um die Versorgung einer älter werdenden Gesellschaft zu gewährleisten, spielt in den überle-gungen des Rechnungshofes keine Rolle.
Denkbare Größen zur Bestimmung der Zahl der Medizinstudien-plätze wären die Zahl der in den Ruhestand tretenden Ärzte und der künftige medizinische Versorgungsbedarf. Ein Vergleich der Bevölkerungszahlen der Bundesländer hilft auch deshalb wenig weiter, weil sich die Alterszusammensetzung der Bevölkerung in den Ländern sehr unterschiedlich entwickelt. Nach einer Prognose des Statistikamtes Nord werden im Jahr 2025 in Schleswig-Hol-stein 27 Prozent der Einwohner 65 Jahre und älter sein, im Stadt-staat Hamburg mit seiner anhaltenden Anziehungskraft auf jün-gere Menschen nur 20 Prozent. Auch die Tatsache, dass der Anteil der in Teilzeit arbeitende Ärzte steigt, muss bei der Betrachtung, wie viele Mediziner wir ausbilden müssen, berücksichtigt werden.
Trifft die steigende Nachfrage nach Medizinern, auch außerhalb klassischer ärztlicher Berufsfelder, auf eine weiterhin konstante oder – wie gefordert – rückläufige Zahl von Absolventen, wird sich das Problem eines sich abzeichnenden Ärztemangels kaum lösen lassen. Bedacht werden sollte zudem die Langzeitwirkung jeder heutigen Entscheidung. Aufgrund der langen Aus- und Wei-terbildungszeiten der Nachwuchsärzte macht sich ein Abbau von Studienplatzen erst in gut zehn Jahren in der Versorgung bemerk-bar. Fehlen dann Ärzte, ist ein kurzfristig wirksames Gegensteuern nicht möglich.
ausbildungskapazitäten in schleswig-Holstein über dem BundesdurchschnittDie Rhetorik in der schleswig-holsteinischen Debatte zur Hoch-schulmedizin erweckt gelegentlich den Eindruck, das Land würde im Vergleich zum Rest der Republik exorbitante Ausbildungslasten tragen. Richtig ist, dass Schleswig-Holstein mehr Mediziner aus-bildet als der Durchschnitt der Länder. Kommen deutschlandweit nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 98 Medizinstu-denten auf 100.000 Einwohner, sind es in Schleswig-Holstein 109. Richtig ist aber auch, dass Schleswig-Holstein keineswegs eine Spitzenposition einnimmt. So gibt es im ebenfalls strukturschwa-chen Mecklenburg-Vorpommern 172 Medizinstudienplätze je 100.000 Einwohner, gefolgt vom Saarland (162), Hamburg (161), Berlin (151), Sachsen-Anhalt (133), Hessen (125) und Baden-Württemberg (111). Unter dem Bundesdurchschnitt liegen unter anderem große Länder wie Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
Die Forderung, dass Schleswig-Holstein nicht über seinen eige-nen Bedarf hinaus Mediziner ausbilden sollte, könnte schnell zum Eigentor werden, wenn andere Bundesländer eine Gegen-rechnung aufmachen. Denn in der Gesamtbetrachtung ist Schles-
wig-Holstein ein „Exporteur“ von Studenten und verfügt über eine im Ländervergleich nur unterdurchschnittliche Zahl an Stu-dienplätzen. Zwischen Nord- und Ostsee leben 3,4 Prozent der Einwohner der Bundesrepublik, allerdings studieren derzeit nur 2,2, Prozent aller Studenten im hohen Norden. Im Jahr 2011 nah-men rund 10.000 junge Menschen ihr Studium an einer Hochschule in Schleswig-Holstein auf – ganze zwei Prozent aller Erstseme-ster in Deutschland. Und während in Hamburg, mit 1,8 Millionen Einwohnern deutlich kleiner als Schleswig-Holstein, 88.000 Stu-denten an Fachhochschulen und Universitäten eingeschrieben sind, sind es in Schleswig-Holstein (2,8 Millionen Einwohner) nur 55.000. Zu kleinstaatlich sollte also gerade Schleswig-Holstein in dieser Frage nicht argumentieren.
angehende Ärzte möchten nicht nur als Kostenverursacher wahrgenommen werdenDie Diskussion über die Kosten der Hochschulmedizin in Schleswig-Holstein hält – nimmt man den 2003 vorgelegten Abschlussbericht der „Erichsen-Kommission“ zur Entwicklung der Hochschulen im Land als Ausgangspunkt – seit bald einem Jahr-zehnt an. Immer wieder wurden die medizinischen Fakultäten auf-grund ihrer hohen Kos ten in Frage gestellt, vor knapp zwei Jahren drohte gar die Schließung der Medizinerausbildung in Lübeck. Das bleibt nicht ohne Wirkung auf die Studenten, die den Widerspruch durchaus registrieren, dass sie einerseits umworben werden, weil immer mehr Stellen in Kliniken und Praxen unbesetzt blei-ben, anderseits aber ihre Ausbildung in der haushaltspolitischen Diskussion stets als eine finanzielle Belastung erscheint, die das Land überfordert. Dass dies die Neigung, nach dem Studium die Karriere in Schleswig-Holstein fortzusetzen, nicht erhöht, kann hören, wer mit Studenten spricht.
Medizinstudenten mit hoher erfolgsquoteFür Schleswig-Holstein ergeben sich aus den vorhandenen Aus-bildungskapazitäten durchaus Vorteile. Denn mit den beiden Medizinstudiengängen in Kiel und Lübeck gelingt es dem Stu-denten-Exportland Schleswig-Holstein, junge Akademiker nach Schleswig-Holstein zu holen. Fast 75 Prozent der Studienanfän-ger kommen aus anderen Bundesländern. Und viele von ihnen, das legt eine im April 2011 veröffentliche Absolventenbefragung der Universität zu Lübeck nahe, bleiben nach Abschluss der Hoch-schulausbildung zunächst im Norden. Rund die Hälfte der berufs-tätigen Absolventen aus den Jahren 2008/2009 waren zum Zeit-punkt der Befragung durch ihre Alma Mater in Schleswig-Holstein beschäftigt (im Vergleich zur Absolventenbefragung 2008 eine Steigerung von 13 Prozentpunkten), ganz überwiegend als Assi-stenzärzte. Für Schleswig-Holstein, das im Ländervergleich den geringsten Anteil von Akademikern an allen Beschäftigten auf-weist, durchaus ein positiver Effekt.
Dass die Ausgaben für die Ausbildung angehender Ärzte gut inves-tiertes Geld sind, zeigt zudem die hohe Erfolgsquote der Medizi-ner. Während insgesamt mehr als die Hälfte aller Studenten an den Universitäten des Landes sein Studium abbricht – und so ein erheblicher Teil der in die Hochschulausbildung dieser Studieren-den investierten Mittel verloren sind –, ist die Erfolgsbilanz der angehenden Ärzte beeindruckend: Im Studiengang Medizin an der Universität zu Lübeck schließen beachtliche 98 Prozent ihr Stu-dium erfolgreich ab.
DELF KRÖGER, KVSH
GEsundhEITspoLITIK
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201218
K O N G R E S S V E R N E T Z T E G E S U N D H E I T
Woher sollen in Zukunft die Ärzte kommen? Bietet das Versor-gungsstrukturgesetz geeignete Voraussetzungen, dass dieses Pro-blem in Zukunft gelöst werden kann? Und vor allem, wer soll das bezahlen? Diese Fragen waren beim Kongress „Vernetzte Gesund-heit“, zu dem über 500 Teilnehmer und rund 50 Referenten aus dem gesamten Bundesgebiet in die Halle 400 nach Kiel gekom-men waren, allgegenwärtig. Der Bundesgesundheitsminister will verstärkt auf kommunale Initiativen setzen. „Die Gemeinden erhalten jetzt z. B. die Möglichkeit, Arztpraxen auch in Eigen- regie zu betreiben. Der Kreativität und den Kooperationswillen der Gemeinden in einer Region sind keine Grenzen mehr auferlegt, wenn es darum geht, junge Mediziner an sich zu binden“, erklärte Daniel Bahr. Auch die Bundesländer müssten sich in Zukunft auf einen härteren Wettbewerb einstellen. Dieser Wettbewerb um den Ärztenachwuchs sei der richtige Weg, auch um den Medi-zinernachwuchs für eine Tätigkeit auf dem Land zu gewinnen. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg sah das etwas anders. Er befürchtet ein finanzielles Buhlen der Bundes-länder um die Ärzte. „Ich sehe mit Sorge, dass Bundesländer wie Baden-Württemberg vor Landtagswahlen einen Sack Geld hinstel-len, um junge Mediziner aufs Land zu locken“, so Garg. Er könne einen solchen Sack Geld nirgendwo hinstellen, weil das Land das Geld nicht habe. Garg ist skeptisch, ob sich junge Ärzte allein durch Prämien in strukturschwache Gegenden locken lassen.
Inhalte als Instrumente Der Bundesgesundheitsminister ging auch in seinem Vortrag zum Thema „Vernetzte Versorgung“ auf diese Punkte ein. Bahr geht fest davon aus, dass mit dem Versorgungsstrukturgesetz der Weg zu einer langfristigen qualitativ hochwertigen medizinischen Ver-sorgung gesichert werden könne. „Wir sorgen mit den neuen gesetzlichen Grundlagen dafür, dass Arztpraxen in Zukunft dort zu finden sein werden, wo die Menschen sie brauchen, ob in Ham-
burg oder an der Schlei, wo ich selbst gerne Urlaub mache“, hob er hervor. Er wolle, dass Ärzte in Zukunft mehr Zeit für Patienten haben und dies in Verbindung mit fairen Rahmenbedingungen, so Bahr. Dafür liefere das neue Gesetz mit seiner dezentralen Aus-richtung und dem Verzicht auf Kostendämpfungsmaßnahmen die richtigen Voraussetzungen. Als Beispiel nannte Bahr die Aufhe-bung der Residenzpflicht für Ärzte. „Praxissitz und Wohnort müs-sen nun nicht mehr identisch sein. So könne ein Arzt, der in einer Metropole wohne, künftig seinen Praxissitz auch in einer Umland-gemeinde haben. So erhofft sich Bahr positive Wirkungen für die ländliche Region. Auch durch die erweiterten Möglichkeiten zur Zweigpraxisgründung könnten sich gerade im ländlichen Raum chancen für eine gesicherte Versorgung ergeben, gerade im ländlichen Raum die ambulante ärztliche Versorgung zu sichern. Außerdem schaffe das Gesetz die Möglichkeit für eine flexiblere Bedarfsplanung, denn diese orientiere sich zukünftig am tatsäch-lichen Versorgungsbedarf vor Ort und nicht an starren Kreisgrenzen.
anreize im vergütungssystemBahr verteidigte noch einmal die finanziellen Steuerungskompo-nenten des Gesetzes. Er könne keinen Kritikpunkt darin finden, wenn Ärzte in unterversorgten Gebieten von Maßnahmen der Mengenbegrenzung ausgenommen würden. Auch die Stärkung des Grundsatzes „Beratung vor Regress“ bei Wirtschaftlichkeits-prüfungen im Arzneimittel- und Heilmittelbereich und die Schaf-fung von Transparenz im Rahmen der Richtgrößen und bei der Anerkennung von Praxisbesonderheiten im Heilmittelbereich könnten helfen, dass man auch in Zukunft auch in ländlichen Gebieten noch genügend Ärzte antreffen werde.
JAKOB WILDER, KVSH
Kein Geld im SackMehr Landärzte durch mehr Wettbewerb zwischen Ländern und Kommunen? Landesgesundheitsminister Dr. Heiner Garg und Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr waren zumindest in dieser Frage unterschiedlicher Ansicht.
GEsundhEITspoLITIK
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 19
Wer Wahlkampf sehen will, schaut über den großen Teich. Da hauen sich Republikaner und Demokraten, Teaparty-Bewegung und Einzelbewerber bei den Vor-wahlen die Themen und das Geld um die Ohren, dass es kracht. Wir lernen, dass es einen Staat wie New Hampshire gibt und fragen uns insgeheim seit wann. Geld strömt, Tränen fließen, die durchweg blonden Frauen der Kandidaten lächeln, was das Zeug hält – das ist großes Kino, finden auch wir. Aber: Das hat ja nichts mit Politik zu tun, beeilen wir uns nachzuschie-ben. Denn, wo bleiben die Themen, das Ringen um Konzepte und Visionen, der ehrliche Wettstreit um Wählerstimmen? Das läuft bei uns doch ganz anders. – Tatsächlich, es läuft bei uns anders. Es nennt sich Landtagswahlkampf – und schon bei dem Wort mel-det Bauch an Kopf ein Gefühl wie der Geschmack von sauer gewordener Milch: Man hofft, sie wäre noch gut, weiß aber beim ersten Blick: nee, Danke.
Dabei fehlt es ja nicht am guten Willen. Selbst die Kanzlerin hat sich schon eingeschaltet in das Rin-gen der Kandidaten um – ja worum eigentlich? Wel-che Frage: Um die Themen natürlich. Ach ja: Haus-haltssanierung, Kindergartenplätze, Energiewende, Kanalverbreiterung. Schon nach der Aufzählung der Themen weiß man, warum die Kandidaten völlig fer-tig aussehen. Wie soll man das nur schaffen. Und weil die Aufgaben ohnehin nicht lösbar sind, ist man nett zueinander. Wahlkampf – ja, aber nur ganz kurz. Wer will schon diesen lästigen Kampf um Wählerstimmen, das Ringen um Visionen und Konzepte, wollen uns die Kandidaten glauben machen. „Rasche Lösungen“ werden angekündigt und endlich wolle man in der Sache vorankommen.
Das überzeugt die Wähler hierzulande natürlich sofort. Nur wen man wählen soll, weiß man nach diesen Auftritten nicht. Aber vielleicht haben sich die Kandidaten ja schon untereinander verständigt, wer es nach dem 6. Mai macht. Dann können wir eigent-lich vor dem Wahllokal eine Münze werfen, bevor wir unser Kreuz machen, wenn das denn überhaupt erforderlich ist. Ein Trost bleibt: Der Wahlkampf in den USA liefert Bilder über das ganze Jahr bis in den Spät-herbst, aus jedem Staat und von jeder Partei. Da kön-nen wir uns noch lange freuen, wie viel substanzieller es doch bei uns läuft, meint
IHR cRITIcUS
Wahlkampf á la Holstein
K I E L E R S P I T Z E N
KoLumnE
GEsundhEITspoLITIK
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201220
G A S T B E I T R A G
Bei dem Verteilen von Wohltaten, finanziert über Schulden, kommt der Zeitpunkt, zu dem kein Geldgeber mehr bereit ist, sein Geld in Staatsanleihen zu investieren ohne die Gewissheit zu haben, dass sein Geld sicher angelegt ist. Das Leben auf Kredit hat also Grenzen, im privaten wie im öffentlichen Bereich.
abwägendes sparenSo leicht es ist, das Prinzip des Sparens zu verkünden, so schwierig ist die Umset zung. Dabei muss anerkannt werden, dass es nicht darum gehen kann, Sparen als absolutes und unverrückbares Prin-zip mit der Forderung durchzusetzen, Sparen zur Norm zu setzen und keinerlei Ausnahmen zu dulden. Sparen muss also differen-ziert erfolgen. So kann es in der Volkswirtschaft darum gehen, Fördermittel einzusetzen, um Beschäftigung und Wachstum zu sichern. Im Gesundheitswesen zum Beispiel geht es darum zu finan zieren, was aus übergeordneter gesundheitspolitischer Sicht als prioritär bezeichnet werden kann. Beispiele sind die Umset-zung des nach gewiesenen medizinischen Fortschritts für alle oder die Einrichtung von Lehrstühlen für Allgemeinmedizin an medizi-nischen Fakultäten, um eine ausreichende Zahl von Medizinstu-dierenden für die Allgemeinmedizin zu gewinnen.
In der Quintessenz bedeutet dies, dass es zwar keine Alternative zum Sparen gibt, weder in öffentlichen Haushalten noch im Gesundheitswesen. Sparen ist damit ein übergeordnetes Prinzip. Dies bedeutet jedoch nicht Sparen um jeden Preis. Auch in Zukunft muss es möglich sein, zusätzliches Geld dort einzusetzen, wo dies nach Abwägen aller Interessen geboten ist. Was allein zählt, ist die Saldierung, ist das Gesamtergebnis. In der Summe aller Maßnahmen muss am Ende ein Spareffekt entstehen, muss erreicht wor-den sein, was heute als Grundsatz politischen Handelns bezeichnet wird: Es darf nicht mehr ausgegeben werden als eingenommen wird, und dies ohne Kredite und ohne Schulden. Und nur das ist es, was zählt.
sparen im großen wie im KleinenGespart werden muss auf allen Ebenen, im Großen wie im Kleinen. Was Sparpro gramme für ganze Länder an Auswirkungen haben kann, wird in Griechenland oder Spanien, aber auch in Belgien oder Großbritannien demons-triert. Es wird ge streikt bis hin zum General-streik, und das Volk geht auf die Straße. Im Kleinen ist es nicht viel anders. überall kann
gespart werden, nur nicht in dem Bereich, von dem ich selbst betroffen bin oder zu dem ich eine besondere Beziehung habe. Dies ist der Aspekt des Sparens, der harte Entscheidungen erfor-dert, aber auch harte Ausein andersetzungen erwarten lässt, im Großen wie im Kleinen.
sparen im Kleinen: Beispiele aus schleswig-HolsteinBleiben wir beim Sparen im Kleinen. Wer die Tagespresse verfolgt erkennt, dass die Diskussion über konkrete Sparmaßnahmen im vollen Gange ist. Dem Vorschlag folgt der Protest. Hierzu einige Beispiele der jüngsten Vergangenheit aus den Kieler Nachrichten (KN).
In der Ausgabe vom 19. November 2011 wurde unter der über-schrift „Sorge um die Sexual medizin“ darüber berichtet, dass die Sektion Sexualmedizin am Standort Kiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) stark gefährdet ist. Der Grund sei, die Notwendigkeit zum Sparen sowohl beim Land als Träger des UKSH als auch beim UKSH selbst. Im gleichen Artikel wird berichtet, dass der Allgemeine Studie rendenausschuss (AStA) der Universität Kiel in einer Resolution den Erhalt der Lehre in der Sexualmedizin
Der Protest ist programmiertSie wollen es alle: Sparen. Bis auf die Linken verkündet jede der im Bundestag ver tretenen Parteien, dass für die Haushaltspolitik der Zukunft das Gebot des Sparens höchste Priorität haben muss.
GEsundhEITspoLITIK
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 21
fordert und weitere Gründe dafür anführt, dass auf die Sektion Sexualmedizin in Kiel nicht verzichtet werden kann. Es wird weiter auf die Kritik des Interdisziplinären Arbeitskreises für Forensische Psychiatrie und Psychologie e. V. hingewiesen, der seine Bestür-zung über diese Entwicklung zum Ausdruck bringt und fordert, dass es dringend geboten sei, diesen Lehr- und Forschungsbe-reich zu pfle gen, zu fördern und möglichst auszubauen. Auch das Landeskriminalamt meldet sich zu Wort und bedauert diese Ent-wicklung. Ein Kommentar in der gleichen Ausgabe steht unter der überschrift „Zur Sexualmedizin in Kiel – Kompetenz muss erhal-ten bleiben“. Die Diskussion endet zunächst mit einem Bericht vom 22. Dezember 2011 unter der überschrift „Sexualmedizin: Konzept gefordert“. Danach fordern „Die Grünen“ im schleswig- holsteinischen Landtag von der Landesregierung ein ressortübergreifen des Konzept zur Erhaltung der Sexualmedizin.
Ein anderes Thema sind die Kosten für die Schülerbeförderung. Hier geht es um die Beteiligung der Eltern. Von der Landesregie-rung heißt es, dass es vor dem Hinter grund der Haushaltskonso-lidierung unverzichtbar sei, Eltern an den Kosten für die Schüler-beförderung zu beteiligen. Die KN greifen diese Problematik am 2. Dezember 2011 auf und berichten, dass sich Protest gegen den Sparkurs von Schwarz-Gelb aufbaut bis hin zu einer Volksinitia-tive. Die politische Forderung der Eltern, repräsentiert durch die Landeselternbeiräte, ist die kostenlose Fahrt zur Schule für alle 400.000 Schüler.
In den KN vom 14. Dezember 2011 wird das neue Denkmalschutz-gesetz aufgegriffen. Der schleswig-holsteinische Landtag hat mit den Stimmen der cDU/FDP-Koalition ein neues Denkmalschutzge-setz beschlossen, das stärker als bisher wirtschaftliche Interessen berücksichtigt und sparsamer ist. Die Kritik von Opposition und Experten bis zu der Behauptung, es handele sich um ein Denkmal-schutzabbaugesetz, war un überhörbar.
Etwas allgemeiner ist die Diskussion um den Haushalt der Stadt Kiel, worüber in den KN vom 8. Dezember 2011 berichtet wird. Der Haushalt muss von der Landeregierung genehmigt werden. Innenminister Schlie wirft der Stadt Kiel eine intransparente Haus-haltsführung und einen unzureichenden Sparkurs vor als Antwort auf die Vorwürfe der Stadt und von Kommunalpolitikern, mit einer Kreditkürzung jeglichen Gestaltungsspielraum zu nehmen. Das Land jedoch drängt weiter auf einen Spar kurs.
schlussfolgerungDiese Beispiele machen deutlich, wie groß der Graben ist zwi-schen der Notwendig keit zum Sparen und der Umsetzung in kon-kretes Handeln. Der Graben wird noch tiefer, wenn neben der Notwendigkeit zum Sparen die unverändert gebliebenen For-derungen nach dem Ausbau von Leistungen berücksichtigt und überwiegend auch abgewehrt werden müssen, und dies in wohl allen Lebens- und Politikbereichen.
Es lassen sich Schlussfolgerungen ziehen. Schlussfolgerungen, die auch für das Gesundheitswesen von Bedeutung sind. Die wohl wichtigste Schlussfolgerung lautet, dass begründet, erläutert und gerechtfertigt werden muss, was gefordert wird. Es muss gerade von der Politik immer und immer wieder darauf hingewiesen werden, dass Wohlstand auf Dauer nicht über Schulden finan-ziert werden kann. Es muss deutlich gemacht werden, dass beim Sparen alle Lebens- und Politikbereiche zur Diskussion gestellt werden müssen. Es müssen Prioritäten gesetzt und Rangfolgen dafür entwickelt werden, was für eine Bevölkerung vorrangig und was weniger vor rangig ist. Es muss abgewogen werden zwischen wichtig und weniger wichtig. Die Bevölkerung muss nachvoll-ziehen können, warum in einzelnen Bereichen weniger und in anderen Bereichen mehr gespart werden muss und auch gespart werden kann.
Nicht anders ist die Situation im Gesundheitswesen. Es fehlt nicht an Gründen, warum gespart und verändert werden muss. So werden andere Strukturen in der hausärztlichen Versorgung, die Bildung von Zentren in der fachärztlichen Versorgung im Kran-kenhaus und im niedergelassenen Bereich mit weiteren Wegen für den Patienten verbunden sein. Der Umfang des Leistungska-talogs der Gesetzlichen Krankenversicherung wird sich verringern müssen. Es wird abzuwägen sein, was von den heutigen Struk-turen und dem heutigen Leistungsumfang als prioritär und was als posterioritär angesehen werden kann. Dies ist mühsam, aber es ist unvermeidlich.
Soziale Gerechtigkeit und sozialer Frieden ohne Schulden, diese Aufgabe kommt auf uns zu. Es ist eine schwierige Aufgabe. Und wahrscheinlich gilt: Was auch im mer vorgeschlagen wird, der Protest ist programmiert.
PROF. DR. FRITZ BESKE,
FRITZ BESKE INSTITUT FüR GESUNDHEITS-SySTEM-FORScHUNG, KIEL
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201222
Dass Benutzerdaten von Playstation-Spielern geknackt wurden, hatten wir, da so etwas bei weltweit aufgestellten großen IT- Firmen passierte, teilweise noch amüsiert zur Kenntnis genom-men. Aber dass Ende letzten Jahres Sozialdaten psychisch Kranker frei zugänglich ins Internet gelangten, war schon erschreckend.
Die Presseberichte zu diesem sensiblen Thema fielen entspre-chend drastisch aus:• „Tausende Daten psychisch Kranker im Internet: Datenschüt-
zer prüfen Panne“ (Lübecker Nachrichten, 7. November 2011)
• „Schwere Datenpanne im Gesundheitsbereich: Mehrere 1.000 sensible Daten psychisch kranker Patienten gelangten ins Internet. Betroffen waren vor allem Menschen in Schleswig-Holstein. Medizinische Befunde und Dokumen-tationen einsehbar, möglicherweise monatelang online!“ (Focus, 4. November 2011 )
Eines vorweg: Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es auch in die-sem sich immer weiter entwickelnden und verbreiternden Bereich unserer Arbeits- und auch Privatwelt nicht. Wir können uns nur permanent anstrengen, die Risiken des Informationswerkzeugs Internet so klein wie möglich zu halten.
Daher war uns nach dem ersten Schock auch klar, dass die Wahr-scheinlichkeit eines solchen Ereignisses mit den Daten, die Ihrer Kassenärztliche Vereini-gung in Ihrem und dem Auftrag des Gesetzgebers anvertraut werden, sehr klein ist.
Ich möchte Ihnen hier einen kurzen überblick – die Doku-mentation dieser Prozesse füllt viele Ordner und so manche Festplatte – über unsere Maßnahmen zur Wahrung der Datensicherheit und des Datenschutzes bei der KVSH geben. Das beginnt bei den Mitarbeitern der KV, und das ist auch eine entscheidende Stelle: Wir alle, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Sozialdaten arbeiten, verpflichten uns vor unserem Justitiar zur Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Regeln und den daraus resultierenden Handlungsanweisungen in der KV. Mögen der Verkauf von Daten aus Liechtensteiner oder schweizer Konten ein gesellschaftlich akzeptierter Akt sein, die Honorardaten unserer Mitglieder oder die Diagnosen Ihrer Pati-enten und auch alle anderen Daten, die wir zur Erfüllung unseres Auftrages benötigen, sind für den Rest der Welt tabu. Dieses ist uns allen jederzeit bewusst.
Der Vorstand gibt durch Dienstvereinbarungen die Leitlinien vor, unser Datenschutzbeauftragter wirkt auf die Einhaltung des Bun-desdatenschutzgesetzes und anderer Gesetze hin. Eine seiner
wesentlichen Aufgaben ist die Kontrolle und überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Datenverarbeitungsprogram-men. Er wird unterstützt bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen vom IT-Sicherheitsbeauftragten.
Und dann ist da ein großes Bündel an technischen Maßnah-men, von der körperlichen Zugangskontrolle zu sensiblen Netz-werk- und Serverkomponenten bis hin zu „highly sophisticated“ Abschottungsstrategien auf Softwarebasis. Nicht alles darf ich an dieser Stelle detailliert beschreiben – es ist aus nahe liegenden Gründen geboten, der anderen, dunklen Seite des Internets nicht zu viele Informationen zukommen zu lassen, aber einige – offen-sichtlich außerhalb der KV nicht überall umgesetzten – Konzepte sollen hier skizziert werden. Die Abschottung der IT-Infrastruktur, also Server, Datenbanken, clients (das sind im wesentlichen die Arbeitsplatzrechner) der KVSH, vor den Zugriffen aus dem öffent-lichen Internet erfolgt durch den Einsatz verschiedener Security Gateways (Sicherheitszugänge).
Die Firewall (Brandmauer) trennt die Zugänge von außen – also Internet und andere Zugangsarten – von den internen IT-Struk-turen der KV. Server die vom Internet erreichbar sein müssen, da sie Daten empfangen oder versenden sollen, sind in einer DMZ (Demilitarized Zone) – einem Niemandsland – gruppiert (Bild 1).
Der Zugriff aus dem Internen Netzwerk auf Dienste im Internet ist grundsätzlich durch die Firewall gesperrt. Ein client kann sich nur über einen Web-Proxy (proxy: Stellvertreter oder auch Vermittler) mit dem Internet verbinden. Der Proxy ist in der DMZ platziert und bündelt die Internetzugriffe. Ein client muss auf der Firewall die Erlaubnis zum Zugriff auf den Proxy haben und der Nutzer muss sich am Proxy mit Benutzername und Kennwort authentifizie-ren.Neben der Einschränkung für Mitarbeiter nicht auf unsichere Dienste zuzugreifen, wird Angreifern vor allem der Zugriff auf einen Arbeitsplatz-Pc blockiert. Denn diese „verstecken“ sich hin-ter dem Web-Proxy und sind für Angreifer nicht erkennbar (Bild 2).
Täglich werden große Anzahlen an E-Mails versendet und emp-fangen. Ein E-Mail-Gateway wird eingesetzt, um externe E-Mail-Kommunikation zu ermöglichen ohne den sensiblen internen GroupWise-Server (das ist das KV-interne Kommunikationspro-gramm für E-Mails aber auch Termine für Besprechungen und
D A T E N S I c H E R H E I T
Die Einschläge kommen näherDie Themen Datensicherheit und Datenschutz werden insbesondere im sensiblen Bereich des Gesundheitswesens immer wichtiger. Wir geben einen Überblick, wie die KVSH in diesen Bereichen aufgestellt ist.
Bild 1
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 23
Weiterleitung von Arbeitsaufträgen) zu gefährden. Das Gateway übernimmt in der KVSH folgende Funktionen:
Es empfängt externe E-Mails, filtert Spam, Viren, sonstige Bedro-hungen heraus und leitet diese an den internen Server weiter. Es versendet E-Mails an externe Empfänger nach einem bestimmten Regelwerk (Berechtigungen, etc.) und es ver- und entschlüsselt sensiblen E-Mail-Verkehr, ohne dass der Nutzer aktiv werden muss, z. B. Datenlieferung von KV an Kostenträger oder umge-kehrt (Bild 3).
Unser Web-Portal ist im Internet unter www.ekvsh.de oder im KV-SafeNet – das ist ein besonders sicherer Zugangsweg inner-halb des KV-Systems – unter www.ekvsh.kv-safenet.de zu errei-chen. Ein Login kann mit Benutzername und Kennwort oder mit einer Signaturkarte erfolgen. Die Verbindung mit dem Server ist grundsätzlich verschlüsselt. Da ein Web-Portal durch die notwen-digen Zugriffe auf die internen Datenbanken- und File-Server ein hohes Risiko für die Datensicherheit darstellt, wird hier eine Multi-Schicht-Architektur zur Absicherung gewählt. Diese im Detail zu erläutern, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen und ist – siehe Bild 3 – auch nicht angezeigt.
Zwischen der sensiblen Datenlage und dem öffentlichen Inter-net gibt es folglich vielfache Sicherungssysteme, die unerlaubte Zugriffe blockieren.
Die KVSH ist sowohl Datenlieferant als auch Datenempfänger in den unterschiedlichsten Bereichen. Die übertragungswege wer-den für jeden Einzelfall gesondert festgelegt. Hierbei kommen die Sensibilität der Daten, die technologischen Gegebenheiten der Partner und die Häufigkeit der Datenlieferungen als Kriterien zum Tragen.
Die Zugänge werden für jede Einrichtung und jede Datenart ein-zeln vergeben und basieren auf einer Zertifikatsverschlüsselung. Die zuständigen Mitarbeiter in den Fachabteilungen bereiten die Daten gemäß Vereinbarung auf und stellen diese auf dem Server bereit bzw. greifen auf die eingegangenen Datenlieferungen zu. Ähnlich wie die KVSH betreiben auch andere Einrichtungen sFtP-server (Secure File Transfer Protokoll: Sicheres Protokoll zur über-tragung von Dateien) zum Datenaustausch. Der Sicherheitsstan-dard ist ähnlich hoch zu bewerten. Die Verbindungen zu diesen
Servern werden zentral über die Firewall der KVSH admini-striert und den Mitarbeitern in den Fachabteilungen zur Verfü-gung gestellt. Auch bei diesen Datenlieferungen werden die Daten vorher nach Vereinba-rung zugeschnitten und somit nur die notwendigen Daten ausgetauscht.
Nun aber noch zu einem besonders sensiblen Bereich, dem Daten-austausch zwischen Ihrer Praxis und der KV und dem Austausch der Praxen untereinander. Die „1-Click-Datenübermittlung“ aus der Arztpraxis ist eine übertragung von Datenlieferungen an die KVSH per SFTP aus der Praxis-Software über eine gesicherte VPN-Verbindung (Virtual Private Network) auf den SFTP-Server der KVSH. Bei dieser übertragung ist der übertragungsweg verschlüs-selt, das Protokoll ist verschlüsselt und auch die zu liefernden Dateien sind mit dem KBV-cryptomodul verschlüsselt – also im wahrsten Sinne des Wortes doppelt und dreifach gesichert. Bevor
ein Anbieter von Praxissoft-ware für eine solche Datenlie-ferung zugelassen wird, muss er sein Verfahren durch das ULD (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz SH) begutach-ten lassen. Die teilnehmenden Ärzte ihrerseits müssen aktiv ihre Einwilligung zur Teilnahme am Online-Verfahren geben.
Wenn Sie bis hierhin lesenderweise vorgedrungen sind, haben Sie schon ein gerüttelt Maß an Geduld mit diesem doch sehr tech-nik-lastigen Teil meiner Darstellung bewiesen. Dafür gilt Ihnen mein verständnisvoller Dank. Mein Anliegen ist es, Ihr Vertrauen in diese Technologie zu erhalten. Denn die Internet-Technologien werden auch im Gesundheitswesen zunehmend häufiger als nütz-liche Werkzeuge eingesetzt werden.
Ein letztes Beispiel dafür ist unser eKvsH-email-Dienst, ein von der KVSH betriebener, gesicherter Email-Dienst zur Kommunika-tion zwischen Ärzten und Psychotherapeuten, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen im Gesundheitswesen. Dieser Dienst ist ausschließlich im KV-SafeNet verfügbar, wird auf gesonderten Systemen der KVSH betrieben und steht allen unseren Mitgliedern aber auch den anderen Institutionen zur Verfügung.
Und um ganz sicher zu sein, dass er den höchsten Ansprü-chen an Datenschutz und Datensicherheit genügt, befindet sich dieser Dienst zurzeit in einer Auditierung durch das „Unabhän-gige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein“. Nur so können wir einigermaßen ruhig schlafen – natürlich außerhalb der Dienstzeit – ohne befürchten zu müssen, mit Schlagzeilen wie den eingangs zitierten Morgenmagazinen aufgeschreckt zu wer-den. Wie ebenfalls oben gesagt, einen 100-prozentigen Schutz gibt es nicht, aber wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesse-rung unserer Datensicherheit. Und auch Sie können uns dabei unterstützen, indem Sie bevorzugterweise die so gesicherten Kommunikationswege der KVSH zur Bewältigung Ihrer Aufgaben benutzen.
MANFRED JASPERS, KVSH
Bild 2
Bild 3
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201224
P R ü F W E S E N
Die Funktion und Rolle der Prüfinstanzen sind gesetzlich eindeutig festgelegt. Während das Verfahren der Wirtschaftlichkeitsprüfung jahrzehntelang von Krankenkassen und Kassenärztlichen Ver-einigungen gemeinschaftlich durchgeführt wurde, besteht seit dem 1. Januar 2008 eine eigenständige Prüfungsstelle. Dieser Prüfungsstelle obliegt die Wirtschaftlichkeits prüfung der ambu-lanten vertragsärztlichen Versorgung (Paragraf 106 SGB V). Die Prüfungsstelle prüft und entscheidet jeweils nach Maßgabe der zwischen der KV und den Krankenkassen geschlossenen Verträgen und der Prüfvereinbarungen, ob Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoßen haben und welche Maßnahmen daraufhin zu treffen sind. Die Prüfungs-stelle unterstützt die Widerspruchsbehörde, den sogenannten Beschwerdeausschuss, organisatorisch bei der Erfüllung seiner laufenden Geschäfte.
Nach Lesart des Bundessozialgerichts handelt es sich bei der Wirt-schaftlichkeitsprüfung um ein hohes Gut mit dem Ziel „möglichst effektiver Verhinderung unwirtschaftlicher Behandlungs- oder Verordnungs weisen“.
emotionen und FaktenDie Arbeit der Prüfgremien ist in der Ärzteschaft umstritten und wird manchmal sogar als ungerecht oder zumindest ineffektiv bezeichnet. Markus Eßfeld, Leiter der Prüfungsstelle der Ver-tragsärzte und Krankenkassen in Schleswig-Holstein, begegnet der Kritik mit einem Blick auf die Statistiken. „Bei unaufgeregter Betrachtungsweise wird man den Vorwurf des geringen Erfolges
bei hoher Verunsicherung der Betroffenen leicht entkräften können. Von ca. 5.000 Ver-tragsärzten sind von einer Maßnahme der Wirtschaft-lichkeitsprüfung nur acht Pro-zent jährlich betroffen. Nicht vergessen werden sollte, dass hierzu von vornherein vermeidbare Fälle zählen, wie beispielsweise die Ver-ordnung eines Kontrazepti-vums für über Zwanzigjäh-rige oder die Verordnung von Lifestyle-Präparaten, welche von der Versorgung gesetzlich Krankenversicher-
ter ausgeschlossen sind.“ Zusätzlich weist Eßfeld darauf hin, dass manchmal Ärzte zu prüfen sind, bei denen bekanntermaßen Pra-xisbesonderheiten vorliegen. „Dies ist für die Betroffenen ärger-lich, aufgrund gesetzlicher Regelungen aber unumgänglich. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung dient nicht zuletzt dem Schutz der weit überwiegenden Mehrheit der Vertragsärzte (über 90 Prozent). Das sind diejenigen Ärzte, welche sich an die Regeln halten. Diese tragen dazu bei, dass das System der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung funktions- und leistungsfähig bleibt. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts beruht die Wirtschaftlichkeitsprüfung auf sachgerechten und vernünftigen Erwägungen des Allgemein-wohls“, so Eßfeld.
Wie läuft das Prüfungsprozedere ab?Fast alle Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden auf einer rein sta-tistischen Grundlage eingeleitet, sei es beim Honorar oder bei den Verordnungen. Die Verordnungen eines Arztes werden beurteilt nach den vereinbarten Richtgrößen, nach Durchschnittswerten
beim Sprechstundenbedarf, nach Zufallsstichproben und in zahlreichen Fällen nach Anträgen auf Sonstigen Scha-den. Letzteres betrifft vor allem den Punkt Verordnung außerhalb der Zulassung. Eine Honorarprüfung wird vor allem bei überschreitung der Zeitprofile und statistisch auffälligen Abweichungen vom Abrechnungsverhalten der Fachgruppe eingeleitet. Die Prüfungsstelle schreibt bei Einleitung eines Prüfver-fahrens die betroffene Praxis an und informiert diese über
die Anträge und deren Begründungen. Der Arzt wird aufgefordert, innerhalb einer Frist eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. „Das Schreiben der Prüfungsstelle sollte man nicht ignorieren und einfach wegdrücken“, erklärt Dr. Dieter Freese, Allgemeinarzt aus Bad Segeberg, der seit 16 Jahren als ärztliches Mitglied im Beschwerdeausschuss tätig ist.
Der betroffene Arzt sollte auf jeden Fall antworten und in seiner Stellungnahme die Gründe erläutern, die aus seiner Sicht z. B. zur Mehrverordnung geführt haben. „Wenn aber vom Arzt nichts kommt, muss eben leider strikt nach Aktenlage entschieden wer-den“, bedauert Freese. Durch eine plausible Erklärung des Arztes besteht vor der Festsetzung eines eventuellen Regresses noch die Möglichkeit, Einfluss auf die Entscheidungen zu nehmen. Im güns-tigsten Fall könnte das zur Beendigung des Prüfverfahrens führen.
Bei einer Regressfestsetzung besteht nach der Prüfvereinbarung die Möglichkeit, eine individuelle Richtgrößenvereinbarung abzu-schließen. Durch eine solche Vereinbarung kann der Gang zum Beschwerdeausschuss vermieden werden; in vielen Fällen kommt es aber durch den Widerspruch des Arztes, aber auch der Kran-kenkassen und der KV zu einem Verfahren vor dem Beschwer-deausschuss.
Blick in die BlackboxIhre Entscheidungen werden selten geliebt und nicht immer gleich verstanden. Dennoch sind Prüfungsstelle und Beschwerdeausschuss wichtige Elemente der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzteschaft und Krankenkassen.
Markus Eßfeld, Leiter der
Prüfungsstelle
Dr. Dieter Freese, Allgemeinarzt,
Bad Segeberg
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 25
Die rolle des BeschwerdeausschussesDer Beschwerdeausschuss, paritätisch mit drei Ärzten und drei Krankenkassenvertretern und einem unparteiischen Vorsitzen-den besetzt, entscheidet dann über den Widerspruch. „Man darf nun aber nicht denken, dass sich hier automatisch immer zwei Lager gegenüberstehen. 4:3 Entscheidungen gibt es so gut wie nie und in der weit überwiegenden Zahl der Fälle sind wir im Ausschuss einheitlicher Meinung“, erklärt Freese. Auch BARMER GEK Nord Landesgeschäftsführer Thomas Wortmann,
einer der drei Vertreter der Krankenkassen im Beschwer-deausschuss, sieht in diesem Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung in Schles-wig-Holstein eine Instanz mit Augenmaß. „Besonders hervorzuheben ist die offene Gesprächs- und Diskussions-kultur, in der vertrauensvoll alle Fakten auf den Tisch kommen. Das heißt natür-lich nicht, dass regelmäßig einvernehmliche Entschei-dungen getroffen werden“, erklärt Wortmann. Die
Stimme des Vorsitzenden gibt bei Stimmengleichheit am Ende den Ausschlag. „Der unparteiische Vorsitzende kann schnell zum Zünglein an der Waage werden. Aber getroffene Entscheidungen sind richtungsweisend und werden als Maßstab des künftigen
Handelns akzeptiert. Dadurch ist der Beschwerdeausschuss ein wichtiges Regulativ in der gemeinsamen Aufgabenbewältigung von KV und Krankenkassen“, so Wortmann.
Der arzt vor dem BeschwerdeausschussBeim Verfahren vor dem Beschwerdeausschuss besteht immer die Möglichkeit einer persönlichen Anhörung, die auch von vielen wahrgenommen wird. Dennoch bedeutet es für die allermeisten Ärzte einen Schock, wenn sie vor den Beschwerdeausschuss gela-den werden, vor allem wenn sie bisher noch nie auffällig waren und jetzt zum ersten Mal vorgeladen werden. „Es gibt natürlich manchmal Fälle, wo Ärzte unschuldig schuldig geworden sind, z. B. wenn ein altgedienter HNO-Arzt im Vergleich zu seiner Berufsgruppe zu viele Salben verordnet hat und dafür in Regress genommen wird, obwohl er damit medizinisch gesehen immer sehr gute Erfolge hatte“, sagt Freese.
Für ihn ist es aber wichtig festzuhalten, dass im Beschwerdeaus-schuss immer die Beurteilung der individuellen Situation des Arztes die Richtschnur für die Entscheidung ist. „Für uns ist es dabei am überzeugendsten, wenn der Arzt persönlich vorspricht, einen Kollegen als unterstützenden Berater mitbringt und dann gut vorbereitet seine medizinischen Entscheidungen erklärt. Einen Rechtsanwalt zu engagieren, der rein auf der juristisch-formalen Schiene argumentiert, ist nicht unbedingt ein Vorteil“, so Freese. Auch seine beiden ärztlichen Kollegen Dr. Jörg Heinze, Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin aus Geesthacht und carl culemeyer, Allgemeinarzt aus Ascheffel sehen das so. Die drei wurden zwar von der KVSH für dieses Amt benannt, sind aber
Thomas Wortmann, BARMER GEK Nord
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201226
in ihrer Entscheidung unabhängig und nicht weisungsgebunden. Diese Unabhängigkeit gilt auch für die Vertreter der Krankenkas-sen. „Das ist wichtig zu wissen, denn es kommt nicht selten vor, dass die Mitglieder der Krankenkassen im Beschwerdeausschuss bei Vorliegen neuer Erkenntnisse die Anträge der Krankenkassen zurückziehen“, sagt Freese.
Beschwerdeausschuss oder sozialgericht?Ein Widerspruch gegen die Entscheidung der Prüfungsstelle hat eine aufschiebende Wirkung. Eine Klage gegen die Entscheidung des Beschwerdeausschusses führt zu einem Verfahren vor dem Sozialgericht, hat teilweise im Falle einer Regressfestsetzung
keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet im Klartext: Ein Regress muss beglichen werden, sobald der Beschwerdeaus-schuss den Regress festgesetzt hat. Wird der Regress fällig, teilt der Beschwerdeausschuss dies der KV mit und die verrechnet den Betrag mit den laufenden Honorarzahlungen. Das Sozialge-richt prüft vor allem, ob das Verfahren rechtmäßig und nach den Prüfvereinbarungen abgelaufen ist. Gegen die Entscheidung des Sozialgerichts gibt es für alle Verfahrensbeteiligten die Möglich-keit der Berufung beim Landessozialgericht.
JAKOB WILDER, KVSH
Der Beschwerdeausschuss ist ein vom Gesetz vorgeschrie-benes Selbstverwaltungsorgan, das über Beschwerden von Ärzten, der KV Schleswig-Holstein oder der Krankenkassen gegen Bescheide der Prüfungsstelle entscheidet.
Der Beschwerdeausschuss ist von Gesetzes wegen paritätisch mit Mitgliedern (mindestens je zwei) der ärztlichen Selbstver-waltung und der Krankenkassen besetzt. Sie werden autonom von beiden Seiten entsandt. In Schleswig-Holstein haben wir uns darauf verständigt, regelmäßig mit drei Mitgliedern bei-der Seiten zu verhandeln, um Entscheidungen auf eine mög-lichst breite Basis zu stellen.
Die Sitzungen werden von seinem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter geleitet. Auf diese (unparteiischen) Personen müssen sich die Vertragsparteien verständigen. Neben der Sitzungsleitung und gerichtlichen Vertretung des Ausschusses – der Vorsitzende muss die Befähigung zum Richteramt haben – sollen sie in Zweifelsfällen mit ihrer Stimme den Ausschlag geben können. In der Praxis kommt es dazu praktisch nie, bei Hunderten von Entscheidungen ist maximal eine Hand voll durch die jeweiligen Vorsitzenden entschieden worden.
Grundlage der Arbeit des Beschwerdeausschusses ist – ebenso wie bei der Prüfungsstelle – die gesetzliche Regelung in Para-graf 106 SGB V und die darauf fußenden Vereinbarungen der
P R ü F W E S E N
Der Beschwerdeausschuss in der Wirtschaftlichkeitsprüfung
Dr. Johann David Wadephul,
Vorsitzender des BeschwerdeausschussesProf. Günther Jansen,
stellvertretender Vorsitzender des Beschwerdeausschusses
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 27
Vertragsparteien in Schleswig-Holstein (z. B. „Sprechstun-denbedarfsvereinbarung“; die Vereinbarungen sind auf der Homepage der KVSH nachzulesen.). All das ist Ausfluss des Wirtschaftlichkeitsgebotes von Paragraf 12 SGB V. übersetzt heißt es in etwa: „Die vertragsärztliche Versorgung ist „wirt-schaftlich“, wenn der Vertragsarzt (Leistungserbringer) die (notwendigen, ausreichenden und zweckmäßigen) Leistun-gen mit einem möglichst geringen Aufwand an „Kosten“ (im Sinne von Ausgaben der Krankenkassen) erbringt.“ (Auszug aus dem KBV-Fortbildungsheft Nr. 9)
Der Beschwerdeausschuss wird – wie in jedem Verwaltungs-verfahren die Widerspruchsinstanz – bei Rechtsbehelfen (Widersprüchen) gegen Entscheidungen der Prüfungsstelle tätig. Dabei kann es sich sowohl um Beschwerden von Ärzten oder der KV handeln, die mit einem Regress an sich oder in der Höhe nicht einverstanden sind, aber auch um den Rechts-behelf von Krankenkassen, die einen zu geringen oder über-haupt keinen festgesetzten Regress bemängeln.
Ausdrücklich hinzuweisen sind alle Betroffenen an dieser Stelle auf die einmonatige Widerspruchsfrist, die zwingend einzuhalten ist. Es gibt zwar nur wenige Fälle der Verfristung, doch ist jeder Fall einer zu viel. Hinzuweisen ist auch auf das Recht jedes Betroffenen – sei er Arzt oder Krankenkasse – eine persönliche Anhörung vor dem Beschwerdeausschuss bean-tragen zu können. Oftmals kann auf diese Weise der Sachver-halt – etwa die Verordnungsweise und deren Umfang – besser nachvollzogen werden.
Dem Beschwerdeausschuss obliegt nach den Worten des Bun-dessozialgerichtes die sogenannte „intellektuelle Prüfung“ der Bescheide. Dies ist insbesondere bei der großen Zahl der Regresse, die auf statistischen Berechnungen beruhen, von besonderer Bedeutung. Zentral ist das Feststellen von soge-nannten Praxisbesonderheiten. Sind die Leistungen ihrer Art nach für die Arztpraxen der Vergleichsgruppe atypisch oder liegen die Leistungen angesichts ihrer Abrechnungshäufigkeit wesentlich über dem Fachgruppendurchschnitt, dann gibt es Anlass von einer derartigen Praxisbesonderheit auszugehen. Insbesondere für die statistischen Prüfungen (Honorar, Richt-größen, Sprechstundenbedarf) gibt es dann Anlass, von dem statistisch gewonnenen Ergebnis abzuweichen.
Hier zahlt sich aus, dass beide Vertragsseiten ihre Experten in den Ausschuss entsenden. Sie sind es im Ergebnis, die der-artige überlegungen fachlich nachvollziehen können oder Besonderheiten auffinden, gegenüber denen eine Statistik notwendigerweise blind ist.
Auf diese Weise konnte in der Vergangenheit ein großer Konsens erreicht werden. Er zeigt sich nicht nur darin, dass nahezu sämtliche Entscheidungen einstimmig fallen. Auch kommt es nur sehr selten vor, dass die Krankenkassen gegen Entscheidungen des Beschwerdeausschusses gerichtlich vor-gehen. Der Beschwerdeausschuss ist ganz überwiegend durch
die Sozialgerichte, die angerufen werden können, bestätigt worden, im letzten Jahr auch erneut durch das Bundessozial-gericht. Dennoch sei jedem, der mit einer Entscheidung des Beschwerdeausschusses nicht einverstanden ist, der Weg zum zuständigen Sozialgericht empfohlen. Auch hier gilt eine ein-monatige Klagefrist nach Erhalt des Widerspruchsbescheides! Vor dem Sozialgericht gibt es keinen Anwaltszwang, obgleich es sicher Anlass gibt, jedenfalls in komplizierteren Konstel-lationen, einen entsprechend vorgebildeten (Fach-) Anwalt hinzuzuziehen.
Die Wirtschaftlichkeitsprüfung hat ihre Funktion innerhalb der überwachung der Gesamtwirtschaftlichkeit wahrzunehmen. Für die Mitglieder des Beschwerdeausschusses wird bei ihrer Arbeit immer wieder deutlich, wie fachlich qualifiziert Ärzte handeln und wie sie sich gezielt für ihre Patienten einsetzen. Dennoch zeigen die Prüfungen auch, dass es immer wieder Ärzte gibt, die auf die vereinbarten Rahmenbedingungen keine oder nicht ausreichend Rücksicht nehmen. Deshalb wer-den wohl alle Mitglieder des Beschwerdeausschusses eine Stärkung der Beratungsmöglichkeit und -pflicht begrüßen. Denn wenn die Institutionen der Wirtschaftlichkeitsprüfung gemäß Paragraf 106 SGB V tätig werden, ist das Kind oft schon in den Brunnen gefallen.
Unser Dank gilt den Vertragsparteien in Schleswig-Holstein, die uns nunmehr seit sieben Jahren mit dieser Aufgabe betraut haben und insbesondere unseren „Kollegen“ aus der Ärzteschaft und den Krankenkassen, mit denen wir in oft viel-stündigen Sitzungen unsere Prüftätigkeit verrichten.
DR. JOHANN DAVID WADEPHUL,
VORSITZENDER DES BEScHWERDEAUSScHUSSES,
PROF. GüNTHER JANSEN,
STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DES BEScHWERDEAUSScHUSSES
„Es zahlt sich aus, dass beide
Vertragsseiten ihre Experten in den
Ausschuss entsenden.“
„Wenn die Institutionen der
Wirtschaftlichkeitsprüfung tätig
werden, ist das Kind oft schon in den
Brunnen gefallen.“
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201228
Während bis vor einigen Jahren das Berufsrecht der Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte jegliche Werbung untersagte und Werbeanzeigen nur zu bestimmten Anlässen erlaubt waren, zeigt sich nun allge-mein die Tendenz, das ehemals sehr strenge Werbeverbot erheb-lich zu lockern. Die nachfolgende Aufzählung bezieht sich dabei überwiegend auf Angaben aus der Musterberufsordnung der Ärzte vom 10.09.2002, fortgeschrieben am 12.08.2003, herausgegeben von der Bundesärztekammer (www.baek.de). Man muss wis-sen, dass die Beurteilung der einzelnen Sachverhalte mittlerweile dynamisch erfolgt und sich in einigen Fällen sogar von Bundesland zu Bundesland unterscheidet. Bei Unklarheiten bietet es sich daher an, noch einmal bei der Ärztekammer Schleswig-Holstein nachzu-fragen (Tel. 04551 803 0).
Eine komplizierte BeziehungDas ärztliche Berufsrecht hat in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen erfahren. Was ist eigentlich erlaubt und was nicht?
Beispiele für zulässige arztwerbung Beispiele für unzulässige arztwerbung
• Hinweise auf Ortstafeln, in kostenlos verteilten Stadtplänen und in Bürgerinformationsstellen
• Geburtstagsglückwünsche an eigene Patienten ohne Hinweise auf das eigene Leistungsspektrum
• sachliche Informationen in Medien
• Auslegen von Flyern/Patienten-Informationsbroschüren/auch „Wartezimmerzeitungen“ mit organisatorischen Hinweisen und Hinweisen zum Leistungsspektrum sowie Angaben zur Person (z. B. Zeitpunkt der Erteilung der Facharztanerken-nung, besondere Sprachkenntnisse)
• Das Auslegen von Werbematerialien innerhalb der eigenen Praxis z. B. Plastikhüllen für chipkarten, Kugelschreiber und sonstige Mitgaben mit geringem Wert (z. B. Kalender mit Namens-/Praxisaufdruck)
• Organisation „Tag der offenen Tür“, Kultur-, Sport- und Sozialsponsoring
• nicht aufdringliches (Praxis-)Logo
• Kunstausstellungen in der Praxis
• Verbreiten von Flugblättern, Postwurfsendungen, Mailingaktionen
• Trikotwerbung, Bandenwerbung, Werbung auf Fahrzeugen
• Angabe von Referenzen
• bildliche Darstellung in Berufskleidung bei der Berufs-ausübung, wenn ein medizinisches Verfahren oder eine ärztliche Behandlungsmaßnahme beworben wird
• jegliche herkömmliche Werbung in anpreisender, irreführender und vergleichender Form
• produktbezogene Werbung durch/für Dritte im Wartezimmer
• Plakatierungen, z. B. in Supermärkten
• Werbung mit Äußerungen Dritter, insbesondere Dank-schreiben, Anerkennungsschreiben oder Empfehlungs-schreiben
Vors icht +++ Vors i cht +++ Vors i cht +++
A R Z T U N D W E R B U N G
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 29
Beispiele für zulässige arztwerbung Beispiele für unzulässige arztwerbung
• sachlich berufsbezogene informierende Werbung, die nicht anpreisend, irreführend oder vergleichend ist. Praxis-broschüre, in der medizinische und organisatorische Informa-tionen dargestellt werden
• Zusatzinformationen in Anzeigen, wie Erreichbarkeit, Öffnungszeiten, Verkehrsanbindung
• Hinweise auf Zertifizierung der Praxis, z. B. Bescheinigung per „ISO-9000-Qualitätszertifikat“ über genormte Organisati-onsabläufe
• Das Auslegen von Hinweisen auf die eigene Tätigkeit bei anderen Unternehmen des Gesundheitswesens (z. B. Apo-theken, Massagepraxen, Wellnesseinrichtungen)
• das Verteilen von Werbeprodukten außerhalb der Praxis
• Sonderangebote
• Die Bezeichnung der eigenen Praxis, z. B. als „Institut“, „Tagesklinik“, „Ärztehaus“, „Gesundheitszentrum“, „Zen-trum für xyz“
• Werbung mit Gutachten, Zeugnissen, wissenschaftlichen oder fachlichen Veröffentlichungen sowie Hinweisen darauf
• Werbung, die darauf zielt, die „Hilflosigkeit und Leicht-gläubigkeit“ eines Patienten auszunutzen, beispielsweise Versprechen auf Heilung
• Werbung mit Aussagen, die geeignet sind, Angstgefühle hervorzurufen
Beispiele für zulässige Inhalte bzw. gestaltung einer Homepage/Praxisbroschüre/Praxisschild
Beispiele für unzulässige Inhalte bzw. gestaltung einer Homepage/Praxisbroschüre/Praxisschild
• Mindestinhalt des Praxisschildes: Name, (Fach-) Arztbezeich-nung, Sprechzeiten, gegebenenfalls die Zugehörigkeit zu einer Berufsausübungsgemeinschaft
• Angabe von nach der Weiterbildungsordnung erworbenen Qualifikationen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Qua-lifikationen, Tätigkeitsschwerpunkte und organisatorische Hinweise
• Praxisorganisatorische Hinweise (Hinweise auf Sprechstun-den, Öffnungszeiten, Telefonnummern, Lage der Praxis, Erreichbarkeit der Praxis, Parkmöglichkeiten)
• Wettbewerbe, Gewinnspiele
• Patienten-Diskussionsforen
• Veröffentlichungen von Dankschreiben.etc.
• jegliche Art von Werbebannern und Pop-up-Fenstern Einrichtung von elektronischen Gästebüchern
• jegliche Form von Ferndiagnose und Ferntherapie im Internet
Eine eigene Homepage, ein Facebook-Auftritt oder doch ein Flyer? Welche Art von Werbung Ärzten eigentlich erlaubt ist, zeigt auch ein Film im Web.TV der KVen unter www.kv-on.de/html/806.php.
JAKOB WILDER, KVSH
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201230
Nordlicht: Herr Sterzik, worauf müssen Ärzte achten, wenn sie Zuwendungen und Vergünstigungen von Phar mafirmen erhalten?
Klaus-Henning sterzik: Das hängt davon ab, wie der Große Strafsenat des BGH entscheidet. Vom 3. Senat ist ihm ja die Fra ge vorgelegt worden, ob Vertragsärzte bei der Verordnung von Hilfsmitteln als Amtsträger im Sinne des Strafgesetz-buches anzusehen sind und hilfsweise für den Fall, dass der große Senat die ses verneint, ob Vertragsärzte dann jedenfalls als Beauftragte der Krankenkassen handeln. Bejaht der Große Senat die erste Frage, kommen die sogenannten Straftaten im Amte, also Vorteilsan nah me und Bestechlichkeit nach den Paragrafen 331 und 332 Strafgesetzbuch in Betracht, wird die zweite Frage be jaht, kommt der Straftatbestand der Bestech-lichkeit im geschäftlichen Verkehr nach Paragraf 299 Straf - ge setz buch in Betracht.
Nordlicht: Was bedeutet diese seltsame „hilfsweise“ Fragestellung?sterzik: Der Unterschied liegt im Wesentlichen darin, dass es für Paragraf 299 einer konkreten, auf künftige unlautere Bevor-zugung gerichteten sogenannten Unrechtsvereinbarung bedarf, während es für die Vorteilsan nahme als Amtsträger schon aus-reicht, wenn der Zuwendende mit stillschweigendem Einver-ständnis des Vertragsarztes als Empfänger dessen allgemeines Wohlwollen, Stichwort „Klimapflege“, an strebt.
Damit ist der Anwendungsbereich der Amtsdelikte, also der Paragrafen 331 ff, weiter und damit hinsichtlich der Bezie-hungen zur Pharmaindustrie sowie zu Heil- und Hilfsmittel-erbringern für den Vertragsarzt ge fährlicher. Allerdings sind die Tatbestandsbeschreibungen des Strafgesetzbuches hier un scharf, sodass im Falle eines Falles schwer prognostiziert werden könnte, ob tatsächlich nur der Straf tatbestand des Para-grafen 299 oder der Paragrafen 331 ff verwirklicht wäre. Der Strafrahmen, also bis zu drei Jah ren Freiheitsstrafe oder Geld-strafe, ist ohnehin bei beiden gleich. Falls der BGH also auch nur eine der beiden Fragen bejaht, sollte allergrößte Zurückhaltung bei der An nahme von Vergün-stigungen bzw. Zuwendungen durch Pharmafirmen oder son-stige Medizinpro duk te hersteller geübt werden; kurz gesagt: nichts annehmen!
Nordlicht: Was glauben Sie, wie der BGH entscheiden wird?sterzik: Ich hoffe, dass der Große Senat beide Fragen verneint, also dass Vertragsärzte weder Amtsträger noch Beauftragte der Krankenkassen sind, und zwar sowohl aus rechtsdogmatischen als auch aus politi schen Gründen.
Nordlicht: Was wären denn die möglichen politischen Auswirkungen?sterzik: Es ist ja nicht zu verkennen, dass die beruflichen Frei-heiten des Freiberuflers Arzt im vertragsärztli chen Bereich
P H A R M A M A R K E T I N G
Ärzten droht Anwendung des StrafrechtsEs geht um Bestechung: Eine norddeutsche Medizingerätefirma hatte ihre Geräte Arztpraxen kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug wurde von den Praxis-inhabern erwartet, dass sie Geräte dieser Firma verschreiben. Unabhängig von der Frage der medizinischen Notwendigkeit einer solchen Verordnung sehen Bundesan-waltschaft und Krankenkassen den Tatbestand der Bestechung erfüllt. Das in Kürze in dieser Sache ergehende Urteil des für Strafsachen zuständigen Großen Senats des Bundesgerichtshofes ist daher von grundsätzlicher Bedeutung und wird mit Span-nung erwartet. Was für Ärzte auf dem Spiel steht, darüber sprach das Nordlicht mit dem Justitiar der KVSH, Rechtsanwalt Klaus-Henning Sterzik.
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 31
immer weiter eingeschränkt worden sind. Auch im letzten Reformgesetz, dem GKV-VStG, sind z. B. mit der Neuregelung des Paragrafen 128 SGB V neue Einschränkungen hinzugekom-men, die die Beteiligung von Vertragsärzten an z. B. kleineren Pharmafirmen und die Vereinbarung von Privatliquidationen problema tisch machen. Wenn jetzt sogar ein höchstes deut-sches Gericht den Freiberufler Vertragsarzt in eine weitere öf fentlich-rechtliche Zwangsjacke steckt, könnte dies für den künftigen Gesetzgeber Anlass und Argumentationshilfe sein, unter Bezugnahme auf die höchste deutsche Rechtsprechung – wenn man vom Bundesverfassungsgericht absieht – die Frei-beruflichkeit des Vertragsarztes auch im geschrie benen Recht des SGB V und des darunter liegenden Normengefüges weiter einzu schrän ken.
Nordlicht: Sie nennen das Stichwort „Bundesverfassungs-gericht“. Könnte dieses denn eine Entscheidung des Großen Senates des BGH noch korrigieren?sterzik: Das käme zunächst darauf an, ob die in dem jetzigen Verfahren Angeschuldigten bzw. Angeklagten gegen ein auf der Rechtseinschätzung des Großen Senates fußendes BGH-Urteil den Weg zum Bundesverfassungs gericht wählen, was ja auch immer mit erheblichen Kostenrisiken verbunden ist. Allerdings ist mein Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht als Hüte-rin grundgesetzlich ge schützter Individualrechte in den letz-ten Jahren nicht gerade gestiegen. Was wollen Sie von einem Verfassungsge richt erwarten, das z. B. seinerzeit die 68-Jahre-Regelung für freiberufliche (!) Vertragsärzte nicht nur bestätigt, sondern sogar noch mit dem sogenannten Demenzbeschluss ver ziert hat. Im GKV-Bereich scheinen sich die höchsten deut-schen Gerichte eher der Systemerhaltung als dem Schutz ärztli-cher Berufsfreiheitsrechte verpflichtet zu fühlen.
Nordlicht: Und die von Ihnen sogenannten rechtsdogmtischen Auswirkungen?sterzik: Es könnte einer immer weitergehenden Rechtsausle-gung bzw. richterlichen Rechtsfortbildung Tür und Tor geöffnet werden, die sich zulasten der Vertragsärzte immer weiter vom geschriebenen Recht entfernt. Auch wenn der Vertragsarzt an einem öffentlich-rechtlichen Leistungs system beteiligt ist, ist er doch nicht im Sinne des Paragrafen 11 StGB dazu bestellt, Auf-gaben der öffentlichen Verwaltung wahrzunehmen. Genauso wenig ist er Beauftragter eines geschäftlichen Betriebes. Denn weder liegt seiner Verordnungstätigkeit ein Auftrag der KV zugrunde noch ist die KV als Körperschaft des öffentlichen Rechts ein geschäftlicher Betrieb. Dies entspricht auch der gängigen Kommentie rung, wonach die Tätigkeit öffentlicher Behörden jedenfalls soweit keinen geschäftlichen Betrieb darstellen, als sie als Hoheitsträger handeln. Genau Letzteres ist aber bei den Kassenärztlichen Vereinigungen der Fall. Ich sehe hier allmäh-lich die Gefahr, dass die Grenze zulässiger Gesetzes auslegung bzw. richterlicher Rechtsfortbildung überschritten wird.
Es ist ja auch nicht so, dass Vertragsärzte nicht dem normalen Strafrecht unterworfen wären. Rech net ein Vertragsarzt z. B. Leistungen ab, die er tatsächlich nicht erbracht hat und richtet dadurch einen Schaden an, kann er wegen Betruges strafbar sein. Seitdem in der Rechtsprechung und Lite ratur anerkannt ist, dass der Vertragsarzt bei der Verordnung von Medikamen-ten, Heil- und Hilfsmit teln als Sachwalter der Vermögensin-teressen der Krankenkassen anzusehen ist, kann er, wenn er
z. B. gewährte Rabatte nicht auch abrechnungsmindernd berücksichtigt, wegen Untreue strafbar sein. Allerdings war anfänglich auch sehr umstritten, den Vertragsarzt als Ver-mögenssachwalter der Krankenkassen zu bezeichnen. Aber immerhin gehört zu diesen sogenannten Vermögensstraftaten, dass bei der Krankenkasse oder je nach Fallgestaltung auch bei der KV respektive der Gesamtheit der übrigen Vertragsärzte ein finanzieller Schaden entstanden ist. Dieser Schadenseintritt mag dann ja die Sachwalterfiktion noch vertretbar erscheinen lassen. Aber mit dieser Vermögenssachwalterstellung im Wege richterlicher Rechtsfortbildung war meines Erachtens dem all-gemeinen Rechtsinteresse schon mehr als Genüge getan.
Nordlicht: Was wäre denn die Alternative gewesen?sterzik: Den Vertragsarzt eben nicht zum Vermögenssachwalter der Krankenkassen zu machen. Für eine Strafbarkeit wäre das nicht notwendig gewesen. Bezogen auf den Arzt wäre dann die Krankenkasse fremder Dritter gewesen, mit der Folge, dass dann statt der Untreue der Strafbestand des Betruges gemäß Paragraf 263 StGB verwirklicht worden wäre.
Nordlicht: Das klingt aber ein bischen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera.sterzik: Vordergründig ja, zumal der Strafrahmen bei Betrug auch noch etwas höher liegt, aber es wäre eben nicht die Spur vom Vermögenssachwalter zum Amtsträger gelegt worden.
Die damit möglichen Bestechlichkeits- bzw. Korruptionsdelikte verzichten nämlich, anders als die Vermögensdelikte Betrug und Untreue, auf einen Schadenseintritt und genau hierin liegt die Brisanz.
Nordlicht: Was kann schlimmstenfalls passieren?sterzik: Als Amtsträger würde dann jegliche Verordnung des Vertragsarztes potentiell eine „Diensthandlung“ darstellen. Ließe sich zudem im Umfeld dieser Diensthandlung eine mate-rielle oder immate rielle Zuwendung einer Pharmafirma oder eines sonstigen Dritten feststellen, wäre immer der An fangsver-dacht einer strafbaren Vorteilsnahme oder Bestechlichkeit möglich, ohne dass faktisch irgendjemand finanziell geschädigt sein müsste.
Nordlicht: Was empfehlen Sie da den Ärzten?sterzik: Wenn der BGH tatsächlich wie befürchtet entscheidet: Wie schon eingangs gesagt, größtmögliche Zurückhaltung bei der Annahme von Zuwendungen, materiell oder immateriell, wenn die Gefahr besteht, dass die Grenze des Sozialadäquaten überschritten wird. Wo diese Grenze liegt, muss vom Staatsan-walt bzw. vom Staatsgericht im Einzelfall entschieden werden und ist daher abstrakt kaum zu prognostizieren. Die einmalige Zuwendung des klassischen Kugelschreibers mit Werbeaufdruck dürfte aber sicherlich im zulässigen Bereich bleiben, während der viel zitierte kostenlose oder vergünstigte Hotelaufenthalt in landschaft lich reizvoller Umgebung zum Zwecke einer soge-nannten Fortbildungsveranstaltung der Pharma firma sicher den Bereich der Sozialadäquanz überschreitet. Auch die sogenann-ten Anwendungsbeobachtungen sind äußerst problematisch.
DAS INTERVIEW FüHRTE ESTHER RüGGEN, KVSH
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201232
Was bedeutet das für sie im Praxisalltag?Mit dem endgültigen Wegfall der Ambulanten Kodierrichtli-nien (AKR) zu Jahresbeginn werden die Funktionalitäten in Ihrer Praxisverwaltungssoftware entsprechend angepasst. Alle jetzt noch enthaltenen Informationen zu den AKR in der Software werden danach komplett herausgenommen. Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten haben stattdessen künftig die Mög-lichkeit, sich Hinweise zur Anwendung der IcD-10-GM anzeigen zu lassen. Die Nutzung dieses Service ist freiwillig. Es soll Sie weiterhin bei der Verschlüsselung von Behandlungsdiagnosen unterstützen. Somit bleibt die Praxissoftware weiterhin ein wich-tiges Medium für die korrekte Verschlüsselung von Behandlungs- diagnosen. Ihre Software bietet Ihnen weiterhin die zwischenzeit-lich gewohnte Kodierunterstützung, wenn Sie dieses wünschen. Wir haben diesbezüglich mit Ihren Herstellern in den vergange-nen Wochen gesprochen. Die Darstellung und die Funktionalität bleibt für Sie in der gewohnten Form erhalten.
Ist die korrekte anwendung der Kodierung nach ICD-10 wirklich nur für die Krankenkassen wichtig?Nun stellt sich natürlich eine berechtigte Frage: Warum ist die Kodierung von Behandlungsdiagnosen mit gesicherten IcD-10-Schlüsseln weiterhin wichtig? Die AKR ist zwar vom Tisch, aber die Verpflichtung zur Kodierung bleibt nach wie vor für alle Praxen bestehen, denn Diagnoseschlüssel haben zum einen Ein-fluss auf den Morbi-RSA und zum anderen auf die Entwicklung der MGV. Korrektes Kodieren ist somit eine wichtige Aufgabe für die Entwicklung der Vergütung. Verschlüsselt werden die Behand-lungs-Diagnosen weiterhin nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitspro-bleme, in der jeweils gültigen Fassung, kurz IcD-10-GM (2012), die bereits sei 2000 eingesetzt wird.
es besteht weiterhin ein zusammenhang zwischen Kodie-rung und geld?Insgesamt handelt es sich um ein komplexes System und die Frage ist, welchen Stellenwert hat die Kodierung von Behand-lungsdiagnosen in diesem Zusammenhang: Ärztliches Honorar ist abhängig von Geldströmen. Grundsätzlich gilt: Je mehr Versicherte mit hoher gut verschlüsselter Morbidität das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen, desto mehr Geld fließt zur Verteilung an die regionalen Krankenkassen. Das bedeutet nicht, dass gesunde Patienten nicht mehr gefragt sind. Es bedeutet nur, dass Patienten mit multiplen Erkrankungen ein hohe Morbidität aufweisen und
durch korrekte Diagnosekodierung einen höheren Geldfluss an die Krankenkassen nach Schleswig-Holstein verursachen. Durch die erfolgten Anpassungen in den Praxisverwaltungssystemen werden Sie bei der Wahl der richtigen Behandlungsdiagnose unterstützt. erhalten die Krankenkassen bei einer Kodierung nach „altem stil“ im umkehrschluss nun weniger geldmittel aus dem gesundheitsfonds, weil die Kodierung ungenügend ausge-führt wird? Das wäre durchaus möglich. Die Tragweite der IcD-Kodierung wird schon in 2013 bei der Steigerung der MGV greifen. Es gibt also eine direkte Beziehung zwischen ärztlichen Diagnosen, Gesamtvergütung und Einnahmen der Krankenkassen.
Welche Hilfen erfolgten bisher von der seite der KvsH?Bisher wurde im „Nordlicht“ eine Reihe von Kodierhilfen in Abstimmung mit Vertretern der Berufsverbände veröffentlicht. Bisher sind erschienen:• Diabetes mellitus Typ 1 und 2• Asthma/cOPD• Koronare Herzerkrankungen• Entzündlich-rheumatische Erkrankungen• Hauterkrankungen• Aktuell in diesem Heft: chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
Weitere Kodierhelfer• Zi-Hausarzt- bzw. Facharztthesauri als Kitteltaschenversion
bzw. Schreibtischauflage (bisher erschienen für Hausärzte, Orthopäden und Urologen). Weitere sind in Vorbereitung und werden Ihnen von der KVSH bereitgestellt.
• IcD-10-Browser als Suchmaschine ist über die Homepage der KBV zu erreichen.
• Zi-Kodier-Hilfe www.zi-berlin.de
Entscheidend bei der Kodierung ist jedoch die Nutzung der Praxis-waltungssoftware. Die Programme sind auf jeden Fall in der Lage, die Vertragsärzte und Vertragstherapeuten bei der Kodierung weiterhin zu unterstützen. Es kommt lediglich auf den Schalter an: „An“ oder „Aus“. Die KVSH plädiert für „AN“.
cHRISTIANE REUTER, TIMO RIcKERS, KVSH
A M B U L A N T E K O D I E R R I c H T L I N I E N
Ein Gesetz und seine WirkungMit dem Versorgungsstrukturgesetz ist zwar die Vorgabe zur Vereinbarung von Ambulanten Kodierrichtlinien (AKR) auf Bundesebene entfallen, die Verpflichtung zur Kodierung nach der ICD-10-GM aber bleibt weiterhin bestehen. Das richtige Kodieren bleibt also auch nach dem Wegfall der AKR wichtig.
ICD-10-GMIICCCCDICCCCDICCCDDDD 110000 GGGGMMMDDD---1110000---GGGMMMDDD-111000--GGGMMMMMMMIICCDDDD 11000 GGGMMMMIICCCCCCCDDDDDDDDD 111111000000 GGGGGGGMMMMMMMMMMMM
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 33
Hinweise zur Handhabung der Kodierhilfe• Die übersicht soll als Arbeitshilfe dienen und enthält nur einen Ausschnitt aus dem Diagnosespektrum der IcD-10-GM 2012.
KodierhilfeChronisch-entzündliche Darmerkrankungen
Klug kodierenleicht gemacht
i
allgemeine Hinweise zur Diagnosedokumentation• Erfassung aller Behandlungsdiagnosen in der
Abrechnungssoftware• Alle Diagnosen sind mit der IcD-10-GM so spezifisch
wie möglich zu kodieren
• Diagnosen, die gesichert sind, mit dem Zusatz „G“ verschlüsseln
• Kodierung dem Verlauf/Schweregrad der Erkrankung anpassen
Ko
die
rh
ilfe
Sa
mm
elex
emp
lar
6 c
hr
on
isch
-en
tzü
nd
lich
e d
ar
mer
kr
an
ku
ng
en
ICD-10-gM 2012
Morbus Crohn (enteritis regionalis)
1.-3. stelle 4. stelle 5. stelle
K50
.0 crohn-Krankheit des Dünndarms
.1 crohn-Krankheit des Dickdarms
.8 Sonstige crohn-Krankheit 0 crohn-Krankheit des Magens
1 crohn-Krankheit der Speiseröhre
2 crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend (crohn-Krankheit sowohl des Dünn- als auch des Dickdarms)
8 Sonstige crohn-Krankheit
.9 crohn-Krankheit, n.n.b.
Colitis ulcerosa
1.-3. stelle 4. stelle
K51
.0 Ulzeröse (chronische) Pankolitis
.2 Ulzeröse (chronische) Proktitis
.3 Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis
.4 Inflammatorische Polypen des Kolons
.5 Linksseitige Kolitis
.8 Sonstige colitis ulcerosa
.9 colitis ulcerosa, n.n.b.
sonstige nichtinfektiöse gastroenteritis und Kolitis
1.-3. stelle 4. stelle 5. stelle
.0 Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung
.1 Toxische Gastroenteritis und Kolitis (Das toxische Agens kann zusätzlich verschlüsselt werden)
.2 Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis (durch Nahrungsmittelallergie)
K52 .3 colitis indeterminata 0 Pancolitis indeterminata
1 Linksseitige colitis indeterminata
2 colitis indeterminata des Rekto-sigmoids
8 Sonstige colitis indeterminata
.8 Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis (inkl. Kollagene Kolitis, Lymphozytäre Kolitis)
.9 Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, n.n.b.
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201234
Weitere mögliche Komplikationen/Erkrankungen
Beispiel 1Ein Patient klagt seit mehreren Wochen über Durchfall und Bauchschmerzen einhergehend mit Gewichtsver-lust. Das Blutbild weist Entzündungswerte (erhöhtes cPR) auf. Es wird weitere Diagnostik (Sonographie, Koloskopie) durchgeführt und ein Morbus crohn des Dickdarms und des Dünndarms festgestellt.
Behandlungsdiagnose:K50.82 G Sonstige crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend
Beispiel 2Ein Patient weist die typischen Symptome einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung des Dick-darms auf. Die Diagnostik inkl. Koloskopie lässt keine eindeutige Unterscheidung zwischen Morbus crohn und colitis ulcerosa zu.
Behandlungsdiagnose:K52.30 G Pancolitis indeterminata
eigene notizen
Reizdarmsyndrom K58.-
Megakolon K59.3
Arthritis bei Morbus crohn M07.4*
Arthritis bei colitis ulcerosa M07.5*
Dickdarm-/Dünndarmstenose K56.6
Darmfistel (enterokutane Fistel) K63.2
Analfistel (perianale Fistel) K60.3
Rektalfistel K60.4
Vesikointestinalfistel N32.1
Gallensäure Verlustsyndrom K90.8
Alimentärer Zinkmangel E60
Eisenmangel E61.1
Osteoporose bei sonstigen andernorts klassifizierten Krankheiten
M82.8*
Erythema nodosum L52
Pyoderma gangraenosum L88
Stomatitis ulcerosa K12.1
Eisenmangelanämie D50.-
Sonstige B12-Mangelanämie D51.8
Sonstige Folsäure-Mangelanämie D52.8
Immunkompromittierung u. a. durch Steroide, Immunsuppressiva oder Biologika
D90
Infektion des Verdauungstraktes durch Zytomegalieviren
B25.80†
Virusbedingte Darminfektion n.n.b. A08.4
Bakterielle Darminfektion n.n.b. A04.9
Paralytischer und mechanischer Ileus ohne Hernie K56.-
Darmabzess K63.0
Sonstige Sepsis A41.-
Peritonitis K65.-
Energie- und Eiweißmangelernährung mäßigen und leichten Grades
E44.-
Sonstige Vitaminmangelzustände E56.-
ICD-10-Kode
Bauch- und Beckenschmerzen R10.-
übelkeit und Erbrechen R11
Sonstige Stuhlveränderungen (auch okkultes Blut im Stuhl)
R19.5
Kachexie R64
Koloskopie Darmkrebsvorsorge Z12.1
Funktionelle Diarrhoe K59.1
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 35
S E R V I c E
Sie fragen – wir antwortenanTworTEn dEs sErVIcE-TEamsAuf dieser Seite gehen wir auf Fragen ein,
die dem Service-Team der KVSH immer wieder gestellt werden. Die Antworten sollen Ihnen helfen, Ihren Praxisalltag besser zu bewältigen.
Wenn der Arzt einen Hausbesuch macht und nicht aus der Praxis, sondern von seinem Wohnort aus losfährt, wird dann das Wege-geld ab Wohnort angesetzt?
Nein, das Wegegeld wird immer ab Praxis gerechnet, unab-hängig davon, von wo der Hausbesuch tatsächlich gestartet wird.
Vor einiger Zeit haben wir zur Kennzeich-nung der eigenen Patienten im Organisier-ten Bereitschaftsdienst immer die Pseudo-GOP 99899 angesetzt, nun lässt sich diese Ziffer nicht mehr in den PC eintragen, gibt es die 99899 nicht mehr?Die Kennzeichnung mit der Pseudo-GOP 99899 ist entfallen.
Ein Patient, der schon die neue elektro-nische Gesundheitskarte besitzt, kommt mit einer Überweisung zu uns, die noch mit der alten Versichertenkarte ausgestellt wurde. Die Versichertennummer hat sich geändert. Ist die Überweisung gültig oder muss eine neue angefordert werden?Diese überweisung hat Gültigkeit und kann unabhängig vom Wechsel der Karten verwendet werden. In der Software gibt es die Möglichkeit die neue Versichertennummer zusätzlich zu der Alten einzutragen.
Nimmt auch die Polizei am DMP-Diabetes-Vertrag teil?
Nein, die Polizei Schleswig-Holstein nimmt am DMP Diabetes-Vertrag nicht teil, das heißt, Patienten die über die Polizei versichert sind, können nicht ins DMP-Diabetes eingeschrieben werden. Anders verhält es sich mit der Bundespolizei, diese nimmt
eingeschränkt am Vertrag teil, es können alle Zif-fern außer Erst- und Folgedokumentation abgerechnet
werden. Erst- und Folgedokumentation müssen nicht erstellt werden und die Patienten müssen nicht eingeschrieben werden.
Wie werden Arbeitsunfälle abgerech-net? Dürfen wir als nicht Durchgangsärzte (D-Ärzte) die Erstversorgung machen?Jeder Arzt darf die Erstversorgung eines Arbeitsunfalls erbringen, wenn eine sofortige Behandlung erforderlich ist. Dies muss von der Erstversorgenden Praxis dann bei der zuständigen Berufsge-nossenschaft gemeldet und auch über diese abgerechnet wer-den. Die Weiterbehandlung muss über den D-Arzt erfolgen.
Das Service-Team erreichen Sie unter der Rufnummer 04551 883 883• montags bis donnerstags von 8.00 bis 17.00 Uhr• freitags von 8.00 bis 14.00 Uhr
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201236
Die Natur liegt in Bunsoh quasi gleich vor der Haustür: Bis zum Nord-Ostsee-Kanal fährt man nur zwei Kilometer. Direkt nach dem Ortsschild fällt der Blick auf das großzügige, reetgedeckte, kombi-nierte Praxis-Wohnhaus von Dr. Ute Lang. Die 60-Jährige Ärztin für Allgemeinmedizin, die zwei Semester Architektur studierte, bevor sie im Losverfahren endlich den heiß ersehnten Studienplatz in Medizin erhielt, hat es 1996 selbst entworfen. Das Haus verfügt im Erdgeschoss über neun Räume mit insgesamt 160 Quadratme-tern Praxisfläche. Es gibt zwei Sprechzimmer, einen großen Emp-fangsbereich und ein attraktives Wartezimmer. Im ersten Ober-geschoss bietet es noch einmal 130 Quadratmeter Wohnfläche.
BehandlungsschwerpunkteDr. Ute Lang gründete ihre Praxis 1993 neu und baute sich danach einen eigenen Patientenstamm auf. Der Altersdurchschnitt ihrer Patienten liegt lediglich bei ca. 45 Jahren und sie hat neben den „normalen“ hausärztlichen Fällen wegen des Arbeitsschwer-punktes „Diagnostik und Therapie von Borreliose „sehr viele Patienten, die auch von sehr weit her kommen, um sich von ihr behandeln zu lassen. Neben der allgemeinärztlichen Arbeit bietet sie eine vertiefte Behandlung im psychotherapeutischen Bereich und in Akupunktur. Außerdem gibt es Patientenkurse zu
den Themen „Autogenes Training für Erwachsene und Kin-der“, „Gesunde Ernährung und Abnehmen mit LOGI“ und „Kreisgymnastik im Sommer“ an.
Landarzt-Lehrpraxis„Obwohl ich ein sehr temperamentvoller Mensch bin, kann der Studierende bei uns ohne große Hektik lernen und arbeiten“, erklärt Dr. Ute Lang, die vor Jahren aus München nach Schleswig-Holstein kam und ihr Herz an Land und Leute verlor. „Jeder Patient wird hier ganzheitlich betrach-tet und wir legen großen Wert auf die Klärung auch kompli-zierter gesundheitlicher Zusammenhänge.“ Die Praxis ver-fügt über ausführliche und moderne Nachschlagewerke. Die Lehrärztin bietet umfassende und ungeschminkte Ein-blicke in das Know-how einer Arztpraxis sowohl auf orga-nisatorischem wie auch auf kaufmännischem Gebiet. Die Studierenden werden in Diagnostik und Therapieplanung einbezogen und können eigenständig mitarbeiten.
vom Beruf überzeugtFür Dr. Ute Lang liegen die Vorteile, Lehrpraxis für Allge-meinmedizin zu sein, auf der Hand. Sie hat selbst großes Interesse am Lehren und Lernen und sieht es als wich-tigen Vorteil an, dass ihr eigener Kenntnisstand durch den Informationsaustausch mit Studenten oder Assistenten
up to date bleibt. “Ich möchte gern mit meiner Einstellung zum Beruf der Landärztin Vorbild sein, Engagement und Patientenzu-wendung vorleben und den Nachwuchsmedizinern zeigen, dass es sehr befriedigend ist, mehr zu geben.“ Ein positives Feedback der Patienten ist dabei ihr Schutz vor Burn-out. Doch sie ist auch „überzeugungstäterin“. Ihr aktueller PJ-Student fomulierte es so: „Land- und Hausarzt zu sein bedeutet ihr weit mehr als wirt-schaftliche Unzufriedenheit, sondern ist Berufung und Belohnung zugleich“. Dr. Ute Langs überzeugung ist wohl ansteckend, denn sie konnte bereits ihren ersten Lehrstudenten, der am Anfang noch unbedingt Anästhesist werden wollte, zum „Landarztdasein“ bekehren.
JAKOB WILDER, KVSH
Landärztin aus ÜberzeugungIn Bunsoh in der Lehrpraxis von Dr. Ute Lang finden die Studierenden „ Landarzt-Romantik“ pur. Das malerische Bauerndorf zwischen Albersdorf und Rendsburg hat nur knapp 1.000 Einwohner. Es gibt eine kleine Grundschule, einen Kindergarten und ein Natur-Schwimmbad mit Quellwasser.
AKA
DEMISCHE LEHRPRAXEN
HO
CHSCHULSTANDORTE • K
IEL •
LÜ
BEC
K
sie haben Interesse, selbst Lehrpraxis für allgemeinmedizin zu werden?
Information zu Kriterien und Anmeldung:Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-HolsteinJakob Wilder, Gesundheitspolitik und KommunikationTel. 04551 883 475, E-Mail [email protected]
L E H R P R A x E N A L L G E M E I N M E D I Z I N
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 37
Angesichts des Ärztemangels insbesondere in strukturschwa-chen und ländlichen Gebieten liegt ein Fokus auf Netzwerkakti-vitäten von Regionen, Kreisen und Kommunen zur Organisation der Versorgung. Die dreitägige Veranstaltung dient als Plattform für den direkten Austausch zwischen Ärzten und Psychothera-peuten, Krankenkassen und Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung. Sie können sich auf der Messe einen überblick über das Angebot in diesem Bereich verschaffen, Kontakte knüpfen, Kooperationen schließen oder auch Verträge anbahnen. Koopera-tionspartner ist die Agentur deutscher Arztnetze.
Programmhighlights Veranstaltungsort ist das dbb forum berlin in Berlin-Mitte. Den Auftakt bildet am 27. Februar eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Demographischer Wandel und wohnortnahe Versorgung“. Die Ausstellung, bei der sich rund 30 Projektträger an Informati-onsständen mit ihren Versorgungsprojekten präsentieren, findet am 28. und 29. Februar statt. Parallel zur Ausstellung wird ein Rahmenprogramm mit Debatten, Fachforen und Vorträgen ange-boten: So startet der 28. Februar mit einem Impulsdialog zwischen dem Vorstandsvorsitzenden der KBV, Andreas Köhler und Bundes-gesundheitsminister Daniel Bahr. Darüber hinaus sind die wohn-ortnahe Versorgung in Ärztenetzen sowie die Rolle von Gesund-heitsregionen Themen am zweiten Veranstaltungstag. Weiterer Höhepunkt an diesem Tag ist eine Diskussionsrunde zur Arznei-mittelsteuerung durch das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG).
FachtagungAm 29. Februar geht es in medias res: Zum einen findet eine Fachtagung der Medizingeografen statt, zum anderen werden in Fachforen der rechtliche Rahmen bei Delegation, Zuweisung und Kooperation erörtert sowie IT-Anforderungen und Lösungen diskutiert. Beispiele indikationsbezogener Kooperationen und die Möglichkeiten strukturierter Kooperation zwischen den Gesund-heitsberufen runden das fachliche Themenspektrum des dritten und letzten Veranstaltungstages ab, der mit einer gesundheitspo-litischen Diskussionsrunde schließen wird.
anmeldungBesucher können sich über die Internetseite www.versorgungs-messe.net zur Messe anmelden: Dort steht ein Online-Anmelde-formular für die Veranstaltungsbuchung zur Verfügung. Ausführ-liche Informationen zum Programm, den Ausstellern und den Referenten ebenfalls unterwww.versorgungsmesse.net
KASSENÄRZTLIcHE BUNDESVEREINIGUNG (KBV)
Marktplatz für Innovationen K B V - V E R S O R G U N G S M E S S E
Vernetzte wohnortnahe Versorgung ist das Schwerpunktthema der diesjährigen KBV-Versorgungsmesse. Sie findet vom 27. bis 29. Februar 2012 in Berlin statt.
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201238
aufgabenschwerpunkteDas ÄZQ ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesärztekam-mer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und besteht seit 15 Jahren. Der Leiter, Prof. Dr. Günter Ollenschläger, gab in seinem Impulsreferat einen überblick über die Aufgabenbereiche des Zentrums. Die Aufgabenschwerpunkte des ÄZQ liegen unter anderem in den Bereichen• Entwicklung und Implementierung Nationaler Versorgungs-
leitlinien• Entwicklung von Patienteninformationen• Patientensicherheit/Fehlervermeidung in der Medizin• Qualitätsmanagement in der Medizin• Evidenzbasierte Medizin• Wissensmanagement und Wissenstransfer im Gesundheits-
wesen• Wissensportal Arztbibliothek
Natürlich konnten nicht alle Themen ausführlich behandelt wer-den. Die Themen wurden von Moderatoren bestimmt. Die Refe-renten stellten sich auf die Anregungen aus Schleswig-Holstein ein. Alle oben genannten Gebiete können auf der Homepage www.azq.de weiter vertieft werden.
Hier ist besonders das „Wissensportal Arztbibliothek“ www.arzt-bibliothek.de zu empfehlen. Dort kann man Leitlinien und Pati-enteninformationen direkt abrufen. Diese Patienteninformationen sind frei von Interessensteuerung der Pharmaindustrie, werden vom ÄZQ fachlich geprüft und können unbedenklich in den Praxen
eingesetzt werden. Natürlich können Patienten auch direkt auf diese Seiten verwiesen werden.
Die Leitlinien, die bisher entwickelt worden sind, haben in den ärztlichen Alltag noch recht zögerlich Einzug gehalten – das liegt einerseits am Umfang der meisten Leitlinien, andererseits an der Problematik des Zugangs (z. B. in der Praxis während der lau-fenden Sprechstunde), und drittens an der schlechten Anwend-barkeit auf den ja immer sehr individuellen Einzelfall (Alter, Geschlecht, Komorbiditäten, Komedikationen und andere mehr).
Ollenschläger betonte die Notwendigkeit, diese Leitlinien und Patienteninformationen aus der Ärzteschaft zu entwickeln, damit einerseits das Wissen der Basis und damit auch die Alltagstaug-lichkeit dieser Informationen gegeben ist, und andererseits damit auch die Akzeptanz der entwickelten Endprodukte in der Ärzte-schaft zu stärken. Um diesen Weg ein gehöriges Stück voranzu-treiben, hatten sich seine Kolleginnen und er auf den Weg von Berlin nach Bad Segeberg gemacht.
Leitlinien im FokusEin hochkarätiges Referententeam vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) aus Berlin informierte auf dem Qualitätszirkel-Moderatorentreffen in der KVSH.
Q U A L I T Ä T S S I c H E R U N G
KVSH Vorstandsvorsitzende Ingeborg Kreuz, Dr. Susanne Weinbrenner, Dr. Sabine Schwarz, Prof. Dr. Dr. Ollenschläger
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 39
LeitlinienNach diesem Impulsreferat mit anschließender intensiver und engagierter Diskussion folgte als Referentin Dr. Susanne Weinbrenner, die über den Entwicklungsprozess der kürzlich ver-öffentlichten Nationalen Versorgungsleitlinie „Kreuzschmerz“ berichtete. Der Entwicklungsprozess hat insgesamt fast vier Jahre Zeit in Anspruch genommen. Es waren fast 30 Teilnehmer (unter anderem Hausärzte, Gebietsärzte, Physiotherapeuten) in die Leit-linienerstellung eingebunden. Leitlinien sollten als • Entscheidungshilfe und als• „Handlungskorridor“gesehen werden. Man sollte diese Leitlinien kennen und sie beachten. Man muss sich aber nicht in jedem Einzelfall „sklavisch“ daran halten. In vielen Fällen gibt es zum Beispiel Kontraindika-tionen gegen bestimmte Medikamente, sei es durch Unverträg-lichkeiten, sei es durch befürchtete Interaktionen mit anderen Therapeutika, weswegen ein Abweichen von der Leitlinie sinnvoll ist. Wichtig ist in diesem Fall lediglich eine ausreichende Doku-mentation der Gründe für das Abweichen in der Patientenakte. Die Leitlinie „Kreuzschmerz“ ist im Portal „Arztbibliothek“ zugäng-lich. Sie umfasst in der Vollversion 200 Seiten – was für den Praxi-salltag wesentlich zu umfangreich ist. Selbst die „Kurzfassung“ hat noch 65 Seiten, von denen immerhin ca. 55 Seiten Text umfassen. Eine gute, übersichtliche Fassung kann man meines Erachtens in dem Artikel von J. chenot und A. Becker im Juni-Heft des Jahres 2011 der Zeitschrift für Allgemeinmedizin (www.online-zfa.de/article/die-nationale-versorgungsleitlinie-kreuzschmerzen/uebersicht-review/2011/06/1410) nachlesen.
Leider gibt es Studien, die zeigen, dass die Inhalte vieler Leit-linien wohl gut bekannt sind (Bekanntheitsgrad bei ca. 80 Pro-zent), dass sie aber in deutlich geringerem Maße angewandt werden (nur zu ca. 60 Prozent), und dass sie noch seltener in den Praxis-Routinebetrieb übergegangen sind (nur noch zu ca. 40 Prozent). Es scheint sich aber ein Wandel zu vollziehen. Während es früher sinnvoll und ausreichend war, pro Fach ein ausführliches Fachbuch gelesen, verstanden und behalten zu haben, ist es bei dem massiven Wissenszuwachs und den heute üblichen „Multiautoren-Publikationen“ selten noch möglich, ein in sich stimmiges, didaktisch geeignetes und ausreichend langes aktuelles Werk zu erhalten.
In der „Generation Google“ wird das erforderliche Wissen ohne-hin entweder auf dem Desktop oder via Smartphone online abge-fragt. Diese elektronische Wissensvermittlung hat zweifelsfrei den Vorteil der größeren Aktualität, birgt aber die Gefahr, dass eine gegebenenfalls interessengesteuerte Information nicht so einfach identifiziert werden kann wie z. B. in den „Streuzeitschrif-ten“, die wir alle zuhauf in die Praxis geliefert bekommen. Dort fällt es schon eher auf, wenn der Artikel zu einer neuen Thera-pieoption auf der gegenüberliegenden Seite durch eine entspre-chende Werbung „begleitet“ wird. Auch dieses Referat wurde wieder intensiv und teilweise kontrovers diskutiert. Dabei ergab sich eine so angeregte Aussprache, dass erwogen wurde, dieses Thema – gewissermaßen im Sinne eines konstruktiven Diskurses – als eigenständige Veranstaltung in diesem oder einem ähnlichen Kreis im kommenden Jahr aufzugreifen.
PatienteninformationenAls zweites inhaltliches Referat folgte dann die Darstellung von Dr. Sabine Schwarz aus dem ÄZQ über die bisher vorliegenden Pati-enteninformationen (unter www.arztbibliothek.de zu finden).
Es gibt die in der Berufsordnung verankerte Pflicht des Arztes und das Recht des Patienten zur Aufklärung. Nicht immer möchte der Patient dieses Recht in extenso wahrnehmen – bei einem harm-losen Husten will nicht jeder einen halbstündigen Vortrag über Gründe, mögliche Komplikationen und leitliniengerechte Therapie dieser Erkrankung hören. Die meisten Patienten erwarten primär, dass es ihnen bald wieder besser geht …
Wenn aber durch Änderung des Lebensstiles eine Mitwirkung des Patienten erforderlich ist, um entweder die Krankheitsdauer abzu-kürzen oder die Notwendigkeit der Medikamentengabe zu redu-zieren, dann ist es häufig so, dass diese Ratschläge in der Praxis zwar gehört werden, spätestens 500 Meter nach dem Verlassen der Praxis aber wieder vergessen sind. Hier helfen Informations-materialien, die entweder schriftlich (in Papierform) oder elektro-nisch (via Internet) dem Patienten verfügbar gemacht werden.
In vielen Praxen werden schriftliche Informationsmaterialien vor-gehalten – besonders die Unterlagen z. B. zur Aufklärung vor Ope-rationen. Es gibt aber auch viele Ratgeber, die Tipps zur Selbsthilfe z. B. bei Befindlichkeitsstörungen geben. Oft werden diese Rat-geber von pharmazeutischen Firmen herausgegeben, wobei das Logo dieser Firmen auf dem Deckblatt oder der Rückseite noch das geringste Problem darstellt. Diese Firmen haben durch die oft nicht objektive Darstellung in diesen Ratgebern immer wie-der versucht, ihre eigenen Präparate als einzig hilfreiche Therapie darzustellen. Das wurde bemerkt und kritisiert, seither ist man etwas „dezenter“ geworden.
Nicht dezent ist man bei der Beeinflussung z. B. von Selbsthil-fegruppen, die in vielen Fällen massive Unterstützung seitens der pharmazeutischen Industrie erhalten. Dort werden teilweise interessengesteuerte Falschinformationen gestreut, gegen die wir in der Ärzteschaft nahezu machtlos sind. Diesem Defizit will das ÄZQ entgegensteuern, indem es die Patienteninformationen und -ratgeber prüft und auf die wissenschaftlich wirklich bewiesenen Fakten reduziert. Diese Informationen sollen über das Internet, aber auch über die Arztpraxen bekannt gemacht werden und sich so – gewissermaßen im „Verdrängungswettbewerb“ – gegen die unseriösen Informationsbroschüren in der Patientengunst durch-setzen.
Nach ausgiebiger Diskussion auch dieses Referates konnte man anhand des starken Interesses der Anwesenden auf weiteren Bedarf an Informationen und Aussprachemöglichkeiten zu diesen Themen schließen. Es wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2012 eine Fortsetzung geben – Termine und Themengebiete wer-den rechtzeitig veröffentlicht.
Leitlinien für Patienten, die aktuellste zum thema KreuzschmerzUnter www.versorgungsleitlinien.de/patienten/kreuz-schmerzinfo stehen jetzt neue Informationen für Patienten bereit: Die ausführliche PatientenLeitlinie „Kreuzschmerz“ und die beiden Kurzinformationen „Akuter Kreuzschmerz“ und „chronischer Kreuzschmerz“ vermitteln in verständlicher Form, was Kreuzschmerzen sind, wie sie entstehen können und wie sie behandelt werden. Auf der Grundlage der ausführlichen PatientenLeitlinie wurden zusätzlich zwei Kurzinformationen erar-beitet, die nun ebenfalls im Internet zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen.
PROF. DR. JENS-MARTIN TRÄDER, ALLGEMEINMEDIZIN, LüBEcK
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201240
N E U E S A M M E L E R K L Ä R U N G
Alles auf GrünFür das 1. Quartal 2012 gibt es eine neue Sammelerklärung. Das Formular ist übersichtlicher und anwenderfreundlicher.
Was ist neu? Was hat sich geändert?
Kennzeichnung der abgerechneten Leistungen Präzisierung zur Dokumentation der alleinigen Leistungserbringung: Ab sofort ist hier nur dann ein Eintrag erforderlich, wenn ange- stellte Ärzte, Ärzte in Weiterbildung oder Entlastungsassistenten tätig waren.
ergänzende erklärung aufgrund verschie- dener Bestimmungen zum eBM Aufnahme zur Abrechnungsbestätigung der Pauschale für konservative Augenärzte (GOP 06225)
Wegfall der tagesbezogenen angaben zum ärztlichen Bereitschaftsdienst Der Arzt bestätigt ab sofort ausschließlich die Teilnahme am ärzt- lichen Bereitschaftsdienst.
Alles was Sie zum korrekten Ausfüllen der Sammeler-klärung/Online-Sammelerklärung beachten müssen, finden Sie in unserer neuen Ausfüllhilfe. Im Online-bereich, unter www.ekvsh.de, haben wir für jeden Vertragsarzt und Psychologischen Psychotherapeuten das persönliche und im Quartal gültige Online-Exem-plar bereits hinterlegt. Das Programm unterstützt Sie beim korrekten Ausfüllen der Sammelerklärung. Durch die Hinterlegung im Online-Portal haben Sie zudem eine Kopie der Sammelerklärung für Ihre Unterlagen.
Einen Leitfaden als Ausfüllhilfe gibt es im Internet unter www.kvsh.de/Praxis/abrechnung oder im Online-Portal www.ekvsh.de
THOMAS STEFANIW, TIMO RIcKERS, MIcHAEL VENEMA, KVSH
alle wichtigen nummern auf einen Blick
Fragen zum ausfüllen Tel. 04551 883 294
technische Fragen zum online-Portal Tel. 04551 883 888
sonstige Fragen zur sammelerklärung Tel. 04551 883 535
Internet, Portal: www.kvsh.de
Kv safenet: www.ekvsh.kv-safenet.de
e-Mail: [email protected]
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 41
F O R M U L A R E
Keine Angst vor der TodesbescheinigungDas Ausfüllen des Formulars „ Todesbescheinigung“ hat so seine Tücken. Wir wollen Ihnen deshalb eine kleine Anleitung an die Hand geben, damit Sie unnötige Fehler vermeiden und nicht den Überblick verlieren.
Die Mappe „Todesbescheinigung“, die der Dokumentation der Leichenschau dient, enthält neben dem eigentlichen Formular zwei Umschläge. Das Formular selbst gliedert sich in einen ver-traulichen und einen nichtvertraulichen Teil. Der vertrauliche Teil liegt in vierfacher Ausfertigung vor. Am Anfang des Formulars steht der Block mit den persönliche Daten. Haben Sie die Patien-tendaten eingetragen, müssen Sie den vertraulichen Teil abtren-nen, da sich der nichtvertrauliche Teil, der auf der ersten (weißen) Seite erscheint, vom Aufbau des vertraulichen Teils unterscheidet. Ein Durchschreiben ist nicht erwünscht.
„geheimnisse“ der FormularmappeDer nichtvertrauliche Teil erfasst allgemeine Informationen zur Identifikation des Toten, Sterbeort und Todeszeitpunkt, epidemio-logische und andere Warnhinweise sowie die Angabe zum „natür-lichen“ oder „unnatürlichen Tod“. Aufgepasst: Das Formular bietet nur die Möglichkeit, einen „natür-lichen“ oder einen „unnatürlichen Tod“ zu attestieren. Die Ent-scheidung ist an dieser Stelle nicht immer ganz leicht. Sie sollten aber keine Angst vor dem Ankreuzen des „unnatürlichen Todes“ haben. Wenn auch nur der kleinste Hinweis darauf besteht, dass irgendetwas nicht stimmt, kreuzen Sie bitte den „unnatürlichen Tod“ an.
Auf den anderen vier Seiten finden Sie den vertraulichen Teil der Todesbescheinigung. Er ist kompliziert, aber auch sehr wichtig. über die Angaben zum behandelnden Arzt und die Dokumenta-tion der sicheren Todeszeichen müssen Sie hier die Todesursache in Form einer Kausalkette vom Grundleiden bis zur unmittelbaren Todesursache dokumentieren. Die Kausalkette ist im Formular von unten nach oben aufgebaut, sodass Sie in der obersten Zeile die unmittelbare Todesursache angeben müssen und in der letzten Zeile das Grundleiden. Natürlich kann bei einer bloßen Leichen-schau nicht immer eine sichere Todesursache gefunden werden.
Aussagen wie „Verdacht auf ...“ oder „mögli-cherweise ...“ sollten Sie allerdings trotzdem nicht wählen, da sie bei der Zusammenstellung der Todesursachenstatistik ohnehin nicht berück-sichtigt werden. Ziehen Sie also, wenn nichts Genaues bekannt ist, die Angabe „Todesursa-che unbekannt“ einer vagen Spekulation vor. Wenn Sie alles eingetragen haben, müssen Sie jede Seite noch unterschreiben und abstem-peln. Der nichtvertrauliche Teil sowie das graue Blatt 1 des vertraulichen Teils im verschlossenen grauen Umschlag verbleibt bei den Angehöri-gen. Das blaue Blatt 2 ist gegebenenfalls dem Obduzenten zuzuleiten. Das gelbe Blatt 3 des Formulars soll im gelben Umschlag unmittelbar an der Leiche verbleiben. Das rosafarbene Blatt 4 ist die Ausfertigung für den die Leichenschau durchführenden Arzt.
Weitere InformationenSeit Mitte 2011 gibt es geänderte neue Formu-lare zur Todesbescheinigung, die die ab Januar 2011 gültigen Todesbescheinigungen abgelöst
haben. Neu ist, dass für die Uhrzeit des Sterbezeitpunktes bzw. der Leichenauffindung jetzt vier Kästchen vorhanden sind. Das weitere Ausfüllen des nichtvertraulichen Teils ist außerdem auf den unteren Abschnitt der Seite verlagert worden, damit man deutlicher auf das vorherige Trennen der Seiten aufmerksam gemacht wird. Eventuell noch vorhandene Formulare vom Januar 2011 dürfen nur noch bis zum 31. Dezember 2012 verwendet werden. Die Todesbescheinigung können Sie unter anderem über den W. Kohlhammer Deutscher Gemeindeverlag GmbH beziehen, Postfach 18 65, 24017 Kiel, Tel. 0431 554857, Fax 0431 554944, E-Mail dgv-kiel@ kohlhammer.de
JAKOB WILDER, KVSH
verpackung der todesbescheinigung
nic
htv
ertr
auli
cher
tei
l
vertraulicher teil (4×)
grau
grau
Blau gelb rosa
gelb
arztverbleibt bei der Leiche
gegebenenfalls an den obduzenten
angehörige
Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 3
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201242
Fachgebiet/arztgruppe Planungs bereich* Praxisform Bewerbungs frist** ausschreibungs nummer
Psychotherapie Lübeck EP 29.02.2012 16068/2011
* Die Stadt Kiel und die Stadt Lübeck stellen jeweils einen Planungsbereich dar. Alle übrigen Planungsbereiche richten sich nach den Kreisgrenzen, außer der Kreisregion Stadt Neumünster/Kreis Rendsburg-Eckernförde (NMS/RD-E) und der Kreisregion Stadt Flensburg/Kreis Schleswig-Flensburg (FL/SL-FL).
** Die Bewerbungsfrist ist eine Ausschlussfrist, das heißt, es können nur Bewerbungen akzeptiert werden, die innerhalb der Bewerbungsfrist eingehen. Sollte innerhalb der Bewerbungsfrist keine Bewerbung eingehen, so gilt die Ausschreibung maxi- mal für ein weiteres Jahr. Die Bewerbungsfrist ist gewahrt, wenn aus der Bewerbung eindeutig hervorgeht, auf welche Aus- schreibung sich die Bewerbung bezieht, für welche Adresse die Zulassung beantragt wird und ein Arztregisterauszug beigefügt wurde.
Flensburg
Kiel
Lübeck
Neumünster
Dithmarschen
HerzogtumLauenburg
Nordfriesland
Ostholstein
Pinneberg
PlönRendsburg-Eckernförde
Schleswig-Flensburg
Steinburg
Stormarn
Segeberg
Lübeck
nähere Informationen zu den ausgeschriebenen Praxen erhalten sie unter folgenden telefonnummern:
04551 883 378 04551 883 291
Der Bewerbung sind ein Auszug aus dem Arztregister sowie ein unterschriebener Lebenslauf beizufügen. Ferner ist ein polizeiliches Führungszeugnis der Belegart „O“ (Behörden-führungszeugnis) zu beantragen.
Hinweis: Die Wartelisteneintragung ersetzt nicht die Bewerbung!
Bewerbungen richten Sie bitte an: KVSH, Zulassung/Praxisberatung, Bismarckallee 1-6, 23795 Bad Segeberg
Öffentliche Ausschreibung von Vertragspraxen
Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein schreibt auf Antrag von Ärzten/Psychotherapeuten deren Praxen zur Übernahme durch einen Nachfolger aus, sofern es sich bei dem maßgeblichen Planungsbereich um ein für weitere Zulassungen gesperrtes Gebiet handelt.
gemäß Paragraf 103 Abs. 4 SGB V
B E K A N N T M A c H U N G E N
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 43
Kreis DithmarschenFrau Dipl.-Psych. Petra Jasper ab 1. Oktober 2011 als Psycholo-gische Psychotherapeutin, beschränkt auf einen halben Versor-gungsauftrag, für 25704 Meldorf, 1. Breiter Weg 14, als Nach-folgerin von Herrn Dipl.-Psych. Jürgen Wiegand.
Herr Dipl.-Psych. Markus Büschges als Psychologischer Psycho-therapeut für 25746 Heide, Norderstraße 82 - 86, als Nachfolger von Herrn Dipl.-Psych. christoph groth .
stadt KielFrau Dipl.-Psych. Heike orloff als Psychologische Psycho-therapeutin, beschränkt auf einen halben Versorgungsauf-trag, für Kiel als Nachfolgerin von Frau Dipl.-Psych. Adelheid Deingruber.
Frau Andrea Fladerer, Psychologische Psychotherapeutin für die ausschließliche Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit halbem Versorgungsauftrag in 24159 Kiel, Hof Pries 2, hat ihre Vertragspraxis nach 24159 Kiel, Jägerallee 16, verlegt.
Frau carmen schweiger, ausschließlich psychotherapeutisch tätige prakt. Ärztin in 24143 Kiel, Elisabethstraße 87, hat ihre Vertragspraxis nach 24103 Kiel, Ziegelteich 14, verlegt.
stadt LübeckFrau Dr. med. Annette scheuer als ausschließlich psychothe-rapeutisch tätige Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrank-heiten, beschränkt auf einen halben Versorgungsauftrag, für 23552 Lübeck, Breite Straße 1-5, als Nachfolgerin von Frau Dr. med. Anne Bangert.
Frau Dipl.-Psych. Hermine reichert, Psychologische Psychothe-rapeutin in 23554 Lübeck, Friedhofsallee 104, hat ihre Vertrags-praxis nach 23552 Lübeck, Große Petersgrube 6, verlegt.
Frau Dipl.-Psych. claudia Duske als Psychologische Psychothe-rapeutin für 23552 Lübeck, Fleischhauerstraße 26, als Nachfol-gerin von Frau Dipl.-Psych. Dagmar schätzle.
stadt neumünsterFrau Dipl.-Psych. Manuela Bischoff gemäß Paragraf 101 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 3 Satz 1 SGB V (Job-Sharing) in Verbindung mit den Paragrafen 23a bis h Bedarfsplanungs-Richtlinie als Psychologische Psychotherapeutin für 24534 Neumünster, Großflecken 39.
Frau Dipl.-Psych. Manuela Bischoff und Frau Dipl.-Psych. Maren Hofmann, Psychologische Psychotherapeutinnen, haben die Genehmigung zur Führung einer Berufsausübungsgemeinschaft in Neumünster erhalten.
Kreis nordfrieslandHerr Detlef Bobrowski, ausschließlich psychotherapeutisch tätiger Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in 25821 Bredstedt, Kampistoft 1, hat seine Vertragspraxis nach 25821 Bredstedt, Markt 6, verlegt.
Kreis PinnebergFrau Dipl.-Psych. Sibylle Kraus, Psychologische Psychothera-peutin in 25421 Pinneberg, Osterholder Allee 7, hat ihre Ver-tragspraxis nach 25421 Pinneberg, Oeltingsallee 30, verlegt.
Frau Dipl.-Psych. Susanne reichelt, Psychologische Psycho-therapeutin in 25421 Pinneberg, Osterholder Allee 7, hat ihre Vertragspraxis nach 25421 Pinneberg, Oeltingsallee 30, verlegt.
Kreis PlönFrau Dr. med. Elli stenkamp, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit halbem Versorgungsauftrag in 24248 Mönkeberg, Quedensweg 1, hat ihre Vertragspraxis nach 24306 Plön, Seestraße 26, verlegt.
Kreis steinburgFrau Dipl.-Psych. Angelika Maib als Psychologische Psychothe-rapeutin, beschränkt auf einen halben Versorgungsauftrag, für 25379 Herzhorn, Wilhelm-Ehlers-Straße 10, als Nachfolgerin von Herrn Dr. med. christian Kramm-Freydag.
Herr Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. christoph Braukhaus, Psycholo-gischer Psychotherapeut in 25548 Kellinghusen, Brauerstraße 25, hat seine Vertragspraxis nach 25548 Kellinghusen, Fried-richstraße 2, verlegt.
Kreis ostholsteinDie bis zum 31. März 2012 befristete Ermächtigung von Frau Dr. phil. Dipl.-Psych. Susanne rahman, Psychologische Psycho-therapeutin, zur Durchführung diverser Leistungen in Neustadt, wurde bis zum 31. März 2014 verlängert.
Kreis rendsburg-eckernfördeFrau Dipl.-Psych. claudia tiefert, Psychologische Psychothe-rapeutin, Rendsburg, wurde mit Wirkung vom 24. November 2011, befristet bis zum 30. Juni 2012, für 24768 Rendsburg, Moltkestraße 4, zur Beendigung der im Rahmen des Job-Sha-rings mit Frau Hofmann, Neumünster, begonnenen Therapien bei den im Antrag namentlich benannten Patienten ermächtigt.
Folgende Psychotherapeuten wurden zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Über-weisungspraxis ermächtigt. Diese Beschlüsse sind noch nicht rechtskräftig, sodass hiergegen noch Widerspruch eingelegt bzw. Klage erhoben werden kann:
Folgende Psychotherapeuten wurden rechtskräftig zur Vertragspraxis zugelassen:
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201244
P S y c H O T H E R A P I E
Ambulante neuropsychologische Therapie wird GKV-Leistung
Zum Ende des letzten Jahres fasste der Gemeinsame Bun-desausschuss (G-BA) noch einen wichtigen Beschluss. Die ambulante Neuropsychologie soll in den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen werden. War die neuropsychologische Therapie bislang allein nur im stationären Rahmen möglich, soll sie zukünftig bei Patienten mit erworbenen Hirnschädigungen – beispielsweise nach einem Schädelhirntrauma oder einem Schlaganfall – auch ambulant durchgeführt werden können. Von den jährlich etwa eine halbe Million neurologischen Neuerkrankungen oder durch Unfallschäden beeinträchtigten Patienten, kom-men ungefähr 40.000 bis 60.000 Patienten dafür in Frage. Der Beschluss des G-BA wird jetzt vom Bundesministerium für Gesundheit geprüft und nach erfolgter Nichtbeanstandung tritt er in Kraft. Danach müssen noch Vergütungsregeln und -höhen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) festgelegt werden, damit der Beschluss dann tatsächlich die Versorgung verbessert. Zur Ausübung der neuropsychologischen Diagnos-tik und Therapie werden Fachärzte und Psychotherapeuten berechtigt sein, die über eine neuropsychologische Zusatzqua-lifikation inhaltsgleich oder gleichwertig der entsprechenden Weiterbildungsordnung verfügen.
Weitere Information: Was ist eigentlich Neuropsychologie? Nordlicht Heft 5/2006 unter www.kvsh.de Nordlicht-Archiv. Methodenbewertung: Neuropsychologische Therapie unter www.g-ba.de
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz verursachen Kosten in Milliardenhöhe
Arbeitsbedingte psychische Belastungen verursachen in Deutschland jährlich Kosten von fast 30 Milliarden Euro. Und psychische Probleme seien eine wesentliche Ursache für Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung. Dieses Resümee ziehen der Epidemiologe Dr. Bödeker (Bundesverband BKK) und der Mathematiker Friedrichs (Institut für Prävention und Gesundheitsförderung Uniklinik Essen) in einer Studie. So lau-tete eine Meldung der Hans-Böckler-Stiftung zum Jahresende (www.boeckler.de). Ähnlich lautende Meldungen tauchen immer wieder auf. Sie wecken Assoziationen wie, … Und täg-lich grüßt das Murmeltier. Wer kennt sie nicht, die Filmkomö-die mit Bill Murray und Andie MacDowell. Die Hauptfigur des Films steckt in einer Zeitschleife fest. Und das Leitthema ist die allmähliche Veränderung dieses vormals egozentrischen und zynischen Menschen, die dann letztendlich zur Befreiung aus der ewigen Wiederholung führt.
Und täglich grüßt das MurmeltierDen immer wiederkehrenden und ähnlich lautenden Mel-dungen nach steckt auch unser Gesundheitssystem in einer Art Zeitschleife fest – höchst bedauerlich und bedrohlich für die psychisch kranken und belasteten Menschen! Noch nie haben psychische Belastungen und Erkrankungen so viel Aufmerksamkeit in den Medien erfahren wie im Jahre 2011. Doch wer oder was ändert sich? Wo steckt der Zyniker? Der Gesetzgeber führt an, dass sich durch das GKV-Versorgungs-strukturgesetz alles bessert. In einer Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums ist zu lesen: „Die Versorgung der Patientinnen und Patienten wird sich maßgeblich verbes-sern.“ Aber am Jahresende kommt der Vorsitzende des größ-ten deutschen Berufsverbandes der Psychotherapeuten Dieter Best zu der Feststellung:„ Das Jahr 2011 stand ganz im Zei-chen des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes (GKV-VStG), von dem sich die Psychotherapeuten eine Verbesserung der psy-chotherapeutischen Versorgung erhofft hatten. Das Ergebnis ist Unsicherheit und eine drohende Verschlechterung, jedoch keine Verbesserung.“ Wird uns also weiterhin das Murmeltier grüßen?
Diagnosen kodieren und übermitteln!
Mit dem GKV-VStG ist zwar die verpflichtende Einführung ein-heitlicher Ambulanter Kodierrichtlinien (AKR) gestrichen wor-den. Die Systematik, nach der sich die finanziellen Mittel, die die Gesetzlichen Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds erhalten, unter anderem an bestimmten Krankheitsbildern ihrer Versicherten orientieren, bleibt jedoch erhalten. Auch der jährliche Honorarzuwachs, den einzelne Kassenärztliche Verei-nigungen erhalten können, bleibt teilweise an eine dokumen-tierte Morbidität der Versicherten gebunden. Ärzte und Psy-chotherapeuten sind aber nicht nur deswegen gehalten, ihre Diagnosen nach IcD-10 zu verschlüsseln und zu übermitteln. Honorarabrechnungsordnung der Kassenärztlichen Vereini-gung Schleswig-Holstein und das Sozialgesetzbuch verlangen, dass die an der Versorgung teilnehmenden Ärzte und Psycho-therapeuten in ihren Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen einschließlich des Tages der Behand-lung mit Diagnosen aufzuzeichnen und an die Kassenärztliche Vereinigung zu übermitteln haben (vgl. Paragraf 295 SGB V). Es geht hier auch um das nicht ganz abwegige Ansinnen, dass der Leistungsträger – in diesem Fall eine gesetzliche Versiche-rung – ein Anrecht darauf hat, zu erfahren, wofür er bezahlt. Im Bereich der privaten Krankenversicherungen gilt dieses ebenfalls.
HEIKO BORcHERS, PSycHOLOGIScHER PSycHOTHERAPEUT,
KINDER- UND JUGENDLIcHENPSycHOTHERAPEUT, KIEL
Aktuelles aus der Psychotherapie
praxIs & KV
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 45
N E U E S A U S K V E N U N D K B V
BundesArztsuche-App für Android-Smartphones
Berlin – Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat ihre bundesweite, mobile Arztsuche nun auch für Smartphone-Besitzer modifiziert, die über ein Android-Betriebssystem verfügen. „Mit der BundesArztsuche als App haben wir sozu-sagen eine virtuelle Brücke zum Arzt geschlagen. Auch Smart-phone-Nutzer können jetzt davon profitieren“, erläuterte KBV- Vorstand Dr. carl-Heinz Müller. Bereits 94.000 iPhone-Besitzer hätten laut KBV die seit einem Jahr kostenlos erhältliche Ver-sion der BundesArztsuche für das iPhone heruntergeladen. Die App ermögliche Nutzern, an jedem beliebigen Ort in Deutsch-land nach einem Arzt oder Psychotherapeuten zu suchen. Die einzelnen Fachgebiete oder Zusatzbezeichnungen fänden sich in den Untermenüs. Das Ergebnis zur Arztsuche zeige die App in einer Liste oder auf einer Landkarte mit dem eigenen Standort an. Nutzer könnten nach Anklicken eines Arztstand-ortes Adresse, Telefonnummer, Fachgebiet und Zusatzbezeich-nungen einsehen.
Ein weiterer Klick ermögliche einen direkten Anruf oder das Versenden einer Mail. Den Weg zum Arzt weise die Smart-phone-Navigation auf Wunsch ebenfalls. www.kbv.de/arzt-suche/Bundesarztsucheapp.html
Berlin - Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat eine Broschüre für niedergelassene Ärzte zum Thema „Mehr Sicher-heit bei der Arzneimitteltherapie“ veröffentlicht. Die Broschüre aus der Reihe „KBV PraxisWissen“ soll Ärzte für das Thema sensibilisieren und ihnen dabei helfen, unerwünschte Ereig-nisse in der Arzneimitteltherapie zu vermeiden. Die Broschüre gehe dabei auf typische Probleme in jeder Phase des Medika-tionsprozesses ein, erkläre anhand von Fallbeispielen und gebe praxisgerechte Tipps, fasste Prof. Ferdinand M. Gerlach, Direk-tor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main zusammen. Bei der Zusammenstellung der
Informationen wurde die KBV von Wissenschaftlern des Insti-tuts unterstützt. Die Broschüre kann kostenlos per E-Mail an [email protected] bestellt werden. Darüber hinaus erstellt die KBV in Kooperation mit der Arznei-mittelkommission der deutschen Ärzteschaft regelmäßig die Publikation „Wirkstoff AKTUELL“ mit praxisorientierten Hinwei-sen und Empfehlungen zu Wirkstoffen. Die aktuelle Ausgabe „Rationale Antibiotikatherapie bei Infektionen der oberen Atemwege“ behandelt ebenfalls Aspekte einer sicheren Arznei-mitteltherapie (www.kbv.de/ais/12905.html).
Kostenlose KBV-Broschüre zur Arzneimitteltherapie
Impfstreit in Rheinland PfalzMainz – Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) ist nicht länger bereit, die Politik der AOK Rheinland-Pfalz im Bereich der Impfungen hinzunehmen. „Ohne konkrete Anhaltspunkte unterstellt die AOK Rheinland-Pfalz Hunderten von Ärzten bei der Erbringung von Impfleistungen Unregel-mäßigkeiten und Unwirtschaftlichkeit“, erklärt Dr. Peter Heinz, stellvertretender Vorsitzender der KV RLP, den Unmut. „Diese Vorwürfe weisen wir scharf zurück. Das Vorgehen bedient die Null-Toleranz-Schiene. Dieser konfrontative Umgang mit Ärzten ist nicht hilfreich im Bestreben, die Impfquote in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Auch ist er nicht dazu geeig-net, dem drohenden Ärztemangel im Land zu begegnen. Die von der AOK Rheinland-Pfalz angestrebten Regresse bei Impf-stoffen gegen Ärzte sind sicher kein Anreiz, junge Mediziner auf das rheinland-pfälzische Land zu locken“, so Heinz weiter. Eine Auswertung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung zur Inanspruchnahme der Grippeschutzimpfung hat gezeigt, dass Rheinland-Pfalz bereits im Jahr 2008 nach Baden-Württemberg die schlechteste Impfrate im Bundesge-biet aufweist und damit weit unter dem Bundesdurchschnitt liegt
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201246
dIE mEnschEn Im Land
V O R O R T
Es gibt natürlich eine Menge „politisch korrekter“ Freizeitbeschäf-tigungen wie Golfen, Joggen, Reiten oder Segeln. Motorradfah-ren hingegen ist bekanntlich laut, Motorradfahren ist gefährlich, Motorradfahren ist schlecht für das grüne Gewissen. Ja, alles rich-tig, aber: Motorradfahren macht auch „wahnsinnig“ viel Spaß.
Am Motorradfahren scheiden sich eben die Geister: Entweder man liebt es oder man hasst es. Eine „neutrale Meinung“ scheint es nicht zu geben. Die Entscheidung, diesen Artikel zu verfassen (und mich damit der Gefahr einer Flut empörter Leserbriefe auszuset-zen), basiert dabei vor allem auf der folgenden Feststellung: Jeder Mensch sollte eine Freizeitbeschäftigung pflegen, die ihm Freude macht, Hektik und Stress vergessen lässt und seine Energiespei-cher wieder auffüllt. Auf folgende Frage an all die Patienten, die mich mit den Symptomen einer psychovegetativen Erschöpfung (F48.0G) in meiner Praxis aufsuchen, kann mir KEINER (!) eine Antwort geben: „Was machen Sie eigentlich nur für sich selbst?“. Ob die Freizeit nun in Lederkombi oder Jogging-Schuhen erlebt wird: Wer will da mit moralinsaurem Blick den ersten Stein wer-fen? Ich kenne einen Menschen, der fährt an jedem Wochenende mit seinem voll ausgestatteten Highend-Wohnmobil irgendwo an den Nord-Ostsee-Kanal und beobachtet den ganzen Tag Schiffe. Warum nicht? Wenn es ihn entspannt? Sie finden so etwas „krank“? Nun ja, auf eine gewisse Weise sind wohl auch Motor-radfahrerInnen „krank“:
eine eigene Welt mit eigener spracheDer erste Tag eines neuen Jahres ist für MotorradfahrerInnen der 1. März. Das Jahr heißt auch nicht Jahr, sondern Saison. Sie spre-chen eine fremde Sprache mit Wörtern wie „curbs“ und „Turns“ und sie genießen Tätigkeiten, für die die Allgemeinbevölkerung Vokabeln wie „verrückt“ bereithält. Wenn sich bei Sonne und Wärme alle Welt entkleidet, ziehen sie sich schwarzes Leder an. Das alles macht sie glücklich.
Motorradfahren ist trotz aller unbestreitbarer Gefahren nicht gleichzusetzen mit Verantwortungslosigkeit. Die Gefahren der (Land)Straße sind mir z. B. nicht zuletzt durch meine Nebentätig-keit im Rettungsdienst als Notarzt wohl bewusst. Um aber Ver-gnügen und Verstand, um Bauch und Kopf unter den sprichwört-lichen Hut zu bekommen, verlege ich mein Hobby am liebsten auf die Rennstrecke. Auf diese Weise kann man Potential und Performance moderner Motorräder erfahren, ohne andere Ver-kehrsteilnehmer, sich selbst und nicht zuletzt das Punktekonto in Flensburg zu gefährden.
organisierte rennen – reduziertes risikoRennstrecken gibt es sowohl im nahen Dänemark (Padborg Park) als auch in Mitteldeutschland (Moto-Park Oschersleben, Euro-Speedway Lausitzring, Sachsenring, Nürburgring, usw.). Dort findet man auf Veranstaltungen diverser Organisationen eine
PS-Power aus PahlenWas macht ein Hausarzt eigentlich in seiner Freizeit? Dr. Reimar Vogt steigt regelmäßig auf seine 200 PS starke BMW S 1000 RR und vergisst auf der Rennstrecke den manchmal hektischen Berufsalltag.
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 47
dIE mEnschEn Im Land
abgesperrte Strecke vor: Es gibt weder „Bauernglätte“ noch den verursachenden Landwirt samt Trecker, der plötzlich vom Feld auf die Straße einbiegt. Es gibt außerdem keinen Gegenverkehr und dank Wildfangzäunen keinen entsprechenden Wechsel liebes-toller Kreaturen (die den Jagdsport ausübenden KollegenInnen könnten hier sicherlich besser als ich die korrekte Gefährdungs-lage durch Rot-, Dam- und Niederwild beschreiben). Stattdessen gibt es spezielle Straßenbeläge, die hohe Schräglagen und den Einsatz von profillosen Slickreifen erlauben sowie ein Asphalt-band, dessen Krümmungen bisweilen an die Zick-Zack-Naht einer sternförmigen Tischdecke zum Weihnachtsfest erinnern.
Gestartet wird in verschiedenen Gruppen, die der Veranstal-ter nach Leistung der Motorräder und Erfahrung der FahrerIn-nen unterteilt. Gefahren wird in zeitlichen Abschnitten („Turns“ ... aha!) von zumeist 20 Minuten. Pro Gruppe sind je nach Ver-anstaltung etwa 10-30 FahrerInnen auf der Strecke. Je nach Streckenlänge und Geschwindigkeit schafft man in den 20 Minu-ten einige wenige bis reichlich Runden. Wer es möchte, kann mittels Infrarot-Laptimer (Lap = Runde) während oder nach dem Rennen seine Zeiten auslesen.
Den Teilnehmern solcher Rennveranstaltungen ist sicherlich vieles gemeinsam: Die Freude an schneller Fortbewegung, das Sammeln von Erfahrungen im Grenzbereich sowie die Begeiste-rung für Technik bzw. die Beherrschung derselben. Es geht bei solchen Events nicht um Pokale, Punkte und Siegertreppchen, da wird weder auf noch neben der Strecke gedrängelt, geschubst oder mittels Einsatzes der Ellenbogen ein missliebiger Konkurrent beseitigt. Die „Benzingespräche“ vor und nach den Rennen tragen nicht unerheblich zum Spaß an solchen Veranstaltungen bei.
Sollte man tatsächlich einmal „die Kurve nicht kriegen“, so ist ein Sturz auf der Rennstrecke sicherlich nicht so gefährlich wie auf der öffentlichen Straße: Großzügig angelegte Kiesbetten neben dem Asphaltband fangen Fahrer und Maschine auf und minimie-ren – neben der obligatorischen Schutzkleidung – das Verletzungs-risiko. Es stehen weder Bäume noch Verkehrsschilder an der Stre-cke, stattdessen viele Helfer mit Fahnen, durch deren Schwenken andere RennteilnehmerInnen auf Gefahrensituationen aufmerk-sam gemacht werden.
entspannung für den „alltagswahnsinn“Ich selbst fahre seit letztem Jahr eine BMW S 1000 RR in weitge-hend originalem Zustand, sodass ich mich damit auch noch auf öffentlichen Straßen bewegen darf. Aber mal Hand aufs Herz: Wer braucht schon 200 PS und eine aus dem Stand nach 19 Sekunden erreichte Spitzengeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern auf einer öffentlichen Straße?
Ich würde mich freuen, im nächsten Nordlicht von einem ande-ren, vielleicht nicht ganz alltäglichen Hobby zu lesen, mit dem eine Kollegin oder ein Kollege den „ganz alltäglichen Wahnsinn“ aus RLV und QZV, Medikamenten-Budget, Regressen, Punkten, Dokumentation, Organisation, Qualitätsmanagement, Fortbildung, Zirkelarbeit, Sonderverträgen, Versicherungsanfragen, Reha-Anträgen sowie Berichten für das Landesamt für soziale Dienste und so weiter vergisst. Nur zu! Trauen Sie sich! Sie gehören doch nicht zu den „Outburners“, die so gar nichts mehr für das eigene Seelenheil tun :-) !?
DR. REIMAR VOGT, ALLGEMEINARZT, PAHLEN
sErVIcE
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201248
V E R O R D N U N G S M A N A G M E N T
Sicher durch den Verordnungs-Dschungel
Neues Jahr neues Glück?
Welche Arzneimittel sind grundsätzlich verordnungsfähig? Wie viele Heilmittel dürfen pro Rezept verordnet werden? Welche Budgetgrenzen sind zu beachten? Diese Fragen stellen sich niedergelassene Ärzte immer wieder, denn die Gefahr ist groß, in die „Regress-Falle“ zu tappen. Damit Sie sicher durch den Verordnungs-Dschungel kommen, in formieren wir Sie auf dieser Seite über die gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien bei der Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln.
Haben sie Fragen? Dann rufen sie das verordnungsmanagement der KvsH an:
Ihr ansprechpartner im Bereich arzneimittel, Heilmittel und Impfstoffe
Thomas FrohbergTel. 04551 883 304 [email protected]
Ihre ansprechpartnerin im Bereich sprechstundenbedarf
Heidi DabelsteinTel. 04551 883 353 [email protected]
Ihre ansprechpartnerin im Bereich Hilfsmittel
Anna-Sofie PlathTel. 04551 883 362 [email protected]
zunächst sind hier die verordnungen im Heilmittelbe-reich außerhalb des regelfalles zu nennen. Das Versorgungsstrukturgesetz sieht vor, dass genehmigte Verordnungen außerhalb des Regelfalles nicht der Wirt-schaftlichkeitsprüfung unterliegen sollen. Diese Vorgabe kann aber noch nicht umgesetzt werden. Die Krankenkas-sen/Verbände wollten auf Anfrage noch keine Stellung beziehen.
Frühe nutzenbewertung durch den g-BaDer G-BA hat zwar einen beträchtlichen Zusatznutzen für Ticagrelor festgestellt, dass bedeutet jedoch nicht, dass die Verordnung dieses Wirkstoffes grundsätzlich wirtschaftlich ist. Sie sollten sich streng an die Indikation instabile Angina pectoris und NSTEMI halten. Die Preisbildung für dieses Präparat ist noch nicht abgeschlossen.
MisteltherapieDer G-BA hat die Klage vor dem BSG gewonnen, sodass jetzt eindeutig feststeht, dass jedes Mistelpräparat (auch anthroposophische und homöopatische) nur in der palli-ativen Therapie maligner Tumore zur Verbesserung der Lebensqualität zu Kassenlasten verordnet werden kann.
grippeimpfstoffeDie AOK Nordwest hat die Versorgung mit Grippeimpf-stoffen für die Saison 2012/13 als Ausschreibung laufen, sodass keine Vorbestellung erforderlich ist. Die AOK über-nimmt die Bestellung. Näheres teilen wir Ihnen zu gege-bener Zeit mit, sobald weitere Informationen vorliegen.
Es gibt mal wieder eine Reihe von Neuerungen in der bunten Welt der Verordnungen.
THOMAS FROHBERG, KVSH
sErVIcE
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 49
Ein wichtiges Qualitätsziel der DMP-Verträge Asthma bronchiale stellt insbesondere die Schulung für Kinder und Jugendliche dar. Um alle Ärzte, die am DMP Asthma bronchiale teilnehmen bei der Umsetzung des Qualitätszieles zu unterstützen, stellt die KVSH nun eine übersicht der zur Schulung berechtigten Ärzte zur Verfügung. Selbstverständlich wurde im Vorwege das Einverständnis zur Ver-öffentlichung der Daten jedes einzelnen Kollegen eingeholt. Der nachfolgenden Liste kann entnommen werden, welche nieder-gelassenen Ärzte diese Schulung im Rahmen der DMP-Verträge anbieten.
Informationen zu Schulungsteams der AGAS (Arbeitsgemein-schaft Asthmaschulung) erhalten Sie unter www.asthmaschulung.de.
name strasse Plz ort telefon
Dr. med. Peter Ahrens Moltkeplatz 12 23566 Lübeck 0451 63434
Berrit Ahsbahs-Niemann Dorfring 4 24257 Köhn 04385 5131
Dr. med. Rolf Bigalke Großflecken 51 - 53 24534 Neumünster 04321 43000
Dr. med. Uwe Blauert Zum See 2 24223 Schwentinental OT Raisdorf 04307 1771
Ulrich Gidion Lehmberg 7 24103 Kiel 0431 2400240
Dr. med. Julian Glattfelter Grönauer Heide 3 23627 Groß Grönau 04509 87570
Dr. med. Rainer Haase Angelburger Str. 8 24937 Flensburg 0461 17662
Dr. med. Volker Habermann Rathausgasse 2 23611 Bad Schwartau 0451 24755
Dr. med. Kathrin van Heek Hollesenstraße 25 24768 Rendsburg 04331 26367
Dr. med. Heinrich Stephan Herding Österstrasse 6 25704 Meldorf 04832 95080
Dr. med. Rudolf Höhne Neuhöfer Straße 18 23858 Reinfeld 04533 4520
Dr. med. christian Horn Ahrensböker Str. 11 23617 Stockelsdorf 0451 494447
Dr. med. Gerd Hüls Damm 49 25421 Pinneberg 04101 28747
Dr. med. claudius Junge Kirchenstraße 60 24211 Preetz 04342 889088
Ingo Kirchholtes Neuhöfer Straße 18 23858 Reinfeld 04533 4520
Dr. med. Petra Mikloweit Norderstraße 12 21502 Geesthacht 04152 877110
Olaf Opitz Sophie-Dethleffs-Straße 27 25746 Heide 0481 64615
Dr. med. Thomas Parlowsky Moltkeplatz 12 23566 Lübeck 0451 63434
Dr. med. Gertrud Reingruber Sieker Landstraße 122 - 124 22927 Großhansdorf 04102 1864
Eva-Maria Schafmeister Mürwiker Str. 162 24944 Flensburg 0461 30588
Dr. med. Peter Schröder Hohenwestedter Straße 28 24589 Nortorf 04392 4402
Dr. med. Hans-Jörg Tirpitz Zur Höhe 10 24955 Harrislee 0461 72288
Angela Waskow Norderstr. 82 25746 Heide 0481 78790
Dr. med. Nourjan Wässer Schillerstraße 1 21502 Geesthacht 04152 3154
Dr. med. Alexander Weise Kisdorfer Weg 3 a 24568 Kaltenkirchen 04191 2146
Dr. med. Angelika Wenner-Binding Gahlendorfer Weg 4 23769 Fehmarn OT Burg 04371 503100
Dr. med. Tatjana Werner Bischof-Wilhelm-Kieckbusch-Gang 12 23701 Eutin 04521 2860
Alles auf einen BlickD M P A S T H M A B R O N c H I A L E
Wir haben für Sie eine Liste aller Schulungsberechtigter Ärzte für Kinder und Jugendliche zusammengestellt.
KEVIN MAScHMANN, KVSH
Mit QEP® stellt die Kassenärztliche Bundesvereinigung ein für Praxen spe-zifisches Qualitätsmanagementverfahren zur Verfügung. QEP® – „Qualität und Entwicklung in Praxen“ – wurde gemeinsam mit niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten, QM-Experten und unter Einbeziehung von Berufsverbänden und Arzthelferinnen entwickelt. QEP® bietet Ihnen:• konsequente Praxisorientierung • einfache Anwendbarkeit • viele Umsetzungsvorschläge und Musterdokumente • die Möglichkeit zur Fremdbewertung/Zertifizierung
INHALTE DES SEMINARS: • Vermittlung von Grundlagen des Qualitätsmanagements; Vorteile und
Grenzen von QM• Einstieg in das QM-System QEP® (Qualität und Entwicklung in Praxen)• Intensive praktische Übungen mit den Materialien des QEP®-Systems
(Qualitätszielkatalog kompakt/QEP®-Manual)• Arbeitstechniken und Werkzeuge – erste Schritte für den Aufbau eines
QM-Systems in der eigenen Praxis
ORT: Sitzungszentrum der KVSH, Bismarckallee 1– 6, 23795 Bad Segeberg
TEILNAHMEGEBÜHR: 200 EUro Pro PErSon, inkl. Kursmaterial (QEP®-Qualitätszielkatalog/QEP®-Manual) und Verpflegung
FORTBILDUNGSPUNKTE: 18
TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verbindliche Anmeldungen werden in schriftlicher Form angenommen (Brief/Fax oder E-Mail) und in der reihenfolge des Posteingangs berücksichtigt. Abmeldungen können schriftlich bis zehn Tage vor der Veranstaltung bzw. im Krankheitsfall kostenlos erfolgen. Bei Absage bis drei Tage vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 50 Prozent der Teilnah-megebühr fällig. Die Benennung von Ersatzpersonen ist möglich. Spätere Absagen oder nichterscheinen erfordern die volle Seminargebühr.
FÜR ÄRZTEtHeMa: QEP®-Einführungsseminar
datuM: 24. FEBRUAR, 15.00 BIS 21.00 UHR 25. FEBRUAR, 9.00 BIS 17.00 UHR
Abt. QualitätssicherungBismarckallee 1 – 6, 23795 Bad Segeberg Angelika Ströbel regina Steffen Tel. 04551 883 204 04551 883 292Fax 04551 883 7204 04551 883 7292E-Mail [email protected] [email protected]
k o n t a k t + a n m e l d u n g
sErVIcE
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201250
SeminareW A S , W A N N , W O ?
Zu Seminaren wird nicht mehr persönlich eingeladen.
Bekanntmachungen erfolgen ausschließlich über das
Nordlicht.
tHeMa: Die Arztabrechnung – Sie fragen, wir antworten
datuM: 21. MÄRZ, 14.30 BIS 17.30 UHR
Im rahmen dieses Seminars werden wir mit Ihren Mitarbeiterinnen ins-besondere aktuelle Abrechnungsfragen zum EBM und zur GoÄ erörtern, sowie auf Fragen rund um die Verordnung eingehen.
REFERENTEN: Petra Lund, Abrechnungsleiterin Ernst Sievers, stellv. Abrechnungsleiter Thomas Stefaniw, referent, Abrechnungsabteilung Thomas Frohberg, Abteilung Verordnungsmanagement Jörg ruge, Privatärztliche Verrechnungsstelle
ORT: Hotel „Altes Gymnasium“, Süderstraße 6–8, 25813 Husum
TEILNAHMEGEBÜHR: Das Seminar ist kostenfrei.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verbindliche Anmeldungen werden bis zum 12. März 2012 in schriftlicher Form ange-nommen (Brief/Fax oder E-Mail) und in der reihenfolge des Posteingangs berücksichtigt.
FÜRMEDIZINIScHE FAcHANGESTELLTE
Abt. QualitätssicherungBismarckallee 1 – 6, 23795 Bad Segeberg nadine Kruse Telefon 04551 883 332 Fax 04551 883 374E-Mail [email protected]
k o n t a k t + a n m e l d u n g
sErVIcE
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 51
VeranstaltungenKVSH-Kreisstellen8. FEBRUAR, 17.30 UHRBildgestützte Strahlentherapie (IGRT)ort: Blauer SaalInfo: Kreisstelle Flensburg-Stadt, Tel. 0461 429 39, Fax 0461 468 91
22. FEBRUAR, 18.30 UHRKardiologie am Aschermittwochort: Hotel WasserlebenInfo: Kreisstelle Flensburg-Stadt, Tel. 0461 429 39, Fax 0461 468 91
29. FEBRUAR, 16.00 UHRGeschluckt, gestürzt, verbrüht – Notfälle bei Kindernort: Klinik für Kinder und Jugendmedizin/Klinik für Unfallchirurgie Fliednersaal DiakoInfo: Kreisstelle Flensburg-Stadt, Tel. 0461 429 39, Fax 0461 468 91
Schleswig-Holstein22. FEBRUAR, 14.00 BIS 18.00 UHRSchematherapieort: Hotel Mercure, Hanseatenplatz 2, 25524 ItzehoeInfo: referent: Dr. Eckhard roediger, Ansprechpartner: Dipl.-Psych. Ulla Kamps-Blass, Tel. 04821 600184, Achim Kreutzer, Tel. 04821 4084142, Fortbildungspunkte sind beantragt E-Mail: [email protected] [email protected]
22. FEBRUAR, 18.30 UHRLaparoskopische chirurgie in der Onkologieort: Schloß TremsbüttelInfo: Weiterbildungsveranstaltung mit Dr. Thomas Jungbluth E-Mail: [email protected]
23. FEBRUAR, 20.00 UHR„selfish brain“ – neue Forschungsergebnisseort: ConventGarten, rendsburgInfo: referent: Prof. Dr. Peters, Lübeck, Kontakt: Dr. Achim Distelkamp, Tel. 04331 663966, Fax 04331 663929 E-Mail: [email protected] www.aev-rd.de
22. FEBRUAR, 18.30 UHRLaparoskopische chirurgie in der Onkologieort: Schloß TremsbüttelInfo: Weiterbildungsveranstaltung mit Dr. Thomas Jungbluth, E-Mail: [email protected]
Wir übernehmen nur
für KVSH-Termine Gewähr.
22. MÄRZ, 20.00 UHRFallstricke der Leichenschauort: ConventGarten, rendsburgInfo: referent: Prof. Dr. Kaatsch, Kiel, Kontakt: Dr. Achim Distelkamp, Tel. 04331 663966, Fax 04331 663929 E-Mail: [email protected] www.aev-rd.de3. MAI, 20.00 UHRcervix-carcinom, der neuste Standort: ConventGarten, rendsburgInfo: referent: Prof. o. Behrens, rendsburg, Tel. 04331 663966, Fax 04331 663929 E-Mail: [email protected] www.aev-rd.de
24. MAI, 20.00 UHRSomatoforme und funktionelle Störungenort: redderhuskrog, HolzbungeInfo: referent: Dr. G. Tuinmann, Hamburg, Tel. 04331 663966, Fax 04331 663929 E-Mail: [email protected] www.aev-rd.de
16. BIS 20. APRIL, DGHO-Seminar, Basiskurs Hämatologisches Laborort: Städtisches Krankenhaus Kiel, Konferenzraum, Haus 2, 2. oG, Eingang MetzstraßeInfo: Anmeldeschluss: 17. März, Ansprechpartner: Inges Kunft, Tel. 0431 1697 1268, Fax 0431 1697 1264 E-Mail: [email protected] www.uk-s-h.de
21. JUNI, 20.00 UHRHepatitis – updateort: ConventGarten, rendsburgInfo: referent: PD Dr. Hinrichsen, Kiel Tel. 04331 663966, Fax 04331 663929 E-Mail: [email protected] www.aev-rd.de
Deutschland3. MÄRZ Kölner Herz-Lungen-Konferenzort: MArITIM Hotel Köln, Heumarkt 20, 50667 KölnInfo: Intercongress GmbH, Tel. 0761 69699 0, Fax 0761 69699 11 E-Mail: [email protected] www.intercongress.de
9. MÄRZ, 9 BIS 18.00 UHR1. Berliner Knorpelsymposiumort: DrK Klinikum Westend, Hörsaal, Spandauer Damm 130, 14050 BerlinInfo: organisation: Intercongress GmbH, Tel. 0761 69699 0, Fax 0761 69699 11 E-Mail: www.berliner-knorpelsymposium.de www.intercongress.de
sErVIcE
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201252
Ansprechpartner der KVSHK O N T A K T
VorstandVorstandsvorsitzende Dr. Ingeborg Kreuz .................................................................. 218/355Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Dr. ralph Ennenbach ............................................................... 218/355
Geschäftsstelle Operative Prozesse Ekkehard Becker .................................................... ..........................486
AbteilungenAbrechnung Petra Lund (Leiterin)/Ernst Sievers (stellv. Leiter) ................. 306/245 Fax ................................................................................................... 322Abteilung Recht – Justitiar Klaus-Henning Sterzik (Leiter) ................................................. 230/251Abteilung Recht Maria Behrenbeck ........................................................................... 251 Hauke Hinrichsen ............................................................................. 265 Tom-Christian Brümmer ................................................................... 474 Esther Petersen................................................................................ 498Ärztlicher Bereitschaftsdienst Thomas Miklik (BD-Beauftr. d. Vorstands) ...................................... 579 Alexander Paquet (Leiter) ............................................................... 214Akupunktur Doreen Knoblauch ........................................................................... 445Ambulantes Operieren Stephanie Purrucker ........................................................................ 459Arthroskopie Stephanie Purrucker ........................................................................ 459Ärztliche Stelle (Röntgen) Kerstin Weber .................................................................................. 529 Uta Markl ......................................................................................... 393 Tanja ohm-Glowik ............................................................................ 386 nina Söth ......................................................................................... 571Ärztliche Stelle (Nuklearmedizin/Strahlentherapie) Kerstin Weber .................................................................................. 529 Thomas Müller ................................................................................. 325Arztregister Anja Scheil/Dorit Scheske ............................................................... 254Assistenz-Genehmigung Brigitte Gottwald ............................................................................. 255 renate Tödt ..................................................................................... 358Balneophototherapie Michaela Schmidt ............................................................................ 266Betriebswirtschaftliche Beratung Marion Grosse .................................................................................. 343chirotherapie Michaela Schmidt ............................................................................ 266Dermatohistologie Marion Frohberg .............................................................................. 444Dialyse-Kommission/LDL Marion Frohberg .............................................................................. 444Diabetes-Kommission Aenne Villwock ................................................................................ 369
DMP Team Marion Frohberg ............................................................................. 444 Helga Hartz ..................................................................................... 453 Caroline Polonji .............................................................................. 280 Kevin Maschmann ........................................................................... 326 Tanja Glaw ....................................................................................... 685 Drogensubstitution Astrid Patscha .................................................................................. 340 Christine Sancion ............................................................................. 470EDV in der Arztpraxis Timo rickers .................................................................................... 286 Janin Looft ....................................................................................... 324 Tobias Kantereit ............................................................................... 320Ermächtigungen Susanne Bach-nagel ......................................................................... 378 Daniel Jacoby .................................................................................... 259 Katja Fiehn ....................................................................................... 291 Tyneke Grommes ............................................................................. 462ESWL Marion Frohberg ............................................................................. 444Finanzen Karl-Heinz Buthmann (Leiter) .......................................................... 208Formularausgabe Sylvia Warzecha ............................................................................... 250Fortbildung/Veranstaltungen nadine Kruse ................................................................................... 332Fortbildungspflicht nach Paragraf 95 SGB V Detlef Greiner .................................................................................. 527Früherkennungsuntersuchung Kinder (Hausärzte) Heike Koschinat ............................................................................... 328Gesundheitspolitik und Kommunikation Esther rüggen (Leiterin) ................................................................. 431Hautkrebs-Screening Kevin Maschmann .......................................................................... 326Hausarztzentrierte Versorgung Heike Koschinat .............................................................................. 328Herzschrittmacherkontrollen Monika Vogt .................................................................................... 366Histopathologie im Rahmen Hautkrebs-Screening Kevin Maschmann ........................................................................... 326HIV/AIDS Doreen Knoblauch ........................................................................... 445Homöopathie Kevin Maschmann ........................................................................... 326HVM-Team/Service-Team Stephan rühle (Leiter) .................................................................... 334Internet Jakob Wilder .................................................................................... 475 Borka Totzauer ................................................................................. 356Invasive Kardiologie Monika Vogt .................................................................................... 366Interventionelle Radiologie Grit Albrecht ................................................................................... 533Kernspintomographie Grit Albrecht .................................................................................... 533
Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-HolsteinBismarckallee 1 - 6, 23795 Bad SegebergZentrale 04551 883 0, Fax 04551 883 209
sErVIcE
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 53
Koloskopie Melanie Krille .................................................................................. 321Koordinierungsstelle Weiterbildung Petra Fitzner .................................................................................... 384Krankengeldzahlungen Doris Eppel ....................................................................................... 220Laborleistung (32.3) Marion Frohberg ............................................................................. 444Langzeit-EKG Monika Vogt .................................................................................... 366Mammographie (kurativ/Screening) Kathrin Zander ................................................................................. 382 Anja Liebetruth ................................................................................ 302Molekulargenetik Marion Frohberg .............................................................................. 444Niederlassung/Zulassung/Psychotherapeuten Susanne Bach-nagel ........................................................................ 378 Katja Fiehn ....................................................................................... 291Niederlassung/Zulassung/Ärzte Evelyn Kreker .................................................................................. 346 Tyneke Grommes ............................................................................. 462 Daniel Jacoby ................................................................................... 259 nicole Geue ..................................................................................... 303 Petra Fitzner .................................................................................... 384Niederlassungsberatung Evelyn Kreker .................................................................................. 346 Bianca Hartz ..................................................................................... 255 Susanne Bach-nagel ........................................................................ 378 André Zwaka .................................................................................... 327Nordlicht aktuell Borka Totzauer ............................................................................... 356 Jakob Wilder .................................................................................... 475Nuklearmedizin Grit Albrecht .................................................................................... 533Onkologie Doreen Knoblauch ........................................................................... 445Otoakustische Emissionen Michaela Schmidt ............................................................................ 266Patientenauskunft Paragraf 305 SGB V Detlef Greiner .................................................................................. 527Personal Christine Storm ................................................................................. 260 Lars Schönemann .............................................................................. 275 Anke Tonn ......................................................................................... 295 Anke Siemers .................................................................................. 333 Dirk Ludwig ....................................................................................... 425 Fax ................................................................................................... 451Phototherapeutische Keratektomie Stephanie Purrucker ........................................................................ 459Photodynamische Therapie am Augenhintergrund Stephanie Purrucker ........................................................................ 459Physikalisch-Medizinische Leistungen Michaela Schmidt ............................................................................ 266Plausibilitätsausschuss Hauke Hinrichsen .............................................................................. 265 Susanne Hammerich ......................................................................... 686 Ulrike Moszeik ................................................................................. 336 rita Maass ....................................................................................... 467Polygraphie/Polysomnographie Marion Frohberg .............................................................................. 444
K O N T A K T
Pressesprecher Marco Dethlefsen ............................................................................ 381 Fax .................................................................................................. 396Psychotherapie Melanie Krille .................................................................................. 321Qualitätssicherung Aenne Villwock (Leiterin) ........................................................ 369/262 Fax ................................................................................................... 374Qualitätszirkel/Qualitätsmanagement Angelika Ströbel .............................................................................. 204 Detlef Greiner .................................................................................. 527 regina Steffen ................................................................................. 292 Fax ................................................................................................... 374QuaMaDi Kathrin Zander ................................................................................. 382Radiologie-Kommission Aenne Villwock ................................................................................ 369 Angela Cabella ................................................................................. 458Röntgen (Anträge) Grit Albrecht .................................................................................... 533Röntgen (Qualitätssicherung) Angela Cabella ................................................................................. 458Rückforderungen der Kostenträger Heinz Szardenings ........................................................................... 323Schmerztherapie Monika Vogt .................................................................................... 366Service-Team/Hotline Telefon ..................................................................................... 388/883 Fax ................................................................................................... 505Sonographie (Anträge) Ute Tasche ....................................................................................... 485Sonographie (Qualitätssicherung) Susanne Paap .................................................................................. 228 Christina Bernhardt .......................................................................... 315Sozialpsychiatrie-Vereinbarung Melanie Krille .................................................................................. 321Soziotherapie Melanie Krille .................................................................................. 321Sprechstundenbedarf Heidi Dabelstein .............................................................................. 353Strahlentherapie Grit Albrecht .................................................................................... 533Struktur und Verträge Dörthe Deutschbein (Leiterin) ......................................................... 331 Fax ................................................................................................... 488Team Verordnung Thomas Frohberg ............................................................................. 304Team Verordnung Hilfsmittel Anna-Sofie Plath .............................................................................. 362Telematik-Hotline ................................................................................. 888Teilzahlungen Brunhild Böttcher............................................................................. 231Tonsillotomie, BKK VAG-Nord, BARMER GEK Doreen Knoblauch ........................................................................... 445Umweltmedizin/Umweltausschuss Marion Frohberg ............................................................................. 444Vakuumbiopsi Dagmar Martensen ......................................................................... 687Verordnung medizinische Rehaleistungen Christine Sancion ............................................................................. 470
sErVIcE
Nordlicht a K t u e l l 1/2 | 201254
Widersprüche (Abteilung Recht) Gudrun Molitor ................................................................................ 439Zulassung Bianca Hartz (Leiterin) ............................................................. 255/358 Fax ................................................................................................... 276Zweigpraxis Karsten Wilkening............................................................................ 561Zytologie Marion Frohberg .............................................................................. 444
Stelle nach Paragraf 81a SGB V: Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen Klaus-Henning Sterzik .............................................................. 230/251
PrüfungsstelleRosenstr. 28, 23795 Bad Segebergtel. 04551 9010 0, Fax 04551 901022
Vorsitzender des Beschwerdeausschusses Dr. Johann David Wadephul ........................................................ 90100 Prof. Günther Jansen (Stellvertreter) .......................................... 90100Leiter der Dienststelle Markus Eßfeld ............................................................................ 901021Verordnungsprüfung Elsbeth Kampen ........................................................................ 901023 Dr. Michael Beyer ...................................................................... 901015 Dorthe Flathus-rolfs .................................................................. 901015 Astrid Stamer ............................................................................. 901024Arznei-/Pharmakotherapie-Beratung (prüfungsbezogen) Elsbeth Kampen ........................................................................ 901023 Dr. Michael Beyer ...................................................................... 901015 Evelyn Sonnenrein ..................................................................... 901024 Honorarprüfung Birgit Wiese ............................................................................... 901012 Hans-Peter Morwinski ............................................................... 901011 Manfred Vogt ............................................................................. 901013Zweitmeinungsverfahren Gastroenterologie Hans-Peter Morwinski ............................................................... 901011Zweitmeinungsverfahren Rheuma Birgit Wiese ............................................................................... 901012Service Verordnungsprüfung Manuela Johnsen ....................................................................... 901020 Tanja Bauer ........................................................................... ..... 901016 Susanne Schuldt.................................................................... ..... 901025Service Honorarprüfung Sabine Kruse ............................................................................. 901016
K O N T A K T
An diese Stelle nach Paragraf 81a SGB V kann sich jede Person wenden. Es handelt sich um eine organisatorisch verselbstständigte und weisungsungebundene Einrichtung. Sie hat im rahmen ihres gesetzlichen Auftrages allen genügend substanziierten Hinweisen auf Sachverhalte nachzugehen, die auf Unregelmäßigkeiten oder auf eine rechtswidrige oder zweckwidrige nutzung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit den Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein hindeuten und die aufgrund der einzelnen Anga-ben oder der Gesamtumstände glaubhaft erscheinen.
Nordlicht aktuell
offizielles Mitteilungsblatt der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein
Herausgeber Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein Dr. Ingeborg Kreuz (v.i.S.d.P.)Redaktion Marco Dethlefsen (Leiter); Prof. Jens-Martin Träder (stellv. Leiter); Borka Totzauer (Layout); Jakob Wilder Redaktionsbeirat Ekkehard Becker; Dr. ralph Ennenbach; reinhardt Hassenstein; Dr. Ingeborg Kreuz; Esther rüggen Druck Grafik + Druck, Kiel Fotos iStockphoto
Anschrift der Redaktion Bismarckallee 1– 6, 23795 Bad Segeberg,Tel.: 04551 883 356, Fax: 04551 883 396, E-Mail: [email protected], www.kvsh.de
Das nordlicht erscheint monatlich als Informationsorgan der Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. namentlich gekennzeichnete Beiträge und Leserbriefe geben nicht immer die Meinung des Herausgebers wieder; sie dienen dem freien Meinungsaustausch. Jede Einsendung behandelt die redaktion sorgfältig. Die redaktion behält sich die Auswahl der Zuschriften sowie deren sinnwahrende Kürzung ausdrücklich vor. Die Zeitschrift, alle Beiträge und Abbildungen sind urheberrecht-lich geschützt. nachdruck nur mit schriftlichem Einverständnis des Herausgebers. Wenn aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form eines Wortes genutzt wird („der Arzt“), ist hiermit selbstver-ständlich auch die weibliche Form gemeint („die Ärztin“).
I m p r e s s u m
Zentrale Stelle Mammographie-ScreeningRosenstr. 28, 23795 Bad Segeberg Tel ................................................................................................... 898900Fax ............................................................................................... 8989089Dagmar Hergert-Lüder (Leiterin) ..................................................... 8989010
sErVIcE
Nordlicht a K t u e l l1/2 | 2012 55
KielKreisstelle: Herzog-Friedrich-Str. 49, 24103 Kiel Tel .............................................................................................. 0431 93222 Fax ......................................................................................... 0431 9719682Wolfgang Schulte am Hülse, AllgemeinarztTel ............................................................................................ 0431 541771 Fax ........................................................................................... 0431 549778 E-Mail ..................................................................... [email protected]
LübeckKreisstelle: Parade 5, 23552 Lübeck, Tel .............................................................................................. 0451 72240 Fax ......................................................................................... 0451 7063179Dr. Andreas Bobrowski, LaborarztTel ........................................................................................... 0451 610900 Fax ......................................................................................... 0451 6109010 E-Mail .............................................................. [email protected]
FlensburgKreisstelle: Berglücke 5, 24943 FlensburgTel ............................................................................................. 0461 42939 Fax ............................................................................................. 0461 46891Dr. Wolfgang Barchasch, FrauenarztTel .............................................................................................. 0461 27700 Fax ............................................................................................ 0461 28149 E-Mail ............................................................ [email protected]
NeumünsterJörg Schulz-Ehlbeck, hausärztl. InternistTel ........................................................................................... 04321 47744 Fax ........................................................................................... 04321 41601 E-Mail ..................................................... [email protected]
Kreis DithmarschenBurkhard Sawade, Praktischer ArztTel .............................................................................................. 04832 8128 Fax ............................................................................................. 04832 3164 E-Mail ..................................................... [email protected]
Kreis Herzogtum LauenburgDr. Monika Schliffke, AllgemeinärztinTel .............................................................................................. 04541 3585 Fax .......................................................................................... 04541 84391 E-Mail .......................................................... [email protected]
Kreis NordfrieslandDr. Martin Böhm, InternistTel ............................................................................................. 04841 5037 Fax ............................................................................................. 04841 5038 E-Mail ..................................................... [email protected]
Kreis OstholsteinDr. Thomas Schang, chirurgTel ............................................................................................ 04521 72606 Fax ......................................................................................... 04521 409433 E-Mail ......................................................... [email protected]
Kreis PinnebergDr. Zouheir Hannah, OrthopädeTel ............................................................................................ 04106 82525 Fax ........................................................................................... 04106 82795 E-Mail ........................................................... [email protected]
Kreis PlönDr. Joachim Pohl, AllgemeinarztTel .............................................................................................. 04526 1000 Fax ............................................................................................ 04526 1849 E-Mail .................................................................. [email protected]
Kreis Rendsburg-Eckernfördecarl culemeyer, AllgemeinarztTel .............................................................................................. 04353 9595 Fax ............................................................................................. 04353 9555 E-Mail ....................................................................... [email protected]
Kreis Schleswig-FlensburgDr. carsten Petersen, InternistTel .......................................................................................... 04621 951950 Fax .......................................................................................... 04621 20209 E-Mail ........................................................... [email protected]
Kreis SegebergDr. Dieter Freese, AllgemeinarztTel ............................................................................................ 04551 83553 Fax ........................................................................................ 04551 879728 E-Mail ............................................................ [email protected]
Kreis SteinburgDr. Klaus-Heinrich Heger, InternistTel .............................................................................................. 04124 2822 Fax ............................................................................................ 04124 7871 E-Mail ............................................................ [email protected]
Kreis StormarnDr. Hans Irmer, ArztTel ............................................................................................ 04102 52610 Fax .......................................................................................... 04102 52678 E-Mail ............................................................. [email protected]
Kreisstellen der KVSH
K O N T A K T