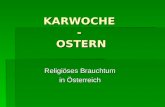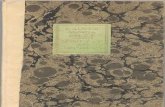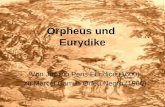Orpheus in der Spätantike (Studien und Kommentar zu den Argonautika des Orpheus: Ein literarisches,...
Transcript of Orpheus in der Spätantike (Studien und Kommentar zu den Argonautika des Orpheus: Ein literarisches,...

Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron 265
im Chaos, sondern sorgfältig, der Reihe nach einnehmen (siehe etwa AR 1,528–530). Bei Valerius wird das Einnehmen der Plätze sogar mit der Auf-zählung der Argonauten, d.h. dem Katalog, verbunden (VF 1, 350–488).Das Detail, dass die Argonauten in den AO ihre Sachen u n t e r ihren Bän-ken und nicht n e b e n diesen (AR 1, 528.544; VF 1, 487) verstauen, findetsich auch in der homerischen Schilderung des Phaiakenschiffes und der An-ordnung der Phaiakensachen durch Alkinoos (Od. 13, 20f.)
361–368 Kλ κ )# σ % $ | 6H, Zµ«Ν«, %) ’ %« #A)6. | O¹ ’ Ν’ %’ : 0 (« | Ν «α % ’ Ν« Ϊ, | $. $-« "µ 0 λ 0. | T« ’ ¹µ« 5O« $’ #-( < | $« d), % ’ #H) | π# »« (λ $ : Zur besonderen Zuneigung Heras zu Iason undihrer damit in Verbindung stehenden ‚Schutzfunktion‘ für das Gelingen derArgonautenfahrt siehe auch die Verse AO 60f., 64f., 296f. Darauf, dass einegewisse Inkonsequenz darin besteht, dass Hera einen günstigen Fahrtwindwehen lässt, die Argonauten sich aber (AO 363f.) ans Rudern machen, wo-nach wiederum (AO 371f.) vom Wehen der Winde in der Gegend des Peliondie Rede ist, hat Vian (1987), S. 100 ad 368 hingewiesen und Überlegungenzu einer eventuellen Textumstellung angestellt. Davon abgesehen jedoch,dass sich das Nebeneinander von Segel- und Ruderfahrt in der Praxis garnicht ausschließt (vgl. v.a. AO 622 und 624f.), ist zu bedenken, dass dieepische Erzählung – gerade im Fall der AO und der zahlreichen in ihnenenthaltenen intertextuellen Anspielungen – keine naturwissenschaftlich prä-zise Wiedergabe von Naturvorgängen zu geben braucht und oft auch nichtgibt. Zur Bezeichnung der Argonauten als ‚Könige‘ siehe die Kommentarezu AO 70 und 283f.
AO 369–454: Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron: Eine Erwäh-nung des bereits in der Ilias als „gerechtester aller Kentauren“ (Il. 11, 832)bezeichneten Cheiron findet sich in verschiedenen Versionen des Argonau-tenmythos, so auch bei Apollonios Rhodios und Valerius Flaccus. Dochwährend bei diesen die Begegnung (VF 1, 255–259.407–410) oder der Sicht-kontakt mit dem Kentauren (AR 1, 553–558) im Rahmen der jeweiligenDarstellung nicht viel Raum einnimmt und nur en passent erfolgt, ist die Chei-ron-Episode in den AO ausführlicher ausgestaltet. Entgegen der generellenund durch die kürzere Gesamtlänge der AO naturgemäß bedingten Ten-denz, Episoden, die in den jeweiligen Hypotexten bisweilen ausführlich ge-schildert werden, nur anzudeuten oder stark zu verkürzen, bietet die Chei-ron-Episode den entgegengesetzten Fall: Der Verfasser der AO räumt dem
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

266 Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron
Zusammentreffen der Argonauten mit Cheiron immerhin 85 Verse ein.Aufgrund dieser besonderen Gegebenheit ist es möglich, die kompositori-sche Qualität der Passage ohne Rücksicht auf einen konkreten (erkennba-ren) Hypotext zu betrachten.
In besonderer Dichte und Bündelung finden sich zahlreiche Charakte-ristika und typische Motive der AO in der Cheiron-Szene wieder: Die Höhledes Kentauren bietet den betont rustikal-einfachen Rahmen, der durch Hel-den- (Cheiron) bzw. kosmogonischen Gesang (Orpheus) gefüllt wird. DasAlter der beiden Konkurrenten wird thematisiert (Orpheus als der jüngerescheut sich, gegen Cheiron überhaupt anzutreten); der junge Achill gehörtzur Szenerie des Gesangsduells und erinnert durch seine bloße Präsenz undseine Jugend noch einmal nachdrücklich an die besondere literarische bzw.mythenchronologische Konstruktion der AO als inszenierter Archegetinder griechischen Literatur und vor allem des Epos (s.o. S. 16): Nicht zufälligdürfte etwa vom Leierspiel des kleinen Achill die Rede (AO 397f.) sein, dermit seinen Kinderhänden die Saiten zupft; dieselben Händen werden später,wie jeder Rezipient weiß, die ‚männermordenden‘ sein, mit denen er auch inder Ilias die Leier spielen wird (Il. 9, 186).
Interessant ist die Frage nach der Funktion einer solchen aufwendig ge-stalteten Szene, die der Verfasser der AO offensichtlich bewusst in Ergän-zung bzw. Erweiterung bekannter Mythenversionen geschaffen hat: Da essich bei dem kosmo- bzw. theogonischen Gesang, den Orpheus als Wettbe-werbsbeitrag vorträgt, bereits um die zweite kosmo- bzw. theogonische Par-tie der AO handelt (siehe bereits AO 12–32), besteht prinzipiell die Möglich-keit, vor dem Hintergrund der verschiedenen narrativen Ebenen beiderGesänge (der eine als Teil der Rahmenhandlung, der andere eingebettet indie Erzählung selbst) eine werkinterne Korrektur einer Kosmogonie ausdem Mund des Orpheus zu vermuten, zumal die Kern- bzw. Rumpftheogo-nie der Verse AO 421–431 in der Nennung der kosmischen und göttlichenInstanzen nicht identisch mit dem ist, was in den Versen AO 12–32 genanntworden war. Abgesehen davon jedoch, dass die Frage der Korrektheit einerKosmogonie in der antiken Literatur nicht ernsthaft diskutiert wurde bzw.dies kein relevantes Kriterium für die Betrachtung eines Weltentstehungs-gedicht gewesen sein dürfte, sind die Divergenzen beider Partien, die im we-sentlichen in der Einfügung der Instanzen Gaia und Thalassa zu Beginn derzweiten Theogonie (AO 423) bestehen, zu gering, um einen substantiellenUnterschied ausmachen zu können. Eine textexterne Funktion scheint alsonicht vorzuliegen.
Das Einbringen der zweiten Theogonie auf der Ebene der erzähltenHandlung ermöglicht vielmehr eine ansprechende Beschreibung der Wir-kung des Orpheusgesangs, die in der Schilderung des Verzücktseins derTiere und der unbelebten Natur in den Versen AO 435–439 auch explizit er-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron 267
folgt. Diese ästhetische Funktion der Partie entfaltet ihre volle Wirkunginsofern, als der Verfasser der AO durch die Doppelung des Theogonie-Mo-tivs (nachträglich) einen ähnlichen Rahmen wie beim Vortrag der Theogoniein den Versen 421–431 und eine vergleichbare Außenwirkung auch für denKontext der Rahmenhandlung der AO evoziert. Die zauberhafte Wirkung,die für den Gesang auf der Ebene der Erzählung explizit erwähnt wird, wirdso implizit auch für die (Rahmenhandlung der) AO in Anspruch genommen.
Gleichzeitig stellt die Zeichnung des Kentauren Cheiron (und des ge-samten Aufenthaltes der Argonauten in dessen Höhle) einen positiven Anti-typos zur odysseischen Zyklopen-Szene bei Polyphem dar. Nicht nur die Ge-stalt beider Wesen wird als riesig und wundersam beschrieben (siehe denKommentar zu AO 392–398), sondern auch die Schilderung der Höhle desCheiron mit den Stallungen vor ihrem Eingang (siehe den Kommentar zuAO 431–441) dürfte auf die homerische Schilderung zielen. Diese stellt dieFolie für den durchweg gelungenen Besuch der Argonauten beim Kentau-ren dar, der z.B. trotz seines halbwilden Wesens auch in Hinsicht auf denWeingenuss einen deutlichen Gegensatz zum Zyklopen bildet. Einer sol-chen Deutung liegt durchaus ein aemulatives Moment zugrunde, das jedocheher auf der Ebene der handelnden Personen selbst als auf der Darstellungder Szene liegt: Wie Cheiron sich positiv von seinem Pendant Polyphem ab-hebt, so tun dies auch Orpheus und die Argonauten im Vergleich zu Odys-seus und dessen Gefährten. Nicht durch List und Täuschung, sonderndurch den Gesang des Orpheus wird die Herausforderung, die der Höhlen-bewohner Cheiron dem Orpheus stellvertretend für alle und gegen dessenerklärten Willen abverlangt, bewältigt. Zum Aspekt der Höhle siehe darüberhinaus oben S. 112–115.
Da dem Aspekt der Wahrheit und ihrer dichterischen Darstellung in denAO eine entscheidende Bedeutung zukommt (s.o. S. 15f.), ist auch die Wahlder Gesangsthemen, über die der Verfasser der AO sowohl Cheiron als auchOrpheus singen lässt, zu registrieren. Indem der Kentaur Cheiron über dieSchlacht der Kentauren mit den Lapithen sowie den Kampf mit Herakles(der ja im Auditorium anwesend ist) singt und Orpheus eine (wie bereits inder Rahmenhandlung) orphisch-hesiodisch anmutende Kosmo- und Theo-gonie vorträgt (die als Hymnos bezeichnet wird), wird eine enge Verbindungzwischen Singendem und Gesungenem geschaffen, d.h. Autorität für denjeweiligen Gesang impliziert (siehe hierzu die Kommentare zu den VersenAO 413–431). Auch in der Betonung des Wahrheitsaspektes unterscheidetsich der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron fundamental von dem desOdysseus bei Polyphem, dessen zentrales Element die lügnerische Selbstbe-zeichnung des Odysseus als ‚Niemand‘ ist.
Der Ort der Begegnung ist von Iolkos und dem Versammlungsort derArgonauten – so heißt es bei Valerius (VF 1, 255) – in dessen Höhle auf dem
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

268 Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron
Pelion verlegt worden, dessen nordöstliche Ausläufer die Argonauten alsihre erste Station anlaufen. Zur Variation gegenüber Apollonios siehe auchden Kommentar zu AO 369f. Obwohl für die Gestaltung der Cheiron-Epi-sode keine direkten Parallelen in Hinsicht auf die gesamte Szene vorhandenzu sein scheinen, lassen sich doch manche Reminiszenzen an Bilder undMotive gerade bei lateinischen Autoren (siehe den Kommentar zu AO431b–441) erkennen.
369–375 Kλ κ λ 6 | P "+«$’ « . | T(« ’ $-« « :+ µ« | µ "’:9 % . α | < « $9 ". #E’ Ν µ« | 0 α | % ’ 0b « M-, - 8 : Als eine erste Landmarke passieren dieArgonauten nach ihrer Abfahrt das Pelion-Gebirge, dessen Bezeichnung als*« sich auch in Valerius’ Kennzeichnung desselben als ‚mit Eschen be-deckt‘ abzeichnet (VF 1, 406: quantum Peliacas in vertice vicerat ornos; 2, 6: iamquefretis summas aequatum Pelion ornos; vgl. v.a. auch Il. 8, 557: 3 ’ 3 »λ λ « Ν und Il. 16, 143f.: P% , κ λ #) X# | P , «). Dass den Argonauten der Pelion gegenMorgen (also nach einer durchfahrenden Nacht) am Ufer erscheint, wäh-rend er bei Apollonios als Ausgangspunkt der Fahrt angedeutet wird (AR 1,549f.), ist geographisch dadurch bedingt, dass beim Alexandriner offen-sichtlich von der Südwestseite des Pelion, d.h. von der Iolkos zugeneigtenSeite, die Rede ist und so auch Kap Tisaion als erste Sichtmarke genannt wer-den kann (AR 1, 566ff.), während im vorliegenden Vers eine präzise geogra-phische Zuordnung, wo genau die Argonauten an Land gehen, unmöglichist: Zu wenig ist über die genaue Dauer der Nachtfahrt gesagt (AO 303f.sowie 366–368). Allzu schwer lassen sich auch die Angaben über dasVerschwinden von Kap Tisaion und Sepias (AO 460) aus dem Blickfeld derArgonauten zur präzisen Bestimmung eines Ortes der Cheiron-Höhle deu-ten. Eine genaue Verortung der Cheiron-Höhle ist offensichtlich nicht imInteresse des Verfassers der AO. Für eine nicht weiter präzisierte Verortungim Pelion-Gebirge siehe als Parallele das Ilias-Scholion ad Il. 16, 144 b Erbse:, «α λ „, 9«“. 3 C Ν X« C ?%« Ν«µ« Z" Ν ., 3 )i ² X#. Im übrigen gilt für sämt-liche geographische Angaben auch in den AO das Diktum des Eratosthenes(bei Strabon 1, 2, 15) in bezug auf die Bestrebungen, die Orte der Odysseebzw. die vermeintliche Fahrtroute des Odysseus ausfindig zu machen und zubestimmen: Solche Bestrebungen seien ebenso sinnlos wie der Versuch, denLederarbeiter zu finden, der den Windsack des Aiolos genäht hat.
Zur Erklärung der sonst nirgends belegten Konstruktion $.«« )* $µ« zieht Vian (1987), S. 101 ad 371 « $µ« als Attribut
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron 269
zu )* (les gouvernails (tenus) d’une double main). Voß sieht dagegen of-fensichtlich einen genitivus separationis: „Tifys nunmehr liess ruhen von bei-den Händen das Steuer …“. Die Parallele in AO 375 (. C $)spricht eher für Voß.
Zur Fahrt der Argonauten unter Segeln und Rudern siehe den Kom-mentar zu AO 361.
376–384 T( 8 - J ²µ ¹ P-«α | „7 ,$( « Κ µ | ) %λ α %X | %λ +)), « K- , | θ q’= P ’ :> α | Ρ« < 9 λ$ - , | Ν ’ σ = > λ $ | ν)κ )) <E «, | » -« $: Obwohl auch Apollonios den Peleus an verschiedenen(und entscheidenden) Stellen zu den Argonauten reden lässt (etwa AR 2,1217; 3, 504; 4, 494), stellt die folgende ‚Wunschrede‘ des Peleus offensicht-lich eine Erfindung des Verfassers der AO dar.
Im Gegensatz zur Mehrheit der anderen Kentauren galt Cheiron schonin der Ilias als « K.# (Il. 11, 832). Bemerkenswert häufigwird er bei Neuplatonikern genannt. Neben seiner Gerechtigkeit ist er v.a.für drei Aspekte berühmt: Seine Qualitäten als Arzt bzw. Heilkundiger, seinemusikalischen Fähigkeiten und seine Funktion als Erzieher (des Achill wieauch des Iason, des Aktaion und des Aristaios), siehe etwa Porphyrios,Quaest. Hom. 9, 443, 1: … ) µ « σ , 9 X#«,%$; Ρ κ λ )*; Proklos, In Remp. 1, 150, 10: λ$µ ;µ« .« (sc. Achill) λ µ )( #%)# X# "):Alle drei Eigenschaften werden auch in der Rede des Peleus (AO 381f.) ge-würdigt. Zu seiner Funktion als Erzieher und weiser Lehrer des Achill sieheauch Platon, Pol. 391c.
Durch die Nennung der musikalischen Qualitäten des Cheiron (Ν’ σ % 9 $λ $%# | ν κ $- 8E%#«) bereitet Peleus in seiner Rede motivisch bereits das ‚Ge-sangsduell‘ zwischen Orpheus und Cheiron (AO 406–441) vor. Dass nebender Verbindung der Kithara zu Apollon auch die zu Hermes genannt wird,erweist sich zudem als gelehrte Anspielung auf die zwei in besonderer Weisemit der Leier bzw. ihrer Erfindung verbundenen Gottheiten, d.h. auf denErfinder (HH in Merc. 24–62) und ihren besonders geschickten Spieler. DasWort $« (in den Handschriften z.T. im Akkusativ mit Bezug auf) ist sonst nirgends belegt, aber in seiner Bildlichkeit durchaus be-merkenswert: Das gesamte im homerischen Hermeshymnos (a.a.O.) ge-schilderte Geschehen wird evoziert.
Zur Heimat bzw. Lokalisation der Kentauren 1) im Pholoe-Gebirge,
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

270 Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron
2) im Pindos-Gebirge und 3) auf dem Pelion (AO 370) sowie zu der ge-schickten Kombination dieser drei Orte durch den Verfasser der AO siehev.a. Vian (1987), S. 101 ad 380.: „La Pholoé, demeure du Centaure Pholos, setrouve en Arcadie, dans le prolongement du mont Érymanthe. Les Centau-res ne sont pas habituellement localisés dans le Pinde; mais Homère (B 744)dit qu’ils furent chassés du Pélion chez les Aithikes et ceux-ci sont situésdans le Pinde par certains commentateurs: Strab., 9, 5, 12 et 19; Lexikon desfrühgriech. Epos, s. AL«. C’est donc une indication érudite que notre poèteintroduit ici.“
Zur Gestaltung der Cheiron-Episode vor dem Hintergrund zahlreicherParallelen bei Silius Italicus siehe den Kommentar zu AO 438f. sowie Vian(1987), S. 23f. Zur Lokalisation der Höhle des Cheiron siehe den Kommen-tar zu AO 369ff.
Zur Form « (Konjektur durch Sitzler) und möglichen Alter-nativen siehe Vian (1987), S. 178. Zur Konstruktion von " mit Dativsiehe L&S s.v. B1.
385–391 < λ π . G« $)Q | +,$), % $) ., | P+ : 0 X ’ 0 | σ λ % « $)Q ’ $α | + « %λ λ +. | #A, , %λ «,, S | g µ« %( λ d c .“ Die Jugend desAchill war Gegenstand zahlreicher literarischer Ausformungen mit Andeu-tungen bereits in der Ilias (wo allerdings – trotz seiner Erwähnung in Il. 16,143f. – nicht Cheiron, sondern Phoinix als Erzieher des Achill im Vorder-grund steht), aber auch bei Apollonios (4, 811–815) und Valerius Flaccus(VF 1, 255–270). Insbesondere die hellenistisch geprägte Literatur zeigte einausgeprägtes Interesse an Anekdoten und der literarischen Ausformung derJugendjahre der berühmtesten Helden; siehe etwa Radke (2007), S. 267–273,v.a. 271ff. Ein solches Interesse kommt nicht zuletzt auch in der Gestaltungder vorliegenden Episode zum Ausdruck. In der Wendung , $ wird dabei ein Motiv eingeführt, das gegen Ende der Cheiron-Epi-sode erneut aufgegriffen werden wird (AO 445: , $): Im vorlie-genden Vers ist es Thetis, die den kleinen Achill im Arm trägt, später wirdihn Peleus zum Abschied von Cheiron im Arm halten. Durchaus interessantist die Parallele, die die in den AO beschriebene Konstellation in einer Pas-sage bei Nonnos (Dion. 14, 430) erfährt, wenn dort davon die Rede ist, dassOiagros den kleinen Orpheus bei seiner Frau Kalliope lässt. Eine als durch-aus innig beschriebene Beziehung des Peleus zu seinem kleinen Sohn Achillfindet sich auch bei Valerius Flaccus (VF 1, 255–270), wo Cheiron – zurFreude des Vaters – mit dem Kind auf dem Arm zu den noch am Strand ver-sammelten Argonauten gelaufen kommt.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron 271
Zur Höhle des Cheiron siehe den Kommentar zu AO 369f. Zur Bedeu-tung des Cheiron als eines ‚Heroen-Erziehers‘ siehe den Kommentar zu AO378f. Zur Bezeichnung des Pelion als „waldig“ siehe den Kommentar zuAO 369f.
Die Formulierung bei Apollonios (a.a.O.: j [sc. Achill] κ X#«, \ K. | N%« ") wird insofern spielerisch abgewan-delt, als mit \ nun nicht mehr vom Ort, an dem Achill aufwächst, son-dern von seinem Charakter die Rede ist.
392–398 &« :Ω %( $, ¹ ’ . | A*> 0’ *κ:+ α | ¹ « 8 %’ * -« | ()« K«, $+ 8 9 | ¹ ²( -« > α | $). ’ ¹« G« λ P« ¹µ« | λ- d, « ’ % X : Obwohl im vorliegenden Versnicht von einer Höhle, sondern einer -* die Rede ist, lässt die spätere Ent-wicklung des Geschehens (AO 431ff.: µ C 9 "« \ -*) so-wie die Bezeichnung des Ortes als *« kaum einen anderen Schluss zu,als auch hinter -κ )* (vgl. auch )" in AO 442) das Be-treten der eigentlichen Höhle des Cheiron zu verstehen und nicht nur das ei-nes Vorplatzes.
Vom Gesang des Orpheus im Kontext einer Höhlenbeschreibung istauch bei Apollonios Rhodios die Rede (AR 4, 1128–1160), bei dem Or-pheus, zusammen mit den Argonauten, den Hochzeitsgesang für Iason undMedea anstimmt, und zwar vor der Höhle stehend und singend, in der dasPaar die Hochzeit vollzieht. Der Verfasser der AO korrigiert mit seinen Ver-sen den (nach seinem Empfinden offensichtlich unangemessenen) Ein-druck (siehe den Kommentar zu AO 399–405), den die Schilderung beiApollonios hervorruft, und gibt dem Orpheus-Gesang mit der Schilderungnicht nur des Sieges über den im Leierspiel erfahrenen Cheiron, sondernauch der Begleitumstände (Orpheus verzaubert die ihn hörenden Tiere,Bäume und Steine, siehe AO 433–439) den ihm gebührenden Rahmen.Auch der aus der Schar der übrigen rauhen Kentauren hervorragende Chei-ron wird hier zunächst in seiner kentaurenhaften Größe beschrieben. Zueiner möglichen Parallele zur Schilderung des Kyklopen in der Odyssee(9, 298) siehe Vian (1987), S. 102 ad 396.
Dass der Verfasser der AO in seiner Beschreibung besonders auf diemusikalische Bildung des Achill abzielt, spielt nicht zuletzt auf die be-rühmte Beschreibung des leierspielenden Achill in der Ilias (9, 186) an. Aufdie so evozierte Szene mag auch die Erwähnung der angenehmen Wirkungdes achilleischen Leierspiels verweisen (AO 398: "« ’ ,"X#; Il. a.a.O.: µ (sc. Achill) ’ l " 9).
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

272 Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron
Zum Verständnis von ¹ im Sinne eines dativus commodi siehe Vian (1987),S. 59; womöglich ist aber auch von einem noch schwächeren dativus ethicusauszugehen. Zur Form des handschriftlich überlieferten Hapax ,! sieheVian (1987), S. 102 ad 392 (gegen Schneiders von West favorisierter Konjek-tur ,$). Für parallele Konstruktionen von $# siehe Nonn., Dion.32, 139 (,"« λ "9) sowie 39,19 (¹« … ²!«).
399–405 #A’ Ρ + <’ Ν $)#« «, | $ «$, - ’ Ν g, | ( ’ %α ’ $-. «, | < )« 0 "µ , | - ’ %α $« ’ %λ (« | ( - - % , | *> 0’ % µ « S: DasMotiv des Küssens steht am Anfang und am Ende der Cheiron-Szene,siehe AO 445f. (¹ P.« 8’ 3 *): Wie der Kentaurseine Gäste jeden einzeln mit einem Kuss begrüßt, wird Peleus mit einemKuss von seinem Sohn Achill Abschied nehmen (AO 446). Neben demMotiv der Eltern, die den kleinen Achill im Arm halten (AO 386 und 445),bildet das Kuss-Motiv damit die zweite Klammer, die die Cheiron- bzw.Achill-Szene umschließt und ihre Geschlossenheit sowie ihren Liebreiz un-terstreicht.
Die in den folgenden Versen geschilderte Bewirtungsszene ist hinsicht-lich des geschilderten Umfelds der Höhle bewusst schlicht gestaltet, wieHermann (ad loc.) zurecht bemerkt: „Caeterum observatu dignum est, quod noster[sc. der Verfasser der AO] Chironi ab rudi et agresti cultu gratiam conciliare studet.“Hermanns Vermutungen zu einer möglichen Intention für eine solch rusti-kale Schilderung, Szenen wie die vorliegende entsprächen dem Geschmackdes zeitgenössischen Publikums (welches nach Hermann eigenen Ergebnis-sen ja ein spätantikes, vermutlich dem 4. Jahrhundert zuzuordnendes seinmüsste) und seien diesem deshalb geschuldet (a.a.O.: Id est aetatis nimis iampolitae, et primorum hominum simplicitatem desiderantis. Homeri aetas heroibus atqueinsignibus viris magnifica omnia et splendida assignebat.), sind reine Spekulation:Schließlich erweckt die Schilderung einen insgesamt literarisch-bukolischüberformten (und nicht irgendwie spezifisch spätantik geprägten) Eindruckund gibt einen durchaus angemessenen Rahmen für ein Gesangsduell zwi-schen einem Kentauren und Orpheus ab.
Vian verweist darauf, dass mit 8#"« … % nicht so sehr‚Streu‘ als vielmehr ein ‚Fell‘ oder eine ‚Decke‘ gemeint sein dürfte, da8#"« in erster Linie in bezug auf Tierfelle oder Stoffe verwendet werde(ausführlicher und mit Parallelen Vian [1987], S. 178]. Folgt man dieser Deu-tung im vorliegenden Fall, würde dies einen interessanten Kontrast zurSchilderung der ‚Hochzeits-Höhle‘ bei Apollonios darstellen (AR 4, 1128–1160; siehe auch den Kommentar zu AO 393), vor der Orpheus in der hel-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron 273
lenistischen Version zusammen mit den anderen Gefährten den Hochzeits-gesang für Iason und Medea anstimmt. In dieser Höhle bei Apollonios hatman, gewissermaßen als Hochzeitsbett, das Goldene Vlies ausgebreitet, des-sen prachtvolle, glänzende Erscheinung beim Alexandriner (a.a.O.) be-schrieben wird. Indem das Motiv eines ausgebreiteten Fells (das im Fall derAO als löcherig, zerfranst beschrieben wird, s.o.) aufgenommen wird, wirddas – durchaus einprägsame – Höhlenbild des Apollonios gewissermaßenüberschrieben und die beim Alexandriner situationsbedingt vorherrschendeerotische Stimmung durch den musischen Kontext der AO ersetzt; eine Mo-difikation, die der Gesamttendenz der AO, das Erotische weitestmöglichauszusparen, entspricht.
Das Motiv der Schlichtheit in der Beschreibung der äußeren Umständeder Cheiron-Höhle wird zunächst fortgeführt ($%« ’ ,λ !«).Das eigentliche Mahl, das Cheiron den Helden kredenzt, ist aber gleichzeitigvon homerischer Fülle. Die Verbindung von einfachem, aber reichhaltigenEssen mag auf die Pholos-Episode im Rahmen der Taten des Herakles an-spielen (siehe etwa Apollodor 2, 83ff.), wo der den Herakles bewirtendeKentaur Pholos dem Herakles gebratenes, sich selbst aber rohes Fleisch ser-viert. Dass der Kentaur Cheiron seinen Gästen in der vorliegenden Szenen-gestaltung Wein ausschenkt, stellt vor dem bei Apollodor geschilderten Hin-tergrund ein in gewisser Weise pikantes Detail dar, wenn man an den imMythos (Apollodor a.a.O.) verankerten Topos denkt, nach dem Kentaurenbei verschiedenen Gelegenheiten (etwa der Bewirtung des Herakles oder derHochzeit bei den Lapithen) nach Weingenuß zu ausfälligem Benehmenneigten. Im Falle des Cheiron ist von solcher Kentauren-Unart jedochnichts zu spüren, was seine herausgehobene Stellung unter allen Kentaurenund seine Kultiviertheit noch einmal unterstreicht (siehe die Kommentarezu AO 378f. und 415). Zur Bezeichnung der Argonauten als ‚Könige‘ sieheden Kommentar zu AO 70f.
406–412 #A’ Ρ κ . ’ Ϊ« 0 ), | λ %-« ², ,’ q 0) ) | X -) Q . |#A’ %)Ω * – λ ) %+ :Ω« | ² )))) :Q –, | ’ *µ« X % ’ $ | 6) )Ν’ % f «: Die Hochzeits-Szene bei Apollo-nios (AR 4, 1128–1160), deren mögliche Parallel- bzw. Kontrastfunktion be-reits angedeutet worden ist (siehe den Kommentar zu AO 401f.), dürfteauch hinsichtlich des Motivs der lärmenden bzw. ihre Hände bewegendenund zusammenschlagenden Argonauten als Folie dienen: Wie sie beimAlexandriner ihre Speere schwingen (AR 4, 1155f.: O¹ ’ ,λ $λ | .*« $*), während Orpheus das Hochzeitslied für Iason und Me-dea anstimmt, so klatschen sie unter lautem Rufen in den AO, damit Or-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

274 Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron
pheus in den Gesangswettstreit mit Cheiron tritt. Der Effekt ist nicht zuletztder, dass eine Differenzierung zwischen Orpheus und seinen (musikalischunterlegenen) Gefährten deutlich wird, wenn diese vor allem danach verlan-gen, dass Orpheus ‚laut‘ (#.) auf seiner Kithara spielen möge: Viel-leicht eine raffinierte Anspielung auf den Orpheus des Apollonios, der sei-nen Orpheus etwa gegen die Sirenen (AR 4, 909: ’ ,κ,* ) dadurch gewinnen lässt, dass er schlicht lauter als seineKonkurrentinnen singt. Orpheus weist dieses Ansinnen zunächst taktvollzurück und geht auf das Ansinnen seiner Gefährten, gegen Cheiron in einenWettkampf einzutreten, zunächst nicht ein – aus Scheu vor dem Alter des er-fahrenen Kentauren.
Das Gesangsduell mit Cheiron stellt dabei das erste zweier derartigerDuelle dar, von denen in den AO die Rede ist: Während Orpheus im Wett-streit mit den Sirenen (AO 1264–1290) zum Schutz der Gefährten selbst dieInititative ergreifen wird, zögert er zunächst, auf den Vorschlag der Argo-nauten einzugehen, gegen den guten Kentauren und nur um des Gesangeswillen (_ «), wie dieser selbst es ausdrückt, anzutreten: Bereits imvoraus bahnt sich an, dass Orpheus den älteren – auch von ihm offensicht-lich geachteten – Cheiron besiegen wird (der mit dem gleichen Instrumenteingeführt wird, mit dem auch die Sprechinstanz Orpheus zu Beginn derAO eingeführt worden war, siehe AO 413).
Zur Konstruktion von Ϊ« 3 siehe den Kommentar zu AO 100und 233.
413–418 P« ’ σ K« $ +, | b < ’ % k #A-«. | &O« ’ Ν’ Ν K- &-- , | ?« L $« g « | ’ ³« <H- 6« | % =9 +, %λ « ρ« 0):Unter dramaturgischen Gesichtspunkten nachvollziehbar lässt der Verfasserder AO den Kentauren im Duell gegen Orpheus beginnen. Die Wahl desThemas, das sich Cheiron für sein Lied im Wettstreit mit Orpheus wählt,erscheint dabei plausibel und verwunderlich zugleich. Als Kentaur verfügt ereinerseits über das notwendige Wissen, sowohl den Kampf der Kentaurengegen die Lapithen (der auch als hinter $« R « stehend auf-zufassen ist) als auch die Auseinandersetzung mit Herakles wahrheitgemäßzu besingen. Dieser Aspekt der Wahrheit ist einerseits als epischer Topos zuverstehen; zur besonderen Relevanz in den AO und zum Wahrheitsbezugder von Cheiron und Orpheus vorgetragenen Gesänge siehe aber obenS. 267. Andererseits ist es einigermaßen befremdlich, einen Kentauren vonden unrühmlichen Taten seiner Artgenossen singen zu hören, die er ganzoffensichtlich nicht mit der Absicht vorträgt, die Kentaurenseite zu rühmen(siehe etwa AO 416: $« R «, 418: ,λ "« ρ« 3).
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron 275
Das Wahrheitsmotiv scheint für den Verfasser der AO im Vergleich zu sol-chen Bedenken gegen die Themenwahl überwogen zu haben; zusätzlichwird die herausgehobene Stellung des Cheiron, der sich eben von den ande-ren Kentauren so positiv unterscheidet, durch diese seine nicht beschöni-gende, nüchterne Darstellung noch unterstrichen. Die Erwähnung des dieLapithenschlacht besingenden Cheiron findet sich auch bei Valerius Flaccus(VF 1, 140–143): parte alia Pholoe multoque insanus Iaccho | Rhoetus et Atracia sub-itae de virgine pugnae. | crateres mensaeque volant araeque deorum | poculaque, insignisveterum labor, hierzu näher Nelis (2005), S. 174ff. Für die Darstellung desCheiron bei Silius Italicus siehe den Kommentar zu AO 421f.
Zur Lokalisation der Kentauren siehe den Kommentar zu AO 380. Zurauch für den Rahmen des Gastmahls relevanten Anekdote, wie die Kentau-ren, vom Wein berauscht, über Herakles herfallen und von diesem getötetwerden, siehe den Kommentar zu AO 399–405. Zum Bezug von zu « vgl. Opp., Hal. 2, 555: ’ $ #.
419–431a A*> 0) ) ’ *µ Ω )) ) | % «) ¹λ« $ $+α | 8 $ X« +V, | ³« %U -«, —« ’ O*µ« %« « J, | @« ’* ), « G«, | - λ *- - 5E , | Ρ ’ 0 Ϊ, 8 Ν $’Ν, | λ K :, —« ’ %« F | d$ +« $+α | ’ ² ) , | λ B.«, B, @) ’ 0)’ $α |$6 ’ &) - | d: Zum Thema sei-nes Gesanges wählt Orpheus – wie Cheiron (siehe den Kommentar zu AO413–418) – eine Materie, in der er selbst über autoritatives Wissen verfügt,d.h. eine Kosmo- und Theogonie. Man ist geneigt, wie beim Kentaurenauch hier als Grund für die Wahl durch den Verfasser der AO das Wahrheits-Motiv zu vermuten, dass also der Verfasser der AO für den Vortrag der Or-pheus-Figur ein Thema wählt, das mit diesem in besonderer Weise assoziiertwird, in dem sich Orpheus „gut auskennt“ und zu dessen wahrheitsgemäßerVerkündung er deshalb wohl mehr als jeder andere Potential hat (zum Wahr-heits-Motiv in den AO s.o. S. 15 sowie S. 267).
Dabei ist zu beachten, dass die Theogonie der Verse 421–431 diejenigeTheogonie, die in der Rahmenhandlung (AO 12–32) vorgetragen wurde,zwar ergänzt (Vian, S. 6: „L’œuvre majeure, qui donne lieu à un sommairedétaillé, est une théogonie suivie d’une anthropogonie (v. 12–32), thème quisera rappelé aux v. 421–431), von ihr aber nicht abweicht und somit einemWahrheitsanspruch nicht zuwiderläuft. Zum Problem der Stellung des Ou-ranos in beiden Theogonien siehe unten den Passus zu den Versen AO 422f.(Himmel, Erde, Meer).
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

276 Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron
Die Frage, welche Theogonien bzw. kosmogonischen Vorstellungen undTraditionen im einzelnen im Hintergrund unserer (hesiodisch-orphisch ge-prägten) Passage stehen mögen, wird kaum mit Sicherheit zu beantwortensein (siehe auch S. 49; außerdem Rufinus, Recognit. 10, 30 [=fr. 55 Kern]: omnissermo apud Graecos, qui de antiquitatis origine conscribitur, cum alios multos, tum duospraecipuos auctores habet, Orpheum et Hesiodum. Horum ergo scripta in duas partes intel-ligentiae dividuntur, id est, secundum litteram et secundum allegoriam, et ad ea quidem quaesecundum litteram sunt, ignobilis vulgi turba confluxit. Ea vero quae secundum allegoriamconstant, omnis philosophorum et eruditorum loquacitas admirata est. O. igitur est, qui dicitprimo fuisse Chaos sempiternum …). Bei Apollonios Rhodios (1, 496–511, vgl.etwa 498: " $λ« 3) ist dem Orpheus jedenfalls ebenfalls einkosmogonischer Gesang in den Mund gelegt, wenn auch der Kontext beimAlexandriner (nach dem Streit des Iason mit Idas) gänzlich verschieden ist.
Eine interessante Parallele findet sich zudem bei Silius Italicus (Pun. 11,449–480): Neben der Darstellung, wie Achill von Cheiron musisch erzogenwird, findet sich hier im Rahmen der Aufzählung berühmter Sänger auch dieBeschreibung der Wirkung des Orpheus-Gesangs (dazu siehe die Kommen-tare zu AO 433f. und 436f.) sowie die Andeutung einer Kosmogonie ausdem Munde des Orpheus.
Chaos: In der beschriebenen hesiodisch-orphischen Tradition stehend(siehe auch den Kommentar zu AO 12) nennt Orpheus zu Beginn seineskosmogonischen Hymnos (* m) Chaos als erste Instanz.Der Ausdruck ,%U .« wird dabei nichts anderes bedeuten könnenals die Bezeichnung, wie die in den folgenden Versen genannten InstanzenHimmel, Erde und Meer (sowie Eros?) durch das Chaos erzeugt werden.Zur ‚Abstammung‘ dieser Instanzen sowie des Eros aus dem Chaos siehefrr. 55.56 Kern; siehe auch Vian (1987), S. 179. Zur Bezeichnung des Hym-nos als *« im Sinne einer Enallage siehe Vian (S. 179) mit Verweisauf ähnliche Formulierungen bei Hesiod (Th. 814: $%« '!) oderApollonios Rhodios (AR 4, 1697: " $%«) sowie parallele Wortbildun-gen etwa in AO 513 (*«).
Himmel, Erde, Meer: ~ Hes. Th. 117 (n!’ -.«), 931f. (%«| "); HO 23, 4 (κ C ) Dass Ouranos nach dem Chaos alsdie zweite Instanz im Verlauf der Weltschöpfung genannt wird, stellt auf denersten Blick die einzige wirkliche Abweichung von der Reihenfolge der Kos-mogonie zu Beginn der AO dar, wenn Ouranos dort (AO 18) erst nachChaos, Chronos, Aither, Eros, Nyx und Brimo genannt wird. Allerdings er-folgt die Nennung des Ouranos im Kontext des Proöms wohl nicht inner-halb der ‚Chronologie‘, sondern zur Bezeichnung der Herkunft der Gigan-ten, für die er ja bereits vorausgesetzt wird.
Die Nennung der drei Instanzen Himmel, Erde und Meer, die alsGrundbestandteil fast aller (griechischen) Weltentstehungsmythen (Du-
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron 277
chesne-Guillemin [1962], Sp. 1469) nicht als spezifisch orphisch gelten müs-sen, ist dem Orpheus, wie erwähnt, auch in der Kosmogonie bei Apollonios(AR 1, 496: 5H ’ ³« ! λ -µ« C % …) in den Mund ge-legt.
Mit der Formulierung ,« "« V ist vor dem Hintergrund ähnlicherTexte der wesentliche Unterschied zwischen Chaos als dem Ν und denspäteren, ‚gestalteten‘ Instanzen Himmel, Erde, Meer und Eros (s.u.) ge-meint (siehe fr. 55 Kern: 8H« X%« , Ρ #O. ]µ ", , $ « m« " …). Das Bild verfügt also – imUnterschied etwa zu in erster Linie dichterischen Formulierungen von der„unendlichen Erde“ (AO 20) – durchaus über eine ernstzunehmende kos-mogonisch-philosophische Dimension.
Eros: Zur Stellung des Eros und seiner Erwähnung direkt im Anschlussan die Instanzen Himmel, Erde und Meer als vierter ‚Spross‘ des Chaossiehe auch Proklos, In Parmen. p. 1175, 7f. (= fr. 67 Kern/fr. 106 Bernabé).Bei diesem wird der chaotische Urzustand vor der Scheidung der einzelnenElemente geschildert ($# %# 1# 9 4$),den erst Eros-Phanes beendet.
Das hohe Alter des Eros (und damit auch seine wichtige Position für dieEntstehung weiterer kosmischer Instanzen und Götter: Ρ ’ 3Ϊ) ist sowohl in der hesiodischen (Th. 120) wie auch in orphischenTheogonien als den beiden maßgeblichen ‚Varianten‘ griechischer Theogo-nien (s.o.) bezeugt. Zum Problem der Bezeichnung des Eros als Eros (undnicht als Phanes o.ä.) im Rahmen orphischer Theogonien siehe den Kom-mentar zu AO 14. Neben den beiden erwähnten theogonischen Traditionen(zu weiteren Vorlagen unserer Partie siehe Kern, S. 100 [=fr. 29]) ist die Be-zeichnung des Eros als „ältester“ wie im vorliegenden Fall aber auch aus pla-tonischen Kontexten vertraut (siehe Platon, Symp. 178b1: […] , !«. ρ µ µ [5E#] …, V ’ Ρ« […]).
Bereits in den Versen AO 14f. war Eros mit diversen Epitheta versehenworden, die auch in anderen Kontexten Verwendung finden. Zur Bezeich-nung -*« vgl. etwa Ps.-Iustin, De mon. 2, p. 104e-105b (III 132 Otto)[=fr. 245, 8 Kern] sowie Aristobulos bei Eusebios fr. 245, 8 (Textvariante)[= fr. 247, 10 Kern], allerdings ohne dass dort Eros explizit als die bezeich-nete Gottheit genannt würde. Seine Bezeichnung als .« ist sonst nir-gends bezeugt.
Kronos: Die Bezeichnung des Kronos durch das Hapax legomenon )-"« verweist in kürzest möglicher Form auf die bekannte Überlieferung,nach der Kronos seine Kinder verschlang – aus Furcht vor dem Verlust sei-ner Herrschaft.
Zeus: In wenigen Worten wird der weitere Verlauf der ‚olympischen Ge-schichte‘ durch den Verfasser der AO skizziert: Die Herrschaft geht von
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

278 Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron
Kronos auf dessen Sohn Zeus über (hier bezeichnet mit dem seit den home-rischen Werken [vgl. Il. 1, 419 u. ö.] üblichen Epitheton ‚blitzeschleudernd‘bzw. ‚blitze-froh‘).
Brimo, Bakchos, Giganten: In der Reihenfolge, dass zuerst die Errichtungder Zeus-Herrschaft mit der anschließenden Entstehung bzw. Zeugung wei-terer Götter (AO 428: ²"# %# " ) genanntwird, folgt die Darstellung der Reihenfolge bei Hesiod (Th. 886ff.). Eineexakte Deutung dessen, was im vorliegenden Fall mit dem Ausdruck ‚«‘gemeint ist, fällt bei der extremen Kürze des Ausdrucks allerdings schwer:Der Kontext ist zu wenig konkret, um eine eindeutig identifizierbare Bege-benheit aus dem Mythos zu suggerieren. Vian verweist darauf, dass sich eineanaloge Formulierung bei Platon (Pol. 379e: ( 3 λ ) auf dasParisurteil beziehe (Vian [1987], S. 105 ad 428), dass also von einer ‚Probe‘(mise à l’ épreuve) die Rede ist. Womöglich sei deshalb hinter der Erwäh-nung der „späteren Götter“ (die offensichtlich nicht der Generation desZeus angehören) z.B. Dionysos oder auch der – vergöttlichte – Herakles an-zunehmen; dies offensichtlich deshalb, weil Dionysos wie Herakles im My-thos selbst mit verschiedenen ‚Proben‘ assoziiert werden; womöglich istauch an den Kampf der Olympier mit den Giganten, die sogenannte Gigan-tomachie, zu denken (siehe etwa Apollodor 1, 34–38): v.a. Herakles, aberauch Dionysos tragen ja wesentlich zum Sieg der Götter über die Gigantenbei [zum Lohn des Herakles siehe bereits Hesiod, Th. 954f.]. Die Erwäh-nung (ihrer) « (im Sinne von «, siehe Vian a.a.O.) würde soeine plausible, wenn auch kaum zwingend notwendige Erklärung finden.
Erschwert wird das Verständnis noch durch die Fortführung der Satz-konstruktion im folgenden Vers: Es stellt sich die Frage, ob " auch auf B « und B%$ zu beziehen ist, d.h. ob die Identität der²"# %# durch die Nennung von Brimo (die in der Antike in derRegel entweder mit Artemis-Hekate oder mit Demeter identifiziert wurde,siehe Kern [1897], Sp. 853) und Bakchos als Vertretern einer jüngeren Göt-tergeneration näher ausgeführt wird, oder ob die Nennung von Brimo undBakchos wie die der Giganten auf die 3’ $ zu beziehen ist. Da letzte-res inhaltlich kaum zu begründen ist, ist Wests Vorschlag in Erwägung zuziehen, das zwischen B « und B%$ zu setzen, um deren Nen-nung als explikative Apposition zum Ausdruck „" “ zu ver-deutlichen. Mit der Erwähnung der 3’ $ der Giganten setzte dann –gekennzeichnet durch die Partikel ’ – ein neuer Gedanke ein. (Zur Naturder 3’ $ siehe den Kommentar zu AO 17f.) Unklar bleibt aber auchbei einer solchen Annahme, was mit der erwähnten « gemeint seinkönnte. An Vians Text ist deshalb bis auf weiteres festzuhalten.
Dass im Rahmen einer (wenn auch knappen) Weltentstehungsschilde-rung nach der Erwähnung göttlicher Urinstanzen (Chaos, Himmel, Erde,
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron 279
Meer) sowie der Götter (Eros, Kronos, Zeus, Brimo, Bakchos) zuletzt auchdie Menschen erwähnt werden, kann als für alle griechischen Kosmogonienkonstitutiv gelten.
Zu den verschiedenen in den AO genannten Instrumenten siehe denKommentar zu AO 72.
431b–441 Rµ 8 > « d *κ | π« « κ, )-«α | 0 ’ Ν λ Ν) + | P,"U« > -« d )«. | K <’ ¹ 8 QQ %’ Κ%6 | ’ %)α « ’ $« $« | +))« $Q« 0α | : ’ %. -K- | (« , « ’ % «. | A*> ²K« % (’ %λ ) | µ % , σ« ’ d²9: Insbesondere die Darstellung bei Silius Italicus (Pun. 11, 466–467:Cum silvis venere ferae, cum montibus amnes, | immemor et dulcis nidi positoque volatu |non mota volucris captiva pependit in aethra.) stellt eine interessante Parallele zumBild der Vögel, die vor Verzückung das Fliegen und die eigenen Nester ver-gessen, dar. Die Eindringlichkeit des Bildes lässt eine gemeinsame Vorlageals möglich erscheinen, doch auch der direkte Bezug ist denkbar. Die zahl-reichen Indizien für die Rezeption auch lateinischer Literatur durch den Ver-fasser der AO sprechen für eine solche Annahme (siehe bereits Venzke[1941]). Anders argumentiert Nelis (2005), S. 176 („It is very unlikely indeedthat „Orpheus“ is here directly imitating Silius Italicus“), der im Anschlussan die hier zitierte Stelle Überlegungen zur von ihm als notwendig konsta-tierten gemeinsamen Quelle anstellt (seiner Meinung nach ein orphischerText womöglich aus der Zeit vor [ ! ] Apollonios Rhodios), S. 176 und 184:„But the simple question still to be answered: was an Orphic text the com-mon source of Apollonios Rhodios, Valerius Flaccus, Silius Italicus and„Orpheus“?“ (…) From all the Orphic material surveyed by Martin West,the most obvious candidate, given that we are dealing with epic poets, mustbe the Cyclic theogony, i.e. the text, best preserved for us by Apollodorus,which was placed at the beginning of the Epic Cycle.“ Ähnliche Skepsis inbezug auf die direkte Rezption lateinischer Dichtung durch den Verfasserder AO deutet auch Vian an (1987), S. 22: „Bien que le poète soit presqueexclusivement tributaire d’ Apollonios, au moins dans la première partie deson œuvre, il lui arrive de quitter son modèle, non pour s’abandonner à sapropre fantaisie, mais pour s’inspirer d’autres traditions, dont certaines sontconnues par la poèsie latine. Voici un recensement des principaux passagesqui attestent ces contaminations avec plus ou moins de certitude.“). ZurMöglichkeit der Kenntis und direkten Rezeption lateinischer Literatur durchgriechischsprachige Autoren – von der im Fall der AO auszugehen ist (s.o.) –siehe aber umfassend Gärtner (2005), S. 280–287.
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

280 Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron
Im Gegensatz zur Schilderung der Wirkung des Orpheus-Gesangs aufdie belebte und unbelebte Natur betritt der Verfasser der AO mit der Schil-derung der Reaktion des Kentauren (soweit wir sehen können) literarischesNeuland. Das Bild des zum Orpheus-Gesang tanzenden, stampfenden undden Takt schlagenden Cheiron, das der Verfasser der AO beim Rezipientenevoziert, ist unerwartet und damit reizvoll. Zur Bedeutung der Formulie-rung $!’ ,λ )( | µ ,# im Sinne von „schlug mit der einenHand | kräftig aufs Handgelenk der anderen“ bzw. „in die Handfläche deranderen“ siehe auch die Bemerkung Vians (1987), S. 179 ad 441 mit Verwei-sen auf Nonnos (Dion. 2, 64. 464; 12, 198; 25, 35; 37, 682) und das Etymolo-gicum Magnum 492, 23–25 Gaisford (s.v. «). Die Parallele in der Darstel-lung des Kenaturen Cheiron durch den Verfasser der AO zur Schilderungdes Zyklopen in der Odyssee (9, 298), was die Beschreibung der körperlichenErscheinung und beider Größe angeht (AO 394f.), wird abgerundet durchdie Erwähnung der Ställe des Kentauren vor seiner Höhle (. K-.).
Zur Frage der genauen Lokalisation des Wettstreits zwischen Orpheusund dem Kentauren im Innern der Höhle oder davor siehe den Kommentarzu AO 393. Zum bewaldeten Pelion siehe den Kommentar zu AO 369f; zuden einzelnen in den AO genannten Instrumenten siehe den Kommentar zuAO 72.
442–449 T(« ’ : Ω« Ν <’ % | τ »M-. #E)Ω ’ Ν $+α | ¹ 8 « d), 0 8 -’g«. | P( ’ % $) $ ¹ P#« | <’ 0- + λ Ν > | ) α + 8 ’#A-«. | A*> %λ K« 9 )« k λ | -, + , : Das Motiv der sich bzw. den ‚Zeitplan‘ ver-gessenden Argonauten ist fester Bestandteil aller überlieferten Argonauten-epen. Es findet sich neben weiterer Verwendung in den AO (AO 480–483 inbezug auf den Aufenthalt auf Lemnos) auch bei Apollonios Rhodios (AR 1,861ff.) und Valerius Flaccus (VF 2, 369ff.). Indem es in den AO in Verbin-dung mit der Cheiron-Episode statt dem Lemnos-Aufenthalt verwendetwird, wird in gleichem Maße die betörende Wirkung der Orpheus-Musik wiedie Vermeidung einer erotisch aufgeladenen Szene deutlich.
Wie zu Beginn der Cheiron-Episode davon die Rede war, dass die Mut-ter den kleinen Achill auf ihrem Arm trug (AO 386: , $ - ), so wird dieses Motiv zum Abschluss der Szene durch die Erwäh-nung des Vaters wieder aufgenommen und die Szene auf diese Weisegeschlossen. Ihren zweiten Abschluss findet die Cheiron-Episode im Ab-schiedskuss, den Peleus seinem Sohn Achill gibt: Mit einem Kuss (AO 400)hatte der Kentaur die Argonauten in seiner Höhle begrüßt. Die Fähigkeit
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

Der Aufenthalt der Argonauten bei Cheiron 281
des Verfassers der AO, unter Einbeziehung intertextueller Bezüge einenselbständigen, in sich geschlossenen und sogar emotional aufgeladenenKontext zu schaffen, ist in der vorliegenden Szene besonders gut greifbar,vgl. Od. 16, 15 (. " * λ Ν# % 9); Il. 6, 484 (- % [sc. Andromache]); VF 1, 257–259.
Nähere Aufmerksamkeit erfordert die Erwähnung des Geschenks, dasCheiron dem Orpheus zum Abschied überreicht. Vians Erläuterungen(1987), S. 106 ad 449 vermögen zwar, eine Vorstellung des Präsents zu ver-mitteln, wenn er " mit „une peau de faon tigrée“ übersetzt:Mit " dürfte aber nicht nur ein wie auch immer geartetes „Hirsch-kalbfell“ näher (als ‚getigert‘) beschrieben werden; der Symbolcharakter desGeschenks ist in jedem Fall zu berücksichtigen. So wird « erstens alst.t. für die Tracht des Dionysos und seiner Bakchanten und Bakchantinnenverwendet, was sie als Geschenk für Orpheus bereits hinreichend qualifi-ziert. Zweitens dürfte die Bezeichnung der « als ‚vom Panther stam-mend‘ auf die vielfältigen Konnotationen abzielen, die mit der Erwähnungdieses Tieres einhergehen: Nicht nur soll Kybele (als eine für die AO [sieheAO 22] relevante und mit diversen Mysterienkulten verbundene Gottheit)als Kind von Panthern aufgezogen worden sein (Diod. 3, 58, 1), die sichdeshalb wohl auch in ihrem Gefolge befinden (siehe Jereb [1949], Sp. 751),sondern man setzte den Panther in besonderer Weise mit Dionysos in Ver-bindung (Ovid, Met. 3, 669; Nonn., Dion. 15, 194; 23, 126). Diese Verbin-dung ist wiederum vor dem Hintergrund des in den AO verarbeiteten undmit der Orpheus-Figur in besonderem Maße verbundenen Aspektes der(dionysischen) Mysterienkulte (siehe etwa Hdt. 2, 81) in der Person desNarrators Orpheus besonders präsent (zur ,enzyklopädischen‘ Technik s.o.S. 42f.). Über Konnotationen im dionysisch-kultischen Bereich hinaus be-gegnet das Pantherfell außerdem im Umfeld des Argonautenmythos, wennbei Pindar (4. Pyth. 140) davon die Rede ist, dass Iason auf seinem Weg zuPelias ein Pantherfell trägt, welches er zuvor von Cheiron zum Geschenk ( ! )erhalten hat: „Ebenso wie bei Dionysos scheint auch bei den Kentauren dasP.-Fell neben und an Stelle der « getreten zu sein.“ (Jereb [1949],Sp. 752).
450–454 #A’ Ρ κ +))« $« 0, | Ν« % -« ² ) $> (« $ | =« », #« ’ %«, | 8 M- :8 « %µ $ | ²«. %« : Wünscht der Kentaur, der Sohn derPhilyra, in der Darstellung bei Apollonios Rhodios den Argonauten eben-falls eine sichere Heimkehr (AR 1, 556: ,* $""), so wird diese Bitte in den AO ergänzt um das Motiv des Wun-sches nach Ruhm bei den späteren Generationen, den sich die Argonauten
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM

282 Die Fahrt der Argonauten von Cheiron zu Kyzikos
mit ihrer Fahrt erwerben mögen (siehe auch AO 95). Die Ethopoiie desCheiron, die sich in ihrer durchweg positiven Darstellung durch die gesamteSzene des Aufenthaltes der Argonauten bei dem Kentauren zieht, findet inder Segensbitte für diese ihren Abschluss und Höhepunkt: Die Anrufung al-ler Götter durch Cheiron stellt gleichzeitig den Höhepunkt in der Darstel-lung des Cheiron in starkem Kontrast zur Figur des Zyklopen in der Odysseedar, der Odysseeus und seine Gefährten nach deren Aufenthalt in seinerHöhle ebenfalls bis zum Ufer ‚begleitet‘, sie dann aber verflucht.
AO 455–489: Die Fahrt der Argonauten von Cheiron zu Kyzikos über Sa-mothrake und Lemnos: In die Gestaltung der Fahrtroute vom Pelion, derHöhle des Cheiron, zu König Kyzikos an der Küste der Propontis wird derim Rahmen der Argonautenliteratur beliebte und häufig ausführlich behan-delte Aufenthalt der Argonauten auf Lemnos und die damit verbundenenamourösen Abenteuer durch eine nur angedeutete Schilderung derselben insolcher Weise integriert, dass die Sprechinstanz Orpheus die Episode nur imStile einer praeteritio streift (zur für die Darstellung der AO charakteristischenVermeidung affektbezogener Schilderungen s.o. S. 10). Damit einherge-hend ist die Schilderung in den AO von einem gewissen Übergangscharak-ter geprägt und hat – von einigen Details wie der frühen Erwähnung des Pe-lion ganz abgesehen – schon in der Knappheit der Darstellung größereÄhnlichkeit mit der bei Valerius als mit der ausführlicheren bei Apollonios.Siehe Vian (1987), S. 106: „La matière de ce développement est presque en-tièrement tirée d’Apollonios (…). Le poète se borne à situer l’épisode deChiron avant et non pendant le périple et à intervertir les escales de Lemnoset de Samothrace; dans les deux cas, le changement se fait aux dépens de lagéographie. Conformément à l’esprit de l’œuvre, l’escale de Samothrace estmise en valeur, alors que celle de Lemnos, où les Argonautes s’abandonnentà de coupable amours, est expédiée en quelques vers réprobateurs qui impli-quent une critique évidente d’Apollonios.“ Über weitere mögliche Hypo-texte – etwa aus dem Bereich der geographischen Fachliteratur – kann nurspekuliert werden.
Das Mittel der praeteritio setzt der Verfasser der AO an verschiedenerStelle (siehe AO 1347) ein, um Episoden, die in anderen Versionen des Ar-gonautenmythos, namentlich bei Apollonios, ausführlicher geschildert wer-den, nicht ausführen zu müssen. Die Motivation mag von Fall zu Fall variie-ren und nicht zuletzt in der Notwendigkeit der Raffung und Auslassungeiniger Episoden liegen, die bei der insgesamt kürzeren Gesamtlänge desEpos unumgänglich ist. Im Fall der Lemnos-Episode kommt hinzu, dassdiese dem Aspekt des Affekthaft-Erotischen besonders verhaftete Szenenicht recht zu dem (neu-) platonischen Hintergrund der AO und damit der
Brought to you by | Heinrich Heine Universität DüsseldorfAuthenticated | 93.180.53.211
Download Date | 12/17/13 9:49 AM