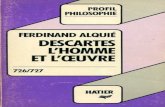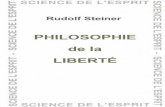La philosophie de la vie de Hans Jonas à la rencontre du ...
Philosophie im Mittelalter - epub.ub.uni-muenchen.de · La conception de la philosophie au moyen...
Transcript of Philosophie im Mittelalter - epub.ub.uni-muenchen.de · La conception de la philosophie au moyen...

Philosophie im Mittelalter Entwicklungslinien und Paradigmen
Herausgegeben von
Jan P.Beckmann, Ludger Honnef eider,
Gangolf Schrimpf und Georg Wieland
FELIX MEINER VERLAG HAMBURG

Urtiversitdts-
BibJioîhek
M ü n c h e n
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Philosophie im Mittelalter I hrsg. von Jan P. Beckmann . . . - Hamburg : Meiner, 1987.
ISBN 3-7873-0747-8 NE: Beckmann, Jan P. [Hrsg.]
© Felix Meiner Verlag GmbH, Hamburg 1987. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte durch alle Verfahren wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien, soweit es nicht §§ 53 und 54 URG ausdrücklich gestatten. - Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn. Druck: WS-Druckerei, Mainz, Buchbinderische Verarbeitung Georg Kränkl, Heppenheim. Printed in Germany.

INHALT
I. URSPRÜNGE UND ANFÄNGE: VOR- UND FRÜHSCHOLASTIK
Bausteine für einen historischen Begriff der scholastischen Philosophie . . 1
Von Gangolf Schrimpf, Fulda
Zur mittelalterlichen Geistesgeschichte. Die Eigenart des europäischen Mittelalters und seines Denkens aus der Sicht Japans 27
Von Chumaru Koyama, Tokio
Die Selbsttranszendenz des Denkens zum Sein. Intentionali tätsanalyse als Gottesbeweis in »Proslogion«, Kap . 2 39
Von Klaus Riesenhuber, Tokio
IL DER SCHRITT ZUR UNIVERSALEN GESTALT! DAS PHÄNOMEN DER SCHOLASTIK
Rationalisierung und Verinnerlichung. Aspekte der geistigen Physiognomie des 12. Jahrhunderts 61
Von Georg Wieland, Trier
Éthique et connaissance de soi chez Abélard 81
Par Gérard Verbeke, Louvain
Kategorien der Sittenlehre. Gedanken zur Sprache der Mora l in einem Logik-Kompendium des 12. Jahrhunderts 103
Von Klaus Jakobi, Freiburg
A Parallel in the East to the »Logica Vetus« 125
By Shlomo Pines, Jerusalem
Le «De generatione et corruptione» d' Avicenne en traduction latine médiévale 131
Par Simone Van Riet, Louvain-la-Neuve
Wilhelm von Auvergne und die Transformation der scholastischen Philosophie im 13. Jahrhundert 141
Von Gabriel Jüssen, Bonn

X Inhalt
III. PHILOSOPHIE ALS EIGENE DIMENSION: DIE ENTWÜRFE DER HOCHSCHOLASTIK
Der zweite Anfang der Metaphysik. Voraussetzungen, Ansätze und Folgen der Wiederbegründung der Metaphysik im 13./14. Jahrhundert 165
Von Ludger Honnef eider, Berlin
L a conception de la philosophie au moyen âge. Nouvel examen du problème 187
Par Fernand Van Steenberghen, Louvain-la-Neuve
Thomas Aquinas on Substance as a Cause of Proper Accidents 201
By John F. Wippel, Washington D. C.
«Omnis corporis potentia est finita.» L' interprétat ion d'un principe aristotélicien: de Proclus à S. Thomas 213
Par Carlos Steel, Louvain
» . . . sie reden, als ob es zwei gegensätzliche Wahrheiten gäbe.« Legende und Wirklichkeit der mittelalterlichen Theorie von der doppelten Wahrheit 225
Von Ludwig Hödl, Bochum
Avicennas Auffassung von der Schöpfung der Welt und ihre Umbildung in der Philosophie des Heinrich von Gent 245
Von Raymond Macken, Löwen
Natura ad unum - ratio ad opposita. Zur Transfomation des Aristotelismus bei Duns Scotus 259
Von Fernando Inda rte, Münster
IV. ANALYSE UND KRITIK: DIE DIFFERENZIERUNG DER SCHOLASTIK IM SPÄTEN MITTELALTER
Allmacht, Freiheit und Vernunft. Zur Frage nach »rationalen Konstanten« im Denken des späten Mittelalters 275
Von Jan P. Beckmann, Hagen
Zur Authentizi tät der naturphilosophischen Schriften Wilhelms von Ockham 295
Von Gerhard Leibold, München

Inhalt XI
Res and Signum - O n the Fundamental Ontological Presupposition of the Philosophy of Wil l iam Ockham 301
By B. Ryosuke Inagaki, Fukuoka (Japan)
War Ockham ein Antimetaphysiker? Eine semantische Betrachtung 313
Von Lammen Marie de Rijk, Leiden
Robertus Anglicus O F M und die formalistische Tradition 329
Von Wolfgang Hubener, Berlin
Die philosophischen Wissenschaften an der Krakauer Universität im 15. Jahrhundert 355
Von Mieczyshw Markowski, Krakau
V. TRANSFORMATION UND KONTINUITÄT: MITTELALTER UND MODERNE
Neuzeit vor der Neuzeit? Zur Entdramatisierung der Mittelal ter-Neuzeit-Zäsur 369
Von Odo Marquard, Gießen
Vom Mittelalter zur Neuzeit. A m Beispiel der Modali täten 375
Von Josef Simon, Bonn
Thomas von A q u i n und die Neuzeit 387
Von Wilhelm Korff München
Naturgesetz und Bindung Gottes 409
Von Rainer Specht, Mannheim
Wie beurteilt Leibniz den ontologischen Gottesbeweis? 425
Von Albert Zimmermann, Köln
Reziproke Beziehungsstufung bei Johannes Duns Scotus, Luis de Mol ina und J . G . Fichte 439
Von Harald Holz, Münster
Wertorientierung durch Wissenschaft? Z u m Wandel des Verhältnisses von Wissenschaft und Bildung 455
Von Hans Michael Baumgartner, Bonn
PERSONENREGISTER 467

Thomas von Aquin und die Neuzeit
VON WILHELM KORFF, MÜNCHEN
1
Wir rekurrieren auf das Denken der Vergangenheit, um uns der Wahrheitsüberstiege zu vergewissern, von denen wir heute leben. In einer sich zunehmend als Einheit erfahrenden Menschheit treten Kriterien zutage, die sich zugleich als Bausteine ihrer Herkunftsgeschichte erweisen. Von hier aus kommt Thomas eine neu zu entdeckende Schlüsselbedeutung zu.
2
Al le wesentlichen Entwicklungslinien der Geschichte der westeuropäischen Gesellschaft lassen sich einem zentralen, in entscheidenden Zügen christlich interpretierten Leitgedanken zuordnen: der Aufdeckung, Entfaltung und Sicherung des Subjektstatus des Menschen. In der mit zunehmender Ausgestaltung immer deutlicher hervortretenden Effizienz dieses Ansatzes liegt zugleich der Grund seiner überaus raschen, weltweiten Rezeption und Universalisierung, über den sich heute die Menschheit als Ganze zusammenzuschließen beginnt. In ihm scheint der Strukturkern des Menschseins selbst getroffen. Hieran kommt Thomas ein Antei l zu, der in seinen Konsequenzen längst nicht ausgeschöpft ist.
3
Zwischen Mittelalter und Neuzeit legen wir gewöhnlich eine Zäsur , bei der es weniger um genaue zeitliche Fixierungen als um sich über viele Einzelschritte vollziehende fundamentale Veränderungen in der Grundausrichtung des Denkens geht. Sucht sich mittelalterliches Denken angesichts des Leidensdrucks der Welt und der Unausweichlichkeit menschlicher Schulderfahrung der Wahrheit Gottes über den Menschen vorgängig aus Gottes Heilshandeln zu vergewissern und hieraus seine Würde als Subjekt zu bestimmen, so weitet neuzeitliches Den-

388 Transformation und Kontinuität • W. Korff
ken das, was der Mensch von Gott erhofft, auf die Welt als Schöpfung hin aus. Insofern ist der Satz des Thomas »gratia supponit naturam et perficit e a m « 1
theologisch bereits ein zentraler neuzeitlicher Satz.
4
Mein Interesse an Thomas zielt auf ein theologisch konsistentes Begründungsverständnis der neuzeitlichen Vernunft. In deren Ausweitung auf die Welt hin ist die Eigenständigkeit der irdischen Wirklichkeiten bereits vorausgesetzt. Genau hier beginnt das Problem der »Legitimität der Neuzeit« als theologisches Problem. Gott ist nicht Substitutionsprinzip seiner Schöpfung, sondern deren Ursprungs- und Vollendungsprinzip.
5
Schöpfung meint bei Thomas nicht einfachhin Fertigung im Sinne von Fertigstellung. Das ins Dasein Gerufene geht nicht darin auf, daß es ist, sondern d a ß es sich verwirklicht, erfüllt. »Jedes Seiende ist seiner eigenen Tätigkeit und Vollendung wegen d a . « 2 Erst aus der Dynamik der in ihm liegenden Wirkkraft zu dem ihm eigenen Tätigsein vermag es zu gelingen, gewinnt es die ihm je eigene sinnhafte Gestalt und Reali tät . Das gilt im Prinzip für alle geschaffenen Möglichkei ten, von der unbelebten Materie bis hin zum Menschen. Thomas wendet sich damit insbesondere gegen jene in der islamischen Philosophie seiner Zeit vertretenen Positionen, nach denen alle Wirkkraft der geschaffenen Dinge unmittelbarer Ausdruck des Wirken Gottes ist, so daß ihnen jede Fähigkeit zur Eigentät igkei t abgesprochen wird. Eben dies aber hieße nach Thomas nicht nur die Digni tä t der Kreatur herabmindern, sondern auch die Vollkommenheit der schöpferischen Macht Gottes selbst verkleinern und in Frage stellen. 3 Der Schöpfungsakt würde entleert, die Welt zur Marionette eines in seiner Allmacht reduzierten Gottes.
/ à
Wenn es aber nun zum Wesen eines jeden geschaffenen Seins gehör t , aus sich selbst heraus tätig zu sein, so schließt dies nach Thomas noch ein weiteres ein: Auch die »Form«, die A r t und Weise der Tätigkeit des jeweiligen Seins kann nicht
1 STh I, 1, 8 ad 2; M I , 99, 2 ad 2. 2 STh I, 65, 2. 3 ScG III, 69.

Thomas von Aquin und die Neuzeit 389
unabhängig von der Struktur dieses Seins selbst gedacht werden, sondern steht mit ihr in einem ursächlichen Zusammenhang. Sein ist Tätigsein gemäß der ihm eigenen Wirkkraft und Form. 4 Von hier aus gelangt Thomas zu dem generellen Ax iom: agere sequitur ad esse in actu - das Tätigsein folgt auf das Wirklichsein. 5
Die Zielrichtung der Argumentation ist offensichtlich keine andere als vorher. Sie dient der Verdeutlichung und Unterstreichung desselben schöpfungstheologischen Sachverhalts. Die Schöpfungswirklichkeit stellt sich in all ihren Erscheinungsformen als eine dynamische, zu eigentätigem Sein befähigte G r ö ß e dar. Von daher ist es völlig unstatthaft, das thomanische A x i o m in Anwendung auf das Zuordnungsverhäl tnis von Sein und Sollen beim Menschen als ein ethisches Ax iom zu nehmen und auf dieser Grundlage den sich für den Menschen ergebenden konkreten sittlichen Sollensforderungen eine unmittelbar ontologische Legitimation zu verschaffen. Unter dieser »seinsethischen« Voraussetzung, für die man sich mit dem bekannten »agere sequitur esse« zudem noch eine eigene verkürzte Formel zurechtlegt, käme dann der praktischen handlungsleitenden Vernunft in der Tat nur die Funktion eines Ablese- und Exekutionsorgans zu. Das aber steht eindeutig gegen das Begründungsverständnis des Ethischen bei Thomas. Wollte man tatsächlich die Zuordnungsbestimmung von Sein und Tätigsein auf die Besonderheit des menschlichen Handelns als eines spezifisch ethischen Handelns anwenden, so würde dies im Gegenteil von Thomas her gerade die Einzigartigkeit dieser Zuordnung hervortreten lassen: Das Sein des Menschen, aus dem sich für ihn die sein spezifisch eigenes Tätigsein als Sinn ermöglichende und Sinn realisierende Vollzugsform ergibt, ist kein statisch ausdefiniertes, sondern wesenhaft entwurfsoffenes, sich selbst aufgegebenes Sein. Der Mensch ist »sui causa«, Wesen der Selbstursächlichkeit . 6 Gerade darin unterscheidet er sich ja von allen übrigen Geschöpfen. Das Spezifische seines Tätigseins ist vernunftbestimmtes Tätigsein, kraft dessen er sein Leben zu führen und zu gestalten vermag, so daß er darin in eigener Weise teilhat an der schöpferischen Tätigkeit Gottes.
7
Die Kompatibil i tät solch schöpfungstheologisch geführter Über legungen mit den Argumentationen heutiger, bei der Sonderstellung des Menschen, seinem Subjektstatus, ansetzender Handlungstheorien liegt auf der Hand. U m so gewichtiger schlägt es deshalb zu Buche, daß in dieser für das Begründungsverständnis des Ethischen zentralen Frage nicht die originäre Konzeption des Thomas den Sieg
4 ScG I, 43. 5 ScG III, 69. 6 De Ventate 24, 1; cf. 22, 6 ad 1.

390 Transformation und Kontinuität • W. Korff
davontrug, sondern die essentialistisch verkürzten Deutungen seiner spät- und neuscholastischen Rezipienten. Damit wurde die Neuzeit in der Tat um eine theologisch wesentliche Einsicht gebracht, und zwar letztlich zum Nachteil für ihr Vertrauen in die Universalität der christlichen Wahrheit selbst. D ie Dissoziation von christlichem Glauben und der sich in vielen ihrer Wege weit von ihrem christlichen Ursprung entfernenden neuzeitlichen Rational i tät erfolgte nicht grundlos. In jedem Fall aber hat das, was an Engführungen in der christlichen Moralbegründung bis in einzelne kirchliche Verlautbarungen hinein bis heute immer wieder durchschlägt, hier seine Wurzel. Es kann deshalb nicht wundern, daß dies auch innerkirchlich, bei den Gläubigen selbst, eine eigene Akzeptanzproblematik in Sachen der Mora l hat entstehen lassen.
8
Was den theologischen Ansatz seiner Mora lbegründung betrifft, sehe ich bei Thomas selbst nirgends einen Schatten von Heteronomie.
9
Im Prolog zum ethischen Teil seiner Summa ist der theologisch-anthropologische Grundakkord angeschlagen: Der Mensch ist B i l d Gottes kraft seiner Selbstmächtigkeit als Vernunft- und Freiheitswesen. E r ist Prinzip der ihm eigenen Tätigkeiten und hat damit Gewalt über seine Werke. Die erschaffende Tätigkeit Gottes kulminiert in der Hervorbringung des Menschen als eines Wesens, das an dessen schöpferischer Herrschaft aktiv teilhat.
10
Hier liegt zugleich der zentrale Gedanke des thomanischen Gesetzestraktats, wie er in Summa theologiae I—II, 90-108 entwickelt ist, nämlich menschliche Normativität in ihrer Gründungslogik theologisch-ethisch so zu fassen, daß darin einerseits Gott als Grund und Zie l dieser Normativität und andererseits der Mensch als das sich selbst normativ entwerfende Wesen erkannt und gewahrt bleibt. Erschlossen wird dies über den Begriff der lex aeterna, des »Ewigen Gesetzes« als der alles umfassenden Vernunft, mit der Gott als creator et guber-nator universi die Welt erschafft, trägt und lenkt. Hieran hat der Mensch in doppelter Weise teil, zum einen, kraft des Schöpfungshandelns Gottes, durch die lex naturalis, zum andern, kraft des Heilswillens Gottes, durch die lex divina. Entscheidend für jede weitere Auslegung dieser Zusammenhänge ist, wie dies insbesondere W. Kluxen deutlich gemacht hat, die hier von Thomas in ganz

Thomas von Aquin und die Neuzeit 391
eigener Weise vorgenommene analoge Verwendung des Gesetzesbegriffs.7 Deshalb m u ß bei den herausgestellten Weisen der lex sehr genau zwischen Gesetz als positiv formulierter oder formulierbarer Norm und Gesetz als Metanorm, als rein dispositiver, ungeschriebener Wirkgröße unterschieden werden.
11
Gerade die lex naturalis wird von Thomas im Sinne einer rein dispositiven Größe gefaßt.
12
A l s schöpfungsmäßig gegebene Grundlage allen sittlichen Handelns liegen die ersten Prinzipien der lex naturalis in der menschlichen Vernunft selbst.8 So wie diese Vernunft, weil auf Wahrheit schlechthin angelegt, im Vollzug ihres Erkennens der Unterscheidung von wahr und falsch fähig ist, so vermag sie als handlungsbezogene, praktische Vernunft nach gut und böse zu unterscheiden. In beiden Hinsichten folgt sie hierbei dem Prinzip der Nichtkontrar ie tät : E i n Sachverhalt bzw. eine Handlung läßt sich, unter Heranziehung ein und derselben G r ü n d e , nicht zugleich als wahr und als falsch bzw. als gut und als schlecht behaupten. Menschliche Vernunft strebt sonach als erkenntnisbezogene wie als handlungsbezogene Vernunft nach Übere ins t immung mit sich selbst. Sie ist auf Nichtwidersprüchlichkeit hin angelegt. Sie vermag nur den Gründen zu folgen, die sich ihr zeigen. Im Falle des Handelns aber sind dies solche, die erst im Tun zur Übere ins t immung des Handelnden mit sich selbst führen. Daraus ergibt sich als universell geltende oberste Handlungsregel, was als gut erkannt wird, ist zugleich als zu Tuendes anzuerkennen und anzustreben und was als böse erkannt wird, als ein zu Lassendes zu verwerfen: »Bonum est faciendum et prosequendum, malum vitandum!« Menschliches Handeln bleibt sonach, soll es sittliches Handeln sein, strikt an die Wahrheitsfähigkeit und Einsichtskraft des Subjektes zurückgebunden. Erst daraus gewinnt der Handelnde seine moralische Identi tät . Handeln gegen eigene bessere Überzeugung und Einsicht ist Schuld.
13
A l s zu erstrebendes Gutes kann ethisch nur gelten, was der Vernunft des Subjektes nicht widerspricht. So ist der Mensch gebaut. Daraus empfängt mensch-
7 W. Kluxen, Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin, Mainz 1964, 2., erw. Aufl. Hamburg 1980, 233 ff.
8 Zum Folgenden STh M I , 94, 2.

392 Transformation und Kontinuität • W. Korff
liches Handeln seine sittliche Würde . Es gilt als Pauluswort: »Alles, was nicht aus Überzeugung geschieht, ist Sünde« (Rom 14,23); Thomas fügt hinzu » . . . das heißt , alles, was gegen das Gewissen ist. A l so ist der Wil le , der von der irrigen Vernunft abweicht, sittlich schlecht .« 9 Diese Verbindlichkeit des Gewissensspruchs gilt selbst noch im Fall schwerwiegenden Irrtums, etwa wenn dem Handelnden Enthaltsamkeit von Unzucht oder der für das He i l notwendige Glaube an Christus als von der Sache her falsch und darin moralisch verwerflich erschiene. Der Wille kann, soll er ein sittlicher sein, seine Dignität nur aus der Einsichtskraft des Subjektes gewinnen: »Jegliches Wollen, das von der Vernunft abweicht, mag dieses nun recht sein oder irren, ist immer sch lech t .« 1 0 L . H o n -nefelder hebt zu Recht hervor, daß diese Frage der subjektiven Vermittlung des objektiven Wahrheitsanspruchs im praktischen Bereich, beginnend mit Abae-lard, weit früher Relevanz gewinne als im theoretischen. 1 1 Kern der Sittlichkeit ist die Wahrhaftigkeit des Handelnden gegen sich selbst. Dar in ist der für die Neuzeit bestimmend gewordene Gedanke der Gewissensfreiheit ethisch personal verankert. Die Forderung nach dessen struktureller Einlösung stellte sich für Thomas freilich noch nicht. Z u m Anspruch auf Gewissensfreiheit als politisch einklagbarem Menschenrecht war es trotz allem noch ein weiter Weg.
14
Die obersten Prinzipien müssen in allem ethischen Urteilen und aller Wahl präsent bleiben, sagen aber als solche noch nichts über den jeweiligen Inhalt des zu verfolgenden Guten aus. Dieser kann nämlich nicht in der Vernunft selbst gefunden werden. Der Mensch ist animal rationale. Seine Vernunft besteht nicht für sich, sondern ist zugleich Funktion einer Natur, deren rahmengebende Dispositionen Thomas in generellen, dem Menschen als Menschen eignenden »natürlichen Hinneigungen« herausstellt. Hierzu rechnet er die sich naturhaft geltend machende inclinatio des Menschen zur Selbsterhaltung, zur Arterhaltung, zu einem Leben in Gesellschaft, zum rationalen Erfassen der Wirklichkeit und zur Erkenntnis der Wahrheit über Gott . Was der Entscheidungsvernunft erst ihre jeweilige inhaltliche Qualifikation zum Guten oder Bösen gibt, empfängt sie mit dem Aufnehmen oder Verfehlen eben dieser im Menschen waltenden »inclina-tiones naturales«, die »die Vernunft von Natur aus als gut ergrei f t« . 1 2 Eine Zuordnungslogik, die sich für Thomas grundsätzlich aus der Tatsache legitimiert, daß die inclinationes naturales ein unbeliebig offenes System von Strebungen
9 STh I—II, 19, 5. 1 0 Ebd. 1 1 L. Honnefelder, Wahrheit und Sittlichkeit. Zur Bedeutung der Wahrheit in der Ethik,
in: E.Coreth (Hrsg.), Wahrheit in Einheit und Vielheit, Düsseldorf 1987, 147-169. 1 2 STh I—II, 94, 2.

Thomas von Aquin und die Neuzeit 393
darstellen, das, wie die Entscheidungsvernunft selbst, von ein und derselben lex aeterna getragen und bewegt ist und als solches seinerseits von sich aus letztlich nichts anderes intendiert als die sich zum Guten entscheidende Handlungsvernunft selbst. Auch inclinationes naturales tragen sonach eine Teleologie in sich. Sie sind nicht bloßes Material der Handlungsvernunft, sondern entziehen diese gerade der Beliebigkeit. Dennoch bedürfen sie als dispositive, entwurfsoffene Größen auch ihrerseits eines »ordinäre«. Sie sind keine unmittelbar handlungsleitenden Regeln. Sie sind nicht Normen, sondern Metanormen. Soll das mit ihnen von Natur aus Intendierte erreicht werden, so bedürfen sie der normativen Konkretion. Das aber ist die Leistung der praktischen Vernunft als »Klugheit«, die hierzu die geeigneten Wege und Mit tel zu erkunden und darin letztendlich auch das jeweilige Z ie l in seiner genaueren Gestalt zu formulieren hat. 1 3 Die sittliche Normwelt, die das Handeln des Menschen konkret regelt, ist Produkt seiner eigenen Selbsttätigkeit als Vernunft- und Freiheitswesen. Sie ist nicht einfachhin vorgegeben, sondern kraft des in ihm wirkenden »natürlichen Gesetzes« zur Gestaltung aufgegeben.
75
Für die praktische Vernunft, wie auch entsprechend für die scientia practica, gibt es keinen von ihrer Gestaltungsaufgabe unabhängigen Gegenstand. Sie baut ihn vielmehr - so Thomas - je und je auf: » . . . in practicis autem scientiis intenditur quasi finis constructio ipsius subjecti.«14 A u f diese Seite der funktionalen Hervorbringungen gehören dann auch schon die einzelnen, sich aus der Natur der Sache ergebenden Vorschriften, die praecepta naturalia. Dabei gilt: je konkreter die Vorschrift, um so bedingter die Reichweite ihrer Richtigkeit. Das ist schon vom Ansatz her plausibel. Die inclinationes, die gleichsam das gestaltungsoffene naturhafte Substrat der praecepta bilden, stehen in keiner prästabil ierten Harmonie zueinander; ihre Zielwerte müssen den gegebenen Umständen gemäß je und je aufeinander abgestimmt werden. Die praecepta naturalia stehen bei Thomas nicht ohne Grund im Plural - in ihnen werden die einzelnen human relevanten Güter geschützt - während er für den Begriff der lex naturalis ausschließlich die Singularform wählt. In der lex naturalis geht es in der Tat um die eigentliche, mit dem Wesen des Menschen selbst gegebene, unwandelbare Wirkkraft und G r ö ß e , also nicht um eine Vielfalt von Normen.
1 3 STh I—II, 95, 2; I—II, 91, 3; I—II, 94, 5. 1 4 In Anal. Post. II, 41, Nr. 362.

394 Transformation und Kontinuität • W. Korff
16
A l s der übergeordne te und umfassende Begriff, der sich in seiner Ausrichtung auf das gesamte menschliche Handeln bezieht, ist bei Thomas die lex naturalis auch gegenüber dem ius naturale angesetzt. Das ergibt sich schon daraus, daß der Begriff des Rechts nur solche Angelegenheiten betrifft, die sich auf die Beziehung zum anderen erstrecken 1 5, als Naturrecht also als Frage nach dem natürlich Gerechten, Angemessenen und Billigen im Umgang mit anderen. Dabei gilt der Grundsatz: was der Natur der Sache nach ungerecht ist, kann nicht durch ein gesatztes Recht, auch wenn es aus gemeinschaftlicher Bill igung (ex communi placito) hervorgegangen ist, gerecht werden. 1 6 Die durch die Vernunft gebotene Gerechtigkeit, die als Austausch- und Verteilungsgerechtigkeit »jedem das Seine« zuerkennt, bleibt allem gesatzten Recht vor- und übergeordne t . Erst der Rekurs auf sie läßt das von Natur Rechte, das ius naturale hervortreten. Thomas geht es hier also nicht um die Herausstellung bestimmter, als unwandelbar zu betrachtender naturrechtlicher Einzelforderungen, sondern um einen Gegenbegriff zum gesatzten Recht und damit zum Recht als Konvention. Unwandelbar ist vielmehr das aus sich heraus wirkende Naturgesetz - die lex naturalis - , seine konkreten rechtlichen Ausgestaltungen im Sinne der Forderung des Gerechten hingegen liegen auf der Ebene der Applikat ion und sind damit - »natura autem hominis mutabilis e s t « 1 7 - bereits durch Ums tände und Güte rkonkur renzen mitbestimmte Größen . Insofern ist also schon im Hinblick auf naturrechtlich geltend gemachte Forderungen mit einer gewissen sach- und kulturspezifischen Wandelbarkeit der Beziehungsbedingungen selbst zu rechnen, so daß dies erforderlichenfalls eine Neubestimmung der betreffenden relatio ad alterum unter dem Gesichtspunkt der Ausgeglichenheit gerade von der Natur der Sache her erforderlich macht. Im Fall des positiven gesatzten Rechts tritt dieses Moment der Flexibilität einer bestimmten Rechtsgestaltung als Ausdruck der Vielfalt möglicher ethisch vertretbarer Lösungswege dann durchgängig und explizit hervor.
17
Der entscheidende Ertrag der lex-naturalis-Lehre des Thomas scheint mir darin zu liegen, daß diese Lehre im Prinzip antiessentialistisch angelegt ist. Was Thomas im Begriff der lex naturalis in grundlegender strukturlogischer Distinktion von prima principia und inclinationes naturales erkennt und systematisch entfaltet, hat für heutige Ethik richtungsweisende Bedeutung. Mi t seinem Rekurs auf ein
1 5 STh II-II, 57, 1. 1 6 STh II-II, 57, 2. 1 7 Ebd.

Thomas von Aquin und die Neuzeit 395
naturales Substrat menschlichen Handelns, von ihm im Begriff der inclinationes naturales gefaßt, wird der Bl ick auf Wirkgesetzlichkeiten gelenkt, die sich ihrer naturhaften Anspruchsgestalt nach als genuin empirische und darin zugleich als empirisch weiter erforschbare Größen darbieten. Von daher erscheint im Ansatz des Thomas der Raum für eine Ausweitung der ethischen Frage auf die Frage ihrer empirisch-anthropologischen Grundlegung prinzipiell freigegeben. Der in der Entwicklung der modernen Human- und Sozialwissenschaften beschrittene Weg gewinnt hieraus seine volle philosophische und theologische Legitimation.
18
Wer wie Thomas nach einem natürl ichen Gesetz fragt, das allem sittlichen Handeln als vernünftige, von sich aus wirkende Größe zugrunde liegt, und wer sich zugleich so entschieden um dessen strukturelle Entschlüsselung bemüht , der setzt voraus, daß der geschaffenen Wirklichkeit generell, in der Vielgestaltigkeit ihrer Erscheinungsformen, Vernunft innewohnt, die aufzudecken zur Bestimmung und Verwirklichung des Menschen gehört . Thomas hebt dies in einen grundsätzlichen theologischen Zusammenhang: Durch die Erkenntnis der geschaffenen Natur hat der Mensch an der Vollkommenheit Gottes Ante i l und gewinnt Ähnlichkeit mit seiner Weisheit. 1 8 Ja er geht noch einen Schritt weiter. D e m Hervortreten von Wahrheit - und er zitiert hier zustimmend Ambrosius - kommt theologisch prinzipiell Dignität zu, unabhängig von der Person dessen, der sie erkennt: »Alles Wahre, von wem immer es auch gesagt wird, ist vom Heiligen G e i s t . « 1 9
19
In dieser Ausweitung der nach dem He i l des Menschen fragenden Vernunft auf die Welt als Schöpfung hin, unterscheidet sich Thomas grundsätzlich von Augustinus. Insofern liegt hier der erste entscheidende Überschri t t zur Neuzeit. Das Heil der Welt geschieht nicht nur an der Schöpfung, sondern in ihr und mit ihr. Gotteserkenntnis darf nicht gegen Welterkenntnis ausgespielt werden. Gerade dies aber ist bei Augustinus gegeben, dessen Fragen, bewegt von der Heillosigkeit der Welt, letztlich nur eine Zielrichtung zuläßt , in der der Mensch Genüge finden kann und an der zugleich alles Weltverhältnis in seiner Eigenbedeutung zerschellt, die Frage nach dem lebendigen Gott. »Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? N i h i l o m n i n o ! « 2 0 Welterkenntnis bleibt unter dieser Voraussetzung
1 8 ScG II, 2. 1 9 STh I—II, 109. 1. 2 0 Augustinus, Soliloquia I, 2, 7.

396 Transformation und Kontinuität • W. Korff
marginalisiert. Was nicht offen zutage liegt, verdient kein weiteres Interesse. Erkenntnis der wahren Natur verpflichtet geradezu zur Enthaltsamkeit in der Erforschung der tatsächlichen Natur. Al les andere ist »curiositas«, Neugierspiel der Vernunft, die sich im Aufdecken von Entlegenem, Abkünf t igem, Nutzlosem befriedigt, von dem, was »praeter nos« liegt, und eben darin ihre eigentliche Bestimmung vergiß t . 2 1 Damit aber bleibt letztlich auch der Vernunft als Handlungsvernunft jede schöpfungsmäßig eigene und als solche aus sich maßgebl iche Kompetenz abgesprochen. Zwar ist auch nach Augustinus das natürl iche Gesetz dem Menschen »ins Herz geschrieben« (Rom 2,15), so daß es »keine Verkehrtheit je herauszureißen ve rmag« 2 2 , tatsächlich erkennbar wird es aber dennoch erst im Licht des geoffenbarten Willens Gottes. 2 3 D e m stellt Thomas die Grundformel entgegen: »Die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet s i e . « 2 4
20
Der Differenzsetzung von Gnade und Natur korreliert auf der normativen Ebene die Unterscheidung von lex divina und lex naturalis. 2 5 Dar in ist vorausgesetzt, daß der Mensch kraft des in ihm wirkenden »natürlichen Gesetzes« imstande ist, gemäß der ihm eigenen Vernunft sein Leben dem Willen Gottes entsprechend zu führen. Wenn also diesem »natürlichen Gesetz« dennoch ein besonderes »göttliches Gesetz«, nämlich das Gesetz des Al t en und das Gesetz des Neuen Bundes zuzuordnen ist, so stellt sich damit zugleich die Frage nach deren spezifischer Notwendigkeit und Bedeutung. Wer immer die Argumentation des Thomas in dieser Frage für konsistent hält , dem wird die Entscheidung nicht schwerfallen, wo im derzeitigen moraltheologischen Streit zwischen »Glaubenseth ik« und »autonomer Mora l im christlichen Kontext« die größere Plausibilität liegt. Das
2 1 Augustinus, Confessiones X, 35. 2 2 Ebd. II, 4. 2 3 Dieser bei Augustinus grundgelegten soteriologischen Sicht der lex naturalis kommt
wirkungsgeschichtlich eminente Bedeutung zu. Gratian transponiert sie zur Bestimmung des ius naturale in die Rechtssphäre und gibt ihr so für die Kanonistik rechtstheologische Maßgeblichkeit: »Ius naturale est, quod in lege et in evangelio continetur« (Gratian, Dec-retum D. 1). Die darin gleichzeitig zutage tretende Tendenz zu »Werkgerechtigkeit« und zur Vergesetzlichung des christlichen Anspruchs wird später von Luther im Gegenzug mit der Dichotomie der »Zwei-Reiche-Lehre« beantwortet. Dem »weltlichen Naturgesetz«, das in der von der Sünde gezeichneten Welt Ordnung ermöglicht, wird ein heilschaffendes, sich allein im rechtfertigenden Glauben an Christus erschließendes »göttliches Naturgesetz« gegenübergestellt. Hierzu W. Korff, Zugänge zum Naturbegriff, in: ders., Wie kann der Mensch glücken? Perspektiven der Ethik, München 1985, 33-47.
2 4 STh I, 8 ad 2. 2 5 STh I—II. 99, 2 ad 1.

Thomas von Aquin und die Neuzeit 397
Ganze nimmt sich eher als Neuauflage desselben Problems aus, dem sich bereits der »doctor communis« konfrontiert sah.
21
Für die lex vetus - hier als Inbegriff der im Al ten Bund gegebenen moralischen Gebote gefaßt - ist festzustellen, daß ihr im Bezug auf die lex naturalis eine kontestierende Funktion zukommt. Damit nimmt Thomas eine gegen die augu-stinische Tradition gerichtete Einsicht auf, die seit Petrus Abaelard, Wilhelm von Auxerre und Alexander von Haies zunehmend an Maßgeblichkeit gewinnt. 2 6 Die lex vetus erweist sich angesichts der durch die Sünde gezeichneten tatsächlichen Verfaßtheit des Menschen zwar als »zukömmlich« (convenienter), im Sinne einer das sittlich Gebotene konkret anmahnenden und einschärfenden Hi l f e 2 7 , fügt aber als solche dem im Prinzip von Natur aus sittlich Erkennbaren inhaltlich nichts Neues hinzu. 2 8 Dies wird bei Thomas durch die Tatsache unterstrichen, daß die positive Willensoffenbarung Gottes ihre sittliche Evidenz erst daraus gewinnt, daß sie vom Menschen zugleich als Anspruch seiner eigenen Vernunft erkannt wird. Das Gute wird nicht erst dadurch gut, daß Gott es befiehlt. »Wer die bösen Taten unterläßt , nicht weil sie böse sind, sondern weil Gott es geboten hat, handelt nicht frei .« 2 9
22
Gott ist der Schöpfer der Welt. E r steht für diese Welt ein. E r offenbart im Menschen, den er nach seinem Bilde geschaffen hat, die Unüberbie tbarkei t seiner schöpferischen Macht. E r will für diese Welt das H e i l , das er selbst ist. E r wird Mensch. Erst im Geheimnis der Kenosis Gottes beginnt sich der Sinn der Welt endgültig zu lichten. Sie gewinnt ihre Vollendung aus und in der Liebe Gottes selbst. Darin liegt die Substanz der lex nova.
23
»principalitas legis novae est gratia Spiritus Sancti, quae manifestatur in fide per dilectionem operan te .« 3 0
2 6 Hierzu W. Korff, Norm und Sittlichkeit. Untersuchungen zur Logik der normativen Vernunft, Mainz 1973, 2.,neu eing. Aufl., Freiburg/München 1985, 46f.
2 7 STh I-II, 98, 6. 2 8 STh I-II, 100, 1. 2 9 Expos, super II epist. ad Cor. 3, 2. 3 0 STh I-II, 108, 1.

398 Transformation und Kontinuität • W. Korff
24
Gratia Spiritus Sancti, das bedeutet das Hineingenommensein des Menschen in die Bewegung jener Liebe, mit der Gott die Welt liebt. Was sich in Christus, dem menschgewordenen Ewigen Wort Gottes, erschließt und mitteilt, ist die befreiende, schlechthin affirmative Wirklichkeit des Geistes Gottes selbst. Hie r liegt das Eigentliche des »Gesetzes des Neuen Bundes« , darin hat es seine »tota virtus«, seine »ganze Kraf t« . 3 1
25
M i t der lex nova wird nichts von dem zurückgenommen, was dem Menschen schöpfungsgemäß eignet und wozu er als Mensch bestimmt ist. Sie hebt seine auf Grund natürlicher Befähigung gegebene Kompetenz zu verantwortlichem sittlichem Handeln weder auf, noch ersetzt oder kreiert sie diese. Insofern kann die lex nova auch nirgends als eine der menschlichen Natur fremde, heteronome G r ö ß e erfahren werden. Das als unwiderrufliches Ja Gottes zu seiner Welt im Glauben erkannte »Gesetz des Geistes des Lebens« (Rom 8,21) zielt vielmehr gerade darauf, dasjenige im Menschen zu seiner Vollgestalt zu befreien, worauf dieser von Natur immer schon angelegt ist, zur Mündigkei t eines Lebens aus der Affirmation Gottes selbst. 3 2
26
»Das Al te Gesetz wurde zur Zeit der Gnade verworfen; nicht als schlecht, sondern als ohnmächt ig und ungeeignet, denn nichts hat es zur Vollendung geführ t .« 3 3
27
Erst mit der lex nova, dem Vollendungsprinzip allen geschöpflich-menschlichen Handelns, tritt auch der spezifische hei lsökonomische Stellenwert der lex vetus ins volle Licht. Was hierbei erkennbar wird, gilt entsprechend für die Heilsrelevanz der konkreten normativen Gestalt von »Gesetz« überhaup t . - Wenn Thomas zur Klärung dieses Zusammenhangs insbesondere auch auf Augustinus' »De spiritu et littera« rekurriert, so deshalb, weil hier die erstmals bei Paulus als
3 1 STh I-II, 106, 1. 3 2 Vgl. STh I-II, 106, 1 u. 4. 3 3 STh I-II, 98, 2 ad 2.

Thomas von Aquin und die Neuzeit 399
Grundthema der Theologie aufgeworfene Problematik von »Gesetz und Evangelium« auf einen bedeutsamen systematischen Punkt gebracht ist. Insgesamt wird jedoch deutlich, daß der Spannungsbogen von lex naturalis, lex vetus und lex nova, von Schöpfung, Sünde und Er lösung, von Natur, positivem Gottesgebot und Evangelium bei Thomas in sehr viel umfassenderer Weise ausgehalten und begriffen ist als bei dem von neuplatonischem Denken beeinflußten Augustinus und später , wenn wir hier die wirkungsgeschichtliche Linie weiter ausziehen, als bei dem durch die augustinisch-ockhamistische Tradition geprägten Luther.
28
Das »Alte Gesetz« macht nicht vor Gott gerecht. Es vermag zwar dem Menschen den Weg zur gerechten Gestaltung der einzelnen Handlungen in der Vielfalt seiner Lebensbezüge zu weisen, bewirkt aber darin noch nicht seine »iustificatio«, die Herstellung seiner Gerechtigkeit vor Gott . Diese empfängt er vielmehr durch die gratia Spiritus Sancti, kraft deren er in jene Bewegung der Liebe hineingenommen wird, mit der Gott die Welt liebt und alles zur Vollendung führt. Von daher bleibt zugleich jede Möglichkeit eines von der menschlichen Gerechtigkeit ableitbaren Heilsanspruchs ausgeschlossen. Verfehlt doch der Mensch gerade dort seine Gerechtigkeit vor Gott , wo er glaubt, sie als seine eigene Gerechtigkeit fassen und aus sich selbst begründen zu k ö n n e n . 3 4
29
Was am »Alten Gesetz« verworfen wird, ist nicht der Gült igkeitsanspruch der hier aufgestellten sittlichen Forderungen, sondern der ihm darin unterstellte A n spruch als Heilsschlüssel. Nur wo der Mensch sein Hei l als unverfügbares Geschenk erkennt, bleibt eine Vergesetzlichung der Heilsfrage ausgeschlossen.
30
Wie sensibel Thomas das Problem der Vergesetzlichung der Heilsfrage nimmt, zeigt sein sehr grundsätzlich angesetztes Bemühen , den Anspruch der lex nova von jeglichem Vorwurf der Vergesetzlichung freizuhalten. Denn selbst diese kommt nicht ohne gewisse, auch verrechtlichbare Strukturen aus. Sonst bedürfte
3 4 STh I-II, 99,12; hierzu ferner W. Korff, Kernenergie und Moraltheologie. Qer Beitrag der theologischen Ethik zur Frage allgemeiner Kriterien ethischer Entscheidungsprozesse, Frankfurt/M. 1979, 94-97.

400 Transformation und Kontinuität • W. Korff
es keiner Kirche. Die Lösung sieht er in seiner Unterscheidung von »principali-ter« und »secundario«. Grundsätzl ich, »principaliter«, ist das Gesetz des Neuen Bundes »die Gnade des Heiligen Geistes, die sich im Glauben [an diese befreiende Zuwendung Gottes zur Welt in Christus] manifestiert und in der Liebe [als dem Aufgreifen der sich darin eröffnenden Liebeshaltung Gottes] wirksam wird«?5
A l s solche aber ist die lex nova »indita et non scripta«, unverfügbare , eingestiftete, dispositive Wirkgröße. - Erst in zweiter L in ie , »secundario«, ist sie auch »geschriebenes« Gesetz, nämlich im Hinblick auf das, was den Menschen in Wort und Schrift zum Glauben an diese Gnade hinführt und die Teilhabe daran sakramental ordnet und vermittelt. D a ß hier freilich auch die Einbruchsstelle einer neuerlichen Vergesetzlichung der Heilsfrage liegt, sah Thomas durchaus. Nicht ohne Grund zitiert er in diesem Zusammenhang die Warnung des Augustinus: »Einige bedrücken unsere Religion, von der Gottes Barmherzigkeit gewollt hat, daß sie frei ist und in ganz einsichtigen und wenigen Sakramenten gefeiert wird, so sehr mit knechtischen Lasten, daß die Bedingung der Juden erträglicher war, denn diese waren zwar der Bürde des Gesetzes, nicht aber menschlichen Anmas-sungen un te rwor fen .« 3 6
31
Der Mensch kann der Zuwendung Gottes zu ihm nur im Glauben innewerden. Insofern gehört der Glaube zum Wesenskern der lex nova selbst. Erst in dem sich loslassenden Glauben erfährt der Mensch seine Gerechtigkeit vor Gott als Tat der Liebe Gottes: »Per fidem homo iustificatur« (Rom 5,1). 3 7 Dar in wird ihm zugleich das Ganze seiner Bestimmung transparent: »Der Glaube ist das dauernde Fundament der Gläubigen , das sie auf die Wahrheit stellt und in ihnen selbst die Wahrheit zeigt«, wie dies Pseudo-Dionysius formuliert. 3 8 Dasselbe wird nach Thomas vom Hebräerbr ief in der Aussage zusammengefaßt : »Der Glaube ist die Substanz der zu erhoffenden Dinge« (Hebr. 11,1). Hier ist in der Tat eine Dimension im Verständnis von Glaube angezielt, in der »fides qua« und »fides quae«, Glaube als Vertrauen und Glaube als Zustimmung zusammenfallen. Genau hier aber tut sich zugleich auch das Dilemma auf. Der das He i l eröffnende Glaube bleibt fundamental über die darin implizierte Anerkenntnis der ersten »einfachen und immer existierenden Wahrhe i t« 3 9 an die Zustimmung zu den sich notwendig aus ihr ergebenden und mit ihr in organischem Zusammenhang stehenden Einzelwahrheiten des Glaubens zu rückgebunden . 4 0 Die Heilsfrage er-
3 5 STh I-II, 108, 1. 3 6 STh I-II, 107, 4; Zitat: Augustinus, Ep.55 ad Januarium. 3 7 STh II-II, 4, 5. 3 8 STh II-II, 4, 1; Zitat: Ps.-Dionysius, De div.nom., 7, 5. 3 9 STh II-II, 1, 1; Zitat: Ps.-Dionysius, De div.nom., 7, 5. 4 0 Vgl STh II-II, 1-10.

Thomas von Aquin und die Neuzeit 401
scheint von der Frage der Rechtgläubigkeit unablösbar . So stellt sich dies Thomas dar. Die entscheidende Einsicht, die er in kühnem Vorstoß im Bezug auf die Begründung der sittlichen Vernunft menschlichen Handelns bereits gewonnen hat, nämlich die Einsicht in die subjektive Vermittlung eines jeden praktischen Wahrheitsanspruchs, bleibt ihm hier für den Anspruch der theoretischen Wahrheit verschlossen. Das unterscheidet ihn von der Neuzeit. Indem er so den theoretischen Aspekt der Wahrheit des Glaubens ohne weitere Differenzierung mit der Heilsfrage konfundiert, hat dies zugleich ekklesiologische und politische Konsequenzen. Die Heilsfrage betrifft nicht nur das He i l des einzelnen, sondern das He i l aller und bleibt darin notwendig institutionell vermittelt. Jede Abweichung von der durch die Kirche verwalteten Wahrheit des Glaubens wird zu einer Gefahr für das Hei l der übrigen. Von daher läßt Häresie keine Duldung zu: »Denn weit schwerere Schuld ist es, den Glauben zu fälschen, der der Seele das Leben gewährt , als Geld zu fälschen, das nur zum Unterhalt des zeitlichen Lebens d ien t .« 4 1
32
Eine Argumentation, die die Tilgung des Ketzers aus der Gemeinschaft der Gläubigen, seine physische Vernichtung rechtfertigt, ist für heutiges ethisches Denken, das die Unverfügbarkeit des Menschen, seine Würde als moralisches Subjekt, zum Prinzip hat und dies auch theologisch unterbaut sieht, schlechthin unannehmbar. Tatsächlich setzen wir die Notwendigkeit der subjektiven Vermittlung aller Wahrheit, ihrer freien Zustimmungsfähigkeit durch das Subjekt, darin bereits voraus. Dies gilt auch für die von zusätzlichen Prämissen abhängige Glaubenswahrheit. Auch sie muß , gerade weil sie als eine mit dem Heil des Menschen in Zusammenhang stehende Wahrheit erkannt wird, frei angenommen werden können und sich darin als diskursfähig und argumentativ vermittelbar erweisen. Dazu aber gehört , daß auch bei grundsätzlicher oder partieller Nicht-zustimmung zu den Explikationen dieser Wahrheit, die kommunikative Voraussetzung zu deren Erkenntnis nicht zerstört wird. Überzeugungskonfl ikte , in denen der Mensch, der ja das Ziel dieser Wahrheit ist, als Subjekt gewahrt bleiben soll, lassen sich, wenn sie nicht argumentativ zu lösen sind, nur auf der Basis der Toleranz, die als solche den Wahrheitsweg offen hält , auf ethisch verantwortbare Weise bewältigen.
4 1 STh II-II, 11, 3.

402 Transformation und Kontinuität • W. Korff
33
M a n müßte den Dialog mit Thomas auf der Stelle abbrechen, wollte man seiner These zur Ketzerverfolgung, die nur auf dem Hintergrund der mittelalterlichen Leitidee der Einheit von Religion und Gesellschaft zu verstehen ist, eine für seine Lehre vom »Neuen Gesetz« konstitutive und von ihr unablösbare Bedeutung zuschreiben. Tatsächlich spielt sie im Gesetzestraktat selbst keinerlei Rol le , sondern wird erst im konkreten ethischen Teil der Summa im Rahmen seiner Lehre über den Glauben entwickelt. Was vielmehr im Gesetzestraktat allein als das Bestimmende, als principalitas der lex nova herausgestellt wird, ist die gratia Spiritus Sancti, Gottes rettend-befreiende Liebe zum Menschen, die sich in einem Glauben manifestiert, der in der Liebe wirksam wird. Thomas kommt darauf später, in seiner Über legung zum Verhältnis von Glaube und Liebe nochmals zurück. Ohne die Liebe ist der Glaube »virtus informis«, gelangt er nicht zu seiner vollen Wirklichkeit als Tugend. 4 2 Glaube, der sich in der b loßen Anerkennung und Versicherung der göttlichen Wahrheiten erschöpft, ist ein toter Glaube . 4 3
Auch gewinnt er seine er lösende, Leben erweckende Kraft nicht dadurch, daß er die Werke der Liebe in den Dienst seiner eigenen Bestät igung stellt, sondern darin, daß er »durch die Liebe wirkt als durch seine eigene Form«: »Fides non operatur per dilectionem sicut per instrumentum, ut dominus per servum, sed sicut per formam propri a m . « 4 4
34
Im Bezug auf die lex-nova-Lehre bleibt festzuhalten und zu folgern: (1) Die von Thomas in der lex nova vorgenommene Unterscheidung von prin-
cipaliter und secundario ist notwendig und zureichend. (2) Al les , was im secundario zusammengefaßt ist, m u ß unter dem Blickpunkt
des Heils als Funktion des principaliter verstanden werden und steht in seinem Dienst.
(3) Die Gültigkeit und unbedingte Dignität der Heilswahrheiten und Heilsmittel wird durch ihre Zurechnung zum secundario in keiner Weise gemindert. Sie sind Frucht der nach Wahrheit drängenden Glaubensvernunft, die sie unter dem Beistand des principaliter, nämlich des in dieser Glaubensvernunft wirksamen Heiligen Geistes, in stetem theologisch-kirchlichen Ringen als gült ige, zustimmungsfähige Wahrheiten erwiesen hat.
(4) A l l dies aber hebt den Tatbestand, daß es sich, bezogen auf das Heilsgeschehen selbst, um secundaria handelt, nicht auf. Wo immer deshalb der Versuch
4 2 STh II-II, 4, 5. 4 3 STh II-II, 4, 4. 4 4 STh II-II, 23, 6.

404 Transformation und Kontinuität • W. Korff
so bleibt festzustellen, daß darin die für die Neuzeit so entscheidend gewordene Einsicht in die Wahrheit der Subjektstellung des Menschen maßgeblich vorangebracht worden ist. U m den Menschen als Subjekt geht es in der Bestimmung der lex naturalis ebenso zentral wie in der Bestimmung des principaliter der lex nova. Hier hat er Zusammenhänge aufgedeckt, denen für das Verstehen und Bestehen menschlichen Daseins bleibende, grundlegende Bedeutung zukommt, auch im Hinblick auf die Bewältigung unserer heutigen Probleme.
37
Der Mensch ist ein Wesen unveräußerl icher Gewissensbildung. Nur im unbedi ^2-
ten Gehorsam gegen den Anspruch der eigenen handlungsleitenden Vernum erfährt er seine ethische Identi tät . D a ß deshalb auch in allem Umgang des Menschen mit dem Menschen ein Unbedingtes zu respektieren sei: der Mensch als Wesen des Gewissens, als moralisches Subjekt und darin als »Zweck an sich selbst«, als Person - das zu erkennen, ist von dort nur noch ein weiterer, zweiter Schritt. Prima principia und kategorischer Imperativ sind als gleichermaßen fundamentale Handlungsbestimmungen einander zuzuordnen.
38
Der im Status des Menschen als moralischem Subjekt hervortretende Grundanspruch menschlicher Personwürde ist geeignet, Basis für ein Menschheitsethos zu werden und damit eine für jedermann nachvollziehbare, universell konsensfähige Mora l zu gewährleisten, mit der sich jeder Mensch als vernünftiges, sich selbst aufgegebenes, verantwortliches Wesen respektiert und gewollt sieht. Mi t der Herausbildung von Menschenrechten hat dieser Grundanspruch globale politische Bedeutung gewonnen.
39
Ist erst einmal der in der Personwürde des Menschen begründe te Sollensanspruch als unabdingbare Handlungsmaxime erkannt, ergibt sich daraus, daß die Vernunft sittlichen Handelns nicht allein tugendethisch zu erschließen ist, sondern zugleich als strukturelle Frage begriffen werden m u ß . Insofern kann der Mensch auch der ihn tragenden gesellschaftlichen Reali tät mit ihren Normen, Institutionen und sozial übergreifenden Systemen keine von seinem Subjektstatus unabhängig zu definierende sittliche Vernunft zubilligen. Vielmehr erschließt sich ihm diese erst aus deren Zuordnung zum Menschen als Person: »Ursprung,Träger und Z ie l aller sozialen Institutionen ist und m u ß sein die menschliche Person.« Diese

Thomas von Aquin und die Neuzeit 405
ethische Grundbestimmung, wie sie das II. Vatikanische K o n z i l 4 8 hier zum Maßstab setzt, stellt selbst das Resultat einer Entwicklung dar, mit der das ethische Bewußtsein im Prozeß der Neuzeit zunehmend auf die es normierenden und ihm als solche vorgegebenen sozialen Strukturen übergreift und der am universellen Anspruch menschlichen Personseins ausgerichteten moralischen Differenz unterwirft. Es gibt nicht nur gutes und schlechtes Handeln im Hinblick auf gegebene Normen, gut oder schlecht können auch die dieses Handeln regelnden Normen und Institutionen selbst sein. Damit aber sieht sich der Mensch nicht nur in Gehorsamsverantwortung vor Normen gerufen, sondern ebenso auch in Gestaltungsverantwortung für sie. D e m hat Thomas, obschon in seiner Ethik der Personbegriff noch keine Schlüsselrolle spielt, mit seinem Verständnis der lex naturalis als dispositiver Wirkgröße bereits entscheidend vorgearbeitet. Für Thomas ist die Normenwelt nicht einfachhin vorgegeben, sondern kraft der dem Menschen eigenen Natur zu menschengerechter Gestaltung aufgegeben.
40
Die Aufdeckung des Subjektstatus des Menschen impliziert die Ausweitung seiner Vernunft auf Welt hin. Der Mensch erfährt die ihn umgreifende Schöpfung zunehmend als Objekt seines Handelns. Neuzeit bedeutet Wende der Vernunft nach außen , Erschließung der Welt in all ihren Möglichkeiten. Hier gewinnt ein Lebensgefühl Raum, das sich auftuende Grenzen nicht als Begrenzung, sondern als Herausforderung zu ihrer Überwindung erfährt. Im Aufknüpfen des unendlich komplexen Gewebes dieser Wirklichkeit nach vielfältigen Methoden und der Nutzung darin erkannter Gesetzmäßigkei ten, beginnt der Mensch, die Welt seinen Bedürfnissen dienstbar zu machen. Die Effizienz dieses Vorgehens hat ein neues Weltverhältnis von eminent expansiver Kraft entstehen lassen. Sein A n spruch impliziert Universali tät . Z u seiner Verbreitung bedarf es keiner Missionare. Keine übe rkommene Kultur vermag sich auf die Dauer seinem Sog zu entziehen. Mi t der globalen Rezeption dieser technisch-wissenschaftlichen K u l tur, so meint Hannah Arendt hier, ist »die Entstehung des Menschengeschlechts-im Unterschied zu der Menschheit als einer regulativen Idee der Menschenwürde - zu einer einfachen Tatsache geworden« . 4 9
41
Es ist keine Frage, daß die technisch-wissenschaftliche Kultur, die als solche keine Grenze kennt, das Bewußtsein der Menschheit, ihr konkretes Denken und Han-
4 8 Pastoralkonstitution »Gaudium et Spes«, Nr. 25, Abs. 1. 4 9 H.Arendt, Vita activa, Stuttgart 1960, 252.

Thomas von Aquin und die Neuzeit 403
gemacht wird, das Hei l mit der Zustimmung zu den secundaria und ihrem Vollzug gleichzusetzen, führt dies notwendig zu einer Vergesetzlichung nicht nur im Bezug auf die Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? - sie führt auch zur Abwürgung der für die Neuzeit zentral gewordenen Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Menschen?
35
E i n Glaube, der die Liebe als seine eigene Form hat und darin der Vernunft menschlichen Handelns die Liebe Gottes zum übergreifenden Maßstab setzt, führt zweifellos auch in der Bestimmung der konkreten Ordnung dieses Handelns zu neuen, vertieften Bewertungen dessen, was als das jeweils Dringlichere, Bessere, Höhe re anzusehen ist. »Für die Vermehrung der Liebe gibt es keinen endgültigen Abschlußpunkt in diesem L e b e n . « 4 5 U m so abwegiger aber erscheint es, hieraus eine mögliche Exklusivität spezifisch christlicher Normen ableiten zu wollen. Tatsächlich liefe dies nur auf eine neue Form von Vergesetzlichung des Christlichen heraus. Denn auch hier, in der glaubensgeleiteten Liebe als Formprinzip menschlichen Handelns ist die Natur vorausgesetzt und ist sie Vollendung dieser Natur. »Die Kernfrage einer vom Glauben geprägten Ethik«, so Böckle hierzu, »kann nicht heißen, ob die für das zwischenmenschliche Verhalten sich stellenden Forderungen nur von Christen vertreten werden. Die Frage heißt vielmehr, ob und wie die sich aus der umfassenden Botschaft des Evangeliums ergebenden Konsequenzen für das zwischenmenschliche Leben allen Menschen verständlich gemacht werden können, weil sie im Blick auf eine heilsgeschichtlich verstandene Natur im Prinzip konsensfähig sind. Das Problem der christlichen Ethik ist nicht die Exklusivität der vom Glauben geprägten Normen, sondern vielmehr deren Kommunikab i l i t ä t . « 4 6 - »Es gibt Mysterien des Glaubens, es kann aber keine mysterienhafte sittliche Handlungsnorm geben, deren Richtigkeit im zwischenmenschlichen Handeln nicht positiv einsehbar und eindeutig bestimmbar w ä r e . « 4 7
36
Zieht man eine Bilanz der hier von Thomas entfalteten theologischen Lehre vom Menschen und seiner geschöpflichen Bestimmung unter dem Heilswillen Gottes,
4 5 STh II-II, 24, 7. 4 6 F. Böckle, Fundamentalmoral, München 1977, 290. 4 7 F. Böckle, Unfehlbare Normen? in: H. Küng (Hrsg.), Unfehlbar? Zürich-Einsiedeln-
Köln 1973, 283.

406 Transformation und Kontinuität • W. Korff
dein, in zunehmender Weise universell erfaßt und bestimmt. In ihr schafft sich das »Bedürfnissystem Menschheit« seine instrumentelle Form. D e m korrespondiert ethisch die »regulative Idee Menschenwürde« und bleibt ihm als humanisierendes Prinzip zuzuordnen. Das Subjekt der instrumenteilen Vernunft ist seiner Natur nach ein moralisches Subjekt. Die instrumentelle Vernunft m u ß sich sonach als Vollzugsweise der Vernunft des moralischen Subjekts Mensch qualifizieren. Wo dies nicht geleistet wird, brechen jene Diskrepanzen auf, denen wir uns heute konfrontiert sehen. Die unbewält igten Nebenfolgen des technischen Fortschritts in bezug auf Umwelt , Arbeitswelt, Konsumwelt und Beziehungswelt sind nicht nur physische, sondern moralische Übe l .
42
»In der Vernunft liegt der Ursprung unserer ganzen Fre ihe i t . « 5 0 Wo immer der Mensch als »principium operum s u o r u m « 5 1 , als Prinzip der ihm eigenen Tätigkeiten und Urheber seiner Werke, die Verantwortung für das von ihm in Gang Gesetzte preisgibt, beraubt er sich der wahren Möglichkeit seiner Freiheit und verfehlt darin seine Bestimmung als B i l d Gottes. E r bringt Gottes Absicht um ihren Sinn; er verstößt gegen seinen Wil len. Wir können Gott nur in der Weise beleidigen, daß wir gegen die Vernunft unserer schöpfungsmäßigen Bestimmung und Möglichkeit verstoßen: »Non enim Deus a nobis offenditur, nisi ex eo quod contra nostrum bonum ag imus .« 5 2
43
Kraft seiner Vernunft hat der Mensch an der Providentia divina in aktiver Weise Ante i l . E r vermag für sich und andere Vorsehung auszuüben - »sibi ipsi et aliis p rovidens« . 5 3 Hierzu gehört auch die methodische Anwendung und Ausweitung der instrumentellen Vernunft, der er die gewaltige Entwicklung der technischwissenschaftlichen Kultur verdankt. Der objektivierende, instrumentelle U m gang mit Wirklichkeit gehört zu seiner geschöpflichen Grundstruktur, zu seiner Bestimmung als Mensch. Ohne ihn vermag er nicht zum aktualen Stand seines Menschseins zu gelangen.
5 0 De ventate 24, 2. 5 1 STh I-II prologus. 5 2 ScG III, 122. 5 3 STh I-II, 91, 2.

Thomas von Aquin und die Neuzeit 407
44
Der Mensch ist von Natur verantwortungs- und sittlichkeitsfähig. E r ist seinem Wesen nach moralisches Subjekt. E r ist dies unter den Bedingungen seiner eigenen Kontingenz in einer kontingenten Welt. Dar in liegt die Grundeinsicht der lex-naturalis-Lehre des Thomas. A l l e Kr i t ik am Mißbrauch der instrumentellen Vernunft kann sonach immer nur als Kr i t ik am tatsächlich geübten Verhalten, als Mangel an moralischem Verantwortungsbewußtsein gefaßt werden, nicht aber als Infragestellung der geforderten sittlichen Kompetenz und Verantwortungsfähigkeit des Menschen überhaupt . Es irren also jene, die von dem faktischen Fehlverhalten des Menschen auf eine grundsätzliche, unaufhebbare Dysfunktio-nalität zwischen sittlicher und instrumenteller Vernunft schließen und im Namen der sittlichen Vernunft eine neue, gegen die instrumentelle Vernunft gerichtete Ethik fordern. Der Ruf nach einer »emanzipativen Vernunft«, die sich aus der b loßen Negation zur instrumentellen Vernunft versteht (Horkheimer) 5 4 , ist im Grunde der Ruf in eine die Struktur der Schöpfung verneinende Utopie.
45
Wenn das Subjekt der instrumentellen Vernunft moralisches Subjekt ist und instrumentelle Vernunft zu seiner Verwirklichung gehört , dann läßt sich Ethik als Frage nach dem Verantwortbaren, als Suche nach dem gelingenden Leben, als B e m ü h e n um das bonum commune nicht »jenseits« der instrumentellen Vernunft ansiedeln. Ethik arbeitet durchaus nicht »unter ihrem Anspruch«, wie dies G . Al tner behauptet, wo sie »als Hilfswissenschaft für die Abschätzung von Technologiefolgen fungier t«. 5 5 Sittliches Handeln vollzieht sich unter den Bedingungen dieser kontingenten und durch menschliche Schuld vielfältig Versehrten Welt. Was immer menschliches Dasein glücken läßt, ist das Resultat von Optimierungsprozessen, des Abwägens von Güte rn und des Abwägens von Übeln . Dies gilt auch dort, wo sich der Mensch im Glauben von Gottes Heilswillen umfangen weiß und im Handeln von seiner Liebe bestimmt ist.
46
Menschliche Glückserfahrung geht wesenhaft mit dem aktuellen Vollzug und der Einlösung menschlicher Selbstaufgegebenheit zusammen, mit dem »wirkend Tätigsein« entsprechend der dem Menschen wesensspezifischen Befähigung zu
5 4 M.Horkheimer, Kritik der instrumentellen Vernunft, Frankfurt/M. 1967. 5 5 G. Altner, Überlebenskrise in der Gegenwart. Ansätze zum Dialog mit der Natur in
Naturwissenschaft und Theologie, Darmstadt 1987, 175.

408 Transformation und Kontinuität • W. Korff
optimaler Entfaltung seines Seinkönnens, seiner »Trefflichkeit«. Thomas nimmt hier die Grundaussage des Aristoteles uneingeschränkt auf: »Felicitas est opera-tio secundum virtutem per fec tam.« 5 6 Dies allein bleibt auch unter der Voraussetzung gültig, daß darin immer noch nicht die endgültige Vollendung und Erfüllung liegt, das schlechthin vollkommene Glück, das für den Menschen im Prinzip nur Gott selbst sein kann. Ja es ist gerade dieses Wissen, daß die letzte Vollendung des Menschen in Gott selbst liegt, das dem begrenzten tätigen Glück dieses Lebens nochmals eine neue, erst darin erkennbare Dignität vermittelt. Es ist nicht mehr nur welthaftes Glück - »felicitas« - sondern, wie Thomas jetzt den aristotelischen Begriff des Glücks theologisch übersetzt , wirkliche »beat i tudo«. Teilhabe am ewigen göttlichen Glück, wenn auch noch unter den Bedingungen und in der Weise der Endlichkeit: »Göttl icher denn alles ist, Gottes Mitarbeiter zu se in .« 5 7 U n d eben dies ist der Mensch.
5 6 STh I-II, 3, 2. 5 7 ScG II, 21; Zitat Ps.-Dionysius, De coel.hier. 3. - Während Thomas im Ethikkom
mentar, also im philosophischen Kontext den aristotelischen Begriff der suOaiuocovfa regelmäßig mit »felicitas« wiedergibt, nimmt er hierfür im theologischen Zusammenhang der Summa, um im gleichen Sachverhalt die theologische Komponente, den positiven Bezug auf die ewige Vollendung des Menschen hervortreten zu lassen, den Begriff »beatitudo« in Anspruch. Die »beatitudo« dieses Lebens ist, wenngleich unvollkommen (imperfecta), so doch bereits reale »Teilhabe« an der vollkommenen Glückseligkeit - »participatio perfectae beatitudinis«. Vgl. W. Kluxen, Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin, Hamburg 21980, 134.

466 Transformation und Kontinuität • H . M . Baumgartner
Humani tä t : als Rechtfertigung der fundamentalen Basis alles menschlichen Wertens und Handelns. 6
Erst eine vollständige und zusammenhängende Bearbeitung dieser Aufgaben eröffnet die Möglichkeit zu begründen , daß und wie die modernen Wissenschaften trotz der irritierenden Dissoziation des Wissens und trotz des allgemein geltenden Postulats der Wertfreiheit in der Lage und im Recht sind, nicht nur Wertbeziehungen festzustellen, sondern selber - wenn auch indirekt - zu werten, Werte zu vermitteln, zu bilden.
D a ß es sich hierbei um Aufgaben handelt, die der Philosophie vorbehalten sind, weil sie nur philosophisch, d .h . gnoseologisch und wissenschaftstheoretisch, bewältigt werden können , bedeutet keine Unterschätzung der Wissenschaften; es geht vielmehr lediglich um die nötige Unterscheidung und Zuweisung von K o m petenz. D a ß die Philosophie diese Kompetenz beansprucht, steht nicht im Widerspruch zu ihrer Stellung als Partnerin der Wissenschaften, erst recht nicht, wenn man ihre Rolle in Anlehnung an Hans Lenk pragmatisch als Moderatorin des interdisziplinären Gesprächs zu umschreiben sucht. 7 Schließlich mag man sich in Erinnerung rufen: Die Frage nach der Möglichkeit von Bildung durch Wissenschaft war immer schon von der A r t , daß in ihrer Erör te rung die Wissenschaften philosophisch wurden, jedenfalls mit Philosophie sich berühr ten .
Vernunft. In: Grenzfragen, Bd. 12, hrsg. v. N. A. Luyten, S. 175-217, Freiburg/München 1982.
6 Vgl. Verf.: Thesen zur Grundlegung einer transzendentalen Historik. In: Seminar: Geschichte und Theorie. Umrisse einer Historik, hrsg. v. H. M. Baumgartner u. J. Rüsen, S. 274-302, 2. Aufl. Frankfurt/M. 1982. - Vgl. ebenso: H. M. Baumgartner/O. Höffe, Zur Funktion der Philosophie in Wissenschaft und Gesellschaft, in: K. Salamun (Hrsg.), Was ist Philosophie? UTB 1000, S. 301-312, 2. Aufl. Tübingen 1986.
7 Vgl. H. Lenk, Perspektiven pragmatischen Philosophierens, in: K. Salamun (Hrsg.), a.a.O. (s. Anm. 6), S. 313-334.

PERSONENREGISTER
Abaelard s. Petrus Abaelardus Abbagnano, N. 298 Adams, M . M . 303 Adelard von Bath 70 Adelmannus von Lüttich 9f., 13 Aegidius Romanus 167, 170, 176, 250,
255, 356, 363, 366 Aertsen, J. A. 314 Ahmad Ibn al-Saläh 127 f. Alanus von Lille 64 Albertus Magnus 133, 145, 148, 158,
161, 166, 171 ff., 175f., 356, 363 Albumasar 234 Alexander IV., Papst 229, 232 Alexander von Alexandria 240 Alexander von Aphrodisias 216, 222,
224 Alexander Bonini 363 Alexander von Haies 161, 397 al-Fârâbï (Alfarabi) 125-128, 145, 234 Algazel 234, 411 f., 420 Alger von Lüttich 13 Alhazen 234 Allard, M. 224 Alonso Alonso, M. 134, 136ff. Altner, G. 407 d'Alverny, M.-Th. 133, 135 Ambrosius 11, 395 Ammonius 127, 131, 214 Anastasius von Cluny 13 Anawati, G . C . 132 Andreas Galka von Dobczyn 362 Andreas von Gionzio 361 Andreas von Ko'scian 366 Andreas Wezyk 364 f. Andronikus von Rhodos 126 Anselm von Canterbury 4, 16-19,
20ff., 34f., 39-59, 63, 71, 103, 190, 198, 375-378, 380ff., 384, 425ff., 429
Anselm von Laon 65, 93 Ansfrid von Préaux 13 Antonius Andreae 364
Antonius Sirectus 331, 333-335, 337-341
Antonius Trombeta 331 Apuleius 142 Arendt, H. 405 Aristoteles 1, 23, 30, 37, 75f., 87, 94,
96, 99f., 105f., 109ff., 115, 120ff., 125 ff., 129, 131, 133, 149, 152f., 156-159, 165, 169f., 172, 176f., 188, 190ff., 196, 213-223, 227, 230, 234-236, 242f., 247-252, 257, 261 ff., 266-273, 275, 281, 283-286, 290, 292, 298f., 305f., 309, 314, 318ff., 324, 326, 356f., 360, 362ff., 366ff., 439 f.
Arius Didymus 87 Arnald von Villanova 133, 190 Arnaldez, R. 132 Ascelinus von Chartres 13 Asclepius 167 Auer,J. 334 Augustinus 5f., 11, 37, 40, 44, 51 f.,
65f., 89f., 93, 101, 142f., 156, 160, 187f., 194f., 241, 289, 336, 372, 395f., 398ff., 411
Augustinus von Ferrara 334f., 338ff. Averroes 132f., 166ff., 170, 215-220,
222-224, 231, 234-236, 242, 356, 411 Avicebron 234 Avicenna 23, 81 f., 131-139, 148, 150,
166, 169-173, 175, 180, 216, 218, 222f., 231, 234f., 245-257, 356
Bacon, F. 145 Bacon, Roger s. Roger Bacon Baeumker, C. 1, 370 Balie, C. 331 Bannach, K. 275 Barraclough, G. 35 Barth, K. 42, 44, 59, 190 Bartholomäus von Bologna 228-236 Bartuschat, W. 103

468 Personenregister
Baudry, L. 297 f. Baumgarten, A. G. 415 Baumgartner, H. M. 455, 463, 465f. Baumgartner, M. 163 Baumstark, A. 128 Baur, L. 167,230 Bazân, B.C. 204, 209, 212, 252 Beckmann, J.P. 182, 275, 288, 290 Beda 70 Behler, E . 246-249 Béraudy, R. 10 Berengar von Tours 9-17, 67 Berkeley, G. 307, 420f. Bernard, G. 331 Bernhard von Chartres 69 Bernhard von Clairvaux 21 f., 74, 77,
144 Bernhard von Neiße 367 Bernold von Konstanz 14 Bessarion, Kardinal 330 Beumer, J. 239 Biel, G. 412, 417f. Blomme, R. 93 Blumenberg, H. 277-283, 288f., 291,
369, 371, 372f. Böckle, F. 411 Boehner, Ph. 183f., 284, 297f., 301,
311, 313, 412 Boese, H. 131 Boethius 40, 70, 106, 108, 110f., 125,
128, 158, 188, 192 Boethius von Dacien 199, 225, 227, 250 Boler, J. 303 Bolz, N.W. 277 Bonaventura 45, 161, 188, 193, 195f.,
284, 290 Borgnet, A. 172 Bouhot, J.-P. 10 Bouillard, H. 44 Bouyges, M. 217 Boyle, R. 422 f. Brady, I. 282 Brampton, C.K. 297f. Bröcker, M. 143 Brown, B.F. 206 Brown, J.V. 239 Brown, St. 184, 296, 298, 300 Brulefer 331, 335, 338ff. Burleigh, W. 347
Busa, R. 203 Butler, A. 49 Buytaert, E . M . 332, 334, 350
Caffarena, J .G . 339 Cameron, A. 127 Campsall, R. 327 Cantin, A. 14 Cassiodor 129 Cathala, M.-R. 201 Cenacchi, G. 40 Cenci, C. 296 Chenu, M.-D. 2ff., 25, 63, 71, 142f.,
148, 162 f. Christensen, J. A. 127 Chrysipp 87 Cicero 86, 88, 95 Clarembaldus von Arras 70 Combes, A. 329f. Conring, H. 428 Constantin von Sarnano 331 Courtenay, W.J. 277 Curtius, E . R. 65 Cusanus s. Nikolaus von Kues Czartoryski, P. 367
Dancy, R. 261 Daniel von Morlay 66 Daniels, A. 40f. Day, S. 303 De Bruyne, E . 142 f. Decker, B. 168, 173f., 206 Delhaye, P. 13 Delorme, K. 167 Demokrit 454 Deneffe, A. 229 Descartes, R. 39, 46, 161, 379, 409ff.,
413, 419f., 422, 426f., 429f., 434, 436
Devisse, J. 5 De Wulf, M. 2, 164, 190, 197, 313 Didier, J.-C. 13 Dihle, H. 154 Dinha 127 Diogenes Laertius 87 f. Dirlmeier, F. 86 Domanski, J. 368 Dominicus Gundissalinus 67, 145, 152,
167

Personenregister 469
Dreßler, F. 15 Dudovet, J. 331 Duhem, P. 298 Duns Scotus s. Johannes Duns Scotus Durandus von Troarn 10, 13
Ebert ,Th. 110 Eckhart, Meister 190, 198 Ehrle, F. 197, 238 Emden, A . B . 296 Endres, J. A . 14 Erdmann, B. 432 Eriugena s. Johannes Scottus Eriugena Etzkorn, G . I . 179, 183ff. Euklid 358 Evans, G . R 59
Fichte, J . G . 153f., 370, 372, 439, 447-452
Flasch, K . 52, 58 Flashar, H . 165 Fliehe, A . 35 Fonseca, P. 266, 412, 418 Franz von Mayronis 330 f., 334 ff.,
339ff., 344f., 348-352 Frede, M . 110 Fulbert von Chartres 10 f.
Gâl, G . 296, 321 Galen 127, 131 Galilei, G . 409 Gardet, L . 246-249 Gaunilo von Marmoutiers 40, 49, 51,
376 Gauthier, R . - A . 151 f., 204 Geiger, L . B. 174 Genequand, Ch. 217 Gerhard, C . I . 427 Gerhard von Cremona 133 Gerson s. Johannes Gerson Gevaert, J. 220 Gibson, M . 9, 14 Gilbert von Poitiers 68, 103-124 Gilson, E . 88, 91, 133, 148, 150, 190,
193ff., 197, 201, 221, 370 Giraldus 13 Glorieux, P. 229, 238, 240 Gössmann, E . 69, 74 Goichon, A . - M . 138, 246
Gonsette, J . 15 Gottfried von Fontaines 133, 207, 229,
241 Gottschalk von Orbais 5ff., 9ff. Gozechinus Scholasticus 14 Grabmann, M . 2, 152, 230, 370 Graiff, C . A . 175 Gratian 6, 39, 65 Gredt, J . 314 Gregor I X . , Papst 151 Gregory, T. 70, 187, 189-198 Guitmund von Aversa 13
Habermas, J. 459 Hahn, A . 6, 72 Harnack, A . v . 371 Harris, C. R. S. 171 Hartmann, W. 15 Haskins, C H . 32 Hauréau, B 1 Haverals, M . 237 Hayduck, M . 167 Hegel, G . F . W . 369f., 376, 385f., 461 f. Heidegger, M . 178 Heinrich von Gent 166, 168, 177, 207,
228f., 233, 236-241, 245, 249-257, 280 f.
Heinrich von Harclay 240 Heinrich von Werl 339 f. Henrich, D . 40, 160, 427, 429-432, 436 Henry, D . P. 50, 103 Herbert von Bosham 40 Heriger von Lobbes 10 Herodot 84 Herrera, R. A . 53 Heurtevent, R. 10, 13 Herveus Natalis 349 Hinkmar von Reims 5 Hissette, R. 196, 224ff., 232, 240 Hochstetter, E . 313, 412 Hödl, L . 5, 12, 225, 227, 237 Höffe, O. 466 Hoeres,W. 262 Hoffmann, F. 281 Holz, H . 439, 442, 447, 454 Homer 85 Honnefelder, L . 165, 168-171,
177-182, 186, 259, 392 Horkheimer, M . 415

470 Personenregister
Hrabanus Maurus 6 f. Hübener, W. 277, 329 Hugo von Breteuil 13 Hugo von St. Viktor 143 Humboldt, W.v. 461 f. Hume, D. 419, 422f. Husserl, E . 39
Ibn Abï Usaybi'a 126 Inagaki, B. R. 301 Inciarte, F. 259 Isaak von Stella 68 Isidor von Sevilla 5
Jacobi, K . 103, 153 Jakob von Aleus 237 Jakob von Ascoli 240 Janke, W. 427f., 430f., 436 Javelet, R. 40 Johannes Buridanus 366 f. Johannes Canonicus 330, 341 Johannes Duns Scotus 45, 56, 161,
166ff., 170, 177-184, 191, 198 f., 228f., 240f., 243, 259-273, 280f., 285, 290, 323, 328, 330, 345f., 348, 351, 356, 412, 417, 419, 425f., 438-442, 445f., 454
Johannes Gerson 329, 332, 340 Johannes von Glogau 359-362, 364,
367 Johannes Gunsalvi 135 ff. Johannes Philoponus 127, 131, 135,
214-219, 222, 224, 246f. Johannes von Polliaco 229 Johannes de Ripa 329ff., 352 Johannes von Salisbury 68 f. Johannes de S. Benedicto 237 Johannes Scottus Eriugena 5-9, 11 f.,
15f., 19, 21 f., 34, 63, 161, 188 Johannes Versor 366 ff. Johannes Wiclif 329f., 362 Jolivet, J. 75 Jüssen, G . 141, 149, 163, 168 Justinian, Kaiser 127 Juvenal 83
Kant, I. 39, 45, 49, 56f., 165, 181, 187, 193, 259, 271, 284, 314, 376ff., 378-382, 384, 423, 447, 461 ff., 465
Keeler, L . W. 209 Kelley, F. 183 ff. Kenny, A . 78 Kepler, J . 409 Kienzier, K . 50, 53, 56 Kleanthes 83 Kleutgen, J. 370 Kluxen, W. 2, 62, 65, 79, 173f., 176,
180f., 185, 187, 229, 259, 285, 290, 296, 313, 390f., 411, 416, 425, 439, 442
Koch, J . 2f., 25 Köpf, U . 76 Kohlenberger, H . 40, 43, 45f., 49, 56 Kopernikus, N . 357 Kopper, J . 45 Korff, W. 387, 396f., 399 Korolec, J . B . 368 Kramp, J. 155, 161 Kremer, K . 166 Krings, H . 295 Kripke, S. 442f. Kuksewicz, Z . 367
Lakmann, C. 332, 334f., 338-341 Landry, B. 146 Lanfrank 9, 12-18, 67 Lang, A . 79 Leclercq, J . 24 Lefèvre, Ch. 212 Leff, G . 298, 301, 313, 320, 326 Leibniz, G . W . 46, 56, 372, 381, 413,
415, 420ff., 426-438 Leibold, G . 182, 184, 295, 297, 300 Lenk, H . 466 Lewis, C . I . 442 Liebeschütz, H . 63 L i t t ,Th . 219 Locke, J . 422f., 427, 429 Lorimer, W . L . 235 Lottin, O. 108 Loux, M . J . 316, 326 Lukrez 409 Luscombe, D . E . 81, 91 Luther, M . 396, 399 Lutterell, J . 281
Mabille, M . 229 Macken, R. 166, 245, 249-255

Personenregister 471
Macrobius 108, 144 Madkour, I. 132 Maier, A . 298 Maimonides s. Moses Maimonides Maiol i , B . 106 Malalas 127 Malebranche, N . 415, 421, 428 Mandonnet, P. 201 ff., 252 Manegold von Lautenbach 14 f. Manzolus 341 Marcion 371 f. Maréchal, J. 454 Maritain, J . 196 Markowski, M . 355f., 359f., 362, 366 Marquard, O. 369 Marrone, S. P. 149ff. Marsilius von Inghen 356 Martianus Capella 19 Martin IV., Papst 237 Martin, A . 217, 224 Martin, G . 314 Martin, M . 217 Masai, F. 194 Masnovo, A . 141 Mastrius von Meldola 341 Matsumoto, M . 33 Maurer, A . 201, 301 Mauritius a Portu Hibernicus 331, 339 Maywald, M . 226 McEvoy, J. 147 Meier, L . 329, 333 Melanchthon, Ph. 412f. Meyerhof, M . 126 Michael Scottus 167 Michot, J. 132 Mie the ,T .L . 40 Miethke, J. 227, 236, 286, 296, 298 Millas Vallicrosa, J . M . 134 Minio-Paluello, L . 125 Molina, L.de 266, 439, 442-449, 452 Montague, R. 443 Montclos, J.de 9 Moody, E . A . 148, 301, 313, 320 Moreau, J. 51 More wedge, P. 165 Moses Maimonides 65, 133 Mückshoff, M . 229 ff. Muczkowski, J . 355 Murait, A . de 259
Nasr, S . H . 187 Natorp, P 165 Newton, I. 284, 409 Nicolaus Bonetus 330, 341 ff. Nielsen, L . O . 106 Nikolaus von Kues 34, 381 ff. Norena, C. 301
Obermann, H . A . 143f., 277 Ockham s. Wilhelm von Ockham O'Donnell, J . R . 142, 147 Odo Rigaldus 284 Oehler, K . 110 Oeing-Hanhoff, L . 166, 173, 175f. Origenes 161 Otloh von St. Emmeram 14f. Otte, G . 69 Owens, J. 165, 169, 172
Panaitius 88, 100 Pascal, B . 88f. Paschasius Radbertus 10 Patricius 10 Paul von Würzen 361, 363, 366 f. Pelster, F. 229 Peppermüller, R. 19 Perotinus Magnus 143 Pession, P. 201 Peter von Ail ly 412, 418 Peter von Candia (Alexander V.) 238 Peter von Sienno 361, 363, 365 Petrus Abaelardus 5, 19-24, 68, 71,
74ff., 78, 117, 150, 392, 397 Petrus Aureoli 341 Petrus de Castro vol 330, 333, 335,
338 ff. Petrus Damiani 14f., 67 Petrus Helias 65 Petrus Lombardus 65, 161, 282, 446 Petrus Musaeus 341 Petrus Thomae 330, 332-335, 337-344,
348 ff. Philipp der Kanzler 157 Philippe, M . - D . 221 Philippson, R. 87 Pieper, A . 103 Pinborg, J. 317, 328 Pindl-Büchel,Th. 117 Pines, S. 125

472 Personenregister
Platinga, A . 40 Plato 75, 82, 84ff., 101, 131, 154, 192,
214, 216, 252, 268, 316, 411, 460, 462 Platzeck, E . W . 45 Plotin 108, 248 Pohlenz, M . 87 Porphyrius 117, 125, 300, 303 Poseidonius 100 Pouchet, R. 48 Priscian 114 Proba 128 Proklus 131, 134, 213-216, 224, 248 Pseudo-Dionysius Areopagita 221, 400,
416
Qu ine ,W.V.O. 261 Quinn, J .F. 193
Rabe, H . 214 Radulphus Brito 349 Rahner, K . 176 Ranke, L .v . 28 Rather von Verona 10 Rathramnus 10 Razi 132 Regenbogen, O. 86 Rescher, N . 127 Richter, V. 182, 184, 296f. Riedlinger, H . 147 Rijk, L . M . d e 19, 104, 117, 313, 316 Ritter, J. 290 Rivera Recio, J .F. 134 Robb, J . H . 204 Robert, P. 193 Robert Grosseteste 147, 161 Robertus Anglicus 330f., 341-345,
347-351 Robin, L . 85 Rochais, H . M . 144 Roger Bacon 133, 158, 167 Roland-Gosselin, M . D . 202 Rorty, R. 160 Roscelinus von Compiègne 18 Ross, D. 86 Rothholz, W. G . H . 227 Rousseau, J. J . 67 Rupert von Deutz 77 Russell, B. 288, 448
Sack, R H . 296 Saffrey, H . D . 127 Salomon, der Jude 135 ff. Sbaralea, L H . 297 Scapin, P. 45 Schauwecker, H . 15 Schelling, F . W . J . 75, 454, 461 f. Schelsky, H . 461 Schiller, F. 84 Schipperges, H . 66 Schmaus, M . 330 Schmidt, G . 46, 427 Schmidt, M . A . 106, 113 Schmitt, F.S. 39, 41-44, 50, 103 Schrimpf, G . 1, 5f., 8, 169 Scott ,T.K. 303 Seckler, M . 76 Seneca 40, 86, 94, 100 Siger von Brabant 175, 196, 199, 209,
21 If., 224, 227, 250, 252 Silwanus von Quardu 128 Simon, J. 375, 380 Simon de Brion 227 Simplicius 135, 167, 214f., 246 Smet, A , 135 Sokrates 84f., 252, 460 Southern, R . W . 14, 61f., 64f., 71, 147 Specht, R. 409 Spinoza, B.de 419, 421 Steel, C. 213 Steele, R. 167 Stegmüller, F. 447 Steinen, W. von den 24 Stephan, R. 143 Stephan Tempier 224f., 227, 250 Stephan von Tournai 77 Stobaeus 83, 87 Stolz, A . 42, 190 Streveler, P. A . 303 Stump, E . 158 Suârez, F. 266, 301, 409f., 413, 415,
417
Tacitus 29 Tanaka, M . 33 Taubes, J. 277 Tempier s. Stephan Tempier Theiler,W. 153 Themistius 131, 135

Personenregister
Theodorakopoulos, J . N . 187 Theoduin von Lüttich 13 Theophrast 86 f. Thierry von Chartres 70 Thomas Anglicus 330 Thomas von Aquin 37, 40, 45, 54, 57,
76, 78f., 131, 133, 135, 144, 148, 152, 161 f., 166 ff., 171-177, 179, 191, 195, 199, 201-213, 215, 218-224, 227f., 230, 240f., 249f., 254f., 259, 272, 290f., 305-308, 310f., 320, 323, 332, 352, 356, 366f., 372, 377, 380, 382, 410ff., 415, 417f., 446, 454
Thorndike, L . 142, 145 Trithemius 155
Valois, N . 141 Van den Bergh, S. 411 Van Riet, S. 131, 166, 171, 175, 246 Van Steenberghen, F. 30, 32, 158, 187,
193-197, 199, 209, 225, 227 f. Verbeke, G . 81, 89, 100, 246ff. Vignaux, P. 187, 190f., 198f., 313, 330 Vitalis a Fumo 229 Volk, H . 334 Voltaire 370
Wadding, L . 262, 297, 330 Wagner, H . 286, 454 Walter von Chatillon 66 Wéber, E . - H . 211 f. Weidemann, H . 174
Weisheipl, J . A . 204, 210, 297 f. Weisweiler, H . 229 Wicki , N . 157 Wiclif s. Johannes Wiclif Wieland, G . 61, 75, 108, 169, 172 Wieland, W. 246 f. Wilhelm von Auvergne 141-163,
168 Wilhelm von Auxerre 397 Wilhelm von Champeaux 93 Wilhelm von Conches 70 Wilhelm von Macon 237 Wilhelm von Moerbeke 131, 135 Wilhelm von Ockham 34, 161, 166,
182-185, 190, 196, 224, 266, 273, 275, 280-286, 290-293, 295-311, 313-322, 324-329, 345f., 412
Wilhelm von Shyreswood 158 Wilhelm von St.-Thierry 22 Wilhelm von Vauroullion 332 Wilpert, P. 65 Wippel, J .F. 172, 174, 201 Wittgenstein, L . 143, 150, 448 Wlodek, Z . 364 Wolff, Ch. 165, 415 Wolfhelm von Brauweiler 13 Wood, R. 321
Zayed, S. 132 Zenon 86 Zimmermann, A . 77, 166f., 170ff.,
315, 323, 425, 430