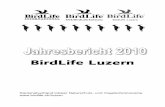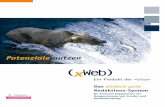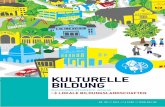Potenziale lokaler Bildungslandschaften
-
Upload
deutsche-kinder-und-jugendstiftung-dkjs -
Category
Documents
-
view
228 -
download
0
description
Transcript of Potenziale lokaler Bildungslandschaften

Potenziale Lokaler Bildungslandschaften Was sie sind, wie sie funktionieren und wie man sie unterstützen kann

Warum Bildungslandschaften? Bildung als Schlüsselthema der kommunalen Entwicklung
Bildung ist ein wesentlicher Faktor bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung von Städten, Landkreisen und Gemeinden. Eine gut ausgebaute, konzeptionell aufeinander bezogene und verlässlich miteinander ver-knüpfte Bildungsinfrastruktur kann zur gesellschaftlichen Teilhabe der Bürger/innen eines Gemeinwesens und zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen.
Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung kommunaler Bildungslandschaften (2009)
Eine Kommune, die Kindern und Jugendlichen eine hochwertige Bildung anbieten kann, ist auch für deren Eltern attraktiv. Bildungsorientierte Eltern fühlen sich in einer bildungsorientierten Kommune eher zu Hause. Eine Kommune, die es schafft, Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten angemessen zu fördern, vergrö-ßert deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt und verringert dadurch langfristig die eigenen Ausgaben für Sozial-transfers. Kommunen, die auf das Thema Bildung setzen, sind für den demographischen Wandel besser gerüstet.
Peter Bleckmann und Dr. Anja Durdel (DKJS): Lokale Bildungslandschaften. Perspektiven für Ganztagsschulen und Kommunen (2009)
Modernes Bildungsverständnis: Verknüpfung formaler und non-formaler Bildung
Ich habe immer gedacht, dass es ein bisschen verrückt ist, dass wir innerhalb der Schule viel Kraft investieren, um Stoff zu bearbeiten, der „echt“ aussieht und sich „echt“ anfühlt, während die wirklich echte Welt draußen weiter läuft. Und diese echte Welt ist voller Geschichte, Sozialkunde, Arbeitslehre, Naturwissenschaft, Mathematik, Schreiben, Technik und alles andere. Warum gehen wir nicht einfach nach draußen?
Dennis Litky, Gründer der amerikanischen Metropolitan Schools (2004)
Der subjektbezogene Blick auf Bildungsprozesse im Lebenslauf relativiert die Bedeutung formaler Bildungsinsti-tutionen und öffnet ihn für neue und andere Lernorte und Bildungsgelegenheiten.
Zwölfter Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung (2005)
Effizienzsteigerung durch staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft
Eine kooperative und in den regionalen Kontexten zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen abge-stimmte Politikgestaltung gilt als effektiver und effizienter, weil so die unmittelbare Berücksichtigung tatsächlich vorhandener Ressourcen sowie die Entwicklung kollektiver Innovationsleistungen „vor Ort“ steigen („Regionale Modernisierungspolitik und Enthierarchisierung der Politikgestaltung“).
Prof. Dr. Karl Düsseldorf, TU Berlin (2010)
Das durch die Stadt in den Kitas betreute Kind ist das gleiche Kind, das morgen die Grundschule und übermor-gen die weiterführende Schule durchläuft, für die das Kultusministerium zuständig ist. Für gelingende Bil-dungsbiographien wird es immer mehr darauf ankommen, ein konsistentes System von Bildung, Betreuung und Erziehung zu schaffen.
Peter Rohrbach, Bürgermeister der Stadt Weiterstadt (2008)
2

Was ist eine lokale (oder kommunale) Bildungslandschaft?
Dr. Anja Durdel und Peter Bleckmann: Lokale Bildungslandschaften. Perspektiven für Ganztagsschulen und Kommunen (2009)
Stimmen aus der Praxis:
„Das Ganze muss nachhaltig sein. Denn wir treten hier nicht an, um das alles nur für den Zeitraum von „Le-benswelt Schule“ zu machen. Das empfinden wir auch als so positiv. Wir haben eine gemeinsame Zielstellung. Das führt aus meiner Sicht zu Nachhaltigkeit.“
Dezernentin für Beschäftigung, Bildung, Kultur und Soziales des Salzlandkreises, Sachsen-Anhalt
„Es ist sehr gut, dass uns ‚Lebenswelt Schule’ einen Leitfaden gegeben hat und uns über die Prozessbegleiterin unterstützt hat. Wir wussten ganz genau, wo lang wir laufen, wohin wir laufen. Aber ich muss schon sagen, dass das Ganze durch ‚Lebenswelt Schule’ systematisiert worden ist.“
Schulleiterin Campus Technicus, Bernburg, Sachsen-Anhalt
„Wir brauchen Problembewusstsein bei Steuerkräften und die Erkenntnis, dass die Kooperation eine wichtige strategische Aufgabe ist. Entschließt man sich, die Zusammenarbeit in einer Region, einem Kreis systematisch und gezielt voranzubringen, braucht es einen aktivierenden Start mit einem breiten Teilnehmerkreis aus beiden Systemen. Eine Arbeitsgruppe zur Moderation und Koordination des Prozesses ist unabdingbar.“
Schulrat, Potsdam-Mittelmark
„Satrup nimmt seinen Bildungsauftrag, den es als Standort von Schulen, Kindergärten, Bücherei, Volkshochschu-le und weiteren Bildungseinrichtungen herleitet, sehr ernst. Dies macht Satrups Bürgermeister Harald Krabben-höft bei der Auftaktveranstaltung -,Bildungslandschaften zwischen den Meeren – Bildung gemeinsam verantwor-ten´ im Satruper Amtshaus deutlich.“
Flensburger Tageblatt, 10.11.2009
„Der lokale Sozialraum (Dorf, Stadtteil, Kiez) stiftet Identität und ermöglicht Beziehung. Beides ist für eine gelin-gende Bildungsbiographie unabdingbar Voraussetzung.“
Fachdienstleiter Kinder- und Jugendhilfe, Weiterstadt
„Lokale Bildungslandschaften“ sind
• langfristige,• professionellgestaltete,• aufgemeinsames,planvollesHandelnabzielende,• kommunalpolitischgewollte• NetzwerkezumThemaBildung,die–• ausgehendvonderPerspektivedeslernendenSubjekts–• formaleBildungsorteundinformelleLernweltenumfassenund• sichaufeinendefiniertenlokalenRaumbeziehen.
3

4
Steuerung lokaler Bildungslandschaften „Bildungslandschaften brauchen feste Strukturen der Kommunikation und Kooperation und entsprechende Steuerungsinstrumente.“
Dieter Assel, Fachdienstleiter Kinder- und Jugendhilfe Weiterstadt
Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung kommunaler Bildungslandschaften (2009)
Herausforderungen bei der Steuerung lokaler Bildungslandschaften:
„Für einen Gesamtplan stellen sich gleich mehrere Fragen, die gelöst bzw. angegangen werden müssen:
•WassinddierelevantenBildungsorte,dieaufBildungsprozesseEinfluss haben bzw. Bildungszugänge ermöglichen?
•WiekönnenschulischeundaußerschulischeBildungsortemiteinander zu Abstimmungen kommen und sich in ihren Lern- und Förderangeboten aufeinander beziehen?
•Wiekönnenaußerschulischebzw.anGanztagsschulenaußerunterrichtliche Bildungsbemühungen miteinander verbunden werden, um z.B. Lernschwä- chen, die im Unterricht auffallen, beheben zu können?
•WelchedasschulischeLernenergänzendenundunterstützendenFormen der Bildungsförderung werden benötigt und sind auch sinnvoll?
•WiekönnenLerngelegenheiteninformalen,non-formalenundinformellen Bildungsorten gefördert werden?
•WelcheRollekanndieFamilienbildung(evtl.gekoppeltmitderElternarbeit an Schulen) spielen, um Eltern zu stärken?
•KanndieVolkshochschuleeinenBeitragzuBildungsförderungleistenund wenn ja, welchen?
•WiekönnendieverschiedenenAngebotederGemeindenimländlichenRaum miteinander gekoppelt werden; kann es Abstimmungen geben?
•KönnenFamilienzentrenimBereichderTageseinrichtungenfürKinderauch im schulischen Raum ein wirksamer Ansatz sein?
•WiekönnenÜbergängezwischendenverschiedenenBildungsbereichenso gestaltet werden, dass alle Kinder und Jugendlichen davon profitieren?
•WiemüssenBildungswerbungundÖffentlichkeitsarbeitgestaltetsein, um die gewünschten Zielgruppen zu erreichen?“

5
Zentrale Steuerungsinstrumente einer lokalen Bildungslandschaft:
• Abteilungsübergreifendes Gremium zur strategischen Weichenstellung, Rückbindung an kommunale / Landesressorts und Entscheidungswege;
• Arbeitsfähiges Umsetzungs-Team;
• Professionelle Prozess-Steuerung zur Synchronisation der Teilprozesse;
• Entwicklung verbindlicher Leitbilder;
• Entwicklung übergreifender Handlungsregeln entlang der Bildungsbio- graphie der Bürger, die für unterschiedliche Professionen bindend sind;
• Aufbau dezentraler Entwicklungseinheiten;
• Bedarfsorientierte Formen des Bildungsmonitoring / Bildungsberichter- stattung, die Kennzahlen aus dem Bereich formaler Bildung erhebt, sich aber nicht darin erschöpft
• Selbstevaluation;
• Aktive Kommunikation innerhalb und außerhalb der kommunalen Öffentlichkeit und Beteiligungsmöglichkeiten für junge und alte Bürgerinnen und Bürger.

6
Steuerungsstrukturen einer Bildungslandschaft am Beispiel „Lebenswelt Schule“ Weiterstadt:
Dr. Heike Kahl, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
„Vernetzung macht nur Sinn, wenn es inhaltliche Ziele gibt, sonst gibt es eine Vernetzung um der Vernetzung willen.“
• Modellkommune seit 2007
• Lage: Rhein-Main-Gebiet; 24.000 Einwohner
• 2 Gesamtschulen, 4 Grundschulen, 1 Förderschule 16 Kindertageseinrichtungen, SV an Schulen und Aktionsgruppe JUMP (Jugend macht Politik)
• Elternbeiräte / Fördervereine in Schulen und Kitas Kommunale Jugendförderung
• Entwicklungsthema: Übergangsgestaltung Kita- Grundschule-Weiterführende Schule
• ZiEL: Entwicklung eines kommunalen Handlungs- leitfadens zum Übergangsmanagement
Ein gemeinsames Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Jacobs Foundation

7
Netzwerkstruktur in der Modellkommune Weiterstadt
Stadtverwaltung Bildungsbeirat
Eltern
weiter-führende
Schule
Jugendhilfe- einrichtung
N.N.
Familien- zentrum
Kitas
Grund- schule
Vereine Verbände
Land-kreis
Unter-nehmenLandtag
Zivilge-sellschat
Stattl. Schulamt
Projektbeirat
Steuerungs- gruppe
Prozess- steuerung
Entscheider/ Unterstützer
Operative Ent-wicklungsarbeit
strategische Steuerung,Ressourcenplanung
Konzeptentwicklung und Management derBildungslandschaft
Operative Netzwerke von Einrichtungen
Prozessbegleitung

8
Strategische Entscheider und Unterstützer:
Zentrales Steuerungsinstrument BildungsbeiratDer Bildungsbeirat wurde vom Rat der Stadt einberufen. ihm gehören Vertreter der Bildungseinrichtungen, der Kommunalverwaltung, zivilgesellschaftlicher Träger sowie Elternvertreter an. Funktionen und Aufgaben:
• Beratung der politischen Gremien in Bildungsfragen • Erstellung von Bildungsberichten und lokalen Bildungsplänen • Entwicklung von Handlungskonzepten und Zielorientierungen in Fragen der Bildung, Betreuung und Erziehung • Förderung des Dialogs zwischen Schulen und Jugendhilfeträgern
Projektbeirat Der Projektbeirat wurde einberufen, um weitere Entscheider und Unterstützer auch außerhalb der Kommune selbst in den Prozess einzubeziehen. ihm gehören Vertreter des Landkreises, des staatlichen Schulamts, des Landtags, aus Unternehmen und Stiftungen an.
Projektsteuerung:
Steuergruppe
• Konzeptentwicklung • Projektmanagementaufgaben• Bündelung von Zwischenergebnissen • Zeitliche Steuerung des Prozesses und Synchronisierung von Teilergebnissen • Selbstevaluation
Operative Entwicklungsarbeit 80-100 Einzelakteure, idR Fachkräfte aus Bildungseinrichtungen, bei kommunalen Fachtagen Stadtteil-AGs, in denen das Thema „Übergangsmanagement“ konkret zwischen den beteiligten institutionen diskutiert und entwickelt wird, AG Jugendbeteiligung

Sta
tio
nen
deS
Pr
oze
SS
eS in
Wei
ter
Sta
dt
Prozess- steuerung
entscheider / unterstützer
oPerative ent-wicklungs- arbeit
Aufn
ahm
e vo
n W
eite
rsta
dt in
s Pr
ogra
mm
Leb
ensw
elt S
chul
e
Ents
chei
dung
für d
as E
ntw
ickl
ungs
-vo
rhab
en: Ü
berg
angs
man
agem
ent
Sep
t 200
7Fe
b 20
08Ju
ni 2
008
Feb
2009
aug
200
9Ja
n 20
10S
ept 2
010
Bünd
elun
gSt
art P
roze
ss-
begl
eitu
ng
Vors
tellu
ng d
es
Proj
ekts
im S
tadt
rat
Bera
tung
N
etzw
erkm
anag
emen
t du
rch
Expe
rten
Aufta
ktve
r-
anst
altu
ng
Ents
chei
dung
der
Kita
s, G
rund
-sc
hule
n un
d w
eite
rfüh
rend
en
Schu
len
zur T
eiln
ahm
e
Ist-
Stan
ds-E
rheb
ung
Übe
rgan
gsm
anag
emen
t
Ausw
ertu
ng Is
t-St
and
in
der
Pro
jekt
grup
pe
1.Fa
chta
gung
Bild
ung
Reso
nanz
foru
m
mit
alle
n Le
istun
gen
der
Einr
icht
unge
n 2.Fa
chta
gung
: En
twic
klun
g Le
itbild
; Bi
ldun
g St
adtte
il-A
Gs
Vera
bsch
iedu
ng
1.Zw
ische
nber
icht
im
Sta
dtra
t Vors
tellu
ng E
rgeb
niss
e
der S
tadt
teil-
AG
s
Sync
hron
isier
en d
er
Proz
esse
der
Sta
dtte
il-A
Gs
3.Fa
chta
gung
m
it al
len
Akt
iven
Grü
ndun
g Pr
ojek
tbei
rat
(Lan
dkre
is, S
taat
liche
s Sc
hula
mt,
Unt
erne
hmen
, Zi
vilg
esel
lscha
ft)
Vera
bsch
iedu
ng
Han
dlun
gsle
itfad
en
Übe
rgan
gsm
anag
emen
t
Um
setz
ung
des
Konz
epts
zum
Übe
r-
gang
sman
agem
ent
Wei
tera
rbei
t St
adtte
il-A
Gs
Steu
erun
gsgr
uppe
und
Ko
nzep
t ent
steh
en

10
Das Programm „Lebenswelt Schule“ der DKJS und der Jacobs Foundation
Im Programm Lebenswelt Schule werden vier Modellkommunen dabei unterstützt, anhand konkreter Vorha-ben lokale Verantwortungsnetzwerke aufzubauen, bei denen alle relevanten Akteure mitwirken. Während der Bearbeitung dieser konkreten Vorhaben werden lokale Strukturen nachhaltig verändert, so dass schließlich alle Kinder und Jugendlichen der jeweiligen Altersgruppe optimal unterstützt werden. Lebenswelt Schule zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:
•EinkonkreteslokalesVorhabenistderAusgangspunktfürdenAufbauderNetzwerkstrukturen. •DielokalenVorhabenwerdenmitdemBlickaufdieBegleitungdesLernwegseinesKindes und Jugendlichen entwickelt. •SchulenwerdenineineregionaleNetzwerkstruktureingebettetundsozuPartnernim Gemeinwesen. •DieSteuerungerfolgtineinemdialogischenProzesszwischenPraktikern,Verwaltungund Zivilgesellschaft, bei dem bottom-up und top-down-Steuerung ineinandergreifen.
DiebeteiligtenKommunenerhaltenimProgramm„LebensweltSchule“folgendeUnterstützung:
•ProfessionelleProzessbegleitungzureffizientenNetzwerksteuerung; •BeratungbeimAufbauderlokalenStrukturen,derZielformulierungundEvaluation; •MöglichkeitendesPeer-to-Peer-LernensbeibundesweitenNetzwerktreffen; •AnschubfinanzierungfürlokaldefinierteVorhaben; •UnterstützungbeiÖffentlichkeitsarbeitundKommunikation.

11
Rückmeldung der externen Evaluation zu Lebenswelt Schule
Prof.Dr.ThomasCoelenundOliverStettner,KommunalpädagogischesInstitut,ExterneEvaluation„LebensweltSchule“(2009)
Schleswig-Holstein: Bildungslandschaften zwischen den Meeren
Kernelementevon„LebensweltSchule“habensichbewährtundregenanderezurNachahmungan:VordemHintergrundderErfahrungendesProgramms„LebensweltSchule“hatdasLandSchleswig-HolsteineineigenesProgrammaufgelegt,mitdemdreikleinerekreisangehörigeKommunenbeiderGestaltungihrerBildungslandschaftunterstütztwerden.DasProgrammheißt„Bildungs-landschaftenzwischendenMeeren-Bildunggemeinsamverantworten.“DasProgramm wird vom Sozialministerium in Kooperation mit dem Kultusministeriumverantwortet;esistimSommer2009angelaufen. DieStrukturelemente,aufdiedabeizurückgegriffenwurde,sind:
•Prozessbegleitung; •AnschubfinanzierungfürlokaldefinierteVorhaben; •FachlicheBegleitungdurchdieServiceagenturGanztägigesLernenderDKJS; •Vernetzungundvoneinanderlernen.
http://www.dkjs.de/programme/bildungspartner-vernetzen/zwischen-den-meeren.html
„Die entscheidenden Kernelemente von Lebenswelt Schule haben sich in der Praxis gut bewährt bzw. entwickelt. Sie machen – auch im Vergleich mit ähnlichen Programmen – die besonderen Stärken des Programms aus. Sie sind es wert, in andere Kontexte übertra-gen zu werden:
•Bottom-upStrategie:AnknüpfenanbestehendeDiskurseundGremien;
•KommunaleZuständigkeitundVerantwortung:Leadershipder örtlichenPolitikundVerwaltung;
•BiographiebegleitendePerspektive:GestaltungvonÜbergängen.
HinsichtlichderÜbertragungsmöglichkeitenderProgrammideeunddergenann-tenKernelementelässtsich–inallerVorsichtnacheinemJahrBeobachtungszeit–einegutePrognoseformulieren.“

12
Auftaktveranstaltung Lebenswelt Schule Weiterstadt – Reportage
Eine ganze Stadt macht SchuleWeiterstadt.BiszumFrankfurterFlugha-fensindes20km.AmkleinenBahnhofahnt man nichts von der großen weiten Welt.ObwohlderNameesschonseitüber1000Jahrenverspricht,istWeiterstadterst1993Stadtgeworden.DiefünfDörfersindjetztStadtteile.DergrößteMediamarktEu-ropaswurde2002imGewerbegebieteröff-net,inzwischengibteseinengrößeren.WoeinGroßmarktist,sindviele.2009solleineneueShopping-Malleröffnetwerden.DieJVA Weiterstadt hat manchmal prominente Gäste. Aber sonst, was gibt es aus Weiterstadt zuberichten?Erstaunliches.DennWeiterstadtisteinBildungs-Labor.Freiwillig.VollerPioniergeist.SieisteinevonbundesweitvierModellkommunendesProgramms„LebensweltSchule“derDeutschenKinder-undJugendstif-tung(DKJS)undJacobsFoundation.DarüberhatnichtdasLosentscheiden,sondernEngagement.WeiterstadthatsichmitdemPlan„BildungauseinerHand“beworben.DerbündeltdieArbeit,dieWeiterstadtindenvergangenenfünfJahrenschonbegonnenhat.Seit2003gibtesinderKommu-neeinenBildungsbeirat.NachPISAhabendieBürger,dieBildungseinrichtungenunddiePolitikerin Weiterstadt etwas ändern wollen. Statt in Zuständigkeiten zu denken, wollten sie über die Sache nachdenken.WiebekommenunsereKinderbessereBildungundmehrChancen?BürgermeisterPeterRohrbachsagt:„WirhabendieErfahrunggemacht,dassmanvonuntenrichtigvielbewegenkann,wennmanalleanBordholt.“
Der Weiterstädter Bildungsweg„WaswirheuteMittagprobieren,dasgabesinHessennochnie“,sagtDr.WilfriedVetter.Derpen-sioniertePersonalmanageristderVorsitzendedesBildungsbeirats.HeutehabensiealleLehrerundErzieherderStadteingeladen,umüberBildungzureden,überihrenPlan„BildungauseinerHand“.Sie wollen ein lokales Bildungsnetzwerk knüpfen, das alle verbindet, die für die Bildungsbiographie derKinderundJugendlichenzuständigsind.DieWechselvonderKitaindieGrundschule,vonderGrundschule in die weiterführende Schule, bis zum Gymnasium soll ohne Brüche gestaltet werden. DasverlangteinenanderenBlickaufdieKinderundwassiekönnen.UnterstütztvomProgramm„LebensweltSchule“sollenindennächstendreiJahrensystemübergreifende,vonKindernundElternmitgestalteteBildungspläneundLerndokumentationen(Portfolios)entwickeltwerden.DazubrauchtmanalserstesdieLehrerdersiebenWeiterstädterSchulenanBord.Daswirdnichteinfach,aberdieAnstifterimBildungsbeiratsindoptimistisch.DiskussiongehörtzumProzess,damithabensieschonvielErfahrung.„SchulentwicklungfängtimmeranderBasisanundentwickeltsichdannweiter.PerErlassgehtdagarnichts“,sagtDr.WalterSchnitzspan,SchulleiterderAlbrecht-Dürer-Gesamtschule.DieterAssel,FachdienstleiterFachbereichKinderundJugendderStadt,ergänzt:„Eskommtdaraufan,esaufweiterstädtischzumachen.“

13
Startschuss für „Lebenswelt Schule“DerSaalistrestlosgefüllt.„SovielResonanzsiehtschonmalgutaus“,freutsichWilfriedVetter.ErmoderiertdenNachmittagundbegrüßtdasgespanntePublikum.BürgermeisterPeterRohrbachspricht von einem Meilenstein, denn die ganze Stadt – von der Kita bis zur Kirchengemeinde – zieht aneinemStrang.ErdanktallenfürihrEngagement:denLehrern,denErziehern,denSozialarbei-tern,denEltern,denSchülern.PeterBleckmann,Programmleiter„LebensweltSchule“derDKJS,stelltkurzdieProgrammzielevor:„DerSatz»Niemandsollzurückbleiben«klingtsoeinfach,ihnumzusetzenistjedochschwer.“DerAufbaulokalerBildungslandschaftenwieinWeiterstadtsollzei-gen,dassderAnspruchverwirklichtwerdenkann.DieBegleitung,DokumentationundEvaluationderEntwicklungvonWeitertstadtsollzumVorbildguterPraxiswerden.AndereKommunenwerdenspäterlernen,wieesauf„weiterstädtisch“geht.PeterBleckmannwünschtderStadtvielErfolg,dassihre Bildungslandschaft wächst, gedeiht und bald blüht.
Drei Jahre HausaufgabenJetztwird„LebensweltSchule“inWeiterstadtkonkret.„DieIdeeist,dasswirnichtgucken,wieeinKindschulfähigwird,sondernwiedieKita,dieSchulekindfähigwerden“,formuliertDieterAsseletwasprovokantdasZiel,„deshalbsollenLerndokumentationenalsInstrumentimMittelpunktstehen.“DerindividuelleBildungsplansollhelfen,einengemeinsamenBlickaufjedesKindzubekommenundesentsprechendzufördern.WalterSchnitzspanergänzt,individuelleFörderplänesollen nicht erst geschrieben werden, wenn Schüler sitzen bleiben, sondern sollen dokumentieren, was ihnen gelingt, wie sie sich entwickeln. Weil er seine Kollegen kennt, fragt er gleich selbst: Was dasdenSchulenbringt,außerzusätzlicheArbeit?NatürlichseieseineFragederRessourcen,soderSchulleiter.DieneuenLösungenmüssenfürjedenLehrerumzusetzensein.EswirdPädagogischeTagegeben,ProjekttagezurFortbildung,KreativeLösungenmitverschiedenenKooperationspart-nern und Arbeitsgruppe, die an den bestehenden Strukturen angebunden sind. Als professionelle BegleiterundProzessmanagerunterstützenUlrikeLeonhardtundChristinaFlehrindennächstenMonaten,indendreiJahren,dieWeiterstädter.Wiegut„BildungauseinerHand“zumneuenHes-sischenBildungs-undErziehungsplanpasst,zeigtSabineKoenen,selbstSchulleiterininderKom-mune,aberauchalsFachberaterinfürdasStaatlicheSchulamtdesLandkreisesDarmstadt-DieburgundderStadtDarmstadtaktiv.DieSchulenundKitasvonWeiterstadthabennichtaufdenfertigenBildungs-Plangewartet,sondernschonFortschrittegemacht,dieindreikurzenReferatenvorgestelltwerden.
Mit gutem Beispiel voranFrühförderung.DieFörderschuleAnna-Freud(Peter-Petersen-Schule)kooperiertmitdieKitaPusteblume,um den Übergang besserzugestalten.BeateSchmahl,Ergotherapeutin,stelltdieArbeitsweiseih-rerKitavor.„DurchdieDokumentationindenPortfoliobüchernhabenwireinengutenBlickaufdieLernhaltungderKinder,“sagtsie.MitdemErgebnis,nichtfürjedesKindistesgutmit6indieSchulezugehen.FürundmitdiesenKindernarbeitetFrauReinheimer,LehrerinderAnna-Freud-Schule,vierStundeninderWocheinderPusteblume.„Wirhabenfestgestellt,dassKindererstsehrspätdemFörderzentrumgemeldetwerden,inder3.,4.KlasseodersogarnachdemÜbergangzurSekundarstufe.DabeihabenvieledieserKinder,schonimKindergartenAuffälligkeitenundLern-schwierigkeitengezeigt.“DurchdieengeKooperationmitderKitakannsiefrühaufdieFörderungeinzelnerKinderEinflussnehmen,dieElternbesserberaten,mitFachdienstenschnellerkooperie-ren, individuelle Lernwege entwickeln und den Übergang zur Schule begleiten, moderieren.

14
IndividuelleLernbegleitunginderGrundschule.DieLehrerinMarianneSebanarbeitetinihrerer-stenKlasseandderSchloss-SchuleGräfenhausenschonmiteinerLerndokumentation.„AlsichvoreinigenJahreneinLerntagebuchausWeiterstadtindieHändenbekam,dachteich,dasisttoll,wa-rumführenwirdasnichtweiter?“InzwischenhatsiemiteinerKolleginverschiedeneArbeitsblätterentwickelt.ZumBeispieldenBogen»Selbsteinschätzung«.ImGesprächmitdenKindernnotiertdieLehrerininverschiedenenKategorien:»Soseheichmich,sosiehtmichmeineLehrerin«.DieElternsindbeidemGesprächdabei,alsZuhörer.DieKinderfühlensichsehrernstgenommen.EinanderesBlatthatdieÜberschrift„Geschafft!Gelernt“.Hierwirddokumentiert,wasdasKindgelernthatundwieesdasgelernthat.EinBlattheißt„Daskannichgut“.ZumBeispielstehtda:„IchverstehedieLese-Arbeitsblätterganzgut.Kinder,dienichtweiterwissen,dürfeninmeinHelferbürokommen.“DasBlatt„Geschichtenübermich“könnenauchElternoderGroßelternzuHauseausfüllen.
IndividuellerLehrplan.FrauVergin,Lehrerin,undMarkusRies,Sozialarbeiter,vonderHessenwald-schule,arbeitenmiteinemneuenLernkonzeptinderKlasse7e,einerverbundenenHauptschul-undRealschulklasse.EinindividuellerLernplanbegleitetdieSchülerdurchdasganzeSchuljahr.AufdemBlatt„MeineLernwoche“wirdTagfürTageingetragen,wassielernenwollenundwassiegelernthaben.DafüristRitualisierungwichtig.DieersteStundeamMontagistfürdenRückblickaufdieLernwoche reserviert. Alle sitzen im Kreis. Was hat geklappt, was nicht, wo fehlt mir was, wer kann mirhelfen,daszuergänzen?DerSozialarbeiterMarkusRiesistachtStundenproWocheamNach-mittaginderKlasse.Erbietet„betreutesLernen“an.Kinder,diezuwenigeschulischeErfolgehaben,sollendurchdiezusätzlicheFörderungpositiveErfahrungenmachen.„WirversucheninkleinenGruppen,vonetwa10Schüler,zuarbeiten,dasistwichtigfüreinpositivesLernklima“,sagtMarkusRies.SeineGruppesolleinOrtsein,andemsiezeigen,wassiekönnen.
Ja, aber. So geht das nicht.DasPublikumapplaudiertvollerRespekt.Dannwirdesunruhig,eswirddiskutiert.MitvielenFragezeichen.Washeißtdasfüruns?Gehtdas?Wiemachendiedas?SchülerderAlbrechtDürerSchulehabenKuchengebacken,Brötchengeschmiert,kochenKaffeeundverkaufenallesandieLehrer. Gestärkt und erfrischt gehen sie in die Arbeitsgruppen im großen Saal, die sich nach Ge-burtsmonatensortieren.DieGruppeMärz/Aprilwandertaus,indenruhigenMusikraum.ChristinaFlehrbittetumeinekurzeVorstellung.InderRundesitzenLehrerinnenundErzieherinnenauszehnEinrichtungen.ManchehabenselbstSchulkinder,zweisindinderElternarbeitaktiv.EinigesindKollegen,abervielesehenunbekannteGesichter.WelcheAnregungennehmensiemit?DasLern-konzeptderHessenwaldschule,vorallemdasbetreuteLernenwirdvielgelobt.AnderebegeistertdasBildungsbuchanderSchloss-Schule.FüreineKita-Erzieherinwaresneu,dassSchulendasLernta-gebuchweiterführen.EinerLehrerinfragt,wieschafftmandasmitsowenigZeitundinsogroßenKlassen?EineanderebringtesaufdenPunkt:„DieVoraussetzungensindso,dassesnichtmöglichwird.“SeufzernundKopfnickenaufvielenPlätzen.„Ja,dasgehtgarnicht.“ChristinaFlehrfasstdieImpulseaufdemFlipchartzusammen.Dannbittetsiealle,auffarbigeZettelzuschreiben,wassiesichwünschenodererhoffen.BlaufürSchule,gelbfürKita,grünfürEltern.Manchefüllenschnellmehrere Zettel aus. Andere lassen ihren leer.
Der Anfang ist gemacht.Die90Minutenwarenzuschnellvorüber.ImgroßenSaalstellenalleArbeitsgruppenkurzihreErgebnissevor.DerMai/Juni-Gruppefielauf,wieunterschiedlichdieBegriffesind.AmGymnasi-umseiderKompetenzbegriffselektivundausgrenzend,inderKitaseierforderndundfördernd.IndergroßenSeptember/Oktobergruppewarenvielebegeistert.EinähnlichesTreffensollteesjedes

15
Jahrgeben.DieTeilnehmermöchtendieErgebnissesehen.GroßerWunsch:BeiallenÜbergängensollKo-KonstruktiondasPrinzipsein,dasKindimMittelpunktstehen.DieNovember/DezemberGruppeergänzt:derPerspektivwechselistwichtig,waskanndasKind.DieLerndokumentationkönntehelfendenBlickzuverändern.LernenimProzess,seifürdieSchulenneu,abereineChance.SichüberBegriffezuverständigenmüsstederAnfangsein.Undwiesollesweitergehen?Biszum28.AprilmüssensichdieEinrichtungenentscheiden,obsieteilnehmenwollen.Esistfreiwillig.DannbeginnendieArbeitsgruppenihreProjektezuentwickeln.„EsisteinProzess,wirentwickelnetwasgemeinsam.ErstinderArbeitmerkenwird,wasgehtinWeiterstadtundwasnicht.Vielleichtkom-menwirauchnochzuganzneuenAnsätzen“,sagtDieterAssel.
Das Momentum von WeiterstadtEsistkurzvor18Uhr.InWeiterstadtistetwaspassiert.EineLehrerin,dieschonlangeinderSchuleist,sagtimRausgehen:„Ichhabesoetwasnochnieerlebt.Normalerweisesitzenwirnurdortundhörenzu.Heutewarallesanders.“VielewerdendiesesGefühlmitnachHausenehmen.Einigewer-den mitmachen. In Weiterstadt wird sich etwas richtig verändern.

Impressum
Deutsche Kinder- und JugendstiftungTempelhofer Ufer 1110963 Berlin
Tel.: (030) 25 76 76 0Fax: (030) 25 76 76 10
Dr. Heike Kahl (Geschäftsführerin)Peter Bleckmann (Bereichsleiter „Bildungspartner vernetzen“)
© Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 2010
weitere Infos:www.lebenswelt-schule.netwww.dkjs.de