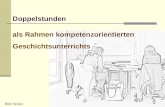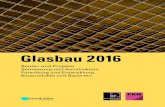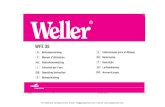1 Doppelstunden als Rahmen kompetenzorientierten Geschichtsunterrichts Bild: Weller.
Rezension: Glasbau-Praxis. Konstruktion und Bemessung. By B. Weller, F. Nicklisch, S. Thieme, T....
-
Upload
jens-schneider -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of Rezension: Glasbau-Praxis. Konstruktion und Bemessung. By B. Weller, F. Nicklisch, S. Thieme, T....

81Stahlbau Spezial 2009 – Konstruktiver Glasbau
Rezensionen
len-Tragwerk und andererseits eben, ge-krümmt/geknickt und doppelt ge-krümmt. Hinsichtlich des Tragverhaltenswerden zug-, druck- und biegebean-spruchte sowie hybride Tragwerke aufihre Eignung bei Glastragwerken unter-sucht. Dieses Kapitel mit seinen ausge-wählten Beispielen zeigt etwas von derSpannbreite der möglichen Anwendun-gen von Glastragwerken und der großentechnischen Intelligenz bei der Umset-zung des Tragverhaltens in Konstruktionund Detailausbildung.
Vor allem müssen an dieser Stelle die12 experimentellen Projekte gewürdigtwerden, die der Verfasser mit studenti-schen Mitarbeitern und Seminargrup-pen entwickelt hat. Mit diesen Beispie-len wird gezeigt, wie die Synthese kon-struktiver, funktionaler undgestalterischer Aspekte in einer kreati-ven Auseinandersetzung mit konkretenRahmenbedingungen einer Planungsauf-gabe gelingen kann. Alle Prototypensind hervorragend gelungene Neuent-wicklungen von Glasstrukturformen alsreine Glastragwerke oder hybride Kon-struktionen mit einer intelligenten Kom-bination von Glas mit anderen Materia-lien. Es ist richtig spannend, sich mitdiesen Projekten im Einzelnen zu befas-sen und zu sehen, mit welchem Könnendiese unterschiedlichen Konstruktionenentworfen, ausgearbeitet und gebautwurden. Die meisten von ihnen wurdenin Vorträgen und auf der „glasstec“ derFachwelt vorgestellt und hatten ein re-ges Echo zur Folge.
Dieses überaus interessante Buch wirddem Leser uneingeschränkt empfohlen.
Prof. Dr.-Ing. Wilfried FührerRWTH Aachen
Weller, B., Nicklisch, F., Thieme, S., Wei-mar, T.: Glasbau-Praxis. Konstruktionund Bemessung. Berlin: Bauwerk Verlag,2009. 264 S. mit zahlr. Abb. und Tab., 17 ×24 cm, ISBN 978-3-89932-190-6. 39,00 €
Glas hat sich im konstruktiven Inge -nieurbau einen festen Platz neben denklassischen Baustoffen Stahl, Stahlbetonund Holz erobert. Berücksichtigt man,dass die Fassaden im Hochbau inzwi-schen oft einen höheren Anteil an denGesamtkosten eines Gebäudes haben
nen aus Glas. Im ersten Hauptkapitel„Gläserne Spannweiten“ führt der Ver-fasser in die Breite des Themas ein. AlleEntwurfs- und Konstruktionsparameterwerden in eigenen Kapiteln ausführlichund anschaulich dargestellt, aber auchin ihrer gegenseitigen Korrelation ge-zeigt. Da das Entwickeln von Struktur-formen auf die Integration von Raum-und Konstruktionsformen hinausläuft,zeigt der Verfasser in einem hilfreichenSchema wie Kapitel 2 und 5 (Raumfor-men) und Kapitel 3 und 4 (Konstruk -tionsformen) auf den Fokus des Bucheszielen. Von dieser Mitte her (Kapitel 6und 7) muss das Buch gelesen werden.
Zunächst werden Raumformen vonGlasdächern besprochen. Danach werdendie mechanischen, konstruktiven, physi-kalischen und gestalterischen Qualitätendes Werkstoffs Flachglas in Abhängigkeitder technischen Bearbeitungen und Ver-edelungsprozesse betrachtet und in Textund Tabellenform übersichtlich darge-stellt. Ein Kapitel befasst sich mit der ma-terialgerechten Konstruktion und der Fü-getechnik. Wegen der Sprödigkeit desGlases stellt das Fügen von Glasbauteilendie zentrale Herausforderung dar. Beson-ders deshalb, weil neben der Tragfähigkeitauch die Resttragfähigkeit im gebroche-nen Zustand sichergestellt sein muss.Platten und Scheiben (im statischenSinne) können an ihren Kanten teilweiseoder umlaufend linienförmig gelagertoder aber an Kanten, Ecken oder in derFläche punktförmig gestützt sein. DieKonsequenzen dieser verschiedenen La-gerungsarten für das Glas und für die Auf-lager werden an dieser Stelle besprochen.
Ein größerer Abschnitt ist der Verbin-dung selbst gewidmet und hier nebenKraft- und Formschluss dem Stoff-schluss, dem Kleben. Die Eigenschaftender Klebstoffe, ihre Anwendungsmög-lichkeiten und die daraus folgendenKonstruktionen werden sehr gut darge-stellt. Ausführlich werden die statischenNachweisverfahren für Tragfähigkeit,Resttragfähigkeit und Gebrauchstaug-lichkeit durch rechnerische Nachweiseoder Versuche erläutert.
Die technischen Nutzungsanforde-rungen an Räume, wie Witterungs-schutz, Tageslichtnutzung, Energiege-winnung, Wärme-, Sonnen- und Hitze-schutz, Belüftung, Brandschutz,Raumakustik sowie Wartung und Reini-gung werden auf die typischen Raumfor-men Glashof, Glasband und Glasmitteangewandt. Mit vielen Beispielen undzugehörigen Abbildungen werden die je-weiligen Aussagen belegt.
Die Entwurf- und Konstruktionsprin-zipien fließen dann im zentralen 6. Kapi-tel in einer Typologie der Glastragwerkezusammen. Die Gliederungen dieser Ma-trix sind einerseits Stab-, Flächen-, Zel-
als das Tragwerk, ist dies kein Wunder.Das vorliegende Buch ist eine Neuauf-lage des in der Fachwelt bereits bekann-ten und schon vergriffenen BuchesGlasbau-Praxis in Beispielen aus demJahr 2005. Inzwischen hat sich derStand der Technik im Glasbau weiter-entwickelt und mit ihm auch das Buch,dessen Seitenanzahl sich nahezu ver-doppelt hat. Einige Grundlagen zumKonstruieren mit Glas wurden ergänztund ein Beispiel geht auch auf diepunktförmig gelagerten Verglasungenein, denn mit den Technischen Regelnfür die Bemessung und Ausführungpunktförmig gelagerter Verglasungen(TRPV) sind für die Standardanwendun-gen von punktförmig gelagerten Vergla-sungen bauaufsichtliche Regelungeneingeführt worden. Außerdem wurde imBuch die Umstellung der Lastnormender DIN 1055er-Reihe berücksichtigt.
Die neue Auflage kann wieder beson-ders für Einsteiger im KonstruktivenGlasbau sehr empfohlen werden. Durchdie klare, logische Struktur, die die wich-tigsten Verglasungen nacheinander an-hand von Beispielen behandelt und dabeiimmer auf die aktuellen Vorschriften imGlasbau eingeht, findet man sehr schnelleinen Zugang zur Materie. Der Verweisauf die jeweiligen Vorschriften in derRandspalte macht das sehr einfach. Unddie warnenden Hinweise auf das „an-dere“, spröde Materialverhalten von Glasund die Wichtigkeit der guten konstrukti-ven Durchbildung fehlen auch nicht.
Gut und wichtig ist auch das Kapitelzu den baurechtlichen Grundlagen, zuZulassungsverfahren und dem Instru-ment der Zustimmung im Einzelfall, so-wie die Integration der Regelwerke imAnhang. Leider sind ja die baurechtli-chen Vorgaben (auch durch die Baure-gelliste) inzwischen so kompliziert ge-worden, dass selbst Eingeweihte nichtimmer durchblicken. Noch ein kleinerVerbesserungsvorschlag für die nächsteAuflage: Bei den eingefügten Beispielenmit Finite-Element-Berechnungen wäreeine farbige Darstellung schön und bes-ser nachvollziehbar. Zudem wird imBuch bei der Bemessung des Glases mitWindlasten nach DIN 1055-4 für denaerodynamische Beiwert cp immercpe,10 verwendet, obwohl noch umstrit-ten ist, ob zwischen cpe,10 und cpe,1 li-near interpoliert werden muss.
Insgesamt ist das Buch eine Berei-cherung für den Glasbau, das weiterdazu beitragen wird, dass der WerkstoffGlas in der Baupraxis innovativ einge-setzt werden kann. Es eignet sich gut fürdie Lehre und sollte in keinem Inge -nieurbüro fehlen.
Prof. Dr.-Ing. Jens SchneiderTechnische Universität Darmstadt
20_075-082_(KG_B_1+Verba?nde).qxd:000-000_(KG_B_1).qxd 17.03.2009 10:43 Uhr Seite 81