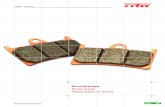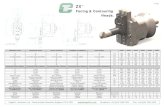Rogers1973b
-
Upload
personzentriert -
Category
Documents
-
view
93 -
download
0
Transcript of Rogers1973b

In diesem Artikel möchte ich die Entwicklung und Veränderung meiner Einstellungen und meines Verhaltens anderen Menschen gegenüber erörtern. Ich werde dabei nicht nur meinen beruflichen W crdegang, sondern auch meinen persönlichen W cg schildern. Lassen Sie mich mit meiner Kindheit beginnen. In einem engen, vom Pietismus geprägten Elternhaus intr�jizierte ich die Werthaltungen meiner
10 Meine Philosophie der
interpersonalen Beziehungen
und ihre Entstehung
Carl R. Rogers
Eltern anderen Menschen gegenüber. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auch wirklich an sie glaubte, ich weiß aber, daß ich nach ihnen handelte. Ich glaube, man kann die Haltung unserer Familie Menschen gegenüber, die nicht zu dieser großen Familie gehörten, etwa so charakterisieren: Sie verhalten sich auf recht zweifelhafte Art und Weise, spielen Karten, gehen ins Kino, rauchen, tanzen, trinken und tun andere unaussprechliche Dinge. Das Beste, was man tun kann, ist, sie zu tolerieren, weil sie es vielleicht nicht besser wissen, sich vor jeder engen Berührung mit ihnen fernzuhalten und ein eigenes Leben innerhalb der Familie zu leben. »Komm von ihnen weg und bleib für dich« ist ein befolgcnswertcs Wort der Bibel. Meiner Erinnerung nach charakterisierte dieses unbewußte arrogante Abseitsstehen mein Verhalten während der ganzen ersten Jahre in der Schule. Ich hatte sicherlich keine engen Freunde. Einige J ungcn und Mädchen meines Alters fuhren zum Beispiel nachmittags auf der Straße hinter unserem Haus Rad. Aber ich hatte keinen Kontakt zu ihnen, ich besuchte sie nicht und sie kamen nie zu uns. Was die Beziehungen zu den Familienmitgliedern angeht, so war ich sehr gern mit meinen jüngeren Brüdern zusammen und spielte auch mit ihnen, war auf den älteren Bruder eifersüchtig und bewunderte meinen ältesten Bruder, obwohl der große Altersunterschied nur wenig Kommunikation erlaubte. Ich wußte, meine Eltern liebten mich, aber es wäre mir niemals in den Sinn gekommen, ihnen persönliche oder private Gedanken oder gar Gefühle mitzuteilen, weil ich wußte, daß diese beurteilt und für mangelhaft befunden worden wären. Meine Gedanken, meine Phantasien und die wenigen Gefühle, deren ich mir bewußt war, behielt ich bei mir. Diese Kinderjahre waren gekennzeichnet durch das völlige Fehlen
185

dessen, was ich heute als enge und kommunikative interpersonale Beziehung mit anderen bezeichnen würde. Meine Haltung anderen gegenüber zeichnete sich durch Distanz und Zurückhaltung aus, eine Haltung, die ich von meinen Eltern übernommen hatte. Ich besuchte sieben Jahre lang die gleiche Grundschule. Später besuchte ich eine Schule nie länger als zwei Jahre, was zweifellos Auswirkungen auf mich hatte. Als ich in die High School eintrat, wurde mir mein Wunsch nach Freunden stärker bewußt. Aber die Einstellungen meiner Eltern und die Umstände machten jede Befriedigung dieses Bedürfnisses unmöglich. Ich besuchte drei verschiedene High Schools und hatte immer lange Schulwege auf mich zu nehmen, so daß ich an keinem Ort wirklich Wurzeln schlagen und nie an außerschulischen oder abendlichen Aktivitäten mit anderen Schülern teilnehmen konnte. Ich achtete und mochte einige meiner Mitschüler, und sicher achteten und mochten auch einige mich - vielleicht zum Teil meiner guten Noten wegen-, aber es blieb nie genügend Zeit, Freundschaften zu cntwikkeln, und ich hatte nie engen persönlichen Kontakt mit irgendeinem von ihnen. Während der ganzen Zeit meiner High-School-Jahre hatte ich nur ein einziges Rendezvous - zu einem Essen einer Oberstufonklasse. Ich hatte also in den so wichtigen Jugendjahren keinen engen Freund und nur oberflächlichen persönlichen Kontakt. Gefühle drückte ich in meinen Englischaufsätzen aus, jedenfalls in den zwei Trimestern, in denen ich einigermaßen verständnisvolle Lehrer hatte. Zu Hause fühlte ich mich meinem nächstjüngercn Bruder verbunden, aber ein Altersunterschied von fünf.Jahren machte eine wirkliche Gemeinsamkeit unmöglich. Ich war ein völliger Außenseiter - ein Zuschauer in allem, was persönliche Beziehungen betraf. Mein intensives wissenschaftliches Interesse am Sammeln und Aufziehen von großen Nachtfaltern war zweifellos Kompensation, Ersatz für das Fehlen enger Bindungen. Es wurde mir zunehmend bewußt, daß ich eigenartig war, ein Einzelgänger, dem es an Gelegenheiten fehlte, Menschen kennenzulernen. Meine sozialen Fertigkeiten waren kaum entwickelt, meine Phantasien in dieser Zeit, so nehme ich an, müssen absonderlich gewesen sein und wären von einem Diagnostiker wahrscheinlich als schizoid klassifiziert worden, aber zum Glück kam ich nie mit einem Psychologen in Berührung. Das College war für mich die erste Unterbrechung dieser Erfahrung der Einsamkeit. Ich ging auf ein landwirtschaftliches College und schloß mich dort sofort einer Gruppe Studenten an, die dem CVJM
186
angehörten. In dieser Gruppe entdeckte ich zum ersten Mal, was es heißt, Kameraden und sogar Freunde zu haben. Da gab es lebhafte, erfreuliche und interessante Diskussionen zu moralischen und ethischen Fragen, auch persönliche Probleme wurden diskutiert. Zwei Jahre bedeutete mir diese Gruppe sehr viel, bis ich mich entschloß, Geschichte zu studieren und auf das College of Letters and Science überwechselte, wo ich den Kontakt mit ihr allmählich verlor. Während dieser Zeit machte ich meine ersten tastenden Versuche in meinem späteren Beruf: Ich leitete eine Gruppe von Jugendlichen, und diese Erfahrung machte mir Spaß. Meine Vorstellung von dem, was zu tun war, war dabei allerdings völlig auf die Aktivitäten begrenzt, denen wir uns widmen konnten - Wandern, Picknicks, Schwimmen und ähnliches. Ich kann mich nicht erinnern, daß wir jemals über ein Thema diskutiert hätten, das die Jungen interessierte. Mit Gleichaltrigen zu kommunizieren, dies schien mir nicht mehr unmöglich, aber ich dachte wohl nie im Traum daran, daß man es auch mit diesen Zwölfjährigen tun könnte. Ich war außerdem Berater in einem Sommerlager für Jugendliche aus sozial schwachen Schichten, mit acht Beratern und hundert Jungen unter meiner Aufsicht. Kirschenpflücken und anschließend Sport, das waren meine Vorstellungen von einem angemessenen Programm. Aus dieser Zeit habe ich meine erste Erinnerung an einen sehr zweifelhaften Versuch, eine »hilfreiche« Beziehung zu schaffen. Aus unserem Heim waren einige Dinge und Geld verschwunden. Alles deutete auf einen bestimmten Jungen hin. So nahmen ein paar Berater und ich ihn beiseite, um von ihm ein Geständnis zu erlangen. Die Bezeichnung »Gehirnwäsche« war damals noch nicht erfunden, aber wir waren Fachleute darin. Wir schmeichelten, argumentierten, versuchten zu überreden, wir waren freundlich und tadelten - manche beteten sogar für ihn, aber er widerstand all unseren Versuchen, sehr zu unserer Enttäuschung. ·wenn ich auf diese peinliche Szene zurückblicke, dann wird mir klar, worin meine Vorstellung von Hilfe damals bestanden haben muß: Man bringt einen Menschen dazu, sein schlechtes Verhalten zu bekennen, auf daß er dann belehrt werden
· kann, welches der rechte Weg sei.In anderer Hinsicht jedoch wurde ich ein sozialeres Wesen. Ich fingan, Verabredungen mit Mädchen zu treffen, voller Ängstlichkeit, aberes war immerhin ein Anfang. Ich stellte fest, daß ich mich älterenMädchen gegenüber freier ausdrücken konnte, daß sie mir wenigerAngst machten. Damals begann auch meine Beziehung zu Helen, diespäter meine Frau wurde, und der allmählich sich entwickelnde
187

Austausch von Hoffnungen, Wünschen und Vorstellungen ließ mich entdecken, daß geheime Vorstellungen und Träume tatsächlich mit einem anderen Menschen geteilt werden können. Dies war eine immer wichtiger werdende Erfahrung für mich. Nach zwei Jahren College wurden Helen und ich voneinander getrennt, aber unsere Beziehung dauerte an, bis wir wiederum zwei Jahre später heirateten. Rückblickend stelle ich fest, daß dies meine erste liebevolle und enge Beziehung war. Sie bedeutete mir die Welt. In den beiden ersten Ehejahren lernten wir eine lebensnotwendige Lektion: Wir lernten, daß jene Elemente einer Beziehung, die zu teilen unmöglich erscheint - die insgeheim störenden und unbefriedigenden Seiten-, sich am ehesten mitzuteilen lohnen. Dies zu lernen war schwer, voller Risiken und Schrecken - und wir haben es viele Male neu lernen müssen. Aber für uns beide war es eine reiche Erfahrung. In der Postgraduicrten-Ausbildung am Union Seminary besuchten wir gemeinsam Kurse, gingen aber auch jeder seine eigenen Wege -Helen betätigte sich stärker auf künstlerischem Gebiet-, bis sie dann durch die Geburt unseres ersten Kindes stärker in Anspruch genomnmen wurde. Obwohl ich mich bei meinen Studien immer mehr von den eher akademisch ausgerichteten Vorlesungen über Religion abwandte, machte ich in der Zeit zwei Erfahrungen, die mir halfen, meine Art der Beziehungen zu anderen besser zu gestalten. Die erste Erfahrung war ein von Studenten organisiertes und geleitetes Seminar. Hier trugen wir gemeinsam die Verantwortung für die ausgesuchten Themen und dafür, wie wir den Kurs durchführen wollten. Wichtiger noch: wir teilten uns unsere Zweifel mit, unsere persönlichen Probleme mit unserer Arbeit, und wurden so zu einer Gruppe, deren Mitglieder einander vertrauten. Die zweite Erfahrung war ein Kurs über »Arbeit mit jungen Leuten«, den Goodwin Watson leitete, der noch heute aktiver NTL-Ausbildcr und Wegbereiter progressiver Ideen im Bildungsbereich ist. In diesem Kurs wurde mir zum ersten Mal klar, daß Arbeit mit Menschen ein Beruf sein könnte. Er zeigte mir einen Weg aus der religiösen Arbeit heraus, und das Ergebnis dieser beiden entscheidenden Erfahrungen war, daß ich (wörtlich) »nach gegenüber« auf das Tcacher's College Columbia überwechselte, wo Goodwin Watson mein Doktorvater wurde. Ich fing an, imBereich klinische Psychologie zu arbeiten. Dort lernte ich durchWilliam Hcard Kilpatrick auch die Gedanken von John Deweykennen.In diesen Jahren hatte ich gelernt, daß Miteinander-Teilen möglichund bereichernd ist, daß in einer engen Beziehung auch die Dinge, die
188
man glaubt, nicht teilen zu können, für das Miteinander von Bedeutung sind. Ich hatte herausgefunden, daß man einer Gruppe zutrauen kann, zu signifikantem und relevantem Lernen zu kommen. Ich fing sogar an zu entdecken, daß auch ein Professor seinem Studenten V crtraucn schenken kann. Ich hatte erkannt, daß man Menschen, die Schwierigkeiten haben, helfen kann, daß es aber widerstreitende Vorstellungen gibt über das Wie. Bei meiner Ausbildung in klinischer Psychologie lernte ich zwei Vorgehensweisen kennen, wie man Menschen, die nach Hilfe suchen, begegnen kann. Am Tcachcr's College wurde der Klient Tests, Messungen, diagnostischen Interviews und Behandlungsvorschriften unterzogen, um so Informationen über ihn zu erhalten. Dieser »kalte« Ansatz wurde jedoch mit Leben gefüllt von Persönlichkeiten wie Leta Hollingworth, die uns durch ihre Person mehr beibrachte als durch ihre Vorlesungen. Als ich dann später an dem damals neuen und wohlhabenden Institute for Child Guidancc eingeschrieben war, war ich einer ganz anderen Atmosphäre ausgesetzt. Dort dominierten die Psychoanalytiker, und der Einzelne und seine Lebensgeschichte standen im Mittelpunkt des Interesses. Dort lernte ich den Patienten mit Hilfe von Fallgeschichten kennen, welche die gesamte Persönlichkeitsdynamik der Großeltern, Eltern, Onkels und Tanten berücksichtigt und schließlich den »Patienten« selbst: mögliches Geburtstrauma, Art der Entwöhnung, Grad der Abhängigkeit, Geschwistcrbczichungcn usw. Daran schließen sich ausgefeilte Tests einschließlich des Rorschach-Tests an und schließlich viele Gespräche mit dem Patienten selbst, ehe über die Art der Behandlung entschieden wird. Das Ergebnis war meistens dasselbe: Handelte es sich zum Beispiel um ein Kind, dann wurde es psychoanalytisch behandelt, die Mutter von einer Sozialarbeiterin betreut und gelegentlich wurde auch der klinische Psychologe herangezogen, um sich mit dem Kind zu befassen. Hier führte ich meinen ersten Therapiefall durch. Aus einer »Betreuung« entwickelten sich in immer stärkeren Maße persönliche Gespräche, und ich entdeckte, wie aufregend es ist, V erändcrungen im Verhalten eines Menschen zu beobachten. Ob diese Veränderungen auf meine Begeisterung oder auf meine Methoden zurückzuführen waren, kann ich nicht sagen. Rückblickend wird mir klar, daß mein Interesse am Gespräch und an der Therapie zum Teil wohl aus meiner früheren Einsamkeit herrührte. Hier gab es einen gesellschaftlich anerkannten Weg, Menschen wirklich nahe zu kommen und vielleicht ein wenig den Hunger nach Kommunikation zu stillen, den ich selbst verspürt hatte. Dieser
189

Weg bot mir die Möglichkeit, engen Kontakt zu Menschen herzustellen, ohne deshalb mich selbst immer wieder in einer engen Beziehung engagieren zu müssen - ein (für mich) langwieriger und oft schmerzhafter Prozeß. Als ich meine Arbeit in New York beendet hatte, Wlfßte ich - mit der Sicherheit eines frisch Ausgebildeten -, wie man mit Menschen professionell umging. Trotz der großen Unterschiede zwischen dem Teacher's College und dem Institute kam ich dank ihrer Hilfe zu etwa folgender Formulierung: »Ich werde eine Riesenmenge Daten über diesen lvlenschen sammeln:seine Lebensgeschichte, seine Intelligenz, seine besonderen Fähigkeiten, seine Persönlichkeit. Aus all diesem Material kann ich eineDiagnose erstellen, ich kann die Ursachen seines augenblicklichenVerhaltens sowie seiner persönlichen und sozialen Ressourcen aufzeigen und eine Prognose für seine Zukunft aufstellen. Ich werde michbemühen, all dies den verantwortlichen Stellen, den Eltern und demKind - sofern es dies versteht - in einfacher Sprache zu erklären.Ich werde vernünftige Vorschläge zur Verhaltensänderung machen,und ich werde die Bemühungen um Veränderung durch häufigenKontakt verstärken. Bei all dem werde ich versuchen, objektiv zu seinund nur dann meine persönlichen Gefühle zu äußern, wenn dies zurHerstellung einer bcfriecligcnclcn Beziehung notwendig ist.«Dies erscheint mir heute ein bißchen unglaublich, aber das wardamals meine Auffassung, denn ich erinnere mich noch gut an dieV crachtung, die ich für einen Psychiater empfand, der nicht Analytiker war und der Problemkinder so behandelte, als ob er sie gern hätte.
Er nahm sie sogar mit nach Hause. Offensichtlich hatte er nie gelernt,wie wichtig es ist, bei allem Mitgefühl Distanz zu wahren. Ich wußtealso nun, was zu tun war, als ich nach Rochcstcr, New York ging alsMitglied eines Chile! Study Dcpartmcnt. Dies war eigentlich eineChile! Guidancc-Klinik für straffällig gewordene Kinder und fürsolche, die wegen ihrer schlechten Familienverhältnisse unter clcrAufsicht sozialer Institutionen standen. Ich war mir meiner Sache sosicher! Und ich erinnere mich (schmerzlich) daran, PTA- undGemeindegruppen gesagt zu haben, unsere Klinik sei mit einer Autowerkstatt zu vergleichen - man kommt mit einem Problem, erhälteine Diagnose von einem Experten und Ratschläge, wie man derSchwierigkeit beikommen könnte.Meine Vorstellungen von Therapie wurden jedoch bald ausgehöhlt.Da ich in einer festen Gemeinschaft lebte, stellte ich fest, daß ich mitden Folgen meiner Ratschläge leben mußte - und sie waren längst
190
nicht immer von Erfolg gekrönt. Viele der Kinder, mit denen ich arbeitete, waren vorübergehend in einem uns benachbarten Erziehungsheim untergebracht, so konnte ich sie Tag für Tag sehen. Zu meinem Erstaunen kam es manchmal vor, daß ein.Junge nach einem besonders »guten« Gespräch, in dem ich ihm alle Ursachen seines Fehlverhaltens erklärt hatte, es am nächsten Tag ablehnte, mich zu sehen. So mußte ich ihn zuerst zurückzugewinnen versuchen, um herauszufinden, was schiefgelaufen war. Allmählich begann ich aus meinen Erfahrungen zu lernen. Als ich dann Direktor des neuen und unabhängigen Rochestcr Guidance Center war, welches das Chile! Stucly Department abgelöst hatte, kamen immer mehr Leute aus eigenem Antrieb zu uns. In diesen Fällen hatten wir keinerlei »Druckmittel«, weder Kindern noch Eltern gegenüber, und mußten daher zunächst eine gute Beziehung aufbauen, wenn wir wirklich helfen wollten. Dann ereigneten sich einige Dinge, die mein Vorgehen merklich änderten. Ich habe das für mich entscheidendste Ereignis schon einmal beschrieben, aber ich will es hier wiederholen. Eine intelligente Mutter brachte ihren äußerst schwierigen Sohn in die Klinik. Ich selbst ermittelte die Fallgeschichte, während ein anderer Psychologe den Jungen testete. Wir kamen beide zu der Überzeugung, daß das Hauptproblem in der ablehnenden Haltung der Mutter ihrem Sohn gegenüber lag. Wir beschlossen, daß ich mit der Mutter dieses Problem bearbeiten, mein Kollege mit dem.Jungen eine Spieltherapie durchführen sollte. In vielen Gesprächen versuchte ich - aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen nun schon viel sanfter und freundlicher- der Mutter zu helfen, Einsicht in ihr Verhalten und die daraus folgenden negativen Auswirkungen auf ihren Jungen zu gewinnen. Alles zwecklos. Nach ungefähr zwölf Gesprächen sagte ich ihr, wir hätten ja nun beide einen Versuch gemacht, ohne jedoch wirklich etwas zu erreichen, und wir sollten das Ganze wahrscheinlich aufgeben. Damit war sie einverstanden. Als sie dabei war, den Raum zu verlassen, drehte sie sich um und fragte: »Beraten Sie hier auch Erwachsene?« Verwirrt antwortete ich, daß dies manchmal der Fall sei. Woraufhin sie zu ihrem Stuhl zurückkehrte, die Geschichte ihrer Schwierigkeiten zwischen ihr und ihrem Mann hervorsprudelte und von ihrem großen Bedürfnis nach Hilfe sprach. Ich war vollständig überwältigt. Was sie mir da erzählte, ähnelte in keiner Weise der glatten Geschichte, die ich ihr entlockt hatte. Ich wußte kaum, was tun, also hörte ich erst einmal zu. Nach vielen weiteren Gesprächen verbesserte sich nicht nur ihre eheliche Beziehung, auch die Probleme
191

ihres Sohües nahmen in dem Maße ab, wie sie selbst freier wurde. Um etwas vorwegzunehmen: Sie war die erste Klientin, die noch jahrelang danach mit mir in Kontakt blieb, solange bis ihr Sohn das College besuchte. Das war für mich eine Erfahrung von größter Bedeutung. Ich war ihr gefolgt, nicht sie mir. Ich hatte einfach zugehört, anstatt sie zu dem diagnostischen Verständnis zu bringen, das ich schon erreicht hatte. Die Beziehung zwischen dieser Frau und mir war zwar weniger »professionell« als persönlich, aber die Ergebnisse sprachen für sich.Etwa um die selbe Zeit fand ein kurzes zweitägiges Seminar mit OttoRank statt, und ich sah, daß er in seiner Therapie (nicht in seinerTheorie) Dinge betonte, die zu erlernen ich gerade angefangen hatte.Ich fühlte mich angeregt und in meiner Arbeit bestätigt. Ich arbeitetemit einer Sozialarbeiterin zusammen, die an der Philadelphia Schoolof $ocial Work in der Rankschen »Beziehungstherapie« ausgebildetworden war, und lernte viel von ihr. Meine Auffassung von Therapieänderte sich so immer mehr. Ich habe dies in meinem Buch ClinicalTreatment of the Problem Child, das 1937-38 entstanden ist, dargelegt,und dort auch der Beziehungstherapie ein langes Kapitel gewidmet.Der Rest des Buches folgt im wesentlichen einem diagnostisch-präskriptiven Ansatz.In Ohio, wohin ich 1940 ging, lehrte ich Post-Graduierte meineAuffassung von klinischer Arbeit, was meine eigene Arbeit wiederumbereicherte. Auch hier wurde mir allmählich bewußt, daß ich offenkundig etwas Neues (und vielleicht sogar Originelles) über Beratungund Psychotherapie sagte, und so schrieb ich Die nicht-direktive Beratung. Mein Traum, therapeutische Gespräche aufzuzeichnen, wurdewahr, und allmählich konzentrierte sich mein Interesse auf die Wirkung von unterschiedlichen Reaktionen im Gespräch. Dies führte zueiner starken Betonung der Technik, der sogenannten »nicht-direktiven Technik«.Ich stellte jedoch fest, daß dieses neu gefundene Vertrauen in meinenKlienten und seine Fähigkeit, seine Probleme selbst zu erforschen undzu lösen, auch weitreichende Auswirkungen auf andere Gebiete hatte.Wenn ich meinen Klienten vertraute, warum vertraute ich dann nichtmeinen Studenten? Wenn dies für einen Menschen mit Problemenbedeutungsvoll war, warum dann nicht für ein ganzes Kollegium? Ichmerkte, daß ich mich nicht auf eine neue Methode eingelassen hatte,sondern auf eine andere Lebens- und Beziehungsphilosophie.Dann erhielt ich die Gelegenheit, an der University of Chicago einneues Beratungszentrum aufzubauen, nach meinen Vorstellungen
192
und mit von mir ausgewählten Mitarbeitern. Ich glaube, ich kann meine Vorstellungen aus dieser Zeit wieder zusammenfassen: Ich habe Vertrauen in die Menschen, in ihre Fähigkeiten, sich und ihre Probleme selbst zu entdecken und zu verstehen, und in ihre Fähigkeiten, diese Probleme auch zu lösen - in einer engen, beständigen Beziehung, in der ich ein Klima echter Wärme und echten Verständnisses schaffen kann, sind Menschen dazu in der Lage. Ich werde es riskieren, die gleiche Art Vertrauen in meine Mitarbeiter zu setzen, und versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der jeder Einzelne für die Handlungen der Gruppe als Ganzes verantwortlich ist und umgekehrt die Gruppe für jeden Einzelnen Verantwortung trägt. Mir wurde Autorität gegeben, ich werde sie ganz der Gruppe übertragen. Ich werde meinen Studenten Vertrauen entgegenbringen, sie sollen ihren eigenen Weg wählen und ihren Fortschritt aufgrund ihrer Wahl selbst bewerten.« In Chicago lernte ich sehr viel, und ich hatte reichlich Gelegenheit, die eben erwähnten Hypothesen zu überprüfen. Die empirische Untersuchung unserer therapeutischen Hypothesen, die schon früher begonnen hatte, wurde fortgesetzt. Bis zum Jahre 195 7 hatte ich eine fundierte Theorie über die Therapie und die therapeutische Beziehung entwickelt. Ich hatte die »notwendigen und hinreichenden Bedingungen für eine therapeutische Persönlichkeitsveränderung« formuliert, im wesentlichen persönliche Einstellungen, keine professionelle Ausbildung. Es war ein ziemlich vermessener Artikel, aber er regte im Laufe der nächsten fünfzehn Jahre zu vielen Forschungsprojekten an, und sie haben im allgemeinen eine Bestätigung meiner Hypothesen gebracht. Es war die Zeit, in der ich auf Drängen meiner Studenten mit S0ren Kierkegard und vor allem mit Martin Buber bekannt wurde (zuerst durch dessen Schriften, dann persönlich). Wiederum fühlte ich mich in meinem neuen Ansatz bestätigt und fand zu meiner Überraschung heraus, daß er der Existenzphilosophie eng verpflichtet war. Schließlich war dies eine Zeit, in der ich für mein persönliches Leben viel gelernt habe. Eine gescheiterte therapeutische Beziehung bewirkte eine tiefe innere Krise und führte mich schließlich zur Therapie bei einem meiner Kollegen. Ich verspürte nun am eigenen Leib, was es heißt, an einem Tag eine Woge neuer Einsichten zu erhalten, um am nächsten Tag in einer Welle der Verzweiflung alles wieder zu verlieren. Ich lernte jedoch allmähiich, nicht nur Klienten, Mitarbeitern und Studenten zu vertrauen, sondern auch mir selbst, all den Gefühlen, Ideen und Wünschen, die in nnr ständig cmporstci-
193

gen. Dies war ein langwieriger und schwieriger, aber entscheidender Prozeß. All diese Erfahrungen übertrugen sich in zunehmenden Maße auf meine Beziehungen zu Gruppen - zuerst auf die Workshops, die wir bereits 194·6 in Chicago durchführten, dann auf all die Gruppen, mit denen ich mich in den vergangenen Jahren so stark befaßt hatte. Es waren alles Encountergruppen, lange bevor diese Bezeichnung geprägt wurde. Ich will noch kurz die Jahre in Wisconsin und La J olla erwähnen. In Wisconsin fiel mir wieder auf, was ich in Chicago schon bemerkt hatte - daß die meisten Psychologen im großen und ganzen neuen Ideengegenüber nicht besonders aufgeschlossen sind. Vielleicht trifft dasauch für mich zu, obwohl ich immer gegen diese Abwehrhaltunggekämpft habe. Die Studenten jedoch waren nach wie vor für Neuesoffen.In Wisconsin machte ich eine bittere Erfahrung. Der großen Forschungsgruppe, welche den Einsatz von Psychotherapie bei Schizophrenen studieren sollte, übertrug ich Autorität und Verantwortung.Ich ging jedoch in dem Versuch, ein Klima für wirklich offeneinterpersonale Kommunikation herzustellen, was hierfür fundamentalist, nicht weit genug. Als es dann zu ernsten Krisen kam, machte ichden noch schlimmeren Fehler, die Autorität, die ich der Gruppeübertragen hatte, wieder selbst zu übernehmen. Rebellion und Chaoswaren verständlicherweise das Ergebnis. Das war eine der schmerzvollsten Lektionen, die ich je gelernt habe - ein Lektion darüber, wieman in einem Unternehmen partizipatives Management nicht handhaben soll.In La Jolla waren meine Erfahrungen glücklicher. Eine GruppeGleichgesinnter baute mit mir das Center for Studies of thc Personauf, ein höchst ungewöhnliches und aufregendes Experiment. Ichwerde versuchen, nur die interpersonalen Aspekte zu beschreiben,denn es wäre unmöglich, auf all die Tätigkeiten einzugehen, die vonden Mitgliedern ausgeübt werden, von Kenia über Rom bis nachIrland, von New Jersey über Colorado bis nach Seattlc, und die vonder Psychotherapie über die Schriftstellerei bis zu irgendwelchenesoterischen Forschungen reichen, von der Beratung von Organisationen bis zur Leitung von Gruppen aller Art und bis zum Anzetteln vonRevolutionen in den Erziehungsmethoden. Wir sind eine engeGemeinschaft, in der sich die Einzelnen gegenseitig unterstützen, abereinander auch offen kritisieren. Obwohl wir einen Direktor haben -er ist für Routineangelegenheiten zuständig -, hat keiner größere
194·
Autorität als die anderen. Jeder kann tun, was er will, allein oder zusammen mit anderen.Jeder ist für seinen eigenen Unterhalt verantwortlich. Im Augenblick erhalten wir nur eine kleine Unterstützung von einer privaten Stiftung. Wir mögen die (anfangs oft unsichtbaren) Fesseln nicht, welche Zuwendungen von großer Höhe von Regierungs- oder sonstiger Seite bedeuten. Uns hält nichts zusammen als das gemeinsame Interesse an der Würde und der Fähigkeit der Personen und die ständige Möglichkeit echter Kommunikation. Für mich ist es ein großartiges Experiment, eine funktionierende Gruppe (im Grunde genommen eine Nicht-Organisation) ausschließlich auf die Stärke intcrpcrsonaler Teilnahme zu gründen. Meine Begeisterung könnte mich jedoch dazu verführen, zu lange davon zu erzählen. Einen anderen wichtigen Einfluß auf meine Arbeit möchte ich aber noch erwähnen. Ich wurde vor Jahren von Lcona Tyler in einem privaten Brief darauf hingewiesen, daß mein Denken und Handeln eine Art Brücke zwischen östlichem und westlichem Denken zu sein scheine. Das war für mich zuerst ein überraschender Gedanke, aber inzwischen stelle ich fest, daß ich in den letzten] ahrcn einige Techniken des Buddhismus, des Zen und ganz besonders die Sprüche des Lao-tsc, des chinesischen Weisen, der vor 2500 J ahrcn gelebt hat, schätzen gelernt habe. Lassen Sie mich einige seiner Gedanken zitieren, die in mir tiefen Widerhall gefunden haben: »Es ist als ob er zuhörteund solches Zuhören wie scins hüllt uns in ein Schweigenin dem wir schließlich zu hören beginnenwas wir eigentlich sein sollen.«Eine Aussage verbindet die Gedanken von zwcien meiner Lieblingsdenker. Martin Bubcr versucht, das taoistische Prinzip des »wu-wei«zu erklären, das in Wirklichkeit das Handeln des ganzen Seins ist,aber so ohne Anstrengung, wenn es ganz und gar wirksam ist, daß esoft bezeichnet wird als ein Prinzip des »Nicht-Handelns«, eine ziemlich irreführende Bezeichnung. Bubcr erklärt dies folgendermaßen:» In das Leben der Dinge eingreifen heißt sie und sich schädigen ...Der sich auferlegt, hat die kleine, offenbare Macht; der sich nichtauferlegt, hat die große, heimliche Macht.... greift der Vollendete nicht in das Leben der Wesen ein, er erlegtihnen nichts auf, sondern er verhilft allen W cscn zu ihrer Freiheit(Lao-tsc): er führt durch seine Einheit auch sie zur Einheit, er machtihr Wesen und ihre Bestimmung frei, er erlöst Tao in ihnen« (1953).Ich vermute, daß meine Bemühungen um Menschen sich zunehmenddarauf gerichtet haben, »ihre Natur und ihr Schicksal« zu befreien.
195

Oder wenn man nach der Definition eines wirksamen Gruppenhelfers sucht, braucht man nur bei Lao-tsc nachzusehen: »Ein Führer ist dann am bestenWenn die Menschen kaum wissen daß er existiertNicht so gut wenn die Menschen ihm gehorchen und ihm zujubelnAm schiech testen wenn sie ihn verachten ...Von einem guten Führer, der wenig redetWenn seine Arbeit getan ist, sein Ziel erreicht istWerden sie alle sagen: Wir haben es selbst getan.«
Mein Lieblingsspruch jedoch, der viele meiner tiefsten Überzeugungen zusammenfaßt und ebenfalls von Lao-tse stammt, lautet folgendermaßen:»Wenn ich Menschen nicht dazwischenfahre, passen sie auf sichselbst auf,Wenn ich Menschen nicht befehle, verhalten sie sich von selbstrichtig.Wenn ich Menschen nicht predige, werden sie von selbst besser,Wenn ich mich Menschen nicht aufdränge, werden sie sie selbst.«
Dies scheint sehr einfach, für mich jedoch enthält es eine Wahrheit,die wir in unserer westlichen Kultur bisher nicht wirklich erkannthaben.
Schluß
Ich glaube, ich habe klar erkennen lassen, daß ich über die Jahre hinweg einen sehr weiten Weg zurückgelegt habe, wenn man bedenkt, von welchen Annahmen ich ausgegangen war: daß der Mensch im Wesen böse ist; daß man ihn, als professioneller Helfer, am besten als Objekt behandelt; daß Hilfe sich auf Fachwissen gründet; daß der Experte den Einzelnen beraten, manipulieren und formen darf: um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Und nun lassen Sie mich noch einmal zusammenfassen, woran ich heute glaube und wonach ich leben möchte. Ich habe V crtraucn in mich selbst, in meine Fähigkeiten und Erfahrungen, in die Gefühle des Ärgers und der Zärtlichkeit, der Scham und des V erletztseins, der Liebe und der Ängstlichkeit, der Großzügigkeit und der Furcht - all dies ist Teil von mir. Ich möchte froh sein über alle meine Gedanken
- törichte, kreative, seltsame, vernünftige, triviale-, alle sind sie einStück von mir. Ich mag meine Impulse - angemessene, verrückte,leistungsorientierte, sexuelle, mörderische. Ich will diese Gefühle,
196
Gedanken und Impulse als Teil meiner selbst akzeptieren, auch wenn ich oft nicht nach ihnen handeln werde. Wenn ich mich ganz akzeptiere, dann wird mein Verhalten angemessener. Nach meiner Erfahrung geschieht Außerordentliches, wenn ein von Glaubwürdigkeit, Achtung und V erstehen geprägtes Klima gcschaf� fcn wird. In einem solchen Klima wird Starrheit zu Beweglichkeit, statisches Beharren zu Entwicklung, Abhängigkeit zu Autonomie, Vorhersagbarkeit zu spontaner Kreativität, Abwehrhaltung zu Selbstannahme und Selbstverwirklichung. Aufgrund dieser meiner Erfahrungen glaube ich, daß Liebe eine Umgebung schaffen kann, in der Menschen, Gruppen und sogar Pflanzen sich entfalten können. Ich habe gelernt, daß es zu einer wirklichen Beziehung gehört, Gefühle auszudrücken. Wenn sie als G�Jiihle ausgedrückt werden, die ich empfinde, mag dies zunächst Bestürzung hervorrulen, ist aber letztlich lohnender als jeglicher V ersuch, sie zu leugnen oder zu verbergen. Ich glaube, daß intcrpersonale Beziehungen sich für mich als eine rhythmische Bewegung darstellen: Offenheit und Ausdruck und danach Angleichung; Fluß und Wandel und danach Ruhe; Risiko und Angst und danach Sicherheit. Ich könnte nicht ständig in einer Encountergruppe leben. Ich brauche die »Erdgebundenheit« wirklicher Erfahrung, ich kann mein Leben nicht in Abstraktionen leben. Folglich ist es für mich lebensnotwendig, enge und gute Beziehungen mit l'vlcnschcn zu haben, mir die Hände mit Erde schmutzig zu machen, das Knospen einer Blume zu beobachten, den Sonnenuntergang zu betrachten. Wenigstens ein Fuß muß auf dem Boden der Wirklichkeit stehen. Mein Leben ist dann am schönsten, wenn ich meine Kraft nach außen richten kann. Ich brauche die Meditation, um mich selbst zu verstehen. Aber dies muß wieder in Tätigkeit münden - in den Umgang mit Menschen, ins Schreiben eines Buches, in eine handwerkliche Arbeit. Schließlich glaube ich, daß die Philosophie der interpersonalen Beziehungen, zu deren Formulierung ich beigetragen habe, in allen Situationen Bedeutung hat. Ich glaube, daß sie sich auf die Therapie anwenden läßt, auf die Ehe, auf das Verhältnis Eltern und Kinder, Lehrer und Schüler, Hoch- und Niedriggcstcllte, auf den Umgang von l'vlcnschen verschiedener Rassen. Ich wage sogar zu behaupten, daß diese Philosphie auch in der Politik im Umgang mit anderen Nationen zu mehr l'vicnschlichkcit beitragen würde und daß
197

sie an die Stelle der Formel »Macht schafll Recht« treten sollte. Dies
ist der Weg zur Selbstzerstörung. Ich stimme mit Martin Buber und den alten orientalischen Weisen überein: »Der sich auferlegt, hat die kleine, ofü:nbare Macht; der sich nicht auferlegt, hat die große, heimliche Macht.«
198