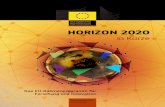Soziale Innovation Forschung und Entwicklung
-
Upload
fachhochschule-nordwestschweiz -
Category
Documents
-
view
288 -
download
1
description
Transcript of Soziale Innovation Forschung und Entwicklung
-
So
zial
e In
nova
tio
n
Fors
chu
ng
un
d E
ntw
ickl
un
g
der
Ho
chsc
hu
le f
r
So
zial
e A
rbei
t FH
NW
201
5
So
zial
e In
nova
tio
n F
ors
chu
ng
un
d E
ntw
ickl
un
g d
er H
och
sch
ule
fr
So
zial
e A
rbei
t FH
NW
201
5
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNWHochschule fr Soziale Arbeit Von Roll-Strasse 10Postadresse: Riggenbachstrasse 164600 OltenThiersteinerallee 574053 Basel
T +41 848 821 011info.sozialearbeit @ fhnw.chwww.fhnw.ch / sozialearbeitwww.facebook.com/FHNWsozialearbeitwww.twitter.com/hsaFHNWblogs.fhnw.ch/sozialearbeit
Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW setzt sich aus folgenden Hochschulen zusammen:
Hochschule fr Angewandte Psychologie FHNW Hochschule fr Architektur, Bau und Geomatik FHNW Hochschule fr Gestaltung und Kunst FHNW Hochschule fr Life Sciences FHNW Musikhochschulen FHNW Pdagogische Hochschule FHNW Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW Hochschule fr Technik FHNW Hochschule fr Wirtschaft FHNW
-
Luzia Truniger und Susanne Bachmann Forschungskompetenzen in der Sozialen Arbeit. Editorial 5
I. Schwerpunkt Evaluations- und Wirkungsforschung
Peter Sommerfeld:Forschung ist auch ein Handwerk Die Entwicklung von Forschungskompetenzen in der Sozialen Arbeit Ein Gesprch 8
Regula Kunz und Daniel Gredig:Handlungskompetenz als Ziel eines Fachhochschulstudiums in Sozialer Arbeit: Und was hat das mit Forschung zu tun? 14
Matthias Httemann und Anne Parpan-Blaser:Kompetenzen zur Gestaltung innovativer Entwicklungsprozesse: Hinweise aus dem Innovationsprogramm INCUMENT 20
II. Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW vom 1.1.2014 bis 31.12.2014
Institut Beratung, Coaching und Sozialmanagement Portrt des Instituts 26 Jeremias Amstutz, Sarah Madrin und Peter Zngl:
Analyse von Stellenangeboten in der Sozialen Arbeit 28 Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Instituts 34
Institut Integration und Partizipation Portrt des Instituts 38 Eva Bschi und Stefania Calabrese: Erwachsene mit schweren, mehrfachen Beeintrchtigungen und herausfordernden Verhaltensweisen
im Wohnbereich (HEVE) 40 Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Instituts 46
Institut Kinder- und Jugendhilfe Portrt des Instituts 56 Olivier Steiner und Rahel Heeg: Peer Education/Peer Tutoring zur Frderung von Medienkompetenzen Jugendlicher:
Evaluation verschiedener Projekte 58 Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Instituts 62
-
Institut Professionsforschung und kooperative Wissensbildung Portrt des Instituts 70 Daniel Oberholzer, Regina Klemenz und Matthias Widmer: Subjekt- und teilhabebezogene Leistungsbemessung in der Behindertenhilfe 72 Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Instituts 78
Institut Soziale Arbeit und Gesundheit Portrt des Instituts 86 Lucy Bayer-Oglesby und Holger Schmid:
Innovative Methoden zur Wirkungsforschung in der stationren Suchttherapie Messung von Vernderungen der Lebensqualitt 88
Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Instituts 94
Institut Sozialplanung und Stadtentwicklung Portrt des Instituts 102 Christoph Mattes und Rebekka Sommer:
Schuldenberatung in Winterthur eine Standortbestimmung des bestehenden Hilfeangebots 104 Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Instituts 110
Studienzentrum Soziale Arbeit Portrt des Instituts 128 Maria del Pilar Gonzalez, Stefan Eugster-Stamm, Regula Kunz, Adi Stmpfli, Eva Tov und Dominik Tschopp:
Schlsselsituationen in der Sozialen Arbeit 130
III. Publikationen der Mitarbeitenden der HSA FHNW vom 1.1.2014 bis 31.12.2014 137
IV. Referenzliste: auftraggebende bzw. finanzierende Institutionen und Projektpartner 155
V. Kontakt und Impressum 160
-
Hochschule fr Soziale Arbeit 4 | 5
Besuchen Sie uns auf der Websitewww.fhnw.ch/sozialearbeit/forschung-und-entwicklungHier finden Sie laufend die aktuellsten Projekte derHochschule fr Soziale Arbeit FHNW und die neuestenPublikationen unserer Mitarbeitenden.
Auf blogs.fhnw.ch/sozialearbeitfinden Sie Blog-Beitrge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW. Prsentiert werden aktuelle Forschungsarbeiten und spannende Themen im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir freuen uns auf einen regen Dialog mit Interessierten: Bringen Sie sich ber die Kommentarfunktion ein!
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser
Die aktuelle Ausgabe der Publikation Soziale Innovation. Forschung und Entwick-lung an der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW widmet sich schwerpunkt- mssig dem Thema Forschungskompetenzen. In drei Beitrgen werden unter-schiedliche Facetten des Verstndnisses und der Bedeutung von Forschung und Entwicklung beleuchtet und die Entwicklung von Forschungskompetenzen im Bachelor- und Master-Studium diskutiert.
Die Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der fhrenden Hochschulen fr Soziale Arbeit im deutschsprachigen Raum entwickelt. Wesentlich dazu beigetragen haben neben der Verankerung und Aner-kennung der Hochschule in der Praxis und der vielfltigen Kooperationsbeziehun-gen mit Praxisorganisationen die breit gefcherte Forschungskompetenz und die daran gekoppelten Fhigkeiten, Fragen aus der Praxis in der Forschung aufzuneh-men und Forschung und Entwicklung mit Ausbildung, Weiterbildung und Dienst-leistung zu verknpfen.
Dem Leistungsbereich Forschung und Entwicklung wird in der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW ein hoher Stellenwert beigemessen. Er ergibt sich nicht nur aus dem Bedarf, die Lehre auf dem neusten Stand zu halten, sondern auch daraus, die Studierenden zu einem gekonnten Umgang mit wissenschaftlichem Wissen zu befhigen und eine offene und kritische, forschende Haltung zu frdern. Daher ist die Verschrnkung von Forschung und Lehre in der Entwicklung der Berufsbefhi-gung der Studierenden zentral. Die Angehrigen der Profession mssen ber kon-krete Wissensbestnde und Kompetenzen verfgen, die ihnen ein angemessenes Verstndnis der zu bearbeitenden Problemlagen wie auch ein fall- und kontext- angemessenes Handeln erlauben. Professionalitt und Professionalisierung sind daher auf Forschung angewiesen.
In der Debatte um die Nutzbarmachung von wissenschaftlichem Wissen fr die Praxis wird der Kooperation von Forschenden und Professionellen in der Praxis eine Schlsselrolle zugesprochen. Angehrige der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW kooperieren denn auch mit Professionellen der Praxis, was der Weiterent-wicklung und Frderung der Innovation von problemangemessenen und effektiven Handlungsanstzen, Methoden und Interventionen unter sich wandelnden Rah-menbedingungen dient. Die Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW hat mit ihrem Schwerpunkt Soziale Innovation einen eigenen, weithin anerkannten Ansatz der Vermittlung von Wissenschaft und Praxis entwickelt und Mitarbeitende der Hoch-schule haben wegweisende Beitrge fr die Gestaltung solcher Kooperationsver-hltnisse formuliert.
Auch auf konomischer Ebene konnte sich die Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW erfolgreich positionieren, das eingeworbene Ertragsvolumen eindrcklich steigern sowie eine breit abgesttzte Zusammensetzung der Auftraggebenden, der Finan-zierungs- und Forschungsfrdergremien in ihren Projekten sichern. Im schwei- zerischen Vergleich der Hochschulen fr Soziale Arbeit erzielte sie gemss SBFI-Analyse 2013 den Hchstwert an akquirierten Drittmitteln in Forschung und Entwicklung (SBFI 2013).
Forschungskompetenzen in der Sozialen ArbeitEditorialLuzia Truniger und Susanne Bachmann
Prof. Dr. Luzia TrunigerDirektorin
Dr. Susanne BachmannWissenschaftliche Mitarbeiterin Forschung und Entwicklung, Hochschulzentrum
-
Hochschule fr Soziale Arbeit
Forschungskompetenzen in der Sozialen ArbeitEditorial
Peter Sommerfeld beschreibt im Interview, welche Kompetenzen notwendig sind, um als Professionelle der Sozialen Arbeit anwendungsorientiert forschen zu kn-nen und was zum Erfolg von Forschung und Entwicklung an der Hochschule bei-trgt. Er geht dabei besonders auf die Frage ein, was fr die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis wesentlich ist.
Regula Kuhn und Daniel Gredig legen dar, weshalb es von Bedeutung ist, dass sich die Studierenden sowohl im Bachelor- als auch im Master-Studium mit For-schung auseinandersetzen und welche Kompetenzen auf den jeweiligen Studien-stufen erworben werden. Schliesslich diskutieren sie den Anspruch der Hochschu-le, Wissenschaft und Praxis zu verknpfen und errtern, wie es gelingt, die Nhe zur Forschungspraxis und auch die Nhe zum sozialarbeiterischen Handeln in den Organisationen der Sozialen Arbeit umzusetzen.
Matthias Httemann und Anne Parpan-Blaser stellen in ihrem Beitrag das Innovationsprogramm INCUMENT INCUbate social developMENT vor und le-gen dar, welche Kompetenzen ntig sind, um Kooperationen von Hochschule und Praxisorganisationen so zu gestalten, dass innovative Entwicklungen mglich sind. INCUMENT ist eines der gefrderten Projekte im Rahmen des Programms BREF
Brckenschlge mit Erfolg der Gebert Rf Stiftung und swissuniversities, wel-ches explizit auf neuartige Lsungen fr gesellschaftliche Herausforderungen und modellhafte Kooperationen mit Praxispartnern aus Wirtschaft und Gesellschaft fokussiert.
Der zweite Teil des Berichtes informiert ber die aktuellen Forschungs- und Ent-wicklungsarbeiten der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW. Die Institute und das Studienzentrum Soziale Arbeit stellen sich in Portrts vor und geben einen Einblick in ihre laufenden Projekte. Ein Verzeichnis der Publikationen der Mitar-beitenden der Hochschule sowie eine Liste der Projektpartnerschaften und Auf-traggebenden beschliessen das Heft.
Alle Forschungs- und Entwicklungsprojekte sind mit einer URL versehen, ber die Sie Projektberichte im Internet abrufen knnen. Aktuelle Informationen ber die Projekte und Publikationen finden Sie berdies auf unserer Website www.fhnw.ch/sozialearbeit/forschung-und-entwicklung. Und auf www.blogs.fhnw.ch/sozialear-beit knnen Sie Blog-Beitrge von Angehrigen der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW lesen.
Wir wnschen Ihnen eine anregende Lektre.
Luzia Truniger Susanne BachmannDirektorin Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschung und Entwicklung, Hochschulzentrum
6 | 7
I.Schwerpunkt Evaluations- und Wirkungsforschung
-
Hochschule fr Soziale Arbeit I. Schwerpunkt Evaluations- und Wirkungsforschung 8 | 9
Peter Sommerfeld ist Dozent am Institut Soziale Arbeit und Gesundheit der Hoch-schule fr Soziale Arbeit FHNW. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem die Professionalisierung der Sozialen Arbeit und die forschungsbasierte Praxisent-wicklung.
Peter Sommerfeld, was braucht es fr Kompetenzen, um in der Sozialen Arbeit ge-sellschaftliche Problemstellungen zu untersuchen und Lsungsvorschlge fr so-ziale Problemlagen zu erarbeiten?Das Forschungsverstndnis der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW ist vorrangig anwendungsorientiert. Das heisst, es umfasst sowohl Grundlagenwissen als auch praktisches Wissen oder Anwendungswissen oder technologisches Wissen, wie auch immer man das nennen will.
Das heisst nichts anderes, als dass das gesamte Spektrum wissenschaftlichen Wis-sens hier eine Rolle spielt. Die Soziale Arbeit als transdisziplinre Handlungswis-senschaft hat mit all den verschiedenen Wissenssorten zu tun, die man in der Wissenschaftstheorie ausformulieren kann.
Eine so verstandene Forschung braucht Forschende, die fhig sind, sich in so ei-nem breiten Feld wie dem der Sozialen Arbeit und damit in einem weiten Ein-zugsgebiet von potenziell relevanten Wissensbestnden orientieren und innova-tive Forschungsfragen entwickeln zu knnen. Weiter mssen sie die Bandbreite sozialwissenschaftlicher Methoden beherrschen, um die Forschungsfragen bear-beiten zu knnen und mit den Ergebnissen Rekombinationen zu schaffen, die wie-derum an den Forschungsstand in der Sozialen Arbeit anschlussfhig sind.
Das ist also sehr voraussetzungsvoll?Es macht einen Teil dieser Paradoxie der Sozialen Arbeit aus, dass sie einerseits eine sehr junge Disziplin ist von der wohl die wenigsten denken, dass das ber-haupt eine Wissenschaft ist oder eine braucht und andererseits ist sie eine sehr anspruchsvolle Disziplin. Insofern braucht es Forschende, die ber hohe und spe-zifische Kompetenzen verfgen. Forschende, die koordinieren, zusammenhalten, vernetzen und, wenn man so will, den Diskurs anleiten knnen im Sinne dieser Disziplin der Sozialen Arbeit. Das heisst wiederum, dass sehr viele Ressourcen bentigt werden, wenn man in diesem Feld wirklich ernsthaft etwas bewegen will. Auf der anderen Seite gibt es natrlich viele Optionen in einem so breiten Feld. Und das bedeutet: Es gibt viele Chancen, viele offene Fragen, viele Mglichkeiten, auch die eigene Kompetenz zur Entfaltung zu bringen und sich darin zu entwickeln. Zu-gleich besteht die Gefahr, sich zu verzetteln. Insofern sind unbedingt thematische Fokussierungen notwendig. Dies sind dann auch strategische Entscheidungen, was man bearbeiten mchte und was nicht.
Die Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW ist eine der fhrenden Hochschulen fr Soziale Arbeit und Referenz fr Soziale Innovation. Wie ist das angesichts dieser hohen Anforderungen an die Kompetenzen der Forschenden gelungen? Ein Aspekt des Erfolges der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW ist, dass wir es von Anfang an geschafft haben, sehr kompetente Forschende ins Boot zu holen. Einerseits hatten wir das Glck, dass der Arbeitsmarkt der Sozialwissenschaften in der Schweiz sehr viele gute junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Herkunftsdisziplinen, und auch aus der Sozialen Arbeit, zur Verf-
Forschung ist auch ein Handwerk Die Entwicklung von Forschungskompetenzen in der Sozialen ArbeitEin Gesprch mit Prof. Dr. Peter SommerfeldSusanne Bachmann (Mitarbeit: Judith Sibold)
gung gestellt hat. Andererseits ist die Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW fr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem Ausland attraktiv, hier vor al-lem Personen, die aus der Sozialen Arbeit kommen. Das hat mit den Arbeitsbedin-gungen und der Reputation zu tun, die in dieser Hochschule aufgebaut wurden. Es ist uns offensichtlich gut gelungen, diese Nachwuchsforschenden in die Soziale Arbeit und in die dynamische Entwicklung dieses Faches in der Schweiz einzubin-den. Viele davon begreifen sich nach wie vor als Soziologinnen oder Psychologen. Mit der ganzen Struktur dieser Hochschule und der Ausrichtung der Sozialen Ar-beit als Wissenschaft und mit einer gengend grossen Zahl von Mitarbeitenden aus der Sozialen Arbeit wurde aber erreicht, dies in einen produktiven Zusammen-hang mit der Sozialen Arbeit zu bringen.
Wie kann man diese Kompetenzen aufrechterhalten und weiterentwickeln? Das hngt primr davon ab, wie weit man Forschungsprojekte durchfhren kann. In der Forschung ist learning by doing mindestens so wichtig wie bei einem Hand-werk. Forschung ist eben auch ein Handwerk!
Dies gilt sowohl fr diejenigen, die Projekte konzipieren und leiten, als auch fr diejenigen, die in Projekten mit so guten Forschenden zusammenarbeiten. Wie beim Handwerk ist in der Forschung das Meister-Lehrlings- oder -Schlerin-nen-Verhltnis entscheidend. Wenn man das erreicht, wirkt es wie eine Multiplika-tion. Wenn man also in einem Forschungsprojekt beispielsweise zu viert arbeitet eine hufige Grsse von Projekten bei uns , und eine Person davon weist grosse Forschungserfahrung und -kompetenz auf, dann multipliziert sich das mal drei. So werden Forschungskompetenzen gebildet und entwickelt.
Wie kann man erreichen, dass die ntigen Kompetenzen an der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW in der Ausbildung entwickelt werden? In der Grundausbildung im Bachelor-Studium lernt niemand die Kompetenzen, die wirklich zum Forschen notwendig sind. Trotzdem ist es wichtig, dass die Bache-lor-Studierenden diesen ersten Einblick erhalten. Ein erstes Gespr dafr zu be-kommen, was es heisst zu forschen, ist eine wichtige Voraussetzung. Das Mas-ter-Studium, so wie es an der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW konzipiert ist, gibt den Studierenden sehr viele Mglichkeiten, Kompetenzen im Hinblick auf For-schung zu erwerben. Und da kann man die talentierten Studierenden auf ein Niveau bringen, sodass sie spter in Projekten an der Hochschule arbeiten knnen.
Viele unserer ehemaligen Master-Studierenden arbeiten tatschlich an der Hoch-schule fr Soziale Arbeit FHNW als Assistenz in Forschungsprojekten. Das heisst, wir bilden zu einem Teil wenigstens unseren eigenen Nachwuchs aus. Das ist unglaublich wertvoll. Von denjenigen, die ich persnlich begleitet habe, kann ich sagen, dass sie sich prchtig entwickelt haben. Etliche davon schreiben eine Dis-sertation. Mindestens die zwei, die ich ein wenig nher beobachten kann, brauchen keinen Vergleich mit Absolvierenden von der Universitt zu scheuen.
Du hast eben Forschungsprojekte angesprochen, die zentral sind, um Forschungs-kompetenzen weiterzuentwickeln. Denkst du da an bestimmte Projekte, bei denen das besonders sichtbar wird? Nein, das bezieht sich nicht auf bestimmte Projekte, sondern es geht darum, ber-haupt Forschungsprojekte realisieren zu knnen. Die Fhigkeit zu forschen wird
Prof. Dr. Peter SommerfeldDozent
-
Hochschule fr Soziale Arbeit I. Schwerpunkt Evaluations- und Wirkungsforschung 10 | 11
Forschung ist auch ein Handwerk Die Entwicklung von Forschungskompetenzen in der Sozialen ArbeitEin Gesprch mit Prof. Dr. Peter Sommerfeld
besser, je fter man das macht. Das gilt fr die quantitativen wie auch fr die qua-litativen Methoden. Das erfordert Praxis. Egal, ob es darum geht, vorwiegend mit einer einzelnen Methode zu arbeiten und diese voranzutreiben, oder ob es darum geht wie ich das mache unterschiedliche Methoden in verschiedenen Projekten anzuwenden.
An der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW gibt es Projekte, die extrem anspruchs-volle methodische Designs verfolgen. Diese Kompetenz muss ber lange Zeit auf-gebaut werden. In anderen Projekten wird das Forschungsdesign mit verschiede-nen Beteiligten zusammen entwickelt. Das ist ein weiterer Aspekt: Wenn eine Hochschule ber viele einzelne hoch kompetente Forschende verfgt, knnen diese einzelnen Forschenden ihre unterschiedlichen Kompetenzen zusammenbringen. Hier hat die Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW mittlerweile, allein schon auf-grund ihrer Grsse, wie man so schn sagt, eine kritische Masse erreicht. An dieser internen Vernetzung kann man aber grundstzlich immer noch weiterarbeiten, das ist nie perfekt, unter anderem weil Forschende auch Individualisten sind.
Insofern wrde ich mir zuweilen wnschen, dass es mehr Ressourcen gibt, um ber Institutsgrenzen und thematische Schwerpunkte hinweg arbeiten zu knnen. Denn das braucht Mittel. Gleichzeitig sind die thematischen Fokussierungen in den Instituten natrlich auch wichtig. Die Soziale Arbeit quasi unstrukturiert zu beforschen hiesse, sich darin zu verlieren. Die Institute der Hochschule ermg- lichen einen bestimmten Blick und eine Bndelung von Forschenden um The-menschwerpunkte.
Welche Rolle spielt der Austausch mit der Praxis betreffend der Forschungskom-petenzen?Wenn man mit der Praxis zusammenarbeitet, dann braucht es zustzliche und andere Kompetenzen als die eigentlichen Forschungskompetenzen. Nmlich vor-wiegend sozialarbeiterische oder soziale Kompetenzen: Kompetenzen des Bezie-hungsaufbaus, der Kommunikation, des Schaffens einer vertrauensvollen Arbeits-atmosphre, eines Arbeitsbndnisses, wenn man so will. Das sind die Kompetenzen, die man braucht, wenn man direkt mit der Praxis arbeitet.
Das Projekt Wisskoop, das du leitest, beschftigt sich intensiv mit der Frage, wie Wissenschaft und Praxis in der Sozialen Arbeit miteinander kooperieren (zum Pro-jekt siehe Kasten). Welche Erkenntnisse in Bezug auf Forschungskompetenzen konntet ihr bisher gewinnen?
Im Projekt untersuchen wir, wie die Kooperation zwischen Wissenschaft und Pra-xis tatschlich erfolgt. Eines der Hauptergebnisse ist, dass in Kooperationsprojek-ten letztlich oft nicht wirklich Forschung betrieben wird. Sondern in der Regel sind das Entwicklungsprojekte. Oft auch in Form eines Transfers von frheren For-schungsergebnissen in die Praxis. Das beinhaltet oftmals, dass Hochschulen ge-meinsam mit Praxispartnern versuchen, Forschungserkenntnisse in eine fr die Praxis praktikable Form zu bersetzen.
Tatschliche Forschung mit dem Ziel, neue Erkenntnisse zu generieren, ist eher die Ausnahme. Daher ist die Antwort auf die Frage nach den Kompetenzen eigentlich eine offene Frage. Es gibt Kooperationsprojekte in unserem Sample, die eher klas-
sische Forschungsprojekte sind und die Kooperation eher aufgesetzt ist. Dies ver-langt klassische Forschungskompetenzen. Transfer- oder Entwicklungsprojekte bentigen hingegen vorrangig Kompetenzen fr Organisationsentwicklung, Bera-tung oder Coaching.
Die Frage, die sich stellt, ist: Welche Methoden wren geeig-net, wenn Forschung tatschlich kooperativ stattfinden wr-de? Dadurch, dass wir nur sehr wenige Anhaltspunkte haben und wenige Projekte, in denen das berhaupt stattfindet, knnen wir die Frage eigentlich nicht beantworten. Sondern wir mssen an der Stelle fragen: Wie knnen wir Forschungs-methoden so nutzen, um Erkenntnisse in die professionelle Praxis einzuspeisen? Was heisst das, wenn dabei wissen-schaftliche Gtekriterien herangezogen werden? An der Stel-le stehen mehr offene Fragen als Antworten, die wir darauf geben knnen.
Zusammengefasst wrde ich sagen, bezglich Kooperation mit der Praxis spielen Forschungskompetenzen aus meiner Sicht eher eine untergeordnete Rolle. Denn Kooperationspro-jekte stehen und fallen vor allem mit der Beziehungsebene. Und erst wenn dies funktioniert, knnen Forschungskompetenzen richtig zur Geltung gebracht werden.
Was heisst das fr die Kooperationsprojekte an der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW? Es ist wichtig, den Begriff Forschung und Entwicklung ernst zu nehmen. For-schen und Entwickeln sind nicht dasselbe. Diese Differenz dieser beiden in einen Begriff zusammengefhrten Begriffe ist wichtig, auch wenn beides zusammen-hngt. Hier braucht es noch weitere berlegungen und Erfahrungen, wie aus Ent-wicklungsarbeit dann wieder Erkenntnisse generiert werden knnen. Das ist indi-rekt noch einmal eine Antwort auf die vorige Frage. Vermutlich sind noch Methoden zu entwickeln, wie neue Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Standards standhal-ten, aus kooperativen Entwicklungsprojekten gewonnen werden knnen.
Der klassische Ansatz ist: Jemand entwickelt etwas, und jemand anders beforscht das. Faktisch aber verschwimmen die Grenzen zwischen Wissenschaft und Praxis in kooperativen Entwicklungsprojekten. Das macht es dann aber auch so schwierig, das was darin gewonnen wurde wieder als wissenschaftliche Erkenntnis darstell-bar zu machen.
Der Praxis-Optimierungs-Zyklus (POZ) ist ein an der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW entwickeltes Konzept. Es zielt darauf, bei der Entwicklung und Untersu-chung von Verfahren und Anstzen der Sozialen Arbeit sowohl wissenschaftliches und praktisches Wissen einzubeziehen. Was heisst das konkret fr den Forschungs-prozess?Mit dem POZ haben wir versucht, kooperative Wissensbildung zu operationalisie-ren und haben dafr ein zirkulres Ablaufschema entworfen. Der POZ ist eigentlich ein einfaches Modell, das darstellt, wie Forschung in den Zyklus integriert werden kann, in dem sich die Praxis sowieso befindet, nmlich sozusagen zwischen Routi-ne und Innovation. Soll in der Praxis etwas entwickelt werden, knnen Forschungs-
Wissensproduktion durch Kooperation? Zur Kooperation von Forschung und Praxis in der Sozialen Arbeit (Wisskoop) Das Projekt Wisskoop beschftigt sich mit der Frage, ob sich Formen der Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis, wie sie professions- und wissenschaftstheore-tisch fr die angewandten Sozialwissenschaften begrn-det werden knnen, auch in der Sozialen Arbeit etab- lieren und bewhren und welche Formen diese Koopera-tionen empirisch annehmen. Das von Peter Sommerfeld geleitete Projekt, das einen wichtigen Beitrag zur Weiter-entwicklung der Sozialen Arbeit leistet, luft von 2011 bis 2015.
-
Hochschule fr Soziale Arbeit 12 | 13
ergebnisse einfliessen. In diesem Moment, so ist es im POZ formuliert, verndert sich der Modus. Das ist nicht mehr der Forschungsmodus, sondern ein Modus der Innovation oder des Entwickelns und Ausprobierens. Und das, was dabei entsteht, wird wiederum in einer separaten Forschung evaluiert. So ist der POZ aufgebaut.
Das, was in diesem anderen Modus passiert, ist eben Entwicklung. So ist im POZ Forschung und Entwicklung modellhaft etappiert. In unseren Untersuchungen konkreter Projekte zeigt sich, dass das viele auch tatschlich so oder so hnlich durchfhren. Dass es also zunchst eine Forschung gab, und dann werden Praxis und Wissenschaft miteinander zu kombinieren versucht.
Hier stellt sich die Methodenfrage, wie gesagt, sehr stark: Wie kann man diese Verknpfung unterschiedlicher Wissenssorte also von praktischem und wissen-schaftlichem Wissen methodisch angehen? Wie kann man die Ergebnisse sowohl in der Praxis als auch im wissenschaftlichen Kontext sichern? Das sind spannende und sehr schwierige Fragen.
Zurck zu den Forschungskompetenzen: Was trgt neben kompetenten Forschenden,Projekterfahrung und thematischer Fokussierung zum Erfolg von Forschung bei?Ein wesentlicher Faktor ist, dass die Institutsleitenden selbst Forschende sind und daher auch wissen, was das heisst. Und daher dafr Ressourcen zur Verfgung stellen. Das ist zentral.
Ausserdem ist es entscheidend, dass Forschende die Mglichkeit haben, ihre For-schung in Form von Publikationen verwerten zu knnen. Darin misst sich der wis-senschaftliche Wert unserer Arbeit. Damit haben wir die Reputation aufgebaut, die uns auf dem Arbeitsmarkt und bei Projektantrgen zugute kommt. Das ist ein wesentlicher Faktor, warum die Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW als Fach-hochschule also als ein Ort, an dem Wissenschaft und professionelle Berufsbil-dung verwoben werden so erfolgreich ist, und zwar nicht nur im Vergleich zu anderen Fachhochschulen in der Schweiz: Da muss man im gesamten deutschspra-chigen Raum lange suchen, um eine Institution zu finden, die in den vergangenen Jahrzehnten auch nur annhernd eine solche Forschungsleistung erbracht hat.
Wie gesagt: Mit Publikationen ist auch Reputationsaufbau verbunden. Und das ist wiederum eine wichtige Bedingung fr Forschung: Whrend auf der einen Seite die Praxis der Forschung wichtig ist fr den Kompetenzaufbau, braucht es auf der anderen Seite ebenfalls gengend reputierte Leute, die Erfolg haben, wenn es dar-um geht, Drittmittel zu generieren. Und dieser Reputationsaufbau ist nur mglich ber Publikationen und insofern eben akademische Karrieren, zu denen auch die Promotion gehrt.
Problematisch scheint mir, dass die Trgerbeitrge eigentlich nicht reichen, um diese grundlegenden Pfeiler des wissenschaftlichen Arbeitens finanzieren zu kn-nen. Zwischen den drei Polen Ressourcen, Themen und Kompetenzen gibt es einen engen Zusammenhang. Kompensiert wird dieser Mangel durch das Engagement der Mitarbeitenden, die bereit sind, immer schon das nchste Projekt anzufangen, bevor das letzte abgeschlossen ist, oder gleich schon in mehreren Projekten paral-lel zu arbeiten.
Forschung ist auch ein Handwerk Die Entwicklung von Forschungskompetenzen in der Sozialen ArbeitEin Gesprch mit Prof. Dr. Peter Sommerfeld
-
Hochschule fr Soziale Arbeit I. Schwerpunkt Evaluations- und Wirkungsforschung 14 | 15
Die Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW bietet ein Bachelor- und Master-Studium in Sozialer Arbeit an. Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiums entwickeln in ihrem Studium eine generalistische Berufsbefhigung, die sie fr die selbststndige und verantwortliche professionelle Ttigkeit in den Berufsfeldern der Sozialarbeit und Sozialpdagogik qualifiziert. Das darauf aufbauende Mas-ter-Studium befhigt die Absolventinnen und Absolventen ebenfalls generalis-tisch zur Wahrnehmung anspruchsvoller konzeptioneller Aufgaben und dabei insbesondere zur Evaluation und innovativen Weiterentwicklung von Herange-hensweisen, Verfahren und Angeboten Sozialer Arbeit. Im Herbstsemester 2014/ 2015 befanden sich 1198 Studierende im Bachelor-Studium und 81 Studierende im Master-Studium.
Ein Blick ins Curriculum der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW zeigt, dass sich die Studierenden beider Studienstufen mit Forschung auseinandersetzen. Ange-sichts des Ziels, knftige Professionelle fr die praktische Soziale Arbeit auszubil-den, mag dies vielleicht erstaunen. Wir fragen deshalb bei den Leitenden der bei-den Studienstufen nach.
Das Kompetenzprofil des Bachelor- und Master-Studiums in Sozialer Arbeit besagt, dass im Studium drei Typen von Kompetenzen entwickelt werden sollen. Zum einen die Fach- und Methodenkompetenzen, zum anderen die Sozialkompetenzen und schliesslich auch Selbstkompetenzen. Unter den Fach- und Methodenkompe-tenzen findet sich unter anderem die Kompetenz zu forschen. Wofr brauchen Sozialarbeitende berhaupt Forschungskompetenzen?
Regula Kunz, Leiterin Bachelor-Studium: Professionelle der Sozialen Arbeit greifen in der Arbeit mit ihren Klientinnen und Klienten (womit einzelne Personen, aber auch Familien, Gruppen oder Gemeinwesen gemeint sind) wie auch bei der Wahr-nehmung von konzeptionellen Aufgaben und in der Angebotsentwicklung mehr-fach auf wissenschaftliches Wissen zurck, auf Theorie wie auch empirische For-schungsergebnisse.
Das Studium bereitet die Absolventinnen und Absolventen darauf vor, Beratungs- und Untersttzungsprozesse problem-, personen- und kontextangemessen zu ge-stalten und ihre Analysen wie auch ihr Handeln fundieren und begrnden zu kn-nen. Daher stehen im Studium insbesondere die Entwicklung von Kompetenzen zur Analyse von sozialen Problemen, zur Rekonstruktion individueller Problemlagen wie auch zur methodischen Bearbeitung der Probleme ihrer Klientinnen und Klien-ten im Vordergrund.
Professionelle Soziale Arbeit setzt also voraus, dass die Fachkrfte ber die Kom-petenz verfgen, sich wissenschaftliche Diskurse zu erschliessen und zu verstehen, Forschung nachzuvollziehen und ihre Ergebnisse kritisch zu bewerten, um diese schliesslich fr das Verstndnis des einzelnen Falls, fr die Begrndung ihres Han-delns und fr die Weiterentwicklung ihres Angebots heranzuziehen. Sie mssen Studien finden, lesen, verstehen, bewerten und sich zunutze machen knnen. Des-halb mssen Studierende Kompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens erwerben und auch von forschungsmethodischen Belangen so viel verstehen, dass sie For-schungsergebnisse fr ihre praktische Arbeit nutzbar machen knnen. Sie mssen
ihren Fall interpretieren und ihr Vorgehen angemessen begrnden knnen. Ebenso dient dieses Wissen als Referenzrahmen fr eine Reflexion. Nur erfahrungsbasiert auswerten und weiterentwickeln entspricht nicht dem Anspruch einer Profession.
Daniel Gredig, Leiter Master-Studium: Das Master-Studium bietet auf den Kompe-tenzen des Bachelor-Studiums aufbauend die Mglichkeit, eine erweiterte Profes-sionskompetenz zu erwerben und die in diesem Zusammenhang notwendigen for-schungsbezogenen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Das Master-Studium an der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW bereitet die Studierenden beispielsweise auf die wissenschaftsbasierte Weiterentwicklung der professionellen Verfahren, Ange-bote und Programme vor, indem es Kompetenzen zur Evaluation, zur forschungs-basierten (Weiter-)Entwicklung von Angeboten wie auch zur Gestaltung und Fh-rung von Innovationsprozessen frdert. Die Studierenden werden auf Master-Stufe so in die Lage versetzt, die professionelle Praxis auf ihre Effektivitt hin zu be-trachten, das Vorgehen der Praxis auf sich verndernde Herausforderungen hin anzupassen und auch Antworten auf neu auftauchende Problemstellungen zu for-mulieren und zu erproben. Hierzu mssen die Studierenden nicht nur Kompeten-zen fr die Gestaltung und Leitung von Entwicklungsprozessen aufbauen. Sie ms-sen auch in der Lage sein, Forschungsergebnisse kritisch zu beurteilen und in Prozesse der Konzeptentwicklung einfliessen zu lassen. Und in diesem Rahmen mssen sie auch ber die Kompetenzen verfgen, die es ihnen erlauben, selbst neue Erkenntnisse hervorzubringen. Sie sollten z.B. in der Lage sein, Vorgehen, Pro-jekte und Programme in der Praxis zu evaluieren und die Ergebnisse unterschied-lichen Stakeholdern gegenber in geeigneter Weise zu prsentieren.
Was tut die Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW, um Forschungskompetenzen bei den Studierenden aufzubauen: Welche Angebote gibt es dafr konkret?
Regula Kunz: Im Bachelor-Studium werden die Grundlagen gelegt, um wissen-schaftlich arbeiten zu knnen. Dies geschieht in zwei Modulen. Im einen werden die Studierenden allgemein in die Wissenschaft eingefhrt. Sie lernen zu verstehen, was Theorien sind, wie Erkenntnisse berhaupt entstehen, wie Fragestellungen aus dem aktuellen Fachdiskurs hergeleitet und formuliert werden. Zudem erlernen sie die Literaturrecherche in Bibliotheken, Datenbanken und Fachzeitschriften.
Das andere Modul fokussiert auf Forschungsmethoden. Dazu werden die Studie-renden in die Grundstze von qualitativer wie quantitativer Forschung eingefhrt. Sie entdecken die Schritte des empirischen Verfahrens in kleinen projektartigen Aufgaben. Ziel ist, Ergebnisse aus der Forschung und den dahinter liegenden For-schungsprozess verstehen zu knnen, um diese auf die eigene sptere Praxis hin deuten und nutzen zu knnen.
In der fallbasierten Theoriearbeit im zweiten Semester und in der Bachelor Thesis am Ende des Studiums zeigen die Studierenden ihre Kompetenz, wissenschaftlich arbeiten zu knnen. Sie erlernen damit die Fhigkeit, den aktuellen Forschungs-stand und Fachdiskurs zusammenfassend wiederzugeben, wissenschaftliches Wissen zu erfassen und im Hinblick auf eine Fragestellung kritisch zu beleuchten sowie daraus Erkenntnisse und Antworten abzuleiten.
Handlungskompetenz als Ziel eines Fachhochschulstudiums in Sozialer Arbeit: Und was hat das mit Forschung zu tun?Ein Interview mit Prof. Dr. des. Regula Kunz und Prof. Dr. Daniel Gredig
Prof. Dr. des. Regula KunzLeiterin Bachelor-Studium Soziale Arbeit
Prof. Dr. Daniel Gredig, dipl. SozialarbeiterLeiter Master-Studium Soziale Arbeit
-
Hochschule fr Soziale Arbeit I. Schwerpunkt Evaluations- und Wirkungsforschung 16 | 17
Handlungskompetenz als Ziel eines Fachhochschulstudiums in Sozialer Arbeit: Und was hat das mit Forschung zu tun?Ein Interview mit Prof. Dr. des. Regula Kunz und Prof. Dr. Daniel Gredig
Daniel Gredig: Das Master-Studium baut auf den im Bachelor-Studium entwickel-ten, grundlegenden Fhigkeiten auf und frdert diese Kompetenzen dahingehend weiter, als die Studierenden sich vertieft mit einzelnen Verfahren der Datenerhe-bung (wie z.B. der Gestaltung eines Interviews oder der Konstruktion eines Frage-bogens) und mit Methoden der Datenauswertung befassen, wie z.B. mit Interpreta-tionsverfahren von verbalen Daten oder Statistik. Zudem befassen sie sich mit wissenschaftstheoretischen Grundlagen. Diese erlauben ihnen, grundstzlich un-terschiedliche Herangehensweisen in der Erkenntnisproduktion zu berblicken und den Einfluss von grundlegenden philosophischen Fragen auf den Forschungs-alltag und einzelne Studien zu erkennen. Dies hilft, Ergebnisse von Studien einord-nen und kritisch beurteilen zu knnen. Die Studierenden sollen aber nicht nur Fachwissen ber Forschung erwerben. Sie sollen auch die Fhigkeit entwickeln, angesichts einer bestimmten Fragestellung entscheiden zu knnen, welche die an-gemessenen Methoden zur Beantwortung der Frage sind. Und sie sollen auch eini-ge gngige Verfahren der Datenerhebung und -auswertung beherrschen. Deshalb absolvieren die Master-Studierenden eine Art Forschungspraktikum: Sie nehmen an einer Forschungswerkstatt teil, in der sie in einer Gruppe von maximal acht Teilnehmenden und von zwei erfahrenen Forschenden begleitet den Prozess von der Fragestellung bis hin zur Berichterstattung ber die Ergebnisse durcharbeiten. So machen die Studierenden erste Erfahrungen in der Erzeugung von Erkenntnis-sen, lernen diese Arbeit zu reflektieren und gelangen zu einem breiter fundierten Verstndnis fr Forschungsergebnisse. Sie ben dabei natrlich auch Verfahren, auf die sie dann in ihrer knftigen Praxis bei Evaluationen von Projekten und der forschungsbasierten Entwicklung von Angeboten zurckgreifen knnen.
Ein zustzliches Element, das die Forschungskompetenz weiter untersttzt, sind Master-Thesen, die in Form einer empirischen Arbeit erbracht werden. In diesen Arbeiten knnen die Absolventinnen und Absolventen des Studiums belegen, wel-che Kompetenzen sie in Sachen Forschung aufgebaut haben.
Wie wird denn Forschung praxisnah vermittelt?
Daniel Gredig: Im Zusammenhang mit Forschung ist die Nhe zu zwei unterschied-lichen Formen von Praxis angesprochen. Zum einen geht es um die Nhe zur For-schungspraxis, zum anderen um die Nhe zum sozialarbeiterischen Handeln in den Organisationen der Sozialen Arbeit. In beiden Hinsichten scheint mir in hohem Mass eine Praxisnhe gegeben. Lassen Sie mich zuerst auf die Nhe zur For-schungspraxis eingehen: Auch die forschungsbezogene Lehre ist eng mit der eige-nen Forschungsttigkeit der Dozierenden gekoppelt. Da wird nicht nur abstrakt ber Methoden und wissenschaftstheoretische Positionen gesprochen, die dazu fhren knnen, dass die Antworten der Wissenschaft auf eine Frage unterschied-lich ausfallen knnen. Vielmehr werden diese Verfahren anhand von aktuellen For-schungsarbeiten der Dozierenden illustriert, verstndlich gemacht und in ihren Folgen reflektiert.
Diese Nhe zur Forschungspraxis ist entscheidend. Denn erst wenn verstanden wird, was die Kernpunkte eines Verfahrens sind und wie es gehandhabt wird, kann beurteilt werden, was es leisten kann, was man sich davon erwarten und was man sich davon nicht erhoffen darf. Dies ist eine wichtige Voraussetzung fr die spte-re eigene Praxis im Feld, in der es eben wichtig ist, Studien hinsichtlich ihres Vor-
gehens beurteilen zu knnen und auch selbst Erkenntnisse zu erzeugen. Und damit zeigt sich, dass die Beschftigung mit Forschung eben auch eminent wichtig fr die Ausbildung einer Handlungskompetenz im Sinne einer Berufsbefhigung ist.
Damit sind wir nun bei der Praxisnhe im Sinne der Nhe zur sozialarbeiterischen Handlungspraxis angelangt. Auseinandersetzung mit Forschung ist auch nah an der sozialarbeiterischen Praxis, da sie ebenfalls auf die sptere Rolle der Master in der Praxis vorbereitet. Die Nhe zur alltglichen professionellen Praxis ergibt sich weiter auch dadurch, dass z.B. in den Forschungswerksttten oder auch in den Master-Thesen Herausforderungen aufgegriffen werden, mit denen sich die Profes-sionellen in der Praxis aktuell konfrontiert sehen. Die Studierenden lernen, diese handlungspraktischen Herausforderungen in eine Forschungsfrage zu transfor-mieren, sie theoretisch zu rahmen und dann methodisch kontrolliert zu bearbeiten. Darber hinaus lernen sie, die Ergebnisse darzustellen und dabei auf die Bedrf-nisse von unterschiedlichen Anspruchsgruppen (wie z.B. Kolleginnen und Kollegen in der eigenen Organisation, Leitende von Organisationen, Finanzgeber oder auch Verantwortliche der Politik) einzugehen. Damit lernen sie, der Praxis Wissen ber die Ausmasse, die Hintergrnde und Dynamiken von sozialen Problemlagen zur Verfgung zu stellen, oder eben auch Wissen darber, ob ein bestimmtes Angebot den Nutzerinnen und Nutzern, die von einem bestimmten Problem betroffen sind, dabei helfen kann, eine selbstbestimmte Lebensfhrung und Integration zu errei-chen, zu erhalten oder auch wiederherzustellen.
Regula Kunz: Auch im Bachelor-Studium wird Wert darauf gelegt, Lehre, Theorie und Forschung eng zu verknpfen. Die erste promotionsrelevante wissenschaftli-che Arbeit geht von einem Fall aus, den die Studierenden aus ihrer Praxis einge-bracht und anhand eines Reflexionsmodells analysiert und dokumentiert haben. Aus dem Fall greifen die Studierenden ein Thema auf, das sie interessiert, um dar-aus eine Fragestellung zu entwickeln. Diese errtern sie anhand von wissenschaft-licher Literatur und binden die Erkenntnisse am Ende wieder zurck an ihren Fall. Nicht die Lsung des Falles steht im Fokus, sondern die Wissenschaftsbasierung, das bessere Verstehen von Phnomenen, Themen, Zusammenhngen, kurz: die Beantwortung der Fragestellung. Aus solchen Erkenntnissen knnen dann in der Folge auch neue Lsungen auf der Handlungsebene entwickelt werden.
Welche Mglichkeiten haben die Studierenden nach dem Abschluss des Studiums, ihre Forschungskompetenzen in der Berufspraxis einzusetzen?
Regula Kunz: Im Bachelor-Studium steht die Berufsbefhigung im Hinblick auf die direkte Arbeit mit Klientinnen und Klienten im Vordergrund. Wir beabsichtigen nicht, dass die Studierenden eigene Forschung betreiben knnen. Jedoch verstehen wir unter Professionalitt, dass das eigene Handeln wissenschaftsbasiert erfolgt. Dies bedingt zweierlei: Einerseits muss verstanden werden, was Wissenschaft ist, welche Erkenntnisse sie produziert und wie diese Prozesse der Wissensgenerierung vollzogen werden. Nur so knnen die Ergebnisse angemessen bewertet werden. Wissenschaft ist immer Abstraktion, Generalisierung von Spezifischem. Die Studie-renden werden deshalb andererseits whrend ihres Studiums in der Kasuistik da-rin einsozialisiert, wie das Allgemeine und Besondere zueinander in Beziehung gesetzt werden knnen. Wie also die verallgemeinerten Erkenntnisse in Form von Theorien, Modellen und Verfahren wieder auf den Einzelfall bezogen werden.
-
Hochschule fr Soziale Arbeit 18 | 19
Handlungskompetenz als Ziel eines Fachhochschulstudiums in Sozialer Arbeit: Und was hat das mit Forschung zu tun?Ein Interview mit Prof. Dr. des. Regula Kunz und Prof. Dr. Daniel Gredig
Beide Bewegungen sind ntig, um Wissenschaft und Praxis zu verknpfen und dem Anspruch einer wissenschaftsbasierten Praxis gerecht zu werden. Und insofern setzen die Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiums an der Hoch-schule fr Soziale Arbeit FHNW diese im Studium entwickelten Fhigkeiten in ihrer Praxis laufend um auch wenn sie sich dessen in der konkreten Handlungs-situation zum Teil gar nicht mehr bewusst sein mgen.
Daniel Gredig: Wenn wir einen Blick auf die Befragung der Ehemaligen des Mas-ter-Studiums werfen, stellen wir fest, dass unsere Absolventinnen und Absolventen in der Praxis genau solche Stellen bernehmen, an denen sie gefordert sind, die Schnittstelle von Praxis und Wissenschaft und damit eben auch von Forschung zu pflegen. Sie sind hufig an Stellen im Sozialsystem beschftigt, an denen es darum geht, bestehende Angebote auf ihre Leistung hin zu beurteilen und bedarfs-bezogen weiterzuentwickeln, seien es nun Massnahmen der Frherkennung sei-tens der Invalidenversicherung, Angebote zur Armutsbekmpfung, Verfahren im Rahmen des Kinderschutzes, Angebote zur Gesundheitsfrderung der lteren Ge-nerationen oder neue Modelle der Geschlechtergleichstellung. In diesen Funktio-nen greifen sie jeweils auf ihre Forschungskompetenzen zurck, wenn sie sich ge-sichertes Wissen aus der wissenschaftlichen Literatur erschliessen und ntzlich machen oder eben auch selbst Evaluationen vornehmen.
-
Hochschule fr Soziale Arbeit I. Schwerpunkt Evaluations- und Wirkungsforschung 20 | 21
In einer Handlungswissenschaft wie der Sozialen Arbeit ist die Bezogenheit von Wissenschaft und Praxis ein theoretisch kaum zu hintergehendes und praktisch variabel auszugestaltendes Postulat. Was Forschung betrifft, also die theoretisch und methodologisch begrndete Entwicklung von generalisierbarem systemati-schem Wissen ber einen bestimmten Gegenstand (Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW 2009, S. 3), bedeutet Anwendungsorientierung, dass Forschungsergebnisse in der Praxis mittelbar vernderungswirksam werden knnen und potenziell einen gesellschaftlichen Nutzen haben. Dieser Beitrag thematisiert allerdings nicht an-wendungsorientiertes Forschen, sondern zielt auf die Bildung und Verwendung von Wissen in Entwicklungsprojekten. Der Beitrag geht der Frage nach, welche Kompetenzen ntig sind, um Entwicklungsprozesse mit Innovationspotenzial zu gestalten. Dies wird anhand von Kernthemen des Innovationsprogramms INCU-MENT dargelegt.
Das Programm Das Programm INCUMENT gefrdert durch BREF1 wurde auf der Basis der Innovationsforschung und -konzeption in der Sozialen Arbeit (vgl. Httemann/Par-pan-Blaser 2012) sowie der Konzeption kooperativer Wissensbildung (Gredig/Som-merfeld 2007) entwickelt. INCUMENT (INCUbate social developMENT) bietet Inku-bationsrume, in denen Wissens- und Handlungsformen (neu) verschrnkt und mit Blick auf eine Angebotsentwicklung verbunden werden knnen. Geleitet durch ein Manual, wird in INCUMENT die Kooperation von Praxisorganisation und Hoch-schule gestaltet.
Anforderungen an die Beteiligten eines Entwicklungsprojekts knnen je nach Rol-le unterschiedlich ausgeprgt sein. In INCUMENT wurden im Wesentlichen folgen-de Rollen definiert: Die programmverantwortliche Person (leitet die Programmteil-nahme in der Praxisorganisation und fungiert als Ansprechperson whrend des Prozesses), die Programmmitarbeitenden aus der Praxis (stellen ihre jeweilige Ex-pertise zur Verfgung und arbeiten aktiv im Programm mit), die Fachperson aus der Hochschule (verfgt ber bzw. recherchiert Wissen aus Theorie und Forschung zur Themenstellung und bringt dieses in komprimierter und anschlussfhiger Wei-se in den Prozess ein), die Moderation (schafft einen Rahmen, der unter anderem die kreative Suche von Lsungsanstzen, das Halten einer konstruktiven Suchbe-wegung und eine Balance von Neuem und Vertrautem ermglicht). Die Definition von Rollen und Phasen (siehe Abbildung) hilft zu vermeiden, dass unterschiedliche und diffuse Erwartungen die involvierten Personen berfordern und den koopera-tiven Entwicklungsprozess behindern.
1 Als Initiative der Gebert Rf Stiftung und Swissuniversities (Kammer Fachhochschulen) frdert das Programm BREF Brckenschlge mit Erfolg seit 2009 Projekte, die es Fachhochschulen erlauben, innovative Arten der Zusammenarbeit zu realisieren (www.grstiftung.ch).
Abbildung: Prozessstruktur des Innovationsprogramms INCUMENT
Darber hinaus bleiben Prozesse der Wissensbildung und -verwendung in Ent-wicklungsprojekten anspruchsvoll und erfordern von allen Beteiligten besondere Kompetenzen. Anhand der Kernthemen, die fr die Entwicklung und Durchfhrung des Innovationsprogramms INCUMENT grundlegend waren, erfolgt nun eine An-nherung an die Kompetenzen, die eine Programmdurchfhrung von INCUMENT erfordert und zugleich frdert.
ProzessMit Innovationen ist eine Infragestellung der bisherigen Routine verbunden und es besteht die Ungewissheit, ob sich das Entwickelte auch bewhren wird. Ent-wicklungsprojekte mit Innovationspotenzial erfordern eine betrchtliche Offen-heit, die Auseinandersetzung mit Heterogenitt, die Inkaufnahme von Fehlern und die Bereitschaft zu Anpassungen, Vernderungen und Lernprozessen. Um ein Inno-vationspotenzial zu heben, bedarf es auf der Ebene der Beteiligten kreativer Span-nung (Albury 2005: 53) und kontradiktorischer Reibungsflchen (Jaskyte/Kisie-liene 2006: 168). In einem zirkulren Prozess wird nach neuem Wissen gesucht oder bestehendes Wissen neu kombiniert oder adaptiert. Dieser Lernprozess mndet in eine Restrukturierung von Wissen, Kenntnissen und Kompetenzen (Maier et al. 2007: 817). Damit die Herausforderungen in diesem Prozess nicht berhand- nehmen und das Potenzial der Beteiligten fruchtbar gemacht werden kann, braucht es geeignete Rahmenbedingungen, Gefsse und Vorgehensweisen. Die Prozess- orientierung ist in angemessener Form mit einer Zielorientierung in Einklang zu bringen.
Kommunikation Fr die Gestaltung innovativer Prozesse ist es frderlich, wenn ein Team aus un-terschiedlichen Personen zusammengestellt wird, sodass Unterschiede bezglich des fachlichen Hintergrunds, der Stellung in der Organisation, der persnliche Ei-genschaften, des Erfahrungsschatzes usw. bestehen (West/Hirst 2003: 298300). Kommen Beteiligte aus verschiedenen sozialen Systemen zusammen, wie das bei
Kompetenzen zur Gestaltung innovativer Entwicklungsprozesse: Hinweise aus dem Innovationsprogramm INCUMENTMatthias Httemann und Anne Parpan-Blaser
Prof. Dr. Matthias HttemannDozent
Prof. Dr. Anne Parpan-BlaserDozentin
Abklrungsphase
Workshop A
Explorationsphase
Workshop B
Entwicklungsphase
Workshop C
Abschluss- undbergangsphase
Mo
nit
ori
ng
/Eva
luat
ion
INCUMENT
Praxisorganisation Hochschule
-
Hochschule fr Soziale Arbeit I. Schwerpunkt Evaluations- und Wirkungsforschung 22 | 23
Kompetenzen zur Gestaltung innovativer Entwicklungsprozesse: Hinweise aus dem Innovationsprogramm INCUMENT
der Kooperation von Hochschule und Praxis der Fall ist, verstrken sich die kom-munikativen Herausforderungen. Kenntnisse ber das jeweils andere Handlungs-system sind von Vorteil. Die soziale Heterogenitt der Gruppe und die aufgabenbe-zogene Heterogenitt von Wissens- und Erfahrungsbestnden erfordern von den Beteiligten die Bereitschaft zu ausfhrlicheren Verstndigungsprozessen, sodass wechselseitige Anschluss- und Konsensfhigkeit hergestellt werden kann. Aber auch die Fhigkeit zu kritisch-konstruktiven Distanzierungen und die Wertscht-zung von Differenzen sind frderlich. Differenzen und auch Konflikte knnen fr den Prozess und das Ergebnis nutzbar gemacht werden, wenn das Klima der Zu-sammenarbeit grundstzlich vertrauensvoll ist und die Beteiligten geeignete (meta-)kommunikative Kompetenzen aktivieren knnen.
Kooperative WissensbildungKooperative Wissensbildung setzt an der produktiven Differenz von Wissenschaft und Praxis an (Httemann/Sommerfeld 2007). Angenommen werden kann, dass Wissen die Substanz von Innovation (Voss 2003, S. 16) ist und transdisziplinre Prozesse kooperativer Wissensbildung Innovationen begnstigen. Im Koopera- tionsprozess bringen Praktiker, Wissenschaftlerinnen, Adressaten sowie weitere Beteiligte ihre jeweiligen Wissens- und Kompetenzbereiche ein. Gemeinsam ist zu-nchst, die Problemstellung zu analysieren und zu fragen: Welches Wissen kann weiterfhrend sein? Fr die Beteiligten aus der Praxis besteht dann die Aufgabe, vorhandenes Wissen zu explizieren sowie neues Wissen aus dem Praxiskontext zu recherchieren und zusammenzufassen. Die beteiligte Fachperson aus dem Hoch-schulkontext hat speziell die Aufgabe, passende wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenzutragen, auszuwhlen, zu verdichten und zu bersetzen. Die an-schliessende Neukombination unterschiedlicher Wissens- und Handlungsformen und die gemeinsame Bildung neuer Erkenntnisse, Entwicklungsideen und Hand-lungsformen werden in INCUMENT methodisch untersttzt (Parpan-Blaser/Ht-temann 2015).
Kontext Die Rekontextualisierung von Ideen und Vorhaben, die in einem Inkubationsraum entwickelt wurden, stellt eine weitere zentrale Aufgabe dar. Fr den sozial komple-xen Innovationsprozess sind Kompetenzen erforderlich, die dazu beitragen, der neuen Entwicklung in den jeweiligen Kontexten den Boden zu bereiten und die anschliessende Umsetzung und Verbreitung zu untersttzen. Was eine Innovation ausmacht, wird im Wechselspiel von neuen Ideen, ermglichenden und begrenzen-den Kontextfaktoren geformt. Neue Entwicklungen erfordern lokales Kontextwis-sen sowie auch Wertewissen. Denn eine Ausgangskonstellation fr Entwicklungen mit Innovationspotenzial ist in der Sozialen Arbeit nur dann gegeben, wenn einem gesellschaftlichen, sozialethisch fundierten Zentralwert (wie z.B. soziale Gerech-tigkeit, Integration oder Partizipation) nicht angemessen entsprochen wird, pro-fessionelle Soziale Arbeit angezeigt ist und geeignete soziale Dienstleistungsange-bote nicht bereits vorliegen. Neue Dienstleistungsangebote Sozialer Arbeit mssen einen begrndeten Bedarf decken (Hartley 2005: 30).
AusblickDie Gestaltung innovativer Entwicklungsprozesse erfordert ein breites Spektrum an Wissen und Kompetenzen, das in diesem Beitrag nur grob skizziert werden konnte. Anhand des Innovationsprogramms INCUMENT ergeben sich weitere An-haltspunkte, wie die Fhigkeit zur Innovation, die im Kompetenzprofil der Hoch-schule fr Soziale Arbeit FHNW enthalten ist, auf Bachelor- und Masterstufe ge-frdert sowie fr Hochschulmitarbeitende noch prsenter werden kann. Darber hinaus zeichnet sich ab, dass auch aufseiten von Praxisorganisationen der Sozia-len Arbeit die Innovationsfhigkeit gestrkt und die Kompetenz der Professionel-len untersttzt werden kann, kooperative Entwicklungsprozesse zu gestalten.
Literatur Albury, David (2005): Fostering Innovation in Public Services. Public Money & Management 25. Jg.
(1): 5156.Gredig, Daniel/Sommerfeld, Peter (2007). New Proposals for Generating and Exploiting Solution-
Oriented Knowledge. In: Research on Social Work Practice. 18. Jg. (4). S. 292300.Hartley, Jean (2005): Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. Public Money
& Management 25. Jg (1): 2734.Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW (2009). Konzept Forschung und Entwicklung. Von der Hoch-
schulleitung genehmigtes und hochschulintern verffentlichtes Papier. Olten: HSA FHNW.Httemann, Matthias/Sommerfeld, Peter (2007): Forschungsbasierte Praxis. Professionalisierung
durch kooperative Wissensbildung. S. 4057 in: Peter Sommerfeld/Matthias Httemann (Hg.), Evidenzbasierte Soziale Arbeit. Nutzung von Forschung in der Praxis. Baltmannsweiler: Schnei-der Verlag Hohengehren.
Httemann, Matthias/Parpan-Blaser, Anne (2012). Innovation in der Sozialen Arbeit ein altbekann-tes Phnomen und ein neues Forschungsgebiet. In: Schweizerische Zeitschrift fr Soziale Arbeit. 12. Jg. (1). S. 7599.
Jaskyte, Kristina/Kisieliene, Audrone (2006). Organizational innovation. A comparison of nonprofit human-service organizations in Lithuania and the United States. In: International Social Work. 49. Jg. (2). S. 165176.
Maier, Gnter W./Streicher, Bernhard/Jonas, Eva/Frey, Dieter (2007). Innovation und Kreativitt. In: Frey, Dieter/von Rosenstiel, Lutz (Hg.). Enzyklopdie der Psychologie. Bd. 6 Wirtschafts-, Organi-sations- und Arbeitspsychologie. Gttingen: Hogrefe. S. 809855.
Parpan-Blaser, Anne/Httemann, Matthias (2015). Innovationsprogramm INCUMENT: Entwicklung kooperativ gestalten. In: SuchtMagazin. Heft 1. S. 1822.
Voss, Jan-Peter (2003). Nationale Innovationssysteme. In: Voss, Jan-Peter/Fischer, Corinna/Schuma-cher, Katja/Cames, Martin/Pehnt, Martin/Praetorius, Barbara/Schneider, Lambert (Hg.). Innova- tion. An integrated concept for the study of transformation in electricity systems. TIPS. S. 1618.
West, Michael A./Hirst, Giles (2003). Cooperation And Teamwork For Innovation. In: West, Michael A./Tjosvold, Dean/Smith, Ken G. (Hg.). Organizational Teamwork And Cooperative Working. West Sussex: John Wiley. S. 297319.
-
Hochschule fr Soziale Arbeit 24 | 25
II. Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW vom 1.1.2014 bis 31.12.2014
-
Hochschule fr Soziale Arbeit
Institut Beratung, Coaching und SozialmanagementPortrt
Das Institut Beratung, Coaching und Sozialmanagement ICSO fokussiert die inno-vative Gestaltung von Beratungsprozessen und die Funktionsweisen wirkungs- orientierter Planung, Fhrung und Steuerung von Organisationen sowie die Ent-wicklung von Dienstleistungen:
Der Schwerpunkt Beratung bndelt Kompetenzen rund um Beratung in der Sozialen Arbeit und frdert die Professionalisierung von Beratung.
Der Schwerpunkt Coaching positioniert Coaching als professionelle Prozess- beratung in verschiedenen beruflichen Kontexten.
Der Schwerpunkt Sozialmanagement nimmt das Management von und in Organisationen in den Blick, sttzt sich auf das Social-Impact-Modell und fokus-siert spezifisch auf Sozialfirmen.
In Zusammenarbeit mit Praxispartnerinnen und -partnern setzt das Institut mass-geschneiderte Dienstleistungs- und Beratungsmandate sowie Entwicklungsprojek-te um. So fhrt es z.B. Wirkungsevaluationen von Sozialfirmen und Bedarfs- und Organisationsanalysen in Organisationen der Behindertenhilfe durch, entwickelt innovative Beratungskonzepte in Sozialen Diensten, begleitet die Implementierung von Coaching-Programmen und untersttzt Organisationen bei komplexen Pla-nungs- und Steuerungsfragen.
Angewandte Forschungsprojekte widmen sich Themen wie der Beratung mit unter-schiedlichen Medien (Blended Counseling), der zunehmenden Nutzung von Coa-ching als Beratungsformat in der Arbeitsintegration, Wirkungen von Sozialfirmen in der Schweiz, Fragen nach Entscheidungs- und Steuerungsgrundlagen von Fh-rungspersonen in Organisationen der Sozialen Arbeit oder einer Stellenangebots-analyse mit Ziel eines Stellenmonitorings im Sozialwesen.
Das Institut bringt seine Expertise ein in die Ausbildung auf Bachelor- und Mas-terstufe und in seine vier Weiterbildungsmaster-Programme: MAS Systemisch- lsungsorientierte Kurzzeitberatung und -therapie, MAS Psychosoziales Manage-ment, MAS Coaching und MAS Sozialmanagement. Mit internationalen Fach- tagungen und Kongressen bietet das Institut Fachleuten aus Praxis, Bildung und Wissenschaft Diskursplattformen zum Austausch zu verschiedenen Themen.
Kontakt: Prof. Agns Fritze, lic. phil., Institutsleiterin T +41 62 957 20 52, [email protected]/sozialearbeit/icso
Prof. Agns Fritze, lic. phil.Institutsleiterin
II. Forschungs- und Entwicklungsprojekte vom 1.1.2014 bis 31.12.2014 26 | 27
-
Hochschule fr Soziale Arbeit
Institut Beratung, Coaching und SozialmanagementAnalyse von Stellenangeboten in der Sozialen ArbeitJeremias Amstutz, Sarah Madrin und Peter Zngl
Abstractber den Stellenmarkt im Sozialwesen in der Schweiz ist bisher nur wenig bekannt. Bestehende Analysen erfassen das Sozialwesen gar nicht oder nur unzureichend. Personalverantwortliche und Fhrungskrfte sozialer Praxisorganisationen wei-sen vermehrt auf den Bedarf nach gesicherten Daten und Erkenntnissen ber den Stellenmarkt hin, da diese fr die Personalrekrutierung erforderlich sind. Diesen Informationsbedarf will das vorliegende Forschungsprojekt mit der Analyse von Stellenangeboten im Sozialwesen der Schweiz decken. Die dafr notwendigen, aus-gewhlten und anonymisierten Daten werden vom Verein sozialinfo.ch zur Verf-gung gestellt und mittels quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden aus-gewertet. Der Fokus der Analysen richtet sich auf Themen wie Arbeitsbereich, Qualifikationsanforderung und Funktion mit dem Ziel, Muster und Aufflligkei-ten sowie Trends und Entwicklungen im Stellenmarkt zu identifizieren.
Ausgangslage, Zielsetzung und FragestellungenDie Analyse von Stellenangeboten im Arbeitsmarkt der Sozialen Arbeit knpft an die Ergebnisse einer Vorstudie von Amstutz und Zngl (2013) an. Im Rahmen dieser Vorstudie wurde die Entwicklung des Stellenmarktes anhand von Stellenangebo-ten, die auf dem Stellenportal des Vereins sozialinfo.ch verffentlicht wurden, in-nerhalb eines Zeitraums von drei Monaten beobachtet und ausgewertet (n = 1084 Stellenangebote).
In Erweiterung der damaligen Fragestellung fokussiert die aktuelle Studie nicht mehr nur auf Aspekte des Sozialmanagements, sondern bezieht alle Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit ein. Sie hat zum Ziel, zeitnah und kontinuierlich ber Entwick-lungen auf dem Stellenmarkt im Sozialwesen der Schweiz zu informieren. Spezifi-sche Merkmale des Stellenmarktes sollen dabei ebenso untersucht werden wie Anstellungsbedingungen, Qualifikationsanforderungen, Funktionsbereiche, Ar-beitsfelder oder regionale Unterschiede. Dazu sollen folgende Fragen beantwortet werden:WieentwickeltsichderStellenmarktimSozialwesen?WelcheAnforderungenwerdenseitensderstellenausschreibendenOrganisatio-
nen von den Bewerbenden erwartet? LassensichUnterschiedeindenverschiedenenArbeitsfeldernerkennen? LassensichregionaleUnterschiedeerkennen?
Das Forschungsvorhaben ist als Kooperationsprojekt mit dem Verein sozialinfo.ch angelegt. Dieser stellt die Daten der Stelleninserate in anonymisierter Form zur Verfgung und beteiligt sich an der Projektkonzeption sowie an der Verffentli-chung der Ergebnisse.
Der Verein sozialinfo.ch bezweckt die Informations- und Wissensvermittlung fr das Sozialwesen Schweiz. ber sein Internetportal stellt er Dienstleistungen fr Organisationen im Sozialwesen zur Verfgung, beispielsweise das Stellenportal. Mit einer Datenbasis von monatlich 300 bis 500 Stelleninseraten handelt es sich hier um das grsste Onlinestellenportal in der Sozialen Arbeit fr die deutsche Schweiz. Die im Forschungsprojekt genutzten Informationen beruhen auf diesen Daten, wobei nur die forschungsrelevanten Informationen bercksichtigt werden und Rckschlsse auf Organisationen oder Personen ausgeschlossen sind.
Sarah Madrin, B.A.Praktikantin
II. Forschungs- und Entwicklungsprojekte vom 1.1.2014 bis 31.12.2014 28 | 29
Hintergrund und ForschungsstandStellensuchende in der Schweiz profitieren laut aktuellen Forschungsergebnissen von Salvisberg (2013) allgemein von einer konstant hohen Nachfrage in smtlichen Branchen. Besonders bei hoch qualifizierten Stellen ist eine deutliche Zunahme auszumachen, auch wenn Absolventinnen und Absolventen mit einer beruflichen Grundbildung (Lehre) nach wie vor ber eine hohe Arbeitsmarktattraktivitt ver-fgen (vgl. Salvisberg 2013: 2). Der Stellenmarkt des Sozialwesens wird in dieser Untersuchung nicht spezifiziert.
Das Sozialwesen wurde hingegen in einer Erhebung von Sac-chi und Salvisberg (2013) bercksichtigt: Der Forschungs- gegenstand beschrnkt sich dort ausschliesslich auf die Arbeitsmarktchancen von Fachkrften mit einer beruflichen Grundbildung. Demnach betrgt der Anteil Absolventinnen und Absolventen einer Berufslehre im Sozial- und Gesund-heitswesen 11,9 Prozent der untersuchten Arbeitsbereiche. Gleich hoch ist auch die Nachfrage auf dem Stellenmarkt (vgl. ebd.: 4). Der Frauenanteil ist im Sozial- und Gesundheitswe-sen mit 88,5 Prozent der hchste in allen Berufskategorien (vgl. ebd.: 4). In Bezug auf das Angebot von ausgeschriebenen Stellen zeigt sich, dass die Stellenmarktanteile der Berufska-tegorie Sozial- und Gesundheitswesen bei rund zehn Prozent liegen. Darber hinaus wird deutlich, dass im Sozial- und Gesundheitswesen am hufigsten Zusatzqualifikationen und Weiterbildungen verlangt werden (vgl. ebd.: 18). Den Berufen im Sozial- und Gesundheitswesen werden wie bei den technischen und Bauberufen insgesamt berdurchschnittliche Beschftigungsperspektiven at-testiert. Abgesehen von der Gefahr prekrer Beschftigungsverhltnisse (etwa durch niedrige Arbeitspensen) fallen besonders die guten Weiterbildungsmglich-keiten und die grosse Nachfrage nach qualifiziertem Personal auf (vgl. ebd.: 31).
Dass Organisationen im Sozialwesen bedeutende Arbeitgebende in der Schweiz sind, besttigt eine Erhebung des Berufsverbandes fr die Soziale Arbeit AvenirSo-cial (2011). In einer anderen Studie von Frey, Braun und Waeber (2011) wird jedoch kritisch angemerkt, dass die Daten zur Anzahl Beschftigter im Sozialwesen je nach Datenquelle stark variieren.
Eine Durchsicht des Forschungsstandes macht deutlich: Entweder wird das Sozi-alwesen in den bisherigen Erhebungen nicht bercksichtigt oder es wird mit ande-ren Berufsgruppen wie z.B. dem Gesundheitswesen zusammengefasst. Neben den genannten Studien konnten in der Schweiz keine Forschungsergebnisse in diesem Themenfeld identifiziert werden.
Methodisches Vorgehen
I. Bereitstellung und Aufbereitung der Daten
Die Datenbasis besteht aus Informationen, welche die Stellenanbieter, also soziale Organisationen im Stellenportal des Vereins sozialinfo.ch publizieren. Damit diese umfangreichen Daten nicht manuell erfasst werden mssen, stellte der Verein so-zialinfo.ch als Eigentmer des Stellenportals die Stelleninserate der Hochschule
Endlich knnen durch die Zusammenarbeit von Praxis und Forschung qualifizierte Aussagen zum Stellenmarkt der Sozialen Arbeit gemacht werden!Barbara BeringerGrnderin/Geschftsleiterin Verein sozialinfo.ch
Prof. Dr. Peter ZnglDozent
Jeremias Amstutz, M.A. Wissenschaftlicher Mitarbeiter
-
Hochschule fr Soziale Arbeit
Institut Beratung, Coaching und SozialmanagementAnalyse von Stellenangeboten in der Sozialen Arbeit
fr Soziale Arbeit FHNW in anonymisierter Form zur Verfgung. Rckschlsse auf die inserierenden Organisationen oder Personen sind dabei ausgeschlossen. Die Daten wurden vom Forschungsteam in ein Datenbanksystem eingelesen.
II. Analyse der Daten
Quantitative AnalysenIn einem ersten Schritt werden die standardisierten Informationen smtlicher Stelleninserate des Jahres 2014 mittels uni-, bi- und multivariater statistischer Verfahren ausgewertet. Dabei werden in Anlehnung an die oben genannten Frage-stellungen folgenden Dimensionen bercksichtigt:Region(z.B.Kantone,Stdte) Arbeitsfeld(z.B.Behindertenarbeit,Sozialhilfe,Jugendarbeit) Funktion(z.B.Fhrung,qualifizierteFacharbeit) Anstellungsbedingungen(z.B.Pensum,Entlohnung) AnforderunganQualifikationsstufe(z.B.Hochschule,HhereFachschule,beruf-
liche Grundbildung) SonstigeAspekte(z.B.Berufserfahrung,Zusatzqualifikationen,Charaktereigen-
schaften)
Qualitative AnalysenIn einem zweiten Schritt wird der Fokus auf die Stellenbeschreibungen (nicht stan-dardisierte Informationen) gerichtet. Hierfr wird eine nach dem Zufallsprinzip getroffene Auswahl von Stellenangeboten qualitativ ausgewertet. Die Auswertung erfolgt nach dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010). Ziel ist, sowohl Muster und Aufflligkeiten in den Stellenangeboten zu identifizie-ren als auch systematisch nach bestimmten Anforderungskriterien wie erforderli-che Weiterbildung, erwartete Grundkompetenzen usw. zu suchen.
Vorlufige ErgebnisseBisher wurden insgesamt 5748 Stellenangebote in die Analyse einbezogen. Dabei handelt es sich um smtliche Stellenangebote, die im Zeitraum von Januar bis Dezember 2014 auf dem Stellenportal von www.sozialinfo.ch publiziert wurden.
AnstellungsbedingungenIn vier von fnf Stelleninseraten wird eine unbefristete Ttigkeit angeboten.
In ber 40 Prozent der Anzeigen wird ein Beschftigungsgrad von 61 bis 80 Stel-lenprozent angeboten bzw. erwartet. In ber 88 Prozent der Stellen ist ein Teilzeit-pensum mglich.
QualifikationEs handelt sich im Sozialwesen um einen Arbeitsmarkt fr berwiegend qualifi-zierte Fachkrfte (72 Prozent). In fast der Hlfte aller Stellenangebote (44 Prozent) werden Bewerberinnen und Bewerber mit einem Hochschulabschluss gesucht. 17 Prozent aller Stellen werden fr Leitungspositionen ausgeschrieben. Der Anteil von Stellenangeboten, in denen un- oder angelerntes Personal gesucht wird, ist gering.
ArbeitsfelderJede vierte Stelle wird im stationren Umfeld (Heimwesen) angeboten.
II. Forschungs- und Entwicklungsprojekte vom 1.1.2014 bis 31.12.2014 30 | 31
Fast jede fnfte Stelle bezieht sich auf die Felder Erziehung und Bildung sowie Behindertenarbeit. Ebenfalls hufig wer-den Mitarbeitende in den Bereichen Jugendarbeit (16 Pro-zent) und Sozialhilfe (13 Prozent) gesucht. In den genannten Arbeitsfeldern ist im Bereich der Sozialhilfe der Anteil der Festanstellungen im Vergleich zu befristeten Stellen am hchsten (86 Prozent) und im Bereich Erziehung/Bildung am niedrigsten (69 Prozent). Bei den Stellenangeboten im Bereich der Sozialhilfe wird eine deutlich hhere Qualifikation er-wartet als in anderen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit. So sind 68 Prozent aller Stellen im Bereich der Sozialhilfe fr Mitarbeitende mit einem Hochschulabschluss ausgeschrie-ben. Dieser Anteil ist deutlich hher als in den Bereichen Ju-gendarbeit (51 Prozent), Erziehung/Bildung (39 Prozent) und Behindertenarbeit (28 Prozent).
RegionenDie meisten Stellen werden in den Kantonen Zrich (1861), Bern (1207), Aargau (603), Luzern (418) und Basel-Stadt (313) angeboten. Bezogen auf die Bevlkerungszahl in den Kantonen ist die Reihenfolge der meisten Stellenangebote: Basel-Stadt, Zug, Zrich, Bern und Luzern.
Diskussion Durch das Forschungsprojekt erhalten Leitungspersonen und Personalverantwort-liche in Organisationen des Sozialwesens wichtige Anhaltspunkte fr ihre strate-gische und operative (Personal-)Planung, indem sie von Trends und Entwicklungen in ihrem Arbeitsbereich erfahren.
Stellensuchende wie beispielsweise Studierende oder Quereinsteigerinnen und -einsteiger erhalten Orientierung in einem heterogenen und schwer berblickbaren Feld, indem sie ber Erwartungen, Qualifikationsansprche, regionale Verteilung der Stellenausschreibungen sowie ber Trends und Entwicklungen informiert wer-den.
Die Studierendenberatung an Fachhochschulen und Hheren Fachschulen der Sozialen Arbeit kann ihr Beratungsangebot auf aktuelle Daten und Fakten abstt-zen und somit Rat suchende Studierende prziser ber Entwicklungen auf dem Stellenmarkt informieren.
Der Berufsverband der Sozialen Arbeit kann sich zeitnah einen berblick ber den Stellenmarkt im Sozialwesen verschaffen und seine Stellungnahmen mit den Ergebnissen aus den Monitoringberichten anreichern und gegebenenfalls auch besser absttzen.
Transfer Die Studienergebnisse bieten zahlreiche Anknpfungspunkte. In der Lehre knnen sie zur Illustration der aktuellen Nachfrage von Fachkrften in den verschiedenen Arbeitsfeldern genutzt werden. Fr die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten knnen den Ergebnissen wichtige Hinweise ber den aktuellen Bedarf nach spezi-fischer Weiterbildung entnommen werden.
Die Forschungsergebnisse knnen von unterschiedlichen Anspruchsgruppen aufgegrif-fen werden der Arbeitsmarkt im Sozialbereich erhlt ein Gesicht.Barbara BeringerGrnderin/Geschftsleiterin Verein sozialinfo.ch
-
Hochschule fr Soziale Arbeit
Institut Beratung, Coaching und SozialmanagementAnalyse von Stellenangeboten in der Sozialen Arbeit
Darber hinaus werden neben einer kontinuierlichen Berichterstattung in der Fachzeitschrift SozialAktuell (geplant) verschiedene Mglichkeiten der Verffentli-chung geprft. Infrage kommen: Printmedien(z.B.ZeitschriftenmitRelevanzfrdieSozialeArbeitundfrPerso-
nalverantwortliche), Internet(z.B.eineeigensfrdasMonitoringeingerichteteWebsite,diekontinu-
ierlich mit den aktuellsten Analysen der Stellenangebote gespeist wird),DigitaleMedien(z.B.eineApp,beiderInhalteabonniertwerdenknnten).
FinanzierungHochschule fr Soziale Arbeit FHNW
ProjektteamProf. Dr. Peter Zngl, Jeremias Amstutz, M.A. Sarah Madrin, B.A. Barbara Beringer (Geschftsleiterin Verein sozialinfo.ch), Thomas Redmann (Vor-standsmitglied Verein sozialinfo.ch) Elena MriSandy RuppSimon Stckli
SchlsselbegriffeStellenmarkt, Sozialwesen, Stellenmarktmonitor, Berufsfeldanalyse
DauerJanuar 2014 bis Dezember 2015
LiteraturAdecco Swiss Job Market Index Q4. www.adecco.ch/Documents/Press%20Releases/DE/2015/Adec-
co_Swiss_Job_Market_Index_Q4_2014_DE.pdf [Zugriff: 28.01.2015].Amstutz, Jeremias/Zngl, Peter (2013): Sozialmanagement in der Praxis. Eine empirische Analyse von
Stellenangeboten im Sozialwesen der Schweiz. In: Schweizerische Zeitschrift fr Soziale Arbeit. 14 (1, 2013). S. 4259.
AvenirSocial (2011): Beschftigung und Ausbildung im Bereich der Sozialen Arbeit in der Schweiz. Bestandsaufnahme und Perspektiven. Bern: AvenirSocial. www.avenirsocial.ch/cm_data/Positio-nierungBildung_AvenirSocial.2011_D.pdf [Zugriff: 20.11.2014].
Frey, Miriam/Braun, Nils/Waeber, Philipp (2011): Fachkrftesituation im Sozialbereich. Auswertun-gen anhand des Indikatorensystems Fachkrftemangel. Schlussbericht. savoirsocial.ch/fach-kraftesituation-sozialbereich-bericht-bss-13-01-20111.pdf [Zugriff: 11.12.2014].
Monster Index Schweiz. info.monster.ch/MIS/article.aspx [Zugriff: 25.01.2015]. Sacchi, Stefan/Salvisberg, Alexander (2013): Arbeitsmarktperspektiven von Fachkrften aus unter-
schiedlichen Berufen 2013. Report im Auftrag des Staatssekretariats fr Bildung, Forschung und Innovation SBFI. Stellenmarkt-Monitor Schweiz. Universitt Zrich.
Salvisberg, Alexander (2013): Stellenmarkt-Monitor 2013. Auszge aus der Forschungsreihe Stellen-markt-Monitor Schweiz des Soziologischen Instituts der Universitt Zrich. Zrich: NZZ.
Stellenmarkt-Monitor Schweiz. www.stellenmarktmonitor.uzh.ch/index.html [Zugriff: 22.01.2015].
32 | 33
-
Hochschule fr Soziale Arbeit
Die Sozialfirma als Grundstein sozialer Innovation in der Schweiz: Rahmenbedingungen, Erfolgsfaktoren und Wirkungen
Auch in der Schweiz zeigt sich eine Problematik moderner Arbeitsgesellschaften: Fr einen wachsenden Teil der erwerbsfhigen Bevlkerung wird es aufgrund des wirtschaftlichen Strukturwandels zunehmend schwierig, eine dauerhafte Anstel-lung im regulren Arbeitsmarkt zu finden bzw. zu halten.
Langzeitarbeitslosigkeit ist die Folge. Sozialfirmen gewinnen in diesem Zusammen-hang zunehmend an Bedeutung. Das Projekt soll den Organisationstypus Sozialfir-ma in der Schweiz erstmals systematisch erfassen, analysieren und beschreiben. Besonders interessiert dabei dessen Innovationspotenzial und die dafr notwendi-gen Bedingungen. Das Projekt will einen grundlegenden Beitrag zur betriebs- und volkswirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Weiterentwicklung des noch jungen Beschftigungszweiges leisten. In Zusammenarbeit mit Betriebsverantwortlichen, Leistungsfinanzierenden, Regulatoren und weiteren Stakeholdern werden zudem Grundlagen erarbeitet, um das bisher vor allem organisch gewachsene System kohrenter und effizienter zu gestalten sowie das heterogene Angebot besser zu koordinieren. Was ist das Besondere an diesem Projekt? Das Projekt zeichnet sich durch einen interdisziplinren, fachhochschul- und kulturbergreifenden Fokus aus, der sowohl betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche wie gesellschaftliche Aspekte untersucht. Erstmals soll schweizweit eine umfassende Bestandesauf- nahme erfolgen und den unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Sprachregionen Rechnung getragen werden. So werden diverse Instrumente entwi-ckelt und getestet, die eine umfassende und multiperspektivische Wirkungsmes-sung ermglichen und Hinweise auf Innovationspotenzial im Umgang mit Lang-zeitarbeitslosigkeit aufzeigen sollen. Die Forschungsergebnisse dienen dazu, die politisch administrativen Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich zu unterstt-zen und die Rahmenbedingungen effizienter zu gestalten.
FinanzierungGebert Rf StiftungBREF-Brckenschlge mit Erfolg
KooperationFernfachhochschule Schweiz (FFHS)Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)
ForschungsteamLuca Crivelli Prof. Dr. (extern)Stefan Adam Prof.Jeremias Amstutz M.A.Gregorio Avils (extern)Massimo Calmi (extern)Domenico Ferrari (extern)Sigrid Haunberger Dr.Davide Pozzi (extern)Bernadette Wthrich lic. phil.Daniel Zbeli Prof. Dr. (extern)
Dauer01.03.2013 bis 30.06.2015
KontaktStefan Adam Prof.([email protected])
InstitutInstitut Beratung, Coaching und Sozialmanagement
AuftragVerein Lernwerk
FinanzierungVerein Lernwerk
KooperationSV GroupFachhochschule Nordwestschweiz FHNW
ForschungsteamStefan Adam Prof.Sarah Bestgen M.A.
Dauer30.11.2013 bis 30.06.2016
KontaktStefan Adam Prof.([email protected])Sarah Bestgen M.A.([email protected])
InstitutInstitut Beratung, Coaching undSozialmanagement
Institut Beratung, Coaching und SozialmanagementForschungs- und Entwicklungsprojekte
II. Forschungs- und Entwicklungsprojekte vom 1.1.2014 bis 31.12.2014 34 | 35
Erfolgsfaktoren eines Sozialfirmen-Start-up auf dem FHNW-Campus Brugg/Windisch
Seit der Erffnung des neuen Campus-Gebudes der Fachhochschule Nordwest-schweiz FHNW in Brugg/Windisch im Sommer 2013 sind in den Bereichen Gastro-nomie, Facility Services und Administration Services erwerbsbenachteiligte Mitar-beitende ttig. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt der FHNW und des Vereins Lernwerk mit Sitz in Vogelsang (AG). Das Start-up eines sozialen Unternehmens der Arbeitsintegration wird begleitet: Ziel der Studie ist, die Erfolgsfaktoren fr ein Start-up aus Sicht der erwerbsbenachteiligten Mitarbeitenden, des kooperierenden Wirtschaftspartners (SV Group, Rohr) und der zuweisenden Stellen zu identifizieren. Die Identifikation der Erfolgsfaktoren orientiert sich methodisch an den Anstzen der realistic evaluation und formativen Evaluation.
Details zum Projekt: www.fhnw.ch/ppt/content/prj/T999-0365
Details zum Projekt: www.fhnw.ch/ppt/content/prj/T999-0472
-
Hochschule fr Soziale Arbeit II. Forschungs- und Entwicklungsprojekte vom 1.1.2014 bis 31.12.2014 36 | 37
Rollenselbstverstndnisse von Job Coachs
Job Coaching ist ein Coaching-Format, in dem Menschen mit existenziellen Arbeitsplatzproblemen zwecks Reintegration oder Sicherung der aktuellen Arbeits-stelle begleitet werden. Oft werden dabei Menschen mit psychischen oder phy-sischen Beeintrchtigungen angesprochen. Das explorativ angelegte Kooperations-projekt ging der Frage nach, welches Rollenselbstverstndnis Job Coachs haben. Damit verbunden wurde die Art und Weise erforscht, wie Job Coachs die Erwartung der sie umgebenden Akteurinnen und Akteure wahrnehmen und gewichten (unter anderem Klientinnen und Klienten, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Sozial-dienste, rztliche Betreuung) und wie sie das eigene beraterische Handeln bzw. ihre Rolle gestalten und in Konfliktsituationen praktisch durchsetzen. Als Annherung an das Forschungsfeld wurde Wissen ber das Praxisfeld mit theoretischen Vor-berlegungen verknpft und durch Interviews mit den Job Coachs laufend ergnzt und angepasst. Ziel war auch, die Darstellung verschiedener Typen von Job Coachs zu prfen.
Erfolgsfaktoren von sozialen Unternehmen der Arbeitsintegration (Sozialfirmen)
Auf der Grundlage der Gesamtschweizerischen Strategie zur Armutsbekmpfung hat der Bundesrat im Mai 2013 das Nationale Programm zur Bekmpfung und Pr-vention von Armut verabschiedet. Das von 2014 bis 2018 dauernde Programm finanziert unter anderem Forschungsstudien zur Bedeutung der sozialen und beruf-lichen Eingliederung fr die Armutsverhinderung. Im Auftrag des Bundesamtes fr Sozialversicherungen (BSV) wird unter der Leitung des Instituts Beratung, Coaching und Sozialmanagement der Hochschule fr Soziale Arbeit FHNW ein Kooperationsprojekt mit der Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana und der Fernfachhochschule Schweiz zum Thema Erfolgsfaktoren von Sozialfirmen fr die Armutsverhinderung durchgefhrt. Unter Erfolg wird in die-sem Zusammenhang die gelungene Integration in den ersten Arbeitsmarkt durch Sozialfirmen verstanden, aber auch die soziale Integration sowie der Erhalt und die Verbesserung der Arbeitsfhigkeit durch unbefristete Arbeitsstellen in sozialen Unternehmen der Arbeitsintegration. Die Studie ist explorativ ausgerichtet. Sie hat zum Ziel, Erfolgsfaktoren auf betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und rechtlicher Ebene sowie aus der Sicht von erwerbsbenachteiligten Personen zu identifizieren. Die Analyse der Erfolgsfaktoren orientiert sich methodisch an der realistic evaluation.
Institut Beratung, Coaching und SozialmanagementForschungs- und Entwicklungsprojekte
AuftragBundesamt fr Sozialversicherungen (BSV)
FinanzierungBundesamt fr Sozialversicherungen (BSV)
KooperationScuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
ForschungsteamStefan Adam Prof.Domenico Ferrari (extern)Spartaco Greppi Prof. Dr. (extern)Daniela Schmitz Dr. (extern)Bernadette Wthrich lic. phil.Daniel Zbeli Prof. Dr. (extern)
Dauer01.11.2014 bis 31.12.2015
KontaktStefan Adam Prof.([email protected])
InstitutInstitut Beratung, Coaching und Sozialmanagement
FinanzierungFrderfonds HSA FHNWStiftung Suzanne und Hans Bisch zur Frderung der Angewandten Psychologie
ForschungsteamSarah Bestgen M.A.Filomena Sabatella (extern) Elisa Streuli (extern) Tobias Studer lic. phil.
Dauer01.10.2012 bis 28.02.2014
KontaktSarah Bestgen M.A.([email protected])
InstitutInstitut Beratung, Coaching und Sozialmanagement
Details zum Projekt: www.fhnw.ch/ppt/content/prj/T999-0607
Details zum Projekt: www.fhnw.ch/ppt/content/prj/s236-0015
-
Hochschule fr Soziale Arbeit
Institut Integration und PartizipationPortrt
Die Frderung von Integration und Partizipation von Menschen im Sinne der Teil-nahme und Teilhabe an gesellschaftlichen Gtern, Werten und Grundrechten und der Ermglichung eines selbstbestimmten Lebens stellt eine zentrale Zielsetzung der Sozialen Arbeit dar. Das Institut Integration und Partizipation IIP nimmt in Anlehnung an diese Zielsetzung sowohl Menschen in den Blick, deren Partizipation in unserer Gesellschaft in besonderer Weise prekr ist, als auch die Strukturen und Akteurinnen, Akteure in deren Umfeld.
In den thematischen Schwerpunkten Menschen im Kontext von Alter, Menschen im Kontext von Behinderung, Menschen im Kontext von Erwerbslosigkeit, Men-schen im Kontext von HIV und Menschen im Kontext von Migration untersucht das Institut soziale Benachteiligungen und gesellschaftliche Spaltungsprozesse, die zu Ausschluss und verminderter Partizipation fhren. Gleichzeitig werden Zu-sammenhnge und Bedingungen aufgezeigt, die problematische Lebenslagen zu vermeiden helfen und damit zur Erhaltung von Integration und Partizipation bei-tragen knnen. Auch in den Blick genommen wird das Handeln der Organisationen und der Professionellen der Sozialen Arbeit zur Bearbeitung dieser Lebenslagen im jeweiligen Kontext.
Forschung trgt massgeblich zur Erfllung des Leistungsauftrags und zum Profil des Instituts bei, indem Wissen zum Problem- und Ursachenzusammenhang als auch Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Interventionen der Sozialen Arbeit in den jeweiligen Praxisfeldern generiert werden. Mittels qualitativer und quantitativer Methoden werden Daten zu theoriegeleiteten und praxisbezogenen Forschungsfra-gen erhoben und ausgewertet und Ergebnisse dargestellt und kritisch diskutiert. Ausserdem evaluiert das Institut Massnahmen zur Frderung von Integration und Partizipation und vermittelt forschungsbezogene Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung.
Kontakt:Prof. Dr. Sibylle Niderst, InstitutsleiterinT +41 62 957 21 08, [email protected]/sozialearbeit/iip
Prof. Dr. Sibylle NiderstInstitutsleiterin
II. Forschungs- und Entwicklungsprojekte vom 1.1.2014 bis 31.12.2014 38 | 39
-
Hochschule fr Soziale Arbeit
AbstractMenschen mit schweren, mehrfachen Beeintrchtigungen sowie herausfordernden Verhaltensweisen stellen soziale Einrichtungen oft vor grosse Schwierigkeiten. Der Forschungsstand zur Thematik ist gering. Mit vorliegender Studie sollen Erkennt-nisse zur Entstehung von herausforderndem Verhalten in Institutionen, aber auch Hinweise zum Umgang damit und zu den Auswirkungen davon gewonnen werden.
Die Ergebnisse zeigen, dass fr die Entstehung von herausfordernden Verhaltens-weisen neben personenbezogenen Faktoren wie spezifische Beeintrchtigung und Biografie auch kontextbezogene Faktoren wie strukturelle Rahmenbedingun-gen oder Aspekte, welche Mitarbeitende in sozialen Institutionen gestalten kn-nen sehr relevant sind.
In Bezug auf den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen wird deutlich, dass neben bedrfnisorientierten, pdagogischen Massnahmen auch repressive Massnahmen umgesetzt werden. Letztere schrnken nicht nur den Handlungs- und Entwicklungsraum der Klientel ein, sondern verweisen zugleich auf eine stark per-sonenbezogene Sicht. Fr die Entstehung von herausfordernden Verhaltensweisen sind aber kontextbezogene Aspekte ebenso zentral. Daher mssen Interventionen auch kontextorientiert sein. Auswirkungen von herausfordernden Verhaltenswei-sen sind praktisch alle negativ assoziiert. Die zahlreich genannten physischen und psychischen Belastungen der Klientel und Mitarbeitenden verdeutlichen, wie sehr herausfordernde Verhaltensweisen alle Beteiligten beanspruchen.
Ausgangslage und ZielsetzungenDie Problematik der herausfordernden Verhaltensweisen im Sinne von fremd- und selbstverletzenden sowie sachaggressiven Verhaltensweisen von Menschen mit schweren, mehrfachen Beeintrchtigungen ist derzeit in der Praxis der Sozialen Arbeit hochaktuell. Verschiedene Institutionen haben das Thema aufgegriffen und Tagungen dazu organisiert. Diverse Praxisorganisationen nehmen Fachberatungen in Anspruch oder entwickeln spezifische Angebote. Dies zeigt auch, dass sowohl professionelle Begleitende als auch Leitende sozialer Institutionen und externe Beteiligte bei der Begleitung von Menschen mit herausfordernden Verhaltenswei-sen immer wieder stark gefordert sind. In der Praxis ist die Problematik somit grsstenteils erkannt, doch fehlt hufig das spezifische Fachwissen fr einen pro-fessionellen Umgang damit.
Auch erforscht wurde die Thematik bisher noch kaum. In der Schweiz besteht ein grosser Mangel an forschungsbasierten Erkenntnissen zu Menschen mit Beein-trchtigungen generell. Zu herausfordernden Verhaltensweisen von Menschen mit Beeintrchtigungen gibt es keine aktuellen Studien. Um dieses Forschungsdefizit anzugehen, wurde eine empirische Studie durchgefhrt.
Das Ziel des Projekts ist, einen Beitrag zur Verbesserung des Verstndnisses der Situation von Menschen mit schweren, mehrfachen Beeintrchtigungen sowie her- ausfordernden Verhaltensweisen zu leisten.
Institut Integration und Partizipation Erwachsene mit schweren, mehrfachen Beeintrchtigungen und herausfordernden Verhaltensweisen im Wohnbereich (HEVE)Eva Bschi und Stefania Calabrese
Prof. Dr. Eva BschiDozentin
II. Forschungs- und Entwicklungsprojekte vom 1.1.2014 bis 31.12.2014 40 | 41
Forschungsstand und FragestellungenGemss einer Studie aus dem englischsprachigen Raum weisen 20 bis 44 Prozent der Menschen mit kognitiver Beeintrchtigung Verhaltensaufflligkeiten auf (vgl. Doen/Day 2001: 6). Diese Angaben beziehen sich jedoch nur auf den englischspra-chigen Raum. Danach treten solche Verhaltensweisen vor allem bei schwereren Beeintrchtigungen auf und knnen bemerkenswert persistent sein. Diese Verhal-tensweisen sind multifaktoriell bedingt und hngen mit psychologischen, neuro-biologischen, neuropsychischen und soziokommunikativen Faktoren zusammen. Problematisch sei zudem, dass es bei Menschen mit Beeintrchtigungen schwer-falle, zwischen Verhaltensaufflligkeiten und psychischen Krankheiten zu unter-scheiden (vgl. ibid.).
Sarimski und Steinhausen (2008) stellen den aktuellen Forschungsstand im deutschsprachigen Raum in Bezug auf psychische Strungen und Beeintrchtigun-gen dar. Dabei fllt auf, dass nur wenige deutschsprachige Studien vorhanden sind. Die Autoren verweisen daher auf Forschungsergebnisse aus den USA, nach denen aggressive Verhaltensweisen durch positive oder negative soziale Verstrkungs-prozesse aufrechterhalten werden (Sarimski/Steinhausen 2008: 21). Dauerhafte Verhaltensnderungen knnen (zumindest bei Kindern) nur erreicht werden, wenn verhaltensreduzierende Konsequenzen kombiniert werden mit der systemati-schen Anleitung zu Verhaltensalternativen (), die das problematische Verhalten ersetzen knnen (ibid.). Wutanflle und fremdschdigende Verhaltensweisen sind dabei hufig eher Kontrollverluste [sind] als vorstzlich eingesetzte Verhaltens-muster (ibid.). Sie widerspiegeln vor allem bei schwer beeintrchtigten Kindern/Jugendlichen deren berforderung bezglich einer sozialen Anforderung und zeu-gen von der Schwierigkeit, Emotionen zu regulieren (vgl. ibid.).
Entgegen dieser stark individualpsychologisch geprgten Sichtweise zeigt Wllen-weber (2001), dass im deutschsprachigen Raum in den vergangenen Jahren Ver-haltensprobleme von geistig behinderten Menschen in erster Linie als Ausdruck bzw. Merkmal einer Hirnschdigung betrachtet worden sind (Wllenweber 2001: 105). Er betont, es bestehe die Gefahr einer Individualisierung der Problematik und der Umgang mit Verhaltensaufflligkeiten ist zu einer Schlsselproblematik der Behindertenhilfe geworden (ibid.: 106). Er kritisiert, dass Erklrungsanstze, die die augenblickliche Betreuungssituation und Lebenslage in den Mittelpunkt stel-len (), nur unzureichend bearbeitet worden seien (ibid.: 106 f.).
In der Schweiz ist der Forschungsstand mangelhaft. Es gab in den letzten Jahren keine systematischen Studien zur Thematik. Entsprechend gibt es auch keine An-gaben zur Prvalenz. Es kann einzig festgestellt werden, dass im Jahr 2012 insge-samt 25363 Personen mit einer Beeintrchtigung in einer der 551 bestehenden sozialen Institutionen