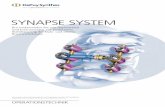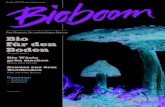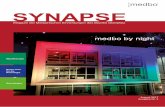Synapse 56
-
Upload
maximilian-batz -
Category
Documents
-
view
246 -
download
6
description
Transcript of Synapse 56

Nr. 56 • Oktober 2011
Zeitschrift der Medizinstudierenden Münchens

Synapse2 www.synapse-redaktion.de
ImpressumRedaktion
Andreas Albrecht, Louise Füeßl, Elena Kindsvater, Maximilian Batz, Ivo Straßer, Lena Sperl, Ste-phanie Zühlke, Nils Engel
Gastbeiträge
Carmen Astra, Martin Glauert, Christoph Kuhm, Marie Tzschaschel, Daniel Rudolph, Philipp Blüm, Sebastian Niedermayer
Herausgeber
Breite Liste Gesundheit Pettenkoferstraße 11 80336 München
Tel.: (089) 51 60 89 20 Fax: (089) 51 60 89 20
Bildnachweis
flickr.com, openclipart.com (u.a. Elliott Edwards, Studio-Hades, liftarn, newt), sxc.hu, Wikimedia Commons (u.a. Evan89, Jorge Barrios), eigene Werke.
Auflage: 3.500 Exemplare Druck: Druckerei Miller, Traunstein Satz: Dark Horse
Editorial
Wir haben für euch neben dem absolut genia-len1 Layout dieser Ausgabe – die Nächte haben sich definitiv gelohnt – gleich mehrere Über-raschungen vorbereitet: wir kommen ab dieser Ausgabe jetzt zweimal pro Jahr heraus.
Weiterhin in Farbe, und ab sofort mit Bonus-Features im Web. Jeder mag kostenlose Bonus-Features die funktionieren! Einfach den QR-Code (das pixelige Quadrat) mit dem Handy abfotografieren – und die richtige App voraus-gesetzt – landet man auf der richtigen Websei-
1 Der Affe der die Typographie macht muss gelobt werden, Bananen reichen mittlerweile nicht mehr.
te. Klingt kompliziert, aber nur weil wir's noch nicht gewöhnt sind – in ein paar Jahren werden die Leute sagen: „Diese Synapse hatte schon anno 2011 QR-Codes ... sehr progressiv!“
Die Redaktion hat sehr engagierten Zuwachs bekommen, die Last-Minute tatsächlich noch fast die Hälfte der Synapse mit auf die Beine gestellt haben. Da können sich manche alten Hasen bei uns eine Scheibe von abschneiden. Es soll doch tatsächlich Leute geben, die ihre Artikel noch in InDesign beim Layouten sch-reiben, tss tsss ...
Und – last but not least – kooperieren wir jetzt offiziell mit beiden Fachschaften: Die TU
hatte vorher längere Zeit eine eigene Zeitung, den Rückfall, die jetzt jedoch schon einige Zeit nicht mehr erschienen ist. Die Synapse wird diese Lücke füllen, wir freuen uns riesig auf unsere neuen RedakteurInnen von der TUM.
Ist das ein Grund zum Feiern? Nein – es sind gleich mehrere! Wir haben dieser Ausgabe ein Glas Sekt beigelegt. Falls du es nicht erhalten haben solltest, bitten wir um Beschwerde unter [email protected] damit wir der Sache auf den Grund gehen können. Hicks. Entschuldigung.
für die Redaktion
Inhalt
Editorial 02
Hypnose 03
Gefährliche Gedanken 04
Gamemaster 07
Es ist vorbei 08
Heilender Schimmel 09
MeCuM-Memo 12
Metakognition 14
Jimma 16
Unterwegs mit Manage & More 19
Schimpanse und Mensch 20
Modul 23 22
Beliebte Drogen 26
Neurobiologische Aspekte einer Annäherung an das Saxophon
28
That's hot 32
Brain Up! 34
Wie schaffe ich es ein glückliches und erfülltes Leben zu führen?
36
Streiks in Uniklinika 38
Gewinnspiel 40

Synapse 3www.synapse-redaktion.de
Editorial 02
Hypnose 03
Gefährliche Gedanken 04
Gamemaster 07
Es ist vorbei 08
Heilender Schimmel 09
MeCuM-Memo 12
Metakognition 14
Jimma 16
Unterwegs mit Manage & More 19
Schimpanse und Mensch 20
Modul 23 22
Beliebte Drogen 26
Neurobiologische Aspekte einer Annäherung an das Saxophon
28
That's hot 32
Brain Up! 34
Wie schaffe ich es ein glückliches und erfülltes Leben zu führen?
36
Streiks in Uniklinika 38
Gewinnspiel 40
Die Wirksamkeit von Hypnose ist wissen-schaftlich gut belegt. Mit Hilfe von MRT und EEG können klar hirnphysiologische Korrelate von Trance-Zuständen nachge-wiesen werden. Bereits wenige Hypnothe-rapie-Sitzungen können eine deutliche Ver-änderung bewirken. Sie kann beispielsweise zur Behandlung von Depression, zur Stei-gerund des Selbstwertgefühls, zum Stressab-bau, aber auch für die Schmerztherapie, und in der Geburtshilfe, eingesetzt werden. Der Einsatz der Hypnose zu therapeutischen Zwecken ist gesetzlich geregelt, und wird von den deutschen Krankenkassen aner-kannt.
Was ist Hypnose?
Im normalen Wachbewußtsein sind bei uns Filter aktiv, die bspw. die Aufforderung „Sie sind ein Hund, und sehen einen Einbre-cher. Bellen Sie um ihn zu verjagen“ als lächer-lich deklarieren. Mit Hilfe von diversen Tech-niken – gleich mehr dazu – werden bei einer Person Trance-Zustände verschiedener Tiefe eingeleitet. In der sog. hypnotischen Trance ist die hypnotisierte Person noch in der Lage sich willentlich zu bewegen, und zusammenhän-gende Worte von sich zu geben. Allerdings ist sowohl die Ansprechbarkeit des Unbewussten, als auch die Konzentration auf eine bestimm-te Sache stark erhöht, während die kritischen Filter stark herunterreguliert sind. Trance-Zu-stände können auch natürlich auftreten – Tag-träume, die Zeit kurz vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen, sowie das konzentrierte Lesen eines Buches oder Schauen eines Films sind Beispiele aus unserem Alltagsleben dafür.
In der Trance können Suggestionen gegeben werden („Sie sind entspannt in der Arbeit“), die auch post-hypnotisch wirksam sein kön-nen, es können frühe Erinnerungen abgerufen werden („An welchem Wochentag war Ihr 7. Geburtstag?"), es lassen sich vielfach sogar Babinski- und Moro-Reflex auslösen (je nach der Altersstufe auf die zugegriffen wird.).
Methoden
Nicht jeder Mensch ist gleich gut hypnotisier-bar. Etwa 10 % der Menschen sind sehr leicht zu hypnotisieren, während es bei etwa 5 % fast gar nicht möglich ist. Die innere Einstellung der zu hypnotisierenden Person – ob sie an die Methode glaubt, oder ihr eher skeptisch gegen-übersteht, ob sie positive Resultate erwartet, usw - der wichtigste Faktor. Es ist auch nicht
möglich, Suggestionen zu geben, die sich gegen den ethischen Code der Versuchsperson rich-ten.
Die Hypnose basiert im Kern auf Aufmerk-samkeitsabsorption bzw. Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine Sache. Das wird bei-spielsweise durch Anstarren eines Objektes, monotone Umweltgeräusche (z.B: tickende Uhren, Meeresrauschen, ...), aber auch durch rhytmische Musik, bestimmte Drogen und Tanz erreicht werden. Für die Induktion ist Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit erfor-derlich. Anschließend kann die Trance beliebig vertieft werden.
Die Hypnose wurde um 1770 von Franz An-ton Mesmer wiederentdeckt, der ihre Heilkräf-te jedoch Magneten zuschrieb, die er den Pa-tienten auflegte. Alfred Russel Wallace meinte mit Hilfe der Hypnose die Gallsche Schädel-karte (siehe Abbildung auf Seite 15) nachwei-sen zu können. Friedrich Engels, der mit Karl Marx die Grundlagen des Kommunismus legen sollte, hielt das jedoch für Humbug. Er konnte einem Jungen selbsterfundene „Gallsche“ Be-reiche suggerieren, die dieser dann unter Hyp-nose nacherlebte. Engels kam zu dem Schluss, dass der Glaube des Hypnotiseurs an die Schädelkarte die gewünschten Effekte beim Hypnotisieren eintreten läßt.
Echt oder Hokus-Pokus?
Bühnen-Hypnose benutzt oftmals eine Kom-bination aus psychologischen Faktoren, Fin-gerfertigkeit, und falschen Vorstellungen des
Publikums. Beispielsweise ist die berühmte kataleptische Brücke - bei der eine Person in einer scheinbar unmöglichen Position auf zwei Stuhllenen steif wie ein Brett liegt, und sich der Hypnotiseur sogar draufstel-len kann - ohne jegliche Hypnose für 1 - 2 Minuten für jeden aushaltbar.
Auf das „Medium“ wird auf der Bühne zudem eine riesige Erwartungshaltung vom Publikum aufgebaut. Gegen die Er-wartungen des Publikums anzugehen, und es dadurch zu enttäuschen, erfor-dert einiges an Mut. Beim Mit-Spielen wird man andererseits durch Klatschen belohnt, und hat eine gute Entschuldi-gung für „peinliches“ Verhalten - man war ja schließlich in Trance.
Trotzdem können spontane Trancezustände bei der Bühnenhypnose auftreten – und das manchmal mit negativer Wirkung. Deswegen ist die Bühnenhypnose in Schweden verboten.
Hypnose
john
y_au
tom
atic
// o
penc
lipar
t.org
QuickFactEinsteins Gehirn hatte ungewöhnlich große Temporallappen. Au-ßerdem fanden sich in seinen Parietallap-pen weniger Furchen als in Vergleichshirnen.
von Maximilian Batz
“Almost all people are hypnotics. The proper authori-ty saw to it that the proper belief should be induced, and the people believed properly.”
- Charles Fort

© mckenna71 // sxc.hu
www.synapse-redaktion.de
"Eine unbekannte Frau bedroht Sie mit einer Waffe. Was fühlen Sie?"
Der Elefant unter uns
Würde ein Elefant sich von dieser Frau ge-nauso bedroht fühlen? Würde sich ein Neu-geborenes auch von ihr bedroht fühlen? Der Elefant und das Neugeborene müssten dazu verstehen, dass von der Waffe eine Bedrohung ausgeht.
Was heißt es aber, dieses Verstehen? Die Waffe und die Frau, die sie hält, müssen zu-nächst wahrgenommen werden. Dann erfolgt eine Abfolge von Schritten im Kopf die aus diesem Bild Informationen extrahieren, und diese Informationen zu bereits gespeicherten Erfahrungen und Intentionen des Individuums in Bezug setzen.
Wow, das war ein Mund voll hochgestochener Wörter. Also, Schritt für Schritt:
Die Informationen fließen von der Retina zu verschiedenen Arealen im Gehirn, wo sie ver-arbeitet werden. Unser Großhirn ist aus 2 ½ Millionen sogenannter neokortikalen Säulen aufgebaut. Jede dieser Säulen enthält 60 000 Neuronen, ist ca. 2 mm hoch und hat einen Durchmesser von 0.5 mm. Wissenschaftler können bislang nur zwölf Neuronen – nicht Säulen – gleichzeitig beim Informationsaus-tausch beobachten, jedoch hat sich das Blue Brain Project das Ziel gesetzt bis 2023 unser Gehirn mit Hilfe von Computern nachzubau-en (siehe Kasten nächste Seite). Unser mo-mentanes Wissen über das Gehirn basiert also noch auf indirekten Hinweisen. Vermutet wird folgendes: die Säulen sind jeweils für unter-schiedliche Prozessschritte zuständig. Es gibt im visuellen Kortex beispielsweise Säulen die Kanten mit 40 ° Neigung wahrnehmen, solche die Kanten mit 50 ° Neigung wahrnehmen usw.
Säulen, Säulen, und Muster
Diese übergeben wiederum ihre Ergebnisse an weitere Säulen, die übergeordnete Schritte auf einer höheren Abstraktionsebene durchführen. Aus Kanten werden Muster („Pistole“), aus Mustern werden abstrakte Begriffe („Waffe“) und diese werden mit Emotionen verknüpft, die eine Handlungskette veranlassen. Diese Handlungskette entsteht zunächst auch als abstrakter Impuls („Flucht“), und wird durch viele Prozessschritte in tatsächliche Handlun-gen umgesetzt (Impulse an den motorischen Endplatten der Beine).
Mit Hilfe der Abstraktion und modularer Bauweise lassen sich sehr komplexe Systeme realisieren, auch wenn die einzelnen Schritte sehr einfach scheinen. Anschaulich kann man das vielleicht an dem System Krankenhaus erklären: ein Patient kommt mit „leichten“ Brustschmerzen in die Klinik. Die Famulantin, die den Patienten aufnimmt, informiert ihren Stationsarzt, dass sie einen Verdacht auf Myo-kardinfarkt hat – der Stationsarzt lässt seine
Synapse4
Gefährliche Gedankenvon Maximlian Batz

Synapse 5www.synapse-redaktion.de
Diktate liegen, und schaut sich den Patienten sofort selber an. Er schreibt ein EKG und lässt die Famulantin Blut abnehmen. Nach Rück-sprache mit den Kardiologen wird bei dem Patienten eine Akut-PTCA mit Stenteinlage durchgeführt. Der Patient kommt schließlich zurück auf die Station, wo ihm der Chefarzt bei seiner wöchentlichen Visite zu dem erfolg-reichen Eingriff gratuliert – der Chef hatte es kurz vorher von dem leitenden Oberarzt so übergeben bekommen.
Ist eine der Personen hier überflüssig, und könnten andere die Aufgaben übernehmen? Bis zu einem gewissen Grad ja, aber kompli-zierte Vorgänge, wie Herzkatheter schieben, erfordern viel Erfahrung und Fingerspitzenge-fühl, das man bspw. von der Famulantin noch nicht erwarten darf. Andere Mitarbeiter hin-ter den Kulissen sind noch gar nicht erwähnt worden - sogar wenn ein erfahrener Arzt alle Tätigkeiten durchführen könnte, würde er vor lauter Drumherum nicht dazu kommen Patien-ten zu behandeln. Daher gibt es verschiedene Berufsgruppen, mit eigenen Hierarchien, und Verantwortungsbereichen, und klar definierten Aufgaben und Kompetenzen.
Dadurch dass jeder Mitarbeiter des Kranken-hauses seine Aufgabe erledigt entsteht eine Behandlungs-Symphonie zum Wohl der Pati-enten.
Ähnlich kann man sich das Gehirn vorstellen: es gibt Teile die Informationen sammeln, es gibt Teile die ausführen (Motorik), und „Experten-systeme“, die helfen Entscheidungen zu fällen – bspw. ob der Gesichtsausdruck der Frau die uns gegenübersteht auf gefährliche Absichten schließen lässt, usw.
Unsere innere Karte
Die Informationen die aus den Sinneskanälen gewonnen werden helfen uns eine Vorstellung von der Umwelt aufzubauen, und daraus ein Modell oder eine Karte zu erstellen. Wir benö-tigen ein mentales Modell unserer Umwelt um sinnvoll mit ihr interagieren zu können. Was passiert wenn ich auf den roten Knopf drücke? Was wird passieren wenn die Frau den Ab-zug betätigt? Wird sie ihn betätigen wenn ich weglaufe? Die mentale Karte enthält ganz ent-scheidend auch Modelle der Denk- und Ent-scheidungsprozesse anderer Personen, sowie
ihres emotionalen Zustandes - die berühmten Spiegelneuronen.
Warum sollte man sich die Zeit nehmen, sich über diese Prozesse die größtenteils unbewußt ablaufen, Gedanken zu machen?
Missverständnisse zwischen Menschen fußen auf jeweils verschiedenen kognitiven Modellen der gleichen Situation. Sie haben sozusagen unterschiedliche Karten und können sich nicht auf den Weg einigen. Das Bewußtsein über die Relativität des eigenen Modells hilft, toleranter und offener für Korrekturen und Änderungen zu sein. Der andere wichtige Aspekt ist Leis-tungssteigerung und Differenzierung: unser Gehirn ist bspw. darauf angelegt, gefährliche Situationen sehr generalisiert zu speichern. Wenn wir hundert Mal vor einem Garten-schlauch erschrecken, und einmal vor einer giftigen Schlange, hat es sich sozusagen schon gelohnt. Der Preis dafür ist bei unserem Abs-traktionsgrad aber hoch – abstrakte Konzep-te wie die Pleite eines Staates wo gerne Ouzo getrunken und Sirtaki getanzt wird, kann uns durchaus reale psychosomatische Beschwer-den bereiten.
QuickFactDie Energie aller Neurone wäre ausreichend, ein Kühlschranklicht (15 W Glühlampe) zum Leuchten zu bringen.
openclipart.org
Das Blue Brain ProjectHeutzutage kann man sich ja schon einiges an Software aus dem Internet herunterladen. War-um also nicht in naher Zukunft auch digitalisier-te Gehirne bedeutender Persönlichkeiten, die einem in verschiedenen Situationen helfen?
Bspw. Einstein für die Physik-Klausur, Sigmund Freud für die Psychiatrie-Klausur, Casanova für Prüfungen anderer Art ...
Das Blue Brain Team möchte das Säugetier-Hirn bis auf die Molekularebene verstehen und nachbilden. Auf einem Supercomputer von IBM (Blue Gene) werden Neuronen so naturge-treu wie möglich nachgebildet und simuliert. In 2008 konnte eine einzelne neokortikale Säule nachgebaut werden, allerdings von einer Rat-te – diese haben nur 10.000 statt den 60.000 Neuronen menschlicher neokortikaler Säulen.
Die Simulation eines ganzen Rattengehirnes ist für 2014 geplant. Sie wird aus 100 „Mesocir-cuits“ mit jeweils 100 neokortikalen Säulen be-stehen, insgesamt also aus 100 Millionen Neu-ronen. Nicht nur das Blue Brain Team forscht an künstlichen Gehirnen: IBM hat auf einem Blue Gene/IP Superrechner mit 144 Terabyte RAM (hundert mal mehr als eine moderne Festplat-te!) passend zu den Rattengehirnen des Blue Brain Projects ein Katzenhirn simuliert.
Das virtuelle menschliche Gehirn soll gemäß Henry Markram, Direktor des Blue Brain Pro-
jects, 2023 möglich sein, und 1000 Rattenhir-nen entsprechen.
Erfahrungsgemäß dauern Software-Projekte jedoch immer doppelt so lange, als was man dafür veranschlägt, und realisieren nur die
Hälfte der geplanten Features. Ich erwarte also ein halbes künstliches Gehirn bis 2050. Vielleicht hilft das halbe Hirn den Forschern, sich fertigzustellen?
http://bluebrain.epfl.ch
© Argonne National Laboratory // flickr.com
Auf dem Blue Gene/IP Supercomputer konnte ein Katzenhirn simuliert werden - 100 mal langsamer

Synapse6 www.synapse-redaktion.de
Wieder der ElefantKommen wir nochmal auf den Elefanten zu-
rück: hat der Elefant Angst vor der Frau?
Die Antwort ist: es kommt darauf an. Hatte der Elefant bereits unangenehmen Kontakt mit gefährlichen Frauen, oder hat er gesehen, wie ein anderer Elefant durch eine Pistole zu Scha-den gekommen ist?
Wir gehen davon aus, dass Elefanten unterei-nander solche Konzepte nicht differenziert dis-kutieren können – bei unserem Kleinkind liegt die Situation aber anders. Sobald es etwas älter ist, kann man ihm die Gefährlichkeit bestimm-ter Dinge vermitteln, ohne dass es sie auspro-bieren muss: Wir glauben unseren Dozenten, dass Hepatitis C und HIV durch Blutkontakt übertragen werden, und ein solcher vermieden werden sollte. Ich denke, keiner von unseren Lesern möchte ernsthaft HIV am eigenen Leib ausprobieren, um daran „zu glauben“.
Es ist also offenkundig, dass wir unsere men-talen Modelle nicht nur durch eigene Erfah-rungen, sondern auch durch Erfahrungen anderer, mündlich oder schriftlich vermittelt kriegen können. Sowohl das Studium als auch dieser Synapse-Artikel sind offensichliche Bei-spiele dafür. Unsere Karten enthalten ziemlich viel Material, was von unseren Ahnen karto-grafiert wurde, ausgehend von den Karten (d.h. mentalen Modellen) und Möglichkeiten (bspw. Werkzeugen) die ihnen damals zur Verfügung stunden.
Einfache Modelle reichen ... manchmal
Newtons einfaches Weltbild1 hielt sich über 200 Jahre, bevor Einstein seine Relativitätsthe-orie entwickelte. Interessant und wichtig wer-den die Einsteinschen Gleichungen allerdings erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten – die wir im Alltag nicht erleben. Das einfache Newtonsche Modell reicht für die meisten Anwendungen. Wenn wir jedoch seltsame Lichterscheinungen an Doppelsternsystemen verstehen wollen ... dann sollten wir uns mit
1 Im Interesse unserer Leser und wegen der fortge-schrittenen Nachtstunde zu der dies geschrieben wird verzichte ich hier auf Formeln usw.
der Relativitätstheorie ausein-andersetzen.
Auch ich bin in die Falle all zu einfacher Modelle getappt. „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu.“ Ich bin davon ausgegangen, wenn ich andere Menschen anständig behandele, immer ihre Interessen mitberücksichtige, und ihnen meine Seele offenlege, wird dasselbe zurückkommen.
Nein, nein, nein. Nicht immer.
Das nennt man naiven Realismus – darin steckt implizit die Annahme drin, dass der an-dere genauso denkt wie ich, dass
1) wie ich ihn oder sie behandele gut für die-sen Menschen ist, weil es gut für mich wäre,
2) dieser Mensch genauso wie ich bei guter Behandlung sich in der Pflicht mir gegenüber fühlt,
3) dieser Mensch versteht was gut für mich ist.
Es ist beispielsweise unmöglich, es einem ech-ten Narzissten „recht“ zu machen. Denn der Narzisst bezieht sein Selbstwertgefühl aus der Erniedrigung anderer, und sieht deren Schwä-chen dementsprechend scharf fokussiert, und sowieso nicht in Relation zu ihren guten Sei-ten. (siehe Kasten)
Um also zu vermeiden, immer wieder gegen die Wand zu laufen, und sich eine selbstorga-nisierte Hölle nach dem Motto „ich tue doch alles richtig, warum sind die nur so böse zu mir?“ zu vermeiden, tut es gut, ab und zu in sich zu gehen, und zu überprüfen ob die Um-welt und die eigene geistige Karte gut genug übereinstimmen, damit es sich stressfrei leben lässt.
Falsches Modell, was tun?
Wenn man bei dieser Selbstanalyse entdeckt hat, dass die Fakten sich mit einem anderen Modell viel praktischer erklären lassen (bspw. nicht „ich bin nicht gut genug“, sondern „die-
ser Mensch stellt aufgrund einer Persönlich-keitsstörung überhöhte Ansprüche, die nicht erfüllbar sind") hat man schon viel gewonnen. Manchmal hilft eine solche blitzartige Er-kenntnis an sich die Frustration zu überwin-den, und eine vollkommen andere emotionale Einstellung zu der Situation zu gewinnen. Üb-licherweise wenn etwas passiert, was absolut inakzeptabel ist.
Manchmal klappt das aber nicht, und wir ge-ben den Glauben nicht auf, dass „alles doch noch gut werden könnte, wenn wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen“. Emotionen können sehr mächtig sein, und von der intel-lektuellen Einsicht losgekoppelt bleiben.
Dopamin wird ausgeschüttet, sobald eine Tä-tigkeit mit darauffolgender Belohnung ange-kündigt wird. Versuche haben ergeben, dass die höchsten Dopaminwerte – und damit einher-gehend die größten Anstrengungen – von dem Versuchsobjekt dann unternommen werden, wenn die Belohnung nicht sicher ist, sondern in nur ca. der Hälfte der Fälle erfolgt.
Gerade wenn es also um schwankende Ableh-nung – der Narzisst hat mal einen schlechten Tag, mal einen guten – geht, kommen wir nur schwer „davon“ los.
Dadurch dass wir uns diesen Prozess verge-genwärtigen, und bewußt wahrnehmen von was wir uns steuern lassen, haben wir eine Chance, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Eine dieser Gegenmaßnahmen könnte beispielswei-se das Aufsuchen eines Psychotherapeuten sein, oder zumindest für den Anfang das Gespräch mit einem/r guten FreundIn, die uns den Rü-cken stärken und eine ehrliche und unabhängi-ge Zweitmeinung zu der Situation bereitstellen kann. Das half mir am meisten von Menschen loszukommen die schlecht für mich waren. Liebe Freunde, danke dass es Euch gibt!
Bonus: Thema Gehirn
http://www.synapse-redaktion.de/56-gehirn
Bon
us
Infokasten NarzissmusNarzissmus ist benannt nach der Sage vom schönen griechischen Jüngling Narkissos, der sich – als Strafe für seinen Stolz – in sein eige-nes Spiegelbild im See verliebte. Er hatte zuvor alle Verehrerinnen und Vererehrer herzlos zu-rückgewiesen.
Der Begriff wird in der modernen Sprache sehr vielfältig genutzt, es schwingt jedoch immer erhöhte Selbstbezogenheit, Egoismus, Einbil-dung und Überhöhung, sowie eine übersteiger-tes Gefühl der eigenen Wichtigkeit für unseren kleinen blauen Planeten.
Einige Experten glauben, dass Narzissten na-turgemäß nach Machtstellungen streben, und
daher eine überdurchschnittliche Zahl von ih-nen in den einflussreichsten Bereichen der Ge-sellschaft zu Gange ist - Medizin (man denke an manche Chefärzte), Finanzen (skrupellose Spekulanten die ungenannt bleibende Staaten in den Ruin getrieben haben) und Politik (nahe-zu die meisten Diktatoren, bspw. Gaddafi).
Die Ursachen von Narzismus scheinen sowohl genetisch zu sein – es hat die höchste Korre-lation unter den Persönlichkeitsstörungen – als auch durch auslösende Faktoren innerhalb der Umwelt zu sein.
Narzissmus ist kein absoluter Zustand („vorhan-den / nicht vorhanden“), sondern ein Kontinuum, ein gewisses Maß von Narzissmus mag sogar für den einzelnen und die Gesellschaft förderlich sein.
Ben
czúr
Gyu
la -
Nar
ciss
us

Synapse 7www.synapse-redaktion.de
Er war am nächsten Tag einfach da. Mitten auf dem Marktplatz, direkt vor dem Rathaus, dessen grüne Fensterläden nun schon wie-der gestrichen wurden (die Lieblingsfarbe des Bürgermeisters war grün), also mitten auf dem Marktplatz stand übr Nacht nun ein Obelisk aus solidem Metall. Welches, das konnte selbst der Bürgermeister, der schließlich ein Diplom hatte, nicht bestimmen.
Was noch wichtiger war, die Frage, wie der Pfeiler auf den Marktplatz gekommen war, konnte auch keiner zur allgemeinen Zufrie-denheit lösen. Er war schließlich zehn Meter hoch und dicker als ein Baumstamm. Seine Oberfläche war volkommen glatt und glänzte leicht an der Sonne, was den Bürgermeister dazu gebracht hatte, zu verkünden, dass der Obelisk aus Metall bestünde.
Am Tag zuvor hatte er selbst genau an diesem Ort gestanden um die Anstreicharbeiten per-sönlich zu überwachen, daran konnte er sich noch genau erinnern. Nachts hatte kein Hund angeschlagen, es waren keine Spuren auf dem das Rathaus umgebenden Rasen, dessen Mitte nun jetzt der Pfeiler "zierte", sogar der Bürger-meister mit seinem leichten Schlaf hatte eine ruhige Nacht hinter sich gebracht - fast zu ru-hig, wie er sich jetzt eingestand.
Er beschloß, für zwölf Uhr eine Bürgerver-sammlung anzusetzen - es musste schließlich
entschieden werden, was mit dem Ding passie-ren sollte.
Zufrieden schaute der Bürgermeister in die Runde. Der Rat war vollzählig eingetroffen. Er strich sich über den sorgfältig gepflegten Bart und glättete eine Falte auf seinem grünen Anzug. Er trank einen Schluck aus dem Glas das auf dem grünen Podest stand und hub an zu sprechen, als ihn ein Gedanke mit voller Wucht traf.
Es war wie - ein Blitz, der in seine Nerven-bahnen eingeschlagen hatte, wie eine Nuklear-explosion in seinem Kopf (gebildete Leute wie der Bürgermeister hatten mehr Vergleichsmög-lichkeiten), oder wie Tante Emmas Kuchen. Er schüttelte seinen Kopf, um den Regenbogen, den er für eine Sinnesillusion hielt, aus sei-nen Augen zu jagen. Der Gedanke aber, den er empfangen hatte - anders konnte das gar nicht passiert sein, auf so etwas Absurdes wäre ein studierter Mann wie er nie gekommen, be-gann in seinem Kopf zu vibrieren, bis er fühlen konnte, wie sein Gehirn sich innerlich wand. Vorsichtshalber berührte der Bürgermeister seine Stirn, um auf Nummer sicher zu gehen - es hatten sich kleine, kalte Schweißtropfen gebildet. Nun ließ er seinen Blick über die ihm anvertrauten Bürger gleiten - alle schie-nen schockiert, mitgenommen zu sein. Einige waren scheinbar sogar dem Weinen nahe. Das konnte er in der Welt die er selbst geschaffen
hatte nicht zulassen. Alles das Werk dieses Metallungeheuers! Der Bürgermeister hatte Schwierigkeiten zu denken, denn der ihm auf-gezwungene Gedanke begann immer stärker zu werden und alles andere zu unterdrücken.
Er nahm noch einen Schluck von der klaren Flüssigkeit. Seine Hände zitterten, er stiess das Glass um, beobachtete dann wie in Zeitlupe, wie das Glas auf dem Boden zerschellte und die einzelnen Splitter wegflogen, während das Podest von den Spritzern durchnässt wurde.
Der Schweiss floss nun schon in Strömen von seinen Schläfen. Er versuchte sich zu konzent-rieren. Das Ding musste weg. Es musste ... weg ... musste ... weg.
Er brach zusammen, um nach einem kurzen Moment der Bewusstlosigkeit seine Bürger in einem ähnlichen Zustand zu sehen. Der Re-genbogen war immer noch da. Er robbte auf dem grünen Teppichboden, um die Glasscher-ben herum, zum Telefon. Alles begann ihm größte Schmerzen zu bereiten, aber er wollte den Gedanken immer noch nicht akzeptieren, konnte nicht, durfte nicht. Er setzte seine letzte Willenskraft ein, und wählte.
Dann wurde ihm schwarz vor Augen.
Ich stehe in der Schlange vor der Kasse, als mir eine scharfe Blondine die etwas weiter hinten steht, freundlich zuwinkt und mich anlächelt.
Ich kann es nicht fassen, dass so ein Blickfang mir zuwinkt. Ob-wohl sie mir irgendwie bekannt vorkommt, kann ich dennoch nicht sagen von wo ich sie kenne.
Dennoch frage ich sie: „Ent-schuldigung, kennen wir uns?“Sie erwidert: „Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke sie müss-ten der Vater einer meiner Kin-
der sein!“Ich erinnere mich zurück an das aller einzige mal als ich untreu war..„Um Gottes Willen! Bist Du die-se Stripperin, die ich an meinem Polterabend auf dem Tischfuss-balltisch vor den Augen mei-ner Kumpel genommen habe, während Deine Kollegin mich mit nasser Sellerie auspeitschte und mir eine Gurke in den A... schob?“
„Nein“ erwidert sie kalt. „Ich bin die Klassenlehrerin von ih-rem Sohn.“
Fritzchen kommt in die Küche zu seinen Eltern und sagt: „Ihr habt mich immer belogen." Sein Vater antwortet: "Aber Fritzchen wie haben wir dich denn belogen?" Meint Fritzchen: "Ihr habt immer gesagt der Osterhase bringt an Ostern di e Geschenke, aber den gibt es nicht. Ich habe die Osternester im Keller gefunden. Ihr habt auch im
mer gesagt der Nikolaus bringt in seinem Sack Süßigkeiten, aber den gibt es auch nicht. Ich habe den Mantel, den Bart und den Sack auf dem Dachboden gefunden. Und ihr habt mir gesagt ich wurde vom Klapperstorch gebracht, aber ich weiß genau d
en g
ibt e
s au
ch n
icht.
Denn
ich
weiß
nun
: Ich
wur
de g
eboh
ren!
Und
die
sen
Bohr
er fi
nde
ich a
uch
noch
!"
johny
_auto
matic
open
clipa
rt.org
Studio-Hades openclipart.org
Gamemaster

© s
rbich
ara
/ sxc
.hu
Synapse8 www.synapse-redaktion.de
Es ist vorbeiPost - Physikum - Impressionen
Es ist vorbei.
Das Physikum liegt hinter mir. Das realisiere ich allerdings nur stückchenweise.
Das Wieder-Einsortieren meiner Bücher ins Regal, das in den letzten Monaten fast leer stand während sich die Bücher auf dem Tisch türmten, ist ein solcher Moment, der mich die Aufregung, Unsicherheiten und Ärgernisse vor, während und nach den Prüfungen vergessen lässt.
Lernen, Wiederholen und Kreuzen
Ein halbes Jahr lang bestand mein Alltag aus Vorlesungen, Seminaren - danach und dazwi-schen Lernen, Wiederholen, Fakten vernetzen, Lernstoff mit Kommilitonen durchsprechen. Ach ja und: kreuzen. Kreuzen derart, dass schließlich sogar mein rechter M. lumbricalis I - die Anatomie sitzt auch nach bestandenen Prüfungen noch - vor lauter „examen online“ Antwort-Anklicken begonnen hat, zu allen passenden und unpassenden Gelegenheiten zu zucken.
Im Laufe dieser schier nicht enden wollen-den Episode meines vorklinischen Studen-tendaseins haben sich einige Gedankengänge geformt und verfestigt, die es im Folgenden mitzuteilen gilt.
Erkenntnisse
Erste Erkenntnis einer Physi-kums-Erprobten: Ja, es stimmt, das Physikum mitsamt der
Vorbereitung ist kein Spazier-gang, aber es ist tatsächlich mög-
lich - entgegen allen kursierenden Horrorgeschichten - auch ohne das Quäntchen Glück zu be-stehen - und ich bin mir ziemlich si-cher, dass ich dieses in
der Mündlichen nicht hatte. Vermutlich schafft man es sogar
mit einer Vorbereitung von nur gut einem Monat, aber diese Erkenntnis steht
angesichts der noch laufenden mündlichen Prüfungen und des noch nicht vorliegenden IMPP-Ergebnisses zum Zeitpunkt der Arti-
kelentstehung aus1.
Erstens-einhalb: Es hängt definitiv vom viel zitierten Lerntyp ab, wann man beginnt, die Bücher mit aller Konsequenz aufzuschla-gen - der Druckmotivations-Lerner tut dies erfahrungsgemäß erst fünf vor zwölf, wenn der durchgeplante Weiterdenker mit außeruniver-sitärem Engagement schon dabei ist, die Wie-derholung des Stoffs abzuschließen.
Zweitens: Unbestritten ist die Versuchung vorhanden, sich von Kommilitonen oder dem
1 Last-Minute-Update: Die Prüfung ist bestanden worden, die Redaktion darf gratulieren!
Berg an Lernstoff bereits weit vor den Prüfun-gen verrückt machen zu lassen. Das sollte man möglichst vermeiden - es ist weder zielführend, noch hilft übertriebener Aktionismus zwangs-läufig weiter. Übrigens: die Prä-Physikum-Pa-nikattacken mit Häufung gegen Mitte August stellen sich früh genug ein - stattdessen kann man in den Seminaren das nötige Selbstbe-wusstsein tanken und entweder durch aktive Beteiligung oder innerliches „Ha, ich wusste die Antwort mindestens genauso gut!“ auf-trumpfen.
Drittens: Es ist wichtig, Pläne zu schmie-den - sowohl für „währenddessen“ als auch für „danach“. Einerseits schöpft man während der teils frustrierenden Lernzeit (gerade zu Be-ginn, wenn der Lernberg bei jedem Sinnieren über selbigen noch mächtiger wird) Motivati-on an lernfreien Tagen, andererseits sieht man ein Licht am Ende des Tunnels, auf das man hinarbeiten kann - sei es eine weite Reise; der Plan, zwei Wochen nach bestandenem Ex-amen nicht mehr vom Sofa aufzustehen und fernzusehen bis die Augen schmerzen; endlich wieder einmal ohne schlechtes Gewissen sich seinen Hobbies zu widmen; nach Hause zu fahren; soziale Kontakte, die mitunter in der Lernzeit sehr in Mitleidenschaft geraten, wie-der zu pflegen; ... oder man beginnt eine Famu-latur, was ein L-Kurs-Dozent uns empfohlen hat und - zur Beruhigung der Leserschaft - üb-rigens nicht mein Plan ist.
Was bleibt
Was mir vom Physikum bleibt, sind verschie-dene Eindrücke und Gefühle. Zum einen ein klein bisschen Fassungslosigkeit, wie schnell die letzten zwei Studienjahre vergangen sind, denn ich erinnere mich noch an das erste Se-mester, als das Physikum noch unfassbar weit
weg und die Testate in Anatomie es waren, die uns allen im Na-cken saßen. Zum anderen auch das Gefühl, von nun an nach der Prüfung der Prüfungen in der
Vorklinik jeder kommenden standhalten zu können - was sich in der Zukunft herausstellen wird. Die verlockende Hoffnung, das jetzt in der Klinik alles besser wird - obwohl ich die Vorklinik, die zwar anstrengend, aber auch sehr lehr- und erkenntnisreich war, keinesfalls missen möchte. Ein Gefühl der Befreiung, eine große Hürde eines jeden Medizinstudenten übersprungen zu haben. Und der Gedanke, ob es wohl vor dem Hammerexamen genau-so schlimm wird? - Aber bis dahin habe ich ja zum Glück noch etwas Zeit!
von Stephanie Zühlke
Das Physikum ist kein Spaziergang

Flemings Arbeitsplatz mit Mikroskop und Petrischalen aus Blech
© Martin Glauert
Synapse 9www.synapse-redaktion.de
Das St. Mary’s Hospital in London ist fast ein kleiner Stadtteil für sich. Vom Haupteingang aus führen zahlreiche Straßen zu den einzel-nen Kliniken und Gebäuden, die sich im Laufe der Jahrzehnte unaufhaltsam vermehrt haben. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, ohne die vielen Wegweiser könnte man sich auf dem Gelände glatt verlaufen. Das ursprüngli-che Hauptgebäude der Klinik liegt direkt an der belebten Hauptstraße, auf der ein unabläs-siger Strom von Autos, Bussen, Lastwagen und Taxis vorbei fließt. Das ehrwürdige Gebäude aus roten Ziegeln ist mit liebevollem Stuck aus Sandstein verziert. Eine breite Steintreppe führt zur schweren Eingangstür. Dahinter wird es schlagartig ruhig, lediglich eine Flügeltür aus Holz quietscht in den Angeln. Die Gänge sind still und leer. Das Haus wirkt, als sei es im Dornröschenschlaf versunken.
Und tatsächlich ist der einzige anwesende Mensch ein junger Gehilfe, der auf einer Bank im Flur direkt neben seinem Wäschewagen eingeschlafen ist. Am Ende des Ganges führt eine steinerne Wendeltreppe durch ein enges Treppenhaus in die oberen Etagen. Durch eine schmale Holztür tritt man in ein kleines Labor. Die drei Fenster sind lange nicht geputzt wor-den, vom Staub der Stadt sind sie fast blind, das Sonnenlicht fällt nur gedämpft herein. Das
Zimmer geht nach Süden, auch ohne Heizung ist es warm hier drin. Unten auf der Straße sieht man den Verkehr, dessen Lärm nur noch leise herauf klingt. Auf den hölzernen Arbeits-tischen an den Fenstern stehen zwei alte Licht-mikroskope und einige kleine Regale mit Re-agenzgläsern. Dazwischen liegen stapelweise Petrischalen und alte Zeitungen. Neben dem Mikroskop ist ein Botanikbuch aufgeschlagen, zu sehen ist die feine Zeichnung eines Schim-melpilzes. In diesem kleinen Raum ereignete sich vor 83 Jahren etwas, das die Welt verän-dert hat.
Die historische Sekunde
Der 3. September 1928 ist ein typischer Mon-tag. Irgendwann gehen auch sechs Wochen Sommerferien zu Ende, und am ersten Arbeits-tag heißt es: Labor aufräumen. Die Mikrosko-pe werden entstaubt, die Petrischalen mit den Nährböden für die Bakterienkulturen kontrol-liert. Nach so langer Zeit sind sie häufig verun-reinigt und dann nicht mehr brauchbar. Ale-xander Fleming tauscht Ferienanekdoten mit seinem Arbeitskollegen Dr. Hayden aus, der seit einer Kinderlähmung im Rollstuhl sitzt. Die Petrischalen sind aus Blech und schep-pern, wenn sie in den Abfallkorb fallen. Wieder ist eine Bakterienkultur verschmutzt. Fleming
will sie gerade wegwerfen, da stutzt er. Diese eine zögerliche Sekunde wird die Welt ver-ändern. Auf dem Nährboden wachsen Strep-tokokken, durch Zufall hat sich ein Schim-melpilz direkt daneben angesiedelt. Um den Pilz herum aber sind die Bakterienkolonien abgeblasst und teilweise ganz verschwunden. Ein ärgerlicher Betriebsunfall, doch Fleming erkennt auf einen Blick die ungeheure Bedeu-tung: der Pilz hat die Bakterien besiegt! Was keinem Forscher bisher gelang, schafft ausge-rechnet dieser ungeliebte Schädling. Den Rest seines Lebens wird Fleming darauf verwenden, ihm auf die Spur zu kommen. Wer ist dieser Mann mit den großen ernsten Augen, dem bis auf den heutigen Tag unzählige Menschen ihr Leben zu verdanken haben?
Ein glücklich verhinderter Chirurg
Alexander Fleming wurde am 6. August 1881 im schottischen Lochfield geboren. Mit 13 Jah-ren verließ der Bauernsohn sein Heimatdorf und zog zu seinem älteren Bruder nach Lon-don. Dort schlug er sich zunächst als Versand-arbeiter bei einer Schiffgesellschaft durch, ein Job, den er hasste. Die Erbschaft eines Onkels ermöglichte ihm unverhofft, Medizin zu stu-dieren. 1901 schrieb er sich in der St. Mary‘s Hospital Medical School ein.
Heilender SchimmelDie Entdeckung des Penicillins
von Martin Glauert

Synapse10 www.synapse-redaktion.de
Man sagt, dass er gerade dieses Krankenhaus auswählte, weil es eine besonders gute Wasser-polomannschaft hatte, denn Fleming war ein begeisterter Sportler. Allerdings muss er auch in seinem Fach fleißig gewesen sein, denn 1908 erhielt er die Goldmedaille der Universität von London als bester Medizinstudent seines Jahr-gangs. Eigentlich wollte er Chirurg werden, da aber keine Stelle frei war, nahm er einen Job in der Impfabteilung an. Aus der Wartestelle wurde eine Lebensstellung. Die Arbeit dort ge-fiel ihm so sehr, dass er beschloss, Bakteriologe zu werden. Es ist ein ironischer Spielzug des Schicksals, dass letztendlich die Entdeckung des Penicillins der Chirurgie mehr half, als der beste Meister seines Faches es vermocht hätte.
Tränen gegen Bakterien
Die Jahrhundertwende ist das große Zeitalter der Bakteriologie. Louis Pasteur und Robert Koch konnten beweisen, dass die gefürchte-ten Krankheiten und die schlimmsten Seu-chen der Zeit durch Bakterien hervorgerufen wurden. Ihre Gestalt ist bekannt, sie tragen eindrucksvolle Namen, aber es gibt kein Ge-genmittel. Im Winter des Jahres 1921 hatte Alexander Fleming wie Tausende Londoner einen Schnupfen. Während der Arbeit tropfte es aus seiner Nase und fiel in die Petrischale auf dem Arbeitstisch. Fleming beobachtete, dass sich die Bakterien daraufhin auflösten. Seine Untersuchungen zeigten, dass sich im Nasensekret und mehr noch in der Tränenflüs-sigkeit Stoffe befanden, die Bakterien abtöten konnten. Lysozym nannte er diese geheimnis-volle Verbindung, das erste menschliche Enzym mit antibakterieller Wirkung. Für seine Versuche brauch-te er jede Menge Tränen, und damit kamen schwe-re Zeiten auf seine Mit-arbeiter zu. Die nämlich mussten sich Zitronenscheiben in die Augen klemmen, damit die Tränen reichlich flossen. Die seltsamen Versuche des Dr. Fleming wur-den zum Gesprächsstoff in der ganzen Stadt, Zeitungskarikaturen zeigten Schulkinder, die übers Knie gelegt und verprügelt werden, während ihre Tränen mit Trichtern in Kanister
abgefüllt werden. Leider blieben alle diese Mü-hen ohne Erfolg, die Lysozyme zerstörten nur harmlose Bakterien, während die gefährlichen Streptokokken davon unbeeindruckt blieben. Das ändert sich erst an jenem Septembertag des Jahres 1928, als Fleming auf den wunder-samen Schimmelpilz stößt, und nun forscht er ruhelos. Er blättert Bücher, befragt Botaniker und findet heraus, dass es sich bei seinem Pilz um Peni-cillum nota-tum handelt. Den Wirk-stoff, der im Schimmelsaft existieren muss, nennt er deshalb von nun an Penicillin. Versuche zeigen, dass dieser machtvolle Pilz, der unter dem Mikroskop aussieht wie ein Blumenstrauß, für Menschen un-schädlich ist. Der Mitarbeiter Stuart Craddock verzehrt eine Probe des Schimmelpilzes und befindet, dass er wie Stilton Käse schmeckt. Er versucht, damit seine Nebenhöhlenentzün-dung zu kurieren, hat aber keinen Erfolg. Nach einigen erfolglosen Behandlungsversuchen wird es wieder still um Flemings Entdeckung. Es gelingt einfach nicht, den Wirkstoff zu ana-lysieren und zu isolieren.
Bettpfannen und Badewannen
Ernst Chain ist ein deutscher Biochemiker, der 1933 am Anfang einer hoffnungsvollen Karriere steht. Seit Abschluss seines Studiums
arbeitet er an Deutsch-lands berühmtestem Kran-kenhaus, der Berliner Charité. Als Hitler an die Macht kommt, ist ihm klar, dass er als Halbrusse und Jude mit linken politischen Ansichten in diesem Land
keine Zukunft hat. Er flieht vor den National-sozialisten nach England und bekommt eine Stelle als Chemiker an der Universität Oxford. Zehn Jahre nach Flemings Entdeckung macht sich sein Team nun daran, den erstaunlichen Schimmelsaft systematisch zu erforschen. England ist im Krieg, die allgemeine Mangel-
versorgung führt zu abenteuerlichen Arbeits-bedingungen. Zur Laborausrüstung gehören Milchkannen, Bettpfannen und Badewannen. Falls es zu einer Invasion durch die Deutschen kommen sollte, planen die Forscher, Proben des Schimmelpilzes auf die Innenseite ihrer Jacken zu schmieren und damit nach Nord-amerika zu entkommen. Unter diesen widrigen Umständen gelingt es Ernst Chain, das Peni-cillin zu isolieren, zu reinigen und zu einem
wirksamen Medikament zu verarbeiten.
Hoffnung und Scheitern
Am 12. Februar 1941 ist es schließlich soweit:
der neue Wirkstoff wird zum ersten Mal an einem Patienten ausprobiert. Albert
Alexander, ein 43 Jahre alter Polizist aus Oxford, hatte sich
bei der Gartenarbeit an einem Rosenstrauch verletzt. Die scheinbar harmlose Wunde ent-zündete sich, dann breitete sich die Infektion im gesamten Körper aus. Alexander verlor ein Auge und es war nur eine Frage der Zeit, bis er an der Blutvergiftung sterben würde. In die-ser aussichtslosen Situation erhält er als erster Mensch Penicillin gespritzt, und wie durch ein Wunder bessert sich sein Zustand. Innerhalb von 24 Stunden sinkt das Fieber, sein Appetit kehrt zurück und die Infektion scheint über-wunden. Dann aber geht der Vorrat an vor-handenem Penicillin zur Neige. Eine Zeit lang kann man einen Teil aus dem Urin des Pati-enten zurückgewinnen und erneut injizieren. Bald jedoch ist die Aktivität des Wirkstoffs erschöpft und Albert Alexander stirbt. Unter diesem Eindruck wählt man für den zweiten Behandlungsversuch bewusst ein Kleinkind, weil es wesentlich kleinere Dosen des neuen Wirkstoffs benötigt. Die alten Filmaufnahmen von damals sind schwarzweiß, sie sind wacke-lig und haben jede Menge Kratzer. Dennoch ist deutlich zu erkennen, dass dieses Kind eine ausgedehnte Entzündung hinter den Augen hat. Die gesamte Augenhöhle ist dick ange-schwollen, das Kind ist todgeweiht, die ver-zweifelten Eltern willigen in den Versuch ein. Auch diesmal tritt eine eindrucksvolle Besse-
Für seine Versuche brauchte er jede Menge Tränen, und damit kamen schwere Zeiten auf seine
Mitarbeiter zu
Struktur von Penicillin G,
das aus Penicillum notatum isoliert wurde
Das Museum wurde 1993 in dem Labor einge-richtet, in dem Fleming jahrelang arbeitete und auch das Penicillin entdeckte.
Die originale Ausstattung ist dort nahezu unbe-rührt zu sehen. In Nebenräumen kann man alte Filmaufnahmen ansehen. Zahlreiche Ausstel-lungsstücke, Briefe und Plakate drehen sich um die Entdeckung des Penicillins und beleuchten die Wirkung, die diese Entdeckung auf die Ge-sellschaft bis heute ausübt.
Geleitet wird das Museum von dem Medizinhis-toriker Kevin Brown, der auch selbst Besucher durch die Räume führt und lebendig zu erzäh-len weiß.
Kontakt & Informationen
Alexander Fleming Laboratory Museum St. Mary’s Hospital,
Praed Street, Paddington, London W2 INY
Telefon 020-7886-6528 oder 020-3312-6528
E-Mail [email protected]
Geöffnet Montag bis Donnerstag, 10 – 13 Uhr
Eintritt Erwachsene 2,00 Pfund Kinder & ermäßigt 1,00 Pfund
Anfahrt Underground Station Paddington Buslinien 7, 15, 27, 36
Altes Hauptgebäude des St. Mary’s Hospital
© Martin Glauert
Alexander Fleming Laboratory Museum

Synapse 11www.synapse-redaktion.de
rung ein, die Schwellung bildet sich zurück, der kleine Patient erholt sich. Dann aber bricht die Entzündung ins Gehirn ein, es kommt zu einer Hirnblutung, an der das Kind stirbt. Wie man heute weiß, war die Anreicherung des Penicil-lins in den ersten Jahren nur unvollständig, die verwendeten Medikamente hatten gegenüber heute nur einen etwa zehnprozentigen Penicil-lingehalt. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass manche Behandlungen nicht erfolgreich waren. Dennoch bedeutete es eine medizini-sche Revolution. Bis dahin konnte man gegen bakterielle Infektionen fast nichts unternehmen. Eine Lungenentzündung oder Hirnhautentzündung en-dete häufig tödlich. Kleins-te Verletzungen führten nicht selten zu einer Blut-vergiftung. Ein Viertel aller chirurgischen Pa-tienten starben regelmäßig an postoperativen Infektionen. Das gefürchtete Kindbettfieber verlief nahezu immer tödlich.
Von der Kriegswaffe...
Es sollten aber noch einige Jahre vergehen, bis solche Krankheiten mit Penicillin geheilt wurden. Denn zunächst wurde der neue Wirk-stoff auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs eingesetzt, da Winston Churchill frühzeitig seine militärische Bedeutung er-kannt hatte. Für die militärische Kampfkraft erwies sich das Medikament als ebenso wichtig wie die Munitionsvorräte. Alte Filmaufnahmen zeigen, dass das Penicillin direkt in die infi-zierten Wunden gespritzt wurde. Wesentlich undramatischer, aber umso häufiger wurde das Penicillin allerdings zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten der Soldaten einge-setzt. Erst nach dem Krieg stand das Penicillin auch für die Zivilbevölkerung zur Verfügung. Die geheimnisvolle Wunderkur, bisher für den Normalverbraucher unerreichbar, zog nun die Aufmerksamkeit auf sich. Man verband mit ihr höchste Erwartungen und die Hoffnung auf eine neue, bessere Zukunft nach den düsteren Jahren des Krieges. Es entstand eine regelrech-te Euphorie, die sich bis zum modischen Irr-sinn steigerte. Bald schon fand das Penicillin seinen Platz im täglichen Leben, wie auf bun-ten Werbeplakaten der Fünfzigerjahre zusehen ist. Die Zahnpasta wurde damit versetzt, ein Lippenstift mit Penicillin sollte den perfekt hygienischen Kuss garantieren. Die Kehrsei-te dieses maßlosen und auch von den Ärzten praktizierten unkritischen Einsatzes von Peni-cillin zeigte sich erst Jahre später. Es kam zur Ausbildung von Resistenzen, die diese neue Waffe im Kampf gegen Krankheiten stumpf machte. In einem ständigen Wettlauf mussten
immer neue Wirkstoffe entwickelt werden, um Infektionen zu heilen.
… zum Lifestyle-Kult
Alexander Fleming wandte nur ein einzi-ges Mal Penicillin bei sich selbst an, als er im letzten Lebensjahr an Lungenentzündung er-krankte. Während der gesamten Arbeitsjahre inmitten von Bakterienkulturen hatte er sich nie mit Keimen angesteckt. Die Entdeckung des Penicillins brachte Fleming weltweiten
Ruhm ein. Er wurde mit Ehrungen überhäuft und von der Königin zum Rit-ter geschlagen. Der Hö-hepunkt war der Nobel-preis für Medizin, den er 1945 gemeinsam mit Ernst
Chain und dem Pathologen Howard Florey für die Entdeckung und Entwicklung des Penicil-lins zuerkannt bekam. Fleming, der Zeit seines Lebens ein leidenschaftlicher Raucher war, starb am 11. März 1955 an einem Herzanfall. Seine Asche ist in der Krypta der Sankt Pauls Kathedrale in London begraben. Nicht weit von der Klinik entfernt, in der Fleming seine weltbewegende Entdeckung machte, steht die St. James‘ Church. Ein Kirchenfenster zeigt Alexander Fleming im weißen Kittel, wie er in seinem Labor eine Petrischale gegen das Licht hält.
Ein Viertel aller chirurgischen Pati-enten starben [bis dahin] regelmä-ßig an postoperativen Infektionen.
Zeitungsartikel über Penicillin im Kriegseinsatz
Die Entdeckung des Penicillins als Comic
Kirchenfenster der St. James‘ Church in Paddington
Über den AutorMartin Glauert hat Theologie und Medizin stu-diert. Er hat sich in einer Gemeinschaftspraxis im Landkreis Kassel als hausärztlicher Internist niedergelassen.
Daneben ist er journalistisch tätig, mit den Schwerpunkten Reise und Medizingeschichte.
Wir danken ihm für die freundliche Genehmi-gung, "Heilender Schimmel" nachdrucken zu dürfen, und die Bereitstellung des Bildmaterials.
QuickFactDas Gehirn hat die Konsistenz einer reifen Avocado.
"avocado": pipo // openclipart.org

Synapse12 www.synapse-redaktion.de
Seit nunmehr einem Jahr gibt es sie – digitale Lernkarten direkt von Studenten für Studen-ten. Was im kleinen Kreis begann ist in der Zwischenzeit gewachsen und wir freuen uns euch zum Wintersemester ein komplett über-arbeitetes digitales Lernsystem präsentieren zu können.
Mit Lernkarten hat sicherlich schon jeder von uns mal gelernt oder aber versucht sich wichtige Dinge zu merken. Auf diesen kon-ventionellen Lernkarten baut MeCuM-Memo auf, allerdings in digitaler Form. Digitale In-halte bieten vielerlei Vorteile: sie sind jederzeit und von jedem internetfähigen Computer oder Smartphone aus verfügbar, können problemlos (ohne neue Karten schreiben zu müssen) ver-ändert und angepasst werden. Außerdem grei-fen sich elektronische Lernkarten nicht ab und können auch sonst nur schwer kaputt gehen.
MeCuM-Memo
MeCuM-Memo ist ein einzigartiges Lernpro-gramm und steht Studierenden der Humanme-dizin an der LMU München ab dem Winter-semester 2011/2012 (17.10.2011) kostenlos auf www.mecum-memo.de zum Registrieren und Download bereit. Eine Ausweitung auf andere Fakultäten und Studierende der TU München ist zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Die-ses Lernprogramm besteht aus zwei großen Bestandteilen: einer Online-Plattform (Wiki), zum Erstellen und Ändern von Lernkarten und einer Offline-Komponente (Java Lernpro-gramm, später Smartphone-App) mit der ihr bestehende Karten erst lernen und dann struk-turiert abfragen lassen könnt. Durch eine auto-matische Synchronisation, die jedes Mal wenn ihr die Lernsoftware startet abläuft, könnt ihr sicher sein immer die aktuellsten Karten zum Lernen zu haben.
Lernen mit digitalen Karten
Zum Lernen kannst du dir erst einmal die re-levanten Karten aussuchen und gegebenenfalls auch Unterkategorien, die dich nicht interes-sieren (wie z.B. Ätiologie, etc) fürs Lernen ent-
fernen. Außerdem kannst du die Karten noch vielfach individualisieren. Es stehen dir hierfür verschiedene Farben zum Markieren zur Ver-fügung. Außerdem kannst du den Karten No-tizen hinzufügen. Diese Änderungen werden beim nächsten Aktualisieren nur dann gelöscht wenn das entsprechend markierte Wort online geändert wurde.
Anschließend, nach dem Lernen mit den Karten, kannst du in den Prüfungsmodus. Alle neuen ungelernten Karten landen erstmals auf dem Anfangsstapel. Je nach Wissen und Ler-nerfolg rücken die Karten einen Stapel weiter. So wird gewährleistet, dass Karten, die nicht korrekt beantwortet wurden öfters zum Ler-nen als perfekt gekonnte Karten. Das Ganze nennt sich „Spaced Education".
Dein Lernerfolg wird immer angezeigt und am Ende einer Lernsession kannst du dein Ab-schneiden ablesen. Alles andere sollte selbst-erklärend sein – spiel einfach ein bisschen mit der Software rum …
Eine ausführliche Anleitung findet ihr übri-gens auch auf www.mecum-memo.de
Welche Karten gibt es bereits?
Aktuell stehen auf www.mecum-memo.de Karten zu allen Organblöcken des Moduls 23 sowie zur Pharmakologie zur Verfügung. Die-se Karten wurden von Kommilitonen erstellt und dienen als Grundstock. Nur durch deinen Einsatz kann es – wie bei Wikipedia auch – in Zukunft neue Karten geben. Je mehr Leu-te mit MeCuM-Memo lernen, desto größer der Kartenpool und desto besser die Qualität der Karten. Es liegt also auch an dir wie gut MeCuM-Memo sein kann! Sogenannte Redak-teure, mit erweiterten Rechten überprüfen die Karten, außerdem sollen in Zukunft auch Do-zenten an der Qualitätskontrolle beteiligt wer-
den. Redakteur kann jede/r Interessierte von euch werden.
MeCuM-Memo bietet sich sowohl zum „nor-malen“ Lernen als auch zur Vorbereitung auf Prüfungen sowie die Staatsexamina an. Je größer der Kartenpool desto größer der Anwendungsrahmen. Beim Lernen für das Hammerexamen ist MeCuM-Memo übrigens entstanden und konnte bis zum heutigen viele fleißige Helfer überzeugen …
Deine Meinung ist uns wichtig!
Besonders wichtig ist uns als studentisches Projekt deine Meinung. Es gibt technisch fast keine Hindernisse und wir sind sehr bemüht deine Ideen und Verbesserungsvorschläge um-zusetzen. MeCuM-Memo ist kein starres Pro-gramm sondern wird sich immer entsprechend deiner Wünsche weiter entwickeln. Bei Anre-gungen, Kritik oder aber technischen Schwie-rigkeiten könnt ihr uns jederzeit kontaktieren (siehe „Kontakt“ auf www.mecum-memo.de).
Als nächste Neuerung arbeiten wir konkret an der Anwendung von MeCuM-Memo auf Smartphones (voraussichtlich ab Sommerse-mester 2012), sodass du immer und überall, z.B. in der U-Bahn, lernen kannst.
MeCuM-Memo ist weltweit einmalig. Erst-mals hast du die Möglichkeit gemeinsam mit Kommilitonen aber trotzdem individualisiert lernen zu können.
Bild: snifty / openclipart.org
systematisches und strukturiertes Lernen
miteinander Lernen
mobiles Lernen
ständige Anpassung an
studentische Wünsche
individualisier
t
Lernen
MeCuM-MemoLernkarten und noch viel mehr ...
von Christoph Kuhm
Mitmachen bei MeCuM MemoDu möchtest bei MeCuM Memo mitarbeiten? Dann werde Redakteur – schicke uns dazu einfach ein kurzes Motivationsschreiben an [email protected] – oder komm zu unse-rem Stammtisch.
Alle Informationen findest du auch online auf unserer Webseite www.mecum-memo.de
Wir freuen uns auf euren Input!

Synapse 13www.synapse-redaktion.de
QuickFactEine blühende Phantasie ist tatsächlich ein Zeichen von Intelligenz - und je mehr und intensiver ein Mensch träumt, desto höher ist sein IQ.
"sleeping": addon // openclipart.org
Schnellstart mit MeCuM-MemoKonkret läuft es so ab: Du gehst auf www.mecum-memo.de und klickst auf „Wiki“ in der Navigationsleiste.
Dort richtest du dir einen Zugang ein und danach kann es sofort losgehen.
Online: Das Wiki
Diese Plattform wird dich sicher-lich an Wikipedia erinnern und sie sollte eigentlich selbsterklärend sein. Hier kannst du neue Karten erstellen oder aber bestehende Karten verbessern. Hierzu gibt es einen übersichtlichen Editor, mit dem ihr die Texte verfassen und gestalten könnt. Jederzeit könnt ihr indem ihr links oben auf
„Seite“ klickt sehen wie die Karte in der Online-Fassung aussehen wird.
Um eine gewisse Ordnung zu schaffen ist es enorm wichtig, dass du neu erstellte Karten auch dem richtigen Fach bzw. der richtigen Krankheitsgruppe zuordnest. Du kannst auch Bilder oder Mindmaps (z.B. mit XMind erstellt) – bitte unter Angabe der Quelle – hochladen („Upload“ un-ter der Kategorie „Bilder“ oben in der Leiste) und den Karten im
„Bearbeiten“-Modus (Editor) hin-zufügen.
Offline: Die Lernsoftware
Nach dem Bearbeiten und Er-stellen neuer Karten musst du einmalig die eigentliche Lernsoft-ware auf www.mecum-memo.de („Software-Download“ in der Navigationsleiste) herunterladen.
Ist dies geschehen kannst du das Programm starten (hierfür muss auf deinem Computer Java installiert sein) und automatisch werden die online vorhandenen Karten heruntergeladen bzw. beim nächsten Zugang automa-tisch aktualisiert.
Weitere ScreenShots
http://www.synapse-redaktion.de/56-mecum-memo
Bon
us
Bei der diamantenen Hochzeit kommt natürlich ein Reporter und fragt das Ehepaar, warum sie immer so harmonisch zusammen gelebt haben. Sagt der Ehemann: "Das fing schon damals auf der Hochzeitsreise in Mexiko an ... Wir hatten einen Ausritt mit einem Maultier. Beim Aufsteigen hat das Tier meine Frau getreten. Sie sagte ganz lei-se: ‚Eins‘. Nach einigen Kilometern war ihr Maultier bockig und wollte
nicht mehr weiter. Sie sagte ganz leise: ‚Zwei‘. In einer Schlucht hat das Tier gescheut und hat meine Frau fast abgeworfen. Meine Frau sagte: ‚Drei‘, hat einen Revolver gezogen und das Tier erschossen. Daraufhin habe ich meiner Frau Vorhaltungen gemacht und gesagt das sei ja wohl nicht notwendig gewesen. Sie hat mich nur ange-sehen und sagte dann ganz leise: ‚Eins‘.
Die Redaktion warnt: Vorsicht, nicht laut loslachen, sonst will Dein Dozent den Witz auch lesen! Und dann musst du deine Synapse hergeben und kannst die anderen Witze nicht lesen. Und der Dozent komm
t nicht mehr zum
Unterrichten, das wollen wir doch alle nicht. Obwohl ... es ist schlussendlich deine Entscheidung, was du machst, Wir haben dich gewarnt. Na gut, wenn wir dich schon mal vom Witz ablenken, dann noch einen kur
zen
als B
onus
für a
lle d
ie d
iese
n Ra
hmen
ferti
gles
en: T
reffe
n sic
h zw
ei J
äger
.
© coscurro // sxc.hu

Synapse14 www.synapse-redaktion.de
von Stephanie Zühlke
Gregory House humpelt durch die Glastür in sein Büro, setzt sich, schwingt den Stock mit einem Knall auf den Tisch. Er greift zu sei-nem großen, rot-grauen Tennisball, wirft ihn in die Luft, fängt ihn wieder auf und beginnt nachzudenken.
Eine Szene, die typischer nicht sein könnte für eine Serie, in der der beste Diagnostiker des Princeton-Plainsboro Hospitals die schwierigs-ten Rätsel löst und damit Krankheiten diagnos-tiziert, auf die niemand anderes hätte kommen können. Unter eingefleischten House-Fans ist seine Vorgehensweise berühmt-berüchtigt, sei-ne Diagnose stellt er durch geschicktes Kom-binieren von Symptomen mit einem Schuss (bestimmt nicht göttlicher) Eingebung.
Ein vielversprechender, abwesender Blick - ergänzt durch ein verschmitztes Lächeln - und House hat eine Idee.
Doch wie funktioniert das; wie entstehen Ge-danken und Ideen? - Begeben wir uns auf eine Reise mit ihnen!
Das Umfeld
Zuerst erscheint das Umfeld, in dem Ideen und weitreichende Gedanken entstehen, inte-ressant, sodass es zum Ausgangspunkt dieses Trips wird.
Unter anderem werden eine anregende Um-gebung, ein neuen Impulsen aufgeschlossener Geist und Gruppenarbeit als förderlich ange-sehen, aber auch ein gezieltes Vorgehen kann zu fruchtbaren Ergebnissen führen.
Eine anregende Umgebung für House? - Zu-erst eine Vicodin schlucken und dann alter-nativ mit dem Tennisball spielen, ein Gespräch mit Wilson oder Cuddy führen, ein bisschen auf dem Klavier herumklimpern ...
Ferner sind die eingehenden Reize, mit de-nen unser Gehirn tagtäglich überflutet wird, die Grundlage von Informationen, auf die der Organismus reagieren kann, soll und muss. Handlungen, die daraus resultieren, dienen in erster Linie der Erhaltung des Gleichgewichts im Organismus. Darüber hinaus sind diese In-formationen über äußere Umwelt und innere Wahrnehmung auch die Grundlage der Entste-hung von Gedanken und Ideen.
Die Wiege der Ideen
Frederic Vester, Biochemiker und ehemaliger Lehrstuhlinhaber der Universität der Bundes-wehr in München, beschreibt in seinem Buch Denken, Lernen, Vergessen die Entstehung von Ideen wie folgt:
„Durch die vervielfachte Anordnung (der Speicherung von Code-Molekülen - diffus in der ganzen Großhirnrinde verteilt) ergeben sich unter den entstehenden Informations-mustern Resonanzen („Mitschwingungen“) und Interferenzen („Schwingungswechsel-wirkungen“). Und diese können von Zeit zu Zeit aus sich heraus völlig neue Sinninhal-te, das heißt ein neues, originales Informa-tionsmuster und damit eine schöpferische Idee erzeugen.“
Noch komplexer wird die Angelegenheit, so-bald man sich mit den weiteren Fähigkeiten insbesondere des menschlichen Gehirns aus-einandersetzt, wie dem Bewusstsein des Selbst und der Fähigkeit, mögliche Handlungen be-wusst abzuwägen und gar Metakognition zu betreiben, über das Denken nachzudenken. Beeindruckend dabei ist, welch hohen Grad der Abstraktion das menschliche Gehirn er-reicht.
Auf der Spur der Strukturen
Hier kommen nunmehr Netzwerke und Strukturen des Gehirns ins Spiel, um die den Menschen auszeichnenden kognitiven Funkti-onen zu lokalisieren.
Mit gewissen Vorbehalten ist die Empfin-dung von Bewusstsein im medialen frontalen Cortex - einschließlich anteriorem cingulären Cortex - und Inselrinde zu verorten. Zusätz-lich gibt es Hinweise darauf, dass gerade in Aufgaben-freien Situationen die Aktivität der Temporallappen von Probanden hoch und da-mit das Langzeitgedächtnis besonders aktiv ist. In verschiedenen Studien erleuchten im fMRT gezielt die genannten Hirnstrukturen bei entsprechenden Aufgaben zu Selbstreflexion, Bewusstsein oder eben beim Nichts-Tun - die Phase, in der womöglich die meisten Ideen entstehen.
Thomas Metzinger, der Professor für Philoso-phie in Mainz ist und sich mit den Themenge-bieten der Ethik und des Bewusstseins befasst, vertritt in einem Interview im ZEIT Magazin die Meinung, „das Selbst ist kein Ding, sondern
„Gehirn: ein Organ, mit dem wir denken, dass wir denken.“
Ambrose Bierce, amerikanischer Schriftsteller
QuickFactEher zufällig entdeckte der französische Arzt Lionel Feuil-let die Besonderheit eines seiner Patienten: Dessen Gehirn ist nur ein Zehntel so groß wie normal, trotzdem kann der Mann ein ganz normales Leben als Verwaltungsbeamter führen. Massiv vergrößerte Ventrikel des Patienten
A CT B,C T1 MRT mit Gadolinium D T2 MRTLV Linker Ventrikel III dritter Ventrikel IV vierter Ventrikel
Pfeil Foramen Magendii Umrandung in D Zyste

Das Gehirn wie man es sich 1864 vorstellte
A Gottesliebe B Stolz C Begriffssinn D Anmut 1 Geschlechtsliebe 2 Elternliebe 3 Freundschaft 4 Heimatliebe 5 Emsigkeit 6 Kampfsinn 7 Zerstörungssinn 8 Esslust 9 Erwerbssinn 10 Verschwiegenheit 11 Vorsicht 12 Ehrgeiz 13 Selbstachtung 14 Festigkeit 15 Gewissenhaftigkeit 16 Hoffnung 17 Gläubigkeit 18 Demut 19 Gutmütigkeit 20 Bausinn 21 Idealitätssinn 22 Nachahmungssinn 23 Frohsinn 24 Beobachtungssinn 25 Formsinn 26 Masssinn 27 Wägesinn 28 Farbensinn 29 Ordnungssinn 30 Zahlensinn 31 Ortssinn 32 Erinnerungssinn 33 Zeitsinn 34 Tonsinn 35 Sprachsinn 36 Kausalitätssinn 37 Vergleichssinn
Synapse 15www.synapse-redaktion.de
es ist ein Vorgang.“ Das stützt auch aus geis-teswissenschaftlichem Blickwinkel die Vorstel-lung von vernetzten Hirnarealen, die unter Zu-sammenarbeit ein Selbstkonstrukt erschaffen.
In diesem Zusammenhang hat der Assoziati-onscortex mit seiner vernetzenden und integ-rierenden Funktion wohl einen großen Anteil an derart komplexen Vorgängen im Gehirn. Laut Hecke Schrobsdorff, Postdoc am Bern-stein Center for Computational Neuroscience in Göttingen, kann man sich diesen als Netz-werk mit „vagabundierender Aktivität“ bei der Ideenfindung vorstellen. Das bedeutet, dass nicht – wie es bei der Erledigung spezifischen Aufgaben der Fall ist – ein bestimmtes Hirnare-al im fMRT aufleuchtet, sondern im Gehirn verschiedenste Areale „zusammengeschaltet“ werden mit dem Ziel, eine möglichst passende Lösung für die jeweilige Aufgabe zu finden.
Eine Idee entsteht diesbezüglich aus bereits
im Gehirn vorhandenen Informationen er-gänzt durch gerade in jenem Moment auf das Gehirn einwirkende Reize.
Was ist das Selbst?
Auch das Konstrukt des Selbst liegt womög-lich ähnlichen Mechanismen zugrunde, wobei es sich bei diesem um ein beständigeres Gebil-de als eine Idee handelt. Das Selbstkonstrukt wird in Abhängigkeit von Erlebten immer wie-der modifiziert, ist somit über einen längeren Zeitraum relativ konstant.
Das Selbstkonstrukt von House: ehrliche und oft sehr sarkastische innere Stimme sei-ner Patienten und Kollegen, um sie von ihrer Scheinheiligkeit zu erlösen ...
Explizite Angaben zu Lage, Aufbau, Funkti-on - Kennzeichen eines jeden Organs, die der gewöhnliche Medizinstudent in Anatomie vor- und rückwärts, makro- und mikroskopisch zu beherrschen bestrebt ist - sind allerdings gera-de bei höheren kognitiven Leistungen nicht zu tätigen. Der Aussage von Hecke Schrobsdorff folgend „wird es immer nebulöser, was denn
nun genau passiert“ je tiefer man versucht, die komplexen Funktionen des Gehirns zu erfor-schen. Er führt dies auf die Schwierigkeit zu-rück, „vernünftige Versuche zu designen, die kontrollierte Bedingungen herstellen“. Proble-me könnten dabei durch die unterschiedliche Motivation der Probanden, aber auch durch die interindividuellen Unterschiede, die in star-ken Divergenzen der Messwerte resultieren, hervorgerufen werden. Zusätzliche Hürden bei der Erforschung der höheren kognitiven Fertigkeiten des menschlichen Gehirns bringt die Tatsache mit sich, dass zum großen Teil bei Experimenten nicht auf dem Menschen ähnli-che Modelltiere zurückgegriffen werden kann, sodass am und mit dem Menschen experimen-tiert wird und Gesunde verglichen werden müssen mit Patienten, die eine selektive zere-brale Schädigung aufweisen. Deshalb kann le-diglich auf „nichtinvasive Verfahren wie EEG, MEG und fMRI“ zurückgegriffen werden. „Die sind entweder räumlich oder zeitlich sehr mies
aufgelöst, und sagen überhaupt nichts über einzelne Neurone aus. (...) Was denn nun (...) mehr oder weniger Aktivität (bei bildgebenden Verfahren) bedeutet, ist Gegenstand ziemlich wilder Spekulationen in den Theorieabschnit-ten vieler Veröffentlichungen“, findet Hecke Schrobsdorff und steht mit dieser Meinung wie viele andere Wissenschaftler den Erkenntnis-sen aus fMRT-Studien skeptisch gegenüber.
Die Sapir-Whorf-Hypothese
Im Kontext der Entstehung von Ideen und Gedanken erscheint abschließend die Sapir-Whorf-Hypothese - von Benjamin L. Whorf in Einklang mit Auffassungen seines Lehrers Edward Sapir entwickelt - erwähnenswert. Sie besagt, dass sprachliche Systeme wie gram-matikalische Strukturen und Wortschatz die Denkstrukturen und auch Denkmöglichkei-ten ihrer Sprecher determinieren. Diesem Sprachdeterminismus zufolge sei menschliche Erkenntnis nur relativ zu den systematischen Möglichkeiten der jeweiligen Einzelsprache möglich. Einen interessanten Ansatz des Ein-blicks in die Divergenz menschlichen Denkens darstellend, muss diese Hypothese dennoch
hinsichtlich ihrer Gültigkeit angezweifelt wer-den.
Ohne in die Tiefen der Linguistik vorzudrin-gen, genügt schon die Vorstellung eines int-elektuellen Zirkels - wie oft geraten jene gebil-dete Menschen, denen man keine mangelnde Sprachfertigkeit zuweisen kann, bei der For-mulierung ihrer Gedanken ins Stocken, korri-gieren zuvor Gesagtes - einzig mit dem Ziel, ihre Gedanken dem Gegenüber begreiflich zu machen. Jemand, der lediglich in der Lage ist, zu denken, was er auch mit seinen Sprachmög-lichkeiten zum Ausdruck bringen kann, dürfte sich keinerlei Probleme der Kommunikation gegenübergestellt sehen.
Außerdem basiert die Annahme der Hypo-these auf einem Zirkelschluss: Wenn in einer Kultur nur über das nachgedacht werden kann, wofür diese Kultur auch die entsprechenden sprachlichen Begriffe bereitstellt – Inuit dem-nach -zig Wörter für Schnee haben, wir aber nur ganz wenige oder die indianische Hopi-Sprache keine Zeitbegriffe kennt – , kann es zu keiner signifikanten Weiterentwicklung dieser Kultur kommen. Ganz nebenbei sei erwähnt, dass Bewohner der Alpenregionen – die wahr-lich nicht dem Kulturkreis der Inuit angehö-ren – über ebenso viele Wörter für Schnee verfügen wie diese. Dass Sprache das Denken beeinflusst, steht außer Frage. Doch dass Spra-che kognitive Prozesse beschränkt, ist nicht zuletzt wegen der Datengrundlage, auf die sich Sapir und Whorf beziehen, zweifelhaft.
Somit steht die Erkenntnis des Sokrates wie so oft am Ende einer Suche nach tiefem Ver-ständnis, Einsicht und Wahrheit:
οἶδα οὐκ εἰδώς - Ich weiß, dass ich nicht weiß.
Andererseits wissen wir aber definitiv:
It ´ s not Lupus!
Buchtipps
Vester, Frederic: Denken, Lernen, Vergessen Deutscher Taschenbuch Verlag
In diesem Buch werden - wie es der Titel ver-spricht - dem Leser die Grundlagen von Prozes-sen im Gehirn erläutert. - Eine Lektüre, die sehr interessant und reich an Einblicken ist, auch und gerade für (zukünftig) lerngeplagte Medi-zinstudenten.
Doidge, Norman: The Brain That Changes Itself Penguin Books
Norman Doidge, US-amerikanischer Psychiater, beschreibt in erstaunlichen Episoden, welch un-geahnte Plastizität unserem Gehirn innewohnt. Dabei zeigt er sowohl die persönlichen Schick-sale von Patienten, als auch die dahinterste-henden Wissenschaftler, die sich mit all ihrem Können dafür einsetzen, Folgeschäden nach Schlaganfällen, Amputationen und anderen Er-krankungen zu minimieren.
Geheimer Online-Bonus: http://www.wie-ideen-entstehen.de & Konversation mit Hecke Schrobsdorff
Buchtipp

Ein Junge pflugt das Feld mit Hilfe von zwei KühenIn Äthiopien ist das Zeichen eines gewissen Reichtums. Im Hintergrund sind die typischen Hütten zu sehen.
Synapse16 www.synapse-redaktion.de
Kurz vor dem Landeanflug weckt mich die Stewardess unsanft. Sie weist mich darauf hin, dass ich meine Rückenlehne hochstel-len soll und meinen MP3-Player ausmachen muss, und sie drückt mir meine Kühlbox in die Hand. Ach ja, fast hätte ich die vergessen.
Äthiopien
Wenn ich verreise, muss ich mich auf Cha-os einstellen, aber meine Vorbereitungen für Äthiopien verliefen selbst für mich turbulent. Die Sprechstundenhilfe in meiner Hausarzt-praxis verpasste mir statt der zweiten Tollwut-Impfung nochmals eine Runde Tetanus (gut, fängt auch mit T an, und ich hätte es auch merken können, dass die Impfung nicht die richtige Farbe hatte), weshalb ich jetzt meine Impfung per Kühlbox nach Istanbul schlep-pen muss, dem ersten Stopp auf meiner Reise.
Mein Visum kam zwei Tage vor der Abreise an, nach einem „bitte-bitte-schnell“-Telefonat mit der Botschaft – wir hatten es 6 Wochen zuvor bestellt. Auch die Umbuchung meines Fluges, der wegen der Unruhen in Kairo ver-schoben werden musste, hatte reibungslos geklappt. Ich begann also mit dem Packen und traf mich ein letztes Mal mit Professor Siebeck, um mir nochmal alle Kontakte vor Ort in Jimma nennen zu lassen. Damit auch die Botschaft in Addis Abeba wusste, dass Studis aus München nach Jimma kämen, schrieb Professor Siebeck noch eine E-Mail an einen Mitarbeiter. Was sollte jetzt noch schief gehen? Leider einiges.
Als ich gerade die letzten Einkäufe für mei-ne Reiseapotheke erledigen will, klingelt mein Handy. Professor Siebeck bittet mich, nochmal zu ihm zu kommen.
Last-Minute Krisensitzung
Der Botschafter hatte ihm eine Mail ge-schrieben, dass es in der Nähe von Jimma zu Unruhen gekommen wäre. Christen hät-ten wohl einen Koran verbrannt, woraufhin Muslime über 80 Kirchen angezündet hätten. Von einer Reise nach Jimma würde uns der Botschafter also abraten.
Was jetzt? Mit den andern Stipendiaten des Austauschprogramms trafen wir uns zur Kri-sensitzung. Wirklich viel war nicht herauszu-finden über die Unruhen. Die Ärzte vor Ort waren per E-Mail nicht so schnell erreichbar, und auch wenn, war es nicht so einfach, di-rekt zu fragen, was los sei, falls die E-Mail in falsche Hände geraten würde. In der Presse fanden wir nicht mehr als einen kurzen Arti-kel, und auch das Auswärtige Amt hatte kei-ne eindeutige Reisewarnung verhängt. Nach einigem Hin und Her beschlossen wir des-halb, doch zu fliegen.
Zurück also zu meinem Flug nach Istanbul und dem Impfstoff. Bis ins Flugzeug hinein
hatte ich es ja schon ge-schafft (dem Steward, der ein offizielles Schrei-ben von mir hatte sehen wollen, hatte ich meinen
Impfpass unter die Nase gehalten, mit dem er zwar nichts anfangen konnte, aber das wollte
er vielleicht nicht zugeben.) Jetzt musste ich eigentlich nur noch aussteigen.
Ein Päckchen vom Piloten
„Nur noch“ ist leicht gesagt. Ob ich mal bit-te mit ins Cockpit kommen könne, der Pilot wolle mich sprechen ... Beinahe hätte er mich in München gelassen, raunzte er mich an – weil ich ihn nicht gefragt hätte, ob ich den Impfstoff mitnehmen dürfe! Wohin ich wei-ter wolle, fragte er. Und ob ich denn, wenn mich jetzt jemand bäte, ein Päckchen mitzu-nehmen, das für ihn mit nehmen würde. Gut, dass ich müde, wie ich war, einfach nur nett lächeln konnte.
Endlich also durfte ich aussteigen. Auf mich wartete eine tolle Woche Istanbul, bevor es weiter ging nach Äthiopien.
Eine Woche später komme ich nachts um vier in Addis an, wo ich eigentlich vom Ho-tel, das ich mir von München aus organisiert hatte, abgeholt werden sollte. Eigentlich. In dem Wissen, dass ich abgezockt wurde, ließ ich mir von einer Taxivermittlerin einen Fah-rer organisieren und zahlte 10 Euro für meine Fahrt zum Hotel. Bevor ich nach Jimma rei-sen würde, wollte ich hier Marie treffen, eine der anderen Studis aus München, um mit ihr noch ein bisschen zu reisen. Bevor wir dann am CBTP (Community Based Training Pro-gram) teilnehmen würden.
Jimma
Jimma ist eine für Äthiopien relativ große Stadt in der Oromo-Region im Westen des
JimmaMedizin und Leben in Äthiopien
von Marie Tzschaschel
Was sollte jetzt noch schief gehen?Leider einiges.

Synapse 17www.synapse-redaktion.de
Landes. Im Verhältnis zu vielen anderen Tei-len ist es dort noch recht grün, und im Umland wird Kaffee angebaut. In der Stuff Lounge, in der wir meist unsere zweistündige Mittagspau-se verbrachten (ja, so etwas gibt es noch für Ärzte), hüpften Affen von Mango- zu Avocado-baum und versuchten uns unser Essen streitig zu machen.
Die ersten zwei Wochen rotierten wir – 6 Medizinstudierende aus München und zwei Ethnologinnen, die uns für ihre Forschung be-gleiteten – zu den verschieden Stationen der Klinik. Marie und ich begannen in der Gynä-kologie. In Äthiopien werden die meisten Kin-der zu Hause entbunden, und häufig leben die Frauen zu weit weg von einer Klinik, um sich überhaupt auf den Weg dorthin zu machen. In die Klinik kamen also entweder Frauen, die nah genug lebten, oder eben jene, die einen Geburtsstillstand erlitten und schnell und drin-gend Hilfe benötigten.
Da es nur einen Kreissaal gab, gab es drei Lie-gen nebeneinander, auf denen entbunden wur-de. Mit einem Hörrohr, wie es in alten Filmen die Hebamme benutzt, wurden die Herztöne des Kindes abgehört und per Hand die Wehen ausgezählt. Anfangs tat ich mich, verwöhnt von technischen Geräten daheim, schwer, überhaupt viel zu hören oder zu spüren, aber mit der Zeit hatte ich den Dreh raus. Schwie-riger fand ich, dass es nur ein Ultraschallgerät für die ganze Klinik gab, das dann eben auch mal in die Innere verliehen werden musste. Und es gab nur wenige Hilfsmittel zur Versor-gung eines (zu früh) Neugeborenen.
Auch wenn ich mir vor meinem Praktikum in Jimma schon bewusst gemacht hatte, dass es dort nicht alles geben würde, was wir in Deutschland nutzen können, war ich ziem-lich bedrückt, als ich sah, dass es weder genug Wärmelampen, geschweige denn Brutkästen oder gar die Möglichkeit zur Intubation für die Kleinen gab. Meine Bewunderung für die Ärzte wuchs enorm, zumal sie uns bei Lehrvi-
siten immer wieder zeigten, was sie unter ihren schlechten Bedingungen alles unternahmen.
Ein Tag in der Psychiatrie
Außer der Gynäkologie und der Pädiatrie hospitierte ich noch einen Tag in der Psychi-atrie. Alle Patienten dort trugen Schlafanzüge mit Teddybär-Mustern. Ziem-lich stigmatisierend, war mein erster Gedanke. Der Grund ist jedoch ziemlich simpel: Da die Angehörigen für die Pflege der Patienten verantwortlich sind und die Patienten ja äußerlich nicht von „Gesunden“ zu unterscheiden sind, bekommen alle Patienten die Schlafanzüge.
Patienten, die neu aufgenommen werden sol-len, werden erst einmal ausführlich interviewt. Wie immer war ich natürlich auch diesmal auf die Übersetzungen der Ärzte bzw. des Pflege-personals angewiesen. Gleich beim ersten Mal hatte ich Glück, wenn man das so sagen darf: Der Patient hatte unter anderem den Wahn, dass er besser Englisch könne als seine Mutter-sprache, weshalb er darum bat, das Aufnahme-gespräch auf Englisch zu führen …
Nach zwei Wochen Klinik begann also das CBTP. Nach einigem Hin und Her, wann es losgehen sollte, trafen sich alle Studierende und Professoren zur Gruppeneinteilung. Wir hatten extra gefragt, ob es sich um die west-liche Zeitangabe handelte oder um die äthio-pische, bei der mit Sonnenaufgang, also um 6 Uhr morgens, der Tag beginnt.
Bul Bul
Meine Kebele, Bul Bul, war das am weitesten entfernte, was jeden Tag eine Stunde Busfahrt übers Land bedeutete. Ein bisschen wie Schul-landheim, nur dass draußen bilderbuchkli-scheehafte Rundhütten, Affenbrotbäume und die typischen, mageren afrikanischen Kühe zu sehen waren. Mit zwei anderen Studis lief ich
von Hütte zu Hütte, um die Fragebögen aus-zufüllen. Ich weiß nicht, wie viele von euch freiwillig an Umfragen teilnehmen und fremde Menschen in ihre Wohnung lassen – in Bul Bul jedenfalls erklärten sich alle bereit, unsere Fra-gen zu beantworten.
Manche der Menschen hatten keinen Strom, kein Haus hatte fließendes Wasser. Die wichtigsten Doku-mente wurden in einer Plastik-tüte aufbewahrt, die an einem Nagel an der Wand hing. Die meisten Familien hatten min-destens 5 Kinder, manche so-
gar 9 oder mehr.
Nachdem wir eine Woche lang Daten gesam-melt hatten, werteten wir diese aus und präsen-tierten sie den anderen Gruppen.
Für die andern 5 LMU-Mediziner endete nach dem CBTP das Programm, und sie flogen zurück nach München.
Da ich aber auch einen Teil meines Mo-duls 6 in Äthiopien verbringen wollte, hatte ich mich noch für das TTP beworben (Team Training Program). Gemeinsam mit anderen äthiopischen PJlern und Studis aus andern Fachrichtungen (Zahnmedizin, Pharmazie, Environmental-Studis) wohnte und arbeitete ich in einem Health Care Center in Asenda-bo. Wie ich später rausfinden sollte, genau der Ort, an dem die Unruhen statt gefunden hat-ten. Die anderen Studis, sie waren schon seit 6 Wochen da, als ich kam, erzählten mir, dass sie den nach den Unruhen Gefangengenommenen Gesundheitserziehung erteilt hätten.
Hyänen in der Ferne
Mit drei anderen Studentinnen teilte ich mir ein Zimmer (zwei teilten sich ein Bett, da das andere als Schrankersatz diente). Da es nur zwei Eimer auf dem Gelände gab, musste ich, wenn ich duschen wollte, erst den Eimer su-
Die wichtigsten Dokumente werden in einer Plastiktüte aufbewahrt, die an einem Nagel an der Wand hängt.
Entbindungsraum im Health Care Center, rechts ist das Hörrohr zu sehen Eine Familie wird von einem äthiopischen Studenten befragt (CBTP)

Synapse18 www.synapse-redaktion.de
chen, um ihn dann mit Wasser füllen und zur Dusche schleppen zu können. Das Klo befand sich am Rand des Geländes, und obwohl mir die anderen versicherten, dass man Hyänen auch dann noch hört, wenn sie 2 km weg sind, hatte ich nachts anfangs etwas Schiss, muss ich gestehen. Dafür habe ich jetzt keine Angst mehr vor Hunden ...
Die meiste Zeit arbeitete bzw. hospitierte ich in der Ambulanz für Erwachsene. Gemein-sam mit Guteta, einem der PJler, mit dem ich mich anfreundete, untersuchte ich soweit möglich die Patienten. Gab es in Jimma noch einen Ultraschall, so hatten wir hier wirklich nur noch unsere Hände und ein Stethoskop. Doch auch so kamen wir oft zu einer Diagno-se, und ich lernte „umzudenken“. Wenn sich in Deutschland ein Patient mit Kopfschmer-zen präsentiert, denke ich zunächst einmal an Spannungskopfschmerz, bestimmt aber nicht an Malaria. Diese kann aber durchaus Kopf-schmerzen, Müdigkeit oder andere unspezifi-sche Symptome hervorrufen.
Auch Patienten mit TBC und Pneumonie wa-ren keine Seltenheit. Leider gibt es in Äthio-pien längst nicht alle Medikamente, die wir in Deutschland haben, und auch wenn die Preise nicht so hoch sind wie bei uns, können sich viele Patienten nicht alles leisten. Und eine Fahrt zur Uniklinik ist für manche unbezahl-bar.
Da die äthiopische Regierung versucht, die HIV-Neuerkrankungsrate massiv zu senken, führten wir bei allen „verdächtig erkrankten“ Personen, also beispielsweise TBC-Patienten, einen HIV-Schnelltest durch. Glücklicherwei-se war keiner davon positiv. Auch als wir in ei-ner Berufsschule einen Vortrag über HIV hiel-ten, Fragen beantworteten und alle testeten, die wollten, war kein positives Ergebnis dabei.
Noch viel zu erzählen ...
Ich könnte jetzt noch seitenweise weiter schreiben, über verschiedene Patienten oder persönliche Erlebnisse, aber das würde den Umfang sprengen. Wenn ihr Fragen habt oder nach Jimma gehen wollt, könnt ihr mir aber gerne schreiben.
Marie untersucht eine kleine Patientin.
QuickFactGehirn ist nicht teuer, denn 1 kg Kalbshirn kostet ungefähr 14 €. Zum Vergleich: 1 kg Kalbsbraten kostet mindestens 25 €
"meat 03": ArtFavor // openclipart.org
Jimma LMU LinkSeit 2002 besteht eine Kooperation für Medi-zinische Aus- und Weiterbildung zwischen den Medizinischen Fakultäten der Ludwig-Maximili-ans-Universität München (LMU) und der Jimma University (JU) in Äthiopien.
Für LMU Studis gibt es mittlerweile viele Mög-lichkeiten nach Jimma zu gehen.
CBPT (Community Based Training Program)
6 Studierende pro Jahr werden durch eine Kommission aus ehemaligen, Lehrenden und Äthiopiern ausgewählt am CBTP (Feldforschung im ländlichen Gebiet um Jimma und Auswertung der Daten) teilzunehmen.
TTP (Team Training Program)
Mitarbeit in einem Health Care Center. Entwe-der im Rahmen des PJs Allgemeinmedizin oder als Modul 6 Projekt.
Weitere Möglichkeiten
Außerdem ist es möglich im Rahmen einer Famulatur, Modul 5 (Gynäkologie) oder fürs PJ (Gynäkologie, Chirurgie, Allgemeinmedizin) nach Jimma zu fliegen.
In jedem Fall ist es absolut empfehlenswert, schon Erfahrungen in Deutschland, und am besten auch noch im Ausland gesammelt zu haben. Euch erwartet eine tolle Zeit, ihr solltet aber bereit sein, auch mal 5 Tage oder mehr ohne fließendes Wasser, Internet oder eventuell sogar Strom aus zu kommen. Genaue Informa-tionen findet ihr unter:
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Chirurgi-sche-Klinik-und-Poliklinik-Innenstadt/de/lehre/jim-ma-lmu/index.html
(oder einfach LMU-Jimma Link bei Google eingeben, das geht schneller, als den Link ab-schreiben…)
Bewerbungsfrist
Die Bewerbungsfrist endet am 19.10.2011
Bonus: Jimma
http://www.synapse-redaktion.de/56-jimma
Bon
us

Synapse 19www.synapse-redaktion.de
Kennst du folgende Situation: Du bist im Münchner Nachtleben unterwegs, unterhältst dich gerade noch angeregt, wirfst einen kur-zen Blick auf die Uhr und realisierst, dass die einzige U-Bahn, die dich heute noch nach Hause bringen könnte, gerade ohne dich ab-fährt? Ärgerlich ist das, weil jetzt oft nur noch die Möglichkeit verbleibt, die Heimreise im Taxi anzutreten und dafür mindestens 10 Euro zu zahlen. Obwohl, eigentlich könnte man ja auch … Moment! – da sind wir ja schon bei meiner Geschäftsidee.
Vom ersten Gedanken zum Business-Plan
Was vor einigen Monaten mit diesem kleinen Gedan-kenexperiment begann, hat sich inzwischen zu einem ambitionierten Projekt ent-
wickelt. Zusammen mit einem interdiszipli-nären Team von vier Studenten erarbeite ich neben meinem Studium ein Geschäftsmodell für diese Idee: Wir analysieren den Markt und die Wettbewerber, sprechen mit Experten und potentiellen Kunden, überarbeiten unser Kon-zept wieder und wieder, und dokumentieren es schließlich in Form eines etwa zehnseitigen Schriftstücks – des Business-Plans. Dieser wird uns später helfen, Investoren für unsere Geschäftsidee zu finden.
Wie ich überhaupt dazu komme? Auf der Suche nach einer praxisorientierten Abwechs-lung zu meinem theoretischen Studium stieß ich letztes Semester auf das unternehmerische Qualifizierungsprogramm der Unternehmer-TUM: Manage&More. Bei diesem 18-mona-tigen Programm habe ich die Möglichkeit, an mehrmonatigen Industrieprojekten mit Un-
ternehmenspartnern mitzuarbeiten oder ei-gene Gründungsprojekte zu initiieren. Dabei unterstützt mich die UnternehmerTUM mit wertvollem Feedback, mit Räumen und Inf-rastruktur sowie einem starken Netzwerk von Unternehmern. Außerdem habe ich die Mög-lichkeit, mich in zahlreichen Workshops und individuellen Coachings persönlich weiterzu-entwickeln – zu Themen wie beispielsweise Rhetorik, Projektmanagement oder Verhand-lungsführung. Jedes Jahr werden für Mana-ge & More 20 Studenten und Doktoranden aus allen Fachrichtungen ausgewählt. Meine Teamkollegen sind eine bunte Mischung von interessanten Persönlichkeiten mit ganz un-terschiedlichen Hintergründen – das macht die Projektarbeit im Team herausfordernd und spannend zugleich.
Dabei sein!
Warum ich das alles erzähle? Du kannst im nächsten Semester dabei sein, wenn wieder 20 motivierte Studenten an den Start gehen und den Blick über den Tellerrand wagen. Alle wichtigen Informationen zum Programm und Bewerbungsverfahren findest du unter www.manageandmore.de
Ich freue mich schon, dir im Wintersemes-ter persönlich zu verraten, wie du nach dem nächsten Barabend am besten wieder nach Hause kommst.
Unterwegs mit Manage & MoreVon Daniel Rudolph
37SignalsAdobe
Aliant ComputerApple
ArsDigitaBlogger.com
BloglinesCraigslist
Del.icio.usExcite
FirefoxFlickr
Fog Creek SoftwareGmail
Groove Networks
HotmailHotorNotHummer WinbladLycos
MarimbaONElistPayPalResearch in MotionSix ApartTickleTiVoTripAdvisorViawebWebTVYahoo!
I N T E R V I E W S W I T H T H E F O U N D E R S O F
J e s s i c a L i v i n g s t o n
Foundersat Work
Stories of Startups’ Early Days
It's all about business.
Synapse StartUp!
Jessica Livingston: Founders at work Apress
Buchtipp
Dieses Buch sollte DIE Bibel des angehenden Jungunter-nehmers, oder neu-Deutsch „Entrepreneurs“ sein. Jessica Livingston, die selber für den Venture Capital Geber Y-Com-binator arbeitet, interviewte in diesem Buch 32 Gründer von High-Tech-Firmen, u.a. PayP-al, Apple, Research In Motion (Hersteller des BlackBerry), Yahoo!, und viele mehr.
Die Gründer erzählen von Er-folgen, und Niederlagen, von
Fallstricken – bspw. gierigen Venture Capital Gebern und unerfahrenen Anwälten auf der eigenen Seite – und geben handfeste Tipps um die eigene Firma zu gründen.
Ich konnte mich von den Ge-schichten kaum losreißen: man bekommt das Gefühl ver-mittelt, alles ist (mit dem richti-gen Team) möglich, und kriegt richtig Lust darauf, mit der ei-genen Idee durchzustarten!
Synapse StartUp!
http://www.synapse-redaktion.de/startup
Bon
us

© orkomedix // flickr.com
50 Jahremaximales Alter
1,0 - 1,7 mGröße
♀ 25 - 50 kg ♂ 35 - 70 kg
Gewicht
400 gGehirngewicht
Fell
172.000 - 300.000geschätzer verbliebener
Gesamtbestand8 MonateTragezeit
7 JahreErreichen des
Erwachsenenalters
2 Jahre oder längerStillzeit
Ständiges am KörpertragenTransport des Nachwuchses
polygam Leben in lockeren Gruppen
meist von einem Männchen geführtSozialisation
Fähigkeit, Daumen zu opponieren und damit Werkzeuge zu nutzen Süchte entwickeln können Fähigkeit zur Trauer Rechnen könnenGemeinsame Möglichkeiten des Menschen und des Schimpansen
Gen Neu5GcNeu5Gc kodiert für eine Sialin-säure, die eine Rolle bei Pro-zessen der Zellkommunikation spielt. Der Mensch hat dieses Gen nicht.
Die Größe des Gehirns sagt nichts über die Intelligenz ausSie korreliert lediglich mit der Muskelmas-se und Fähigkeit zur Feinmotorik, und damit dem Gewicht des Tieres

© Mait Jüriado // flickr.com
110 Jahremaximales Alter
ca. 1,7 mGröße
♀ 55 - 65 kg ♂ 70 - 80 kg
Gewicht
ca. 1,4 kgGehirngewicht
kein Fell
7 Milliardengeschätzer
Gesamtbestand
9 MonateTragezeit
16 - 25 JahreErreichen des
Erwachsenenalters
0 - 10 MonateStillzeit
Kinderwagen Tragen am Körper
Transport des Nachwuchses
Leben in der Familie Ideal der Monogamie
abhängig vom Kulturkreis Sozialisation
> 98,8 % Genetische Übereinstimmung zwischen Schimpanse und Mensch
Gen Har1Har1 sorgt dafür dass unsere Großhirnrinde tief gefaltet ist, und damit viel Platz für die dort sitzenden Zellkörper der Ner-ven bietet.
Gen Foxp2Foxp2 gilt als wichtige Voraus-setzung für die Sprachfähigkeit. Mutationen des Gens können schwere Sprachstörungen ver-ursachen.
Einer der größten Unterschiede des Menschenist vermutlich die Fähigkeit, Imaginäres – zum Beispiel Gedanken, mögliche Handlungsvari-anten – dem Gegenüber mitzuteilen

Synapse22 www.synapse-redaktion.de
Es war an einem der wenigen heißen Tage im Sommer 2010, an dem ich zum ersten Mal mit dem Begriff Modul 23 konfrontiert worden bin. Ich erinnere mich noch gut an die hohen Temperaturen, die an diesem Tag im Walther-Straub Hörsaal herrschten. Trotz der drücken-den Schwüle, der man am besten mit einem kühlen Getränk im Schatten begegnet wäre, war der Hörsaal bis auf den letzten Platz be-setzt, was ihn in eine Art „350 Mann-Sauna“ verwandelte. Eigentlich wollte ich gar nicht hier sein und ich fing deshalb schon an darü-ber nachzudenken, dem Hörsaal den Rücken zu kehren und einen letzten Tag der Ruhe vor dem näher- kommenden P h y s i k u m zu genie-ßen. Es gab s icher l i ch eine Viel-zahl von attraktive-ren Mög-l i c h k e i t e n den Tag zu verbringen. Ich schaute mich im Hör-saal um und sah mein Befinden in den von der Hitze geröteten Gesichtern meiner Kommilitonen widergespie-gelt. Doch die Veranstaltung, die zu diesem großen Andrang geführt hatte, war keine ge-wöhnliche universitäre. Nein, heute standen nicht wir, die Studenten, auf dem Prüfstand, sondern die Universitäten. Kurz vor dem Ende des vorklinischen Abschnitts des Medizinstu-diums, kurz vor dem so furchteinflößenden Physikum, waren die Universitäten, die TU als auch die LMU, gefordert, um uns Medizinstu-denten zu kämpfen. Nach nun fast vier Semes-tern Vorklinik an der LMU - die TU existierte praktisch nicht in der Vorklinik - standen die Zeichen bei mir eher für einen Wechsel zur TU. Ich wollte das enge Korsett der LMU hin-ter mir lassen und die größere Freiheit an der TU erleben. Warum war ich also überhaupt
da? Nun, weil ich, wenn ich ehrlich bin, bis auf diese These, die man so im Verlauf des Studi-ums aufgeschnappt hatte, keine Ahnung über den genauen Ablauf und die Unterschiede des klinischen Abschnitts an der LMU bzw. der TU hatte. Für die Vorstellung der beiden Univer-sitäten nahm ich deshalb die Unannehmlich-keiten gerne in Kauf und folgte mit steigendem Interesse den Präsentationen der einzelnen Universitäten.
Das Modulsystem der LMU
Das Modulsystem der LMU hör-te sich sehr gut und vielverspre-chend an, sodass nach den ers-ten Minuten der Präsentation m e i n e
En t -scheidung an die TU zu gehen ins Wanken kam. Vielleicht ist das Konzept der LMU doch gar nicht so schlecht?
Modul 23 ?!?
Aus diesen Gedanken wurde ich dann je-doch jäh gerissen. Hatte ich da gerade richtig gehört? Modul 23? Modul was?! Doch meine Ohren spielten mir keinen Streich, denn die kleine zierliche Frau, die sich als ein Teil des Organisationsteams dieses Moduls vorstellte, nannte diesen Begriff schon wieder! Und die Idee, die sich hinter dieser Neuerung verbirgt, erschien mir so genial, dass in diesem Moment meine Entscheidung, an welcher der beiden
Universitäten ich meinen klinischen Abschnitt des Studiums absolvieren werde, gefallen war.
Was ist neu?
Doch was genau ist das Modul 23 und wie unterscheidet es sich von den alten Modulen 2 und 3? Während in den Modulen 2 und 3 die Lehrinhalte unabhängig zunächst aus dem internistischen und anschließend aus dem chi-rurgischen Blickwinkel betrachtet worden sind und dadurch eine hohe Redundanz entstand, soll nun im neuentwickelten Modul 23 die in-terdisziplinäre Behandlung des Stoffs erfolgen.
Außerdem soll die Pflichtstundenzahl auf ein Minimum gekürzt werden, um so einen
größeren Freiraum für eigenständiges Arbeiten zu gewähren. Ein weiteres Ziel besteht darin die Prüfungsfrequenz zu er-höhen, um damit einen Prozess des kontinuier-lichen Lernens zu etablieren. Dazu sind acht Themenblöcke entwickelt worden, von denen jeweils vier pro Semester durchlaufen werden. Dabei finden aber immer alle acht Blöcke par-allel zueinander statt. Innerhalb eines Blockes befinden sich deshalb nur etwa 50 – 60 Stu-denten, die in dieser Gruppengröße aber nur die Vorlesung zusammen haben. Am Ende ei-nes jeden vierwöchigen Blockes erfolgt dann eine blockspezifische Abschlussklausur und eine mündlich-praktische Prüfung (OSCE). Die Gesamtnoten der einzelnen Prüfungen
von Philipp Blüm
Das Modulsystem der LMUFür alle, die sich noch nicht im klinischen Abschnitt befinden und denen diese Begrif-fe unbekannt sind, sei hier kurz nochmal eine Erklärung gegeben:
Der klinische Abschnitt an der LMU ist in 6 Module aufgeteilt (Modul 1 – 6), zu denen zusätzlich der L-Kurs angeboten wird.
Modul 1
Modul 1 ist das Einstiegssemester in den klinischen Abschnitt, das auf jeden Fall nach dem Physikum belegt werden muss. Hier werden die sogenannten klinisch-theoretischen Fächer (Pharmakologie, Mi-krobiologie, klinische Chemie, Pathologie, Bildgebung und Humangenetik) behandelt.
Bisher: Modul 2 und Modul 3
Darauf folgte bislang mit Modul 2 das „Innere“-Semester und mit Modul 3 das „Chirurgie“-Semester.
Modul 4 und Modul 5
Im Modul 4 geht es um das Nervensystem und Sensorium (Augenheilkunde, Derma-tologie, HNO, Neurologie, Psychiatrie und Pharmakologie), während im Modul 5 die Spezialdisziplinen der Pädiatrie, der Gy-näkologie, Allgemeinmedizin und Geriatrie behandelt werden.
Modul 6
Das Modul 6 ist schließlich das sogenannte „Projektsemester“, das man ausschließlich für wissenschaftliches Arbeiten bzw. ein Auslandsstudium nutzen kann.

Synapse 23www.synapse-redaktion.de
fließen schließlich in die jeweiligen Leistungs-nachweise ein.
The usual ... with a twist
Der Unterricht setzt sich im Allgemeinen aus Vorlesung, Seminaren, Tutorials und Bedside-Teachings zusammen und wird sowohl von Chirurgen, als auch Internisten gehalten. D.h., dass man z.B. zu einem bestimmten Krank-heitsbild zunächst eine internistische Vorlesung hat und anschließend ein Vertreter der Chirur-gie einen
V o r t r a g über die Möglich-keiten der chirurgischen Intervention hält. Daraufhin folgen Seminare, in denen mit ei-ner Gruppenstärke von etwa 20 Personen be-stimmte Aspekte der Vorlesung vertieft werden bzw. weitere Themen, die in der Vorlesung nicht behandelt werden konnten, besprochen werden.
In den Tutorials, mit einer Gruppengröße von max. 10-12 Studenten, werden im Sinne des problemorientierten Lernens (POL) klinische Fallbeispiele durchgesprochen. Dabei sollen die Studenten selbstständig die Fälle bearbei-ten. Die anwesenden Ärzte sind mehr oder we-niger Beobachter, die nur dann eingreifen soll-ten, wenn die Bearbeitung der Fälle fehlerhaft werden sollte. Probleme und Fragen, die wäh-rend der Bearbeitung auftreten, sollen dann von einzelnen Studenten recherchiert und in der nächsten Stunde als Kurzreferat präsen-tiert werden. So soll das Lernen an den Wis-sensstand der Gruppenmitglieder angepasst und speziell die Bereiche mit noch vorhande-nen Wissenslücken erkannt werden.
Die regelmäßig stattfindenden „Bedside – Teachings“ sind eine gute Möglichkeit das in den anderen Veranstaltungen erlernte Wissen direkt am Patienten anzuwenden. In Klein-
gruppen von 4-6 Studenten, die dann auf Station meist nochmals in Zweiergruppen aufgeteilt werden, können die Studenten eine Anamnese und körperliche Untersuchung durchführen. Dies ist im Sinne des „klinischen Blicks“ sehr wichtig. Ein Krankheitsbild, das man mit eigenen Augen gesehen hat, merkt man sich leichter. Ebenso ist es mit speziellen Untersuchungsmethoden, die man am Pati-enten anwenden kann. Die untersuchten Pa-tienten werden anschließend einem Stations-arzt vorgestellt. Häufig erhält man auch eine
Einsicht in die Akte des Patien-ten. Die betreuenden Ärzte
sollen den Studenten weiterhin Tipps und Hilfestellungen ge-
ben und stehen für Fragen jeder Art und Weise zur Verfügung. Dies ist denke ich, zu-mindest in der Theorie, eine tolle Unterrichtsform, die jedem sehr viel weiterhelfen kann. Der Stoff, der im Modul 23 behandelt wird, ist natürlich mit dem ursprüng-lichen Stoff aus
Modul 2 und 3 ver-gleichbar. Auch die
Unterrichtsformen, wie die Vorlesungen, Semi-
nare, Tutorials und Bedside-Teachings existierten auch schon
früher. Dennoch wurde uns mitgeteilt, dass die meisten Vorlesungen, Seminare und Tutorials an die Bedürfnisse des Modul 23 an-gepasst worden sind. Zusammenfassend kann man demnach sagen, dass die größten Neue-rungen in der Entwicklung der acht Themen-blöcke, der dazugehörigen Kleingruppen, der interdisziplinären Behandlung des Lernstoffs und der erhöhten Prüfungsfrequenz liegen.
Diese Veränderungen sind meiner Meinung nach positiv und haben den klinischen Ab-schnitt an der LMU enorm aufgewertet. Durch das regelmäßige, kontinuierliche Lernen, durch die Fokussierung auf ein überschau-bares Themengebiet und die interdisziplinäre Betrachtung eines Organsystems kann ein um-fassendes Verständnis für die Thematik und die Problematik in der modernen Medizin erreicht werden.
Das erste Mal
Dass wir aber die ersten sein sollten, die die-ses Konzept durchlaufen, führte schon am Tag der Vorstellung zu einer gewissen Besorgtheit und Unsicherheit. Ist denn das System über-haupt gut durchdacht? Es wird sicherlich Startschwierigkeiten geben. Sollen wir die ausbaden? Wie genau werden die Prüfungen
aussehen? Müssen alle Teilprüfungen einzeln bestanden werden oder zählt das Gesamter-gebnis? Helfen mir denn da überhaupt die Alt-klausuren oder muss ich wirklich den gesamten Stoff selbst lernen? Diese und noch viele weite-re Fragen bewegten schon am ersten Tag viele und für einige waren sie sicher ein Grund nicht an die LMU zu gehen. Denn längere Zeiten der Entspannung und Urlaubstrips lässt dieses Sys-tem natürlich während des Semesters nicht zu. Andere wiederum entschieden sich aber gera-de deshalb für die LMU, da sie der Meinung waren dadurch großen Abschlussklausuren am Semesterende zu entgehen. Das Konzept hat also sowohl Vor- als auch Nachteile und viele der Fragen konnten und können teilweise bis heute nicht vollständig beantwortet werden.
Sonderfälle gibt es immer
Ein großes Problem, das folgt wenn ein altes System beendet wird und ein neues folgt, ent-steht dann, wenn es sogenannte Sonderfälle gibt. Wie bereits gesagt, folgt an der LMU auf den vorklinischen Abschnitt immer und ohne Ausnahme das Modul 1. Wenn also Studenten erst im Sommersemester in den klinischen Ab-schnitt kommen, müssen diese zunächst das Modul 1 wählen und dann im kommenden Winter in das Modul 3 bzw. Modul 2 wechseln. Dadurch und durch andere Gründe kam es zu
Die Themenblöcke Die acht Themenblöcke sind im Einzelnen
der AINS-Block (Anästhesie, Intensiv-, Notfallmedizin und Schmerztherapie)
der Organblock Blut und Immunologie
das endokrinologische System
das gastrointestinale System
das kardiovaskuläre System
der Organblock muskuloskelettales System
das nephrourogenitale System
und das respiratorische System.
Zusätzlich, bestimmten Blöcken zugeordnet, finden auch die Trauma- und Rheumawoche, sowie das Blockpraktikum „Innere Medizin“ und das Blockpraktikum „Chirurgie“ statt.
Blockübergreifender Unterricht
Freitags wird außerdem sogenannter „block-übergreifender Unterricht“ angeboten. Dazu zählen die sogenannten interdisziplinären Vor-lesungen, die primär nicht prüfungsrelevant sind, aber auch Veranstaltungen, deren Inhalt in besonderen Prüfungen abgefragt wird. Dies sind die klinisch-pathologische Konferenz und die klinisch-pharmakologische Konferenz.
Der dort behandelte Stoff hat primär über-haupt nichts mit dem eigentlichen Stoff des Blockes zu tun, wird aber im Falle der Patholo-gie durch drei Fragen in jeder Blockklausur und im Falle der Pharmakologie durch zwei Prüfun-gen à 5 Fragen pro Semester abgeprüft. Diese dort gesammelten Punkte sind schließlich für die Abschlussklausuren in Modul 4 und 5 von großer Bedeutung.

Synapse24 www.synapse-redaktion.de
der Situation, dass Studenten bereits entweder Modul 2 oder Modul 3 abgeschlossen hatten, aber noch ein Semester Modul 2 oder 3 aus-stand. Diese Leute nennt man „Übergangsstu-denten“ und dieser Begriff wird für viele Leute, sowohl für die Modul 23-Studenten, als auch für die Mitarbeiter an der Universität, zum Un-wort des Jahres werden. Ich habe jetzt noch ein Bild vor meinen Augen: Der Aufschrei, der plötzlich aus den hinteren Reihen des Hörsaals aufkam und die Gesichter empörter Studenten, die schon damals auf die kommenden Proble-me hinwiesen. Dies wurde meines Erachtens aus der heutigen Erfahrung her nicht ernst ge-nug genommen.
Irgendwann war dann die Präsentation und die Werbekampagne der Universitäten vorbei und die mittlerweile durchgeschwitzten Stu-denten in den warmen Sommertag entlassen. Für einige war die Veranstaltung ein Erfolg, wussten sie doch jetzt für welche der beiden Universitäten sie sich entscheiden werden. Andere waren nach der Vorstellung eher un-entschieden und so manche sicher geglaubte Entscheidung geriet ins Wanken. Doch viel Zeit zum Nachdenken blieb nicht. Das Physi-kum näherte sich rasend schnell. Und genau-so schnell war es dann auch vorbei und für diejenigen, die wie ich sich für die LMU ent-schieden hatten, folgte im Winter zunächst das Modul 1 und die Gewissheit, dass das Lern-pensum in der Klinik keinesfalls kleiner wird. Ganz im Gegenteil! Das Modul 1 toppt wahr-scheinlich jedes Semester. Dennoch ging auch dieses irgendwann vorbei und im Mai 2011 folgte schließlich das Modul 23.
Mein Modul 23
Ich war im Sommersemester 2011 in die The-menblöcke endokrines System (ENDO), gast-rointestinales System (GASTRO), Anästhesie, Intensiv-, Notfallmedizin und Schmerzthe-rapie (AINS), sowie in das kardiovaskuläres System (KARDIO) eingeteilt. Die Vorfreude auf Modul 23 war groß, da nach nun fast 2 ½ Jahren Studium die klinische Medizin im Vor-dergrund stand. Der Beginn des Modul 23 war auch sehr vielversprechend. Der ENDO-Block war dafür, dass er nun zum ersten Mal durch-laufen wurde, gut organisiert. Die 90-minüti-gen Vorlesungen fanden nachmittags ab 12:15 Uhr statt, sodass man den Morgen zur freien Verfügung hatte. Montags und dienstags waren
die Internisten an der Reihe. Donnerstags hiel-ten die Chirurgen ihre Vorlesungen. Der Stoff, der in diesen Stunden vermittelt wurde war umfangreich, aber dennoch gut zu bewältigen. Montags und dienstags gab es dann zusätzlich noch Seminare. Auch diese waren, etwas ab-hängig vom Dozenten, gut und vertieften den Stoff der Vorlesung bzw. sprachen weitere The-men an.
Die Tutorials waren für den Dienstag und Donnerstag angesetzt. Dabei wurden wir dienstags von einem Internisten und donners-tags von einem Chirurgen betreut. Die Arbeit in den Kleingruppen entsprach vom Konzept auch den Erwartungen und war sicherlich im Sinne des problemorientierten Lernens erfolg-reich. Leider war aber gerade diese Veranstal-tung sehr von der Motivation und dem Enthu-siasmus der betreuenden Ärzte abhängig. So gab es wirklich tolle Tutorials, in denen die Stimmung super war, der Lernerfolg stimmte und die Zeit schnell vorbei ging. Andere dage-gen wurden von Ärzten betreut, die offensicht-lich nicht allzu große Lust hatten und diese Stimmung auf die Gruppe übertrugen.
Übergangsstudent oder Überflieger?
Ein weiteres Problem, das hier zum Tragen kam, zeigte sich in der Ähnlichkeit der Tuto-rials zu denen des Modul 2 bzw. 3. Denn für viele Übergangsstudenten waren die Fälle be-kannt, sodass diese häufig so schnell die Auf-gabenstellungen bearbeiten konnten, dass für viele neue Modul 23-Studenten keine Zeit zum Nachdenken blieb und damit der eigentliche Sinn, nämlich das Erkennen der eigenen Wis-sensgrenzen, häufig nicht erfüllt wurde.
Auch die Tatsache, dass ein Tutorial, das nor-malerweise aus 10-12 Teilnehmern bestehen sollte, plötzlich mit bis zu 20 Teilnehmern die Kapazitäten der Räume sprengte und der ge-wollte Kleingruppenunterricht dadurch ad absurdum geführt wurde, zeigte die fehlende Berücksichtigung der etwa 150 Übergangsstu-denten in diesem Lehrkonzept.
Ich erinnerte mich wieder an den Tag der universitären Werbekampagne und die schon damals geäußerten Bedenken, die nicht ernst genommen worden sind. Ob hier, mit der Ge-wissheit, dass es sich um einen einmaligen Zustand handelte, einfach auf Zeit gespielt
worden ist und deshalb keine adäquaten Vor-kehrungen getroffen worden waren? Dies ist kein Versäumnis des ENDO-Blocks, sondern der gesamten Modul 23-Organisation und war in allen Blöcken gegenwärtig.
Ein weiterer Mangel, der auch schon im EN-DO-Block aufgefallen war, war die für viele unzureichende Aufklärung über den genauen Ablauf der Klausuren und OSCEs. Viele Fra-gen blieben lange Zeit ungeklärt und konnten bzw. wollten vielleicht auch nicht von Dozen-ten geklärt werden. Besonders die Hinfüh-rung zu unseren ersten mündlich-praktischen Prüfungen in unserem Studium hätte besser durchgeführt werden können. Einen Katalog an Fertigkeiten, der für jeden Block relevant ist wäre wünschenswert. So könnten die Stu-denten sich gut auf eine solche Prüfung vor-bereiten und das, was für das Arztsein wichtig ist, erlernen. Dies hatte der AINS-Block z.B. in vorbildlicher Weise hinbekommen.
Klausur fair, OSCE ... naja
Ansonsten verlief der erste ENDO-Block aber gut. Die abschließende Klausur war den-ke ich größtenteils fair. Das OSCE dafür eher problematisch. Während in der internistisches Station eine Schilddrüsenuntersuchung bei Verdacht auf Morbus Basedow durchgeführt werden sollte und dort ein Arzt die Prüfung leitete, wurde in der chirurgischen Station ein Aufklärungsgespräch über eine kardiovaskulä-re Interventionsmethode an einem standardi-sierten Patienten verlangt.
Das Thema Angiographie bzw. PTA (perkuta-ne transluminale Angioplastie) hat aber, nicht nur nach meinem Empfinden, relativ wenig mit Endokrinologie gemeinsam, bis auf die Gegebenheit, dass ein endokrinologischer Pa-tient, der Diabetiker, häufig eine Mediasklero-se entwickelt und deshalb gegebenenfalls eine PTA braucht. Wenn aber ein solches Verfahren noch nicht unterrichtet worden ist und es da-rüber hinaus Thema eines anderen Blockes, nämlich des KARDIO-Blocks ist, ist es unfair ein Aufklärungsgespräch über die Komplikati-onen dieser Technik zu verlangen. Außerdem denke ich, dass eine universitäre Prüfung nur von einem Wissenschaftler an der Universität, in diesem Fall von einem Arzt, abgenommen werden sollte. Es kann nicht sein, dass der Stu-
QuickFactDie geschätzte Länge aller Axone im menschlichen Gehirn beträgt etwa 500.000 Kilometer. Zum Vergleich: Die Entfer-nung zwischen Erde und Mond ist ca. 380.000 km
Bild: egonpin // openclipart.org

Synapse 25www.synapse-redaktion.de
dent der Willkür eines standardisierten Patien-ten ausgesetzt ist.
Keine Einsicht und keine Musterlösungen
Obwohl nach den ersten Prüflingen die Auf-gabenstellung und die Zeitproblematik der Prüfung bekannt war und viele sich nochmals speziell vorbereiteten, waren die veröffentlich-ten Ergebnisse im Vergleich zu den Ergebnis-sen der internistischen Station und der Klau-sur deutlich schlechter. Bedauerlicherweise hatten wir bis zum heutigen Zeitpunkt (Stand 08.09.2011) keine Gelegenheit der Einsicht-nahme. Weder im Fall der Klausuren, noch im Fall der OSCEs sind bis heute Musterlösungen veröffentlicht worden. Wie soll der Student die Benotung nachvollziehen können? Wie soll er sich verbessern, wenn er nicht weiß, was er falsch gemacht hat?
In diese Problematik spielt auch die lange Wartezeit auf die Bekanntgabe der Ergebnisse hinein. Bis heute fehlen die OSCE-Ergebnisse der beiden letzten Blöcke, sowie die Klausurer-gebnisse von beiden Pharmaklausuren und des letzten Blockes! Die erste Pharmaklausur liegt mittlerweile schon mehr als 10 Wochen zu-rück. Dies fördert die Zufriedenheit unter den Studenten sicherlich nicht. Auch der Unter-richtsausfall, der teilweise sehr hoch war, ver-ärgerte viele. Man kann es ja verstehen, dass aufgrund von „Notfällen“ ein Dozent mal nicht erscheinen kann. Leider er-folgte selten eine Entschul-digung oder Information und Ansprechpartner, wie z.B. Blockverantwortliche waren häufig nicht erreichbar.
Im GASTRO-Block sind z.B. leider einige chirurgische Vorlesungen ausgefallen. Da die Chirurgie be-zogen auf die Anzahl der Fragen in der Lehre sowieso etwas zu kurz kommt, verschärfte dies die Situation. Viele E-Mails von Kommilitonen
an die zuständigen Personen blieben leider wirkungslos. Der AINS-Block stellt hier eine Ausnahme dar. Er war nicht nur gut organi-siert, sondern darüber hinaus auch ebenso gut durchgeführt. Hier waren auch die Themen der OSCEs bekannt, sodass die Studenten sich gut auf die Prüfung vorbereiten konnten.
Der KARDIO-Block war im Großen und Ganzen auch in Ordnung. Ein Dozent äußerte sich aber verärgert über die neue Situation in Modul 23. Er müsse nun pro Semester viermal die gleiche Vorlesung halten, was seiner Mei-nung nach ein großer Dozentenverschleiß sei. Von etwa 50 Leuten in einem Block erschienen in der Regel auch nicht viel mehr als 20 – 30, sodass er aufgrund der geringen Anzahl an Studenten, die in der Vorlesung waren, keine große Lust mehr auf Unterricht hatte. Er kam dann auch die nächsten Vorlesungen nicht mehr, sodass diese von seinem Assistenten ge-halten worden sind.
Ein Vorschlag
Ein Vorschlag von mir für die Pathologie bzw. Pharmakologie: es würde Sinn machen patho-logische und pharmakologische Fragen zu den jeweiligen Blöcken zustellen und entsprechen-de Unterrichtsveranstaltungen anzubieten.
Leider sind die pathologischen Fragen mo-mentan noch sehr speziell und können mit
dem Begriff „Allgemeinwis-sen“ nicht immer in Verbin-dung gebracht werden. Ohne die Vorlesung sind sie häufig nicht zu beantworten. Zu-sätzlich aber zum eigentli-chen Stoff des Organblocks aus anderen Themenberei-chen exotische Tumormarker
oder ähnliches auswendig zu lernen, erscheint mir nicht so sinnvoll. Dagegen wäre eine pa-thologische Betrachtung der blockspezifischen Krankheiten durchaus interessant. In Pharma-
kologie werden zwar Fragen zu den letzten beiden Themenblöcken gestellt, spezielle Lehr-veranstaltungen aber nicht immer angeboten.
Mein Fazit
Ich habe bewusst die Probleme im Modul 23 hervorgehoben - es ist nur verständlich dass im ersten Jahr nicht alles klappt - vieles hat aber auch bereits gut funktioniert. Die ursprüng-lichen Ziele des Modul 23 sind größtenteils aufgegangen: Man hat ausreichend freie Zeit sich mit dem jeweiligen Thema auseinander zu setzten. Die Vorlesungen sind von hoher Qua-lität und die Seminare ergänzen die Inhalte der Vorlesung gut. Besonders der Kleingruppenun-terricht in Tutorial und Bedside-Teaching ist super. Das Wissen, das hier vermittelt wird, ist wirklich essentiell. Ich möchte hier mich auch bei all den Dozenten bedanken, die mit vollem Enthusiasmus ihr Wissen in toller Art und Wei-se weitergeben und auch die Organisatoren lo-ben, die viel Zeit und Mühe in die Entwicklung des Unterrichts gesteckt haben.
Es ist immer leicht zu kritisieren und Schwachstellen aufzuzeigen. Entscheidend ist es aber, dass man nicht nur über die Schwä-chen redet, sondern sich hinsetzt, diese analy-siert und schließlich beseitigt. Ich denke, dass deshalb die Mitarbeit von Studenten in den Organisationsteams von großer Bedeutung ist. Ich selbst versuche zusammen mit anderen z.B. im ENDO-Block mitzuarbeiten und die-sen zu verbessern. Wenn auch ihr Lust habt mitzuhelfen, so kann ich euch nur dazu ermu-tigen, mal bei einer Fachschaftssitzung vorbei-zukommen und euch in einen Organblock ein-zubringen. Dadurch wird ein jetzt schon tolles Projekt noch besser.
Modul 23 ist ein super Sache! Es wird sich für jeden positiv auf seine ärztliche Zukunft auswirken.
Die pathologischen Fragen lassen sich mit dem Begriff „Allgemeinwissen" nicht immer
in Verbindung bringen
Die Fachschaft ist für alle da!Warum Fachschaft?Weil das Studentenleben ohne Fachschaft nur halb so spannend wäre!
Wir sind für Dich da, wenn es rund ums Studi-um geht – ESI-Einführung, Skriptenverkauf, An-sprechpartner bei Problemen – aber auch wenn Du nach einer anstrengenden Klausur einfach nur abschalten möchtest ... auf einer unserer legendären Medizinerpartys. Last but not least steckt natürlich auch die Fachschaft (mittler-weile beider Unis!) hinter Deiner Synapse.
(Es war in der Tat eine dieser Mediziner-Partys die Euren geliebten Chef-Redakteur zum besten
Studium der Welt gebracht hat, aber ich schweife ab ...)
Die Skripten verkaufen sich natürlich nicht von alleine, aber auch die Partys organisieren sich nicht von alleine. Grund genug für Dich, uns mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite zu stehen!
Und eines Tages, wenn Dich jemand fragt: was hast Du aus Deinem Leben gemacht? Kannst du stolz sagen: ich war bei der Fachschaft, und es war die beste Zeit meines Lebens!.
http://www.fachschaft-medizin.de
http://med.fs.tum.de/
© Marcos Santos // sxc.hu

Synapse26 www.synapse-redaktion.de
In einem Wald sitzt ein Affe und setzt sich gerade eine Spritze an,als plötzlich ein Hase des Weges kommt und zum Affen meint: „Scheiss Drogen, Drogen sind scheisse.Komm wir gehen joggen!“ Der Affe packt sein Zeug widerwillig weg und joggt mit.Nach einer Weile kommen sie zu einem Bären, der sich gerade eine hübsche „weisse Strasse“ reinzie-hen will.Doch bevor der Bär auch nur ein bisschen was erwischt, meint der Hase wieder: „Scheiss Drogen. Drogen sind scheisse. Komm, geh mit uns joggen!“Also packt auch der Bär zusam-
Dieser Artikel ist ein Andenken an meinen Freund Korbi, der sich im Frühjahr dieses Jahres das Leben genommen hat ... er war auf chemischem Gebiet ein Genie, und auch sonst ein sehr besonderer Mensch. M
an konnte sich stundenlang mit ihm
unterhalten ... vor allem über das Them
a Frauen. Das war es, was ihn am Ende verzweifeln ließ. Und die Welt wurde ganz bestimmt um einige bahnbrechende neue Ideen auf dem Gebiet der Opioide beraubt. Wir standen kurz davor, eine seiner N
euen
twick
lung
en a
n ei
ner M
aus
zu te
sten
... W
enn
das
Lebe
n an
ders
gel
aufe
n wä
re, w
ärst
du
noch
hie
r ...
RIP
Korb
i.
Heroin ist ein Opioid mit einem sehr hohen Abhängig-keitspotential. Es wurde ab
1898 von Bayer u.a. als „nicht süchtigmachendes Medikament"
gegen die Entzugssymptome des Morphins und Opiums vermarktet.
In den USA früh wegen politischen Grün-den verboten (da die chinesischen Einwan-derer oft Opium rauchten und später auch Heroin konsumierten), kam das Verbot in Deutschland erst 1971.
Heroin ist lipophil, gelangt rasch ins Ge-hirn, daher kommt es bei i.v.-Gabe zu ei-nem initialen „Kick". Es wird im Körper fast sofort zu 6-MAM deacetyliert, das wiederum am μ-Opioidrezeptor wirkt.
Es wirkt stark euphorisierend und analge-tisch. Es hat eine dämpfende und fokussieren-de Wirkung auf die Bewußtseinswahrnehmun-gen, viele Sorgen werden einem gleichgültig.
Nebenwirkungen sind u.a. Mundtrockenheit, Atemdepression, Übelkeit und Verstopfung.
Interessanterweise sind die μ2-Rezeptoren im GI-Trakt gar keiner Toleranzentwicklung unterworfen, so dass die Verstopfung beste-hen bleibt. Es ist also durchaus nicht selbst-
verständlich, dass es Toleranz-entwicklung im Gehirn gibt!
Bei einem Süchtigen wirkt Heroin etwa 6 - 8 Stunden, wonach die Entzugserscheinungen wieder einsetzen. Die Menge muss aufgrund der Toleranzentwick-
lung ständig gesteigert werden, so dass die meisten auf i.v.-Kon-sum umsteigen. Für den i.v. - Konsum muss Heroin „aufgekocht werden“, d.h. es wird durch Erhitzen mit bspw. Ascorbinsäure ein wasserlös-liches Heroinsalz gebildet.
Der Konsum von reinen Opioiden generell führt zu keinen Organschädi-
gungen, auch bei Langzeitgebrauch. Die 20 - 50 fach erhöhte Sterblichkeit lässt sich hauptsächlich auf den sozialen Abstieg, das Leben in der Drogenszene, und indirekte Ge-sundheitsschäden zurückführen.
Beim sogenannten „goldenen Schuß“ sind meistens andere Substanzen mit im Spiel, bspw. Alkohol oder Benzodiazepine.
Bei einer in Deutschland durchgeführten Stu-die sind bei einer Substitution mit Heroin im Vergleich zu Methadon zwar mehr Zwischen-
fälle aufgetreten, die gesundheitliche und soziale Situation der Patienten hat sich
aber singnifikant gebessert. Seit dem Mai 2009 ist Heroin für die Subs-
titution Schwerstsüchtiger daher wieder zugelassen worden. Groß-
britannien bleibt aber mo-mentan das einzige Land der Welt, in dem Ärzte
Süchtigen Heroin auf Re-zept ausstellen können.
Yoko Ono und John Lennon haben Heroin konsumiert, jedoch nie gespritzt (das Paar hat-te Angst vor Nadeln). Yoko Ono sagte dass sie von einem gierigen Drogendealer vor starker Sucht bewahrt wurden – dieser hatte das He-roin mit Babypuder verdünnt.
Heroin
Die ersten Kokainsträuche kamen bereits 1750 aus Süd-amerika nach Europa. Ein-einhalb Jahrhunderte darauf, im Jahr 1898, beschrieb der spätere Nobelpreisträger Richard Willstätter wäh-
rend seiner Doktorarbiet an der Universität München erstmalig die Mole-kularstruktur von Kokain.
Es wurde ab 1879 verwendet, um Morphin-abhängigkeit zu behandeln. Es wirkt schmerz-stillend, und wurde daher in Deutschland auch als das erste Lokalanästhetikum überhaupt be-nutzt.
Sigmund Freud beschrieb die Wirkung des Kokains als „anhaltende Euphorie die sich von der normalen Euphorie des gesunden Menschen in gar nichts unterscheidet.“ Er er-wähnt eine Zunahme der Selbstbeherrschung, Lebenskraft und Arbeitsfähigkeit, jedoch kei-ne Steigerung der geistigen Kräfte (wie etwa durch Alkohol, Tee oder Kaffee).
Ein Liter Coca Cola (Name!) enthielt bis 1906 rund 250 Milligram Kokain, heute sind nur noch 100 mg Koffein darin enthalten.
Wie bei Kokain auch kommt es zu einer schnellen Toleranzentwicklung, und vor allem starken Depressionen nach der anfänglichen
Euphorie, die die Konsumenten schnell wieder zur Droge greifen lässt.
Pharmakologisch gesehen ist Kokain ein Wie-deraufnahmehemmer an Dopamin-, Noradre-nalin- und Serotonin-Nervenzellen. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Signalaufkom-men an den postsynaptischen Rezeptoren. Die Nebenwirkungen bei zu hoher Dosierung fol-gen zwanglos daraus: Nervosität, Angstzustän-de und paranoide Stimmungen.
Bei Langzeitabhängigen von Kokain fallen die Zähne aus, und es kommt u.a. zu Charakter-veränderungen und chronischem Dermatozo-enwahn (der Wahnvorstellung dass sich Lebe-wesen unter der Haut befinden und bewegen).Personen mit unentdeckten, an sich harm-losen Herzfehlern können bereits nach einmaligem Kokainkonsum sterben.
K o k a i n wird, wie Heroin, intra-nasal oder intravenös konsumiert. Manch-mal sogar in einer ge- fährlichen Kom-bination entgegengesetzer Wirkungen namens „SpeedBall“ zusammen mit Heroin. Cocapaste und Crack (Kokainsalz das mit Natron ver-mischt und erhitzt wurde) werden geraucht.
Crack ist die Droge mit dem höchsten psy-chischen Abhängigkeitspotenzial (gefolgt von Nikotin und Heroin) – seine Wirkung ist viel stärker und schneller als andere Kokain-Kon-sumformen. Genauso schnell verfliegt sie auch wieder, und die Depression setzt ein, so dass ein „Stein“ dem anderen folgt.
Manche mit Methadon substituierte Heroin-abhängige holen sich mittels Kokain
den Kick, der ihnen beim Metha-don fehlt. Das stellt für die
Therapie eine große Hür-de dar, weil die Ablösung vom alten Umfeld stark erschwert wird.
Nach Schätzungen liegt der Jahresverbrauch von Kokain in Deutsch-land bei 20 Tonnen. Zum Vergleich: es
werden in Deutschland pro Jahr ca. 62 Tonnen Gewürze verbraucht.
Kokain
rast
rojo
// o
penc
lipar
t.org
tatica // openclipart.org
Kokain
Heroin

Synapse 27www.synapse-redaktion.de
men und joggt nicht ganz freiwil-lig mit.
Kurz darauf begegnen sie einem Löwen, der sich gerade in aller Ruhe einen Joint dreht.Doch der Hase meint wieder: „Scheiss Drogen. Drogen sind scheisse. Komm mit!“ Der Löwe dreht sich den Joint fertig, zün-det ihn an und haut dem Hasen so eine runter, dass der quer durch die Gegend fliegt.Der Affe und der Bär ganz ver-dutzt: „Wieso hast Du das jetzt gemacht?"Darauf der Löwe: „Mir reicht's. Immer wenn der Hase auf Ecstasy ist, müssen wir joggen!“
Dieser Artikel ist ein Andenken an meinen Freund Korbi, der sich im Frühjahr dieses Jahres das Leben genommen hat ... er war auf chemischem Gebiet ein Genie, und auch sonst ein sehr besonderer Mensch. M
an konnte sich stundenlang mit ihm
unterhalten ... vor allem über das Them
a Frauen. Das war es, was ihn am Ende verzweifeln ließ. Und die Welt wurde ganz bestimmt um einige bahnbrechende neue Ideen auf dem Gebiet der Opioide beraubt. Wir standen kurz davor, eine seiner N
euen
twick
lung
en a
n ei
ner M
aus
zu te
sten
... W
enn
das
Lebe
n an
ders
gel
aufe
n wä
re, w
ärst
du
noch
hie
r ...
RIP
Korb
i.
Cannabis ist in der Bundesrepublik die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Meistens wird es als Joint geraucht, oder in Form verschiedener Lebensmittel gegessen („Space- Cookies“). Im letzteren Fall ist der Eintritt der Wirkung um bis zu zwei Stunden verzögert.
Um mit Marihuana high zu werden braucht man allerdings die richtige Technik: es wird ein tiefer Zug genommen, und die Luft wird lange gehalten. (Mir wird jetzt so einiges klar). Der Genuß der Wirkungen – d.h. ver-änderter Wahrnehmung und veränderter Denkprozesse – von Cannabis scheint eine Lernerfahrung zu sein, in etwa wie Kaffee oder Bier – welche Kinder mögen schon von Geburt an schwarzen Kaffee?
Die Wirkung lässt sich hauptsächlich auf das Δ9 Tetrahydrocannabinol, kurz THC zurückführen. Es wirkt an den Rezeptoren CB1 und CB2, die zum körpereigenen Endo-cannabinoid-System gehören. 1992 konnten Forscher aus Schweinehirnen die erste Kör-pereigene Substanz die an CB1 bindet isolie-ren: Anandamid (Ananda: Glückseligkeit in Sanskrit). CB2 - Rezeptoren kommen haupt-sächlich in Immunzellen vor, und sind an der Zytokinausschüttung beteiligt, während die CB1 – überwiegend auf Nervenzellen vor-handen – die psychotropen Wirkungen von Haschisch vermittelt.
Akute Nebenwirkungen des High-Seins sind u.a. Lach-Flashes, Tachykardie und Heiß-hunger. Das Gehirn entwickelt eine Toleranz für THC, es kann auch zu milden Entzugs-erscheinungen kommen, die aber nur kurz andauern. Langfristig kann es dennoch zu Nebenwirkungen kommen. Cannabis kann in einer komplexen Konstellation mit ande-ren Faktoren Psychosen oder Schizophrenie auslösen. Eine Metastudie in 2011 stellte bspw. fest, dass bei Jugendlichen mit psycho-tischen Erkran- kungen diese bei THC Konsum durchschnittlich um 2,7 Jahre früher einsetzte. Die Effekte auf das E r i n n e - rungs-vermögen schei-
nen komplexer zu sein als nur eine Verschlechterung, in manchen Fällen kommt es so-gar zu einer Verbesserung.
Medizinisch wurde Hanf be-reits seit Jahrtausenden auf viel-fältigste Weise eingesetzt:
Es hilft gegen Schmerzen, Spastiken (bspw. bei Multipler Sklerose), Arthritis, Depressi-on, Übelkeit, Erbrechen und Anorexie. Es ist deswegen besonders interessant als sympto-matische Medikation der Nebenwirkungen bei Chemo- und Strahlentherapie und der HIV-Medikation, sowie in der palliativen Therapie. In 2005 und 2010 durchgeführten Studien an Mäusen konnte außerdem ein po-sitiver Effekt auf chronische Arteriosklerose demonstriert werden, wobei die THC Dosis niedrig genug war um keine psychotropen Wirkungen bei den Mäusen auszulösen.
In Deutschland ist Cannabis seit dem Mai dieses Jahres (2011) zur Herstellung von Arz-neimitteln verkehrsfähig, und cannabishaltige Fertigarzneimittel sind verschreibungsfähig.
Der Einsatz von THC ist ein spannendes und vielversprechendes Gebiet innerhalb der Medizin, das frei von Vorurteilen erfol-gen sollte – zum Wohle unserer Patienten.
MDMA
(RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-methyl-propan-2-amine oder einfach MDMA ist die Hauptkomponente in den kleinen bunten Pil-len auf den Raver-Partys: Ecstasy.
MDMA wird durch Monoamin-Transporter (MATs) in die Neuronen aufgenommen. Dort hemmt es einerseits vesikuläre Monnoamin-Transporter (VMAT), so dass es zu einem Kon-zentrationsanstieg von Seretonin, Noradre-nalin und Dopamin im Zytoplasma kommt, andererseits stimuliert es ihre Freisetzung aus dem Neuron, indem es die Transportrichtung der MATs umdreht. Die Freisetzung von Do-pamin aktiviert die Beloh-nungszentren im Nucleus accumbens. Das freigesetzte Serotonin setzt über weite-re Systeme Oxytocin frei. Oxytocin wird bei der Ge-burt, beim Stillen und auch beim Orgasmus freigesetzt - es vermittelt Lie-be, Nähe und Vertrauen, und spielt eine wich-tige Rolle bei menschlichen Bindungen.
Zusätlich bewirkt MDMA milde psychedeli-sche Effekte - Farben, Formen, Töne werden klarer und schärfer wahrgenommen, Berüh-rungen sind angenehmer. Es besteht ein erhöh-ter Drang mit anderen zu kommunizieren, und sich zu bewegen.
Einige buddhistische Mönche nutzen kleine Mengen von MDMA als sogenanntes Entheo-gen, d.h. eine psychoaktive Substanz die tiefe religiöse Erfahrungen begünstigt oder gar erst ermöglicht. Das war früher MDMAs haupt-sächliche Anwendung: im therapeutischen Setting. Einige Psychotherapeuten behaupten dass der Effekt von nur zwei Stunden MDMA einem Jahr Therapie ähnelt.
Nebenwirkungen sind gedrückte Stimmung, erhöhte Ängst- lichkeit und Stress bis zu einige Tage nach der Einnahme. Akut wirkt MDMA entwässernd
und temperaturstei-gernd, Es können Temperaturen von
40 bis 42° erreicht werden, da-durch kann
es im schlimmsten Fall zu Multiorganversagen und Tod führen. Eine weniger bedroh-liche Nebenwirkung ist das Zähneknirschen. Erfahrene
Raver ken-nen das Problem und improvisieren aus bspw. Leuchtstäben Aufbissschie-nen.
David Nutt, ehemals Vorsitzender des Beirats für Drogenmißbrauch im Vereinigten König-reich (UK) vergleicht das Risiko MDMA zu nehmen mit Pferde-Reiten: Ecstasy-Gebrauch führe in der UK zu dreißig Todesfällen pro Jahr, Reiten zu zehn Todesfällen. Allerdings komme ein „schwerer körperlicher Schaden“ auf 10 000 Ecstasy-Einnahmen, während beim Reiten 1 schwerer Schaden auf 350 Ausritte kommt. Auch die Presse berichtet unausgegli-chen – jeder Tod nach Ecstasy-Konsum wird berichtet, aber nur einer pro 250 Tode aufgrund von Paracetamol kommt in die Schlagzeilen.
Erfahrene Benutzer sagen, dass MDMA zwar eine „Liebesdroge“, aber keine „Sexdroge“ ist. Unter dem Einfluß von MDMA hat man(n) Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen und zum Orgasmus zu kommen. Aber dafür gibt es ja Sextasy (MDMA mit Viagra)!
THC
Cannabis
"Friendly rabbit": danko // openclipart.org
MDMA
Bonus: Thema Drogen
http://www.synapse-redaktion.de/56-drogen
Bon
us
mas
simo
// o
penc
lipar
t.org
von Maximilian Batz

Synapse28 www.synapse-redaktion.de
„Warum?“, so könnte man fragen. Ebenso gut auch: „Wie?“ Was treibt einen frischgeba-ckenen Physikumsabsolventen denn eigentlich dazu, sich ernsthaft an das Saxo-phonspiel zu machen, fast ohne über die ge-ringste musikalische Ex-pertise zu verfügen?
Ich will versuchen, in der nächsten Ausgabe der Sy-napse einen kaleidos-kopischen Über-blick über M e n -s c h e n zu ge-b e n , d i e a u s
v e r -s c h i e -d e n s t e n Lebenssituatio-nen heraus eine t i e f g r e i f e n d e Annäherung an das Musizieren wagen. Vielleicht, so meine ich, be-fördert der Ver-gleich mit dem eige-nen Beispiel die Annäherung an meine wahre Motivation, die gegenwärtig von emotionalen Impulsen überschattet scheint.
Eine jungfräuliche Lust treibt mich – möge sie wohl im Musikarchiv meiner Festplatte wurzeln! Ich bestelle den Acker im Üben und Lernen und ersehne die Ernte herbei! Reife, Frucht! Erblühe zur Leidenschaft!
Musik erleben
Beschäftigen wir uns einstweilen besser mit dem „Wie“. Musikwahrnehmung und -pro-duktion, deren Improvisation sowie die Art und Weise, wie Musik unsere Gefühle berührt sind aus Perspektive der Neurowissenschaften faszinierende Sachverhalte. Offenbar berührt Musik in der Gesamtheit ihrer Teilaspekte sämtliche kognitiven Leistungen des menschli-chen Gehirns: Sensorik, Motorik, Gedächtnis, Emotion und Kreativität, um nur die vordergrün-digsten zu benennen.
Selbst visuelle und gar gustatorische Kompo-nenten können beteiligt sein. Bereits intuitiv neigen wir dazu, Klänge als süß oder Töne als dunkel zu beschreiben. Nur wenige Menschen
koppeln diese Sinneseindrücke allerdings so real, das man von Synästhesie sprechen kann. So zeigt die professionelle Flötistin E.S. auf Darbietung eines induzierenden musikalischen Intervalls hin eine kon-kurrierende Geschmacksemp-findung, die ihr hilft, Intervalle sicher und schnell zu
i d e n t i -f i z i e r e n . Beispiels-w e i s e
schmecken ihr die konso-
naten Intervalle einer Quinte wie reines Wasser und
eine große Terz süß, wo-hingegen die dissonan-ten Intervalle der großen Septine bzw. des Tritonus mit den Empfindungen
sauer und ekelerregend einhergehen.
Methodische Ansätze zur neurowissenschaftlichen
Erfassung des Phänomens Musik sindund bleiben jedoch begrenzt, allein eingedenk der Tatsache, dass ein Musikerleb-nis mehr ist als die Verarbeitung eines akusti-schen Signals.
Kontext bedeutet viel. Wagen wir den Ver-gleich! Wir erleben den virtuosen Pianisten Grigory Sokolov im Live-Konzert oder bekom-men die Einspielung seiner Darbietung in der bedrückenden Situation einer fMRT-Untersu-chung zu Gehör. Würde die fiktive Möglichli-ckeit, in beiden Fällen Einblick in das neuro-nale Aktivitätsmuster des Gehirn zu nehmen, ähnliches zu Tage fördern? Wichtiger und der Messbarkeit entzogen: Wäre unser subjekti-ves Erleben vergleichbar?
Survival of the most musical?
Ist der Genuß von Musik ausschließlich dem Menschen vorbehalte? Tatsächlich ist unsere musikalische Befähi-gung im Tierreich ein-zigartig und evolutionär
auch nur schwer zu begründen. Welchen Se-
lektionsvorteil hat Musik uns eröffnet?
Z u n ä c h s t scheint es gene -
rell sinnvoll, ein
Gehör ausge-bildet zu haben, um
akustische Elemente der Umwelt zu erfassen.
Mag nun ein Musikstück an das Brüllen eines Löwen, das Plätschern
eines Bächleins oder das Zwitschern eines Vogels erinnern, so kann man er-
ahnen, warum Musik zuweilen so sehr unsere Gefühle erregt.
Musik als solche könnte zu Gruppenkohä-sion beigetragen haben, sobald gegenseitiges Lausen seine Funktion als sozialer Kitt in An-betracht wachsender Gesellschaften einbüßen musste. Ferner wird ein Beitrag an der Selekti-on der Sexualpartner diskutiert. Ein Blick auf die frenetischen weiblichen Besucher eines
Auftritts Justin Biebers verbie-tet diesen Gedanken völlig zu verwerfen.
Oder handelt es sich gar um eine Funktion der Brutpflege,
welche im Laufe der Zeit Verallgemeinerung erfahren hat? Wir alle wissen um den beru-higenden Effekt, den Schlaflieder auf Kinder ausüben. Auch haben alle Kulturen ein ent-sprechendes Repertoire ausgebildet.
Am plausibelsten, und wissenschaftlich am Besten belegt, scheint die enge Verknüpfung zwischen Sprache und Musik zu sein, die sich auch neuro-strukturell nachweisen lässt. In dieser Sicht wäre Sprache als Mittel der Kommunikation die evolutionär sinnvolle Ad-aptation. Die zur Sprache befähigenden bio-logischen Dispositionen eröffneten allerdings gleichsam einen unspezifischen Spielraum, der gewissermaßen zufällig die Entstehung der Musik erlaubt hätte.
Musik ist gleich Sprache?
In einer simplen, vereinigenden Definition lassen sich Sprache und Musik als komplexe
akustische Signale, entfaltet im Verlaufe der Zeit, beschreiben. Ihre einfachsten Bestand-teile sind die Phoneme, charakterisiert durch die Klangfarbe bzw. die Noten, welche durch die Tonhöhe gegeben sind. Beiderseits erfolgt die Entfaltung nicht frei, sondern in einer komplexen Syntax, deren Konstruktion einem Regelwerk folgt: der Grammatik der jeweiligen Sprache oder der zugrunde liegenden Musik-theorie.
Gleichwohl ist die dichotome Parallelisierung von Musik und Sprache nicht ubiquitär auf-recht zu erhalten. So verwenden die Lokele des
Musik berührt sämtliche kognitiven Leistungen des menschlichen Gehirns
Für sie schmeckt eine große Terz süß, wohingegen dissonante Interval-
le sauer und ekelerregend sind.
Von Nils Engel
lifta
rn //
ope
nclip
art.or
g

Synapse 29www.synapse-redaktion.de
oberen Kongo-Gebiets große Schlitztrommeln zwecks Vermittlung sprachlicher Botschaften über große Distanzen, während sich die süd-ostasiatischen Hmong einer Art Pfeif-Sprache bedienen. Beides mutet dem westlich-enkultu-rierten Hörer sehr musikalisch an, dient jedoch letztlich der Kommunikation.
In Experimenten der Neurobildgebung offen-baren sowohl melodische als auch sprachliche Reize ein ähnliches bilaterales Aktivitätsmus-ter, welches im Falle des Sprachreizes deutlich in die linke Hemisphäre lateralisiert. Primär und supplementär-motorischer Kortex, Broca-Region, vordere Insel, primärer und sekun-därer auditorischer Kortex, Temporalpol, Ba-salganglien, vorderer Thalamus und hinteres Kleinhin sind unter beiden Reizen aktiv.
Sinfonie trifft Cochlea
Um das Phänomen Musik zu beschreiben, ist es sinnvoll, eine Untergliederung vorzu-nehmen. Die Tonhöhe der einzelnen Note ist durch eine Grundfrequenz gegeben, die ab-hängig vom Instrument eine Klangfarbe durch zusätzliche Obertöne erhält. Über die zeitliche Abfolge von Noten entsteht eine Melodie, wo-hingegen der Zusammenklang mehrerer Stim-men oder Instrumente Harmonie einführt. Die geregelte zeitliche Abfolge des Ganzen, die Pausen einschließt, bedingt den Rhythmus des Stücks. Jenseits der vorgegebenen Notation des Komponisten steht es dem Interpreten fer-ner frei, Tempo und Dynamik - also Lautheit - im Rahmen der Aufführung zu variieren, um dem Stück seinen individuellen Ausdruck zu verleihen.
Die Verarbeitung des akustischen Signals be-ginnt in der Cochlea, die trotz der Komplexität des späteren Sinneseindrucks über die wenigs-ten Sinnneszellen aller menschlichen Sinnes-organe verfügt: nur etwa 3500 innere Haarzellen pro Ohr.
Hier erfolgt bereits eine Art Fouriertrans-formation, die Zerlegung des Klangreizes in einzelne Frequenzanteile auf Basis der physi-kalischen Eigenschaften der Basilarmembran.
Hermann von Helmholtz, deutscher Physio-loge und Physiker, stellte in der Schrift Die Lehre von den Tonempfindungen als physio-logische Grundlage für die Theorie der Musik 1863 einen Erklärungsansatz vor, warum wir gewisse Zusammenklänge als dissonant, an-dere als konsonant empfinden. Demnach füh-re der Zusammenklang von Tönen derselben Frequenz über Interferenz der Schallwellen zur erhöhten Schallintensität. Zwei akustische Wellen ähnlicher aber nicht identischer Fre-quenz bedingen hingegen sogenannte Schwe-bungen: Phasenverschiebungen der sich über-lagernden Wellen münden positionsahängig in Auslöschungen oder Verstärkungen – Stö-ße – innerhalb des Signals. Bei größeren Fre-
quenzdifferenzen der zusammenklingenden Töne erreichen diese Tonstöße eine Frequenz von mehr als 20 - 30 Hz, womit sie, obgleich nunmehr der bewussten Wahrnehmung ent-zogen, eine unangenehme Sensation im Sinne eines „rauen“ Zusammenklangs nach sich zie-hen. Potenziell kann jede beliebige reale Note, die sich ja aus Grundfrequenz und Obertö-nen zusammensetzt, zu dieser unangenehmen Empfindung beitragen. Helmholtz wies jedoch nach, das dies insbesondere für auch wirklich als dissonant empfundene Inter-valle gilt.
So viel zur Physik – keinesfalls ist jedoch bewiesen, dass unserer Präferenz für Konsonanzen erb-lich ist. Zwar zeigen selbst Säug-linge diese Tendenz, die kulturelle Kondition beginnt jedoch bereits vorgeburtlich durch die Umwelt der werdenden Mutter. Auch scheint lediglich der Quinten- und Oktavintervall uni-versellen Eingang in die Tonsysteme der Erde gefunden zu haben – eben diejenigen Interval-le, die schon Pythagoras als die einzig konso-nanten gelten ließ.
Gut gestimmt auf deine Umwelt
Frequenzdiskrimination ist Basis der Mu-sikverarbeitung und wird von Tieren nochbe-
herrscht. Dabei lässt sich die Frequenzland-karte der Basilarmemb-ran auch für höher ge-schaltete Kortexareale zeichnen. Lokalisiert im
sekundären auditorischen Kortex, erlaubt uns die Funktion beispielsweise, verstimmte oder im falschen Schlüssel gespielte Töne einer Me-lodie zu erkennen. Die Aktivierung des Areals ist hierbei nicht auf unsere bewusste Aufmerk-samkeit angewiesen, scheint rechtsseitig ver-stärkt und beweist hier ein im Gegensatz zur linken Seite verfeinertes Auflösungsvermögen.
Vom Ton zur Melodie erfolgt ein Aufstieg in der Hierarchie: Das Aktivierungsmuster dehnt sich vom primären und sekun-dären auditorischen Kortex, dem Planum temporale und den medialen Heschl-Win-dungen auf den superior tem-poralen Kortex aus.
Wir erkennen in der Regel, ob verschiedene Instrumente die gleiche Note
spielen – unabhängig von ihrer Klangfärbung. Dies funktioniert sogar in Abwesenheit der eigentlichen Grundfrequenz in alleiniger Ext-rapolation von einer Zahl von harmonischen Oberschwingungen! Solchermaßen wird bei-spielsweise ein Signal, welches die Frequenz-anteile 800, 1000 und 1200 Hz beinhaltet, als zugehörig zur 200 Hz Grundfrequenz erkannt. Das entsprechende Neuron reagiert auf all die-se Frequenzanteile gleichermaßen und wurde vor Kurzem beim Seidenäffchen nachgewie-
sen.
Wer oder was stimmt eigent-lich diese Neurone? Experimen-te legen hier ein hohes Maß an Neuroplastizität nahe. Gezieltes Training auf einen Ton kann eine
signifikante Ausdehnung des auf den Stimulus hin erregbaren Bereichs bewirken. Der Musi-ker hört sein Instrument tatsächlich anders als andere!
Selbstverständlich lässt sich das Schema neu-roplastischer Umbauvorgänge bei extensivem musikalischem Training auf andere Leistungen den Gehirns übertragen. Man darf sagen: Des Violinisten motorischer Homunkulus verfügt über große Finger an der linken Hand.
Rythm is a dancer!
Das Rhythmusgefühl des Menschen steht im kritischem Zusammenhang mit der Funktion des phylogenetisch alten Vestibularapparats. Die Interpretation eines Rhythmus, beste-hend aus sechs nicht akzentuierten Schlägen, hängt davon ab, ob der Hörer diesen in drei Abschnitte aus zwei Schlägen oder zwei Ab-schnitte zu jeweils drei Schlägen unterteilen möchte. Somit wird entweder das Marsch- oder das Walzer-Schema erfüllt.
Gezielte Stimulation des Vestibularnervs am zweiten bzw. dritten Schlag vermag dieser Ent-scheidungsfindung eine schlüssige Tendenz zu verleihen.
Erfahrungsgemäß machen Rhythmen tanzwütig oder nö-tigen zumindest zum Vollzug synchronisierter Bewegung. Multiple Verknüpfungen zwi-schen auditorischen und mo-torischen Arealen zeichnen hierfür verantwortlich, wer-
den zivilisationsbedingt meiner Meinung nach
Die Coclea verfügt über die wenigsten SInneszellen aller menschlichen Sinnes-
organe.
Der Musiker hört sein Instrument tatsächlich
anders als andere!
Erfahrungsgemäß machen Rhythmen tanzwütig oder nö-tigen zumindest zum Vollzug synchronisierter Bewegung.
QuickFactFrauen verändern ihre funktionelle Hirnorganisation und die damit zusam-menhängenden kognitiven Leistungen während des Monatszyklus. rones // openclipart.org

Synapse30 www.synapse-redaktion.de
jedoch zu selten beansprucht. Die Natürlich-keit des Verlangens wird durch die Fähigkeit von Säuglingen unterstrichen, unter-einjährig sehr komplexe Rhythmen wahrnehmen zu können, wie sie in der Volksmusik fremder Kulturen häufig ausgebildet sind. Ohne Trai-ning geht jene Befähigung dann aber verloren, was die eher simplen Rhythmen westlicher Po-pulärmusik widerspiegeln.
Man ist versucht zu ahnen: Tanz ist existenzi-ell. Wohlan! Befreit euch, „An-die-Bar-Lehner“ dieser Welt! Ihr verpasst ‘nen Haufen Spass.
„Music sounds the way emotions feel“
(Caroll Pratt, Psychologe, 1931)
Die Streicher senken ein letztes Mal ihre Bö-gen, um neuerlich und letztlich zur triumpha-len Auflösung an zu heben: Wir nähern uns dem Finale dieser Betrachtung.
Stark fragmentiert, höchst willkürlich in der Auswahl wurde bisherig versucht, das Phäno-men Musik unter neurowissenschaftichen As-pekten zu beleuchten. Autor und Leserschaft vereinigen sich im Chor, um den so sträflich im Dunkeln belassenen Weg klagend zu besin-gen. Und siehe da! Sie erkennen, genau dies zu können und am Horizont erscheint ein Licht-blick ... Nein, doch nur ein Stichwort: Emoti-on!
Tief verwoben sind Gefühl und Musik, was entscheidend gewesen sein dürfte, diese im Kontext der Evolution vielleicht nicht beson-
ders sinnvolle Anpassung zu konservieren und auszubauen. Vom kleinsten gemeinsamen Nenner her neigt langsame, seichte, tiefe Mu-sik dazu, als beruhigend oder traurig empfun-den zu werden. Schnelle, hohe Melodien sind eher geeignet, uns fröhlich zu stimmen. In der Realität nimmt das emotionale Erleben im Zusammenhang mit Musik natürlich beliebig komplexe Ausgestaltungen und Intensitäten an - gekoppelt an den Kontext sowie die In-volviertheit des Betroffenen in das musika-lische Ereignis. Jene Veränderungen können auch physiologische Parameter wie Herz- und Atemfrequenz umfassen. Wie wird solche Er-regung des Menschen durch Musik erklärbar?
Das Konzept der Spiegelneuronen verweist auf die Aktivierung gewisser neuronaler Schaltkreise, sowohl bei eigener Erregung als auch im Falle der Beobachtung der Mimik ei-ner anderen Person von gleicher emotionaler Verfasstheit. Verwandelt man diesen Erklä-rungsansatz menschlicher Empathie unserem Problem an, so befänden wir uns schlicht auf der nächst höheren Ebene der Abstraktion: Akustische Qualitäten ahmten menschliche, gefühlsverbundene Stimmen und Aktionen nach, welche wir daselbst im Falle psychischer Erregung entäußern könnten. Kulturell be-gründete Anspielungen, unerwartete Melodien und Harmonien ergänzten weitere Facetten.
Chill down the spine
Weniger spekulativ kommt die Evidenz der Neurobildgebung daher, die sich mit dem be-rauschenden chill-down-the-spine-Effekt be-
fasst hat. Sternstunden der Musik jagen uns zuweilen kalte Schauer über den Rücken und zeitigen dabei erhöhte Aktivität von Amygda-lae, orbitofrontalen und ventralen medialen präfrontalen Kortex, Teilen des Mesencepha-lons sowie des Nucleus accumbens - unter anderem Areale, die eine Rolle im endogenen Motivations- und Belohnungssystem des Men-schen spielen und mit Suchverhalten assoziiert werden.
Süchtig bin ich nicht, obschon ich es durchaus werden möchte. D'rum schließe ich vorerst an dieser Stelle – bewegt aber unbefriedigt bringe das Blatt zum schwingen. Saxophon, erklinge!
„Wie“ ich das tue? Nun, das dürfte angeklun-gen sein. Und warum? Weil ich will und kann!
Links zum Thema
Grigory Sokolov Rameau's "La Poule"
Ihr kennt den Pianisten Grigory Sokolov nicht? Live ist er unbeschreiblich, seine Zugaben le-gendär!
http://www.youtube.com/watch?v=xcXY7dyK7eQ
Charles Limb: Your brain on improv
Experimentelle Annäherung an musikalische Improvisation - wenig informativ, aber doch in-spirierend.
http://www.ted.com/talks/lang/eng/charles_limb_your_brain_on_improv.html
Kleines Lexikon der musikalischen Ausfallserscheinungen
Chez Guevara - Revolutionär mit kongeni-taler Amusia?
Bis zu 15 Prozent der Menschen in unserm Kul-turkreis glauben, im Sinne eines erblichen De-fizits unmusikalisch zu sein – vielleicht nur, weil sie eher seltener ins Karaoke-Mikrofon singen. Etwa 5 % der Bevölkerung dürfte tatsächlich an der erblichen Form der „tone-deafness“ lei-den. Betroffene entbehren musikalisches Ver-ständnis, beginnend bereits bei Tonhöhenun-terschieden. Soziale Ausgrenzung droht, wenn Mozarts Zauberflöte vom Baustellenlärm emo-tional nicht unterschieden werden kann.
Andere kognitive Leistungen verbleiben gänz-lich unberührt, womit auch der lateinamerika-nische Revolutionär Chez Guevara als Opfer in Frage kommt. In The Motorcycle Diaries schildert Chez anekdotisch, wie er einst auf einer Party unbewusst einen langsamen und leidenschaftlichen Tango vollführte, während alle anderen Gäste passend zur Musik einen lebendigen Mambo hinlegten.
Maurice Ravel - Fokale Neurodegenerati-on ungeklärter Genese
Schien die Verwicklung in einen Taxi-Unfall zunächst glimpflich auszugehen, bildete Ra-vel nachfolgend zunehmend Symptome einer
Aphasie aus. Schließlich verlor er alsbald die Fähigkeit zu komponieren, konnte seine To-nideen und Schöpfungen jedoch tragischer-weise virtuell durchaus weiterhin „hören“. Ei-nem Freund vertraute er klagenvoll an: „[...] diese Oper (gemeint: Johanna von Orleans) ist hier, in meinem Kopf! Ich höre sie, aber ich wer-de sie nie aufschreiben.“ Der Komponist erlag schließlich 1937 den Folgen eines neurochir-urgischen Eingriffs, welcher die Ursache sei-nes Leidens zu Tage bringen sollte aber ohne Befund blieb. Gleichwohl versuchte die New York Times posthum noch 2008, die repetitive Natur des Boléro – Ravels wohl bekanntestem Werk – als Symptom einer frontotemporalen Demenz zu werten.
Wiener Philharmoniker - Maurice Ravel Bolero
http://www.youtube.com/watch?v=VLVzvv1atwc
Robert Schumann - Fokale aktionspezifi-sche Dystonie
Eigentlich hätte Schumann Pianist werden wol-len. Erst 21-jährig musste er dieses Vorhaben jedoch endgültig aufgeben. Zur Einsicht ver-half ihm letztlich die Tatsache, die eigenhändig komponierten Werke angesichts seines Handi-caps selbst nicht spielen zu können. Nament-lich die Toccata Op. 7 gab seinem Mittelfinger den Rest, obschon er die Erkrankung mit Deh-nungen der Finger in obskuren Streck-Vorrich-tungen zu therapieren suchte.
Die auch als Musikerkrampf bezeichnete Er-krankung weist unter Musikern eine Prävalenz von 1:200 bis 1:500 auf, ist mit exzessivem Üben korreliert und hat wohl auch eine gene-tische Komponente. Kennzeichnend ist, dass eine dem Patienten normalerweise mögliche, feinmotorische Bewegung am Instrument nicht mehr ausführbar ist. Während man in fMRT-Studien eine Unteraktivierung entsprechender prämotorischer Kortexareale findet, besteht eine gegensätzliche Überaktivierung senso-motorischer Regionen, was auf eine Fehlrekru-tierung im Rahmen der motorischen Kontrolle schließen lässt.
Cziffra plays Schumann Toccata Op.7
http://www.youtube.com/watch?v=NncHj0BKCps
Patient S.M. - Wer hat Angst vor den krei-schenden Violinen?
Wer könnte der schaurigen Spannung Alfred Hitchcocks Meisterwerk Psycho schon wi-derstehen? Ohne den genialen Soundtrack Bernard Hermanns wäre die atmosphärische Bannkraft des Film allerdings undenkbar. Beid-seitige Läsion der Amygdalae verwehrt weit mehr als nur den Zugang zu unheimlichen und traurigen Musikstücken.
Bernard Herrmann - Psycho (theme)
http://www.youtube.com/watch?v=qMTrVgpDwPk
cybe
rged
eon
// o
penc
lipar
t.org

Synapse 31www.synapse-redaktion.de
Quelle: www.pd-eff.de
Zeitung der Fachschaft Medizin
Express 06/10
Forscherinnen
Neues von Modul 6
Aktuelle Termine uvm.
...
Synapse
Die Synapse ist die Zeitung von und für die MedizinstudentInnen in München. Wir kommen jedes Semester mit Aktuellem von den Hochschulen, Kultur, Unterhaltung und einem neuen Schwerpunkt-Thema heraus. Farbig gedruckt und kostenlos für euch!
Schau vorbei auf unserer Homepage www.synapse-redaktion.de, und folge uns bei Facebook & Twitter.
Oder besuche uns einfach auf der nächsten Redaktionssitzung mit Deinen Ideen. Die Sitzungen fi nden regelmäßig statt und werden über Twitter angekündigt.
Wir freuen uns auf Dich – als Leser, und als mit-Macher!
Kontakt
synapse-redaktion.de/FaceBooksynapse-redaktion.de/Twitter
Zeitschrift der Medizinstudenten an der Ludwig-Maximilians-Universität MünchenNr. 53 • Oktober 2008
Medizin der Extreme
Ausgabe 55 // Mai 2011
Zeitschrift der Medizinstudierenden Münchens

Synapse32 www.synapse-redaktion.de
„That's hot“ ist ein Lieblingsspruch der Hotel-Erbin Paris Whitney Hilton. Sie ist die Urenkelin von Conrad Hilton, welcher im Jahre 1946 die Hilton Kette ins Leben rief.
Heutzutage ist Hilton Hotels & Resorts eine internationale serviceorientierte Hotel-kette, und ein Teil von Hilton Worldwide. Einen Großteil des Hotelimperiums besitzt die Blackstone Group, eine privates Ei-genkapital-Unternehmen. Es gibt weltweit über 540 Hilton Hotels in 76 Ländern. In München befindet sich zum Beispiel eines im Künstlerviertel Haidhausen direkt am Rosenheimer Platz.
Mehr als nur Erbin
Doch hinter Paris Hilton versteckt sich nicht nur die Hotelerbin, sondern auch die Kunst aus ihrer Berühmtheit ein Geschäft zu machen. 2000 fing Paris an in New York als Model zu arbeiten und später für Mar-ken wie Tommy Hilfiger, Christian Dior und GUESS zu posieren. Von diesem Lebensab-schnitt wissen jedoch nicht so viele, wie von dem Sexvideo. Ihr damaliger Freund Rick Salomon drehte die Filmreihe im Jahr 2003. Ein wenig später wurde dieses unter dem Titel „1 Night with Paris“ trotz untersagter Vertreibung veröffentlicht. Nachdem Paris Klage gegen die Verbreitung eingelegt hatte soll sie am Umsatz mitverdient haben.
Das „spätere“ Mediensternchen nutzte die-sen Rummel und spielte in den darauffol-genden Jahren in verschiedenen TV- sowie Filmrollen mit. Ihre erste bekannte Rolle ist in der Realityshow „The simple life“ zusam-men mit ihrer Freundin Nicole Richie. Die Beiden mussten hier auf ihren gewohnten Luxus verzichten. Seit dieser Show, findet Paris, haben die Menschen eine falsche und verdrehte Vorstellung von ihr: „I think from doing this show for so long, the people think I'm an airhead but it's just the role I had to play. In fact I'm not like that in real life.“
Um jedoch ihre wahre Persönlichkeit zu zeigen und ihre Aussage zu unterstreichen, veröffentlicht Hilton, ein Jahr später, ihre Autobiographie Tongue-in-Cheek. Diese wird zunächst enorm kritisiert, avanciert letztlich jedoch zum Bestseller.
Partygirl ... gegen Bezahlung
Auch ihre Ausflüge in das Partyleben lan-den öfters in den Schlagzeilen. Deswegen wird sie nun als IT-Girl bezeichnet, auch da sie weiß was gerade Trend ist, oder werden wird. Was nicht nur von Vorteil für ihre Kleiderlinie ist, aber dazu spä-ter. Durch ihre Prominenz bekommt sie auf den soeben genannten Partys als Gast für Reden und Tanzen bis zu einer halben Million Dollar (rund 360.000 €).
Ein interessanter Ausrutscher von Pa-ris Hilton im Jahr 2005 löste durch ein
liegengelassenes Handy einen Hype im Internet aus. Ihre Freunde Eminem, Lindsay Lohan, Christina Aguilera und Anna Kournikova fanden ihre persönli-chen Nummern überall im Web.
Zwei Jahre später musste die Erbin wegen eines für ungültig erklärten Füh-rerscheines und Fahrens ohne Licht für 45 Tage in das Central Regional Deten-tion Center. Es gelang ihr die Haftstra-fe auf 23 Tage zu verkürzen, indem sie bei den damaligen Gouverneur Arnold Schwarzenegger eine Überprüfung des Fal-les beantragte. Das Ende ihrer Haft nutzte die Geschäftsfrau um für ihre Kleiderlinie zu werben. Diese wurde in der Kitson Bou-tique in Los Angeles verkauft und bestand aus Tops, Kleidern, Jacken und Jeans.
Was sind schon 3 %?
Viele denken, dass Paris Hilton relativ viel geerbt hat, in Wahrheit vermachte der Großvater Barron Hilton im Dezember 2007 ihr und seinen drei anderen Enkel-kindern nur 3 % des gesamten damaligen Familien-Vermögens ($ 360 Mio.). Das restliche Geld (97% !) floss in die Wohl-tätigkeitsorganisation seines Vaters Conrad N. Hilton. Dementsprechend musste die
It's just the role I had to play. In fact I'm not
like that in real life.
That's hotIntroduction to an heiress
Von Carmen Astra
Paris Hiltons' WohnzimmerBeverly Hills, CA Mulholland Dr. 3340 Clerendon rd.http://www.youtube.com/watch?v=xIKrbolj4y4
© Mickipedia // flickr.com
© Feuillu // flickr.com

Synapse 33www.synapse-redaktion.de
Blondine lernen, ihren Anteil der Summe zu halten und zu vermehren.
Dabei ist sie äußerst erfolgreich und dachte sich z.B. im Jahr 2008 die Realityshow „My new Best Friend Forever“ (= BFF) aus, welche in Los Angeles gedreht wurde. Da sie sich seit 2003 mit ihrer besten Freundin Nicole Richie zerstritten hatte, suchte Paris auf diese Weise eine neue beste Freundin. Diese Serie erfreu-te sich so großer Beliebtheit in den USA, dass Hilton im Anschluss noch eine in Großbritan-nien und in Dubai drehte.
Paris Hilton ist und war nicht nur in Shows, sondern auch im Kino zu sehen. So spielte sie in Filmen wie Zoolander, Bottoms Up und Die Party Animals sind zurück mit, und in einigen anderen weniger bekannten. Um selbst Herrin über ihre Produktionen zu sein gründete Paris Hilton ihre eigene Firma „Paris Hilton Enter-tainment“, unter der sie 2011 ihre neue Show „The World According To Paris“ vertreibt. Ihre Schwester Nicky Hilton sagt, dass die Show ei-nen guten Einblick hinter die sonst „verschlos-senen Türen“ von ihrer älteren Schwester gibt.
Ebenso mischt sie seit 2004 im Musikmarkt mit, mit ihrem eigenen Musiklabel „Heiress Records“. Das erste Album benannte Hilton nach sich selbst: Paris. Obwohl das Album nur mäßig erfolgreich war, erreichte die Sing-le Stars Are Blind eine Top Ten Platzierung in 17 Ländern. Vier Jahre später kam ihr Parodie Song Paris For President in die Plattenläden. In dem Musikclip dazu ist das weiße Haus pink und es soll eine Fashion Police eingeführt werden. Der Song war eine Reaktion auf die Niederlage von Hillary Clinton bei den Prä-sidentschaftswahlen im Jahr 2008, für die sie eigentlich abstimmen wollte. Aufgrund ihrer Niederlage stimmte Paris 2008 für keinen Kan-didaten.
Pitch-perfect
Paris Hilton macht nicht nur Popmusik, sondern kann auch Musicalnummern vortra-gen. So geschehen im Soundtrack zum Musi-cal Repo! The Genetic Opera. Der Produzent Bousman lobt Paris für ihre Stimmprobe für diese Rolle: „She came back the next day, memorized eve-rything, was pitch-perfect, I mean she was awesome.“
Das Fashion-Girl und Mul-titalent wurde am 17.02.1981 in New York ge-boren. Sie ist das älteste Kind von insgesamt vier Kindern, von Kathy (Avanzino) Hilton, einer Schauspielerin, und Richard Hilton, ei-nem Geschäftsmann. Ihre Schwester Nicky Hilton (*1983) ist ebenso aktiv im Geschäft mit Kleider- und Schmuckkollektionen. Ihr Bruder Barron Nicholas Hilton II (*1989) ist bis jetzt leider nur durch negative Schlagzeilen aufgefallen. Er musste beispielsweise einmal 3,5 Mio. Schmerzensgeld an einen Tankwart wegen schwerer Körperverletzung zahlen. Ihr zweiter Bruder Conrad Hughes Hilton III
(* 1994), machte ebenfalls Schlagzeilen – mit illegalem Kokainbesitz.
In Paris' Kindheit zog die Familie oft um. Sie wohnte unter anderem in einer Suite im Wal-dorf-Astoria Hotel in Manhattan, in Beverly Hills und in The Hamptons (eine Ansamm-lung von Siedlungen im Osten New Yorks). Alle Hilton-Kinder sind katholisch erzogen und besuchen die Kirche regelmäßig.
Paris ging in Los Angeles auf die exklusive St. Paul the Apostle Church and School, die sie 1995 abschloss. In den darauffolgenden Jahren besuchte sie unter anderem die Convent of the Sacred Heart, auf der auch Lady Gaga1 war, und die Dwight School. Die Dwight School, in Manhattan, ist eine auf die Universität vor-bereitende Schule für ausgewähltes Klientel. Diese schloss sie mit dem General Education Diploma ab.
A businesswoman and a brandEinen großen Teil in Paris Leben machen ihre
Produkte aus. Die tüchtige Blondine sagt von sich selber: „(But) I consider myself a busi-nesswoman and a brand.“ So hat Paris nicht nur bereits mehrere Düfte (Paris Hilton, Paris Hilton For Men, Can Can, Paris Hilton Just Me, Heiress, Siren) auf den Markt gebracht sondern leiht ihren Namen anderen Produkte, wie z.B. Haarverlängerungen. Ein weiters Fa-shion Produkt ist die „Paris Hilton Footwear“ der Marke Antebi. Paris wird des Öfteren als Werbeikone, wie beispielsweise für GoYellow gebucht.
Im Dezember 2007 posierte Hilton für Rich Prosecco einem goldenen Dosenprosecco, wel-cher dem Otto-Normalverbraucher die Welt
der Wohlhabenden nahe bringen soll. Noch im Febru-ar 2011 machte sie für dieses Produkt in Frankfurt wieder Promotion. Es ist zu sehen, dass Paris ihren Produkten
treu bleibt und es nicht eine einmalige Sache ist. Der Vorstandsvorsitzende der Rich AG, Günther Aloys, ist äußerst zufrieden, dass Pa-ris hilft das Produkt weltbekannt zu machen. Ob der Dosenprosecco auch besser schmeckt bleibt fraglich, auf jeden Fall ist der Preis hap-pig (2 €).
Aktuell ist Hilton Vorstandsvorsitzende von sechs Unternehmen, darunter befindet sich eine Stellenvermittlung und ein Reisebüro.
1 Siehe Artikel in der Synapse 55
Sie entwirft seit 2011 außerdem einen Teil der Azure Urban Resort Hotel Residences auf den Philippinen der Century Properties mit.
MotoGP the Paris way
Ebenso in diesem Jahr ist das IT-Girl Renn-stall-Besitzerin eines MotoGP-Teams gewor-den. Die Fahrer sind Sergio Gadea und Ma-verick Viñales und fahren unter dem Namen „SuperMartxé VIP by Paris Hilton Team“. Die MotoGP ist die Königsklasse des Motor-radrennsports innerhalb der FIM - Weltmeis-terschaft. Am 16. September diesen Jahres hat Paris auf Ibiza ihre eigene MotoGP - Mode-kollektion, in der die Farbe pink eine wichtige Rolle spielt, vorgestellt.
Last but not least ...
Last but not least sind die Beziehungen von Paris Whitney Hilton für die Klatschpresse im-mer wieder ein spannendes Thema.
Es gibt in etwa chronologische Abfolgen, wann sie einen Mann an ihrer Seite hat und wann sie sich freundschaftlich wieder trennen. Zunächst war Hilton mit dem Model Jason Shaw von Mitte 2002 bis Anfang 2003 zusam-men. Bis 2004 hatte sie dann eine Beziehung mit dem Sänger Nick Carter. Im neuen Jahr 2005, fand sie neues Glück mit einem neuem Mann, diesesmal dem griechischen Schiffs-erben Paris Latsis, allerdings nur von Mai bis November. Da die Griechen es ihr angetan hat-ten, war sie daraufhin mit Stavros Niarchos III, ebenso Schiffserbe, bis Mai 2006 zusammen.
Im darauffolgenden Jahr nahm sich Paris eine Auszeit mit einem selbstauferlegten Zölibat. Nach der Auszeit ging es mit dem Gitarristen von GoodCharlotte Benji Madden im Mai bis November 2008 gleich weiter. Die beiden letz-ten Beziehungen sind etwas abweichend von der Chronologie. Mit Doug Reinhardt, der in „TheHills“ mitspielt, fing alles im Februar 2009 an und dauerte bis zum 13.April 2010. Kurz nach der Trennung hatte es Paris Cy Waits an-getan, ein Unternehmer und Miteigentümer von Tryst Nightclub und XS Nightclub in Las Vegas. Im Juni 2011 war auch diese Liaison be-endet.
Billion Dollar Entrepreneur
In diesem Jahr wurde Hilton als „Billion Dollar Entrepreneur“ von Variety Magazine gewählt und erschien auf deren Coverbild. Wie fleißig Paris ist, verrät uns ihr Großvater: „Even my grandpa said to me, ' You work har-der than any of my CEO friends or anyone I know' “.
Ob uns Paris, wie sie es plant, als beste weib-liche DJane erfreuen wird ist abzuwarten. Bis dahin kann sich ein jeder an ihr Zitat: „The way I see it, you should live everyday like its your birthday“ halten, oder sich zumindest da-von inspirieren lassen.
Paris Hilton ist Vorstandsvorsit-zende von sechs Unternehmen.
© Chesi Fotos CC // flickr.com
© Mickipedia // flickr.com

Synapse34 www.synapse-redaktion.de
Was genau ist „Gehirnjogging“? Diese auch als Gehirntraining bezeichnete Methode dient der Erhaltung oder auch Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten wie z.B. Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration oder abstrak-tes Denken. Das Gehirn kann in jedem Alter trainiert werden, denn Studien belegen, dass Menschen bis ins hohe Alter hinein lernen. Die frühere Aussage, dass abgestorbene Hirnzellen nicht mehr ersetzt werden können, hat ihre ab-solute Gültigkeit längst verloren.
Weniger Synapsen
Wodurch nehmen unsere kognitiven Fähig-keiten im Alter ab? Das menschliche Gehirn unterliegt im Laufe des Lebens sehr vielen Ver-änderungen, es ist sogar das Organ im Körper, das am stärksten modifiziert wird. Ein Drittel der Menschen älter als 65 Jahre haben be-reits Einbußen der geistigen Fähigkeiten. Dies bemerkt man durch die zunehmende Lang-samkeit der Menschen in ihrem Denken und Handeln. Sie haben plötzlich Schwierigkeiten, gespeicherte Informationen abzurufen oder brauchen deutlich länger als früher, um Neues zu erlernen. Dies liegt daran, dass im alternden Gehirn immer mehr Synapsen verloren gehen und es somit deutlich länger braucht, um die ankommende Information zu verarbeiten und abzuspeichern.
Eine Synapse ist eine Kontaktstelle zweier Nervenzellen. Hier werden mittels Neuro-transmittern (Botenstoffe im Gehirn) Informa-tionen von einer Zelle zur anderen übertragen. Es kommt zur Bildung von Netzwerken, in denen die jeweilige In-formation immer weiter verarbeitet und dann ab-gespeichert wird.
Leider beginnt deren Abbau sehr früh, näm-lich bereits mit 25 Jahren. Dazu kommt noch, dass er alle zehn Jahre um zehn Prozent zu-nimmt. Außerdem altert auch der Rest unse-res Körpers, wir sehen und hören schlechter als früher. Somit nimmt auch die Qualität der Signale, die von außen kommen, ab. Die In-formation ist bereits bei der Aufnahme nicht mehr genau. Und das was uns an der Informa-
tion fehlt, muss sich unser Gehirn nun selber dazu reimen.
Prävention des Synapsensterbens
Wie kann man diesem Verlust vorbeugen? Durch Veränderungen im Lebensstil. Zum Ei-nen gibt es sehr einfache Methoden, die fast allen Menschen zugänglich sind. So ist zum Beispiel regelmäßige sportliche Aktivität wie Joggen oder Gymnastik nicht zu unterschät-zen und besonders für ältere Menschen gut geeignet, um sie geistig, aber auch körperlich fit zu halten. Körperliches Ausdauertraining verbessert nachweislich das Denkvermögen, das Gedächntis und die Aufmerksamkeit. Die Hirndurchblutung wird gefördert und wirkt sich positiv auf die Bildung neuer Blutgefäße und Synapsen aus.
Wie das genau funktioniert ist nicht end-gültig geklärt und erfordert noch sehr viel Forschungsbedarf, es gibt aber bereits viele Vermutungen. Zum Beispiel gibt es Hinwei-se, dass körpereigene Substanzen wie der Nervenwachstums-Faktor BDNF (Brain Deri-ved Neurotrophic Factor) beim Wachstum von Nervenzellen und auch der Neubildung von Verbindungen zwischen Nervenzellen im Ge-hirn eine entscheidende Rolle spielt.
Gingko und Meditation
Es wird behauptet, dass Nahrungsergän-zungsmittel wie z.B. Gingko biloba die geistige Leistungsfähigkeit erhöhen. Dazu gibt es je-doch keinen wissenschaftlichen Beweis.
Eine weitere Möglich-keit ist die Meditation. Hirnforscher sollen an-hand von Studien an Mönchen herausgefun-den haben, dass wäh-
rend des Meditierens vor allem die Gamma-Wellen aktiv sind. Gamma-Wellen werden mit geistigen Höchstleisungen in Verbindung gebracht. Außerdem sei durch zahlreiche Bildgebungen des Gehirns und durch Gehirn strommessungen aufgefallen, dass Meditation zu einer Veränderung der Hirnsubstanz führt, ja sogar dass es in verschiedenen Arealen nach
mehreren Wochen regelmäßigen Meditierens zu einer höheren Dichte von Nervenzellen kommt.
Andere Methoden
Gehirnjogging bezeichnet bestimmte geisti-ge Übungen zur Verbesserung der kognitiven Leistung des Gehirns. Dieser Begriff wurde wesentlich durch Siegfried Lehrl (Universität Erlangen) geprägt. Er bezeichne-te dieses Training als „Mentales Aktivierungstraining“ (= MAT), welches es zum Ziel hatte den „Arbeitsspeicher“ op-timal arbeiten zu lassen.
Dazu wurden meh-rere Studien durch-geführt. Ein bemer-kenswertes Resultat: wenn man nur eine kognitive Fähigkeit durch einen speziel- l e n Test trainiert, verbessern sich die ande-ren ebenfalls. Trainiert man z.B. das Ge-dächtnis, so wirkt sich dies auch positiv auf die Aufmerksamkeit und Konzentration aus. Man nennt diesen Effekt Transferwirkung. Auch die Mathematikleistung und die Wortfin-dungsgeschwindigkeit sollen durch das geistige Training gefördert werden. Neurobiochemisch fällt beim Arbeitsspeichertraining eine Erhö-hung des Dopamins im Präfrontalhirn auf.
Das Gehirntraining kann dem Synapsenab-bau und den daraus resultierenden kognitiven Einbußen entgegen wirken.
Sudoku oder neue Kochrezepte?
Es gibt keine bestimmte Methode das Gehirn zu trainieren, bei der man sagen kann, diese sei die beste und die wirkungsvollste. Vielmehr ist es die Mischung aus verschiedenen Tätigkeiten wie z.B eine Fremdsprache lernen, Wandern, Ausprobieren neuer Kochrezepte, die sinnvoll ist und das Gehirn nicht nur einseitig trainiert, sondern Abwechslung bietet.
Brain Up! Das Gehirn im Trainingsanzug
Leider beginnt der Abbau der Synapsen bereits mit 25 Jahren, und er nimmt alle zehn Jahre um zehn Prozent zu.
BRAIN UPSTUDIOS
von Elena Kindsvater

Synapse 35www.synapse-redaktion.de
Deswegen ist es eher zweifelhaft, dass z.B Kreuzworträtsel, Karten spielen, Sudoku und sogar Lesen sich wirklich so gut für das Trai-nieren geistiger Fähigkeiten eignen. Hirnfor-scher meinen nämlich, dass diese Tätigkeiten meist zu einfach sind, sich in ihrer Struktur ähneln und wiederholen und somit dazu füh-ren, dass Prozesse im menschlich Gehirn au-tomatisiert werden. Unser Gehirn knüpft hier keine neuen Verbindungen mehr zwischen den Nervenzellen, sondern greift auf alte, bereits bestehende und erprobte Synapsennetzwerke zurück. Dies ist aber leider keine wirkungsvolle Metho-de, die ausreicht, um den ko-gnitiven Verlust im Alter zu minimieren.
Susanne Jaeggi et al. be-haupteten im Jahr 2008, dass ein Üben mit sog. „n-back" Aufgaben die fluide Intelligenz mess-
bar erhöhen kann. „n-back“ ist ein psy-chologischer Computertest. Bei diesem
Test werden Reize (Zahlen, Buchstaben) präsentiert, deren Reihenfolge man sich
merken muss und dann eine Taste drücken, falls man einen Reiz wiederekennt der z.B 3 Schritte zuvor (3-back) gezeigt wurde. Die Methode hat einige Medienaufmerksamkeit erregt, unter anderem erschien ein Artikel in Wired.
Eine kritische Meinung zu diesem Thema wurde damals von David Moody ver-fasst. Er hebt unter anderem hervor,
dass die Versuchsgruppe und Kont-rollgruppe mit verschiede-nen Tests überprüft wurden, und stellt auch in Frage ob die Tests genügend Aussa-
gekraft für die Quantifizie-rung der fluiden Intelligenz hät-
t e n . Science berichtete allerdings im Jahr 2009, dass 14 Stunden Training über 5 Wochen zu einer messbaren Veränderung der Dichte der kortikalen Dopamin-Rezeptoren führte. Schlussendlich bleibt also unklar, ob die Methode das hält, was sie verspricht. Viel-leicht Zeit für einen Selbstversuch1?
1 Für Windows gibt es eine kostenlose Software namens Brain Workshop, mit der man Dual N-Back üben kann: http://brainworkshop.source-forge.net
Gehirnjogging
Gehirnjogging als Begriff wurde in der brei-ten Öffentlichkeit vor allem durch den Autor Frank Berchem bekannt. Dieser brachte meh-rere Bücher zu diesem Thema auf den Markt. Auch das Konsolenspiel mit dem Namen „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ dürfte fast je-dem bekannt sein. Laut welt.de verkauft der Konzern Nintendo in Europa jede Woche bis zu 60.000 Stück dieser Software. In den USA gibt es sogar „Fitness-Clubs" für das Gehirn, in
denen die Menschen stun-denlang vor den Computern sitzen und verschiende Trai-ningsprogramme absolvie-ren, in der Hoffnung so ihre Intelligenz zu steigern.
Kritische Stimmen
Natürlich gibt es nicht nur Befürworter des Gedächtnistrainings, viele Neuropsychologen zweifeln an dessen Wirksamkeit und dem all-gemeinen positiven Effekt. Großer Kritikpunkt ist, dass das Gehirnjogging zwar das Lösen konkreter Übungsaufgaben nach und nach verbessert, es aber zu keiner signifikanten Ver-besserung der kognitiven Leistungen gegen-über den Vergleichspersonen kommt. Eine All-tagsrelevanz des Geübten ist nicht zu finden.
So verbessern softwarebasierte Denkspiele zwar die Fertigkeiten, die sie trainieren. Je-doch zeigen nur sehr wenige einen positiven Einfluss auf allgemeine kognitive Leistungen in Alltagssituationen. Wird z.B. eine bestimmte Gedächtnistechnik zum Einprägen von Wör-tern durchgeführt, so kann derjenige sich an-schließend viel leichter eine bestimmte Anzahl von Wörtern merken. Es existieren aber kei-ne einschlägigen Beweise dafür, dass die Ge-dächntisleistung insgesamt besser wird.
Man könne das Gehirn nicht ein-fach so plump trainieren mit im-mer wiederkehrenden Übungen wie die Muskulatur, dazu sei es einfach zu kompliziert als Organ. Trotzdem sind Computerspiele mit Kreuzworträtseln, Sudoku und Gehirntrainingsbücher so be-liebt wie nie zuvor.
Gehirnjogging schützt auch nicht vor Alzheimer oder anderen Demenzen und ver-
zögert deren Auftreten nicht. Zumindest ist dies bis heute nicht wissenschaftlich nachge-wiesen. Deswegen sollte man bei Produkten, die das versprechen, vorsichtig sein.
Fazit
Alles in allem lässt sich sagen, dass zumindest im Vergleich zu früheren Zeiten die geistigen Fähigkeiten der Menschen höheren Alters zu-genommen haben. Desweiteren muss betont werden, dass eine riesige Menge an Unsinn über mögliches Gehirntraining im Umlauf sind. Trotz der Unseriösität vieler Methoden, gibt es sehr viele Menschen, die daran glauben. Dies kann jedoch nicht nur unnötiges Geldausgeben bedeuten, sondern auch gefährlich werden. So z.B. bei Einnahme von Hirndoping-Präparaten wie Ritalin und Modafinil. Es ist nicht mal si-cher, ob die Hirnleistung und Lernfähigkeit bei deren Einnahme wirklich so viel besser sind. Das eigentliche Problem sind aber die vielfäl-tigen Nebenwirkungen, die sogar tödlich sein, und auch mit Sicherheit auftreten können. Denn dies ist leider kein Mythos.
Man sollte sich auf das verlassen, was wis-senschaftlich eindeutig belegt ist und aus einer sicheren Quelle stammt. So zum Beispiel, dass eine sinnvolle Lebensstilumstellung nicht nur der Gesundheit zu Gute kommt, sondern auch die geistige Leistung schonend und dauerhaft anhebt. Natürlich schadet es einem nicht zu Lesen, Kreuzworträtsel zu lösen oder Karten zu spielen. Man sollte sich jedoch davor hüten, wundersame Intelligenzsteigerungen oder gar das Vorbeugen oder Verzögern irgendwelcher Hirnerkrankungen zu erwarten. Die Freude bei der Tätigkeit sei Belohnung genug.
In den USA gibt es sogar „Fit-ness-Clubs“ für das Gehirn, in denen die Menschen stunden-lang vor den Computern sitzen.
QuickFactForscher der University of California in Los Angeles fanden heraus, dass Surfen im Web die Leistungsfähigkeit des Gehirns mehr fördert als Lesen.
rejon // openclipart.org
Dein Feedback ist uns wichtig!
Wie können wir die Synapse noch besser machen?
http://www.synapse-redaktion.de/kontakt

Synapse36 www.synapse-redaktion.de
QuickFactBestimmte erlernte Erfahrungen, wie zum Beispiel das Radfahren, ge- hen nie verloren, weil sie im Gehirn unwiderruflich gespeichert werden. Die Ner-venverbindung wird beim Vergessen nicht abgebaut, sondern lediglich deakti-viert.
johny_automatic // openclipart.org
Wie schaffe ich es ein glückliches und erfülltes
Leben zu führen?
1. Hinterfragen Sie nicht.Wenn eine Autorität Ihnen Anweisungen oder Ratschläge gibt, be-folgen Sie sie einfach. Versuchen Sie nicht, eigene Wege zu finden, oder sich weitergehend über die Frage zu informieren. Sie würden
dadurch ja nur kostbare Zeit verlieren.
2. Machen Sie alles wie die Anderen.Individualität wird in der heutigen Gesellschaft nicht gerne gesehen. Wozu sich querstellen? So eine grosse Anzahl an
Leuten um Sie herum kann sich doch unmöglich irren!
3. Konsumieren Sie.Denn Konsum macht glücklich, er füllt Ihr Leben aus. Scheuen Sie sich nicht, Schulden aufzunehmen. Und natürlich soll Ihr
Nachbar nicht damit prahlen können, dass er den schnelleren PC, die schönere Frau und das bessere Bier hat!

37Synapsewww.synapse-redaktion.de
© Tiffa Day // flickr.com
4. Spielen Sie mit.Geben Sie sich das lange gebrauchte Gefühl der Befriedigung und Macht, indem Sie aus der Ihnen zur Verfügung stehenden, breitgefächerten, Palette an Parteien diejenige auswählen, die
ihren Vorstellungen am meisten zusagt. Denken Sie dabei an die Verantwortung die auf Ihren Schultern lastet! Wir leben schließlich nicht umsonst in einem demokratischen Staat, wo
der Einzelne Entscheidungsträger ist.
5. Halten Sie sich an die Gesetze.Sie können es nicht besser wissen als die Gesellschaft. Auch
wenn Sie denken, dass z.B: Der Konsum von Marihuana zu Un-recht verboten ist, haben Sie sicher nicht alles berücksichtigt. Im Zweifelsfalle sprechen Sie mit Ihrer lokalen Authoritätsper-son (z.B: Polizeibeamte) bevor Sie etwas Verbotenes unterneh-
men. Es ist zu Ihrem Schutz!
6. Wissen macht depressiv.Fünf von sechs sogenannten „Intelektuellen“ sind depressiv, ha-ben chronische Schlafstörungen und neigen zum Suizid. Selber schuld, denn sie könnten sich einfach darauf verlassen, dass die Gesellschaft auch ohne Verbesserungen bereits perfekt
funktioniert, und statt dessen, in der Zeit wo sie sich das Wis-sen mühselig aneignen, die Freuden des Lebens geniessen:
Ihre Industrie bemüht sich, Ihnen das größtmöglichste Angebot an Unterhaltungsmöglichkeiten anzubieten.
7. Geld ist unwichtig.Dieses Leben ist sehr wahrscheinlich Ihr Einziges! Machen Sie etwas daraus, genießen Sie es in vollen Zügen! Vergessen Sie aber dabei nicht, die Demokratie in Deutschland durch Spen-
den zu unterstützen.
Von Maximilian BatzFür J.G.

Synapse38 www.synapse-redaktion.de
Liebe zukünftige Kolleginnen und Kollegen,wie viele von euch sicher bereits mitbekommen
haben, sind die Tarifverhandlungen zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), die die Länder als Eigentümer der Uniklinika vertreten, und der Verhandlungskommission des Marburger Bundes (MB), welche uns Ärztinnen und Ärzte vertritt, seit einigen Monaten ziemlich festgefah-ren. Daher ist die Wahrscheinlichkeit in den letzten
Wochen deutlich gestiegen, dass es in Kürze zu einem landesweiten Streik der Klinikärzte kommen wird.
Warum wollen/müssen wir streiken?
Seit dem letzten Tarifabschluss sind wir im Ver-gleich zu allen anderen Klinikträgern – kom-munale wie private Häuser – in Bezug auf das Grundgehalt, umgerechnet auf die vertraglich vereinbarte Wochenstundenzahl, deutlich ins
Hintertreffen gelangt – je nach Eingruppierung im Schnitt ca. 3 %, im Extremfall über 10 %.
Der direkte Vergleich der Entgelttabellen von Uniklinika und anderen Häusern wird dadurch erschwert, dass sich die Wochenarbeitszeit unter-scheidet, auf die sich das Gehalt bezieht. In den Uniklinika haben wir eine Wochenarbeitszeit von 42 Stunden – in den meisten anderen Tarifberei-chen bezieht sich die Tabelle auf eine Wochenar-beitszeit von 40 Stunden. Daher bezieht sich das folgende rechnerische Gehalt auf eine Wochen-arbeitszeit von 40 Stunden.
Vergleicht man nun beispielsweise das Gehalt von Assistenzärzten in der Uniklinika mit dem von HELIOS, bekommt man als Assistenzarzt im ers-ten Jahr im Uniklinikum 3.706,61 €, bei HELIOS 3.900,00 € (- 4,96 %). Vergleich man die übrigen Stufen der Assistenzärzte und Ärzte, so bekommt man einen ähnlichen Unterschied.
Richtig groß wird der Unterschied bei den Fach-ärzten in der höchsten Stufe – diese bekommen im Uniklinikum rechnerisch 5.864,86 €, bei HELIOS 6.400,00 € (- 8,36 %). Genau diese Gruppe ren-tiert es sich für die Klinikträger finanziell klein zu halten – denn in dieser Gruppe sammeln sich die Fachoberärzte an, die eine relativ große Gruppe darstellen. Auf der anderen Seite sind das aller-dings diejenigen, die mit ihrer Expertise unsere Uniklinik ausmachen und die Studierenden und Assistenten ausbilden. Hier zu sparen führt also auf allen unteren Ebenen zu Unzufriedenheit. Ähnlich sieht die Situation im Vergleich zu Ask-lepios, Sana oder Röhn aus. Noch größer sind die Unterschiede über die ganze die Tabelle im Ver-gleich zu Damp (bis zu - 10,66 % für Oberärzte).
Die geringeren Bezüge beziehen sich außer auf das Grundgehalt noch in besonderer Weise auf die Zuschläge für Nacht- und Wochenenddienste, die für „Bereitschaftsdienste" in unseren Häusern noch nicht einmal gewährt werden, wobei Bereit-schaftsdienste in den meisten Fällen genau in diese Arbeitszeit fallen. So kommt es dann zu der absur-den Tatsache, dass wir nachts und am Wochenen-
Streiks in Uniklinikavon Sebastian Niedermayer

Synapse 39www.synapse-redaktion.de
Streiks in Uniklinikavon Sebastian Niedermayer
de nur 95% des Gehaltes bekommen, das wir für die normale Tagesarbeitszeit beziehen - also 5% weniger statt Zuschläge für ungünstige Arbeitszei-ten zu bekommen.
Hierfür fordern wir Änderungen:
• Das Grundgehalt soll angehoben werden, da-mit die Unikliniken wieder konkurrenzfähig werden.
• Nacht- und Wochenendzuschläge sollen deutlich angehoben werden auf 25 % des normalen Stundensatzes - und auch für Be-reitschaftsdienste gelten.
• Ausweitung des Geltungsbereichs des Ta-rifvertrags auch auf unsere Kollegen im Be-triebsärztlichen Dienst und in JVAen (bisher werden diese schlechter bezahlt).
• Änderung der Tabellenstruktur: zusätzliche Stufen für Assistenzärzte und Fachärzte nach den bisher letzten Stufen. Zahnärzte werden z.B. nie Fachärzte und damit ihr Klinikleben lang nach den Assistenzarztstufen bezahlt – auch die „Funktionsoberärzte“ der Zahnärzte
• Ein weiterer Dauerbrenner ist die Vereinbar-keit von Familie und Beruf.
Warum kommen wir damit auf euch zu?
Eventuell kommende Streiks werden auch euch betreffen, da hiervon leider aller Vor-aussicht nach auch die Lehre betroffen wer-den wird. Um das möglichst zu vermeiden werden wir in Kürze ab 5 vor 12 eine aktive Mittagspause machen - also unsere Mittagspause öffentlichkeits-wirksam bestreiken. Damit wollen wir der TdL klar machen, dass wir die Forderungen ernst meinen.
Hierzu seid natürlich auch ihr herzlich will-kommen. Denn es geht um unsere gemeinsa-me Zukunft. Bereits bei den ersten Tarifver-handlungen, die der MB für uns geführt hat, haben die Studierenden auf den Demos eine wichtige Rolle gespielt – je mehr Weißkittel auf der Straße sind, desto mehr Wirkung hat die Aktion. Dies gilt natürlich auch für alle zu-künftigen Aktionen, über die wir euch über den Semesterverteiler auf dem Laufenden hal-ten.
Herzliche Grüße,Sebastian
ehemaliger Fachschaftssprecher - jetzt Assis-tenzarzt im Klinikum der LMU München
ServiceAlles W
ichtige auf einen Blick
Termine 2011
ab 4.10
Anmeldung zu den Kursen des ZHS - Zentraler Hochschulsport in München http://www.zhs-muenchen.de
11.10 bis
13.10ESI-Einführung
17.10 Semesterbeginn WS 2011 / 2012
20.10Anmeldefrist für den Kurs Arzt und Zukunft [email protected]
15.11 19:00Modul 23 Kino „The Experiment“ Vorlesungssaal, Chirurgie Innenstadt Nussbaumstr. 20
30.11 12:00Anmeldefrist für das PJ mit Beginn zum Sommersemester 2012
15.12Bewerbungsfrist für Forschungs- und Famu-lantenaustausch über die bvmd
24.12 bis
06.1Weihnachtsferien
Termine 2012
6.2 Rückmeldefrist für das Sommersemester
17.2 Semesterende
13.3 und 14.3
Physikum Frühjahr 2012
17.4 bis
19.4
Hammerexamen Frühjahr 2012
Offizielle Streik-Infoseite des MB http://www.tdl-tarifrunde.de
Online Service
http://www.synapse-redaktion.de/service
Bon
us
Fachschaftssitzungen an der LMU:In der Fachschaftswohnung der BLG,
während des Semesters Donnerstags ab 19:00
Fachschaftssitzungen an der TU: In den Fachschaftsräumen
während des Semesters Montags ab 18:00

QuickFactDas Gehirn macht etwa 3% der Körpermasse aus, ver-braucht aber im Ruhezustand ca. 20% des Sauerstoffs.
Das ist im Verhältnis gesehen sehr großer Luxus.
Gustavo Rezende // openclipart.org
30 € Lehmanns Gutscheinfür die beste wahre Geschichte*
* Für die beste wahre Geschichte die wir in der nächsten Ausgabe abdrucken – d.h. ein ungewöhnliches, Lustiges oder interessantes Ereignis aus Deinem Leben, es muss Dabei nicht unbedingt medizinisch sein,
darf aber – erhält der Autor einen Gutschein von Lehmanns im Wert von 30 Euro. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Mitglieder der Redaktion dürfen an der Aktion leider nicht teilnehmen.
Schickt uns eure Geschichten an: [email protected]

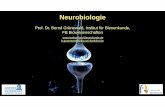




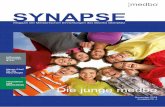

![[download 56]VIP 마케팅(2010) 최종 [호환 모드]dn-amak.ktics.co.kr/kifin/bosu2010/56/01/down/56.pdf해외여행및골프활동중상해보장 홀인원, 알바트로스축하금등](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5f4ab0fd90a01318e9184339/download-56vip-eoe2010-oe-eeoedn-amakkticscokrkifinbosu20105601down56pdf.jpg)