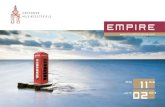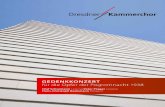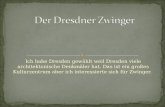Tagungsbericht: Das zweite Dresdner Medizinrechtssymposium
Transcript of Tagungsbericht: Das zweite Dresdner Medizinrechtssymposium

DOI: 10.1007/s00350-014-3663-x
Tagungsbericht: Das zweite Dresdner MedizinrechtssymposiumClaudia Holzner
Am 25. und 26. 10. 2013 fand in Dresden das 2. Medizin-rechtssymposium der Dresden International University (DIU) statt. Die Leitung hatte Prof. Dr. iur. Bernd-Rüdiger Kern. Geboten wurden einerseits eine hohe Diversität der Themengebiete und andererseits konzentrierte Diskussio-nen zu Einzelthemen. Prof. Dr. iur. Wolfgang Lüke, LL.M., Mitglied des Präsidiums der DIU, und Dr. iur. Erik Boden-diek, Vizepräsident der Sächsischen Landesärztekammer, be-grüßten die über einhundert Teilnehmer des Symposions.
Der Themenkomplex zu „Neuerungen im Betreuungs-recht“ startete mit einer Einführung durch Prof. Dr. iur. Adrian Schmidt-Recla, Leipzig. Er sprach über die Ände-rungen, die Anfang 2013 durch das Gesetz zur Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangsbehandlung in Kraft getreten sind. Hintergrund dieser Gesetzesänderung war eine Entscheidung des BGH, der 2012 im Anschluss an eine 2011 ergangene Entschei-dung des BVerfG zur Zwangsbehandlung im Maßregel-vollzug eine Rechtsgrundlage für eine betreuungsrechtli-che Zwangsbehandlung gefordert hat. Dr. iur. Jens Diener, Richter am LG Saarbrücken, illustrierte Konflikte z. B. bei der Einwilligung in eine Zwangsbehandlung aufgrund einer Vorsorgevollmacht. Vorsorgevollmachten oder Pa-tientenverfügungen entsprächen oftmals nicht mehr den
gesetzlichen Ansprüchen. Neu sei, dass die Zwangsbe-handlung nun zu den Unterbringungssachen gem. § 312 FamFG gehöre. Im Anschluss beleuchtete Dr. med. Markus Müller, LL.M., Psychiater und Sachverständiger aus Berlin, das Thema aus ärztlicher Sicht. Müller untersuchte den Ist-Zustand nach der Gesetzesänderung mit dem Ergebnis, dass Zwangsbehandlungen in geringer Zahl wieder vorgenom-men würden. Beispiele unterstrichen die Praxisrelevanz und erklärten die Erkrankungen, bei denen eine Zwangs-behandlung plausibel erscheint.
Es folgte der zweite Themenkomplex „Bewältigung von Hygieneverstößen“. Zunächst beschäftigte sich PD Dr. med. Nils-Olaf Hübner, Leiter des Fachgebietes 14 des Robert-Koch-Institutes, mit den „Aspekten der gu-ten Krankenhaushygiene“. Hübner berichtete über das Infektionsschutzgesetz, die Ländergesetze und die Emp-fehlungen der „Krinko“. Er erläuterte anhand der Maß-nahme der Händedesinfektion sämtliche Prozesse, die im Krankenhaus für die Einhaltung von Hygienestandards zu zementieren waren. Dem schloss sich der Vortrag von Prof. Dr. med. Lutz Jatzwauk, Leiter des Zentralbereichs Krankenhaushygiene und Umweltschutz des Universitäts-klinikums Dresden, an. Jatzwauk begann mit einer filmi-schen Dokumentation über einen Patienten mit schwerem Verlauf einer fraglich stationär erworbenen Infektion mit Staphylococcus aureus. Der Patient ist seither pflegebedürf-tig – dem Klinikum wurde die Haftung dafür auferlegt. Die beiden weiteren Fallbeispiele, das der Adenoviren und
Rechtsanwältin Claudia Holzner, LL.M., Hamburg, Deutschland
Entsprechend § 11 Abs. 1 GenDG darf das Ergebnis einer genetischen Untersuchung grundsätzlich nur der betrof-fenen Person und nur durch die verantwortliche ärztliche Person oder die Ärztin oder den Arzt, der die genetische Beratung durchgeführt hat, mitgeteilt werden. Dies dient der Wahrnehmung des informationellen Selbstbestim-mungsrechts und gewährleistet, dass der betroffenen Person der Befund von kompetenter Seite überbracht wird 128. Um dem zu entsprechen, ist eine persönliche Mitteilung der Ergebnisse sinnvoll. Zugleich wird so sichergestellt, dass es sich bei dem Empfänger um die Testperson und keinen unbefugten Dritten handelt.
VI. Fazit
Auch wenn das genetische Untersuchungsmaterial nicht durch einen Arzt, sondern vor allem identitätssichernd ent-nommen werden muss, zeigt sich insgesamt, dass DTC-Gen-tests sowohl zu medizinischen Zwecken als auch zur Feststel-lung der Abstammung nach dem GenDG nicht zulässig sind, wenn auf die Beteiligung eines Arztes bzw. Sachverständigen vollständig verzichtet wird. Aber selbst wenn derartige Per-sonen involviert sind, ist eine ausschließlich internetbasierte oder telefonische Kommunikation für die erforderliche Auf-klärung regelmäßig nicht geeignet, weshalb eine dennoch
durchgeführte genetische Untersuchung bereits mangels wirksamer Einwilligung rechtswidrig ist und neben straf-rechtlichen Folgen sowohl deliktische als auch vertragliche Schadensersatzansprüche begründen kann. Zudem erfordert auch eine ordnungsgemäße genetische Beratung mehr als die unpersönliche Informationsweitergabe mittels elektroni-scher Medien. Die Missachtung dessen ist für sich geeignet, eine Behandlungsfehlerhaftung zu begründen.
Die über das Internet leicht zugängliche Informations-quelle Gentest sollte alles in allem nicht vorbehaltlos als Zugewinn an informationeller Selbstbestimmung begrif-fen werden. Eine Erweiterung der Selbstbestimmung durch Online-Gentests kann nur dann realisiert werden, wenn der Nutzer in die Lage versetzt wird, die Bedeutung der Untersuchung und ihrer Ergebnisse bestmöglich zu verste-hen. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, erlangt das Individuum nur einen vermeintlichen Autonomiezuwachs und setzt sich den Gefahren der Selbsttäuschung aus 129. Das gilt es insbesondere auch durch die Einhaltung der forma-len Anforderung zu verhindern.
Mitteilungen MedR (2014) 32: 229–230 229
M I T T E I L U N G E N
128) BT-Dr. 16/10532, S. 56.129) Cullen/Neumaier/Fuchs, Ethik Med 2011, 237, 239; krit. auch
Eberbach, MedR 2011, 757, 763.

das der Noroviren, verdeutlichten das hohe Haftungsrisi-ko für Krankenhäuser bei Hygienestandards. Anschließend referierte Prof. Dr. Bernd-Rüdiger Kern über die Haftung für Hygienemängel. Kern legte die einzelnen Anspruchs-grundlagen der vertraglichen Haftung gem. §§ 630 a, 280 Abs. 1 BGB, der deliktischen Haftung gem. § 823 Abs. 1 BGB und den Unterschied zwischen Behandlungsfehlern, Organisationsmängeln und Aufklärung dar. Besonders hervorgehoben wurden die Themen „voll beherrschbares Risiko“, „beweisrechtliche Folgen“ und „Dokumentation“.
Den dritten Themenblock „Verkammerung der Pfle-geberufe – ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz“ bestritten Prof. Dr. iur. Mario Martini, Inhaber des Lehrstuhls für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Europarecht sowie Ver-waltungswissenschaft an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, Dr. iur. Jürgen Faltin, Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz, und Dr. Markus Mai, stellvertretender Pflegedirektor des Krankenhauses Barmherzige Brüder, Trier. Aktuell verfügen pflegerische Berufsgruppen in Deutschland nicht über eigene Kammern. Es gibt seit 2011 in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen Bestrebungen, das zu ändern. Martini stellte die politische Sinnhaftigkeit und die rechtlichen Grenzen einer Pflege-kammer dar. Martini, der die Verkammerung eher kritisch betrachtet, hielt es für vorzugswürdig, die bestehenden Or-ganisationen wie den deutschen Pflegerat oder den Berufs-verband Kinderkrankenpflege Deutschland zu stärken und über eine Spartenverkammerung nachzudenken. Faltin, der eine rheinland-pfälzische Pflegekammer befürwortet, wi-dersprach dem. Kammern seien ein zentrales Element der demokratischen Legitimation. Es gebe keine verfassungs-rechtlichen Hinderungsgründe; für die Verkammerungs-fähigkeit eines Berufes sei es nicht entscheidungserheblich, ob dieser zu den „freien Berufen“ zähle. Er rechnet nach den derzeitigen Planungen für den Herbst 2014 mit der Er-richtung des Gründungsausschusses und für Sommer 2015 mit der Errichtung der ersten deutschen Pflegekammer in Rheinland-Pfalz. Mai teilte diese Auffassung. Er beschrieb den pflegerischen Alltag und vertrat die Ansicht, dass die Kammer zu einer Professionalisierung der pflegerischen Berufe und zu einer verbindlichen Berufsethik führen würde. Die bisherige Arbeit der Gründungskonferenz sei konstruktiv verlaufen.
Dem schloss sich der Impulsvortrag einer alumna, Rechtsanwältin Claudia Holzner, LL.M., an, die sich mit der sektorenübergreifenden Versorgung und den Neuerungen des § 116 b Abs. 2 SGB V n. F. auseinandersetzte. Auch der nächste Tag begann mit dem Impulsvortrag eines alumnus. Carsten Wiedenfeld, LL.M., Bereichsleiter Fachdienste der Jo-hanniter e. V., Thüringen, sprach über den deutschen Ret-tungsdienst im Spannungsfeld zwischen hoheitlicher Auf-gabe und Marktleistung und informierte detailliert über die derzeitige rechtliche Situation des Rettungsdienstes.
Der vierte Themenblock befasste sich mit „Korruptions-prävention im Gesundheitswesen“. Es sprachen Dr. iur. Ale-xander Gruner, Leiter der Rechtsabteilung der Sächsischen Landesärztekammer, Kriminalhauptkommissar Jörg Engel-hard aus dem Landeskriminalamt in Berlin und Dr. iur. Da-niel Geiger, Rechtsanwalt in der Sozietät Dierks & Bohle, Berlin. Gruner betrachtete die mögliche Strafbarkeit von Vertragsärzten. Er referierte über § 73 Abs. 7 und § 128 Abs. 2 SGB V (die vertragsarztrechtlichen Entgelt- und Zu-wendungsverbote) und beleuchtete potentielle Gesetzes-vorhaben. Geiger stellte anhand einer aktuellen Studie von Price Waterhouse Coopers dar, dass die Pharmahersteller in den Beziehungen zu niedergelassenen Ärzten sensibler für Korruptionsrisiken geworden seien, dass eine systematische Korruptionsprävention jedoch noch immer die Ausnahme sei. Das deckte sich mit den Erfahrungen, die Engelhard bei seiner Arbeit gegen Korruption und Betrug im Stationären Sektor im LKA Berlin gesammelt hat. Er stellte die ver-
schiedenen Betrugsmethoden dieses Sektors vor. Engelhard zitierte Rudolf Ratzel: „Die möglichen Beteiligungsformen sind vielfältig, der Einfallsreichtum der Beteiligten nahe-zu unbegrenzt“ (Ratzel/Lippert, MBO-Ärzte, Kommentar, 5. Aufl. 2010, § 31, Rdnr. 3) und Gruner den Römer Marcus Tullius Cicero: „Keine Festung ist so stark, als dass Geld sie nicht einnehmen kann.“
In Themenblock fünf ging es um die „sektorenüber-greifende Versorgung“. Es referierten Prof. Dr. iur. An-dreas Teubner, Professor für Recht im Gesundheits- und Pflegewesen an der westsächsischen Hochschule Zwickau, Marius Milde, Bereichsleiter im Versorgungszentrum AOK Plus, Dr. med. Uwe Leder, Geschäftsführer des SRH Wald-Klinikums Gera, und Dr. med. Martin Huber, Facharzt für Innere Medizin und Leiter eines Kardiologiezentrums in Straubing, Bayern. Die Referenten waren sich einig, dass die Struktur der Einzelpraxis sich ebenso auflösen werde wie die strikte Trennung der ambulanten und stationären Medizin. Sogar im ländlichen Bereich werde der Trend zu MVZs und Praxisgemeinschaften zunehmen. Die Kran-kenhäuser würden in den ambulanten Sektor drängen. Dies sei nicht zuletzt durch den Ärztemangel im hausärztlichen Bereich bedingt. Einfühlsam gelang der Bericht von Huber, der die vertragsärztliche Versorgung im Wandel der Jahr-zehnte anhand seiner Praxis in Bayern schilderte.
Der sechste Block beschäftigte sich mit „Fragen des Da-tenschutzes in Einrichtungen des Gesundheitswesens“. Dr. iur. Sybille Gierschmann, LL.M., Partnerin der Sozietät Taylor Wessing, München, referierte über die „Patienten-einwilligung bei Biodatenbanken“ sowie „Cloud Compu-ting – Patientendaten in der Cloud“. Sie stellte dar, wie mit Hilfe eines Biobankengesetzes Probleme und Unsicherhei-ten bei der Speicherung von medizinisch erhobenen Da-ten ausgeräumt werden könnten. Eine Biodatenbank, die auf einer gesetzlichen Grundlage basierte, wäre in Anbe-tracht der technischen Option der „cloud“ sinnvoll. Ass. iur. Michael Kratz, Datenschutzbeauftragter der Sächsischen Landesärztekammer, stellte Reichweite des Datenschut-zes in der Arztpraxis dar. Er setzte den Schwerpunkt auf die Notwendigkeit der Verschlüsselung von Patientenda-ten und deren Schutz mittels einer Firewall und anderen Programmen.
Der abschließende Block widmete sich der „rituellen Beschneidung von Knaben“. Rechtsanwalt Andreas Ma-nok, LL.M., Ravensburg, referierte in seinem Impuls-vortrag als alumnus über die „verfassungsrechtlichen Aspekte des § 1631 d BGB“ zunächst die Methoden der Beschneidung, ihre möglichen Risiken in Form von me-dizinischen (Spät-)Folgen und die sich daraus ergebenden (Grund-)Rechtsverletzungen der Betroffenen. Im An-schluss sprach Ass. iur. Kathrin Meyer, Leipzig, über die Verstümmelung des weiblichen Genitale. Sie stellte präzise dar, ob die dafür geltenden Regeln im Verhältnis zur Kna-benbeschneidung ergäben, dass die Knabenbeschneidung eine Ungleichbehandlung gem. Art. 3 GG wegen des Ge-schlechts darstelle, und kam zu dem Ergebnis, dass durch die Beschränkung des § 1631 d BGB auf die männliche Be-schneidung ein Verstoß gegen das Verbot der Ungleich-behandlung gem. Art. 3 GG vorliege. Prof. Dr. iur. Holm Putzke, Universität Passau, wies auf die jüngsten Medien-berichte zu dem Thema Beschneidung hin und dehnte das Thema dann in dogmatisch brillanter Weise aus, um die Verfassungswidrigkeit des § 1631 d BGB zu belegen. Putzkes Rechtsauffassung zur rituellen Knabenbeschneidung dürfte den Lesern dieser Zeitschrift durch seine zahlreichen Arti-kel bekannt sein.
Das Fazit lautet, dass sich das Dresdner Medizinrechts-symposium als Bestandteil der medizinrechtlichen Fortbil-dungslandschaft rasch etablieren wird. Das inhaltliche Ni-veau und die Breite des präsentierten Wissens lassen bislang keinen begründeten Zweifel hieran.
Mitteilungen230 MedR (2014) 32: 229–230