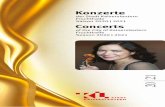Technische Universität Kaiserslautern - chemie.uni-kl.de · CHEMIE Technische Universität...
-
Upload
trinhnguyet -
Category
Documents
-
view
235 -
download
0
Transcript of Technische Universität Kaiserslautern - chemie.uni-kl.de · CHEMIE Technische Universität...
CHEMIE
Technische Universität Kaiserslautern
- Fachbereich Chemie –
Modulhandbuch
für den
Masterstudiengang Wirtschaftschemie
Letzter Beschluss des Fachbereichsrats des Fachbereichs Chemie vom 17.04.2019
Stand: 25.06.2019
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 2 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Inhaltsverzeichnis
Studienplan Masterstudium Wirtschaftschemie ........................................................................ 4
Ziel des Studiengangs ................................................................................................................. 4
Studienverlaufsplan .................................................................................................................... 4
Studiengangsaufbau und Schwerpunkte .................................................................................... 5
Auslandsaufenthalt/Forschungspraktikum ................................................................................ 7
Grundmodule ............................................................................................................................. 8
Grundmodul Anorganische Chemie ............................................................................................ 9
Grundmodul Organische Chemie ............................................................................................. 11
Grundmodul Physikalische Chemie .......................................................................................... 13
Grundmodul: Technische Chemie ............................................................................................. 15
Grundmodul Biochemie ........................................................................................................... 17
Schwerpunktmodule (Praxis sowie Theorie) .......................................................................... 19
Schwerpunktmodul (Theorie): Materialien .............................................................................. 20
Schwerpunktmodul (Praxis): Materialien ................................................................................. 22
Schwerpunktmodul (Theorie): Koordinationschemie mit bioanorganischer Schwerpunktsetzung ................................................................................................................ 24
Schwerpunktmodul (Praxis): Koordinationschemie mit bioanorganischer Schwerpunktsetzung .................................................................................................................................................. 26
Schwerpunktmodul (Theorie): Bioorganik ................................................................................ 28
Schwerpunktmodul (Praxis): Bioorganik .................................................................................. 30
Schwerpunktmodul (Theorie): Synthese und Katalyse ............................................................. 32
Schwerpunktmodul (Praxis): Synthese und Katalyse................................................................ 34
Schwerpunktmodul (Theorie): Spektroskopie und Kinetik........................................................ 36
Schwerpunktmodul (Praxis): Spektroskopie und Kinetik .......................................................... 38
Schwerpunktmodul (Theorie): Massenspektrometrie und Photochemie ................................. 40
Schwerpunktmodul (Praxis): Massenspektrometrie und Photochemie ................................... 42
Schwerpunktmodul (Theorie): MO-Theorie und relativistische Quantenchemie ..................... 44
Schwerpunktmodul (Praxis): Computerchemie ........................................................................ 46
Schwerpunkmodul (Theorie): Algorithmen der Quantenchemie und Gruppentheorie ............ 47
Schwerpunktmodul (Praxis): Methodenentwicklung in der Theoretischen Chemie ................ 49
Schwerpunktmodul (Theorie): Angewandte Heterogene Katalyse .......................................... 51
Schwerpunktmodul (Praxis): Angewandte Heterogene Katalyse............................................. 53
Schwerpunktmodul (Theorie): Molekulare Katalyse ................................................................ 55
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 3 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunkmodul (Praxis): Molekulare Katalyse .................................................................... 57
Schwerpunktmodul (Theorie): Strukturelle Biochemie und Enzymologie ................................ 59
Schwerpunktmodul (Praxis): Strukturelle Biochemie und Enzymologie ................................... 61
Schwerpunktmodul (Theorie): Life-Science.............................................................................. 63
Schwerpunktmodul (Praxis): Life Science ................................................................................. 66
Schwerpunktmodul (Theorie): Lebensmittelchemie ................................................................. 68
Schwerpunktmodul (Praxis): Lebensmittelchemie ................................................................... 72
Masterabschlussmodul ............................................................................................................ 74
Masterabschlussmodul............................................................................................................. 74
Wahlpflichtmodul ..................................................................................................................... 75
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 4 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Studienplan Masterstudium Wirtschaftschemie
Ziel des Studiengangs Der Masterstudiengang „Wirtschaftschemie“ vermittelt vertiefte Kenntnisse im Grenzgebiet zwi-
schen den Fächern Chemie und Wirtschaftswissenschaften und baut konsekutiv auf dem Ba-
chelorstudiengang „Chemie mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften“ der TU Kaiserslautern
auf. Der Masterstudiengang zeichnet sich durch einen hohen Praxisanteil aus, wobei sich die
Forschungsschwerpunkte der beiden beteiligten Fachbereiche in den Inhalten der Lehrveran-
staltungen abbilden. Das Curriculum ermöglicht eine ausgeprägte Profilbildung, wobei eine
wahlweise Spezialisierung in einem der beiden Fachbereiche möglich ist.
Der Master-Studiengang „Wirtschaftschemie“ ist berufsbefähigend und bereitet auf eine Promo-
tion vor, die je nach Profilbildung in den Fachbereichen Chemie oder Wirtschaftswissenschaften
angestrebt werden kann.
Studienverlaufsplan Der Masterstudiengang Wirtschaftschemie beinhaltet Grund- und Schwerpunktmodule sowie
ein Wahl- und Abschlussmodul. Der individuelle Studienverlaufsplan wird in einem Mentor(in)-
Gespräch besprochen. Folgende Graphik stellt einen möglichen Studienverlauf im Masterstudi-
engang dar:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 5 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Studiengangsaufbau und Schwerpunkte
1. Grundmodule der Chemie:
Insgesamt sind mindestens drei chemische Grundmodule aus einer Auswahl der Fach-
richtungen Anorganische Chemie, Organische Chemie, Physikalische Chemie, Technische
Chemie und Biochemie zu wählen. Die chemischen Grundmodule bestehen aus einer 3
SWS umfassenden Vorlesung und in der Regel aus einer Übungsstunde (1SWS).
2. Grundmodule Wirtschaftswissenschaften:
Als Grundmodule Wirtschaftswissenschaften können zwei Module aus den Bereichen
Strategic Management, Operations Research, Wirtschaftsinformatik, Grundzüge der VWL
und Mikroökonomik, Grundzüge der Makroökonomik sowie Spieltheorie gewählt werden,
die nicht Bestandteil des Bachelorstudiengangs mit Schwerpunkt Wirtschaftswissen-
schaften waren.
Operations Research besteht aus Operations Research I & II mit je 3 Leistungspunkten.
Wirtschaftsinformatik bestehen Wirtschaftsinformatik I & II mit je 3 Leistungspunkten.
Die entsprechenden Modulbeschreibungen sind im Modulhandbuch des Fachbereichs
Wirtschaftswissenschaften angegeben. Das Modulhandbuch des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaften ist unter: https://wiwi.uni-kl.de/fileadmin/wiwi.uni-kl.de/modul-
handbuecher/Modulhandbuch_aller_Module_des_Fachbereichs_Wirtschaftswissenschaf-
ten.pdf verfügbar.
3. Wahlpflichtmodul:
Im Wahlpflichtmodul kann ein Modul aus dem vorgegebenen Kanon im Umfang von 5
Leistungspunkten gewählt werden. Studierenden wird empfohlen das vom Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften angebotene Praktikum in der Industrie oder Wirtschaft als
Wahlmodul zu belegen.
4. Schwerpunktmodule Chemie:
Im Rahmen der Schwerpunktmodule sind mindestens zwei Praxismodule und mindes-
tens ein Theoriemodul zu wählen. Als viertes Schwerpunktmodul kann sowohl ein Pra-
xismodul als auch ein Theoriemodul gewählt werden. Die Praxismodule sind in zwei
verschiedenen Fachrichtungen zu absolvieren.
5. Wirtschaftswissenschaftliche Schwerpunkte
Im Fach Wirtschafswissenschaften belegen die Studierenden zwei Schwerpunktbereiche
im Umfang von je 9 Leistungspunkten, wobei in jedem Vertiefungsbereich zusätzlich
eine Seminarleistung (4 LP) zu erbringen ist. Folgende Schwerpunkte stehen zur Verfü-
gung:
- Business Information Systems und Operations Research (für BWL/BWLtQ),
- Business Information Systems und Operations Research (für WI),
- Controlling,
- Economic Theory,
- Entrepreneurship,
- Financial Economics,
- Finanz- und Bankmanagement,
- Human Resource Management und Organizational Behavior,
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 6 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
- Immaterialgüter- und Wirtschaftsrecht (für WI),
- Industrieökonomik,
- Marketing,
- Produktionsmanagement (für BWL/BWL tQ),
- Produktionsmanagement (für WI),
- Strategisches und internationales Management sowie
- Sustainable Development, Ressourcen, Umwelt und Energie.
Die Schwerpunktmodule sind im Modulhandbuch des Fachbereichs Wirtschaftswissen-
schaften dargestellt. Das Modulhandbuch ist unter:
https://wiwi.uni-kl.de/fileadmin/wiwi.uni-kl.de/modulhandbuecher/Modulhandbuch_al-
ler_Module_des_Fachbereichs_Wirtschaftswissenschaften.pdf verfügbar.
6. Für den Wahlbereich können Lehrveranstaltungen aus dem Lehrangebot der Techni-
schen Universität Kaiserslautern belegt werden. Studierenden wird empfohlen das vom
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften angebotene Praktikum in der Industrie oder
Wirtschaft als Wahlmodul zu belegen.
7. Um Studierende adäquat zu betreuen, bietet der Fachbereich Chemie in Zusammenar-
beit mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ein zweistufiges Mentoren-Pro-
gramm an:
Zunächst erfolgt vor Beginn des Masterstudiums eine generelle Erläuterung des Studi-
engangs, in der allen Studierenden die existierenden Wahlmöglichkeiten aufgezeigt
werden.
Vor Auswahl von Schwerpunktmodule werden weitere Mentorengespräche angeboten,
die sich auf die Inhalte der Module konzentrieren und Konsequenzen der Wahl für eine
Schwerpunktsetzung im Studium aufzeigen. (Anmerkung: Die zu einer Vertiefungsrich-
tung gehörenden Module beginnen in der Kennnummer mit der gleichen Abkürzung: AC,
OC, PC, TC, BC, ThC, LS).
8. Für alle Module, die ein chemisches Praktikum enthalten, gilt (auch wenn nicht speziell
aufgeführt!) folgende Teilnahmevoraussetzung:
Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer Ar-
beiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht länger
als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fachbereich
Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden rechtzeitig durch
Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 7 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Auslandsaufenthalt/Forschungspraktikum
Das Curriculum des Master-Studiums sieht vor, dass das Forschungspraktikum im Vertie-
fungsbereich im Ausland absolviert werden kann. Diesbezüglich können die Studieren-
den auf individuelle Kontakte der Hochschullehrer oder auf Möglichkeiten zurückgrei-
fen, die das ERASMUS-Programm bietet.
Im Ausland erbrachte Studienleistungen, die unter die Lissabon-Konvention fallen, wer-
den grundsätzlich anerkannt. Studienleistungen, die nicht unter die Lissabon-Konven-
tion fallen, werden nach Prüfung durch den Prüfungsausschuss des jeweiligen Studien-
gangs bewertet.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 8 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Grundmodule
Fachbereich Chemie:
In den Grundmodulen sind Lehrveranstaltungen eingebunden, die aus dem Angebot von fünf Vor-
lesungen in den Bereichen
Anorganische Chemie,
Organische Chemie,
Physikalische Chemie,
Technische Chemie und
Biochemie
zu wählen sind. Diese Vorlesungen umfassen 3 SWS + (1 Übungsstunde). Im Wintersemester wer-
den die Grundmodule AC und OC angeboten, im Sommerssemester hingegen werden die Grund-
module PC und TC angeboten. Das Grundmodul Biochemie wird im Wintersemester sowie im
Sommersemester angeboten.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 9 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Grundmodul Anorganische Chemie Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_AC_GM-M-5
Prof. H.-J. Krüger, Ph.D. Prof. H.-J. Krüger, Ph.D., Jun.-Prof. Dr. S.
Becker, Prof. Dr. H. Sitzmann
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
150 h 5 LP 1. oder 2. Semester 1 Semester WS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung Moderne Anorganische Chemie 3SWS x 15 = 45 h 105 h 5 LP
2. 3
.
Inhalte:
Aktivierung von Wasserstoff: nicht-klassische Hydridverbindungen, Hydrogenasen, interstitielle
Wasserstoffverbindungen
Aktivierung von Stickstoff: Nitrogenasen, Komplexverbindungen des Distickstoffs, Stickstoffspal-
tung, spezielle Aspekte des Haber-Bosch-Verfahrens
Aktivierung von CO: Gewinnung und Hydrierung von CO, nicht-klassische CO-Verbindungen, Car-
bonylcluster, Reaktionen von Metallionen mit CO in der Natur
Aktivierung von NO: NO in biologischen Systemen, Übergangsmetallkomplexe des NO, NO+ und NO-
, NO, NO2 und N2O als Oxidationsmittel
Aktivierung von Sauerstoff: Sauerstoffkomplexe früher und später Übergangsmetalle, Sauerstoff
Transport und Umsetzung in biologischen Systemen, O3 ↔ O2 ↔ O2- ↔ O2
2- ↔ O2-
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden
kennen die thermodynamischen Prinzipien der Aktivierung kleiner Moleküle.
verstehen grundlegende Mechanismen der Aktivierung kleiner Moleküle sowie deren Bindung an
katalytisch aktive Zentren.
verstehen wie biologische und metallorganische Katalysatoren aufgebaut sind.
kennen wichtige Festkörpersysteme zur Aktivierung kleiner Moleküle und deren Wirkungsweise.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Grundmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Janiak, Meyer, Gudat, Alsfasser, Moderne Anorganische Chemie, 4. Aufl., de Gruy-
ter, 2012.
D. M. Heinekey, A. Lledós, J. M. Lluch, Elongated Dihydrogen Complexes, Chem.
Soc. Rev. 2004, 33, 175 – 182.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 10 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
R. H. Crabtree, Dihydrogen Complexation, Chem. Rev. 2016, 116, 8750 – 8769.
Cotton-Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry (5. Aufl.), Wiley Interscience,
1988.
D. V. Yandulov, R. R. Schrock, Science 2003, 301, 76 – 78.
Y. Nishibayashi, Mo-catalyzed reduction of molecular dinitrogen, Dalton Trans.
2012, 41, 7447 – 7453.
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 11 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Grundmodul Organische Chemie Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrender:
CHE-MM-
Ch_OC_GM-M-5
Prof. Dr. J. Hartung Prof. Dr. J. Hartung
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
150 h 5 LP 1. oder 2. Semester 1 Semester WS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststudium: Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung mit
Übung: Chemie der Naturstoffe 3SWS x 15= 45 h
1SWS x 15= 15 h
90 h 5 LP
2. 3
.
Inhalte:
Einführung
Naturstoff im Kontext
Kohlenhydrate I – Mono-, Di- und Polysaccharide
α -Aminosäuren und Peptide
Alkaloide I – Purine und Pyrimidine
Kohlenhydrate II – N-Glykoside
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden verstehen die Systematik der großen Naturstoffklassen und können diese im
Spannungsfeld evolutionärer und selbstkonstituierender Prozesse einordnen.
Ausgehend von Strukturen und biochemischen Eigenschaften sind die Studierenden in der Lage,
wesentliche Zusammenhänge zwischen Struktur und Reaktivität von Primärmetaboliten zu verste-
hen.
Darüber hinaus beherrschen die Studierenden wesentliche Konzepte zur stereoselektiven Synthese
ausgewählter Zielmoleküle, die sowohl aus industrieller Sicht als auch aus medizinalchemischer
Sicht relevant sind.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: -
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Grundmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: P. Nuhn unter Mitarbeit von L. Wessjohann, Naturstoff-Chemie, S. Hirzel-Verlag,
Stuttgart, 4. Auflage, 2006
P. M. Dewick, Medicinal Natural Product, Wiley, 3. Auflage, New York, 2009
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 12 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 13 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Grundmodul Physikalische Chemie Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_PC_GM-M-5
Prof. Dr. M. Gerhards Prof. Dr. M. Gerhards, Prof. Dr. Dr. G. Nied-
ner-Schatteburg, PD Dr. C. Riehn
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
150 h 5 LP 1.- 3. Semester 1 Semester SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststudium: Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung mit
Übung Spezielle Gebiete der Physi-
kalischen Chemie
3SWS x 15= 45 h
1SWS x 15= 15 h
90 h 5 LP
2. 3
.
Inhalte:
Vorlesung:
Statistische Thermodynamik: Vertiefung der Quantenstatistiken
Elektrochemie und Oberflächenanalyse: Elektrodenreaktionen und -kinetik
Kinetik komplexer Reaktionen, Prinzip eines FT-ICR Spektrometers
Spektroskopie: Prinzip der Molekularstrahlspektroskopie, He-Tröpfchen, Spektroskopie an Oberflä-
chen, Linienverbreiterungen, Bestimmung von Lebensdauern angeregter Zustände
Vertiefung des Stoffes aus der Vorlesung sowie das Vortragen von Übungsaufgaben
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden vertiefen in grundlegenden Gebieten der physikalischen Chemie:
Statistische Thermodynamik,
Reaktionskinetik,
Elektrochemie an Grenzflächen
und Spektroskopie.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Grundmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Wedler, Gerd (2004): Lehrbuch der physikalischen Chemie. 5., vollständig überar-
beitete und aktualisierte Aufl. Weinheim: Wiley-VCH, ISBN-10: 3-527-31066-5
Atkins, Peter W. (2008): Physikalische Chemie. 4., vollst. überarb. Aufl., 1. Nachdr.
Weinheim: Wiley-VCH, ISBN-10: 3-527-32491-7
Hollas, J. Michael (2003): Modern spectroscopy. 4. Aufl. Chichester: Wiley, ISBN-
10: 0-470-84416-7
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 14 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 15 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Grundmodul: Technische Chemie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_TC_GM-M-5
Prof. Dr. W. Thiel N.N.
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
150 h 5 LP 1. oder 2. Semester 1 Semester SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststudium: Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung und
Übung Chemische Produktionsver-
fahren
3SWS x 15= 45 h
1SWS x 15= 15 h
90 h 5 LP
2. 3
.
Inhalte:
Energie- und Rohstoffversorgung.
Raffinerieprozesse zur Erzeugung hochwertiger Kraftstoffkomponenten.
Petrochemie: Erzeugung der wichtigsten Grundchemikalien und Zwischenprodukte für die Chemi-
sche Industrie.
Aufstellen von Stoff- und Energiebilanzen für industrielle Prozesse.
Konzeption chemischer Prozesse basierend auf dem Zusammenwirken von Reaktionstechnik und
Trennprozessen.
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden
verfügen über einen Überblick über die Energie- und Rohstoffversorgung.
sind vertraut mit den grundlegenden industriellen Verfahren zur Kraftstofferzeugung und zur Her-
stellung von Grundchemikalien sowie wichtigen chemischen Zwischenprodukten (inkl. aktueller
Entwicklungen).
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich: Das Grundmodul „Technische Chemie“ aus dem Bachelor-Studiengang Chemie wird
empfohlen.
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung
6. Notenermittlung
Modulnote: Note der Abschlussprüfung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Grundmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Winnacker-Küchler "Chemische Technik", insbes. Band 4
Arpe: Industrielle Organische Chemie
Baerns, Behr, Brehm, Gmehling, Hofmann, Onken, Renken: Technische Chemie
Moulijn, Makkee, van Diepen: Chemical Process Technology
J. Hagen: Chemiereaktoren – Auslegung und Simulation (Wiley-VCH, 2004)
G. Emig, E. Klemm: Technische Chemie – Einführung in die Chemische Reakti-
onstechnik (Springer,2005)
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 16 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
O. Levenspiel: Chemical Reaction Engineering John Wiley & Sons, 1999)
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
Internetseite zur Lehrveranstaltung (enthält vorlesungsbegleitendes Folienmaterial
in elektronischer Form zum Herunterladen für die Studierenden, Lehrbuchempfeh-
lungen, Vorab-Bereitstellung von Übungsaufgaben)
9. Anmeldungsverfahren:
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 17 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Grundmodul Biochemie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_BC_GM-M-5
Prof. Dr. M. Deponte Prof. Dr. M. Deponte
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
150 h 5 LP 1. oder 2. Semester 1 Semester SS sowie WS
1. Lehrveranstaltungen Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststudium: Leistungspunkte
(LP):
Jeweils Vorle-
sung mit Semi-
nar
Auswahl eines der beiden Lehr-
veranstaltungen
3 SWS x 15= 45 h
1 SWS x 15= 15 h
90 h 5 LP
[V1]: Proteinbiochemie
[V2]: Vergleichende Biochemie
2. 3
.
Inhalte:
[V1]: „Proteinbiochemie“
Aminosäurestoffwechsel für Fortgeschrittene (Wdh. proteinogene Aminosäuren, Enzymmechanis-
men, Verbindungen zum Kohlenstoffwechsel, Mediatoren/Hormone/Neurotransmitter, Stickstoff-
ausscheidung)
Proteinstruktur (von der Primär- zur Quartärstruktur, Faltungsproblem, Struktur-Funktionsbeziehun-
gen)
Intrazellulärer Proteinumsatz (Synthese, Faltung, Sortierung, Modifikation, Abbau)
Synthese und Reinigung von Proteinen (Expressions- und Reinigungsmethoden in Forschung & In-
dustrie)
[V2]: „Vergleichende Biochemie“
Entstehung des Lebens, Organismische Vielfalt, Stoffwechselkompartimentierung
Vergleich von Stoffwechselwegen
Purin- und Pyrimidinmetabolismus
Modellsysteme und Anwendungen (eukaryotische und prokaryotische Modellsysteme, molekulare
Werkzeuge)
Vergleich von Pro- und Eukaryoten (z.B. Abwehr- und Immunsysteme, Informationssysteme, Motili-
tät)
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden werden in der Lage sein,
Prinzipien und Relevanz des Aminosäuremetabolismus zu erläutern.
Zusammenhänge zwischen Proteinstruktur, -Faltung und -Funktion zu verstehen.
die wichtigsten Stationen des intrazellulären Proteinumsatzes zu beschreiben.
Vor- und Nachteile von Reinigungsmethoden bezüglich Trennkapazität und Selektivität zu erläu-
tern.
genetische, chemische und biochemische Herangehensweisen zur Beantwortung folgender Fragen
zu beschreiben: Welche Funktion hat ein Protein? Wie erfüllt es diese Funktion?
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Die verpflichtenden Teilnahmevoraussetzungen sind im Anhang der Prüfungsord-
nung geregelt.
Inhaltlich: -
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten:
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 18 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Grundmodul in den Masterstudiengängen Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Nelson & Cox: Lehninger Biochemie, 4. Aufl. (Springer, 2009, ISBN
9783540686378)
Voet & Voet: Biochemistry, 4th Edition (Wiley, 2011, ISBN 9780470570951)
Nelson & Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 7th Edition (WH Free-
man, 2017, ISBN 9781319108243)
Koolmann & Röhm: Taschenatlas Biochemie, 4. Auflage (Thieme, 2009,
ISBN 9783137594048)
Löffler & Petrides: Biochemie und Pathobiochemie, 9. Auflage (Springer,
2014, ISBN 9783642179716)
Lottspeich & Engels: Bioanalytik, 2. Auflage (Springer, 2012, ISBN
9783827429421)
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 19 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodule (Praxis sowie Theorie)
Im Rahmen der Schwerpunktmodule sind zwei Praxismodule und ein Theoriemodul zu wählen.
Als viertes Schwerpunktmodul kann entweder ein Praxismodul oder ein Theoriemodul gewählt
werden. Wenn drei Praxismodule gewählt werden, sind diese in zwei Fachrichtungen zu absol-
vieren. Die Praxismodule sind in unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu absolvieren.
Die zu einer Schwerpunktrichtung gehörenden Module sind fett in der Kennnummer mit entspre-
chender Abkürzung:
Anorganische Chemie – AC
Organische Chemie – OC
Physikalische Chemie – PC
Technische Chemie – TC
Biochemie – BC
Theoretische Chemie – ThC
Lebensmittelchemie – LS.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 20 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Materialien Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MN-
Ch_AC_VM1-M-7
Prof. Dr. H. Sitzmann [V1] Prof. Dr. H. Sitzmann, [V2] Prof. Dr. W.
Thiel, [V3] Prof. H.-J. Krüger, Ph.D.
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
2 Semester WS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Anorganische Strukturche-
mie
2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Vorlesung [V2]: Anorganische Funktionsma-
terialien
2SWS x 15 = 30h 30 h 2 LP
Vorlesung [V3]: Grundlagen der Magneto-
chemie und Magnetische Materia-
lien
2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
2. Inhalte:
[V1]: „Anorganische Strukturchemie“
Vorüberlegungen: Bedeutung der anorganischen Strukturchemie, Methoden der Strukturbestim-
mung, Interpretation von Strukturdaten
Darstellung von Kristallstrukturen: Computerprogramme, Freeware „SCHAKAL“, Atomkoordinaten,
Erstellung einfacher Datensätze, Bildschirmdarstellung ausgewählter Strukturen
Strukturen der Elemente: Metallgitter, Nichtmetalle, Halbmetalle, Chemische Elemente unter
Druck, Atomradien, Phasenumwandlungen
Strukturen von binären und ternären Verbindungen: Kugelpackungen, Ionenradien, Gitterenergie,
Koordinationspolyeder, Verknüpfung von Koordinationspolyedern
Struktur-Eigenschafts-Beziehungen: Mechanische, elektrische und magnetische Eigenschaften
[V2]: „Anorganische Funktionsmaterialien“
Anorganische Pigmente, fluoreszierende Materialien, Chromphore für verschiedene technische Anwendungen
Silikate
Strukturierte poröse Materialien, Zeolithe, mesoporöse Kieselgele, Alumophosphate
Silikone, Phosphazene
Anorganische und metallorganische Polymere, MOFs,
Elektrisch leitfähige Polymere
Lithiumionenbatterien
[V3]: „Grundlagen der Magnetochemie und Magnetische Materialien“
Grundlagen des Magnetismus (Magnetisierung, magnetische Suszeptibilität, unterschiedliche
magnetische Verhaltensweisen der Materie (Diamagnetismus, Paramagnetismus, Antiferromagne-
tismus, Ferromagnetismus, Ferrimagnetismus, Superparamagnetismus, Magnete))
Physikalische Methoden in der Magnetochemie – Magnetische Eigenschaften von isolierten Ato-
men (Elektronenspin, Bahndrehimpuls, Spin-Bahn-Kopplung)
Paramagnetismus in einkernigen Übergangsmetall- und Lanthanoidkomplexen (Van-Vleck-Glei-
chung, Überblick über das magnetische Verhalten von einkernigen Komplexen mit d- und f-Blo-
ckelementen, vereinfachte Betrachtungen und Konzepte, detaillierte Beschreibung der Eigen-
schaften von Übergangsmetallionen in oktaedrischer, tetraedrischer und tetragonal verzerrter ok-
taedrischer Koordinationsumgebung)
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 21 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Kooperative Wechselwirkungen in mehrkernigen Übergangsmetallkomplexen (magnetische
Wechselwirkungen zwischen Spinzentren in zwei- bis vierkernigen Übergangsmetallkomplexen,
Austauschwechselwirkungen zwischen magnetischen Dipolen, Superaustauschwechselwirkungen,
Delokalisierungseffekte, Spin-Polarisationseffekte, magnetische Frustration, Doppelaustauschef-
fekte in gemischt-valenten Verbindungen, Modelle zur Beschreibung der Wechselwikungen)
Magnetische Ordnung in Feststoffen (ein-, zwei- und dreidimensionale magnetische Ordnung, Ko-
ordinationspolymere)
Spindynamik (Relaxationsmechanismen der Magnetisierung, Molekulare Magnete) – Magnetische
Molekulare Schalter (Spin-Crossover-Verbindungen, Valenztautomere)
3. Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sollten
ein grundlegendes Verständnis der wichtigsten Festkörperstrukturen erwerben
in die Lage versetzt werden, zu einer gegebenen Summenformel einer ihnen unbekannten anor-
ganischen Substanz Strukturvorschläge zu unterbreiten
Synthesemethoden der anorganischen Festkörperchemie kennen lernen
verschiedene technische Anwendungen anorganischer Materialien kennen lernen
Synthesemethoden für technisch relevante anorganische Materialien kennen lernen
Charakterisierungsmethoden für anorganische Materialien kennen lernen
magnetische Eigenschaften von Übergangsmetallkomplexen verstehen und ausgewählte magne-
tische Materialien kennenlernen
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Allgemein:
U. Müller, Anorganische Strukturchemie, 6. Auflage, Teubner, 2008
B. E. Douglas,S.-M. Ho, Structure and Chemistry of Crystalline Solids,
Springer, 2006
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 22 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Materialien Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_AC_VM2-M-7
Prof. Dr. H. Sitzmann Prof. H.-J. Krüger, Ph.D., Prof. Dr. W. Thiel,
Prof. Dr. H. Sitzmann, Jun.-Prof. Dr. S. Be-
cker
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS sowie SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Materialien 10SWS x 15 =150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Das Praktikum erfolgt im Rahmen einer Mitarbeit an laufenden Projekten in den am Vertiefungsmo-
dul beteiligten Arbeitsgruppen.
Die/der Studierende wird die in der jeweiligen Arbeitsgruppe üblichen Synthesetechniken und Cha-
rakterisierungsmethoden kennenlernen bzw. vertiefen.
Das Thema der individuell definierten Praktikumsarbeit wird sich im weitesten Sinne von den in
den Vorlesungen vermittelten Inhalten ableiten und der/m Studierenden ermöglichen, die dort er-
worbenen theoretischen Kenntnisse zu vertiefen und in die Praxis umzusetzen.
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sollen
ein grundlegendes Verständnis der Synthesemethoden für anorganische Materialien erwerben
verstehen, wie poröse Materialien synthetisiert werden
sollen Techniken über Synthese und Charakterisierung von Nanopartikeln erwerben
sollen Methoden der Oberflächenfunktionalisierung für technisch relevante anorganische Materia-
lien kennen lernen
sollen magnetische Materialien kennen und anwenden lernen
Synthesen von ausgewählten magnetischen Materialien und deren Charakterisierung durchführen
können
die eigenen Ergebnisse mit denen von literaturbekannten magnetischen Materialien vergleichen
und diskutieren können
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 23 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: U. Müller, Anorganische Strukturchemie, 6. Auflage, Teubner, 2008
B. E. Douglas,S.-M. Ho, Structure and Chemistry of Crystalline Solids,
Springer, 2006
F.E. Mabbs and D.J. Machin, Magnetism and Transition Metal Complexes,
Dover 2008
A.F. Orchard Magnetochemistry, Oxford University Press 2003
M. Gerloch Magnetism and Ligand Field Analysis, Cambridge University
Press 2009
H. Lueken Magnetochemie, Teubner Verlag 1999
Olivier Kahn Molecular Magnetism, Verlag Chemie, 1993
D. Gatteschi, R. Sessoli and J. Villain Molecular Nanomagnets, Oxford Uni-
versity Press 2006
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
- Die Teilnehmerzahl ist durch die Laborkapazität der beteiligten Arbeitsgruppen begrenzt.
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 24 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Koordinationschemie mit bioan-organischer Schwerpunktsetzung Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_AC_VM3-M-7
Prof. H.-J. Krüger, Ph.D. Prof. H.-J. Krüger, Ph.D., Jun.-Prof. Dr. S. Be-
cker
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
2 Semester SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Koordinationschemie für
Fortgeschrittene
2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Vorlesung [V2]: Bioanorganische Chemie
2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Vorlesung [V3]: Physikalische Methoden der
Anorganischen Chemie
2SWS x 15 = 30h 30 h 2 LP
2. Inhalte:
[V1]: „Koordinationschemie für Fortgeschrittene“ Reaktionsmechanismen von Übergangsmetallkomplexen: Substitutionsreaktionen an oktaedri-
schen, quadratisch-planaren und tetraedrischen Komplexen, Elektronentransferreaktionen, Photo-
chemische Reaktionen, Reaktionen an koordinierten Liganden, Radikalligandkomplexe, ausge-
wählte Reaktionen von organometallischen Verbindungen (Substitution, Insertion, Alkylgruppen-
wanderung, oxidative Addition, reduktive Eliminierung)
Grundlagen der Symmetrielehre
Elektronenstruktur von Übergangsmetallionen (Ligandenfeldtheorie, Anwendung der Symmetrie-
lehre in der Ligandenfeldtheorie, Termzustände von Übergangsmetallkomplexen)
[V2]: „Bioanorganische Chemie“
Einleitung (Definition, Übersicht über Metallobiomoleküle, essentiell wichtige Elemente, biolo-
gisch bedeutsame Liganden, funktionelle Bedeutung des Metalls, der Koordinationssphäre und
der Peptidmatrix, harte und weiche Säure-Base-Konzept, allgemeine Aspekte der Koordinations-
chemie, Synthetische Analogstrategie)
Aufnahme, Transport und Speicherung von Metallionen (Siderophore, Transferrin, Ferritin, Me-
tallothioneine, Chaperonproteine)
Lewis-Säure Katalysatoren (Hydrolasen, Peptidasen, Urease, Kohlensäure-Anhydratase)
Elektronentransfer (Allgemeine Grundlagen des Elektronentransfers und der Elektronentransfer-
geschwindig-keit, Cytochrome, Fe-S-Proteine, Plastocyanin, CuA-Zentrum, entatischer Zustand)
Redoxenzyme mit redoxinaktiven Metallionen (Alkohol Dehydrogenase)
Sauerstoffchemie (Allgemeine Eigenschaften der Sauerstoffspezies)
Sauerstofftransport und -speicherung (Hämoglobin, Myoglobin, Hemerythin, Hemocyanin)
Sauerstoffmetabolismus (Photosynthese, Atmungskette, Abbau reaktiver Sauerstoffspezies in der
Natur)
Oxidation von Substraten durch molekularem Sauerstoff, Wasserstoffperoxid, Metalloxide (Cy-
tochrom P450, Peroxidasen, Extradiol- und Intradiol-spaltende Catecholdioxygenasen und Oxi-
dasen, Methanmonoxygenase, Ribonukleotidreduktase, Lipoxygenase, Tyrosinase, Cytochrom-C-
Oxidase, Galaktose-Oxidase)
Organometallische Chemie in der Natur (Vitamin B12, Hydrogenase, Kohlenmonoxid-Dehydro-
genase, Methyl-Coenzym-M-Reduktase)
Isomerasen
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 25 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Stickstoffkreislauf (Nitrogenase, Nitritreduktase, Nitratreduktase)
Schwefelkreislauf (Sulfit Reduktase)
Stabilisierung der Struktur von Biomolekülen durch Metallionen
[V3]: „Physikalische Methoden der Anorganischen Chemie“ Röntgenstrukturanalyse
IR- und Raman-Spektroskopie
NMR-Spektroskopie an paramagnetischen Komplexen
UV-Vis-Spektroskopie, ESR-Spektroskopie
Mössbauerspektroskopie
Elektrochemische Methoden
Kinetische Methoden
3. Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sollen
ein grundlegendes Verständnis der Elektronenstruktur von Übergangsmetallkomplexen erwerben. einen Überblick der Reaktionsmechanismen von Koordinationsverbindungen erhalten. einen Überblick über die Strukturen und Funktionsweisen von Metallionen in der Natur erwerben.
wichtige Charakterisierungsmethoden in der Koordinationschemie kennenlernen.
anhand der wissenschaftlichen Literatur sich in ein bestimmtes Thema vertiefen und dies in Form
einer mündlichen, schriftlichen oder in Form eins Vortrags präsentieren können.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise:
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 26 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Koordinationschemie mit bioanor-ganischer Schwerpunktsetzung Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_AC_VM4-M-7
Prof. H.-J. Krüger, Ph.D. Prof. H.-J. Krüger, Ph.D., Jun.-Prof. Dr. S.
Becker
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS sowie SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Koordinationschemie 10SWS x 15= 150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Das Praktikum erfolgt im Rahmen einer Mitarbeit an laufenden Projekten in den am Vertiefungsmo-
dul beteiligten Arbeitsgruppen.
Die/der Studierende wird die in der jeweiligen Arbeitsgruppe üblichen Synthesetechniken und Cha-
rakterisierungsmethoden kennenlernen bzw. vertiefen.
Das Thema der individuell definierten Praktikumsarbeit wird sich im weitesten Sinne von den in
den Vorlesungen vermittelten Inhalten ableiten und der/m Studierenden ermöglichen, die dort er-
worbenen theoretischen Kenntnisse zu vertiefen und in die Praxis umzusetzen.
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sollen
ein grundlegendes Verständnis der Synthesemethoden in der anorganischen Koordinationschemie
erwerben
spezielle Techniken zum Arbeiten unter anaeroben Bedingungen bzw. Arbeiten bei tiefen Tempera-
turen erlernen
ihre Kenntnisse in den Reinigungs- und Kristallisationsmethoden von anorganischen Verbindungen
vertiefen
spektroskopische und strukturanalytische Charakterisierungsmethoden an Verbindungen anwenden
und die Resultate interpretieren können
ein tieferes Verständnis zur Reaktivität von Koordinationsverbindungen in Lösung entwickeln
gegebenenfalls die Methoden der bioanorganischen Modellsynthese kennenlernen und an einem
ausgewählten Beispiel anwenden können
gegebenenfalls ein Metalloprotein isolieren und charakterisieren können
die eigenen Ergebnisse in Bezug zur Literatur einordnen und diskutieren können
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Benotete Ausarbeitung zum Praktikum: 70%
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 27 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Vortrag: 30%
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise:
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
Es wird dringend empfohlen, die erste Fassung der Ausarbeitung innerhalb von zwei
Monaten nach Abschluss der praktischen Arbeit beim Betreuer abzugeben.
9. Anmeldungsverfahren:
-
- Die Teilnehmerzahl ist durch die Laborkapazität der beteiligten Arbeitsgruppen begrenzt.
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 28 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Bioorganik Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_OC_VM1-M-7
Prof. Dr. J. Hartung Prof. Dr. J. Hartung, Prof. Dr. S. Kubik, Dr.
Tielmann
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester SS
1. Lehrveranstaltungen Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Naturstoffchemie 2 2SWS x 15 = 30h 60 h
8 LP Vorlesung [V2]: Supramolekulare Chemie 2SWS x 15 = 30h 60 h
Vorlesung [V3]: Medizinalchemie 2SWS x 15 = 30h 30 h
2. Inhalte:
[V1]: „Naturstoffchemie 2“ Fettsäuren und Polyketide
Terpene
Shikimate
Alkaloide
[V2]: „Supramolekulare Chemie“
Intermolekulare Wechselwirkungen
Wirt-Gast-Systeme
Catenane, Rotaxane, Knoten
Selbstaggregation
Selbstreplikation
Dynamische Kombinatorische Chemie
Supramolekulare Katalyse
Molekulare Maschinen
[V3]: „Medizinalchemie“
Einführung in die pharmazeutische Industrie und die Entwicklung von Wirkstoffen
Pharmakologische und physikochemische Eigenschaften von Wirkstoffen
Grundlage des Wirkstoff-Designs
Entwicklung von chemischen Herstellverfahren von Wirkstoffen
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sind in der Lage Sekundärmetabolite auf Basis struktureller Argumente in die
Klassen Polyketide, Terpene Shikimisäure-Derivate und Alkaloide einzuteilen. In punkto mecha-
nistischer organischer Chemie beherrschen die Studierenden Grundlagen und Spezialwissen der
Synthese ausgewählter Vertreter der Naturstoffklassen in biologischen Systemen. Um die Funk-
tion von Naturstoffen beurteilen zu können, beherrschen die Studierenden die thermodynami-
schen und kinetischen Grundlagen nichtkovalenter Wechselwirkungen und verstehen Eigenschaf-
ten und Funktionsweisen von synthetischen Modellsystemen für natürliche Rezeptor-Substrat-
komplexe. Die Weiterentwicklung dieser Konzepte in Richtung supramolekularer Systeme schafft
die Grundlage für das Verständnis der Prinzipien selbstassoziierender Systeme, supramolekularer
Katalysatoren und molekularer Maschinen. Das strukturelle Wissen über Sekundärmetabolite und
Rezeptoren setzt die Studierenden in die Lage, Struktur-Wirkungsbeziehungen zu entwerfen und
stereoselektive Synthesen von Wirkstoffen mit Anwendungen beispielsweise in der pharmazeuti-
schen Industrie zu entwerfen.
3. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 29 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Formal: Keine
Inhaltlich:
4. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
5. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
6. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
7. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: [V1]: „Naturstoffchemie 2“ P. Nuhn unter Mitarbeit von L. Wessjohann, Naturstoff-Chemie, S. Hirzel-
Verlag, Stuttgart, 4. Auflage, 2006
P. M. Dewick, Medicinal Natural Product, Wiley, 3. Auflage, New York, 2009
[V2]: „Supramolekulare Chemie“
H.-J. Schneider, A. Yatsimirsky, Principles and Methods in Supramolecular
Chemistry, Wiley, New York, 2000
J. W. Steed, J. L. Atwood, Supramolecular Chemistry, Wiley, New York, 2000
[V3]: „Medizinalchemie“
G. Klebe, Wirkstoffdesign – Entwurf und Wirkung von Arzneistoffen, 2. Auf-
lage, Spektrum, 2009.
L.A. Hulshof, Right First Time in Fine-Chemical Process Scale-up, Scientific
Update LLP, 1. Auflage, 2013.
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
11. Anmeldungsverfahren:
-
12. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 30 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Bioorganik Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_OC_VM2-M-7
Prof. Dr. J. Hartung Prof. Dr. J. Hartung, Prof. Dr. S. Kubik und
Prof. Dr. G. Manolikakes
Arbeitsaufwand ge-
samt
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS sowie SS
1. Lehrveranstaltungen
Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Bioorganik 10SWS x 15= 150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Mechanistische und synthetische Aspekte der Bioorganischen Chemie (für inhaltliche Details siehe
Theoriemodul „Fortgeschrittene Organische Chemie“), Syntheseplanung, Atomökonomie, Umwelt-
und Sicherheitsbewertung, fortgeschrittene Methoden der Stofftrennung und Analytik, beispiels-
weise GC, GC/MS, HPLC, NMR, HR-MS, eigenständige Versuchsauswertung, Abfassen eines Berichts
und universitätsöffentlicher Abschlussvortrag
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Studierende sind in der Lage, bioorganische Forschungsprojekte unter Anleitung zu planen, bear-
bei-ten, dokumentieren und in einem wissenschaftlichen Kurzvortrag mit anschließender Diskus-
sion zu präsentieren. Sie werden in die Lage versetzt, die erhalten Ergebnisse in den wissenschaftli-
chen Kontext einzuordnen und kritisch zu hinterfragen. Die Grundsätze guter wissenschaftlicher
Praxis sind Ihnen bekannt.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise:
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
Forschungsorientierten Arbeiten, wählbar aus den Bereichen Metallorgani-
sche Chemie und Katalyse, Naturstoffchemie und Supramolekulare Chemie
gewählt werden. Auch externe Forschungsaufenthalte im Rahmen des
ERASMUS-Austauschprogramms oder bestehender Industriekooperationen
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 31 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
sind nach Genehmigung des zuvor beim Modulverantwortlichen eingereich-
ten und genehmigten Forschungsexposés möglich.
Themenvergabe, Literaturangaben und Sicherheitsunterweisung erfolgen in
einer Vorbesprechung mit einer Assistentin/einem Assistenten
9. Anmeldungsverfahren:
Schriftlich im Sekretariat Organische Chemie
10. Unterrichtssprache:
nach Vereinbarung
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 32 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Synthese und Katalyse Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_OC_VM3-M-7
Prof. Dr. J. Hartung Prof. Dr. J. Hartung, Prof. Dr. S. Kubik, Prof.
M. Psiorz und Prof. Dr. G. Manolikakes
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS
1. Lehrveranstaltungen Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Physikalische Organische
Chemie
2SWS x 15 = 30h 60 h
8 LP Vorlesung [V2]: Metallorganik und Katalyse 2SWS x 15 = 30h 60 h
Seminar
[V3]: Kennzahlen in der chemi-
schen Industrie
2SWS x 15 = 30h 30 h
2. Inhalte:
[V1]: „Physikalisch Organische Chemie“ Konzepte
Bindungsmodelle
Photochemie
Pericyclische Reaktionen
Korrelationsanalyse
[V2]: „Metallorganik und Katalyse“
Elementarschritte übergangsmetallkatalysierter Reaktionen
Aufstellen plausibler Katalysezyklen
Mechanistische Erklärungen für das Auftreten von Nebenprodukten in katalytischen Reaktionen
Katalytischen Kreuzkupplungsreaktionen wie Suzuki-, Negishi-, Stille, und Sonogashira-Reaktio-
nen
Heck-Reaktionen als Einzelreaktion bzw. als Teil von Reaktionskaskaden
Übergangsmetallkatalysierte Allylierungen mit der Möglichkeit der asymmetrischen Induktion
Carbonylierungsreaktionen [Carbonylierungen Hydroformylierungen und Amidocarbonylierungen]
Übergangsmetallkatalysierte C–H Funktionalisierungen
Oxidative Funktionalisierungen, z.B. Allylische Oxidationen, Epoxidierungen, cis-Hydroxylierun-
gen,
Aminohydroxylierungen und Wacker-Oxidationen
Alken- und Alkinmetatheseinsbesondere zur Synthese mittlerer Ringe
[V3]: „Kennzahlen und Kostenrechnung in der chemisch-pharmazeutischen Industrie“
Ökonomische Bewertung von Wirkstoffsynthesen als Grundlage für eine Firmengründung
Vom Entwickler zum Produzenten zum Markführer
Kostenrechnungen und Bilanzierungen chemischer Unternehmen
Marktanalyse und Strategieanpassung
3. Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Studierende sind in der Lage, thermisch und photochemisch induzierte organische Reaktionen auf
hohem theoretischem Niveau mechanistisch zu beschreiben und zu untersuchen. Der Einfluss von
Substituenteneffekten auf thermodynamisch oder kinetisch kontrollierte Reaktion erschließt sich
den Studierenden aus grundlegenden Konzepten der Physikalisch-Organischen Chemie (Photo-
chemie, Orbitaleffekte, Lineare-Freie-Enthalpie-Beziehungen). Die Prinzipien versetzen die Stu-
dierenden in die Lage, mehrstufige Reaktionszyclen zur Kohlenstoff-Kohlenstoff und zur Kohlen-
stoff-Heteroatom-Verknüpfung zu verstehen, um daraus plausible Katalysezyklen aufzustellen
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 33 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
und kritisch zu bewerten. Die mechanistischen Grundlagen versetzen die Studierenden in die
Lage, themenbezogene Aufsätze
aus der aktuellen Literatur zur organischen Synthese und Katalyse zu verstehen und kritisch auf-
zubereiten, um in einem Seminarvortrag darüber zu referieren.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäße Prüfungsordnung
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: [V1: ]Physikalisch Organische Chemie“
E. V. Anslyn, D. A. Dougherty, Modern Physical Organic Chemistry, University
Science Books, Sausalito, CA, 2004
Fleming, Molekülorbitale und Reaktionen Organischer Verbindungen, 2. Auf-
lage, Wiley-VCH, Weinheim, 2012
K. Popper, Logik der Forschung, Springer, Wien 1935
[V2]: „Metallorganik und Katalyse “
A. Yamamoto, Organotransition Metal Chemistry, Wiley 1986
A. De Meijere, F. Diederich, Metal-catalyzed Cross-Coupling Reactions, 2nd
Ed., Wiley 2004
G. P. Chiusoli, P. Maitlis, Metal-Catalysis in Industrial Organic Processes,
RSC 2006
J. P. Collman, L. S. Hegedus, J. R. Norton, R. G. Finke, Principles and Applica-
tions of Organotransition Metal Chemistry, University Science 1987
R. H. Crabtree, The Organometallic Chemistry of the Transition Metals,
Wiley 2001
[V3]: „Kennzahlen in der Chemischen Industrie“
A. Steinbach, Ressourceneffizienz und Wirtschaftlichkeit in der Chemie
durch systematisches Process Life Cycle-Management, Wiley-VCH, Wein-
heim, 2013
H. Scheck, B. Scheck, Wirtschaftliches Grundwissen für Naturwissenschaftler
und Ingenieure, 2. Auflage, Wiley-VCH, Weinheim, 2007
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 34 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Synthese und Katalyse Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_OC_VM4-M-7
Prof. Dr. J. Hartung Prof. Dr. J. Hartung, Prof. Dr. S. Kubik, Prof.
Dr. G. Manolikakes, Dr. P. Tielmann
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS sowie SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Synthese und Katalyse 10SWS x 15= 150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Mechanistische und synthetische Aspekte der Fortgeschrittenen Organischen Chemie (für inhaltli-
che Details siehe Theoriemodul „Fortgeschrittene Organische Chemie“), Syntheseplanung, Ato-
mökono-mie, Umwelt- und Sicherheitsbewertung, fortgeschrittene Methoden der Stofftrennung
und Analytik, beispielsweise GC, GC/MS, HPLC, NMR, HR-MS, eigenständige Versuchsauswertung,
Abfassen eines Berichts und universitätsöffentlicher Abschlussvortrag.
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Studierende sind in der Lage fortgeschrittene organische Forschungsprojekte unter Anleitung zu
pla-nen, bearbeiten, dokumentieren und in einem wissenschaftlichen Kurzvortrag mit anschließen-
der Diskussion zu präsentieren. Sie werden in die Lage versetzt, die erhalten Ergebnisse in den wis-
senschaftlichen Kontext einzuordnen und kritisch zu hinterfragen. Die Grundsätze guter wissen-
schaftlicher Praxis sind Ihnen bekannt.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise:
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
Forschungsorientierten Arbeiten, wählbar aus den Bereichen Metallorgani-
sche Chemie und Katalyse, Naturstoffchemie und Supramolekulare Chemie
gewählt werden. Auch externe Forschungsaufenthalte im Rahmen des
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 35 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
ERASMUS-Austauschprogramms oder bestehender Industriekooperationen
sind nach Genehmigung des zuvor beim Modulverantwortlichen eingereich-
ten und genehmigten Forschungsexposés möglich.
Themenvergabe, Literaturangaben und Sicherheitsunterweisung erfolgen in
einer Vorbesprechung mit einer Assistentin/einem Assistenten
9. Anmeldungsverfahren:
Schriftlich im Sekretariat Organische Chemie
10. Unterrichtssprache:
Nach Vereinbarung
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 36 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Spektroskopie und Kinetik Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_PC_VM1-M-5
Prof. Dr. M. Gerhards Prof. Dr. M. Gerhards, Prof. Dr. Dr. G. Nied-
ner-Schatteburg, PD Dr. C. Riehn
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststudium: Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Moderne Methoden der
Spektroskopie
2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Vorlesung [V2]: Clusterchemie I
2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Seminar [S1]: Aktuelle Themen aus der
Spektroskopie und Spektromet-
rie II
2SWS x 15 = 30h 30 h 2 LP
3. Inhalte:
[V1]: „Moderne Methoden der Spektroskopie “
Einstein-Koeffizienten
Charakterisierung von Lasertypen (nach Medium, Niveaus, Zeit)
Funktionsweise ausgewählter Lasertypen (z.B. Farbstofflaser, Nd-Yag Laser, Excimer Laser)
Frequenzverdopplung und Mischung
Spektroskopie in Molekularstrahl mit Massenselektion
(apparativer Aufbau, REMPI-Spektroskopie, Doppelresonanzverfahren,
UV/UV und IR/UV-Methoden, Ion imaging)
Fluoreszenzspektroskopie (Laser-induzierte und dispergierte Fluoreszenz,
Ultra-hochauflösende Verfahren)
Hochauflösende Ionenspektroskopie (ZEKE, MATI)
Anwendungen zu allen genannten Methoden: Von Biomolekülen in Gasphase und kondensierter
Phase bis hin zu freien Ionen
Ultra-Kurzzeit-Spektroskopie (apparativer Aufbau, Anwendungen in Gas und Kondensierter Phase)
[V2]: „Clusterchemie I“
Molekulare Cluster und Spektroskopie
Wassercluster als Modellsysteme für makroskopische Lösungen
Desolvatisierung gespeicherter Cluster durch Schwarzkörperstrahlung
Bimolekulare Reaktionen von Wasserclustern und deren Ionen
Schwingungsspektroskopie an ionischen Wasserclustern
Andere Molekülcluster
Ein- und mehrkernige Metallatom-Molekülcluster
[S1]: „Aktuelle Themen aus der Spektroskopie und Spektrometrie II“ 4. Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden
kennen aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Clusterchemie.
kennen aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Laserspektroskopie
können sich anhand der wissenschaftlichen Literatur vertieft in ein bestimmtes Thema einarbei-
ten und dies in Form eines Vortrags präsentieren
5. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 37 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Formal: Keine
Inhaltlich:
6. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
7. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
8. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
9. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Bergmann, Ludwig; Kleinermanns, Karl; Schäfer, Clemens; Dorfmüller,
Thomas (Edts., 2005): Lehrbuch der Experimentalphysik. Zum Gebrauch bei
akademischen Vorlesungen und zum Selbststudium. 2., überarb. Berlin
[u.a.]: Gruyter, ISBN-10: 978-3-11-017484-7
Hollas, J. Michael (2003): Modern spectroscopy. 4. Aufl. Chichester: Wiley,
ISBN-10: 0-470-84416-7
Bernath, Peter F. (2005): Spectra of atoms and molecules. 2. Aufl. New York:
Oxford University Press, ISBN-10: 978-0-19-517759-6
Skript mit weiterer Originalliteratur
Kreibig, IL, Vollmer, M., Optical Properties of Metal Clusters, Springer, Ber-
lin, 1995
Kappes, M., Leutwyler, S., Molecular Beams of Clusters, in: Scoles, G. (Ed.),
Atomic and Molecular Beam Methods, Vol. 1, Oxford University Press, 1988
Haberland, H, Clusters of Atoms and Molecules I und II, Springer Series in
Chemical Physics, Vol. 52 und 56, Springer, Berlin, 1994 und 1995 .
Johnston, R.L., Atomic and Molecular Clusters, Taylor & Francis, London,
2002
Baletto, F., Ferrando, R., Structural Properties of Nanoclusters: Energetic,
Thermodynamic, and Kinetic Effects. Rev. Mod. Phys. 77, 371, 2005
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
10. Anmeldungsverfahren:
-
11. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 38 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Spektroskopie und Kinetik Kennnummer: Modulbeauftragter: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_PC_VM2-M-5
Prof. Dr. M. Gerhards Prof. Dr. M. Gerhards, Prof. Dr. Dr. G. Nied-
ner-Schatteburg, PD Dr. C. Riehn
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS sowie SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Spektroskopie und Kinetik 10SWS x 15 =150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Es werden unter Anleitung Forschungsarbeiten an laserspektroskopischen Molekularstrahlappara-
turen sowie an z.B. FTIR, Fluoreszenzspektrometer oder FT-ICR Apparaturen durchgeführt. Hierbei
werden verschiedenste moderne spektroskopische Methoden von der Infrarot bis zur (Vakuum)UV
Spektroskopie erlernt und kinetische Analysen durchgeführt. Die Thematiken lehnen sich an aktu-
elle Forschungsvorhaben und reichen von Peptid-Analysen bis zu Spin sensitiven Techniken an
Übergangsmetall-Clustern.
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sollen die Benutzung moderner Forschungsapparaturen sowie die kritische Ana-
lyse und Auswertung komplexerer spektroskopischer bzw. kinetischer Analysen erlernen. Dazu ge-
hört die Fähigkeit zu erkennen, welche spektroskopische oder kinetische Analysemethode für die
gegebene Fragestellung adäquat ist und welche Aussagen daraus abgeleitet werden können.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Aufgrund der Diversität der Praktikumsaufgaben wird bei der ersten Besprechung mit
der Praktikantengruppe Literatur empfohlen.
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 39 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
9. Anmeldungsverfahren:
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 40 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Massenspektrometrie und Photo-chemie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_PC_VM3-M-5
Prof. Dr. Dr. G. Niedner-Schatteburg [V1] Prof. Dr. Dr. G. Niedner-Schatteburg,
[V2] Prof. Dr. M. Gerhards
Arbeitsaufwand ge-
samt (30 h = 1 LP):
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststudium: Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Clusterchemie und Mag-
netismus
2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Vorlesung [V2]: Photochemie und theore-
tische. Analysen 2SWS x 15 = 30h 30 h 2 LP
Seminar [S1]: Aktuelle Themen aus der
Spektroskopie und Spektromet-
rie I
2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
2. Inhalte:
[V1]: „Clusterchemie und Magnetismus“ Atomare Cluster, elektronische Eigenschaften und Magnetismus
Klassifizierung von Clustern: Bausteine und intramolekularen Wechselwirkungen
Atomare Cluster der Edelgase und Helium-Nanotröpfchen
Cluster der Alkalimetalle und das elektronische Jelllium-Model
Übergangsmetallcluster und Elementarschritte der Katalyse
Grundlagen des Festkörpermagnetismus und des molekularen Magnetismus
Messung der magnetischen Eigenschaften von Metallclustern
[V2]: „Photochemie und theoretische Analysen“
Grundlagen der spektroskopischen Analyse photochemischer Elementarrektionen
Spektroskopische Anwendungen im Bereich der UV- und IR-Spektroskopie
Analyse von Potentialhyperflächen
Analyse anharmonischer Schwingungsbewegungen
Gekoppelte Oszillatoren (Schwingungskopplung)
Analyse asymmetrischer Rotoren, Kernspinstatistik, Isotopeneffekte
Molekulare Symmetriegruppen
[S1]: „Aktuelle Themen aus der Spektroskopie und Spektrometrie I“
3. Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden
kennen aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Massenspektrometrie und Clusterchemie in
Verbindung mit magnetischen Eigenschaften
kennen aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Photochemie sowie der theoretischen Metho-
den zur Analyse der spektroskopischen Ergebnisse
können sich anhand der wissenschaftlichen Literatur vertieft in ein bestimmtes Thema einarbei-
ten und dies in Form eines Vortrags präsentieren
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 41 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Halperin, W.P, Quantum Size Effects in Metal Clusters, Rev. Mod. Phys. 58,
533, 1986
de Heer, W. A., The Physics of Simple Metal Clusters - Experimental Aspects
and Simple Models, Rev. Mod. Phys. 65, 611, 1993
Brack, M., The Physics of Simple Metal Clusters - Self Consistent Jellium
Model and Semiclasssical Approaches, Rev. Mod. Phys. 65, 677, 1993
Ekardt, W., Metal Clusters, Wiley, New York, 1999
Reinhard, P.-G., Surauld, E., Introduction to Cluster Dynamics, Wiley, New
York, 2004
Turro, Nicholas J.; Ramamurthy, V.; Scaiano, J. C. (2009) : Principles of Mo-
lecular Photochemistry, University Science Books, ISBN 978-1-891389-3
Skript mit weiterer Originalliteratur
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 42 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Massenspektrometrie und Photo-chemie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_PC_VM4-M-5
Prof. Dr. Dr. G. Niedner-Schatteburg Prof. Dr. Dr. G. Niedner-Schatteburg, Prof.
Dr. M. Gerhards, PD Dr. C. Riehn
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS sowie SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Massenspektrometrie und Pho-
tochemie
10SWS x 15 =150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Es werden unter Anleitung Forschungsarbeiten an laserspektroskopische Massenspektrometrie und
Photochemie durchgeführt, wobei neben verschiedenen Typen von Massenspektrometern (z.B.
Flugzeitmassenspektrometer, ESI-TOF,FT-ICR) auch unterschiedliche Lasersysteme eingesetzt wer-
den. Die Thematiken lehnen sich an aktuelle Forschungsvorhaben und reichen von photochemi-
schen Primärprozessen bis zur massenspektrometrischen Analyse komplexer Reaktionen.
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sollen die Benutzung moderner Forschungsapparaturen sowie die kritische Ana-
lyse und Auswertung komplexerer spektroskopischer bzw. kinetischer Analysen erlernen. Dazu ge-
hört die Fähigkeit zu erkennen, welche spektroskopische oder kinetische Analysemethode für die
gegebene Fragestellung adäquat ist und welche Aussagen daraus abgeleitet werden können.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Aufgrund der Diversität der Praktikumsaufgaben wird bei der ersten Besprechung mit
der Praktikantengruppe Literatur empfohlen.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 43 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 44 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): MO-Theorie und relativistische Quantenchemie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_ThC_VM1-M-5
Prof. Dr. C. van Wüllen Prof. Dr. C. van Wüllen
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS
Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Post-Hartree-Fock-
Methoden
2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Vorlesung [V2]: Relativistische Quantenche-
mie
2SWS x 15 = 30h 30 h 3 LP
Seminar [S1]: Theoretische Chemie I 2SWS x 15 = 30h 60 h 2 LP
Inhalte:
[V1]: „Post-Hartree-Fock-Methoden“ Einführung in das Problem der Elektronenkorrelation (Versagen der Hartree-Fock- Näherung bei
"gestrecktem H2"); Diskussion anhand von Paardichten.
Der CI-Ansatz: Prinzip, Rechenaufwand, CI mit Beschränkung des Anregungsgrades, Größenkonsis-
tenz
Die coupled cluster Parametrisierung der full-CI Wellenfunktion, Beschränkung des
Anregungsgrads, CC-D Verfahren: Rechenaufwand, CCSD und CCSD(T), Zusammenhang mit "quad-
ratischer CI"
Kurze Wiederholung der Störungstheorie, Anwendung auf das Korrelationsproblem (Møller-Ples-
set): führende Ordnung, Rechenaufwand, MP3 und MP4
Basissatz-Abhängigkeit der Korrelationsenergie: Konvergenzverhalten und die Ursachen, Extrapo-
lationsmethoden, der r12-Ansatz
Dichtefunktionalverfahren: grundlegende Theoreme und Kohn-Sham-Ansatz, Modellierung des
Austausch-Korrelationslochs, verschiedene Klassen von Austausch-Korrelations-Funktionalen
Quantenchemische Kombinationsmethoden: Gaussian-1,2,3
[V2]: „Relativistische Quantenchemie“
Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie: Relativitätsprinzip, Galileo- und Lorentztransforma-
tion
‚Einbau’ des Spins in die Schrödinger-Gleichung (Pauli-Formulierung), Relativistische Wellenglei-
chungen: Klein-Gordon-Gleichung, Dirac-Gleichung, Rotation von Spinoren, Gesamt-Drehimpuls
Quantenchemie mit der Dirac-Gleichung: Dirac-Coulomb-Operator, variationeller Kollaps und ki-
netische Balance, Brown-Ravenhall-Krankheit
Relativistische Direkte Störungstheorie für nichtentartete und quasientartete Grundzustände, Zu-
sammenhang mit dem quasirelativistischen Pauli-Operator
Quasirelativistische Hamiltonoperatoren: Foldy-Wouthuysen-Entwicklung, Douglas-Kroll-Entwick-
lung, ZORA
[S1]: „Theoretische Chemie I“
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 45 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sollen die Benutzung quantenchemischer Programmpakete für anspruchsvolle
Fragestellungen beherrschen. Dazu gehört die Fähigkeit zu analysieren, welche quantenchemi-
sche Rechenmethode für die gegebene Fragestellung adäquat ist, sowie das Know-How, solche
Rechnungen auf modernen (Parallel-) Rechnern effizient ausführen zu lassen.
Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: F. Jensen, Introduction to Computational Chemistry, Wiley, 2006 (ISBN 978-
0470011874)
C. Cramer, Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models,
Wiley, 2004 (ISBN 978-0470091821)
T. Helgaker, P. Jørgensen, J. Olsen, Molecular Electronic Structure Theory,
Wiley, 2000 (ISBN 978-0471967552)
B. O. Roos (Hrg), Lecture Notes in Quantum Chemistry (Lecture Notes in
Chemistry, Bd. 58), Springer, 1992 (ISBN 978-3540553717)
B. O. Roos (Hrg), Lecture Notes in Quantum Chemistry II (Lecture Notes in
Chemistry, Bd. 64), Springer, 1994 (ISBN 978-3540586203)
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
Anmeldungsverfahren:
-
Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 46 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Computerchemie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_ThC_VM2-M-5
Prof. Dr. C. van Wüllen Prof. Dr. C. van Wüllen, Prof. Dr. M.
Gerhards, Prof. Dr. Dr. G. Niedner-Schatte-
burg
Arbeitsaufwand ge-
samt (30 h = 1 LP):
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS sowie SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Computerchemie
10SWS x 15 =150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Quantenchemische Rechnungen zur Struktur, zur Reaktivität, zur Spektroskopie oder zu magneti-
schen Eigenschaften molekularer Systeme. Intensive Einarbeitung in die Benutzung (mindestens)
eines quantenchemischen Programmpakets (TURBOMOLE, Gaussian, MOLPRO oder MOLCAS).
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sollen die Benutzung quantenchemischer Programmpakete für anspruchsvolle
Fragestellungen beherrschen. Dazu gehört die Fähigkeit zu analysieren, welche quantenchemische
Rechenmethode für die gegebene Fragestellung adäquat ist, sowie das Know-How, solche Rech-
nungen auf modernen (Parallel-) Rechnern effizient ausführen zu lassen.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Aufgrund der Diversität der Praktikumsaufgaben wird bei der ersten Besprechung mit
der Praktikantengruppe Literatur empfohlen.
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 47 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunkmodul (Theorie): Algorithmen der Quantenchemie und Gruppentheorie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_ThC_VM3-M-7
Prof. Dr. C. van Wüllen Prof. Dr. C. van Wüllen
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester SS
Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Algorithmen der Quanten-
chemie
2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Vorlesung [V2]: Gruppentheorie 2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Seminar [S1]: Theoretische Chemie II 2SWS x 15 = 30h 30 h 2 LP
Inhalte:
[V1]: „Algorithmen der Quantenchemie“
Molekulare Ein- und Zweielektronenintegrale über Gaussfunktionen (Rekursionsmethoden, La-
place-Darstellung von r12–1, Rys-Polynome)
Orthogonalisierung von Molekülorbitalen (Verfahren von Schmidt und Löwdin, Orthogonalisie-
rung durch Cholesky-Zerlegung)
Konstruktion der Fockmatrix (integral-getriebene Verarbeitung von Zweielektronenintegralen, In-
tegral-direktes SCF)
Diagonalisierung der Fockmatrix und die Varianten (Dämpfung, Level-Shift, etc.)
Erste Ableitungen der Hartree-Fock-Energie (Hellmann-Feynman- und Pulay-Kräfte)
Zweite Ableitungen der Hartree-Fock-Energie (coupled Hartree-Fock Gleichungen, Besonderhei-
ten bei imaginären und spin-Abhängigen Störungen, störungs-abhängige Basisfunktionen (Kraft-
konstanten oder GIAOs)
Verfahren zur Konvergenzbeschleunigung (DIIS-Varianten)
[V2]: „Gruppentheorie“
Abstrakte Gruppentheorie
Symmetrie-Operationen und Punktgruppen
Darstellungs-Theorie: Matrix-Darstellungen, Reduzible und Irreduzible Darstellungen, Charaktere
und Charakter-Tafeln
Anwendungen: Matrix-Elemente und Symmetrie, direkte Produkte, Symmetrie-angepasste Mole-
külorbitale, Molekülschwingungen, Anwendungen in der Übergangsmetallchemie
[S1]: „Theoretische Chemie II“ Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden
kennen grundlegen Algorithmen, die in der Quantenchemie eine Rolle spielen
kennen aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Laserspektroskopie
können sich anhand der wissenschaftlichen Literatur vertieft in ein bestimmtes Thema einarbei-
ten und dies in Form eines Vortrags präsentieren
Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 48 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: K. Mathiak, P. Stingl, Gruppentheorie für Chemiker, Physiko-Chemiker und
Mineralogen, Vieweg, 1968
S. F. A. Kettle, Symmetrie und Struktur, Teubner, 1994 (ISBN 978-
3519035190)
D. Steinborn, Symmetrie und Struktur in der Chemie, Verlag Chemie, 1993
(ISBN 978-3527284184)
D. M. Bishop, Group Theory and Chemistry, Dover, 1993 (ISBN 978-
0486673554)
F. A. Cotton, Chemical Applications of Group Theory, Wiley, 1990, (ISBN
978-0471510949)
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
Anmeldungsverfahren:
-
Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 49 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Methodenentwicklung in der Theo-retischen Chemie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_ThC_VM4-M-5
Prof. Dr. C. van Wüllen Prof. Dr. C. van Wüllen
Arbeitsaufwand ge-
samt (30 h = 1 LP):
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS sowie SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrveran-
staltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Methodenentwicklung 10SWS x 15 =150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Übersetzung mathematisch formulierter Verfahren in numerisch stabile und effiziente Algorithmen
Modifikation und Hinzufügen von Funktionalitäten in großen Programmpaketen
Benutzung von Versionskontrollsystemen
Erstellung von Tests zur Verifikation der Korrektheit und zur Leistungsmessung von Programmbe-
standteilen
Einübung systematische Fehlersuchstrategien
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sollen das für die Methodenentwicklung in der Theoretischen Chemie notwen-
dige Rüstzeug erwerben. Dazu gehört neben einer Vertiefung der mathematischen und physikali-
schen Kenntnisse auch die Kenntnis von Software-Entwicklungs-Techniken jenseits des Anspruchs
einfacher Programmierkurse.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Aufgrund der Diversität der Praktikumsaufgaben wird bei der ersten Besprechung mit
der Praktikantengruppe Literatur empfohlen.
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 50 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 51 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Angewandte Heterogene Kata-lyse Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_TC_VM1-M-7
Prof. Dr. W. Thiel N.N.
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststudium: Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Angewandte Heterogene
Katalyse 3SWS x 15= 45 h 75 h 4 LP
Seminar [S1]: Heterogene Katalyse 3SWS x 15= 45 h 75 h 4 LP
2. Inhalte:
[V1]: „Angewandte Heterogene Katalyse“ Grundlagen der Katalyse (Geschichte, Wesen der Katalyse, Definition eines Katalysators)
Arten fester Katalysatoren
Methoden zur Herstellung von festen porösen Trägern bzw. Trägerkatalysatoren (Fällung, Impräg-
nierung, Ionenaustausch)
Methoden zur Charakterisierung fester, poröser Katalysatoren (N2-Adsorption, XRD, REM und EDX,
chemische Analyse, Adsorption von Sondenmolekülen, katalytische Testreaktionen)
Formselektive Katalyse
[S1]: „Heterogene Katalyse“
Literaturvorträge über Grundlagen und aktuelle Forschung auf dem Gebiet der Heterogenen Kata-
lyse und der spektroskopischen Charakterisierung von festen Katalysatoren.
3. Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden
besitzen grundlegende Kenntnisse über das Wesen und die Prinzipien der Katalyse im Allgemei-
nen und der Heterogenen Katalyse im Besonderen.
lernen die wichtigsten Arten von Feststoff-Katalysatoren sowie Methoden zu ihrer Herstellung
kennen.
besitzen Kenntnisse über ausgewählte Methoden zur physikalisch-chemischen Charakterisierung
von Feststoff-Katalysatoren.
besitzen Kenntnisse über die wichtigsten katalytischen Testreaktionen.
vertiefen sich anhand der wissenschaftlichen Literatur in einem bestimmten Thema und tragen
dies in Form eines Vortrags vor.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 52 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: J. Hagen, Technische Katalyse, Wiley-VCH
G. Ertl, H. Knözimger, F. Schüth, J. Weitkamp, Handbook of Heterogeneous
Catalysis, 2. Ed., Wiley-VCH
G. Rothenberg, Catalysis – Concepts and Green Applications, Wiley-VCH,
J. W. Niemantsverdriet, Spectroscopy in Catalysis, Wiley-VCH
B. M. Weckhuysen, In-situ spectroscopy of catalysts, American Scientific
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 53 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Angewandte Heterogene Katalyse Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_TC_VM2-M-7
Prof. Dr. W. Thiel N.N., sowie weitere Dozenten in Absprache
mit dem Modulbeauftragten
Arbeitsaufwand ge-
samt (30 h = 1 LP):
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrveran-
staltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Heterogene Katalyse 10SWS x 15 =150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Herstellung eines festen, porösen Katalysators durch Fällung/Imprägnierung
Ermittlung von spezifischer Oberfläche, spezifischem Porenvolumen und Porenradienverteilung
Charakterisierung mittels REM und EDX
Charakterisierung mittels TPO/TPR/TPD
Durchführung je einer katalytischen Reaktion im Festbett-Strömungsreaktor und im Rührautokla-
ven inklusive Produktanalytik und Auswertung hinsichtlich Umsatz bzw. Ausbeute/Selektivität)
Datenanalyse UV/Vis-Spektroskopie
Datenanalyse XRD
Datenanalyse NMR-Spektroskopie
NMR-Untersuchung von sauren Zeolithen für die Kerne 1H, 27Al und 29Si
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden
sollen praktische Erfahrung sammeln bei der Herstellung von Feststoff-Katalysatoren, ihrer Charak-
terisierung mittels grundlegender Methoden und in der Durchführung katalytischer Reaktionen in
verschiedenen Reaktortypen.
sollen die praktische Datenanalyse für ausgewählte Methoden erlernen.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 54 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Literaturhinweise: J. W. Niemantsverdriet, Spectroscopy in Catalysis, Wiley-VCH
B. M. Weckhuysen, In-situ spectroscopy of catalysts, American Scientific
Handbook of Heterogeneous Catalysis, Wiley-VCH
Handbook of Porous Solids, Wiley-VCH
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 55 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Molekulare Katalyse Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_TC_VM3-M-7
Prof. Dr. W. R. Thiel [V1] Prof. Dr. W. R. Thiel & Prof. Dr. H. Sitz-
mann, [V2] Prof. Ulber, [S1] Prof. Dr. W. R.
Thiel
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
2 Semester V1 = SS
V2 + S1 = WS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststudium: Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Homogene Katalyse 2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Vorlesung [V2]: Biotransformation und Bi-
okatalyse 2SWS x 15 = 30h 60 h 3 LP
Seminar [S1]: Homogene Katalyse 2SWS x 15 = 30h 30 h 2 LP
2. Inhalte:
[V1]: „Homogene Katalyse" Geschichte und Grundlagen der homogenen Katalyse
Wichtige Ligandklassen un deren Herstellung
Hydrierung, Hydrosilylierung, Hydroformylierung
Katalytische Polymerisationen
C-C-, C-N-, C-O-Verknüpfungen Olefinmetathese
[V2]: „Biotransformation und Biokatalyse“ Einführung (Definition Biotransformation/Biokatalyse, Geschichte der Biokatalyse)
Biosynthese, Struktur und Wirkungsweise von Enzymen
Gewinnung und Produktion von Enzymen
Nomenklatur und Enzymklassen
Immobilisierung von Enzymen
Kinetik enzymatischer Reaktionen
Regulierung & Hemmung enzymatischer Reaktionen
Optimierung von Enzymen
Reaktoren für Biokatalyse und Biotransformation
Allgemeine Anwendungen; Co-Substratrecycling
Industrielle Anwendung verschiedener Enzymklassen
Ganzzellbiotransformationen
[S1]: „Katalyse“
Vorträge von Studierenden über aktuelle Themen der Katalyse
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 56 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
3. Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
[V1]: „Homogene Katalyse" Die Studierenden
kennen die wichtigsten Grundlagen und Konzepte der homogenen Katalyse.
können diese Konzepte zur Lösung von Problemen und Fragestellungen der homogenen Katalyse
anwenden.
entwickeln selbständig Vorstellungen zu den Reaktionsmechanismen neuer katalytischer Reaktio-
nen.
[V2]: „Biotransformation und Biokatalyse“ Die Studierenden
besitzen ein vertieftes Verständnis über die Anwendung von isolierten Enzymen und von Ganzzell-
systemen in technischen Verfahren.
sind in der Lage, biokatalytische Prozesse nach Vorgabe von Substrat und Produkt eigenständig zu
planen und auszulegen.
[S1]: „Katalyse“ Die Studierenden
können aus einer gegebenen Literatur einen wissenschaftlichen Vortrag erarbeiten.
lernen den Umgang mit Fragen zu wissenschaftlichen Vorträgen kennen.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Keine
Inhaltlich:
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Behr, Angewandte Homogene Katalyse, Wiley-VCH
R.D. Schmid; Pocket Guide to Biotechnology and Genetic Engineering;
Wiley-VCH
W. Storhas; Bioverfahrensentwicklung; Wiley-VCH
K. Buchholz, V. Kasche, U. T. Bornscheuer; Biocatalysts and Enzyme Techno-
logy; Wiley-VCH
S. Bommarius, B. R. Riebel, Biocatalysis, Fundamentals and Applications,
Wiley-VCH
A. Liese, K. Seelbach, C. Wandrey; Industrial Biotransformations, 2. Ed
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 57 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunkmodul (Praxis): Molekulare Katalyse Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_TC_VM4-M-7
Prof. Dr. W. R. Thiel Prof. Dr. R. Ulber, Prof. Dr. W. Thiel; Prof.
H.-J. Krüger, Ph.D.; Prof. Dr. H. Sitzmann;
Jun.-Prof. Dr. S. Becker
Arbeitsaufwand ge-
samt (30 h = 1 LP):
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester einmal jährlich
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktika [P1]: Homogene Katalyse
oder wahlweise
[P2]: Bioverfahrenstechnik
10SWS x 15 =150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
[P1]: „Homogene Katalyse“
Synthese und Charakterisierung homogener Katalysatoren
Planung und Durchführung homogener Katalysen
Auswertung von Katalyseergebnissen
[P2]: „Bioverfahrenstechnik“
Herstellung von Fest- und Flüssigmedien unter Sterilbedingungen
Kultivierung von Mikroorganismen im Schüttelkolben, Zellzählung, Biomassebestimmung
Synthese und Charakterisierung homogener Katalysatoren
Bestimmung von Betriebsparameter für eine Submerskultivierung
Enzymreinigung (Zellaufschluss, Hitzedenaturierung, Aussalzen, chromatographische Proteinaufrei-
nigung, Affinitätschromatographie
Enzymkinetik
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
[P1]: „Homogene Katalyse“
Die Studierenden
sollen die Synthese homogener Katalysatoren unter Anleitung planen und durchführen können.
sollen Charakterisierungsmethoden für homogene Katalysatoren verstehen.
sollen homogene Katalysen planen und durchführen können.
sollen ein grundlegendes Verständnis für die Produktcharakterisierung erwerben.
sollen grundlegende Kenntnisse zur Katalysator- und Verfahrensoptimierung erwerben.
[P2]: „Bioverfahrenstechnik“
Die Studierenden
sollen die Synthese homogener Katalysatoren unter Anleitung planen und durchführen können.
kennen das Handling von Mikroorganismen
kennen den Aufbau von Bioreaktoren
erarbeiten sich Lösungsstrategien bei der praktischen Durchführung von Fermentationen und Bio-
transformationen
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 58 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise:
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 59 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Strukturelle Biochemie und Enzy-mologie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_BC/LC_VM1-M-
5
Prof. Dr. A. Pierik [V1] + [S1] Prof. Dr. A. Pierik und
[V2] Prof. Dr. M. Deponte
Arbeitsaufwand ge-
samt (30 h = 1 LP):
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS
Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststudium: Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung [V1]: Strukturelle Biochemie 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
[V2]: Enzymologie 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
Pflichtseminar
[S1]: Biochemisches Seminar I 2SWS x 15= 30 h 30 h 2 LP
Inhalte:
[V1]: „Strukturelle Biochemie"
Strukturelle Biochemie: Disulfid-Brücken und cis-Prolin, Konformation und Flexibilität, Methoden
(FTIR, ESR, NMR Spektroskopie, Massenspektrometrie, Röntgen-Kristallographie, Kryoelektronen-
mikroskopie), oxidativer Stress
Anwendungen struktureller Information
[V2]: „Enzymologie"
Enzymklassifizierung, Theorie zu steady-state und pre-steady-state Kinetiken sowie Analyse- und
Auswertungsmethoden, Prinzipien der Enzymkatalyse, reversible und irreversible Reaktionen, Inhi-
bitionstypen, Allosterie/Kooperativität, Beispiele ausgewählter Enzymmechanismen
[S1]: „Biochemisches Seminar I“
Themen aus aktuellen biochemischen Artikeln sowie Vorträge und Gruppenseminare (z.B. GDCh,
Bio-kolloquium, Seminare der AGs Pierik & Deponte). Aktive Teilnahme in Form eines selbstgestal-
teten Seminars. Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Vorlesungen
Die Studierenden werden in der Lage sein
sich in die fortgeschrittenen Themen der Biochemie einzuarbeiten und sich in wichtigen biowissen-
schaftlichen Richtungen nach ihren Neigungen zu spezialisieren.
Seminar
Die Studierenden werden in der Lage sein
sich in biochemische wissenschaftliche Literatur zu einem bestimmten Thema einzuarbeiten und
diese in Form eines Vortrags zu präsentieren. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal:
Inhaltlich: Das Grundmodul Biochemie wird dringend empfohlen.
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 60 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: J. Rassow et al. Biochemie, 2. Aufl. (Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2008,
ISBN 978-3131253521)
T. D. Pollard, W. C. Earnshaw: Cell Biology, 2nd Ed. (Saunders, 2007, ISBN
978-1416022558)
T. D. Pollard, W. C. Earnshaw, J. Lippincott-Schwartz: Cell Biology. Das Origi-
nal mit Übersetzungshilfen, 2nd Ed. (Spektrum Akademischer Verlag, 2008,
ISBN 978-3827418616)
Nelson & Cox: Lehninger Biochemie, 4. Aufl. (Springer, 2009, ISBN
9783540686378)
Voet & Voet: Biochemistry, 4th Edition (Wiley, 2011, ISBN 9780470570951)
H. Bisswanger: Enzymkinetik - Theorie und Methoden. 3. Auflage, Wiley-
VCH, Weinheim 2000, ISBN 978-3-527-30096-9
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
Anmeldungsverfahren:
-
Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 61 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Strukturelle Biochemie und Enzy-mologie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_BC/LC_VM2-M-
6
Prof. Dr. A. Pierik Prof. Dr. A. Pierik, Prof. Dr. M. Deponte
Arbeitsaufwand ge-
samt:
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Forschungspraktikum Biochemie 10SWS x 15= 150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Das Praktikum erfolgt im Rahmen einer Mitarbeit an laufenden Projekten in den am Vertiefungsmo-
dul beteiligten Arbeitsgruppen.
Das Thema der individuell definierten Praktikumsarbeit wird sich im weitesten Sinne von den in
den Vorlesungen vermittelten Inhalten ableiten und der/m Studierenden ermöglichen, die dort er-
worbenen theoretischen Kenntnisse zu vertiefen und in die Praxis umzusetzen.
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden
werden in die biochemische Forschung eingeführt.
bearbeiten selbständig biochemische Forschungsthemen führen zu einem bestimmten Thema Ver-
suchsreihen durch.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich: Das Grundmodul Biochemie wird dringend empfohlen.
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Studien- und Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 62 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 63 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Life-Science Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_BC/LC_VM3-
M-6
Prof. Dr. M. Deponte, Prof. Dr. E. Richling [V1] und [V2] Jun.-Prof. Dr. A. Cartus, [V3]
Prof. Dr. A. Pierik,
[V4] und [S1] Prof. Dr. M. Deponte,
[V5] Prof. Dr. J. Fahrer
Arbeitsaufwand ge-
samt (30 h = 1 LP):
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 – 2 Semester Je nach gewähl-
ter Veranstal-
tung
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung Lehrveranstaltungen im Umfang
von
4 SWS aus der Auswahl [V1] -
[V5]:
[V1]: „ Grundlagen und Biochemie
der Ernährung I" (WS) 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
[V2]: Grundlagen und Biochemie
der Ernährung II (SS) 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
[V3]: Mikrobielle Biochemie I (SS) 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
[V4]: [V3]: Mikrobielle Biochemie
II (SS) 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
[V5]: Pharmakologie für Naturwis-
senschaftler I und II (WS/SS) 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
Pflichtseminar
[S1]: Biochemisches Seminar II 2SWS x 15 = 30 h 30 h 2 LP
2. Inhalte:
[V1]: „Grundlagen und Biochemie der Ernährung I"
Bestimmung des Ernährungszustandes
Energiehaushalt: Energiehaushalt und Stoffwechsel, Methoden zur Bestimmung des Energiehaus-
halts
physikalische und physiologische Brennwerte der Makronährstoffe und deren biologische Wertig-
keit
Regulation der Energiebilanz bei Resorption, Postresorption und Hunger mit dem Schwerpunkt der
biologischen Energiegewinnung aus den Nährstoffen
Prinzipien der Stoffwechselregulation und hormonaler Regulation
Regulation der Nahrungsaufnahme und Grundlagen der zentralnervösen Appetitregulation
Anatomie und Physiologie der an Verdauung und Metabolismus beteiligten Organe
Verdauung, Resorption und Transport von Kohlenhydraten, Lipiden und Proteinen
Kohlenhydratstoffwechsel
Lipidstoffwechsel, biologisch relevante Lipide: Phospho- und Sphingolipide und Eicosanoide,
Proteinstoffwechsel; funktionelle Proteine , Stickstoffausscheidung und –bilanz
[V2]: „Grundlagen und Biochemie der Ernährung II“
Epidemiologische Grundlagen und Beispiele ernährungsrelevanter epidemiologischer Studien
Vitamine: Allgemeines, Historie, vitaminähnliche Substanzen
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 64 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Gruppe der fettlöslichen und wasserlöslichen Vitamine: Grundlagen von Verdauung und Resorp-
tion, Bedarf, Bedarfsermittlung und Statusbestimmung , biochemische Funktionen, Hyper- und Hy-
povitaminosen
Mengenelemente, Spurenelemente und Ultraspurenelemente: Resorption, Bedarf, Funktionen, Mi-
neralstoffstoffwechsel und Toxikologie
quantitative und qualitative Aspekte der Ernährung, Grundlagen der Diätetik und besonderen Er-
nährungsformen (Vegetarismus, Veganismus, Vollwertige Ernährung, Vollwerternährung, low carb)
Nutrigenomik
Ernährungsassoziierte Krankheiten, Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten
[V3]: „Mikrobielle Biochemie I"
Radikal-SAM-Enzyme, Hydrogenase, Nitrogenase, Acetogenese und Methanogenese, Pyrrolysin,
Aminosäurenfermentation, Sulfat-Reduktion, Biotechnologie
[V4]: „Mikrobielle Biochemie II“
Spezielle Stoffwechselwege in Bakterien und Protisten, molekulare Parasitologie, Wirkstoffent-
wick-lung, Screening vs. rationales Wirkstoffdesign, Zielmolekülidentifizierung, Resistenzmecha-
nismen
[V5]: „Pharmakologie für Naturwissenschaftler I und II“
Pharmakologie I
Einführung in die Grundlagen der Pharmakologie, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Arzneimit-
telrecht, -entwicklung & -zulassung
Pharmakologie II
Therapeutika folgender Klassen: am Parasympathikus angreifend, am Sympathikus angreifend,
Analgetika, Diuretika, Chemotherapeutika, Antiinfektiva, Hormone, Narkotika und Muskelrelaxan-
tien, Antiasthmatika, Antiallergika, Therapie der Herzinsuffizienz, Antihypertonika und Koronarthe-
rapeutika, Therapeutika des Magen-Darm-Traktes
[S1]: „Biochemisches Seminar II“
Themen aus aktuellen biochemischen Artikeln sowie Vorträge und Gruppenseminare (z.B. GDCh,
Biokolloquium, Seminare der AGs Pierik & Deponte). Aktive Teilnahme in Form eines selbstgestal-
teten Seminars.
3. Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden sollen
in den Vorlesungen ihre Kenntnisse in fortgeschritten Themen der Biochemie erweitern und sich in
wichtigen biowissenschaftlichen Richtungen nach ihren Neigungen spezialisieren.
im Seminar Kompetenzen im Verständnis von biochemischer wissenschaftlicher Literatur und Fer-
tigkeiten im Vortrag erwerben.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal:
Inhaltlich: Das Grundmodul Biochemie wird dringend empfohlen.
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: [V1]: „Grundlagen und Biochemie der Ernährung I“:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 65 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Berg et al., Stryer Biochemie, Spektrum Akademischer Verlag (BIO 100/036,
CHE 694/020 und L BIO 76 sowie Online-Ressource im Uninetz)
Biesalski, Taschenatlas der Ernährung, Thieme Verlag (CHE 230/059 und
BIO 610/061)
Biesalski et al., Ernährungsmedizin, Thieme Verlag (BIO 610/036, CHE
230/052 und L CHE 1)
Koolman und Rhöm, Taschenatlas der Biochemie, Thieme Verlag (CHE
685/095)
Rehner und Daniel, Biochemie der Ernährung, Spektrum Akademischer Ver-
lag (CHE 230/044 und Online-Ressource im Uninetz)
Silbernagl und Despopoulos, Taschenatlas der Physiologie, Thieme Verlag
(BIO 502/096 und L BIO 134)
Thews et al., Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen, Wis-
senschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart (BIO 640/007 und L BIO
293)
[V2]: „Grundlagen und Biochemie der Ernährung II“:
Biesalski, Taschenatlas der Ernährung, Thieme Verlag (CHE 230/059 und
BIO 610/061)
Biesalski et al., Ernährungsmedizin, Thieme Verlag (BIO 610/036, CHE
230/052 und L CHE 1)
Dunkelberg et al., Vitamine und Spurenelemente, Wiley VCH Verlag (Online-
Ressource im Uninetz)
Ebermann und Elmadfa, Lehrbuch Lebensmittelchemie und Ernährung,
Springer Verlag (Online-Ressource im Uninetz)
Haller et al., Biofunktionalität der Lebensmittelinhaltsstoffe, Springer
Spektrum (Online-Ressource im Uninetz)
Kreienbrock et al., Epidemiologische Methoden, Springer Spektrum (Online-
Ressource im Uninetz)
Rehner und Daniel, Biochemie der Ernährung, Spektrum Akademischer Ver-
lag (CHE 230/044 und Online-Ressource im Uninetz)
Pietrzik et al., Handbuch der Vitamine, Urban & Fischer Verlag/Elsevier
GmbH (CHE 248/073)
Biochemie:
Nelson & Cox: Lehninger Biochemie, 4. Aufl. (Springer, 2009, ISBN
9783540686378)
Voet & Voet: Biochemistry, 4th Edition (Wiley, 2011, ISBN 9780470570951)
Nelson & Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 7th Edition (WH Free-
man, 2017, ISBN 9781319108243)
Koolmann & Röhm: Taschenatlas Biochemie, 4. Auflage (Thieme, 2009,
ISBN 9783137594048)
Löffler & Petrides: Biochemie und Pathobiochemie, 9. Auflage (Springer,
2014, ISBN 9783642179716)
Lottspeich & Engels: Bioanalytik, 2. Auflage (Springer, 2012, ISBN
9783827429421)
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 66 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Life Science Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_BC/LC_VM4-M-
6
Prof. Dr. M. Deponte, Prof. Dr. E. Richling [P1] Prof. Dr. M. Deponte, Prof. Dr. A. Pierik
[P2] Prof. Dr. E. Richling, Prof. Dr. J. Fahrer
Arbeitsaufwand ge-
samt
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile)
Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum
Auswahl eines der beiden Prak-
tika.
[P1]: Forschungspraktikum Bio-
chemie 10SWS x 15= 150 h 90 h 8 LP
[P2]: Fortgeschrittenenpraktikum
in Lebensmittelchemie und Toxi-
kologie
10SWS x 15= 150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
[P1]: „Forschungspraktikum Biochemie“
Aktuelle Forschungsthemen
[P2]: „Fortgeschrittenenpraktikum in Lebensmittelchemie und Toxikologie“
Spurenanalytik von Inhaltsstoffen und Kontaminanten unter toxikologischen Gesichtspunkten
Vertiefende analytische Kenntnisse (Isolierung, Strukturaufklärung und Quantifizierung) über die
Zusammensetzung von Lebensmitteln, Lebensmittelbestandteilen, kosmetischen Mitteln und Be-
darfsgegenständen und Biomolekulares Arbeiten (Zellkultur, Zytotoxizität, Proteinanalytik, Toxiko-
logische Testsysteme zur Erfassung von Genotoxizität und Mutagenität)
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
[P1]: „Forschungspraktikum Biochemie“
Die Studierenden sollen
in die biochemische Forschung eingeführt werden.
zur selbständigen Bearbeitung von biochemischen Forschungsthemen hingeführt werden.
ihre Ergebnisse mit biochemischer Fachliteratur hinterlegen und dieses in Form eines Vortrags prä-
sentieren.
[P2]: „Lebensmittelchemie und Toxikologie“
Es werden selbstständige wissenschaftliche Arbeiten in den Bereichen der Lebensmittelanalytik,
Zellkulturarbeiten, biomolekularen Analytik und toxikologischer Untersuchungsverfahren durchge-
führt. Die Studierenden müssen in vorgegebener Zeit eine wissenschaftliche Fragestellung aus den
Gebieten der Lebensmittel oder Toxikologie oder dem Umweltbereich analytisch/wissenschaftlich
(experimentelle Aufgabe) selbstständig bearbeiten und die Ergebnisse fachgerecht schriftlich dar-
stellen.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich:
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 67 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Matissek; Steiner, Lebensmittelanalytik 3. Auflage, Springer Verlag, 2006
Bundesanstalt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Amtliche
Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB, Stand 2009, Beuth
Verlag
Schweizerisches Lebensmittelbuch, Stand 2009, Eidgen. Drucksachen und
Materialzentrale
Lindl & Gstraunthale, Zell und Gewebekultur, Spektrum Verlag, 2008
Lottspeich & Zorbas, Bioanalytik, Spektrum, Akad. Verlag
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 68 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Theorie): Lebensmittelchemie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_BC/LC_VM5-
M-6
Prof. Dr. E. Richling [V1] und [V2]: Prof. Dr. E. Richling,
[V3] und [V4+S1] Prof. Dr. E. Richling, Dipl.-
LMChem. S. Stegmüller
[S2]: Prof. Dr. E. Richling, Prof. Dr. J. Fahrer
Arbeitsaufwand ge-
samt (30 h = 1 LP):
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 – 2 Semester Je nach gewähl-
ter Veranstal-
tung
Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehr-
veranstaltungen:
Selbststudium: Leistungspunkte
(LP):
Vorlesung Lehrveranstaltungen im Umfang von
4 SWS aus der Auswahl [V1]-[V4 +
S1]:
[V1]: Lebensmittelchemie und -tech-
nologie II (WS) 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
[V2]: Lebensmittelchemie und -tech-
nologie III (SS) 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
[V3]: Kosmetische Mittel und Be-
darfsgegenstände (WS) 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
[V4+ S1]: Biomolekulare Analytik und
Seminar zur Biomolekularen Analytik 2SWS x 15 = 30 h 60 h 3 LP
Seminar [S2]: Lebensmittelchemisches/toxiko-
logisches Literaturseminar
2SWS x 15 = 30 h 30 h 2 LP
Inhalte:
[V1]: „Lebensmittelchemie und –technologie II" Wasser und seine Bedeutung als Lebensmittel und Lebensmittelbestandteil
Monosaccharide: Chemie und Reaktivität
Nicht-enzymatische Bräunung
Maillard-Reaktion und ihre Bedeutung für die Lebensmittelqualität (und den Organismus)
Oligosaccharide
Rohr- und Rübenzuckertechnologie
Zuckeraustauschstoffe
Süßgeschmack, Süßstoffe
Kohlenhydrat-Verdauung
Zuckerwaren
Polysaccharide
Stärke: Hauptbestandteile
Eigenschaften, Gewinnung, Technologie, Stärkederivate
Weitere Glucane
Cellulose und –derivate
Futtermittel
C3/C4-Pflanzen, Isotopenverhältnisanalytik
Fettlösliche Vitamine: Vit. A (Retinol), Vit. D (Calciferol), Vit. E (α-Tocopherol), Vit. K (Phytomenadion)
Wasserlösliche Vitamine: Vit. B1 (Thiamin), Vit. B2 (Riboflavin), Niacin (Nicotinsäureamid), Vit. B6 (Pyri-
doxin), Pantothensäure, Biotin, Folsäure, Vit. B12 (Cyanocobalamin), Vit. C (L-Ascorbinsäure)
Mineralstoffe (Natrium, Magnesium, Calcium, Chlorid, Kalium)
Spurenelemente (Selen, Zink, Eisen, Iod)
[V2]: „Lebensmittelchemie und –technologie III“
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 69 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Fettsäuren/Lipide
Grundlagen der Fettchemie
Aufbau und Klassifizierung
Begriffe, Nomenklatur
Biochemie des Auf- und Abbaus
Fette als Nahrungsbestandteile
Fettsäuren, Fettbegleitstoffe
Technologie der Fettgewinnung und Verarbeitung
Nahrungsqualität beeinflussende Reaktionen von/an Lipiden
Autoxidation
Enzymatische Veränderungen
Fettersatzstoffe
Analytik, -Kennzahlen, GC, HPLC
Aminosäuren (Bedeutung, Vorkommen, Konfiguration, Synthese, Analytik)
Stickstoffkreislauf, physiologische Bedeutung der Aminosäuren
Peptide (Synthese, Schutzgruppentechniken, Vorkommen z.B. Glutathion)
Proteinbiosynthese
Biogene Amine, Toxine auf Peptidbasis (z.B. Mutterkornalkaloide), Hormone
Aminosäure- und Proteinanalytik
Protein-Struktur und -Modifikation
Proteine in Lebensmitteln
Fleisch (Muskulatur, rigor mortem, DFD, PSE, Verarbeitung, Kollagen), Fleischwaren
Milch (Zusammensetzung, Verarbeitung, Butter, Käse, Joghurt)
Getreide (Verarbeitung, Zusammensetzung, Kleber)
Getreide als Futtermittel [V3]: „Kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände“
Rechtliche Grundlagen (EU Richtlinien/Verordnungen, LFGB, Kosmetikverordnung)
Anforderungen an die Sicherheitsbewertung (Guidance Dokument des SCCS der EU)
Toxikologische Prüfmethoden (OECD Guidelines)
Alternativmethoden (OECD Guidelines)
Haut (Biolog. Grundlagen, Testsysteme, Teststrategien), Mittel zur Reinigung, zur Pflege und zum
Schutz der Haut, UV-Filer, Repellents
Haare (Aufbau und Struktur), Haarbehandlungsmittel
Dekorative kosmetische Mittel
Geruchssinn, Duftstoffe (Herkunft und Gewinnung), Parfüms, Deodorantien, Antitranspirantien
Mundhöhle und Zähne, Zahnerkrankungen und ihre Prophylaxe, Zahnersatz, Zahn- und Mundpflege-
mittel
Sicherheitsbewertung von Bedarfsgegenständen
Rechtliche Grundlagen (EU Richtlinien/Verordnungen, LFGB, Bedarfsgegenständeverordnung)
Materialien (Kunststoff, Papier, Kork, Keramik, Metalle)
Zusatzstoffe und Kontaminanten (Weichmacher, Farben, Nitrosamine)
Spielzeug, Scherzartikel (Bewertungen an Fallbeispielen)
Textilien (Flammschutzmittel, antimikrobielle Wirkstoffe, Färben und Farbstoffe, Textilhilfsstoffe)
Migration (Einflussgrößen, Messmethoden, Migrationsgrenzwerte, Fallbeispiele) [V4+S1]: „Biomolekulare Analytik“
Einführung in biochemische Methoden
Methoden der Zellkultur, Kultivierung von Säugerzellen
Proteinisolierung, Isolierung von Nukleinsäuren
Elektrophorese (Proteine, RNS), Western Blot, Northern Blot
Immunoassays
Polymerase Kettenreaktion , Methoden der RNA-Quantifizierung
Expressionsanalytik, Klonierung und Transfektion
Internetdatenbanken, (Online-) Literaturrecherche, Multimediale Präsentationen
Seminare über ausgewähltes bioanalytisches Thema (Vorgabe durch den Dozenten)
[S2]: „Lebensmittelchemisches/ toxikologisches Literaturseminar“
Vorgaben durch den betreuenden HochschullehrerIn
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 70 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
[V1] + [V2] „Lebensmittelchemie und –technologie II & III"
Die Studierenden erlangen Grundkenntnisse in der chemischen Zusammensetzung sowie in der Gewin-
nung und Analytik von Lebensmitteln und Futtermitteln. Des Weiteren wird ein Wissen über chemische
Veränderungen bei der Be- und Verarbeitung, Lagerung und Transport sowie Grundkenntnisse der Ana-
lytik vermittelt. Ein weiterer Modulschwerpunkt stellen verfahrenstechnische Grundoperationen in Be-
zug auf die Herstellung, Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln dar.
[V3] + [V4+S1] „Kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände & Biomolekulare Analytik“
Die Studierenden haben in diesem Modul die Wahl zwischen einer Vertiefung ihrer Kenntnisse im Be-
reich der Lebensmittelchemie (Kosmetik und Bedarfsgegenstände) oder der Biomolekularen Analytik.
Zum einen wird somit ein Wissen über die Zusammensetzung sowie rechtlicher Einordnung von kos-
metischen Mitteln und Bedarfsgegenständen vermittelt und somit die Felder die Lebensmittelchemie
Lebensmittel, Futtermittel, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände vollständig abgedeckt. Studie-
rende, die jedoch ihren Schwerpunkt auf physiologische Aspekte ausrichten möchten, bekommen mit
der Vorlesung Biomolekulare Analytik weitere Einblicke in den Nachweis von Biomarkern mit Hilfe be-
währter sowie zukunftsweisenden Methode ermöglicht.
[S2] „Lebensmittelchemisches/ toxikologisches Literaturseminar“
Im Rahmen des Seminars werden selbstständige Literaturrecherchen zu einem ausgewählten Thema
im Bereich der Lebensmittelchemie oder -toxikologie durchgeführt. Dabei werden die Studierenden in
vorgegebener Zeit ein wissenschaftliches Thema aus den Gebieten der Lebensmittelchemie oder -to-
xikologie mit Hilfe aktueller Literatur beschreiben und bewerten. Eine Zusammenfassung ist schriftlich
darzustellen und wird in Form eines Vortrages präsentiert und vertreten. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal:
Inhaltlich: Die Vorlesung Biochemie des Grundmoduls wird dringend empfohlen.
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: [V1]: „Lebensmittelchemie und -technologie II" und [V2]: „Lebensmittelchemie und -
technologie III"
Baltes: Lebensmittelchemie (Springer Verlag)
Baltes: Schnellmethoden zur Beurteilung von Lebensmitteln und ihren Roh-
stoffen (Behr`s Verlag)
Belitz, Grosch, Schieberle: Lehrbuch der Lebensmittelchemie (Springer Verlag)
Schwedt: Taschenatlas der Lebensmittelchemie (Wiley-VCH)
Matissek: Lebensmittelanalytik (Springer Verlag)
Eisenbrand, Schreier: Römpp Lexikon Lebensmittelchemie (Thieme Verlag)
§64 Methoden LFGB (früher: §35 Methoden LMBG)
Schuchmann/Schuchmann: Lebensmittelverfahrenstechnik (WILEY-VCH)
Eisenbrand, Metzler, Hennicke : Toxikologie für Naturwissenschaftler und Me-
diziner (WILEY-VCH)
Nau, Steinberg, Kietzmann: Lebensmitteltoxikologie (Thieme Verlag)
Einschlägige Fachzeitschriften wie ‚Molecular Nutrition and Food Research’
Baltes: Lebensmittelchemie (Springer Verlag)
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 71 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Biochemie der Ernährung; Gertrud Rehner/Hannelore Daniel; Spektrum Aka-
dem. Verlag (2002)
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, Thieme Verlag (2002)
Taschenatlas der Biochemie; Jan Koolman; Thieme Verlag (2002)
Taschenatlas der Physiologie; Stefan Silbernagel; Thieme Verlag (2007)
Römpp Lebensmittelchemie-Lexikon; Thieme Verlag (2006)
Taschenatlas der Ernährung; Thieme Verlag (2007)
[V3]: „Kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände“ Kosmetik und Hygiene, Umbach, Wiley-VCH, 2004
Römpp Lebensmittelchemie-Lexikon; Thieme Verlag, 2006
Eisenbrand, Metzler, Hennicke : Toxikologie für Naturwissenschaftler und Me-
diziner (WILEY-VCH)
Bedarfsgegenstände, A. Montag, Behr’s Verlag 1997
Bundesgesundheitsblatt (Empfehlungen des BGA/BfR)
Fey, Otte: Wörterbuch der Kosmetik, Wiss. Verlagsgesellschaft
Wagner: Waschmittel, Wiley-VCH
[V4+S1]: „Biomolekulare Analytik“ Lottspeich: Bioanalytik, Spektrum-Verlag, neueste Auflage
Rehm: Der Experimentator: Proteinbiochemie / Proteomics, Spektrum-Verlag,
Mülhardt: Der Experimentator: Molekularbiologie / Genomics, Spektrum-Verlag
[S1]: „Lebensmittelchemisches/ toxikologisches Literaturseminar“ je nach Thema in Verantwortlichkeit des betreuenden Hochschullehrers
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
Die Lehre erfolgt unter Einsatz moderner elektronischer Medien in Kombination mit
klassischen Lehrmitteln. Informationsmaterialien werden über das Internet bzw. auf
Wunsch als Kopiervorlagen zur Verfügung gestellt und ermöglichen die Vor- und Nach-
bereitung und Vertiefung des vermittelten Stoffes.
Anmeldungsverfahren:
-
Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 72 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Schwerpunktmodul (Praxis): Lebensmittelchemie Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-
Ch_BC/LC_VM6-M-
6
Prof. Dr. E. Richling Prof. Dr. E. Richling, Prof. Dr. J. Fahrer, Jun.-
Prof. Dr. A. Cartus, Dr. T. Bakuradze, Dipl.-
LMChem. R. Schulte-Hubbert, Dipl.-
LMChem. S. Stegmüller
Arbeitsaufwand ge-
samt (30 h = 1 LP):
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
240 h 8 LP nach Empfehlung der
Beratung (siehe 5 (7))
1 Semester WS sowie SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in Lehrver-
anstaltungen:
Selbststu-
dium:
Leistungspunkte
(LP):
Praktikum Lebensmittelchemie und Toxi-
kologie (Vertiefungspraktikum) 10SWS x 15= 150 h 90 h 8 LP
2. 3
.
Inhalte:
Forschungsthemen-bedingte Inhalte aus dem Bereichen
Lebensmittelanalytik, -technologie
Toxikologie
Chemische Synthese
Biochemische Forschung
3. 2
.
Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Mit erfolgreichem Abschluss des Moduls werden die Studierenden in der Lage sein,
selbstständig wissenschaftlich-experimentell zu arbeiten.
eigenständige Beiträge zur Versuchsplanung und -durchführung einzubringen.
eigenständige Literaturrecherche zu betreiben.
ein Laborjournal zu führen.
einen schriftlichen Forschungsbericht zu erstellen.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal: Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Inhaltlich: Das Praktikum aus dem Grundmodul Biochemie wird empfohlen, sowie das Vertie-
fungsmodul Life Science
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Internetseiten der Arbeitsgruppen der Fachrichtung Lebensmittelchemie
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 73 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Matissek; Steiner, Lebensmittelanalytik 3. Auflage, Springer Verlag, 2006
Bundesanstalt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Amtliche
Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB, Stand 2009, Beuth
Verlag
Schweizerisches Lebensmittelbuch, Stand 2009, Eidgen. Drucksachen und
Materialzentrale
Lindl & Gstraunthale, Zell und Gewebekultur, Spektrum Verlag, 2008
Lottspeich & Zorbas, Bioanalytik, Spektrum, Akad. Verlag
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Deutsch
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 74 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
Masterabschlussmodul
Masterabschlussmodul Kennnummer: Modulbeauftragte/r: Lehrende:
CHE-MM-Ch-AM-
Ma
Alle Professorinnen und Professoren des Fach-
bereichs Chemie oder durch den Prüfungsaus-
schuss bestellte Betreuerin oder Betreuer
Arbeitsaufwand ge-
samt (30 h = 1 LP):
Leistungspunkte (LP): Empfohlenes Studiense-
mester:
Dauer des Moduls: Turnus des Moduls:
900 h 30 LP 4. Semester 1 Semester WS sowie SS
1. Lehrveranstaltungen (Modulteile) Präsenzzeit in
Lehrveranstal-
tungen:
Selbststudium Leistungspunkte
(LP):
Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten, Abfassen
einer schriftlichen Abhandlung; Präsentation eines
Vortrags über die erzielten Ergebnisse
600 h 300 h 30 LP
2. Inhalte:
Je nach gewählter Fachrichtung / Arbeitsgruppe
3. Kompetenzen/Angestrebte Lernergebnisse:
Die Studierenden
sind in der Lage, wissenschaftlich zu arbeiten.
sind in der Lage, selbständige Literaturrecherchen durchzuführen.
können wissenschaftliche Ergebnisse kritisch interpretieren und in den jeweiligen Kenntnisstand
einordnen.
sind fähig wissenschaftliche Ergebnisse schriftlich und mündlich zu präsentieren und zu diskutie-
ren.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul:
Formal & Inhaltlich: Siehe Prüfungsordnung (§16 sowie Anhang).
Nach der Gefahrstoffverordnung ist Voraussetzung für die Durchführung praktischer
Arbeiten die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung, die nicht
länger als ein Jahr zurückliegt. Solche Sicherheitsunterweisungen werden vom Fach-
bereich Chemie in regelmäßigen Abständen angeboten; Ort und Zeit werden recht-
zeitig durch Aushang und im Internet bekanntgegeben.
Sofern eine Masterarbeit im Lehrgebiet der Organischen Chemie angefertigt wird,
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- erfolgreiche Teilnahme an mindestens einem Praxis-Vertiefungsmodul der Organi-
schen Chemie.
- erfolgreiche Teilnahme an drei Praxismodulen mit präparativen Inhalten.
5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbes. Prüfungen, Teilnahmenachweise):
Prüfungsleistung gemäß der Prüfungsordnung.
6. Notenermittlung
Modulnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Stellenwert in der
Endnote: Siehe Anhang Prüfungsordnung.
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 75 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
7. Verwendbarkeit des Moduls:
Vertiefungsmodul im Masterstudiengang Chemie und Wirtschaftschemie
8. Hinweise zur Vorbereitung auf das Modul
Literaturhinweise: Werden themenspezifisch ausgehändigt.
Lernunterlagen
und/oder weitere
Materialien:
9. Anmeldungsverfahren:
-
10. Unterrichtssprache:
Nach Vorgabe der Betreuerin oder des Betreuers.
Wahlpflichtmodul
Als Wahlpflichtmodul kann das Praktikum aus den Wirtschaftswissenschaften belegt werden. Al-
ternativ können alle Lehrveranstaltungen aus dem Master Chemie, die zuvor noch nicht belegt
worden sind, als Wahlpflichtmodul gewählt werden, welche in Summe mindestens 5 Leistungs-
punkte ergeben.
Lehrveranstal-
tungsnr.
Lehrveranstaltung SWS LP Verantwortliche
Person
E 1. Praktikum Praktikum 5 Dr. J. Blank
Wahlpflichtmodul (Lehrveranstaltung/en aus dem Mas-
terstudiengang Chemie)
Das Wahlpflichtmodul (Lehrveranstaltung/en aus dem Masterstudiengang Chemie) kann mit fol-
genden Beispielhaft aufgelisteten Lehrveranstaltungen, welche in Summe 5 LP ergeben, belegt
werden.
Lehrveranstal-
tungsnr.
Lehrveranstaltung SWS LP Verantwortliche
Person
PC_WM1 Ultrakurze Laserpulse: Anwendungen in der chemi-
schen Dynamik und Analytik
2 3 PD Dr. C. Riehn
CHE-400-020-V-
0
Proteinbiochemie 3+1 5 Prof. Dr. M.
Deponte
CHE-400-040-V-
5
Vergleichende Biochemie 3+1 5 Prof. Dr. M.
Deponte
CHE-600-010-V-
7
Post-Hartree-Fock-Methoden 2 3 Prof. Dr. C. van
Wüllen
CHE-300-500-V-
7
Clusterchemie I 2 3 Prof. Dr. Dr. G.
Niedner-
Schatteburg
Modulhandbuch Master-Studiengang Wirtschaftschemie Seite 76 von 76 Fachbereich Chemie, TU Kaiserslautern
CHE-300-520-V-
7
Moderne Methoden der Spektroskopie 2 3 Prof. Dr. M.
Gerhards
CHE-200-090-V-
7
Supramolekulare Chemie 2 3 Prof. Dr. D. Kubik
CHE-200-340-V-
7
Chemie der Sekundärmetabolite 2 3 Prof. Dr. J. Hartung
CHE-100-095-V-
5
Anorganische Strukturchemie 2 3 Prof. Dr. H.
Sitzmann
CHE-100-093-V-
5
Bioanorganische Chemie 2 3 Jun.-Prof. Dr. S.
Becker
CHE-200-350-S-
7
Medizinalchemie 2 2 Dr. Tielmann
CHE-100-091-V-
5
Anorganische Funktionsmaterialien 2 2 Prof. Dr. W. Thiel
CHE-100-112-S-
5
Physikalische Methoden der Anorganischen Chemie 2 2 Prof. Dr. H.-J.
Krüger
CHE-100-304-V-
5 und
CHE-100-305-U-
5
Röntgenstrukturanalyse
3 4 Jun.-Prof. Dr. S.
Becker
Schriftliche Ausarbeitung1
2 Je nach gewählter
Lehrveranstaltung
Softskill 1 2 Je nach Anbieter
Exkursion 1 1 Je nach Anbieter
1Die schriftliche Ausarbeitung wird thematisch im Bereich der gewählten Veranstaltung angefer-
tigt.