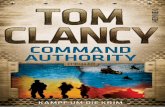TOM CLANCY - bilder.buecher.de · Prolog DieLage Noch war das Arbeitszimmer des Präsidenten leer....
Transcript of TOM CLANCY - bilder.buecher.de · Prolog DieLage Noch war das Arbeitszimmer des Präsidenten leer....
TOM CLANCY
DER SCHATTENKRIEG
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Hardo Wichmann
W I L H E L M H E Y N E V E R L A GM Ü N C H E N
Ohne Macht ist das Gesetz kraftlos.Pascal
Es ist die Funktion der Polizei, bei der Durchsetzung derAbsichten des Staates intern und unter normalenBedingungen Gewalt auszuüben oder mit ihrer Anwendungzu drohen. Es ist die Funktion der Streitkräfte, zu normalenZeiten extern und intern nur zu außergewöhnlichen ZeitenGewalt auszuüben oder mit ihrer Anwendung zu drohen|. . .Das Ausmaß der Gewalt, die der Staat zur Durchsetzungseiner Absichten auszuüben bereit ist|. . ., ist so groß, wiees die jeweilige Regierung zur Vermeidung einesZusammenbruchs ihrer Funktion und einer Aufgabe ihresVerantwortungsbereichs für nötig und angemessenerachtet.
General Sir John Hackett
Prolog
Die Lage
Noch war das Arbeitszimmer des Präsidenten leer. Das OvalOffice im Westflügel des Weißen Hauses ist durch drei Türenzu erreichen: vom Vorzimmer der Sekretärin, aus einer klei-nen Küche, die an das Privatzimmer des Präsidenten an-grenzt, und aus dem Korridor. Für das Büro eines Top-Mana-gers hat der Raum bescheidene Ausmaße; Besucher findenihn unweigerlich kleiner als erwartet. Der Schreibtisch desPräsidenten vor den dicken Fenstern aus kugelsicherem Poly-karbonat, das den Rasen vorm Weißen Haus nur verzerrtsichtbar werden läßt, besteht aus dem Holz vom HMS Resolu-te, einem britischen Polarforschungsschiff, das 1854 im Eisaufgegeben und im folgenden Jahr von Amerikanern gebor-gen wurde. Zum Dank ließ Königin Viktoria aus den Eichen-balken des Schiffes einen Schreibtisch fertigen und demUS-Präsidenten zum Geschenk machen. Das Möbelstück auseiner Zeit, in der die Menschen kleiner waren als heute, wurdewährend Reagans Präsidentschaft etwas erhöht. Nun war esbeladen mit Akten und Positionspapieren, einem Computer-ausdruck des präsidialen Terminkalenders, einer Sprechanla-ge, einem konventionellen Tastentelefon für mehrere Leitun-gen und einem ganz gewöhnlich aussehenden, aber hoch-komplizierten Apparat für abhörsichere Gespräche.
Der Sessel des Präsidenten war eine Sonderanfertigung,deren hohe Rückenlehne zum zusätzlichen Schutz gegenKugeln, die ein Irrer durch die schweren Fenster feuern moch-te, mit dem modernen Werkstoff Kevlar – leichter und festerals Stahl – gepanzert war. Natürlich taten um diese Tageszeit
7
in diesem Teil des Gebäudes rund ein Dutzend Agenten desSecret Service Dienst. Um hier hereinzukommen, mußte jedereinen Metalldetektor passieren und sich der strengen Kon-trolle der Secret-Service-Wache unterziehen. Bei diesen Män-nern, die man an ihren fleischfarbenen Ohrhörern erkannte,trat die Höflichkeit gegenüber der Hauptaufgabe, den Präsi-denten zu schützen, in den Hintergrund. Alle trugen unterden Jacketts schwere Faustfeuerwaffen, und jedem war beiderAusbildung eingeschärft worden, in jedermann und allemeine Bedrohung für WRANGLER, derzeitiger Codename fürden Präsidenten, zu sehen.
Vizeadmiral James Cutter von der US Navy war schon seit6 Uhr 15 in seinem Büro in der Nordwestecke des Westflügels.Der Job des Sicherheitsberaters des Präsidenten verlangteeinen Frühaufsteher. Kurz vor acht trank er seine zweite TasseKaffee, schob die Papiere für die Lagebesprechung in eineLedermappe, schritt durch das leere Zimmer seines Stellver-treters, der gerade in Urlaub war, wandte sich im Korridornach rechts, passierte das ebenfalls verwaiste Büro des Vize-präsidenten, der sich in Seoul aufhielt, und bog hinter der Türdes Stabschefs nach links ab. Cutter gehörte zu den wenigenInsidern – der Vizepräsident zählte nicht zu ihnen –, die ohnedie Genehmigung des Stabschefs das Oval Office betretendurften, wann immer sie es für notwendig erachteten. Aller-dings meldete er sich meist telefonisch an, um den Sekretärin-nen eine Vorwarnung zu geben. Dem Stabschef mißfielen sol-che Privilegien zwar, aber das hatte nur zur Folge, daß Cutterseinen unbeschränkten Zugang noch mehr genoß. Auf demWeg nickten ihm vier Leute von der Sicherheit einen gutenMorgen zu, und der Admiral nahm die Grüße hoheitsvoll zurKenntnis. Cutters offizieller Codename war LUMBERJACK.Er wußte zwar, daß man ihm beim Secret Service intern einenanderen, weniger schmeichelhaften Spitznamen verpaßt hat-te, aber was diese kleinen Fische von ihm hielten, war demAdmiral gleichgültig. Das Vorzimmer lief schon auf vollenTouren; drei Sekretärinnen und ein Agent des Secret Servicesaßen auf ihren Plätzen.
»Ist der Chef pünktlich?« fragte er.
8
»WRANGLER kommt gerade runter, Sir«, erwiderteSpecial Agent Connor. Er war vierzig, Abteilungschef derWache des Präsidenten, und völlig uninteressiert an CuttersMeinung über ihn. Präsidenten und ihre Berater kamen undgingen, manche geliebt, andere verhaßt, aber die Profis vomSecret Service bedienten und schützten sie alle. Sein geübterBlick glitt über die Ledermappe und Cutters Anzug. Heutekeine Waffe. Connor war nicht krankhaft argwöhnisch –immerhin war der König von Saudi-Arabien von einem Fami-lienmitglied ermordet und Aldo Moro von seiner eigenenTochter an die Entführer verraten worden, die ihn dannumbrachten. Sorgen machten ihm nicht nur die Geistesgestör-ten; jedermann konnte eine Bedrohung für den Präsidentendarstellen. Zu seinem Glück brauchte sich Connor nur um diekörperliche Unversehrtheit seines Schutzbefohlenen zu küm-mern. Es gab noch andere Sicherheitsaspekte, die anderen,weniger professionellen Leuten oblagen.
Alles erhob sich, als der Präsident erschien, gefolgt von sei-ner Leibwächterin, einer gelenkigen Frau in den Dreißigern,deren dunkle Locken elegant über die Tatsache hinweg-täuschten, daß sie zu den besten Pistolenschützen im Dienstder Regierung gehörte. ›Daga‹ – so nannten sie ihre Kollegen –lächelte Connor zu. Ihnen stand ein leichter Tag bevor. DerPräsident wollte das Haus nicht verlassen. Sein Terminkalen-der war gründlich überprüft worden – die Sozialversiche-rungsnummern aller nicht regelmäßigen Besucher liefendurch den Fahndungscomputer des FBI –, und die Gästeselbst wurden natürlich so gründlich durchsucht, wie es derVerzicht auf eine Leibesvisitation zuläßt. Der Präsidentwinkte Admiral Cutter mit hinein. Die beiden Agenten sahensich noch einmal den Terminkalender an. Das war reine Rou-tinesache, und es störte Connor auch nicht, daß nun eine Fraueinen Männerjob tat. Daga hatte sich den Posten auf der Straßeverdient, und jeder potentielle Attentäter, der sie als Vorzim-mermaus abtat, würde sein blaues Wunder erleben. WährendCutters Aufenthalt im Chefzimmer lugte einer der beidenAgenten alle paar Minuten durch einen Spion in der weißenTür, um sich zu vergewissern, daß kein Unheil geschah. Der
9
Präsident war nun seit über drei Jahren im Amt und hatte sichan die permanente Observierung gewöhnt. DenAgenten kamkaum je der Gedanke, daß ein normaler Mensch dasbedrückend finden könnte. Es war ihre Aufgabe, über alles,was der Präsident tat, Bescheid zu wissen, und dazu gehörteauch die Häufigkeit seiner Gänge zur Toilette und die Wahlseiner Bettpartner. Ihre Vorgänger hatten alle möglichen Tech-telmechtel gedeckt und vertuscht. Selbst die Gattin des Präsi-denten hatte nicht das Recht gehabt zu erfahren, was er soStunde für Stunde am Tag trieb – zumindest einige Präsiden-ten hatten diese Anweisung gegeben –, nur die Leute vomSecret Service wußten immer Bescheid.
Hinter der geschlossenen Tür nahm der Präsident Platz.Durch die Seitentür brachte der Messesteward, ein Filipino,ein Tablett mit Kaffee und Croissants herein und standstramm, ehe er sich wieder entfernte. Damit waren die Präli-minarien der morgendlichen Routine erledigt, und Cutterbegann mit seinem Lagebericht. Die Unterlagen waren ihmvon der CIA vor Tagesanbruch in sein Haus in Fort Myer, Vir-ginia, gebracht worden; so bekam der Admiral Gelegenheit,die Informationen des Nachrichtendienstes in eigene Wortezu fassen. Sein Bericht war kurz. Es war Spätfrühling, und aufder Welt herrschte relativer Friede. Kriege, die in Afrika undanderswo wüteten, tangierten amerikanische Interessenkaum, und der Nahe Osten war so ruhig, wie er eben seinkonnte. So blieb Zeit für andere Themen.
»Was macht SHOWBOAT?« fragte der Präsident und strichButter auf sein Croissant.
»Das Unternehmen läuft, Sir. Ritters Leute sind bereits ander Arbeit, Sir«, erwiderte Cutter.
»Die Sicherheit der Operation macht mir noch immer Kum-mer.«
»Mr. President, die Angelegenheit ist so geheim, wie ange-sichts der Umstände zu erwarten ist. Gewiß, es gibt Risiken,aber wir beschränken die Zahl der Beteiligten auf das absoluteMinimum, und wer informiert ist, wurde sorgfältig ausge-wählt.«
Das trug dem Sicherheitsberater ein Grunzen ein. Der Prä-
10
sident saß in einer Falle, in die er sich mit seinen eigenen Wor-ten manövriert hatte, mit Versprechungen und Erklärungen;die Bürger hatten die unangenehme Angewohnheit, sich soetwas zu merken. Und selbst wenn sie solche Dinge vergaßen,gab es immer Journalisten und politische Rivalen, die keineGelegenheit zu einer Mahnung verstreichen ließen. Bei vie-lem hatte er in seiner Amtszeit eine glückliche Hand gehabt,aber viele dieser Erfolge mußten geheim bleiben – zu CuttersVerdruß. Andererseits war in der politischen Arena keinGeheimnis sakrosankt – am allerwenigsten in einem Wahl-jahr. Eigentlich sollte sich Cutter um diese Aspekte überhauptnicht kümmern. Als Marineoffizier wurde von ihm erwartet,daß er ein unpolitisches Auge auf die Aspekte der nationalenSicherheit warf, aber diese Richtlinie mußte wohl von einemMönch formuliert worden sein. Mitglieder der Exekutivelegen gemeinhin keine Armuts- und Keuschheitsgelübde ab,und auch mit dem Gehorsam nahmen sie es manchmal nichtso genau.
»Ich habe dem amerikanischen Volk versprochen, diesesProblem anzugehen«, bemerkte der Präsident übellaunig.»Und was ist bisher rausgekommen? Kein Furz.«
»Sir, einer Bedrohung der nationalen Sicherheit kann nichtmit polizeilichen Mitteln begegnet werden.« Cutter war seitJahren auf diesem Thema herumgeritten und hatte nun end-lich ein offenes Ohr gefunden.
Ein neues Grunzen. »Klar, hab’ ich ja auch gesagt.«»Jawohl, Mr. President. Zeit, daß die mal lernen, wie in der
Oberliga gespielt wird.«»Gut, James, Sie sind am Ball. Vergessen Sie aber nicht, daß
wir Ergebnisse brauchen.«»Die werden Sie bekommen, Sir. Darauf können Sie sich
verlassen.«»Es ist Zeit, daß diesem Gesindel eine Lektion erteilt wird«,
dachte der Präsident laut. Daß die Lektionen streng sein wür-den, stand für ihn außer Zweifel.
Eine Stunde später ging die Sonne über der Karibik auf, undanders als im klimatisierten Weißen Haus war hier die Luft
11
schwül und stickig und kündigte einen weiteren von einemzählebigen Hoch bestimmten drückendheißen Tag an. Dasbewaldete Küstengebirge im Westen ließ die Brise zu einemWispern ersterben, und der Eigner der Empire Builder warlängst bereit, in See zu stechen, wo die Luft kühler war undder Wind frei wehte.
Seine Besatzung erschien mit Verspätung. Ihr Aussehengefiel ihm nicht, aber darauf kam es nicht so an, solange siesich benahm. Immerhin war seine Familie an Bord.
»Guten Morgen, Sir. Ich heiße Ramón, und das ist Jesús«,sagte der größere der beiden.
»Meinen Sie, daß Sie mit ihr fertigwerden?« fragte der Eig-ner.
»Si. Mit großen Motorjachten sind wir erfahren.« Der Mannlächelte. Seine Zähne waren ebenmäßig und sauber. DerMann hält auf sein Äußeres, dachte der Eigner. Dann ist erwohl auch vorsichtig. »Und Jesús ist ein vorzüglicher Koch,wie Sie feststellen werden.«
Glatter Schwätzer. »Gut, die Mannschaftsunterkünfte sindim Vorschiff. Treibstoff ist an Bord, und die Maschinen sindwarm. Sehen wir zu, daß wir aus diesem Backofen rauskom-men.«
»Muy bien, Capitán.« Ramón und Jesús holten ihre Sachenaus dem Jeep und mußten einige Gänge tun, ehe alles verstautwar, aber um neun Uhr warf die Empire Builder die Leinen losund lief aus, passierte Ausflugsboote mit Yanqui-Touristenund ihren Angeln und ging auf offener See auf Nordkurs. DieReise sollte drei Tage dauern.
Ramón hatte schon das Steuer übernommen. Das bedeute-te, daß er auf einem breiten, erhöhten Sessel saß, während›George‹, der Autopilot, Kurs hielt. Es war eine glatte Fahrt.Die Rhodes-Jacht war mit Stabilisatoren ausgerüstet, und eineEnttäuschung stellte eigentlich nur die Mannschaftsunter-kunft dar, die der Besitzer vernachlässigt hatte. Typisch,dachte Ramón. Ein Millionenobjekt mit Radar und allemdenkbaren Firlefanz, aber für die Freiwache der Crew, die dasGanze am Laufen hielt, gab es noch nicht einmal Fernseherund Videogerät.
12
Er rutschte auf dem Sitz nach vorne und verdrehte denHals, um in die Back zu lugen. Dort lag der Eigner undschnarchte, als hätte ihn das Auslaufen total erschöpft. Oderwar seine Frau für die Müdigkeit verantwortlich? Sie lagneben ihrem Mann bäuchlings auf einem Handtuch und hattedas Bikinioberteil geöffnet, um sich gleichmäßig den Rückenzu bräunen. Ramón lächelte. Ein Mann konnte auf mancherleiArt zu seinem Vergnügen kommen, aber es war besser, ersteinmal abzuwarten. Vorfreude ist die schönste Freude. Fern-sehton aus der Hauptkajüte hinter der Brücke; die Kinderschauten sich wohl einen Videofilm an. Mitleid mit den vierenverspürte er kein einziges Mal, aber ganz herzlos war er nicht.Jesús war in der Tat ein guter Koch. Die Henkersmahlzeit fielköstlich aus.
Es war gerade hell genug, um sich ohne das Nachtsichtgerätorientieren zu können: das Zwielicht der Morgendämme-rung, das Hubschrauberpiloten hassen, weil sich das Auge zueinem Zeitpunkt, zu dem der Boden noch im Schatten liegt, aneinen heller werdenden Himmel gewöhnen muß. SergeantChavez’ Zug saß mit Vierpunktgurten angeschnallt; jeder Sol-dat hatte die Waffe zwischen den Knien. Der HubschrauberUH-60A Blackhawk glitt hoch über einen Hügel und gingknapp hinter der Kuppe in den steilen Sturzflug.
»Noch dreißig Sekunden«, teilte der Pilot Chavez über dieBordsprechanlage mit.
Geplant war ein verdecktes Absetzmanöver, in dessen Ver-lauf die Hubschrauber scheinbar sinn- und planlos durch dieTäler donnerten, um etwaige Beobachter zu verwirren. DerBlackhawk tauchte zum Boden ab und wurde vom Pilotenabgefangen und knapp über Grund mit der Nase hochgezo-gen: das Signal für den Chief der Besatzung, die rechte Schie-betür zu öffnen; für die Soldaten das Zeichen, den Verschlußihrer Gurte zu lösen. Der Blackhawk durfte nur für einenAugenblick aufsetzen.
»Los!«Chavez stürmte als erster hinaus und warf sich drei Meter
vomAusstieg entfernt flach auf den Boden. Der Zug folgte sei-
13
nem Beispiel und erlaubte es dem Blackhawk, sofort wiederabzuheben und sich bei seinen ehemaligen Passagieren miteiner Ladung Sand ins Gesicht zu bedanken. Gleich darauferschien er am Südhang eines Berges und erweckte den Ein-druck, überhaupt keine Bodenberührung gehabt zu haben.Unten sammelte sich der Zug und schlug sich in den Wald.Seine Arbeit hatte erst begonnen. Der Sergeant gab mit Hand-bewegungen Befehle und führte im Sturmschritt an. Dies warseine letzte Mission; dann konnte er sich entspannen.
In der Waffenerprobungs- und -entwicklungsanlage ChinaFalls in Kalifornien umstand ein Team aus Ziviltechnikernund Munitionsexperten der Navy eine neue Bombe. DieWaffe hatte zwar die ungefähren Abmessungen der altenZweitausend-Pfund-Bombe, wog aber fast siebenhundertPfund weniger. Grund für die Gewichtsersparnis war dieBombenhülle, die nicht aus Stahl, sondern aus mit Kevlar ver-stärkter Zellulose bestand und nur wenige Metallteile zumAnbringen von Leitflossen oder Lenkeinrichtungen enthielt.Es ist weithin unbekannt, daß es sich bei ›Smart-Bomben‹,›intelligenten‹, zielsuchenden Waffen allgemein um schlichteEisenprojekte handelt, an die man die Lenkeinrichtungen nurangeschraubt hatte.
»Die Splitterwirkung ist hier gleich Null«, wandte ein Zivi-list ein.
»Was soll ein für Radar unsichtbarer Stealth-Bomber nüt-zen«, fragte ein anderer Techniker, »wenn der Feind von sei-ner Bewaffnung ein Radarecho erhält?«
Der erste Sprecher räusperte sich. »Was nützt uns eine Bom-be, die den Gegner nicht mehr als vergrätzt?«
»Schmeißen wir sie ihm durch die Haustür, dann bekommter erst gar keine Gelegenheit, vergrätzt zu sein.«
Erneutes Räuspern. Nun wußte er wenigstens, wofür dieBombe gedacht war. Eines Tages sollte sie unter den Tragflä-chen eines neuen, für den Einsatz von Trägern konzipiertenJagdbombers mit der unsichtbar machenden Stealth-Techno-logie hängen. Endlich hat die Navy dieses Programm in Ganggebracht, dachte er. War auch Zeit. Im Augenblick aber stand
14
das Problem an, wie sich diese neue Bombe mit anderemGewicht und anderem Schwerpunkt mit einer Stan-dard-Lenkeinrichtung ins Ziel steuern ließ. Ein Kran hob dasstromlinienförmige Projektil von der Palette und manövriertees unter die mittlere Aufhängung eines ErdkampfflugzeugsA-6E Intruder.
Die Ingenieure und Offiziere gingen hinüber zu dem Hub-schrauber, der sie zum Testgelände bringen sollte. Das Zielwar ein Fünftonner, der, wenn alles nach Plan verlief, eingewalttätiges und spektakuläres Ende finden sollte.
»Maschine im Anflug. Musik machen.«»Roger«, erwiderte der Zivilist und aktivierte die Lenkein-
richtung.»Maschine meldet Zielauffassung – Achtung|. . .« sagte der
Kommunikator.Am anderen Ende des Bunkers schaute ein Offizier durch
eine auf den anfliegenden Intruder gerichtete TV-Kamera.»Bombe frei. Ein glatter sauberer Abwurf. Flossen bewegensich. Gleich knallt’s|. . .«
Auf dem Lkw war eine Zeitlupenkamera montiert, die diefallende Bombe aufnahm. Kaum hatte der Donner der Deto-nation den Bunker erreicht, da ließ der Operator auch schondas Videoband zurücklaufen. Das Abspielen erfolgte mit Ein-zelbildfunktion.
»So, da hätten wir die Bombe.« Zwölf Meter über demLaster wurde die konische Spitze sichtbar. »Wie wurde gezün-det?«
»System VT«, antwortete ein Offizier. VT stand für VariableTime. Die Bombe hatte einen miniaturisierten Radarsenderund -empfänger in der Spitze und war so eingestellt, daß sie ineiner bestimmten Entfernung vom Boden detonierte. In die-sem Fall betrug die Distanz 150 m. »Winkel sieht gut aus.«
»Ich habe gewußt, daß das klappt«, sagte leise ein Inge-nieur. Er hatte die Auffassung vertreten, die Bombe sei zwarals Tausendpfünder ausgelegt, ließe sich aber auf das redu-zierte Gewicht umprogrammieren. Obwohl sie etwas mehrwog, führte die geringere Dichte der Zellulosehülle zu ähnli-chem ballistischen Verhalten. »Detonation.«
15
Der Fernsehschirm wurde weiß, dann gelb, dann rot undschließlich schwarz: Die expandierenden Explosionsgasekühlten sich ab. Den Gasen voraus lief eine Druckwelle:extrem komprimierte Luft, dichter als Stahl, schneller als jedesGeschoß. Keine hydraulische Presse war in der Lage, größe-ren Druck auszuüben. Der Gesamteffekt unterschied sichkaum von der Detonation eines mit Sprengstoff vollgepack-ten Fahrzeugs, der Lieblingswaffe von Terroristen. Nur sehrviel sicherer und eleganter ins Ziel zu bringen. »Donnerwet-ter, so einfach hatte ich mir das nicht vorgestellt. Sie hattenrecht, Ernie – es muß noch nicht einmal der Suchkopf umpro-grammiert werden«, bemerkte ein Commander der Navy. Dahaben wir der Marine gerade eine gute Million gespart, fügteer insgeheim hinzu. Das war ein Irrtum.
16
I
Der Engel der Schiffbrüchigen
Man kann keinen Blick auf sie werfen, ohne Stolz zu empfin-den, sagte sich Red Wegener. Der Küstenwachkutter Panachewar ein Unikat, eine Art Fehlentwicklung, aber er gehörteihm. Er war schneeweiß wie ein Eisberg, abgesehen voneinem orangenen Streifen am Vorsteven, der ihn als Schiff derUS-Küstenwache kennzeichnete. Mit fünfundachtzig MeterLänge war die Panache kein großes Schiff, aber das größte, daser je befehligt hatte, und mit Sicherheit sein letztes. Wegenerwar der älteste Lieutenant-Commander der Küstenwache,aber auch der Engel der Schiffbrüchigen.
Begonnen hatte er seine Karriere wie so viele andere bei derKüstenwache.
Wegener, auf einer Weizenfarm in Kansas aufgewachsen,hatte als junger Mann beschlossen, daß ihm ein Leben amSteuer von Traktoren und Mähdreschern nicht lag, und sichgleich nach dem Schulabschluß bei der Küstenwache gemel-det. Man nahm ihn, ohne sich groß um ihn gerissen zu haben,und eine Woche später saß er im Bus nach Cape May in NewJersey. Noch immer konnte er sich an den Spruch erinnern,den ihm der Obermaat am ersten Tag eingebleut hatte: »Raus-fahren müssen Sie, das steht fest. Ob Sie zurückkommen, istnicht so sicher.«
In Cape May fand Wegener die letzte und beste echte See-mannsschule im Westen. Er lernte mit Leinen umzugehenund Seemannsknoten zu schlingen, Feuer zu löschen, ver-letzte oder in Panik geratene Schiffbrüchige aus dem Wasserzu holen. Nach erfolgreichem Abschluß kam er an die Pazifik-
17
küste und wurde binnen eines Jahres Bootsmannsmaat dritterKlasse.
Es stellte sich schon sehr früh heraus, daß Wegener dergeborene Seemann war. Unter den Fittichen eines bärbeißigenalten Steuermannsmaats erhielt er bald das Kommando auf›seinem‹ Schiff, einem zehn Meter langen Hafenpatrouillen-boot. Wenn ein kniffliger Einsatz bevorstand, fuhr der alteSeebär mit hinaus, um dem neunzehnjährigen Maat auf dieFinger zu sehen. Und vonAnfang an war Wegener ein Schülergewesen, dem man etwas nur einmal zu sagen brauchte. Seineersten fünf Jahre in Uniform schienen ihm wie im Flug ver-gangen zu sein: Nichts Dramatisches war geschehen; er hattenur Aufträge erledigt, vorschriftsmäßig und flott. Als derZeitpunkt der Weiterverpflichtung kam und er sich für sieentschieden hatte, stand ohnehin fest, daß man stets ihn ganzoben auf die Liste setzte, wenn ein harter Job zu erledigen war.Zum Ende seiner zweiten Dienstperiode hin holten Offizieregewohnheitsmäßig seinen Rat ein. Er war inzwischen dreißig,einer der jüngsten Oberbootsmannsmaate überhaupt undnicht ohne Einfluß, denn er erhielt das Kommando auf derInvincible, einem fünfzehn Meter langen Rettungskreuzer, derin dem Ruf stand, zäh und zuverlässig zu sein. Zu Hause warsie an der stürmischen Küste von Kalifornien, und hiermachte sich Wegener zum ersten Mal einen Namen. Wenn einFischer oder Segler in Seenot geriet, schien die Invincibleimmer zur Stelle zu sein, kam über oftmals zehn Meter hoheBrecher getobt, und am Steuer stand ein rothaariger Seebär,der eine kalte Bruyerepfeife zwischen den Zähnen hatte. Imersten Jahr rettete er fünfzehn Menschen das Leben.
Und am Ende seiner Dienstzeit auf der einsamen Stationwaren es über fünfzig. Nach zwei Jahren bekam er seineeigene Station an der Mündung des Columbia River mit ihrerberüchtigten Barre, und dort nahm seine Karriere währendeines heftigen Wintersturms eine entscheidende Wendung.Die Mary-Kat, ein Tiefseefischer, funkte SOS: Maschinen aus-gefallen, Ruder gebrochen, das Schiff driftete auf eine mörde-rische Leeküste zu. Sein Flaggschiff, die fünfundzwanzigMeter lange Point Gabriel, legte binnen neunzig Sekunden ab
18
und begann eine epische Schlacht mit den Elementen. Nachsechsstündigem Kampf gelang es Wegener, die sechsköpfigeBesatzung der Mary-Kat zu retten. Gerade als der letzte Manngeborgen war, hatte die Mary-Kat Grundberührung bekom-men und war auseinandergebrochen.
Und wie das Glück so spielte, hatte Wegener an diesem Tageinen Reporter an Bord, der für den Portland Oregonian Storiesschrieb und selbst ein erfahrener Segler war. Als der Kuttersich durch die turmhohen Brecher vor der Columbia-Barrebohrte, hatte der Reporter auf sein Notizbuch gekotzt, es anseinem Anzug abgewischt und fieberhaft weitergeschrieben.Die in der Folge publizierte Artikelserie ›Der Engel der Barre‹trug dem Autor den Pulitzer-Preis ein.
Im Monat darauf fragte sich in Washington der Senator ausdem Staat Oregon laut, warum ein so tüchtiger Mann wie RedWegener eigentlich kein Offizier sei, und da gerade der Kom-mandant der Küstenwache zugegen war, um die Bewilligungseines Budgets zu diskutieren, war dies eine Bemerkung, dieder Vier-Sterne-Admiral sich zu beherzigen vornahm. AmEnde der Woche war Red Wegener Lieutenant. Drei Jahre spä-ter wurde er für das nächste verfügbare Kommando aufeinem Schiff vorgeschlagen.
Hier stellte sich dem Kommandanten allerdings ein Pro-blem: Es war nämlich kein Schiff verfügbar. Zur Hand warzwar die Panache, aber die war ein recht zweifelhafter Preis.Der Kutter, Prototyp einer wegen Geldmangel gestrichenenKlasse, lag fast vollendet auf einer in Konkurs gegangenenWerft. Da Wegener aber als Mann galt, der Wunder wirkenkonnte, bekam er den Job und dazu ein paar erfahrene Chiefs,die den grünen Offizieren auf die Sprünge helfen sollten.
Als Wegener am Werfttor eintraf, wurde er erst einmal vonStreikposten aufgehalten, und nachdem er dieses Hindernisüberwunden hatte, war er überzeugt, daß es kaum nochschlimmer kommen konnte – bis sein Blick auf das fiel, wasangeblich sein Schiff sein sollte. Ein Objekt aus Stahl, spitz aneinem Ende, stumpf am anderen, nur halb gestrichen, garniertmit Trossen und Seilen, an Deck Türme von Kisten: Es sah auswie ein Patient, der auf dem Operationstisch gestorben und
19
einfach der Verwesung überlassen worden war. Und das warnoch nicht das ärgste, denn die Panache konnte noch nicht ein-mal von ihrem Liegeplatz weggeschleppt werden; als letzteHandlung vor dem Streik hatte ein Arbeiter den Motor einesKrans durchbrennen lassen, der nun den Weg blockierte.
Der bisherige Kapitän hatte sich bereits in Schimpf undSchande entfernt. Die Mannschaft stand zu Wegeners Emp-fang auf dem Hubschrauberdeck versammelt und wirkte wieein Haufen Kinder auf der Beerdigung eines ungeliebtenOnkels.Als Wegener zu ihr sprechen wollte, funktionierte dasMikrophon nicht, und das brach irgendwie den Bann. Erlachte in sich hinein und winkte die Männer zu sich.
»Leute«, sagte er, »ich heiße Red Wegener. In sechs Monatensind wir das beste Schiff der Küstenwache. In sechs Monatenseid ihr die beste Crew. Aber ich bin nicht derjenige, der daszuwege bringt – das müßt ihr tun, und ich will euch ein biß-chen dabei helfen. Als erstes will ich dafür sorgen, daß allesoviel Landurlaub wie möglich bekommen, während ich ver-suche, diesen Schlamassel in den Griff zu kriegen. Amüsierteuch gut. Wenn ihr zurück seid, wird in die Hände gespuckt.Abtreten.«
Erstauntes Raunen unter der Mannschaft, die mit Gebrüllund Getobe gerechnet hatte. Die neuen Chiefs wechselten miterhobenen Brauen Blicke, und die jungen Offiziere, die ihreKarriere bereits aufgegeben hatten, zogen sich verdutzt in dieMesse zurück. Ehe er sich ihnen vorstellte, nahm Wegenerseine drei Chiefs beiseite.
»Erst mal die Maschine«, sagte Wegener.»Ich kann Ihnen fünfzig Prozent Dauerleistung bieten, aber
wenn wir die Turbolader zuschalten, ist fünfzehn Minutenspäter Sense«, verkündete Chief Owens. »Fragen Sie michnicht, warum.« Mark Owens arbeitete seit sechzehn Jahren anSchiffsdieseln.
»Schaffen wir es bis zur Curtis Bay?«»Sicher, wenn es Sie nicht stört, daß es einen Tag länger dau-
ert, Captain.«Wegener ließ seine erste Bombe los. »Gut – wir laufen näm-
lich in zwei Wochen aus und machen sie dort oben klar.«
20
»Mit dem Ersatzmotor für den Kran ist aber erst in einemMonat zu rechnen«, gab Oberbootsmannsmaat Bob Riley zubedenken.
»Läßt sich der Kran drehen?«»Der Motor ist durchgebrannt, Käpt’n.«»Wenn wir soweit sind, befestigen wir eine Trosse am Kran-
ausleger, machen sie am Bug fest und ziehen ihn so aus demWeg. Dann laufen wir rückwärts aus«, verkündete der Kapi-tän. Die Männer machten schmale Augen.
»Dabei kann er kaputtgehen«, meinte Riley nach kurzemÜberlegen.
»Es ist nicht mein Kran. Aber das hier ist mein Schiff, ver-dammt noch mal.«
Riley lachte auf. »Gut, Sie wiederzusehen, Red – ‘tschuldi-gung, Captain Wegener!«
»Auftrag Nummer eins ist, sie zur Fertigstellung nach Balti-more zu schaffen. Sehen wir mal zu, was dafür zu tun ist, underledigen wir eine Arbeit nach der anderen. Wir sehen unsmorgen um sieben. Kochen Sie immer noch Kaffee, Porta-gee?«
»Aber klar, Sir«, erwiderte Obersteuermannsmaat Oreza.»Ich bring ‘ne Kanne mit.«
Zwölf Tage später war die Panache seeklar gewesen. DenKran schafften sie vor Tagesanbruch aus dem Weg, damit nie-mand etwas merkte, und als am Morgen die Streikpostenerschienen, begriffen sie erst nach einigen Minuten, daß dasSchiff nicht mehr da war. Unmöglich, sagten sich alle – es warja noch nicht mal fertig gestrichen.
Die Farbe kam in der Florida-Straße dran, und es wurdeauch noch etwas wesentlich Wichtigeres geregelt. Wegenerwurde von Chief Owens in den Maschinenraum gerufen, woein angehender Maschinist, flankiert vom Ingenieur, überBauplänen brütete.
»Sie werden es nicht glauben, Sir«, erklärte Owens. »Sag’sdem Skipper, Sonny.«
»Matrose Obrecki, Sir. Die Maschine ist falsch installiert«,sagte der.
»Wie kommen Sie darauf?« fragte Wegener.
21
»Sir, diese Maschine ist eigentlich kaum anders als die inunserem Traktor daheim, und an der habe ich oftgeschraubt|. . .«
»Ich glaub’s Ihnen, Obrecki. Weiter.«»Das Turbogebläse ist falsch montiert. Es stimmt zwar mit
dem Plan hier überein, aber die Ölpumpe drückt das Öl ver-kehrt herum durch den Lader. Der Plan stimmt nicht, Sir. Dahat ein Zeichner Mist gebaut. Eigentlich soll die Ölleitung hierangeschlossen sein, aber der Zeichner hat sie auf die andereSeite des Fittings hier verlegt, und das hat anscheinend nie-mand gemerkt, und|. . .«
Wegener konnte nur lachen. Er schaute Chief Owens an.»Bis wann können Sie das zurechtbiegen?«
»Bis morgen, meint Obrecki.«»Sir«, ließ sich Lieutenant Michelson, der Ingenieur, ver-
nehmen. »Das ist meine Schuld. Ich hätte|. . .« Der Lieutenantschien zu erwarten, daß ihm der Himmel auf den Kopf fiel.
»Die Lektion ist, Mr. Michelson, daß man noch nicht einmalder Bedienungsanleitung trauen darf. Kapiert?«
»Jawohl, Sir.«»Recht so, Obrecki. Sie sind Matrose Erster Klasse, nicht
wahr?«»Jawohl, Sir.«»Falsch. Sie sind jetzt Maschinenmaat Dritter.«»Sir, da müßte ich aber erst eine schriftliche Prüfung able-
gen|. . .«»Hat Obrecki Ihrer Meinung nach die Prüfung bestanden,
Mr. Michelson?«»Und ob, Sir.«»Gut gemacht, Leute. Morgen um diese Zeit will ich drei-
undzwanzig Knoten laufen.«Und von da an war alles wie am Schnürchen gegangen. Die
Maschinen sind das Herz eines Schiffes, und kein Seemannauf der ganzen Welt zieht ein langsames Schiff einem schnel-len Schiff vor. Als die Panache fünfundzwanzig Knotengeschafft und diese Fahrt drei Stunden lang gehalten hatte,pinselten die Seeleute sorgfältiger, die Köche bereiteten dieMahlzeiten liebevoller zu, und die Techniker zogen die Bolzen
22
ein bißchen fester an. Ihr Schiff war kein Krüppel mehr, undbei der Crew strahlte der Stolz auf wie ein Regenbogen nacheinem Sommerregen – immerhin hatte einer der ihren denFehler gefunden. Früher als geplant kam die Panache imTriumph in die Küstenwachtwerft Curtis Bay gerauscht.
Sieben Wochen später wurde der Kutter in Dienst gestelltund wandte sich nach Mobile,Alabama, im Süden. Schon jetztgenoß er einen besonderen Ruf.
Drogen. Über Drogen machte sich Wegener nicht allzu vieleGedanken. Drogen waren für ihn Pharmazeutika; etwas, dasman vom Arzt verschrieben bekam und nach Anweisungnahm, bis der Behälter leer war; dann warf man ihn weg.Wenn Wegener seinen Bewußtseinszustand verändern woll-te, tat er das auf die traditionelle Seemannsart mit Bier oderSchnaps – wenngleich nun, da er auf die Fünfzig zuging,weniger häufig. Vor Spritzen hatte er sich schon immergefürchtet – jeder Mensch hat seine geheimen Ängste –, unddie Vorstellung, daß man sich freiwillig eine Nadel in denArmstechen könnte, hatte er schon immer seltsam gefunden. Undweißes Pulver zu schniefen –, also da kam er überhaupt nichtmehr mit. Seine Haltung reflektierte weniger Naivität als dieWerte, mit denen er aufgewachsen war. Doch er wußte, daßdas Problem existierte. Wie alle anderen in Uniform hatte eralle paar Monate eine Urinprobe abzuliefern, um zu bewei-sen, daß er keine ›kontrollierten Substanzen‹ nahm. Was diejüngeren Besatzungsmitglieder als selbstverständlich hin-nahmen, empfanden Leute seiner Altersgruppe als lästigeBeleidigung.
Unmittelbar gingen ihn jene Leute an, die Drogen schmug-gelten. Und die höchste Priorität hatte nun ein Leuchtfleck aufseinem Radarschirm.
Der Morgen war neblig, was dem Captain recht war, auchwenn ihm der ganze Auftrag nicht paßte. Aus dem Engel derSchiffbrüchigen war nämlich mittlerweile ein Polizist gewor-den. Inzwischen hatte sich die Küstenwache nicht nur mitden alten Feinden Wind und Wellen, sondern auch zuneh-
23
UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE
Tom Clancy
Der SchattenkriegRoman
Taschenbuch, Broschur, 720 Seiten, 12,5 x 18,7 cmISBN: 978-3-453-19901-9
Heyne
Erscheinungstermin: November 2001
Als kolumbianische Drogenbosse drei hochrangige US-Amerikaner töten, ist für denGeheimdienstmann Jack Ryan der Punkt erreicht, an dem er zurückschlagen muss. Er stellteine Truppe kampferprobter Männer zusammen und führt sie in einen Schattenkrieg, in dem dieüblichen Regeln nicht gelten.