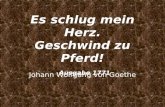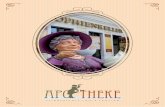Universität Leipzig Philologische Fakultät Institut für...
Transcript of Universität Leipzig Philologische Fakultät Institut für...

03.12.08
Universität LeipzigPhilologische FakultätPhilologische FakultätInstitut für GermanistikSeminarleiter: Prof. Dr. D. Burdorf
Referentin: Ines Köpp

]É{tÇÇ jÉÄyztÇz ZÉxà{x]É{tÇÇ jÉÄyztÇz ZÉxà{x]É{tÇÇ jÉÄyztÇz ZÉxà{x]É{tÇÇ jÉÄyztÇz ZÉxà{x
mâÅ mâÅ mâÅ mâÅ fv{ù~xáÑxtÜáfv{ù~xáÑxtÜáfv{ù~xáÑxtÜáfv{ù~xáÑxtÜá gtzgtzgtzgtz
DJJDDJJDDJJDDJJD

Gliederung
1. Hintergründe der Entstehung1. Hintergründe der Entstehung
2. Darstellung zur Rede
3. Shakespeares Wirkung auf Goethe
4. Literatur - und Bildnachweise4. Literatur - und Bildnachweise
Handschrift

1. Hintergründe der Entstehung vor 1771
• 1766 in Leipzig lernte GoetheShakespeare durch William Dodds TheBeauties of Shakespeare (1752) kennenBeauties of Shakespeare (1752) kennen
• 1767/68 Beschäftigung mit WielandsShakespeare-Übersetzungen (1762-1764)
• 1770/1771 fruchtbarsten Anstoß fürAuseinandersetzung mit ShakespeareAuseinandersetzung mit Shakespearedurch Johann Gottfried Herder inStraßburg
(Schröter, Riege 1983, S. 222)

1. Hintergründe der Entstehung um 1771
• junge Goethe
• kurze Prosaschrift• kurze Prosaschrift
• verfasst zum 14.10.1771
• Namenstag Wilhelms
• als Rede in Straßburg geplantBild 3: Gemälde von Georg Melchior Kraus, 1775
• als Rede in Straßburg geplant
• aber erst im väterlichen Hause in Frankfurt gehalten
(Jeßing, Lutz, Wild 1999, S. 562)

1. Hintergründe der Entstehung um 1771• vor Freunden• erste bedeutende Äußerung Goethes zu
ShakespeareShakespeare• angeregt durch das Shakespeare-Fest von
1768 in Stratford, bei dem David Garrickberühmte Rede gehalten und wichtigeEinsichten zur europäischen Shakespeare-Rezeption zu ewigen Werten erhobenRezeption zu ewigen Werten erhobenhatte:Natur, Leidenschaft und Wahrheit
(vgl. Witte et al. 1998, Bd. 4/2, S. 983)

1. Hintergründe der Entstehung um 1771• Diese Empfindungen, vor allem aber die
Einsichten über Dichtung allgemein, sind indiesem Hymnus auf das schöpferische Genieunschwerzu erkennen. 1unschwerzu erkennen. 1
• [Die Rede] war ein Hymnus auf den Genius,der von den » Fesseln« der drei Einheiten desOrts, der Zeit und der Handlung befreit hatte,die das Drama bisher »krümmten« und dessenMenschen,nicht länger eingeschnürtin GutundBösenichtsalsNaturwaren.Menschen,nicht länger eingeschnürtin GutundBösenichtsalsNaturwaren.
• Die Rede klang wie ein Programm für daskünftige eigene Drama, ja für die Dramatik derganzen jungen Sturm- und-Drang-Generation.2
1 (Witte et al. 1998, Bd. 4/2, S. 983)2 (Killy 1989, Bd. 4, S. 229)

1. Hintergründe der Entstehung nach 1771
• Goethe nahm die Ansprache nicht in seineWerke auf.
• Auch in „Dichtung und Wahrheit“ erwähnt• Auch in „Dichtung und Wahrheit“ erwähntGoethe sie nicht.
• Aber in Familie Friedrich Jacobi, dem derDichter wohl eine eigenhändige Abschriftübermittelt hatte, war dieser Text erhaltenübermittelt hatte, war dieser Text erhaltengeblieben.
• Der Text wurde1854das erste Mal gedruckt.
(vgl. Beutler 1958, Bd. 4, S. 1006)

2. Darstellung zur Rede – M. Luserke„Ich! Der ich mir alles binn, da ich alles nurdurch mich kenne!“ (Blinn 1982, S. 99)
• Goethe setzt gleich damit eine Individuali-• Goethe setzt gleich damit eine Individuali-tätsmarke.
• Es geht zwar oberflächlich um Shakespeare[…], in der Tiefe des Textes aber ausschließlichum Goethe selbst.
• Nicht ohneGrundhatmandiesenAufsatzauch• Nicht ohneGrundhatmandiesenAufsatzauchals ein Sendschreiben an die (noch interne)literarische Öffentlichkeit oder auch als Pro-grammschrift des Sturm und Drang gelesen.
(Luserke 1999, S. 68)

2. Darstellung zur Rede – M. Luserke• Er dient vornehmlich der Selbstverge-
wisserung, das macht schon der Bildbereichdeutlich, den Goethe rednerisch geschicktdeutlich, den Goethe rednerisch geschicktausschöpft.
• Große Schritte, unendlicher Weg, stärksterWanderstab, Siebenmeilenstiefel, Schritte,Tagesreise, emsiger Wanderer, gigantischeSchritte, Fußstapfen, Schritte, abmessen,Schritte, Fußstapfen, Schritte, abmessen,Reise, Tapf, größter Wanderer – das sindinnerhalb von [zehn] Zeilen die verwendetenMetaphern.
(Luserke 1999, S. 68)

2. Darstellung zur Rede – M. Luserke• Shakespeare vergleicht er mit dem größten
Wanderer, dem sich zu nähern das Ziel derReise sei.
• [Im] Shakespeare-Aufsatz, wird Natur nicht• [Im] Shakespeare-Aufsatz, wird Natur nichtbesungen, also literarisiert, sondernprogrammatisch gefordert.
„Und ich rufe Natur! Natur! nichts so Naturals Schäkespears Menschen.“ (Blinn 1982, S. 100)
• Shakespearewird eindeutig als Identifika-• Shakespearewird eindeutig als Identifika-tionsziel benannt.
• Die Entschlossenheit, aufzubrechen undNeues zu wagen, ist offensichtlich.
(Luserke 1999, S. 68-69)

• Die Literatur Shakespeares verschafft ihm[Goethe] das, was ihm noch mangelt, nämlichdie entschlossene und konfliktbereit nachaußengetrageneliterarischeIdentität.
2. Darstellung zur Rede – M. Luserke
außengetrageneliterarischeIdentität.„[…] alles war mir neu, unbekannt, und das un-gewohnte Licht machte mir Augenschmerzen.Nach und nach lernt ich sehen […].“(Blinn 1982, S. 99)
• [S]o beschreibt er diesen Zustand der wach-sendenästhetischenErfahrung.sendenästhetischenErfahrung.
• [Diese Textpassage] schließt sich an das bereitsverwendete Bild von Dunkelheit und Helle an.
(Luserke 1999, S. 69)

• Sie bewahrt damit dem Text den Bedeu-tungsbezug von Shakespeare als demLichtbringer, […].
• Der Dichter,alsSchöpfergotterschafftsicheine,
2. Darstellung zur Rede – M. Luserke
• Der Dichter,alsSchöpfergotterschafftsicheine,seine eigene neue Welt, auch sie entsteht, wiedie Welt des göttlichen Schöpfers, aus derFinsternis.
• Shakespeares Theater, das bedeutet also dieLiteratur Shakespeares,stellt für ihn einenLiteratur Shakespeares,stellt für ihn einen„schönen Raritäten Kasten“dar, „in dem dieGeschichte der Welt vor unseren Augen andem unsichtbaren Faden der Zeit vorbey-wallt“ (Blinn 1982, S. 100).
(Luserke 1999, S. 69-72)

• Als der geheime Punkt von ShakespearesStücken wird der Zusammenprall von Indivi-dualität als Freiheit der Selbstbestimmung(„das EigentümlicheunseresIchs“ , (Blinn 1982,
2. Darstellung zur Rede – M. Luserke
(„das EigentümlicheunseresIchs“ , (Blinn 1982,
S. 100)) und den sozialen und kulturellen Er-fordernissen bezeichnet.
• Das Bild des Raritätenkastens enthält einekomprimierte Verweissymbolik.
• Es setzteinmal die Hell-Dunkel-Metaphorik• Es setzteinmal die Hell-Dunkel-Metaphorikder ästhetischen Erfahrung fort, zum anderenerklärt es bildlich erstmals den Standpunkteiner Ästhetik der doppelten Beobachtung[…].
(Luserke 1999, S. 72)

• Die Literatur beobachtet den Beobachter, derLiteratur beobachtet.
• Am Beispiel Shakespearesheißt dies, derAutor zeigtin seinerLiteraturWeltgeschichte,
2. Darstellung zur Rede – M. Luserke
• Am Beispiel Shakespearesheißt dies, derAutor zeigtin seinerLiteraturWeltgeschichte,wir, die Leser, beobachten dieses Schauspielund wissen, es ist die literarische Darstellungvon Geschichte, es ist eine durch das MediumLiteratur vermittelte Darstellung.
• Wir beobachten,wie literarische Figuren• Wir beobachten,wie literarische FigurenGeschichte beobachten.
(Luserke 1999, S. 72-73)

• Kritisch gewendet bedeutet das, Medien sindnicht Darstellungsformen von Wirklichkeit,sondern Wahrnehmungsfilter.
• Das Beobachteteist medial vermittelt, eine
2. Darstellung zur Rede – M. Luserke
• Das Beobachteteist medial vermittelt, eine›Wirklichkeit an sich‹ gibt es nicht.
• Doch wie verträgt sich dies mit Goethes […Natur]-Programm?
• Die Natur ist nicht das Dargestellte, sonderndie Darstellung selbst, nicht das medialdie Darstellung selbst, nicht das medialBeobachtete ist Natur, sondern die Tatsache,daß ein Beobachter medial beobachtet.
(Luserke 1999, S. 73-74)

• Die Forderung nach Natur bedeutet dieForderung nach einer Ästhetik der doppeltenBeobachtung.
• Wir betrachten die Welt wie in einem
2. Darstellung zur Rede – M. Luserke
• Wir betrachten die Welt wie in einemGuckkasten und betrachten dabei uns selbst.
(Luserke 1999, S. 74)

3. Shakespeares Wirkung auf Goethe• Shakespeare war für Goethe sein Leben lang ein
Gegenstand der kreativen Anregung, derVerehrungundderkritischenAuseinandersetzungVerehrungundderkritischenAuseinandersetzung
• Weisen seine vielen Äußerungen zu Shakespearezwischen 1766 und 1832 unter sich auchWidersprüchlichkeiten und Akzentverschiebungenauf, immer blieb die Bewunderung fürauf, immer blieb die Bewunderung fürShakespeares schöpferische Kraft und überreicheFülle, für seine Welt- und Menschengestaltungungebrochen.
(Witte et al. 1998, Bd. 4/2, S. 982)

4. LiteraturnachweiseBeutler, Ernst: Johann Wolfgang Goethe. Gedenkausgabe der Werke, Briefe und
Gespräche. 28. Aug. 1949, 4 Bde. Zürich 1953.
Blinn, Hansjürgen (Hrsg.): Shakespeare-Rezeption: die Diskussion um Shakespeare in Deutschland. Berlin 1982.in Deutschland. Berlin 1982.
Jeßing, Benedikt, Bernd Lutz, Inge Wild (Hrsg.): Metzler Goethe Lexikon. Mit 150 Abbildungen. Stuttgart, Weimar 1999.
Killy, Walther (Hrsg.): Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Bd. 4. Gütersloh/München 1989.
Luserke, Matthias: Der junge Goethe. Ich weis nicht warum ich Narr soviel Luserke, Matthias: Der junge Goethe. Ich weis nicht warum ich Narr soviel schreibe. Göttingen 1999.
Schröter, Klaus, Helmut Riege: Hermes Handlexikon. Johann Wolfgang Goethe. Leben, Werk, Wirkung. Düsseldorf 1983.
Witte, Bernd (Hrsg.): Goethe-Handbuch in vier Bänden. Stuttgart, Weimar 1998.

4. BildnachweiseBild 1: Schröter, Klaus; Helmut Riege (1983). Hermes Handlexikon. Johann
Wolfgang Goethe. Leben, Werk, Wirkung. Düsseldorf: Econ. S. 222.
Bild 2: Schröter, Klaus; Helmut Riege (1983). Hermes Handlexikon. Johann Bild 2: Schröter, Klaus; Helmut Riege (1983). Hermes Handlexikon. Johann Wolfgang Goethe. Leben, Werk, Wirkung. Düsseldorf: Econ. S. 110.
Bild 3: CD-ROM: 1001 Gedichte, die jeder haben muss. Digitale Bibliothek. Directmedia Publishing GmbH. Berlin: Redaktionsschluss: 23.Oktober 2004.