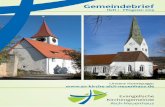Unverzagt, Schirmbeck: Angemessene Vergütung von Urhebern
-
Upload
raabe-verlag -
Category
Documents
-
view
349 -
download
0
description
Transcript of Unverzagt, Schirmbeck: Angemessene Vergütung von Urhebern

B Urheber- und Leistungsschutzrechte sowie Verwertungsgesellschaften
B1 Urheberrecht
33 Kultur & Recht Juni 2006
B1.11 S. 1
Angemessene Vergütung von Urhebern „Gemeinsame Vergütungsregeln“ und erste Gerichtsentscheidungen nach der Reform des Urheberrechtsgesetzes per 01.07.2002
Alexander Unverzagt Rechtsanwalt und Gründungs-Partner der Kanzlei Unverzagt von Have, Ham-burg/Berlin/Köln mit dem Schwerpunkt "Medien- und Kulturrecht"; Lehrbeauf-tragter für den Bereich "Urheber- und Verlagsrecht" u. a. an der Universität Ham-burg (Rechtswissenschaften); Herausgeber und Autor von zahlreichen Werken zu dem Schwerpunktthema. E-Mail:[email protected]; Internet: www.unverzagtvonhave.com Moritz Schirmbeck Jurist
Inhalt Seite
1. Die erste gemeinsame Vergütungsregel! 2 2. „Erste Urteile zur angemessenen Vergütung“ 3 2.1 Angemessenheit der vereinbarten Vergütung 3 2.2 Erforderlichkeit einer Umsatzbeteiligung 4 2.3 Buy-Out und Pauschalvergütung 4 2.4 Ermessen der Gerichte 5 2.5 Lebensstandard und Vergütungspraxis anderer Branchen kein
Maßstab 5 2.6 Tarife anderer Werkarten als Vergleichsmaßstab 5 2.7 Beteiligung an Nebenrechten 6 2.8 Die Entscheidungen im Einzelnen 7 2.9 Konsequenzen für die Praxis und Vertragsgestaltung 8 2.10 Übertragbarkeit auf andere Werkarten 8 2.11 Zusammenfassung 9 In den fast 4 Jahren seit den gesetzlichen Veränderungen im Jahre 2002 (siehe Beitrag B 1.8) ist rechtlich zwar einiges zu diesem Thema geschehen, kaum je-doch etwas, was der Praxis eine große Rechtssicherheit gewährt. Im folgenden Beitrag wird die erste gemeinsame Vergütungsregel zwischen dem Verband deut-scher Schriftsteller und einigen deutschen Verlagen sowie Urteile zur angemesse-nen Vergütung erläutert und ihre Auswirkung auf die Praxis dargestellt.

B Urheber- und Leistungsschutzrechte sowie Verwertungsgesellschaften
B1 Urheberrecht
33 Kultur & Recht Juni 2006
B 1.11 S. 2
1. Die erste gemeinsame Vergütungsregel!
Nach langen und zähen Verhandlungen haben der Verband deutscher Schriftstel-ler (VDS) und einige deutsche Verlage (Berlin Verlag, Fischer, Hanser, Antje Kunstmann, Lübbe, Piper, Random House, Rowohlt, Seemann-Henschel) – also nicht z. B. der Börsenverein – am 09.06.2005 einen Vertrag über die seit 2002 mögliche „Gemeinsame Vergütungsregel“, in diesem Falle „für Autoren belletris-tischer Werke in deutscher Sprache“, geschlossen.1
Der wesentliche Inhalt der Regelung betrifft die Umsatzbeteiligung des Autors
- in Höhe von 8 - 10 % des Nettoladenverkaufspreises (NLV),
- bei Taschenbüchern 5 % - 8 % des NLV, sowie
- bei der Verwertung von Nebenrechten 50 % bzw. 60 %
aus deren Erlösen. Diese erste gemeinsame Vergütungsregel gilt jedoch nur zwi-schen den unterzeichnenden Verlagen und den mit ihnen kooperierenden Autoren. Aus dieser Vereinbarung lässt sich aber auch schließen, dass die Umsatzbeteiligung bei Autoren höher ausfällt als bei Übersetzern, da erstere originäre Urheber sind, während Übersetzern lediglich ein abgeleitetes Bearbeitungsurheberrecht zusteht.
Andere gemeinsame Vergütungsregeln wurden bei Drucklegung dieses Beitrages noch nicht vereinbart.
Auch wenn die Autoren im Vergleich zu anderen Urhebern ganz eigenen Usancen und Gesetzmäßigkeiten unterliegen, werden die Überlegungen aus dieser gemein-samen Vergütungsregel wahrscheinlich Signalwirkung haben und von den Gerich-ten – soweit dies möglich ist – als Richtwert für eine angemessene Beteiligung herangezogen werden. Tendenziell wird man also davon ausgehen können, dass der Urheber regelmäßig auch am Umsatz der Verwertung beteiligt werden muss.

B Urheber- und Leistungsschutzrechte sowie Verwertungsgesellschaften
B1 Urheberrecht
33 Kultur & Recht Juni 2006
B1.11 S. 3
2. „Erste Urteile zur angemessenen Vergütung“
Nachdem zwischen Übersetzern und Verlagen eine Einigung auf gemeinsame Vergütungsregeln gemäß § 36 UrhG scheiterte, reichten einige Übersetzer mit Unterstützung der Gewerkschaften Ende 2004 Klagen in München und Berlin ein. Hierauf sind die ersten landgerichtlichen Entscheidungen zur Frage der an-gemessenen Vergütung von Übersetzern ergangen. Im Einzelnen geht es um zwei Entscheidungen des Landgerichts Berlin und fünf Entscheidungen des Landge-richts München I. Allen Entscheidungen ist gemein, dass jeweils der von Über-setzer unter Berufung auf § 32 UrhG gegen den Verlag auf eine angemessene Vergütung klagte.
Im Folgenden werden die wichtigsten Argumente der Entscheidungen dargestellt werden, um dann zu überprüfen, ob diese Argumente auch auf andere Fallgestal-tungen z. B. auf andere (Bearbeitungs-)Urheber übertragbar sind.
2.1 Angemessenheit der vereinbarten Vergütung
Den Entscheidungen ist durchgängig zu entnehmen, dass die vertraglich verein-barte Vergütung jeweils der Branchenübung entsprach, diese jedoch von den Gerichten als „nicht redlich“ im Sinne von § 32 UrhG eingestuft wurde.
Tipp: Eine vereinbarte Vergütung muss also nicht deshalb angemessen sein, weil sie den marktüblichen Vergütungen entspricht. Es reicht auch nicht aus, wenn man im Vertrag einen Hinweis anbringt, dass beide Parteien von einer Angemessenheit ausgehen. Es kann jedoch nützlich sein, bereits im Vertrag darzulegen, aufgrund welcher Umstände man eine bestimmte Höhe der Vergütung festgelegt hat (z. B. schwierige wirtschaftliche Lage, hohes Risiko der Auswertung, hohes Gesamtauf-tragsvolumen etc.). Solche Kriterien können dann später als Argumentationshil-fen herangezogen werden, falls die Angemessenheit der vereinbarten Vergütung streitig werden sollte. Das LG Berlin hat die Unredlichkeit der Übersetzervergütungen mit der Be-schlussempfehlung des Rechtsausschusses begründet, welche ausdrücklich die Vergütungspraxis der literarischen Übersetzer als Beispiel für eine unredliche Vergütungspraxis nennt. Deshalb müsse der Kläger, wenn eine branchenübliche Vergütung vereinbart wurde, auch keine weiteren, die Unredlichkeit begründen-den Umstände darlegen. Dies kann indes nur für die Branche der Übersetzer gelten, da die anderen Werkschöpfer, wie etwa die Schriftsteller oder Komponis-ten, nicht in solchen Dokumenten genannt werden. Diese müssten also in ver-gleichbaren Verfahren zunächst einmal beweisen, dass die vereinbarte Vergütung unangemessen ist.

B Urheber- und Leistungsschutzrechte sowie Verwertungsgesellschaften
B1 Urheberrecht
33 Kultur & Recht Juni 2006
B 1.11 S. 4
Auch die Münchner Entscheidungen beziehen sich zur Begründung der unredli-chen Vergütungspraxis auf die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses. Die gesetzgeberische Intention sei allerdings nicht gewesen, den Übersetzern eine Vergütung zu sichern, die einem durchschnittlichen Arbeitseinkommen eines Lektors oder Journalisten im Angestelltenverhältnis entspricht. Des weiteren wird von den Münchener Richtern angeführt, dass auch eine übliche Vergütung unred-lich sein könne, „wenn sich in der Branche bestimmte Usancen eingeschlichen haben, weil Werknutzer die schwächere Position der Urheber ausnutzen und Letztere nicht in der Lage sind, angemessene Regelungen durchzusetzen“. Ein Vorliegen eines solchen Ungleichgewichtes wurde jedoch nicht geprüft. Vielmehr wird eine unredliche Vergütungspraxis schon deshalb angenommen, weil die Branchenübung wegen Fehlens jeglicher Absatzbeteiligung einseitig die Interes-sen der Verwerter begünstige.
2.2 Erforderlichkeit einer Umsatzbeteiligung
Beide Gerichte sind im Übrigen der Auffassung, dass bei einer fortlaufenden Nutzung eines Werkes die einmalige Zahlung eines Pauschalhonorars unange-messen sei. Begründet wird dies zum einen mit der in § 32 Abs. 2 Satz 2 UrhG enthaltenen Regelung, dass im Wege einer Gesamtbetrachtung ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Art, Umfang und Dauer der Nutzung und der dafür gezahlten Vergütung bestehen muss. Zur weiteren Begründung wird § 11 Satz 2 UrhG ange-führt, wonach der Urheber tunlichst an dem wirtschaftlichen Nutzen, der aus dem Werk gezogen wird, zu beteiligen ist, und zwar bei jeder einzelnen Nutzung, folglich auch an den Nebenrechten. Anders sei dies nur in Fällen zu beurteilen, in denen dem Werk lediglich eine untergeordnete Bedeutung – wie etwa einem einzelnen Bild in einem bebilderten Lexikon – zukäme. Dieser Ausnahmetatbe-stand findet auf die Übersetzer jedoch gerade keine Anwendung, ist es doch gera-de ihre Tätigkeit, die einen wesentlichen Beitrag zum Erscheinen des Werkes im deutschen Sprachraum leistet.
2.3 Buy-Out und Pauschalvergütung
Das LG Berlin teilt nicht die Auffassung, dass die Zahlung einer pauschalen Vergütung bei gleichzeitiger vollumfänglicher Rechteübertragung grundsätzlich eine unangemessene Vergütung darstellt. Diese Art der Vergütung sei in Fällen, in denen das Werk ein wirtschaftlicher Misserfolg werde, für den Übersetzer sogar vorteilhafter, da sie den Urheber jeglichen wirtschaftlichen Risikos entbinde. Buy-Out-Verträge, in denen der Urheber dem Verwerter alle nur denkbaren Rech-te überträgt, sind folglich auch nach der Reform des Urhebervertragsrechts noch möglich. Eine ausreichende Beteiligung des Urhebers an einem späteren Erfolg des Werkes sieht das Gericht durch die Regelungen des § 32 a UrhG (sogenannte „Bestseller-Vergütung“) als gewährleistet.