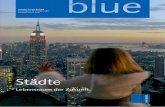Nachhaltige Gewerbegebiete – Gut für die Biodiversität, attraktiv für Unternehmen
„Was macht die Städte so attraktiv? Einsichten und ...€¦ · Univ.-Prof. Dr. Walter Siebel*...
Click here to load reader
Transcript of „Was macht die Städte so attraktiv? Einsichten und ...€¦ · Univ.-Prof. Dr. Walter Siebel*...

Univ.-Prof. Dr. Walter Siebel*
„Was macht die Städte so attraktiv?
Einsichten und Konsequenzen für eine (neue) ländliche Raum-Politik!“
Öffentlicher Vortrag im Rahmen der Mitgliederversammlung der
Bayerischen Akademie Ländlicher Raum
9. Mai 2016, München
*Arbeitsgruppe Stadtforschung am Institut für Sozialwissenschaften, Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg

Walter Siebel: Die Attraktivität der Stadt
Im Jahre 1950 lebten 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde, zwei Drittel davon auf dem Land, ein Drittel in der Stadt. Nach einer
Prognose der UN werden sich 100 Jahre später die Verhältnisse umgekehrt haben: im Jahre 2050 sollen 9,7 Milliarden
Menschen auf der Erde leben, zwei Drittel davon in der Stadt und ein Drittel auf dem Land. Europa schien lange Zeit auf dem
entgegengesetzten Weg, hier schrumpfen viele Städte. Angesichts dieser Entwicklung warnte 1971 der Deutsche Städtetag:
"Unsere Städte veröden vom Zentrum aus" und formulierte einen dramatischen Appell: "Rettet unsere Städte jetzt!“
Ab den siebziger Jahren schien sich diese Entwicklung zulasten der Städte zu dramatisieren. Der ökonomische Strukturwandel
schwächte die industrielle Basis der Städte. In der Folge wanderten die Menschen aus den alten Industrieregionen im
Ruhrgebiet, dem Saarland und in Bremen ab in die prosperierenden, süddeutschen Regionen. Und es zeigte sich noch eine
gänzlich neue Tendenz: die Wanderungen von Bevölkerung und Arbeitsplätzen zielten über die Metropolregionen hinaus auf
abgelegene Gebiete. Einige ländliche Gebiete wiesen sogar die höchsten Wachstumsraten auf. In der Folge sank in beinahe
allen OECD-Ländern das Gewicht der Agglomerationen gegenüber den Nicht-Agglomerationen. Berry (1982) hat dafür den
Begriff der "counterurbanization" geprägt. Jung (1984) und Gäbe (1987) sprechen mit Bezug auf die BRD von
"Desurbanisierung". Es zeigte sich ein doppelter Dekonzentrationsprozess: die Kernstädte verloren durch die Suburbanisierung
gegenüber dem Umland, und die Verdichtungsgebiete verloren gegenüber den ländlichen Regionen. Es schien, als sei die
jahrhundertelange Bewegung in die Städte an ein Ende gekommen, aus der Landflucht eine Stadtflucht geworden.
Aber in den neunziger Jahren änderte sich der Trend erneut. Die Kernstädte gewannen wieder Einwohner, die Zahl der
innerstädtischen Arbeitsplätze wuchs und die Steuereinnahmen stiegen. Gewerbliche Brachen wurden in Wohnungen und
Büros umgewandelt, die Städte wurden erneuert und verdichtet, und die Preise erreichten ungeahnte Höhen. Seitdem wird von
einer „Renaissance der Städte“ gesprochen. Die Ursachen dafür verweisen auf einen länger anhaltenden Trend.
Die Renaissance der Städte hängt erstens mit einem Wandel der Lebensweise zusammen: Immer mehr Menschen leben für
immer längere Zeit allein, unter anderem weil immer später geheiratet wird – wenn überhaupt. Allein Lebende aber
konzentrieren sich in den Städten. Statistisch gesehen sind 61 % aller Haushalte in den Innenstädten deutscher Großstädte
Singlehaushalte.
Der zweite Grund ist die Expansion des Bildungswesens. Die Zahl der Studenten in Deutschland hat sich seit 1965
verzehnfacht auf 2.759.000. Studenten leben dort, wo Universitäten angesiedelt sind, also vornehmlich in den Städten.
Der dritte Grund ist die Zuwanderung. Auch die Zahl der Zuwanderer ist enorm gestiegen, und fast die Hälfte von ihnen (49 %)
wohnt in den Großstädten, von den Deutschen sind es nur 31 %. Die Affinität der Zuwanderer zu den großen Städten hat gute
Gründe. Die Arbeits– und Wohnungsmärkte sind hier aufnahmefähiger und das Bildungssystem ist differenzierter, also sind
auch die Integrationschancen für Zuwanderer besser. Migranten ziehen außerdem vorwiegend dorthin, wohin ihre Landsleute
bereits gewandert sind, das Phänomen der Kettenwanderung. Auch die deutschen Auswanderer in die USA sind zunächst nach
little Germany gezogen. Und schließlich ist der Vorteil der Anonymität der Stadt für Zuwanderer nicht zu unterschätzen: In der
großen Stadt fällt der Fremde weniger auf als auf dem Dorfplatz.
Die Attraktivität der Stadt für Singles, Studenten und Migranten ist nichts Neues, sie sind schon immer in die Städte gezogen.
Neu ist nur, dass Alleinlebende, Studenten und Migranten heute zahlreicher geworden sind. Es gibt aber auch strukturelle
Veränderungen zu Gunsten der Städte.
Die Suburbanisierung, die die Stadtentwicklung in der BRD seit den fünfziger Jahren geprägt hat, wird schwächer. Das
Einfamilienhaus im Grünen gilt als ideale Wohnform für Familien. Suburbanisierung ist deshalb an die familiale Lebensweise
gebunden. Diese aber verliert absolut und relativ an Bedeutung. Absolut, weil im Zuge des demographischen Wandels die
Altersjahrgänge der 26-40 jährigen schwächer werden. Das aber ist das Alter, in dem normalerweise eine Familie gegründet
und ein Haus gekauft wird. Ferner wächst der Anteil derer, die ihr Leben lang kinderlos bleiben, einige leben längere Zeit oder
sogar lebenslang ohne einen festen Partner. Relativ sinkt die Bedeutung der Familienphase, weil die Menschen immer später
heiraten und immer später Kinder bekommen. Die sog. Postadoleszenzphase, das ist die Phase zwischen dem Auszug aus
dem elterlichen Haushalt, dem Eintritt in das Berufsleben und der Gründung einer eigenen Familie, wird immer länger. Am
anderen Ende der Biografie wird die Phase des „leeren Nests“ nach dem Auszug der Kinder aufgrund steigender Lebensdauer
ebenfalls immer länger. Der Suburbanisierung kommen die Menschen abhanden. Die soziale Basis der Suburbanisierung
erodiert.
2

Walter Siebel: Die Attraktivität der Stadt
Auch die ökonomische Basis der Suburbanisierung wird brüchig. Wanderungen an den Rand der Städte sind eng verbunden
mit dem Wunsch nach mehr Wohnfläche und nach Wohneigentum. Um Wohneigentum bilden zu können, ist nicht so sehr ein
hohes als vielmehr ein stabiles, langfristig kalkulierbares Einkommen notwendig als der Voraussetzung für die Kreditwürdigkeit
eines Haushalts. Deshalb haben Beamte die höchste Wohneigentumsquote. Aufgrund der Veränderungen auf dem
Arbeitsmarkt ist diese Bedingung für immer weniger Menschen gegeben. Außerdem sind die Subventionen, die die
Suburbanisierung gefördert haben, nämlich die Eigenheimzulage und die Entfernungspauschale, gekürzt bzw. gänzlich
gestrichen worden. All das aber bedeutet, dass immer weniger Menschen sich Wohneigentum leisten können. Es fehlt das Geld
für die Suburbanisierung.
Schließlich ist Suburbanisierung an die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau gebunden. Danach ist die Frau als
Hausfrau für Haushalt und Kinder zuständig, während der Mann als Ernährer zu geregelten Arbeitszeiten sich außerhalb der
Wohnung aufhält. Heute sind immer mehr Frauen selber berufstätig. Wenn aber in einem Haushalt zwei Erwachsene berufstätig
sind, meist noch zu individualisierten Arbeitszeiten und an verschiedenen Orten, dann wird das Leben in Suburbia, weit entfernt
von den städtischen Arbeitsmärkten, in jeder Hinsicht zu teuer: es kostet zu viel Zeit, behindert die berufliche Karriere und
erschwert die Organisation des Haushalts.
Suburbanisierung wird nicht gänzlich aufhören. Junge Familien mit kleinen Kindern werden weiterhin ins Einfamilienhaus im
Grünen ziehen, aber es werden weniger sein. Die Städte werden also weniger Bevölkerung ans Umland verlieren. Aber es gibt
auch eine neue Nachfrage nach Stadt als Ort des Arbeitens und Lebens. Die Gründe dafür hängen wiederum mit dem
ökonomischen Strukturwandel und mit Veränderungen der Lebensweise zusammen.
Mit dem Wandel zur Dienstleistungs– und Wissensgesellschaft steigt der Anteil der Arbeitsplätze, die in das kleinteilige Gefüge
der europäischen Stadt integrierbar sind. Ein Produktionsbetrieb von BMW würde die Siedlungsstruktur einer europäischen
Stadt sprengen, ein IT Arbeitsplatz oder das Büro eines Designers dagegen passen auch in ein Wohnhaus aus dem 19.
Jahrhundert. Zweitens steigt die Bedeutung von Innovationen in der postindustriellen Ökonomie. Innovationen sind abhängig
von Informationen und vom sog. tacit knowledge. Beides konzentriert sich in urbanen Milieus. Schließlich drittens bevorzugen
die kreativen Arbeitskräfte, auf die die moderne Ökonomie angewiesen ist, urbane Wohnstandorte.
Die Renaissance der europäischen Stadt hängt aber auch zusammen mit dem Wandel der Rolle der Frau. Mittlerweile erwerben
in Deutschland mehr Frauen als Männer die Berechtigung zum Studium. Hoch qualifizierte Frauen wollen ähnlich Männern ein
berufszentriertes, karriereorientiertes Leben führen. Dazu müssen sie von außerberuflichen Verpflichtungen entlastet sein. Mein
englischer Kollege Ray Pahl hat das einmal auf den schönen Nenner gebracht: a professional women needs a wife. Wenn aber
immer mehr Menschen ein berufszentriertes Leben führen, die soziale Voraussetzung, um das zu können, die traditionelle
Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, aber nicht mehr gegeben ist, dann bleiben nur zwei Auswege aus diesem Dilemma:
Einmal die radikale Reduktion aller außerberuflichen Verpflichtungen, insbesondere durch den Verzicht auf Kinder. Zum andern
das Leben in einer modernen Großstadt. Moderne Dienstleistungsstädte mit ihrer Überfülle an privat und öffentlich organisierten
Güter und Dienstleistungsangeboten gleichen riesigen Maschinen, die jedem, sofern er über Geld verfügt, all das bietet, wofür
man früher einen klassischen Haushalt, geführt von einer traditionellen Hausfrau benötigt hatte. Ohne die Dienstleistungs
maschine Stadt wäre das Leben des modernen Singles unmöglich.
Studenten, Singles und Zuwanderer haben immer schon die Stadt bevorzugt, aber sie sind heute zahlreicher als früher.
Der Trend nach Suburbia wird schwächer. Der ökonomische Strukturwandel hin zur postindustriellen Ökonomie und der Wandel
der Rolle der Frau – all das kann das aktuelle Phänomen einer Renaissance der europäischen Stadt erklären. Aber das bietet
noch keine hinreichende Erklärung für die immer schon bestehende und weltweite Anziehungskraft der Städte.
Städte entstehen, sie wachsen und sie erhalten sich durch Zuwanderung. Krieg und Hunger haben von jeher die Menschen in
die Städte getrieben. Aber das Städte überhaupt entstehen können, verdankt sich einer Steigerung des Wohlstands und nicht
der Not. Städtisches Leben wird erst dann möglich, wenn die landwirtschaftliche Bevölkerung mehr Lebensmittel produziert, als
sie selber verbraucht. Der erste Städter war der, der sich nicht täglich mit einer unzivilisierten Natur auseinandersetzen musste,
um überleben zu können. Stadtleben beginnt als ein Schritt der Befreiung aus den Zwängen der Natur.
"Ich verlange von einer Stadt, in der ich leben soll: Asphalt, Straßenspülung, Haustürschlüssel, Luftheizung,
Warmwasserleitung. Gemütlich bin ich selbst". Der Aphorismus von Karl Kraus bringt die Attraktivität der Stadt auf den Punkt:
3

Walter Siebel: Die Attraktivität der Stadt
4
Stadt macht das Leben leichter. Der Bürgersteig bewahrt den Städter davor, im Schlamm warten zu müssen, die Kanalisation
versorgt ihn mit Wasser und entsorgt seine Exkremente, ohne dass er dazu zu einem Brunnen oder einer Jauchegrube gehen
müsste. Elektrizität und Straßenlaternen machen die Nacht zum Tag, und der ÖPNV erspart einem ermüdende Fußmärsche.
Aber der Aphorismus von Karl Kraus meint mehr, als dass in der Stadt die Unabhängigkeit von Natur gelebt werden könne. Er
verweist auf das älteste Versprechen der Stadtkultur: die Befreiung von notwendigen Arbeiten. In der Stadt wird ein Leben
möglich, dass mehr beinhaltet als die Sorge um die eigene Reproduktion. Stadtbildung ist ein Schritt ins Reich der Freiheit
jenseits des Reichs der Notwendigkeit, wie Marx die Utopie einer befreiten Gesellschaft umschrieben hat.
In der griechischen Polis war eine schmale Aristokratie von Männern dieser Utopie recht nahe. Durch Frauen und Sklaven von
allen notwendigen Tätigkeiten entlastet konnten sie das Ideal der "Muße" leben, d.h. ein Leben im Dienst der öffentlichen
Angelegenheiten und der eigenen körperlichen wie geistigen Vervollkommnung. Aristoteles hat die Entlastung von notwendigen
Arbeiten sogar zur Voraussetzung für das Bürgerrecht in der Polis gemacht. Deshalb konnten nach ihm selbst Handwerker und
Kaufleute, im Mittelalter immerhin die Gründerfiguren der europäischen Stadt, in der antiken Polis keine Bürgerrechte
beanspruchen.
Heute leistet die Stadtmaschine Ähnliches für sehr viel mehr Menschen und sehr viel produktiver als die antike
Sklavengesellschaft. Man kann sich in einer Stadt wie New York nachts um zwölf ein Vier-Sterne-Menü bringen lassen,
psychotherapeutische Betreuung erhalten, gewärmte Handtücher werden auch geliefert, und die Verantwortung für die Alten,
die Kranken und die Kinder kann man an die entsprechenden sozialen Einrichtungen abgeben. Die Stadt befreit von
notwendigen Arbeiten und Verpflichtungen, so dass man sich befriedigenderen Tätigkeiten in Beruf und Freizeit zuwenden
kann. Stadt ist das Versprechen auf ein besseres Leben. Ohne dieses Versprechen gäbe es keine Stadt.
Die Stadt steht noch für ein zweites, tiefer reichendes Versprechen, das Versprechen auf eine offene Zukunft. Es hängt mit dem
zusammen, was häufig an der modernen Großstadt kritisiert wird, ihrer Anonymität. Stadt ist ein Ort, an dem Fremde leben. Auf
dem Dorf gibt es nur Nachbarn und Verwandte. Stadt beginnt dort, wo die Bewohner sich nicht mehr kennen. Deshalb sind der
großen Stadt Unübersichtlichkeit und soziale Kälte vorgehalten worden. Und Georg Simmel hat den typischen Städter wenig
sympathisch, nämlich als basiert, distanziert und gleichgültig beschrieben. In der Großstadt fehlen die dichten sozialen Netze
dörflicher Gemeinschaft, die den Einzelnen vor Vereinsamung schützen und ihn auffangen, wenn er Hilfe benötigt. Aber die
übersichtliche Gemeinschaft des Dorfes ist auch eine Instanz hochwirksamer sozialer Kontrolle. Wer hier anders sein möchte,
der hat es schwer. In der großen Stadt dagegen sind die sozialen Kontrollen lockerer. Unter dem Schutz der großstadttypischen
Anonymität und der urbanen Indifferenz des gelernten Städters kann man nach seiner Fasson leben, ohne gleich von Nachbarn
und Verwandten auf den Pfad der Konvention zurückrufen zu werden.
Deshalb verbindet sich mit dem Umzug in eine fremde Stadt häufig die Hoffnung, sein Leben noch einmal neu beginnen zu
können, eben weil einen dort niemand kennt, der einen auf die alte Identität verpflichten könnte. Und diese Hoffnung gründet
nicht nur negativ auf der Abwesenheit von Kontrollen. Die moderne Großstadt bietet eine breite Palette der unterschiedlichsten
Berufsmöglichkeiten, Konsumangebote für jedes Bedürfnis und eine Überfülle von Freizeitbeschäftigungen. Auf dieser Basis
können sich in den modernen Stadtgesellschaften die unterschiedlichsten Milieus herausbilden: die bürgerliche Hochkultur und
die aus dieser Sicht teilweise sehr befremdlichen jugendlichen Subkulturen, das ordentliche Milieu der Kleinbürger und das
unordentliche der Künstler, das Milieu der Homosexuellen und die ethnischen Kolonien der Zuwanderer, das Milieu der
Obdachlosen und das der englischsprachigen Banker et cetera.
Die Stadt ist ein Mosaik aus kulturellen Dörfern. Wer dieses Mosaik durchwandert, begegnet einem weiten Panorama von
Lebensmöglichkeiten und Lebensentwürfen. In der Stadt als Mosaik aus kulturell verschiedenen Welten muss man, wie Robert
Park geschrieben hat, nur eine Straße überqueren, um ein anderes Leben zu beginnen. Stadt ist nicht nur das Versprechen auf
ein besseres sondern auch auf ein anderes Leben. Dieses Versprechen, sich in der Stadt neu entwerfen zu können, d.h. das
Versprechen auf eine offene Zukunft, ist der zweite Grund für die ungebrochene und weltweite Attraktivität von Stadt.