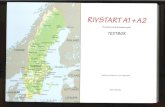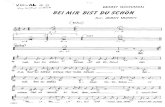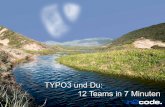Wertschwankungsreserven
description
Transcript of Wertschwankungsreserven

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 1
WertschwankungsreservenMethodik und Ausweis aus Sicht der direkten Aufsicht im BSV
Philipp RohrbachAufsicht Berufliche VorsorgeBundesamt für Sozialversicherung

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 2
Gesetzliche Grundlagen
Art. 48e BVV 2 (Art. 65b BVG) Regeln zur Bildung der WSR im Reglement Grundsatz der Stetigkeit
Art. 47 Abs. 2 BVV 2 Swiss GAAP FER 26 zwingend

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 3
Swiss GAAP FER 26
Grundsätze True and fair view Keine Positionen mit Glättungseffekt
→ WSR bildet einzige Ausnahme !
Bewertungsgrundlagen für Aktiven und Passiven sind stetig anzuwenden und offen zu legen
Marktwertprinzip

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 4
Bildung WSR für die den Vermögensanlagen zugrunde liegenden marktspezifischen Risiken
Bestimmung WSR basiert auf finanzökonomischen Überlegungen und aktuellen Gegebenheiten
Aktuelle Gegebenheiten Kapitalmarktentwicklung? Allokation der Vermögensanlagen Anlagestrategie? Struktur und Entwicklung des Vorsorgekapitals und der
technischen Rückstellungen? Angestrebtes Renditeziel Sicherheitsniveau
Ziffer 15 Swiss GAAP FER 26

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 5
Interpretation von Ziffer 15
“Finanzökonomische Überlegungen“ Was bedeutet dieser Begriff?
“Allokation der Vermögensanlagen“ Als Hinweis auf Diversifikationseffekt bzw.
Korrelationen zu verstehen? “Struktur und Entwicklung des Vorsorgekapitals“
Als Hinweis auf Integration der versicherungstechnischen Risiken zu verstehen?
“Renditeziel“ WSR als Zinsdifferenzreserve?

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 6
Bestimmung des Zielwertes Der Zielwert ist die Sollhöhe der WSR
Keine Bandbreite
In der Verantwortung des Stiftungsrates Beratung durch Experten oder Investment-Controller
Experte äussert sich im Bericht zu WSR Sowohl zum Soll- wie zum Ist-Wert (Risikofähigkeit)
Keine gesetzlichen Vorgaben bezüglich Methodik Zielwert ist kein Instrument der Bilanzpolitik

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 7
Methoden in der Praxis
Pauschalmethode
vs.
Finanzökonomische Methoden

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 8
Pauschalmethode Für jede Anlagekategorie wird ein pauschaler
Prozentsatz festgelegt(→ Grundsatz der Stetigkeit!)
Zielwert = Σ Gewicht * Satz(→ Δ Zielwert nur durch Portfolioumschichtungen)
Hauptprobleme! Korrelationen bleiben unberücksichtigt! Ungenügender Einbezug der tatsächlichen
Schwankungsbreiten (durch Schätzung oder Simulation)

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 9
Weitere problematische Punkte
Homogenität der Risikokategorien Änderung der Pauschalsätze bedarf Reglementsänderung Einbezug der “aktuellen Gegebenheiten“
? Kapitalmarktentwicklung? Allokation der Vermögensanlagen? Anlagestrategie? Struktur und Entwicklung des Vorsorgekapitals und der
technischen Rückstellungen? Angestrebtes Renditeziel? Sicherheitsniveau

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 10
Ausweis in der Jahresrechnung Pauschalsätze sind offen zu legen Allfällige Änderungen der Pauschalsätze sind
auszuweisen (Offenlegung der Auswirkung oder Restatement bezüglich Zielwert)
Aus Ziffer 19 FER 26 [Anhang] ggf. Informationen zu: Bestimmungsprozess der Pauschalsätze (Hinweise auf
Methodik bei analytischer Bestimmung) Benchmarks Fremdwährungsrisiken Gegenparteirisiken Berücksichtigung der Korrelationen Zeithorizont für die Pauschalsätze …

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 11
Fazit: Pauschalmethode
Zweckmässigkeit und Zulässigkeit der Pauschalmethode ist abhängig von der Interpretation von Ziffer 15 FER 26 (insbesondere “aktuelle Gegebenheiten“)
Aufsicht lässt Pauschalmethode zu Finanzielle Sicherheit der Einrichtung steht
im Vordergrund – Verantwortung beim Stiftungsrat

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 12
Finanzökonomische Methoden
→ VaR-basierte Methoden→ (Optionsbasierte Methoden)
Zielwert wird über einen Algorithmus bestimmt (Stetigkeit der Prozedur!) Parameter (z.B. Konfidenzniveau)
Stetigkeit!
Variablen (z.B. Volatilität einzelner Risikokategorien) Marktbedingt (Δ Zielwert nur durch Δ Variablen)

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 13
Ausweis in der Jahresrechnung
Prozedur (Formeln) Werte der Parameter Werte der Variablen→ Bestimmung des Zielwerts muss für den
“kundigen“ Leser nachvollziehbar sein→ Erfüllung des true and fair view Grundsatzes
wird durch Revisionsstelle bestätigt (Relevanz, Wesentlichkeit, Verlässlichkeit etc.)

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 14
Fazit: Finanzökonomische Methoden
Weitestgehende Wahlfreiheit bezüglich Algorithmen und Werte der Parameter
Aufsicht macht keine Zweckmässigkeitsprüfung
Verantwortung beim Stiftungsrat – analog Pauschalmethode

1. Mai 2006 BVG-Apéro, Bern 15
Ausblick aus Sicht der Aufsicht
2006: Erfahrungen sammeln (sowohl bezüglich WSR wie FER 26)
Laufende Analyse der Reglemente und Jahresrechnungen
Beurteilung von generellen Fragen bezüglich WSR (z.B. Leistungsverbesserungen bei eingeschränkter Risikofähigkeit)
→ Pragmatisches Vorgehen bei WSR!