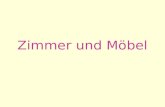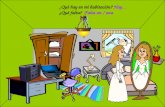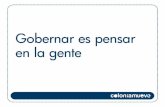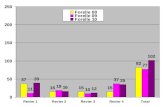Zimmer, Dieter E - Redens Arten
Transcript of Zimmer, Dieter E - Redens Arten
DIETER E. ZIMMER
Redens ArtenBER TRENDS UND TOLLHEITEN IM NEUDEUTSCHEN SPRACHGEBRAUCH
HAFFMANNS VERLAG
Dieter E. Zimmer, geboren 1934 in Berlin, seit 1959 Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit, lebt in Hamburg; bersetzte Werke von Vladimir Nabokov, James Joyce, Jorge Luis Borges, Nathanael West, Ambrose Bierce, Edward Gorey u. a. Nach vornehmlich literarischen und literaturkritischen Arbeiten zunehmend Publikationen ber Themen der Anthropologie, Biologie, Psychologie, Verhaltens- und Sprachforschung. Buchverentlichungen: Materialien zu James Joyces Dubliner (zusammen mit Klaus Reichert und Fritz Senn, 1969) Ich mchte lieber nicht, sagte Bartleby (Gedichte, 1979) Unsere erste Natur (1979) Der Mythos der Gleichheit (1980) Die Vernunft der Gefhle (1981) Herausgeber der Kurzgeschichten aus der Zeit (mehrere Folgen, zuletzt 1985). Die beiden Bnde Redens Arten (ber Trends und Tollheiten im neudeutschen Sprachgebrauch, 1986) und So kommt der Mensch zur Sprache (ber Spracherwerb, Sprachentstehung und Sprache & Denken, 1986) beschreiben den aktuellen Wissensstand der Sprachforschung.
FK Frauensteiner Kreis Unverkuflich 11.06.05
DIETER E. ZIMMER
Redens Artenber Trends und Tollheiten im neudeutschen Sprachgebrauch
HAFFMANS VERLAG
Umschlagzeichnung von Tatjana Hauptmann 1.4.Tausend, Frhjahr 1986 Alle Rechte vorbehalten Copyright 1986 by Haffmans Verlag AG Zrich isbn 3 251 000713
Inhalt
NEUDEUTSCH Trends und Triften 7 WRTER EMPOR ber die Verschnerung der Welt durch sprachliche Manahmen 61 DAS BRDERLICHE DU ber Anredekonventionen 73 DIE, DER, DAS Sprache und Sexismus 91 DER JARGON DER WAHREN EMPFINDUNG Psycho-Deutsch 115 DAS WIRD RGER MACHEN Sprache im Kulturbetrieb 159
WRTER UND FAHNEN Politik als Sprachkampf 217 WETTBEWERB DER BERSETZER Die einstweilige Unentbehrlichkeit des Humantranslators 235 DER ARGAN-EFFEKT Die Liebe zur Pseudo-Wissenschaft 285
ANHANG Nachbemerkung 307 Bibliographie 310 Register 319
NEUDEUTSCHTrends und Triften
W
enn ich das Wort Sprachkritik hre, kommt mir immer ein Bild vors Auge. Ein Mann schlummert im Lwenzahn am Bahndamm, ein Zug kommt vorbei und weckt ihn, und er springt erbost auf, schttelt die Faust, ruft ihm etwas zu, das der Lrm verschluckt, indes der Zug schon immer kleiner wird. Die Sprache schert sich wenig um die noch so tiefempfundenen Einwrfe des Sprachkritikers. Sie verndert sich in einem fort und lt sich nicht aufhalten von der Entrstung ber ihren unsteten Wandel. Denn eben darauf luft Sprachkritik meistens hinaus: da die Sprache leider nicht mehr ist, was sie einmal war. Das Sprachgehr ist konservativ. Es mag nicht, was es nicht gewhnt ist. Meist schreitet solche Sprachkritik gegen einzelne Wrter und Wendungen ein. Gegenwrtig zum Beispiel gerne gegen die Formel ich gehe davon aus, da (steife Sprachprotzerei; auen Gips, innen hohl und so weiter). Was aber ist es, das gegen sie spricht? Da sie sehr hufig geworden ist aber es gibt hufigere. Da soviel Lauferei leicht ridikl wirkt aber viele metaphorische Wendungen haben etwas Komisches; wenn man sie wrtlich nimmt, wrtlicher, als es das allgemeine Sprachempfinden tut; voraussetzen oder unterstellen sind, fat man das ihnen zugrundeliegen9
de, aber verblate Bild ins Auge, um nichts edler. So bleibt als einziger Grund: da man frher anders gesagt hat, ich nehme an, da oder ich setze voraus, da Tatschlich verbindet ich gehe davon aus, da beider Bedeutung auf eine hchst praktische Weise und kommt seinen Benutzern somit dermaen zupa, da sie sich um alle sprachkritischen Einwnde nicht scheren und dabei bleiben werden. Die nchste Generation, gro geworden mit diesem Wort, wird dann nicht mehr begreifen, was man einst an ihm auszusetzen hatte. Nur darum hat die Sprache berhaupt eine Geschichte, weil immer wieder gegen ihre Normen verstoen wird und weil die Allgemeinheit einige dieser Verste schlielich annimmt. Der Sprachversto von heute ist die potentielle Sprachnorm von morgen, das, zu dessen Verteidigung die Sprachkritiker von bermorgen ausrcken werden. Man kann sich gut vorstellen, wie um die Jahrhundertwende Eltern ihre Kleinen belehrten: Das heit nicht Keks, das heit Pltzchen. Wenn schon, dann sag das Cake und die Cakes. Mit der Antwort der Kleinen: Ja, genau, die Keks, die wollen wir. Der nmliche Dialog htte im vierzehnten Jahrhundert so gehen knnen: Gib mir die Birn. Das heit nicht die Birn, das heit die Bir. Birn ist die Mehrzahl. Gibst du mir jetzt die Birn? Studenten der Sprachgeschichte lernen die Lautverschiebungen, als habe es sich um geologische Ereignisse gehandelt, sprachliche Kontinentalverschiebungen sozusagen. Abgespielt haben sie sich wahrscheinlich so, da einige Sprecher es interessant fanden, manche Laute10
nicht mehr so auszusprechen wie ihre Vter. Sicher zu deren Entrstung beharrten sie im siebenten Jahrhundert darauf, das damalige Pendant des Satzes dat Skip fahrt up dem Water zu einem lteren Ohren sicher grausig klingenden das Schiff fhrt auf dem Wasser zu verflschen, und irgendwann war dann die ganze Gegend dieser modischen Seuche verfallen. Noch grere Enttuschungen erwarten den Kritiker, der der quasi magischen Vorstellung verhaftet ist, wenn man die Sprache bessere, bessere man auch die Wirklichkeit. Es ist eine tief sitzende Vorstellung, und in gewisser Hinsicht hngen wir ihr alle an, so wie selbst Rationalisten auf Holz klopfen, um Unglck abzuwenden. Wenn wir Wrter wie Tilgungsstreckungsdarlehen oder Verlustzuweisungsantrag nur widerstrebend herausbringen, so darum, weil sie uns unvertraut sind und weil wir die Amtsstellen nicht leiden knnen, auf denen vertraut mit ihnen umgegangen wird; und weil uns mifllt, da es das, was sie meinen, allen Ernstes geben soll. Und irgendwie machen wir uns dabei die Hoffnung, da auch die Sachen weniger unleidlich wren, wenn es nur geflligere Wrter fr sie gbe. Es ist natrlich eine Illusion. Eine Verschnerung der Sprache verschnert nicht die Welt, sondern nur die Sprache. Eine schnende Sprache kann das Widerwrtige sogar nur noch widerwrtiger machen. Darum wirkt so viele Sprachkritik auf sublime Weise lcherlich: weil sie Neues bekmpft, nur weil es nicht das Alte ist; weil sie hofft, die Welt zu verbessern, wenn sie ein Wort austreibt. Was die Sprachkritik bestenfalls erreichen kann,11
ist sehr viel weniger, und sie mu dafr sehr viel mehr tun. Sie kann sich nicht damit begngen, im Namen einer vergangenen Norm an irgendwelchen Wrtern und Wendungen herumzunrgeln. Sie mu das Bewutsein dafr zu schrfen suchen, welchen Gedanken treffenden oder abwegigen eine bestimmte Sprache Vorschub leistet und welche sie auf der anderen Seite diffamiert; welche Denkweisen Konjunktur haben, wenn bestimmte Sprechweisen aufkommen; was die Sprache verrt und was sie verbirgt und was sie verdreht und was sie verflscht; wo sie Illusionen und Vorurteile verfestigt. Das heit, eine Sprachkritik, die nur Kritik an der Sprache ist, kommt nicht weit. Sie bleibt so stumpf wie die Kritik an einer Sge, die nicht in Betracht zieht, wozu Sgen dienen. Sprache ist nicht an sich gut oder ungut, schn oder hlich; sie wird es nur, wenn man sie an dem mit, was sie ber die Wirklichkeit explizit zu denken oder zu sagen erlaubt oder verhindert. Die Sprache ist in langsamer, aber unablssiger Bewegung. Da Zitty ein Szeneblatt im Spontisinn nicht sei, htte ein Leser vor zwlf Jahren Wort fr Wort unverstndlich gefunden. Das Inserat Habe tierischen Bock irre Typen kennenzulernen wre vor fnfzehn Jahren bei niemandem angekommen. Der Satz Das ist so eine Sache da gehe ich davon aus da einer irgendwie schon selbst herausfinden mu was da so luft und wie er da klar mit kommt nicht, der einen Grammatiker, welcher alle seine Elemente zu bestimmen htte, zur Verzweiflung brchte und doch kein einziges neues Wort und12
auch keine neue syntaktische Regel enthlt, wre vor zwanzig Jahren so weder gesagt noch verstanden worden. Welcher Art sind die Vernderungen, die die deutsche Sprache heute durchmacht? Die auff lligsten und raschesten ereignen sich im Wortschatz. Die Grammatik ist sehr viel schwerer beweglich. Die Lautstruktur scheint nahezu unvernderlich zu sein. Im Wortschatz, im Lexikon scheint uns ein rasanter Umschlag stattzufinden. Der Eindruck tuscht. Herbert Sparmann, einer der Mitarbeiter an dem groen, sechsbndigen Wrterbuch der deutschen Gegenwartssprache aus der DDR, hat aufgrund dieses vollstndigsten Lexikons des heutigen Deutsch ausgerechnet, da Neuschpfungen nur 3,8 Prozent unseres Wortschatzes ausmachen. Von diesen wiederum sind die allermeisten, 3,1 Prozent nmlich, nur neue Zusammensetzungen alter Wrter, und 0,5 Prozent sind Umdeutungen, Umfunktionierungen alter Wrter. Tatschlich sind wirkliche Neologismen neue Wrter fr neue Begriffe sogar beraus rar: Sie machen gerade 0,2 Prozent aus. Da Satzbau und Lautung jeder nderung zh widerstehen und auch der Wortschatz einen aufs ganze gesehen nur sehr migen Anteil von Neuerungen zult, hat brigens bewirkt, da sich die Sprache der Bundesrepublik und der DDR trotz nunmehr vierzigjhriger Teilung nicht nennenswert auseinanderentwickelt haben und dies auch so bald nicht tun werden, allen diesbezglichen Katastrophenmel13
dungen zum Trotz. Die Syntax des in der DDR gesprochenen und geschriebenen Deutsch ist schlechterdings identisch geblieben mit der des West-Deutschen. Die einzigen Divergenzen haben sich an einigen Stellen des Lexikons eingestellt und sind entsprechend oberflchlich. Natrlich gibt es in der DDR gelufige Namen fr Dinge und Institutionen, die der DDR eigen sind: Plansoll, bererfllen, Aktivist, NVA (Nationale Volksarmee), NSW (Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet), ABF (Arbeiter- und Bauern-Fakultt), EOS (Erweiterte Oberstufe), VEB (Volkseigener Betrieb). Einige wenige Dinge heien anders als im Westdeutschen, zum Beispiel die Datsche (Wochenendhuschen), Plaste oder Plast (Plastik), Plastbeutel (Plastiktte), Kombine (eine mehrfunktionelle landwirtschaft liche Maschine), Luftdusche (Haartrockner). Zuweilen macht in der DDR ein eigenes Mode-Slang-Wort Karriere, etwa tiffig (von minderer Qualitt) oder oberdoll (das stliche Pendant zum westlichen tierisch der achtziger Jahre) oder robotern (von russisch rabotatj, arbeiten). DDR-eigen ist die Wendung Fakt ist, da (die auf Walter Ulbricht zurckgehen soll und oft dort steht, wo es im WestDeutschen heute ich gehe davon aus, da heit). Und dann gibt es eine Reihe von Wrtern aus der Parteisprache, die absichtlich Partei ergreifen (parteilich selbst hat den Nebensinn SED-konform erhalten): Die westdeutsche OderNeie-Linie etwa heit Friedensgrenze, der Heimatvertriebene (der sehr parteilich so heit, damit er die Erinnerung an die Heimat und die Ausweisung wachhalte) Umsiedler oder Neubrger. Alles dies aber addiert sich mitnichten zu14
einer neuen, eigenen Sprache. Der Abstand zwischen den deutschen Dialekten oder auch nur zwischen den Sondersprachen der sozialen Schichten oder einzelner Berufsgruppen ist ungleich grer als der zwischen dem Deutsch des brgerlichen und des kommunistischen Deutschland, und die Verklammerung durch das Westfernsehen wird ihn auf absehbare Zeit auch weiter gering halten. Die deutsche Sprache lt es zu, Substantive nach Bedarf und Belieben zusammenzuleimen. Sie drngt in einem einzigen Wort eine Bedeutung zusammen, die sich sonst ber ein Substantiv mit einem Attribut oder sogar mit einem Nebensatz verteilen mte. Die Zusammenfgung spart nicht nur Platz. Sie kann dem zusammengesetzten Wort auch auf subtile Weise zu einer neuen Bedeutung verhelfen, die in seinen Komponenten, als sie noch nebeneinander stehen muten, nicht enthalten war. Groraum und Nazelle sind Verkrzungen von groer Raum und nasse Zelle, aber sie sind auch Wrter fr besondere Unterflle von beiden geworden. Die Leimung von Substantiven fhrt vor allem in der Behrdensprache zu immer lngeren Wrtern. Schon fallen viergliedrige kaum noch auf: Eisenbahnfrachtverkehr, Leitungswasserschadenversicherung. Selbst sechsgliedrige verkraftet das Sprachgehr, ohne aufzumucken: Autobahnraststttenwaschraum. Ab und an taucht gar ein siebengliedriges auf: Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungspolice. Es ist billig, sich darber lustig zu machen. Die Sache gibt es jedenfalls, und das Satzungetm, das zu ihrer Bezeichnung gebildet15
werden mte, wre die Verleimung von Substantiven unmglich oder verboten, fiele mit Sicherheit nicht weniger abschreckend aus. Eine Klasse fr sich sind jene Zusammensetzungen, die aus nichts als aus Wortsplitt bestehen und vor allem in den von der Werbung infizierten Sprachbereichen, bei der Erfindung von Firmen- und Veranstaltungsnamen immer mehr berhand nehmen: aus lateinischen oder griechischen Prpositionen, Prfixen oder Adjektiven wie Neo, Inter, Pro, Anti, Trans, Infra, Ultra, Mikro, Makro. Mini, Maxi, Pseudo, Junior, Senior, Mobil, Super, Semi, Tele und dergleichen sowie Substantiven oder ihren Stmmelformen wie Kosmo, Euro, Petro, Matic, Techno, Psycho, Senso, Mix, Media, Profi, Video, Rent, Dato, Repro, Cargo, ko, Bio, Porno, Sado, Maso, oder, aus den Funktionrssprachen des Kommunismus kommend, Polit und Agit. Sie treten zu Ketten zusammen, die zumeist in irgendeinem modischen Wort fr eine Veranstaltung (Show, Aktion, Parade), ein Gert (System, Set) oder eine Person (Star, Freak) enden. Dieser Wortschrott lt sich fast beliebig verschweien: Maxi-Data-Rent-System, Mini-Repro-Media-Show. Das Hauptprinzip dieser Bildungen scheint zu sein, da die Bausteine kurz sein mssen und da um Himmels willen keine deutschen Bestandteile darin vorkommen drfen, denn die wrden den supermodernen, hochaktuellen Charakter dieser Super-Lingo-Happenings verderben. Was imitiert werden soll, ist wohl die englische Art, zusammengesetzte Substantive zu bilden. Jedenfalls werden hier ganze Bedeutungskomplexe an den Strukturre16
geln des Deutschen vorbei sprachlich eingemeindet. Die aus dem Nonstop-Video-Festival ausgekoppelte Euro-MaxiSingle hrt sich jedenfalls ungemein zeitgenssisch an, so aufgedreht wie ungut. Die meisten Leimwrter sind Ad-hoc-Erfindungen, zum einmaligen Gebrauch bestimmt: Wegwerfwrter (das selbst eines ist), Ex-und-hopp-Begriffe (das auch). Tatschlich ist das Deutsch von heute ein reines Wrterbckerdeutsch, schrieb Ruprecht Skasa-Wei. Jeder modelt sich seine Ausdrcke, wie er sie gerade braucht vielleicht ist eben das die auff lligste Tendenz der neueren Sprachentwicklung berhaupt. Auf wenigen Spiegel-Seiten, in Artikeln und Anzeigen, fanden sich unter anderem: Edelsperrmll, Potenzgeschrei, Elektronikstricker, Laubsgekulisse, Schicksalskolportage, Fitnepedale, Knstlerkarawane, Wirbelsulensprache, Bedienungslotse, Heizkostenteufel. Seltener werden ad hoc Verben improvisiert: absrdeln, behbschen, opern; die Berichterstattung, liest man, lckt. Bei dieser Kombinationswut kann kein Wrterbuch mehr den Ehrgeiz haben, den gesamten Wortschatz zu verzeichnen; kein Auslnder kann hoffen, smtliche Wrter, die ihm in einer deutschen Zeitung begegnen, in irgendeinem Wrterbuch erwhnt und erklrt zu finden. Das deutsche Lexikon: in Teilen entsteht und zerfllt es stndlich. Die Tendenz (neudeutsch der Trend) zur Verknappung, zur konomie, der in einem fort neue zusammengesetzte Substantive gebiert und in dem der Sprachwissenschaft ler Hugo Moser eine der Grundtendenzen heutiger Sprachent17
wicklung sieht, macht sich noch eine andere und hchst produktive Mglichkeit der deutschen Sprache zunutze: die Mglichkeit, zusammengesetzte Adjektive zu bilden. Neudeutsch ist an neugebildeten Adjektiven fast ebenso reich wie an Substantiven; auch von ihnen sind viele nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und zerfallen sofort wieder. Fast jedes transitive Verb kann durch die Nachsilbe -bar in ein Adjektiv verwandelt werden. Es ist verwandelbar. Das Adjektiv kann wiederum zu einem neuen Substantiv fhren: Verwandelbarkeit. Durchschaubar, behebbar, begehbar und unzhlige andere sind Allgemeingut. Ein startbarer oder bremsbarer Wagen erstaunte niemanden. Auch nichttransitive Verben geraten zuweilen in den Sog: Auf unverzichtbar kann nicht mehr verzichtet werden, obwohl man es gar nicht verzichten kann; haltbare Milch ist nicht solche, die sich halten lt. Als ein Allzwecksuffi xoid hat sich -mig erwiesen, in dem Sinn gem wie in dem nicht koscheren Sinn bezglich. Neben richtigen Ableitungen wie vorschriftsmig oder gewohnheitsmig (gem der Vorschrift oder Gewohnheit) wimmelt es heute von illegitimen Abkmmlingen: kalorienmig ist gegen den Nachtisch nichts einzuwenden, benefizmig war das Konzert ein Erfolg, horrormig gab der Film nichts her, frauenmig lief nichts, aber alkoholmig. Am produktivsten ist aber die Mglichkeit, Substantive und Verben mit einem Adjektiv zu einem neuen Begriff zusammenzuleimen. Die Mglichkeit ist alt, wie Wrter wie himmelblau, seetchtig, leidgeprft, feuergefhrlich bewei18
sen, wurde aber lange nur sparsam herangezogen. Heute erst zeigt sie, was in ihr steckt. Ausschlaggebend fr ihren Erfolg ist die Tatsache, da das Substantiv (oder Verb) in keiner bestimmten Beziehung zu dem angehngten Adjektiv stehen mu; es reicht, da es in irgendeiner Beziehung zu ihm steht. Ein jugendfreier Film ist frei fr die Jugend, eine busenfreie Show ist nicht frei fr Buseninhaberinnen und auch nicht frei von Busen, sondern frei an den Busen, das alkoholfreie Getrnk ist frei von Alkohol, und ein vogelfreier Mensch in der zweiten Bedeutung des Worts (in der ersten heit es soviel wie freigegeben fr die Raubvgel) ist frei wie ein Vogel. Obwohl viele Beziehungen zwischen den beiden Komponenten denkbar wren, entsteht kaum jemals irgendein Zweifel. Welche Beziehung zwischen den beiden Komponenten besteht, mu mit sprachlichen Mitteln nicht ausgedrckt werden, es reicht, da beide nebeneinander stehen, um den neuen Begriff mit ausreichender Schrfe sofort zu erkennen: drehen, freudig ergibt drehfreudig; fahren, tchtig fahrtchtig; heilen, krftig heilkrftig; Europa, weit europaweit. Vor allem die Sprachen der Wissenschaft, der Brokratie und der Werbung haben sich aus dieser Quelle reichlich bedient, aber die Alltagssprache folgt ihnen. Whrend Soziologen wertneutrale Formulierungen fr erklrungsbedrftige Zusammenhnge suchen, whrend erfolgsorientierte Brokraten bereichsspezifische und planungsrelevante Daten erheben, um brgerbezogene und mglichst kostenneutrale flchendeckende Manahmen fr strukturschwache Gebiete einzuleiten, waltet die grippegeschdigte Hausfrau pillen19
mde in lauffestem Schuhwerk, fersenverstrkten Strmpfen und hautenger, atmungsaktiver und auch noch pflegeleichter Kleidung qualittsbewut mit ihrem reinigungsaktiven und hoffentlich umweltfreundlichen Waschpulver inmitten der reparaturanflligen Gerte ihres schadenstrchtigen und leider nicht idiotensicheren, noch nicht einmal babyleichten Haushalts und setzt sich zwischendurch, eine Tasse rstfrischen und aromastarken Kaffees zu trinken. Angstfrei ist sie nicht, denn naturbelassen ist noch nicht einmal der Salat, und all die kochtopffertigen Ewaren, die ihr medienadquat angepriesen worden waren, knnten auf unerwnschte Weise geschmacksintensiv sein. Und was dann? Eine besondere Karriere hat das Adjektiv -fhig gemacht. Wenn Kontrahenten (die im brigen eigentlich keine Gegner, sondern Vertragspartner sind) dialogfhig, nmlich fhig zum Dialog sein knnen: warum dann nicht auch konfliktfhig und zukunftsfhig und friedensfhig? Aber was hat man sich unter einem sozialfhigen Zeitgenossen vorzustellen? Einen gesellschaftsfhigen jedenfalls nicht. Von hier ist es nur noch ein kurzer Schritt zum verhandlungs- oder kompromifhigen Papier, und es fllt gar nicht mehr auf, da damit dem Papier eine Eigenschaft zugesprochen wird, die eigentlich seine Urheber haben mten. Aber die angestammte Rolle des Adjektivs, nmlich Attribut eines Substantivs zu sein, kommt ohnehin immer strker ins Wanken. Bei der schwulen Kneipe handelt es sich nicht um eine Kneipe mit dem Attribut der Homosexualitt, sondern um eine Kneipe fr Schwule. Die progressive Buch20
handlung ist nicht selber fortschrittlich, sondern ein Laden fr Fortschrittliche. Ganz hnlich verhlt es sich mit dem biodynamischen Marktstand, der alternativen Reisegruppe, dem kreativen Zweisitzer (der ein spilleriges Sofa ist, das man sich selber bunt beziehen soll). Das Adjektiv wird also in der doppelten Art verwendet, in der etwa auch der lateinische Genitiv verwendet wurde. Amor dei, man erinnert sich: die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott, subiectivus und obiectivus. Flle wie politischer Frhschoppen oder anthroposophische Schule zeigen, wie es zu dem objektiven Gebrauch des Adjektivs kommen konnte: Es ist eine Schule, die sowohl selber anthroposophisch ist (gefhrt wird) als auch von Anthroposophen besucht wird. Zu den beiden wichtigsten Konsumartikeln des Zeitgenossen gibt es leider kein Adjektiv: Auto und Fernseher. Auf die Dauer wird dieses Manko nicht hingenommen werden. Schon tauchen ab und zu erste televisionre berlegungen auf. Und beim Auto trifft es sich gut, da es vom Automobil abgeleitet ist, dem Selbstbeweglichen. Da liegt es nahe, automobil als Adjektiv neu zu erfinden, im Gegensatz zu automobilistisch im Sinne von das Kraftfahrzeugwesen betreffend. Wer empfindlich bleibt fr ursprngliche Bedeutungen, wird der Sprache allenfalls so etwas wie automobile Winterreifen zumuten. Wer aber von derlei Skrupeln frei ist, brummt als automobiler Parasit (Beifahrer) mit automobiler Hchstgeschwindigkeit voll ab in die automobile Zukunft. (Da Fernsehen Fernsehen heit, bereitet der Sprache auch noch andere Ungelegenheiten. Ein Fernseher ist der Appa21
rat und man selber, der vor ihm sitzt. Was tut man da? Man sieht Fernsehen, man sieht das Sehen. Das wurde verkrzt und rationalisiert zu man sieht fern. Nun aber ist nicht mehr klar, ob fern Akkusativobjekt oder Adverb ist: Man sieht was? oder wie? Bei sehen fllt diese Unklarheit kaum auf; um so mehr aber, wenn man dafr das umgangssprachliche gukken einsetzt. Neben ich gucke fern, wo das fern als Adverb interpretierbar ist, hrt man immer fter ich gucke Fernsehen und damit ist aus dem intransitiven gucken eigentlich unstatthaft ein transitives Verb geworden.) Schon vor Jahrzehnten eingebrgert haben sich Ableitungen meist Verkrzungen wie Auto, Photo, Abo(nnement), Tacho, Trafo (fr Transformator) oder Profi, Uni, Krimi, Sozi, Nazi. Im Weltkrieg kamen Ami, Tommy und Russki dazu. Aber whrend es ber lange Zeit hin bei einer Handvoll solcher Bildungen geblieben war, begannen sie Anfang der siebziger Jahre dank dem Bestreben, witzig zu sein, pltzlich ins Kraut zu schieen. Den Weg gebahnt hatten zweifellos deutsche Diminutive wie Schatzi oder Bubi, dazu die analogen englischen Ableitungen, die ber die Jugendsprache nach und nach ins Deutsche einsickerten: Teenie, Hippie, Groupie, Roadie, Smilie, Junkie, Softie, Zombie, Oldie (dieser verwandelte sich beim Import aus einem Wort fr alte Schlager und Filme in eines auch fr alte Autos); und schlielich wohl auch die Prsenz vieler romanischer Wrter auf -i und -o, vom Macho bis zu den Spaghetti. Nun jedenfalls sind sie da, die flotten Verniedlichungen, bald eher hhnisch, bald eher zrtlich, die umstndliche lange Wrter klein kriegen, und22
kein Wrterbuch wre schnell genug, sie alle festzuhalten, denn in einem fort entstehen neue und verschwinden teils auch wieder: der Brummi (Lkw) und der Bulli (Transporter), der Multi, die Muni (Munition), der Molli (Molotowcocktail) und der Synthi (Synthesizer), der Kombi und der Compi (Computer), die Ini(tiative) und die Konfi (Konferenz) und der Quicki, in der DDR der Trab(b)i (ein Motorfahrzeug der Marke Trabant) und der/die Stasi (Staatssicherheitsdienst); und all die vielen i-Leute: der Heini und die Tussi (von Thusnelda), der Schwuli und der Kanni(-bale), der Dummi und der Bundi (Bundeswehrangehrige), der Flippi (der ausgeflippt ist oder herumflippt) und der Chauvi (der heute ein Mann ist, welcher Frauen fr Menschen zweiter Klasse hlt, und damit jede Beziehung zu dem Ur-Chauvin verloren hat, dem patriotischen Rekruten der franzsischen Komdie), der Sponti (anscheinend ein aggressiver Protestjugendlicher) und der Sympi (Sympathisant), der Msli (ein Bio- oder ko-Freak), der Spasti (der normalerweise kein Spastiker ist, sondern jemand, der seine Bewegungen nicht ganz unter Kontrolle zu haben scheint, der frhere Tolpatsch) und der Hirni, der Pooni und der Baggi (rotgekleidete Guru-Abhngige), der Schlaffi und der Laschi und der Schlappi (und das Chappi fr den Hund), der Dissi (Dissident) und der Zoni (DDR-Bewohner), der Grufti (Greis) und der Transi (Transvestit), der Abi (Ausbilder) und der Azubi (Auszubildender) und der Studi (Student), der Zivi (Zivildienstleistender oder Zivilfahnder), der Knasti und der Knacki (der aber nicht nur ein Strafgefangener ist, sondern auch ein knackig wirkender23
Mensch), der Schleimi und der Schmusi und all das andere Schickimicki. Die Ableitungen auf -o sind weniger zahlreich: Demo(nstration), Info(rmation), Dispo(sition), Deo und Video, Hetero und Homo, Brutalo, Schizo, Sado, Maso, Porno, Disko, Anthro(posoph), Mayo(-naise), Realo (Realpolitiker im Gegensatz zum Fundi, dem Fundamentaloppositionellen). Aber auch hier ist das Prinzip erkannt und akzeptiert und wird weiterhin produktiv sein. Knftige Deutschschler werden eine neue Klasse von Substantiven zu lernen haben, die auf -i und -o, und sie werden sich rgern, da auch denen ihr grammatisches Geschlecht nicht anzusehen ist. Die ergiebigste Quelle fr sprachliche Neuerungen ist die Jugendsprache; ihr Hang zum Nonkonformismus hlt die Jugend auch zu sprachlicher Absonderung an. Aber die meisten ihrer Schpfungen verschwinden, wie sie gekommen sind; vieles berlebt die Saison nicht, wird morgen hoffnungslos veraltet wirken und bermorgen vllig vergessen sein. Zu den jugendsprachlichen Wrtern und Wendungen, die die Kurve gekratzt haben, in die Gemeinsprache bernommen wurden und aus ihr einstweilen nicht mehr wegzudenken sind, gehren: der Typ (schwach flektiert), der den lteren Kerl weitgehend abgelst hat, stehen auf (mit dem Akkusativ: ich stehe auf dich), auf die Strae gehen (frher htte es auf die Barrikade steigen geheien), jemanden anmachen (in den beiden Bedeutungen von jemanden belstigen sowie jemanden anhauen und sein Interesse erregen),24
Bock haben auf (statt Lust zu), null Bock (keine Lust), Zoff (Streit, Putz), sich reinziehen oder reinschieben (willst du dir bers Wochenende etwa drei Videos reinziehen?), (an)trnen, ausflippen, nerven und nervig (frher htte es enervieren geheien), stressig und gestret (statt mhsam und angestrengt). Unentbehrlich geworden ist auch die Szene, wie die sie nennen, die nicht zu ihr gehren die anderen sagen Scene (ssihn). Ungefhr ist die Scene das Milieu, aber nicht jedes, sondern ein besonderes, nmlich alternatives: die Spontiscene, die Kneipenscene, die Schwulenscene, allgemein die Sttten der Jugendkultur (Kneipen, Diskos, Programmkinos, Jeanslden, Popkonzerte). Aber vermutlich wird es eines Tages auch eine Busineszene geben. Das offensichtlichste Merkmal jeder Jugendsprache sind ihre Elative: die Adverbien, die einen hohen Grad ausdrkken. An wirksamen Elativen besteht ein groer Bedarf schlielich will jeder Sprecher zum Ausdruck bringen, da etwas nicht blo so, sondern in einem hohen Mae der Fall ist. Und die Elative verblassen schnell. Was heute noch frisch einen hohen Grad bekundete, wirkt bald schon lasch und mde und mu durch neues Material ersetzt werden. Wer einen jugendsprachlichen Text zu datieren htte, hielte sich am besten an seine Bezeichnungen fr sehr, sehr gut, sehr schlecht. Knorke mu Anfang des Jahrhunderts sein; schau (ein schaues Buch) fnfziger Jahre. Und wer Jugendsprache ohne groen Aufwand faksimilieren will, braucht nur ber einen im brigen vllig normalen Text ein paar aktuelle Elative zu verstreuen: in den achtziger Jahren ein echt, irre, un25
heimlich, geil, affengeil, tzend, tierisch, super, grell, derb. Der mokante Ton, mit dem sich die nicht mehr so Jugendlichen ber derlei Schpfungen erheben, ist ganz und gar unangebracht. Ihr wahnsinnig (das hat mir wahnsinnig gefallen) ist kein bichen richtiger und edler als das irre der Jugend; das vllig verblate sehr heit ursprnglich nichts anderes als schmerzhaft, versehrend und war sozusagen das tzend des Althochdeutschen. Sollte tierisch erhalten bleiben (die Chancen sind nicht gro), so wird es in ein paar Jahrhunderten etwa tirsch heien, und auer ein paar Etymologen wird sich niemand an seine Herkunft erinnern. Da es erhalten bleibt, ist allerdings nicht wahrscheinlich. Verschlei und Ersetzung dieser Wrter vollziehen sich immer schneller; gebremst werden sie am ehesten noch dadurch, da der Vorrat an geeigneten Vokabeln nicht unerschpflich ist. Es ist erst einige Jahre her, da redete man von den ins Deutsche eindringenden Fremdwrtern als von einer Seuche. Dahinter stand die (vlkische) Vorstellung, gesund sei nur eine Sprache, die ihre Reinheit bewahre; auch die, da die Sprache den Fremdwortbefall abwehren und eindmmen knne und solle, und da er ein vorbergehendes Phnomen sei: ein paar vereinte Anstrengungen, und das Deutsche erglnze wieder in alter Reinheit. Solche Reden sind inzwischen mehr oder weniger verstummt. Es ist klar geworden, da die scharenweise in die deutsche Sprache eingewanderten Fremdwrter, deren Zahl von Tag zu Tag weiter steigt, durch nichts in der Welt wieder ausgebrgert werden knnen. Es handelte sich nicht um eine26
temporre Erkrankung, eine passagere Immunschwche. Es handelte sich um eine dauerhafte ffnung der Sprachgrenzen. Mit den Waren und den Lebensgewohnheiten kamen auch die Wrter aus dem Ausland; und besonders reichlich strmten sie aus der Leitkultur der Gegenwart, der angelschsischen. Gefrdert wurde dieser Proze durch die Auslschung ihrer Geschichte, was den Nachkriegsdeutschen am liebsten gewesen wre, und deren damit einhergehende tiefe Identittskrise: Alles Deutsche, auch die deutsche Sprache, war pltzlich gar nicht mehr groartig, es war sogar so ziemlich das Hinterletzte, und mit dem englischen Wort konnte man sich als Angehriger der zivilisierten Welt ausweisen. Wenn der Widerstand dagegen zusammengebrochen ist, dann aber wohl nicht nur wegen der Unaufhaltsamkeit des Ansturms. Fremdwrter werden zum Entsetzen der verbliebenen Puristen nicht mehr als etwas Bses gesehen; sondern oft geradezu als ein Gewinn. So sah auch Goethe sie schon: Die Gewalt einer Sprache ist nicht, da sie das Fremde abweist, sondern da sie es verschlingt (Maximen und Reflexionen). Das Englische selbst ist ein Beispiel dafr, wieviel Fremdes eine Sprache verkraften kann, wie sehr sie von Fremdem sogar profitiert. Das Englische entstand, als das Angelschsische sich vollsaugte mit der Sprache der normannischen Eroberer. Es ist eine Hybridisierung aus Angelschsisch und Normannisch, ber die ein halbes Jahrtausend spter noch einmal eine Welle von Latein hinwegging. Zu Shakespeares Zeit waren die beiden Sprachen lngst miteinander27
verschmolzen. Htte das Sprachgefhl sie noch getrennt, so htte sich die purpurnste Stelle der englischen Literatur etwa so angehrt: Sein oder Nichtsein, das ist die Question. Obs geistig nobler ist, die Schlingen und Pfeile einer outrageusen Fortune zu souffrieren oder die Armes zu ergreifen gegen ein Meer von Troubles und ihnen ein Ende zu machen en les opposant Das Deutsche macht heute eine hnliche Invasion aus dem Englischen durch. Es nimmt Schwrme von Gastwrtern auf, verleiht ihnen unbefristete Aufenthaltserlaubnis und wird die meisten von ihnen schlielich einbrgern. Es wird daraus gewandelt, aber auch bereichert hervorgehen. Schon einmal hat es eine solche Invasion nicht nur verkraftet, es hat davon profitiert vom siebzehnten zum neunzehnten Jahrhundert, als ungezhlte Wrter und Wendungen aus dem Franzsischen eindrangen. Viele sind zwar noch heute als Lehnwrter erkennbar, dabei aber doch so deutsch geworden, da es gar keine deutscheren Alternativen zu ihnen gibt. Hierher gehren die Gallizismen der vornehmeren Kreise, fr die Franzsisch lange die Hauptsprache war, der Leute mit Esprit und dazu Portemonnaie, die zur auf Etikette bedachten Hautevolee gehrten, in Palais residierten, auf dem Trottoir der Allee ums Karree flanierten oder promenierten (fr das heute der englische Block eingesprungen ist), in ihren Equipagen ber Chausseen zum Ball oder zur Redoute28
rollten (einer Fete, die besonders etepetete etre peut-tre war), die sich das Men von Domestiken servieren, die Percke vom Friseur kruseln, den Koffer vom Portier schleppen lieen, auf den Fauteuils und Chaiselongues ihrer komfortablen Salons mit Balkon und Parkett-Fuboden Likre nippten, in Hotels abstiegen, mit vorgebundener Serviette im Restaurant dinierten, Roben um ihre Taille schlangen, Kostme und Blusen und Ngligs trugen, Parfms benutzten, ihren Teint im Park der frischen Luft aussetzten und, wie in ihrem Milieu blich, sich vom Feuilleton ihrer Journale auseinandersetzen lieen, da im Theater die Soubrette in der famosen Szene mit dem Leutnant etwas malade gewirkt htte, sowie andere sensationelle und aktuelle Nuancen, die sie hinterher bei den Amouren mit ihren Mtressen Die weniger noblen Kreise, unbekmmerter um Bedeutung, Aussprache oder gar Schreibweise, deutschten derweil die von Hugenotten, Revolutionsflchtlingen und napoleonischen Soldaten bernommenen franzsischen Brocken dermaen brachial ein, zum Beispiel in den Berliner Stadtdialekt, da ihnen heute ihr Ursprung oft gar nicht mehr anzumerken ist: der Deez (tte) und der Feez (fte), blmerant (bleumourant) und ratzekahl (radical), totschick (tout chic) und mutterseelenallein (moi tout seul-allein) und forsch (avec force), plrren (pleurer), die Kinkerlitzchen (nmlich die quincailleries, der Haushalttrdel) und den Muckefuck (mocca faux) und das sonderbare alle in der Bedeutung ausverkauft aufgebraucht, das von all (fort) kommt. Die deutsche Sprache wre um vieles drftiger ohne dieses29
Importgut. Sie wre es auch ohne die heute einstrmenden Anglizismen. Oft wird das englische Wort importiert, weil es keine deutsche Bezeichnung fr den betreffenden Sachverhalt gibt und die bernahme einfacher ist als die Neuerfindung und Durchsetzung eines deutschen Pendants; oder weil die bersetzung zu umstndlich klnge (so hat vielleicht noch die Betriebsleitung, aber kaum noch die Betriebsleitungstechnik eine Chance neben dem Management); oder weil die Wrter zu Bereichen gehren, in denen Englisch die internationale Verkehrssprache ist, etwa beim Luft verkehr, der dem Neudeutschen das Ticket und das Gate, den Piloten und den Jet und das Cockpit, das Einchecken und die Airline beschert hat oder weil den deutschen quivalenten, wo sie vorhanden sind, etwas fehlt, nmlich die Markierung jung, modern, schwungvoll, die Importen aus Amerika automatisch anhaftet. Erst die Sprache des Jazz und dann die der ganzen PopMusik bewahrte die Wrter ihres Ursprungs: Band, Sound, Drums, Riff, Beat, Chorus, Swing, Song, Soul, Folk, Drive, Power, Feeling Die Sprache der Pop-Kultur lie sich vollaufen mit Anglizismen, ja sie ist ein einziger, mit deutschen Funktionswrtern gesprenkelter Anglizismus: Pop, Top, Flop, Stop, Tip, Trip, Dip, Hit, Gag, Fan, Freak, Star, Crack, Insider, Outsider, Man, Boy, Lady, Girl, People, King. Der Pop-Mensch trgt Jeans und Shirts, klebt Stickers an sein Auto, pinnt Posters an die Wand, steckt Buttons an die Jacke, hat Jingles (gesunge30
ne Reklamesprche) im Ohr und Jokies in der Seele, ist total easy und cool. Wir haben auf dieser Fuzzitour ein paar Gigs gemacht, um unsere Instrumentals zu featuren (Spliff ). Die Nase im Trend, setzte sich auf ihren Partys die Schikkeria der Jetset, die (High) Society, auch die Beautiful People genannt mit den Drinks in die Lobby oder an den Pool und spielte VIP oder in. Film und Fernsehen zeigten lckenhaft synchronisierte Thriller mit viel Action, in denen Cowboys, Killer oder Trukker dem Showdown entgegenrasten. Der Normalmensch schlielich ihm bleibt nur, sein Leben zwischen Job, Instant-Nahrung und Sex zu teilen, Stress und Trouble zu meiden, den Body mit Beauty-Lotionen und Aftershave und diversen Sprays oder Fluids zu pflegen und im brigen des Weekends zu harren, da er sein Hobby herausholen kann. Einige Fachgebiete etablierten sich so rasch, da die sprachliche Eindeutschung nicht nachkam, zum Beispiel die elektronische Datenverarbeitung. Gerade noch hat die Schnittstelle das Interface verdrngt, der Bildschirm die Screen, der Absturz den Crash, der Rechner aber nicht mehr den Computer (eigentmlich, welches grammatische Geschlecht wir diesen englischen Substantiven zuteilen, die in ihrer Heimat allesamt Neutren sind). Fr Hardware, Software, Chip, Cursor, Code, Input, Output, Floppy, Compiler, Assembler, Listing, ROM (Read-Only Memory, Festspeicher) und RAM (Random Access Memory, Direktzugriffspeicher) und vieles andere mehr gibt es bisher kein kon31
kurrenzfhiges deutsches Wort. Die jhe Ausbreitung des Heimcomputers wird der Sprache viele Novitten bescheren, unter anderem Wrter fr all die Routinen, nmlich all die blichen Prozeduren am huslichen System: booten (das Betriebssystem einlesen und mithin starten), loaden (das Programm einlesen), scrollen (den Text auf dem Bildschirm auf- und abrollen), formatieren (dem Text ein Format zuteilen), listen (ein Programm ausschreiben), saven (sichern durch Aufnahme in den Speicher), clearen (den Bildschirm freimachen), pippen (auf eine andere Diskette kopieren von dem Befehl PIP, dem Krzel fr Peripheral Interchange Program, einem Programm fr den Datenaustausch zwischen einzelnen Gerten der Peripherie, die in dieser Bedeutung ebenfalls neu ist), printen (ausdrucken). Nicht ausgeschlossen, da Computerfexe einige dieser Ausdrcke bald auch bertragen gebrauchen werden: Pipp mir mal den Parmesan herber! Und immer voran die Werbebranche, die von Berufs wegen Moden macht und sich kein Attribut der Modernitt entgehen lassen kann. So sitzen die PR-Leute, die Art-Directors und die vom Marketing mit ihren Drinks in der Lounge, lauter effiziente Top-Krfte mit einer Menge Know-how (im Englischen heit das brigens weniger ordinr expertise), krperlich fit, sogar topfit, die Geheim-Tips ihrer Bosse, und warten auf das Team der Sponsoren, jene um das ProductImage besorgte Crew, der sie die Displays des Layouts mit den Samples des neuen Designs fr die recycelbaren Spray-Dosen prsentieren wollen, und erzhlen sich die Story vom Ghost32
writer, diesem Playboy, der mitten in der Talkshow wohl von wegen der Midlife-Crisis einen Blackout hatte und dem Model das Dressing ber den Dress go. Eine Zigarettenfirma lie diese Anzeige aufsetzen: Wildlife-Boat Safari. Elephants und Buffalos am Flu. Superlodges und Sonnenuntergnge. Karibasee, Victoria-Falls. 5 Tage zum Growild-Foto-Shooting nach Zimbabwe, Afrika. Auf ins Action-Weekend. Eckhard Henscheid fand es sad, da die Zielgruppe anscheinend das Wrtchen and noch nicht drauf hatte. Die meisten Wortimporte sind Substantive. Adjektiven ist ihre Bedeutung weniger leicht zu entnehmen; so haben erst relativ wenige ihren Weg ins Deutsche gefunden: smart, clever, cool, happy, light, sweet, fit, soft, neuerdings von der Werbebranche unter dem Einflu von saftig zu softig ausgebaut (der Milkshake, den Sie sich selber softig schlagen). Grer ist die Zahl der Verben: kicken, swingen, rocken, joggen, tarnen, flippen, killen, scratchen, stretchen, pushen, jobben, jetten (die es beide im Englischen nicht gibt). Eine besondere Karriere hat checken (auch abchecken) gemacht: Heit es im Englischen in der Hauptsache nachsehen, prfen, so hat es im Deutschen zustzlich die Bedeutung merken angenommen (Er hat nicht gecheckt, da sie ihn voll verarscht). Was die Eingemeindung von Verben erschwert, ist der Umstand, da sie sich flektieren lassen mssen. Managen, handlen, stylen, designen, relaxen, leasen, powern, layouten soweit machen sie keine Sperenzien, aber heit es er hat gemanagt oder gemanaged? gehandled oder dann33
doch gleich gehandelt? er ist relaxt oder relaxed? sie designt oder designed? sie hat gelayouted oder outgelayed oder layoutet oder wie? Einen gangbaren Weg, solche englische Verben zu akkommodieren, hat die deutsche Sprache noch nicht gefunden. Das Englische beeinflut das Deutsche aber noch auf eine andere, sehr viel weniger auff llige Art. Zu den offenen treten immer mehr heimliche Anglizismen: Wrter und Wendungen, die sich auf den ersten Blick so urdeutsch ausnehmen wie aus Grimms Wrterbuch und die dennoch englischer Herkunft sind. Entweder handelt es sich um wrtliche bersetzungen; oder ein fast vergessen dahinvegetierendes Wort wurde unter dem Einflu des Englischen wiederentdeckt und reaktiviert; oder ein deutsches Wort erhielt unter dem Einflu des Englischen zustzlich eine ganz neue Bedeutung, die ihm bisher fremd war; oder seine althergebrachte Bedeutung wurde von einer aus dem Englischen stammenden Neu-Bedeutung unterwandert und mehr oder weniger auer Kraft gesetzt. Realisieren etwa frher hie das nichts anderes als zu Geld machen und vor allem verwirklichen: Solche Hirngespinste lassen sich nicht realisieren. Noch in um 1960 gedruckten Fremdwrterbchern taucht es ausschlielich in diesem Sinn auf. Um 1970 aber nahm es dann auch noch die Bedeutung von to realize an: verstehen, sich klar machen: Er realisiert nicht, da er ein hohes Risiko eingeht. hnliches ist kontrollieren widerfahren. Eigentlich hie es34
berprfen: An der Grenze wurden wir nur flchtig kontrolliert. Heute heit es auch noch beherrschen: Die Aufstndischen kontrollieren den ganzen Norden. Ein kontrolliertes Experiment ist keineswegs ein berwachtes, auch kein berprftes oder beherrschtes Experiment, wie man in unbeholfenen bersetzungen lesen kann; berwacht wird hoffentlich jedes Experiment, sonst hrt es schnell auf, eines zu sein. Vielmehr handelt es sich um eines, bei dem alle erdenkliche Sorgfalt darauf verwendet wurde, da die bei ihm anfallenden Resultate tatschlich von den in Frage stehenden Faktoren hervorgebracht wurden und nicht von irgendwelchen ganz anderen oder dem puren Zufall. Konfirmieren hie fast immer nur einsegnen; heute heit es auch besttigen. Involvieren (in sich beschlieen, aber auch verwickeln) war recht ungebruchlich und wurde erst in Dienst genommen, als die englische Sprache vorgemacht hatte, wie praktisch es ist, ein unumstndliches Wort fr den gleichen Begriff zu haben. Implementieren (ins Werk setzen, durchfhren) gab es gar nicht; als eines der Lieblingswrter der englischen Wissenschaftssprache hlt es heute seinen Einzug ins Deutsche. hnliches gilt fr in- und dekrementieren (um einen bestimmten Wert erhhen oder vermindern). Die neue Computersprache strotzt nicht nur von offenen, sondern auch von heimlichen Anglizismen. Warum die bersicht zu Beginn eines Programms im Englischen menu heit, ist klar. Menu heit Speisekarte. Der Computer reicht einem sozusagen die Karte seiner Leistungen. Ein35
Men aber war im neueren Deutsch nur noch die Speisenfolge, also das Essen selbst. Nun wurde es zu einer bersetzung des Computer-menu. Man gewhnt sich wunderbar schnell an solche Merkwrdigkeiten; nur Novizen fragen sich vergeblich, ob die Hacker, die sich an mengesteuerten Textprogrammen zu schaffen machen, eine besonders verfressene Spezies sind. Was machen diese Hacker? Sie haben das Pawort (nicht etwa, obwohl es auf das gleiche hinausliefe, das Kennwort oder die Losung). Damit adressieren sie ihr System und das heit nicht etwa, da sie ihm Adressen aufk lebten, sondern da sie es ansprechen (um 1960 war beanschriften noch die einzige Bedeutung von adressieren; nun hat es auch noch die des englischen to address bernommen). Wenn sie es dann adressiert haben, beginnen sie mit dem Editieren und eventuell dem Indexieren, beides Importe aus dem Englischen, die verfgbare deutsche nun ja, die wohleingefhrte Fremdwrter (edieren und indizieren) mit dem Rkken an die Wand gedrckt haben. Oder um in die Niederungen der Alltagssprache hinabzusteigen: Feuern hie einst rot werden und spter heizen; in Anlehnung an to fire wurde es zu hinauswerfen. Gefeuert wird, wer im Rattenrennen nicht mithlt (rat-race evoziert Laboratoriumsratten in der Tretmhle). Demnchst werden Kandidaten auch hierzulande rennen mssen (to run), wenn sie sich um ein Amt bewerben. Um ein Amt in der Administration. Die war frher nichts als eine Verwaltungsbehrde. Heute ist daraus nach36
Washingtoner Vorbild nicht weniger als der gesamte gewhlte Regierungsapparat geworden. Der gewhlte Politiker entwickelt Aktivitt oder, mit unserer Vorliebe fr den Plural, Aktivitten. Das wre einst fast eine Beleidigung gewesen, denn es hie soviel wie Betriebsamkeit; heute sind alle Arten von Aktivitt (nmlich, wie das englische activity, Ttigkeit schlechthin) durchweg eine Empfehlung. In seinem Amt dann ist Kompetenz gefragt. Noch Ende der 60er Jahre bedeutete das nur Zustndigkeit: Das fllt nicht in Ihre Kompetenz! Jetzt bedeutet es auch noch, was das englische competence bedeutet: Befhigung. Seltsamerweise haben die Linguisten, besonders die, die scharf darauf waren, jede Spur von Provinzialismus abzuschtteln und die Hhenluft internationaler Debatten zu atmen, sich dieser Art wortwrtlicher Eindeutschung besonders hemmungslos hingegeben. Lssig unterscheiden sie Kompetenz und Performanz des nativen Sprechers (also etwa die Sprachbefhigung und das tatschliche Sprechen in der eigenen Muttersprache), und ein noch leichter Satz etwa von Chomsky hrt sich auf deutsch dann so an: Das Kind mu eine generative Grammatik seiner Sprache auf der Grundlage eines relativ restringierten Maes von Evidenz erwerben. Kein Wunder, da diese Wissenschaft eine Sache fr Esoteriker geblieben ist. Nicht nur, da sie viele tatschlich neue Begriffe enthlt, wie es sich fr eine originelle Disziplin gehrt; sie befremdet auf Deutsch berflssigerweise doppelt, weil sie auch das Vertraute (etwa den simplen Begriff beschrnkt) wrtlich bersetzt und damit fremdartig ausdrckt (re37
stringiert). Was wre das Gegenteil von beschrnkt? Fr den Linguisten natrlich elaboriert. Der Bedeutungsgewinn gegenber einfach und kompliziert ist nahe Null. Fr Evidenz aber mchte ich wrmstens pldieren. Im Deutschen war immer evident, was auf Anhieb einsichtig war. Fr das englische evidence gibt es keine wirklich brauchbare deutsche bersetzung. Es ist weniger als ein Beweis, aber mehr als ein bloes Indiz irgend etwas dazwischen. Gerade dafr aber htte auch das Deutsche ein respektables Wort dringend ntig, vor Gericht wie in den Wissenschaften. In striktem Sinn zu beweisen nmlich so, wie sich ein mathematisches Gesetz beweisen lt ist in den Verhaltenswissenschaften gar nichts. Trotzdem haben manche Hypothesen ein empirisches Material auf ihrer Seite, das ber den Status bloer Indizien weit hinausgeht. Zu seiner Bezeichnung knnte man gut das Wort Evidenz heranziehen. Es meinte dann (und auch dieses meinen ist ein heimlicher Anglizismus): etwas endgltig schwer Beweisbares, fr das gleichwohl gute Grnde sprechen. Und manchem Miverstndnis wre vorgebeugt. Wir sind an vielen Pltzen der Erde vertreten, wirbt eine Firma fr sich. Sie meint: an vielen Orten und hat einfach many places wrtlich bersetzt einer der absolut berflssigen heimlichen Anglizismen. Nicht berflssig scheint dagegen das Netzwerk zu sein. Wie sollte man etwa ein network der Selbsthilfegruppen anders und treffender nennen? Schon in der ersten Zeit deutscher Amerikanophilie war es ja rgerlich, da sich das Amerikanische-Krfte-Netzwerk,38
der vielgeliebte AFN, partout gegen seine Eindeutschung sperrte; Amerikanischer Wehrmachtssender wre semantisch in Ordnung gewesen, emotional aber vllig daneben. Ein Medium war einst ein Vermittler und dann auch noch eine Art Spukagent. Um 1970 hatte die Werbewirtschaft es in seiner englischen Bedeutung Werbetrger eingefhrt. Als Allerweltswort fr eine Informationsvermittlungsmethode oder -anstalt sollte es seitdem Karriere machen. Das Album (wrtlich das Weie) war nichts als ein Sammelbuch. Unter dem Einflu des Englischen ist daraus die Sammellangspielplatte geworden. Die Promotion war einzig die Erlangung der Doktorwrde; heute werden auch Waren nein, nicht promoviert, sondern promotet. Das deutsche Rudiment, das die Bedeutung Restbestand, berbleibsel hat, ist keineswegs die Entsprechung zum englischen rudiment (Anfangsform, Ansatz), wird aber immer fter so gebraucht. Ohne die Wrter Effizienz, effizient lieen sich manche deutschen Stze nur noch halb so effizient formulieren. Manche dieser Verschiebungen sind auerordentlich subtil. Ich glaube mich zu erinnern, da noch vor zwanzig Jahren niemand gesagt htte: Der htte mich glatt gettet. Damals noch htte es umbringen oder ermorden heien mssen; das durchaus vorhandene tten htte einen viel zu klinischen Klang gehabt gettet wurden vielleicht Versuchstiere. Dann aber wurde es zu einer kommoden direkten bersetzung von to kill. hnlich haben lieben und hassen unter dem Einflu von to love und to hate viel39
von ihrer einstigen emotionalen Schrfe verloren; ich liebe Quizsendungen oder ich hasse Ketchup wren frher kaum vorstellbare Stze gewesen. Das deutet schon an, woher viele dieser heimlichen Anglizismen kommen: aus flchtigen Synchronisationen von Filmen und Fernsehspielen. Sie sind oft das Werk von AbcSchtzen der bersetzergilde, die gar nicht auf die Idee kommen, da es fr manche Begriffe vllig ausreichende deutsche Entsprechungen gibt; da die erste Frage des bersetzers sein mte: Wie sagt man das auf Deutsch? Sie holen den Dialog Wort fr Wort heim. Regelmig zum Beispiel greifen solche Sendungen und Filme um drei Nullen zu hoch: Da werden etwa Schadensersatzforderungen in Billionenhhe geltend gemacht, obwohl eine billion nur eine Milliarde ist, und das Element Natrium kommt als Sodium daher. (Auch anderssprachige Filme werden oft nur aufs oberflchlichste eingedeutscht. In einem franzsischer Herkunft ist die Rede davon, da die Heldin in ihr Land zurckgehen will. Der Synchronisateur hat nicht bemerkt, da man diesen Sachverhalt eigentlich mit in die Heimat zurckkehren wiederzugeben pflegt.) Daher kommen denn wohl die meisten jener supermodernen Redensarten, die nichts anderes sind als heimliche Anglizismen. Ja, ich sehe Ihren Punkt (I see your point). Vergi es (forget it). Das ist eine trickige Geschichte (atrikky story). Man wird Ihnen noch die Schau stehlen (to steal the show). Das andere Team liegt in Front (is in front). Es wirkt dreimal strker (statt dreimal so stark). In 198540
wird es passieren. Habt eine gute Zeit (have a good time), Leute (folks)! Das macht keinen Sinn (natrlich mte es hat oder ergibt heien, aber beides pat nicht immer also wird macht sich auf jeden Fall endgltig einbrgern). Sie haben einen doppelten Standard eigentlich wre der double Standard die doppelte Moral oder zweierlei Ma. Das macht mich sauer ist wohl unter dem Einflu von englisch sore gleich wund und rgerlich zustande gekommen. Denn frher konnte man nur, wie Lakmuspapier, sauer reagieren, oder etwas stie einem sauer auf; selber sauer wurde man noch nicht. Zu dem modernen Gruwort hallo wurde nicht etwa der alte germanische Fhrmannsruf (hol ber!), der sich in die ra des Telephons hinbergerettet hatte, sondern der amerikanische Anruf hello. Und als gngigster und gleichzeitig entbehrlichster aller heimlichen Anglizismen ist natrlich einmal mehr (once more) zu nennen. Da das auf Deutsch schlicht noch einmal heit, gert bei dem einen oder anderen auf erleseneren Ausdruck bedachten Schreiber nachgerade in Vergessenheit. Schon hrt man gelegentlich: Ein Bier mehr! (Immerhin nicht ein mehr Bier!) Gewi will der Sprecher im Grunde am liebsten ein anderes Bier! sagen, nur bliebe sein Glas dann wahrscheinlich leer, und so weit geht die Anglomanie dann doch nicht. Manche dieser Sprachimporte sind in der Tat nur modische Protzereien. Andere sind hochwillkommene Bereicherungen. Bleiben werden die einen wie die anderen.41
Ebenso oft verlstert wie die fremden Wrter werden oft die Abstrakta. Gewi, abstrakte Begriffe sind eben dies abstrakt, unanschaulich, man sieht hinter ihnen kein Bild, und ein stark mit ihnen durchsetzter Stil wirkt dnn und fade. Gewi auch, hufig werden sie aus bloer Renommiersucht verwendet, denn sie haben jenen gewissen Touch von Wichtigkeit. Aber meist entsprechen sie einem wirklichen Bedarf: dem nach dem allgemeineren Begriff. Wenn Anfang der siebziger Jahre von Medien die Rede war, verstanden die meisten Mdchen und hielten das neue Wort fr eine wichtigtuerische und ganz und gar berflssige Torheit. Reichte es nicht, wie bis dahin Radio, Fernsehen und Zeitung zu sagen oder, schon abstrakt genug, Funk und Presse? Aber wenn nun auch noch Zeitschriften mitgemeint sein sollten? Und Platten? Und Tonkassetten? Und die noch begriffslos sich ankndigenden Neuen Dingens? Es wurde ein Begriff ntig, der das Gemeinsame an dem vielgestaltigen Besonderen zusammenfate, und ein Wort fr diesen Begriff. Medium (Vermittler) ist gar keine ble Wahl gewesen, und diese abstrakte und anfangs nur lcherlich wirkende Vokabel hat sich in wenigen Jahren unentbehrlich gemacht. Unzweifelhaft gibt es zwischen den Menschen viele verschiedene Arten wechselseitigen Handelns, wechselseitiger Einflunahme, Ksse, Predigten, Ohrfeigen. Wo sie alle gemeint sind, wird ein Wort wie Interaktion bentigt. Unzweifelhaft lassen sich Menschen und Tiere untereinander auf sehr verschiedene Weisen Signale, Botschaften, also Informationen (auch eines dieser Abstrakta) zukommen. Ein42
Wort wie Kommunikation umfat den gesamten Informationsaustausch. Sozialisation, Rezeption, Transparenz, Struktur, System, Kulturtechnik, Enkulturation vor allem die Gesellschaftswissenschaften, die das Gemeinsame an sozialen Vorgngen beschreiben mssen, haben viele dieser neuen Abstrakta hervorgebracht und an die Alltagssprache abgegeben. Diese wehrt sich zunchst, weil sie alles Neue unschn findet. Bis zur allgemeinen Akzeptanz eines Wortes wie Akzeptanz braucht es Jahre. Aber wo immer es sich um eine sinnvolle Prgung handelt, ist sie unaufhaltsam. Auch der Hang zur Pedanterie macht die Alltagssprache abstrakter. Der Hauswirt bemerkt eine Durchfeuchtung im Bereich des Treppenhauskopfes, wo der Mieter einfach beanstandet htte, da es oben im Treppenhaus durchregnet. Die Verkehrsnachrichten fordern auf, schienengebundene Fahrzeuge zu benutzen, wo der normale Autofahrer die Bahn nehmen gesagt htte. Die Bank versichert einem, personenbezogene Daten nicht weiterzugeben, wo der normale Kontoinhaber nur darum gebeten htte, da sie persnliche Angaben fr sich behlt. Der Wetterbericht prophezeit, da sich das Niederschlagsgebiet ostwrts verlagert, wo der normale Regenschirmtrger nur gefunden htte, da der Regen nach Osten abzieht. Meistens ist eine Kostenunterdeckung nichts anderes als ein Verlust; aber da es Mglichkeiten gibt, Verluste aufzufangen und eventuell sogar in Gewinne zu verwandeln, etwa durch Subventionen und Steuerprferenzen, ist Kostenunterdeckung ein durchaus sinnvolles Wort und keine bloe Haarspalterei. So schwankt das Neudeutsche zwischen43
einer ganz eklatanten Unschrfe ( also irgendwie luft das ganze hier unheimlich wie soll ich sagen ) und einer berscharfen Przision, als mten auch beilufigste Formulierungen vor Gericht Bestand haben. Teils aus Renommiersucht, teils aus Begriffsverlegenheit werden die Namen einzelner Wissenschaften verwendet, wo hchstens von den mglichen Gegenstnden der zustndigen Wissenschaften die Rede ist. Die Pathologie ist die Lehre von den Krankheiten; aber ein pathologischer Geiz soll nicht etwa der Geiz der Pathologen sein, noch nicht einmal der Geiz als Gegenstand der Pathologie, sondern schlicht ein krankhafter Geiz. Wirtschaft ist Psychologie soll nicht heien, Wirtschaft sei Seelenkunde; es bezieht sich auf Phnomene wie Verstimmung am Markt oder nervse Brsenkurse und hiee eigentlich Wirtschaft ist Psyche. Die Allianz ist psychologisch wehrlos bedeutet schlicht, da sie psychisch wehrlos ist die Psychologie ist dabei in keiner Weise im Spiel. Die Technologie ist eigentlich eine Theorie der Techniken, es sind nicht die Techniken selbst. Unter dem Einflu des Englischen hat das Wort allgemeiner auch die Bedeutung Technik auf wissenschaft licher Grundlage bernommen. Von zukunftsweisenden Technologien zu sprechen, ist dennoch oft bloe Hochstapelei; die Technologie des Dampfbgeleisens ist bestimmt eine; die Maharischi-Technologie des vereinigten Feldes ist vollends Nonsens. Gleichwohl ist die imponierende Technologie nicht mehr aufzuhalten. Eine Resolution von Sexualpolitikern, die eine bestimmte Erklrung der Homosexualitt in Mikredit44
bringen sollte, behauptete: Homosexualitt ist eine anthropologische Kondition. Aber die Anthropologie wurde vllig grundlos ins Spiel gebracht. Der Satz bedeutete nur: Homosexualitt ist ein menschlicher Zustand, kommt unter Menschen vor. In dieser Form freilich htte es nicht nach einer imposanten Erklrung geklungen, sondern nur die Frage provoziert: Na klar, eben aber warum? Die Philosophie taucht immer fter, unter dem Einflu des angloamerikanischen philosophy, in einer uersten Schrumpffassung als so etwas wie ein Leitgedanke auf: Firmen haben Geschftsphilosophien (ein Uhrenhersteller zum Beispiel eine Philosophie von unverwechselbarer Eleganz und sthetischer Raffinesse), Parteien warnen vor der Philosophie des Minuswachstums (was vermutlich heien soll, da sie Schrumpfungsprozesse nicht zum erklrten Ziel erhoben sehen mchten). In diesem Sinne wre der Satz Meine Philosophie lautet: nicht denken, tun! vllig in Ordnung. kologie das ist nichts anderes als ein Spezialgebiet der Biologie, jenes, das Individuen und Arten nicht isoliert untersucht, sondern in ihren wechselseitigen Abhngigkeiten voneinander und von ihrem Lebensraum, dem Biotop: wer wen oder was frit, wer wen als Wirt benutzt, wer sich hinter wem versteckt, welche Kreislufe einzelne Stoffe in der Natur durchmachen. Denn keine Art existiert fr sich, jede ist einbezogen in einen greren Zusammenhang, ihr kosystem. Wird an einer Stelle in ein kosystem eingegriffen, so ndert sich der ganze Zusammenhang. Sofern eine kologische Politik ausdrcklich eine Bercksichtigung, der in45
der Natur bestehenden Vernetzungen verlangt, fhrt sie das Wort ganz zu Recht. Aber ber diese seine gesunde Basis hat sich das Wort kologie inzwischen lngst erhoben. Es ist ein bloes Wortemblem geworden, das eine Gesinnung signalisiert, eine nebulse Heilslehre. kologie ist die Lehre vom Wohnen im Kosmos, auf Erden und in uns selbst, also sprach zum Beispiel der Schweizer Psychologe August E. Hohler: Sie fragt danach, auf welche Weise wir im Kosmos daheim seien sie ist die Religion der Ehrfurcht vor dem Leben. Nach dem einen fragt sie nicht, das andere ist sie nicht. Und wenn sie partout zu einer Pseudoreligion umgeflscht werden soll, wird sie bald gar nichts mehr sein, nur noch eins jener banalen und leeren Schlagwrter, die niemand mehr hren will. Die Verwechslung der Wissenschaften mit ihren Gegenstnden hat wohl darum um sich gegriffen, weil sich diese oft gar nicht anders bezeichnen lassen. Die Soziologie ist natrlich nicht die Gesellschaft, sondern die Lehre von ihr; gesellschaftlich mte folglich sozial und nicht soziologisch heien. Doch sozial hat die zweite Bedeutung frsorglich; wo sie ausgeschlossen werden soll, wird dann gern eben auf soziologisch zurckgegriffen. So mag die soziologische Relevanz der Gesetzesnovelle eine sein, von der die Soziologie keinerlei Kenntnis nimmt. Noch schlechter ergeht es der Physiologie und der Biologie. Den Stoff wechsel kann man nicht anders als einen physiologischen Vorgang nennen, obwohl er kein Vorgang der Physiologie ist und auch wenn er im Zusammenhang der Rede als Gegenstand der Physiologie nicht weiter interessiert; das Adjektiv physisch ist mit einer ande46
ren Bedeutung (krperlich) besetzt. Und die Biologie untersucht biotische Phnomene, aber es brauchte Mut, dieses Adjektiv anstelle des oft unsinnigen biologisch zu verwenden und etwa von dem biotischen und nicht dem biologischen Schlafbedrfnis zu sprechen, das keine Konsequenz der Biologie ist und diese vermutlich auch nicht weiter beschftigt. So gibt es auch fr diesen Sprachgebrauch oft mildernde Umstnde. Die grndlichste und tiefstgreifende Sprachrevision hat in unserer sogenannten Privatsphre stattgefunden. Wie wir von ihr reden, wre noch vor einer Generation nahezu unverstndlich gewesen. Liebe, Liebeskummer, Verhltnis, Geliebte wurden fast vllig ausgemerzt. Wir sprechen, abstrakter und zu nichts verpflichtet, von unsern Beziehungen und Partnern. Wir tigern, dackeln, gurken, dsen in der Gegend umher. Uns fehlt der Durchblick. Gestret von Leistungsdruck, Anpassungszwngen, Konsumterror und der ganzen stressigen oder nervigen Hektik sitzen (hocken) wir auf unseren Jobs (ein Beruf ist etwas anderes, eine Berufung erst recht) und in unseren WGs (Wohngemeinschaften). Wir hngen herum. Der Frust hat uns. Emotional will nichts laufen (was frher ging oder los war, luft heute). Unser Dauerpartner hat wieder Terror gemacht, weil er nicht richtig tickt. Er ist nmlich ein ganz schn beknackter Typ. Die Beziehungs- oder Zweierkiste luft eben nicht mehr richtig. Es fehlen uns Streicheleinheiten. Es fehlen uns Erfolgserlebnisse. Wir werden gelinkt und sind dann geschockt (frher hie es47
schockiert). Wir suchen Selbstbesttigung und Selbstverwirklichung. Wir gehen auf den Ego-Trip und ziehen unsere eigene Sache durch. Wir warten darauf, da jemand kommt und uns antrnt, uns motiviert und wieder Action angesagt ist. Dann werden wir irre kreativ und spontan. Dann geht die Post voll ab. Soviel haben wir immerhin geschnallt, und Sie werden es auch noch raffen, logo. Es ist ein Mischmasch aus Wilhelm Reich, dem Stil sozialpdagogischer Seminare, dem Deutsch der Ratgeberkolumnen in Illustrierten und etlichen Keheiten des aktuellen Jugendjargons. Unsern Groeltern mten wir ihn bersetzen wie eine fremde Sprache. Verglichen mit dem recht forschen Wandel im Wortschatz, gehen die Vernderungen in der Syntax nur zgernd (heute heit es, um es etwas interessanter zu machen, zgerlich) vor sich. Whrend im Lexikon die Neuerungen kommen und gehen, bewegt sich in der Grammatik kaum etwas. Seit einem Jahrtausend entwickelt sich das Deutsche von einer noch relativ synthetischen Sprache, die syntaktische Bezge durch Wortbeugungen ausdrckte, zu einer analytischen, in der diese Bezge in separaten, mglichst unflektierten Wrtern aufgehoben sind. Aber diese Wandlung ist sehr langsam. Schon vor Generationen klagten Sprachkritiker ber den Verlust des Genitivs und des Dativ -e. Verschwunden aber sind sie noch immer nicht. Die Leiden des jungen Werthers wurden zu den Leiden des jungen Werther; heute hieen sie vielleicht die Leiden von Jung48
Werther oder Das Wertherboy-Problem; aber die Leiden des jungen Werther klingt noch vllig modern. Auch das Absterben des Konjunktivs wird seit Generationen betrauert. In der Umgangssprache hat ihn der Einheitskonjunktiv wrde weitgehend abgelst. Auch einige wenig gebruchliche Konjunktive, die mit Umlaut gebildet werden mten, sind mehr oder weniger verschollen: brauchte, schwmme, bke. Aus der indirekten Rede verschwindet der Konjunktiv ganz, ein wirklicher Verlust, denn mit ihm schwindet eine Mglichkeit der Nuancierung und Przisierung. Der Kanzler betonte, da der Haushalt gesichert ist erzeugt den Anschein einer Faktizitt, die der Sprecher gar nicht behaupten will und die von der konjunktivischen Form gesichert sei auch nicht suggeriert wrde. Aber wenn der Konjunktiv auch im Rckzug begriffen ist, so ist er doch noch lange nicht ausgestorben. In der Schriftsprache ist er quicklebendig. Was sich verwischt, ist der Unterschied zwischen Konjunktiv und Irrealis: also zwischen er gebe mir recht (sagte er) und er gbe mir recht (aber es tut es nicht). Zu Grabe getragen worden ist der Konjunktiv aber offenbar viel zu frh. Ein weiterer grammatischer Trend weicht den Gebrauch der Prpositionen auf, nicht eben verwunderlicherweise, denn oft war er willkrlich genug. Wenn es Bezug zu heit, warum mu es dann unbedingt in bezug auf heien? So findet man zuweilen ein Interesse fr (statt an), Vorstellungen ber (statt von), eine Verbundenheit zu (statt mit), einen Protest fr (nicht gegen), eine Gelegenheit auf (statt zu). Man hilft49
auf der Suche (statt bei), und zwar mit Krften (statt nach). Die Fernsehansagerin kndigt ein Bild ber die chinesische Glubigkeit an. Der Nachrichtensprecher bezeichnet eine Befrchtung fr unbegrndet. Der Pressereferent bedauert, da kein Bewutsein ber die Preisproblematik bestehe. Prpositionen werden berall aus frheren Normen entlassen. In den Augen von Generationen von Sprachpflegern die grte Pest, breitet sich der Nominalstil unaufhaltsam weiter aus. Unser Sprachgefhl Ludwig Reiners hat das schon der vorigen Generation berzeugend klargemacht hlt einen Satz fr geglckt, wenn er im Gleichgewicht ist: hier sein Subjekt (ein Nomen), dort sein Prdikat (ein Verb). Denn in seiner Grundform ist der Satz nichts anderes als eine Aussage ber ein Wesen oder Ding: X tut A, Y ist B. Der Nominalstil verstt gegen dieses Gleichgewicht. Seine Verben sind oft nur noch da, um ihn pro forma zu Ende zu bringen. Eine eigene Bedeutung tragen sie kaum mehr. Oft sind sie von der blassesten Art: sein, haben, werden, fhren, durchfhren, vornehmen, erfordern, bereitstellen, beinhalten (das an gehaltene Beine denken lt), Funktionswrter nur noch, die die Syntax verlangt, keine Inhaltswrter mehr. In dieser Feststellung liegt die Antwort Webers auf die Frage nach dem Grund fr die Tatsache der Entstehung des modernen Kapitalismus ausgerechnet in Europa (Adolf Holl): neun Nomina und nur ein Verb (liegt), und was fr ein schwchliches. Zu dieser Informationsflut fhrt vor allem die geradezu manische Fixiertheit auf Produktion, auf Material- und Informationsaussto, wobei der Informationsaussto50
eine Rechtfertigung der Existenz von zahlreichen Behrden, Institutionen und Einzelpersonen ist (Helmut Swoboda): elf Nomina, zwei Verben (fhrt, ist). Die Grndung der Deutschndemkratschn Reblik, des ersten Staates der Arbeiter und Bauern vor nunmehr 35 Jahren, war ein Wendepunkt in der Geschichte des deutschen Volkes und Europas (Erich Honekker): zehn Nomina, ein Hilfsverb (war), und nur zitiert, um zu zeigen, da auch der Sozialismus die Ausbeutung des Verbums durch das Nomen nicht abgeschafft hat. Ein Stil, der das Gleichgewicht wahrt, erscheint uns weniger abweisend, brokratisch, er erscheint uns lockerer, umgnglicher, freier, grozgiger, anschaulicher, menschlicher, und wer sich ein wenig Sprachbewutsein bewahrt hat, wird die endlosen Prpositionalobjektketten mit den eingeklemmten gedrungenen Adjektiven dazwischen tunlichst vermeiden: Der A des B mit C in D Verb den E berm F nach dem G. Doch knnte der Nominalstil nicht dermaen berhandnehmen, htte er nicht auch Vorteile: Er hilft, Nebenstze zu vermeiden. Und Nebenstze suchen wir nicht nur aus Einsparungsgrnden zu vermeiden, sondern vor allem, weil Nebenstze uns die Rahmung aufzwingen, ein Charakteristikum des Deutschen, ber welches schon Mark Twain seinen Spott ausgo. In seinem Feuilleton Die schreckliche deutsche Sprache von 1880 steht zu lesen: Wenn er aber auf der Strae der in Samt und Seide gehllten jetzt sehr ungeniert nach der neusten Mode gekleideten Regierungsrtin begegnet usf. usw. Das ist aus dem Geheimnis der alten Mamsell von Frau Marlitt. Und dieser Satz ist nach dem ge51
schtztesten Muster gebaut. Sie sehen, wie weit das Verbum von der Operationsbasis des Lesers entfernt ist; nun, in einer deutschen Zeitung kommt es erst auf der nchsten Seite; und ich habe gehrt, da man manchmal, wenn man ein oder zwei Spalten lang aufregende Vorbemerkungen und Einschbe aneinandergereiht hat, in Zeitnot gert und andrukken mu, ohne bis zum Verb gelangt zu sein. Das lt den Leser natrlich sehr erschpft und uninformiert zurck. Der Rahmungszwang reit zweiteilige Verbformen auseinander (Mark Twain hat jenem, jenes, dort, dann und dann, aus diesem oder jenem Grund geschrieben; Mark Twain schrieb was, wann, wo, warum? ab; Hat Mark Twain geschrieben?) und rckt in abhngigen Nebenstzen das Verb ganz an den Schlu ( dem Mark Twain was? wo? wann? etc. schrieb). Der Hrer oder Leser mu das uerste Ende solcher Stze abwarten, um ihren Sinn rckwirkend erfassen zu knnen. Der Sprecher hatte am Nachmittag des Tags, an dem die Konferenz zu Ende gehen sollte, wiederholt eine Einschtzung der Probleme, welche der Realitt gerecht wrde hatte was? Vorgetragen? verlangt? verurteilt? Erst jetzt erfhrt es der Hrer. War der Satz lnger als 25 Wrter, ist sein Kurzzeitgedchtnis erschpft, und ihm ist bereits entfallen, wie der Satz begann. Diesem Krampf entgeht, wer knapp und trocken den Nominalstil whlt: Der Sprecher hatte am Konferenzschlunachmittag eine realittsgerechte Problemeinschtzung verlangt. Auch sonst versuchen wir dem Rahmungszwang auszuweichen. Der Zug trifft heute ein um 16 Uhr auf Gleis 4 kann52
schon einmal die Klammerform ablsen, bei der das ein erst am Ende des Satzes erschiene. Aber derlei Verste gegen die Grammatik fallen uns nicht ganz leicht; sie verletzen unser bei der Syntax besonders konservatives Sprachgefhl. So wird eher die zwar unschne, aber erlaubte Flucht in den Nominalstil weiter ihre grotesken Ergebnisse zeitigen, als da sich der Rahmungszwang weiter lockerte. Der Nominalstil ist knapper, sparsamer, gedrngter. Das gibt ihm seine Aura von Wichtigkeit. Die wiederum hat es den Wichtigtuern angetan. Sie benutzen ihn nicht zur Verknappung und Straffung, sondern im Gegenteil zur Auswalzung. Ein simples lesen ist ihnen zu drftig sie nehmen einen Lektrevorgang vor. Sie essen nicht, sie fhren die Nahrungsaufnahme durch. Sie schieen nicht, sie machen von der Schuwaffe Gebrauch. Sie zeigen nicht an, sie bringen zur Anzeige. Das heit, sie nehmen alle Schrecklichkeit des Nominalstils nicht seines einzigen Vorzugs wegen, sondern ohne jede Notwendigkeit in Kauf. Gerade seine Schrecklichkeit hat es ihnen angetan. Mit seiner Steifheit glauben sie sich den Nimbus dessen zuzulegen, der amtlicherseits Verfgungen treffen und Schrecken erregen darf. Die einzige nderung in der Wortstellung, die im Neudeutschen zu verzeichnen ist, hat ebenfalls mit der Abneigung gegen den Klammerzwang zu tun. Seit einigen Jahren wird, zumindest in der Umgangssprache, weil und obwohl oft nicht mehr als unterordnende, sondern als nebenordnende Konjunktion behandelt, in Analogie zu denn: weil ich la mich nicht linken, obwohl ich steh da nicht drauf.53
Entstanden ist das wohl so, da nach dem weil oder obwohl manchmal eine kurze Pause eintrat, in der der Sprecher sein Argument sammelte, und pltzlich war es da und scho als Hauptsatz hervor: Ich konnte nicht kommen, weil weil ich war gestern gar nicht gut drauf. Es ist eine bescheidene und einstweilen auch noch nicht durchweg akzeptierte grammatische Neuerung. Das Schicksal der Pronominaladverbien ist es, immer fter demontiert zu werden, in der Umgangssprache dauernd, aber gelegentlich auch schon in der Schriftsprache. Pronominaladverbien sind die Kopplungen aus Adverbien (da, wo, hier) und Prpositionen, also Wrter wie dafr, womit, hiervon; pronominal heien sie, weil sie im Satz die Stelle eines Nomens vertreten. Statt dagegen bin ich nicht, hrt man immer hufiger da bin ich nicht gegen; und da ist nichts dran, da kann ich mich nicht mit identifizieren, ich fhle mich da verantwortlich fr, da nicht fr! (bedeutend: dafr brauchst du dich nicht zu bedanken), wo er nichts von hat, er hat hier keinen Nachteil durch. Vor allem an dieser Demontage liegt es, wenn manche uerung im Umgangs-Neudeutsch sich ausnimmt wie ein Trmmerfeld voller Wortsplitter: Keine Ahnung, was es da wohl zu zu sagen geben kann. Betrachtet man einen solchen Satz mit zusammengekniffenen Augen, so wie ein Auslnder ihn she, so nimmt es sich geradezu erstaunlich aus, wie lauter Wrterkleinzeug (was es da wohl zu zu), wenn man ihm eine Aufzhlung von Verben anhngt (sagen geben kann), berhaupt zur Hergabe eines Sinns veranlat werden kann.54
Mit da bin ich kein Fan von ironisiert die Umgangssprache ihren Hang zu solchen Demontagen. Die einzige syntaktische Novitt des Neudeutschen, die nicht nur bestimmte einzelne Wrter betrifft, sondern eine vllig neue Art der Satzbildung erschliet, ist das Mickymausdeutsch: chz, sthn, grbel grbel Es erschien in den frhen fnfziger Jahren, und bezeichnenderweise hat es eine Generation gedauert, bis es in die Umgangssprache aufgenommen wurde: Die Erwachsenen, die ihm zuerst begegneten, fanden es grlich und ganz und gar unzulssig, es nistete sich zunchst nur bei den Kindern ein, und erst als diese selber erwachsen waren, wurde es nicht mehr wegzensiert, sondern als eine spaige neue Ausdrucksmglichkeit zugelassen. Anders als die allermeisten sprachlichen Neuerungen, ist es nicht anonymen Ursprungs. Es ist eine Erfindung von Erika Fuchs, 1908 geboren, Fabrikantengattin aus Schwarzenbach in Oberfranken, promovierte Philosophin, die seit 1951 mit viel Sprachwitz DisneyComics ins Deutsche bersetzt. Die amerikanischen Comics sind voll von lautmalerischen worthnlichen Gebilden wie wooom, fwamm, zonggg, blubb, craashh, die die Krachkulisse der Handlung andeuten. Deutsche Schallworte gibt es wenig, und sie sind schnell aufgebraucht: png, bumm, rums, platsch, zack, bimbam, dingdong, piff paff. Erika Fuchs kam auf eine produktive Idee, wie diesem Mangel abzuhelfen ist: Ich habe einfach die Stmme der jeweiligen Verben genommen. Png! neben einer losgehenden Flinte heit: die Flinte macht png oder, allgemeiner, Flinten machen55
png. So ist die Mickymaussprache zu verstehen: als stnde ein macht davor, nicht aber als Imperativ: seufz, schluchz, schnarch, wrg, kotz, schluck, lechz, hechel, klirr, knirsch, schepper, drucks, blubber, schudder chz! heit nicht etwa du sollst chzen und auch nicht ich chze, sondern da mache ich chz! oder da kann man nur chz! machen. Es ist, in den Begriffen der Transformationsgrammatik, die reine Basis, die im Deutschen, das sogar die Infinitive mit einem -en markiert, sonst nirgends in Erscheinung tritt. Sagt einem ein Jugendlicher sterb, so wnscht er einem nicht den Tod an den Hals; vielmehr heit sterb, wrtlich bersetzt, da mache ich sterb, freier bersetzt da falle ich tot um, das haut mich um. Noch sinniger ist der Effekt, wenn die Stammform um eine Vorsilbe erweitert werden kann: umfall oder fall um (da fllt man um), rger grn (da knnte ich mich grn rgern), lach schlapp (da lacht man sich ja schlapp oder krank). Sprache ist durch und durch figrlich. Sie ist durchsetzt von verblassenden und vollends verblaten Metaphern. Verblassen ist eine, Metapher selbst auch (das Wort bedeutet etwa das anderswohin Tragende). Eigentlich sollte man erwarten, da die Sprache der Gegenwart bei ihren Neuprgungen die Bilder aus der alltglichen vertrauten Umwelt bezieht. Aber die groe Mehrheit ihrer Bilder stammt aus entlegenen Zeiten. Zwietracht wird gest, ein Gebiet beakkert, der Beifall geerntet; es werden Klingen gekreuzt und Lanzen eingelegt; man wei, was die Stunde geschlagen hat,56
grbt dem andern eine Grube oder bringt ihn auf Trab. Die Bilderwelt der Gegenwartssprache wirkt, als lebten ihre Sprecher im spten Mittelalter und auf dem Land. Sie sagen: das ist Wasser auf deine Mhle und nicht etwa Benzin in deinen Motor, sie sitzen auf hohem Ro und nicht etwa im niedrigen Sportwagen, es geht ihnen ein Licht auf und nicht etwa eine Lampe an, sie kommen in Harnisch und nicht in Mikrolaune, sie stellen an den Pranger und bringen nicht in die Bild-Zeitung. Die Zahl der Sprachbilder, die aus der heutigen Industriewelt bezogen werden, ist demgegenber gering. Es sind Wrter und Wendungen wie rotieren, dsen, bremsen, Gas geben, ausrasten, durchdrehen, einen Zahn drauf haben, einen Zacken zulegen, nicht schnell genug schalten, ein Rad ab haben. Sie alle kommen allein in der Umgangssprache vor. In der gehobenen Schriftsprache sind nur Metaphern zugelassen, die keinerlei Gegenwartsbezug zu erkennen geben. Welcher Reichtum hier zu holen wre, aber auch wieviel Unvoreingenommenheit, Beobachtungsgabe und laterales, schpferisches Denken ntig sind, der eigenen Umwelt gltige neue Metaphern abzugewinnen, zeigt manches Gedicht von Peter Rhmkorf: Freunde, Fliebandleuchten, Stechuhrasse, berlebensknstler, Hinz und Kunz, somit leg ich meine Hand nochmal an Masse; keine Angst, ich bin ein Mensch von uns.57
Hugo Moser fate die widerstreitenden Grundtendenzen der Gegenwartssprache einmal treffend so zusammen: Neben der Neigung zur Synthese im Wortschatz steht die zur Analyse im Formenbau Neben einem starken Normbewutsein lt sich eine Schwchung des Normempfindens feststellen. Was wohl allgemein gilt, ist eine Tendenz zu abstrakter Ausdrucksweise, zur Vergeistigung der Sprache, der Verluste an lautlicher Vielfalt und an Formenreichtum entsprechen, das Streben nach sprachlicher konomie und die Absicht, die Efficiency der Sprache nicht nur zu erhalten, sondern vor allem auch zu verstrken Eindeutig ist der Zug zu einem Ausgleich sozialer Art in der Richtung zur Hochsprache hin. Stndig mu sich das konservative System der Sprache einer hchst wandelbaren Wirklichkeit anpassen. Es ist wenig sinnvoll, seinen eigenen Sprachgebrauch zum Ideal zu erheben, jede Neuerung an ihm zu messen und zu verwerfen, wenn sie ihm nicht ganz zu entsprechen beliebt (und es ntzte sowieso nichts). Besser machte sich die Sprachkritik an dem Gedachten hinter den sprachlichen Neuerungen zu schaffen, an den oft unbemerkten Bewertungen, Vorentscheidungen, Eitelkeiten, Vertuschungen, Lgen, die manchen Sprachwandel in Gang setzen. Sie mu dann auch nicht nur chronisch griesgrmig und verbittert sein, in jeder Vernderung Sprachverderb und Kulturverfall wittern. Zuweilen darf sie durchaus einen Zugewinn an Genauigkeit, Eleganz und Witz konstatieren. So, ich gehe davon aus, da einiges bergekommen ist und wir jetzt etwas mehr Durchblick haben, um fortan schneller58
zu checken, was Sache ist und sprachmig so luft. Aber so leicht reit Sie nichts vom Hocker, oder? Bestimmt vermissen Sie das und jenes, was an Sprchen heute so angesagt ist. Dann sagen Sie vielleicht: wieder mal alles gelaufen, tote Hose, kannstu vergessen. Kann ich nur hoffen, da das eine oder andere Sie irgendwie betroffen gemacht hat oder gar echt betroffen, weil sonst rechnet sich Ihr Zeitaufwand schlielich nicht. Denn Sie haben bestimmt viel um die Ohren, diesen ganzen nervigen Schei, den man heutzutage durchpowern mu, damit die Knete rberkommt und unterm Strich die Kohle stimmt und, und, und. Da mu man schon was von haben von der stressigen Leserei. Also, Leute, alles klar? Ahalles klahar! Alles paletti!
WRTER EMPORber die Verschnerung der Welt durch sprachliche Manahmen
iner der zugkrftigsten Motoren allen Sprachwandels ist allezeit der Hang zur Verschnerung gewesen, zum Euphemismus (dem Gutsagen). Das Unscheinbare es soll wenigstens sprachlich aufgewertet, das Unangenehme es soll wenigstens sprachlich weniger anstig gemacht werden. Das Ergebnis sind im ersteren Fall die Renommier,im letzteren die Verbrmungs-Euphemismen. Jene protzen, diese kaschieren. Schiere Renommiersucht erhebt die Wohnung zur Residenz und noch die letzte Klitsche zur Zentrale, zum Zentrum, zum Center oder zum Studio. Es gibt daneben aber auch ein Renommieren durch ironische sprachliche Herabsetzung, das etwa besagt: Seht, wir knnen es uns leisten, achtlos mit den begehrten Gtern dieser Welt umzugehen! Die Dame der Schickeria trgt kein Kleid, sondern einen Fummel, einen mit Klunkern. In ihren Kreisen nchtigt man in keinem Luxushotel, sondern in einer schlichten Herberge (oder, im Spiegel-Deutsch, einer Nobelherberge). Man nimmt nicht das Flugzeug, sondern den Flieger. Man fhrt nicht mit dem Auto, sondern allenfalls mit dem Wagen, besser und unscheinbar-auff lliger aber noch mit der Fahrmaschine oder Karosse, vielleicht aber auch schlicht und ergreifend mit dem Turbo, in dem natrlich kein ordinrer Motor steckt, son63
E
dern ein Triebwerk und dazu eine gewaltige Soundmaschine (die nicht der Auspuff ist, sondern das Autoradio im Cockpit). Kein Laden mag sich heute noch Laden nennen. Selbst der kleine Lebensmittelladen an der Straenecke, bei dem der Kunde seine Milchtte selber aus der Khltruhe nehmen darf, ist nichts Geringeres als ein Supermarkt der unvorstellbar groen Mrkte einer. Im Franzsischen wurden die ursprnglichen Supermrkte durch den inflationren Gebrauch des Wortes dermaen abgewertet, da sie sich inzwischen gern Hypermarkt nennen grer wird es dann aber nicht gehen. Laden nennt sich heute nur, was ber jeden Verdacht erhaben ist, ein ordinrer Laden zu sein: der Kinderladen, der Kontaktladen, der Frauenladen, der Kirchenladen, der Kulturladen. Allerdings auch der Bioladen, aber nur um anzuzeigen, da ein Stck naturnahe Vergangenheit hier ihre Kuratoren gefunden hat. Die Klempnerei firmiert als Abfluzentrale (und gibt damit mglicherweise auch gleich noch zu verstehen, da ihre Leute zu den hheren Knsten des Klempnerhandwerks, dem Dichten eines lecken Wasserhahns beispielsweise, auerstande sind, so wie die Raubritter vom ambulanten Schlsselservice mit wahren Schlosserarbeiten zumeist heillos berfordert wren). Die Tankstelle ist ein Servicenter, der Massagesalon ein Gesundheitsstudio, die Motorradwerkstatt ein Mot-in, das Nudelgeschft ein Teig-in, die Zoohandlung ein Cat-Shop, die Schuhmacherei zweifelhafter Qualifikation eine Absatzbar (in der dann wohl ein Hackenbarkeeper seine Gertschaften64
schwingt), die Imbibude ein Grill-Shop, der Blumenladen ein Floristiktreff, ein Bltenatelier oder eine Plant-Farm, die Sportschule ein Body-Top-Studio, vielleicht mit dem Namen Euro-Power, die Werbeagentur ein Kreativ-Service mit Namen art-power (klein geschrieben), der Trdelladen eine Second-Hand-Boutique oder ein Euro-Antik-Market, und niemanden mehr wrde es berraschen, nennte sich der Zeitungs-,Zigaretten- und Lottoladen nebenan ab morgen Informationszentrale Smoke-in. Die Umbenennung des Puffs in Eros-Center erforderte anfangs wohl eine ziemliche Dreistigkeit; indessen, auch sie gelang und machte das Orgasmusstudio, pardon, das Bordell zu einer so durchaus brgerlichen Angelegenheit, wie der Mnzwaschsalon eine ist. Die Nutte bietet sich als Hostess oder Model feil. Da die Fachhandlung fr Pornographie Sex-Boutique heit, ist dann nur konsequent. Besonders veredelungsbedrftig sind Friseure. Sie nennen sich heute: Coiffeur, Hairstylist, Frisurenstudio, Hair-Station, Haar-Kunst-Atelier, Hair-Inn, Hair-Dresser, Beauty Shop, Barber Shop oder, gleichsam in Anfhrungszeichen, nun gerade Frisr. Das nmlich klingt dann nostalgisch und bringt den empfehlenden Hauch von Anno dazumal. Sprachliche Befrderung wurde auch anderen Berufen zuteil. Natrlich waren es die weniger angesehenen Berufe, die brigen hatten keine Beschnigung ntig, und es war und ist das schlechte Gewissen der Sprachgemeinschaft, die dieser Vokabelkosmetik Vorschub leistete. Die Raumpflegerin als Bezeichnung fr die Putzfrau war zunchst scherz65
haft gemeint, so wie in den zwanziger Jahren schon die Besenartistin und nach dem Krieg dann die Parkettmasseuse oder Fubodenkosmetikerin oder Staubsaugerpilotin, aber da ihre Dienstleistung sehr begehrt war und die Herrschaften ihre herrschaft lichen Allren gerne herunterspielten, wurde aus dem Witz Ernst, und als eine Art Gratisprmie erhielt sie die Namensaufbesserung. Mllmnner wurden zu Mllwerkern, Straenfeger zu Betriebshelfern (der Straenreinigung) oder allenfalls zu Straenreinigern (der Besengardist des neunzehnten Jahrhunderts hrte sich denn wohl doch zu ironisch an). Sobald fr einen Beruf strengere Qualifikationsnachweise gefordert wurden, wurde er auch sprachlich emporgehoben. So wurde schon vor langem aus dem Lehrer der Studienrat, aus dem Pferdeknecht der Pferdewirt, aus dem Waldarbeiter der Forstwirt, aus dem Bauern der Landwirt (der heute wiederum zum Agrarunternehmer wird). Der Vertreter erhob sich zum Reprsentanten, der Reisevertreter zum Reprsentanten im Auendienst, der Medikamentenvertreter zum Pharmareferenten. Der Verkufer, der etwas Besseres sein soll, ist Verkaufsberater. Die wissenschaft lich ausgebildete Hauswirtschafterin nennt sich umstndlichst Oecotrophologin (zu deutsch: die des Haushalts und der Ernhrung Kundige), die Hebamme fungiert als Entbindungspflegerin, der Schneider versucht es als Anzugspezialist, und der Kellner soll zum Restaurantfachmann befrdert werden. Der Azubi aber hat es gegen den Lehrling schwer; es handicapt ihn wohl seine amtliche Knstlichkeit.66
Schopenhauer hat das Ntige dazu angemerkt: wenn eine an sich unverfngliche Benennung diskretitabel wird; so liegt das nicht an der Benennung, sondern am Benannten, und da wird die neue bald das Schicksal der alten haben. Es ist mit ganzen Klassen wie mit dem einzelnen: wenn einer seinen Namen ndert, so kommt es daher, da er den frheren nicht mehr mit Ehren tragen kann; aber er bleibt derselbe und wird dem neuen Namen nicht mehr Ehre machen als dem alten. In der Sprache unseres Jahrhunderts: All diesen kostbaren Erhhungen steht die Abwertung bevor, bis sie wieder ebenso gewhnlich sind wie die Wrter, die sie einst ersetzt haben. Die knstliche Wurstpelle bleibt auch als Natursaitling Kunstpelle. Die Luft verpestung wird nicht harmloser, kommt sie als Schadstoffemission daher. Da sich hinter der Dnnsureverklappung die Vergiftung des Meeres durch Salzsure versteckt, hat sich herumgesprochen. Wenn sich die Atommllbeseitigung Entsorgung nennt, verheit sie sozusagen ein Ende aller Sorgen. Wo findet sie statt? Im Entsorgungspark, der scheints eine Art Garten Eden ist, in dem der Mensch aller Sorgen ledig wird. Die Gegenkultur der Autonomen denn ihre Euphemismen hat auch die Protestszene ruft zu undurchsichtigen Aktionen oder zu Spaziergngen auf, wo an Randale gedacht ist. Schwer nachzuvollziehen, da sich noch vor wenigen Jahren zwei Welten daran schieden, ob man jene terroristische Formation Baader-Meinhof-Bande oder Baader-Meinhof-Gruppe nannte alle Progressiven bestanden auf Grup67
pe. Durchgesetzt aber hat sich der anspruchsvolle Name, den sie sich in leichter Verkennung der Tatsachen selber gegeben hatte: RAF, Rote Armee Fraktion. In der weniger kmpferisch eingestellten Alternativszene werben nicht nur liebe WGs um liebe Mibewohner; ein alternativer Tour-Service (im Klartext ein billiges Reisebro) wirbt auch fr Fahrten in seinem lieben Bus, der ein alter ist. Die Polizei wiederum bringt den Kompressionsgriff zur Anwendung (in dem sich das immerhin Unangenehme des Wrgegriffs zu einer bloen technischen Manipulation verflchtigen soll). Haftanstalten fr politische Gegner heien (anderswo) Psychiatrie. Die Organisationen zur Bekmpfung staatsfeindlicher Umtriebe nennen sich Staatssicherheitsdienst und Verfassungsschutz. Der Abbau von Schutzrechten der Arbeitnehmer heit Aufbrechen struktureller Verkrustungen. Einen Krieg in Mitteleuropa gibt es nicht mehr; hier kommt es allenfalls zum Verteidigungsfall. Der Kriegsminister ist heute ein Verteidigungsminister. Arbeiter wurden zu Arbeitnehmern (immer nimmt der Pbel etwas), die bei Rezessionen (frher Wirtschaftskrisen) nicht entlassen, sondern freigesetzt werden. Wer eine politisch fleckige Weste hat, gesteht, wenn es denn gar nicht anders geht, hchstens ein, er sei in Ereignisse verstrickt gewesen (und zwar in gewisse, bedauerliche oder tragische). Einen besonders unverfrorenen Verbrmungs-Euphemismus hat sich die Polizei einfallen lassen, als sie den gezielten Todesschu in finalen Rettungsschu umtaufte, so als msse es geradezu eine Ehre und Freude sein, von dem getroffen zu werden.68
Niemand will heute mehr alt genannt werden. Der sieht ganz schn alt aus heit: Er steht ziemlich unvorteilhaft da. Da die Leute aber trotzdem weiter alt werden, mute wenigstens ein jugendfrisches Wort her. So wurden die Alten zu Senioren (ein Musterexemplar von neuer Verschleierungs-,ja Verhhnungssprache, bemerkt dazu Eckhard Henscheids satirisches Wrterbuch Dummdeutsch, und: Freilich, die Zeiten werden hrter jetzt auch fr 40 5ojhrige. Die kursieren neuerdings auch schon als Vorsenioren aber vielleicht gelingt es ja noch rechtzeitig, sie systemgerecht in Sptjunioren zu verwandeln). Entsprechend werden Altersheime zu Seniorenzentren, Aufenthaltsrume fr Greise zu Seniorentreffs. Auslndische Arbeiter wurden als Gastarbeiter wenigstens sprachlich willkommen geheien, als wren sie liebe Gste. Dnne wurden zu Zierlichen, Dicke zu Vollschlanken (und darin macht sich vor allem das attraktive schlank breit, nur durch ein schonendes Wort fr sein Gegenteil voll milde eingeschrnkt). Krppel, Kranke, Blinde, Taube, Lahme verschwanden, nicht aus dem Straenbild, wohl aber aus der Sprache: Sie wurden teils erst zu Schwerbeschdigten, spter alle zu (Geh-, Seh-, Hr-)Behinderten. Irre wurden zu Geisteskranken und dann zu psychisch Gestrten, das Irrenhaus wurde zur psychiatrischen Klinik. Arm soll niemand mehr genannt werden. Aus den Armen wurden die Sozialschwachen, aus dem Armenrecht die Prozekostenhilfe, aus der Armenkasse die Sozialfrsorge. Die Hilfsschule avancierte konsequent zur Sonderschule. Klar, da auch die Dummen abgeschafft wurden;69
heute gibt es hchstens noch Lernschwache oder Lernbehinderte, und auch die nur ungern. berall wimmelt es von Partnern. Frher waren das Kompagnons in einer Firma. Es handelte sich da also um eine Beziehung von gleich zu gleich, eingegangen zur Verfolgung geschft licher Interessen. In den Privatbereich drang das Wort ein, als eine gemeinsame Bezeichnung fr Ehegatte und Dauerfreund(in) bentigt wurde, die vorurteilslos beide Lebensformen gleichermaen guthie: Sabine lebt mit ihrem Partner zusammen. Um die Konfrontation von Unternehmern und Untergebenen sprachlich abzumildern, wurden beide pathetisch zu Sozialpartnern ernannt. Der Autohndler, bei dem ich nicht kaufe, beze