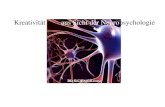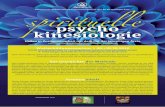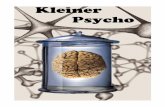Zur Frage der Schmerzempfindlichkeit des Feten: Neuro-, psycho- und verhaltensphysiologische Aspekte
-
Upload
manfred-zimmermann -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
Transcript of Zur Frage der Schmerzempfindlichkeit des Feten: Neuro-, psycho- und verhaltensphysiologische Aspekte

II
UBF, RSICH TEN DerSchmerz " Konzepte, Klinik und Forschung Z ~
Zur Frage der Schmerzempfindlichkeit des Feten: Neuro-, psycho- und verhaltensphysiologische Aspekte* M. Zimmermann Abteilung fiir Physiologic des Zentralnervensystems, II. Physiologisches Institut der Universitfit Heidelberg
Pain in the fetus" neurobiological, psychophysiological and behavioral aspects
Abstract. Until a short time ago, the view prevailed worldwide that children were less sensitive to pain than adults, and such operations as circumcision were per- formed in babies without adequate anesthesia or analge- sia. This view is now considered a misconception, as psychophysiological and behavioral studies show that even neonates have a well-functioning nociceptive sys- tem. Nociception generally refers to the neural and sen- sory aspects of pain, which do not necessarily include conscious experience. There is no discontinuity in the development of the nervous system during birth, and therefore it can be concluded that the fetus is also re- sponsive to noxious stimuli. The question arises as to the stage of ontogeny of the human at which nociceptive behavior begins. Literature on the fetal nervous system reveals that the first signs of somatosensory system func- tion occur at week 7 of gestation and at week 22 the synaptic connection from the nervous periphery to the somatosensory cortex is becoming established. During this period, motor behavior matures, from stereotyped reflexes to spontaneously generated complex motor pat- terns reminiscent of the repertory of voluntary move- ment. From week 22 onward the electroencephalogram (EEG) shows increasingly more varied patterns, and sleep-wake states can be discerned after week 30 of gesta- tion. Somatosensory evoked cortical potentials have been recorded from gestational week 28 onward. Sub- stance P, a neuropeptide associated with pain in the adult nervous System, is present in the fetal spinal cord as early as week 12 of gestation, while the antinocicep- tive opioid peptide enkephalin does not appear until week 24. From week 15 onward, opioid peptides such as fl-endorphin appear in the pituitary; their release be- comes sensitive to environmental stimuli from about
* Herrn Prof. Dr. med. Dr. med. h.c. Hans Schaefer, em. Professor fiir Physiologic an der Universitat Heidelberg, in Verehrung und Bewunderung zum 85. Geburtstag gewidmet.
week 20 onward, which can be considered the onset ot pituitary stress responses. In particular, parturition and abortion induce the release of opioid peptides. Studies of conditioned behavior show that the fetus has the abili- ty to learn. It has been hypothesized that the fetus and neonate possess a procedural memory, which is not transferred to the language-based memory of later phases of life. Learning and memory are the most essen- tial elements for the construct of "consciousness." Therefore, a primitive type or level of consciousness might exist in the fetus. Thus, a considerable range of sensorimotor function, including memory, develops dur- ing fetal life. Anatomical, physiological and behavioral data suggest that the nociceptive system is included in this development. Although we cannot be sure at present whether the fetus consciously experiences pain, beyond the protective nociceptive behavioral responses, anesthe- sia should be used for invasive procedures to protect the fetus and its nervous system.
Zusammenfassung. Nach einer bis vor kurzem weltweit verbreiteten Einstellung sind Kinder weniger schmerz- empfindlich als Erwachsene, und (kleinere) chirurgische Eingriffe wie Zirkumzision wurden bei Neugeborenen vielfach ohne ausreichende Aniisthesie durchgefiihrt. Diese Sichtweise wird heute zunehmend angezweifelt, da psychophysiologische und verhaltensphysiologische Be- obachtungen zeigen, dab bereits Neugeborene ein gu~ funktionierendes nozizeptives System besitzen. Nozizep- tion bezieht sich auf neuronale und sensorische Aspekte des Schmerzes, die nicht notwendigerweise eine bewuBte Wahrnehmung einschlieBen. In der Entwicklung des~ Nervensystems bedeutet die Geburt keine Diskontinui~ t~it, und deshalb kann geschlossen werden, dab auch de~ Fet bereits Reaktionen auf noxische Reize zeigt. In di~ sem Beitrag soil der Frage nachgegangen werden, w a ~ in der Ontogenese des Menschen das nozizeptive Verha!i
Aus der Literatur fiber die fetale Entwick] ten beginnt. lung des Nervensystems ist ersichtlich, dab die erste~ Funktionszeichen des somatosensorischen Systems 'Ji~ der 7. Schwangerschaftswoche auftreten, und dab ab dd
Der Schmerz (1991) 5:122-130 �9 Springer-Verlag 19911

gbersichten 123
22. SSW die nerv6se Peripherie fiber Synapsen zum so- matosensorischen Kortex durchgeschaltet wird. W/ih- rend dieser Zeitspanne reift auch die Motorik von stereo- typen Reflexen zu spontan entstehenden komplexen mo- torischen Mustern, die einem Repertoire von Willkiirbe- wegungen sp/iterer Lebensphasen /ihneln. Das Elektro- enzephalogramm (EEG) zeigt ab der 22. SSW zuneh- mend differenzierte Muster, und ab der 30. SSW k6nnen Schlaf-Wach-Zustfinde unterschieden werden. Bereits in der 28. SSW wurden somatosensorische evozierte Kor- texpotentiale abgeleitet. Das Neuropeptid Substanz P, das im erwachsenen Nervensystem als Neurotransmitter ffir Schmerzinformationen gilt, kann im Rfickenmark des Feten ab der 12. SSW nachgewiesen werden; erst in der 24. SSW erscheint der antinozizeptive Transmitter Enkephalin im Rfickenmark. Etwa ab der 15. SSW las- sen sich Opioide wie fl-Endorphin in der Hypophyse nachweisen; ihre Freisetzung reagiert ab der 20. SSW auf externe Reize, was als Beginn der hypophys/iren StreBantwort gelten kann. Insbesondere ffihren Geburt und Abort zu starken Ausschiittungen von Opioiden. Untersuchungen zur Konditionierbarkeit des Verhaltens bei Frfihgeborenen zeigt, daB bereits der Fet lernf/ihig ist. Fet und Neonatus sollen ein ,,prozedurales Ged/icht- his" haben, das nicht in das sprachorientierte Ged/icht- his der sp/iteren Lebensphasen fibertragen wird. Lernen und Ged/ichtnis sind wichtige Bestandteile des Kon- strukts ,,BewuBtsein". Eine primitive Form (oder Vor- stufe) von BewuBtsein beim Fet erscheint m6glich. W/ih- rend der Fetalzeit entwickelt sich somit ein umfang- reiches Repertoire sensorisch-motorischer Funktionen, einschlieBlich Ged/ichtnis. Anatomische, physiologische und verhaltensm/iBige Beobachtungen machen deutlich, dab das nozizeptive System bei dieser Entwicklung ein- geschlossen ist. Obwohl wir nicht sicher sein k6nnen, ob der Fet bereits Schmerzen ,,erlebt" - fiber die protek- tiven Verhaltensreaktionen hinaus -, sollten bei invasi- ven Eingriffen an/isthesiologische MaBnahmen zum Schutz des Feten und seines Nervensystems ergriffen werden.
In den letzten Jahren hat sich in der wissenschaftlichen und praktischen Bewertung des Schmerzes bei Kindern ein dramatischer Wandel vollzogen, der sich in mehreren internationalen Kongressen und zahlreichen Ver6ffentli- chungen niedergeschlagen hat (z.B. McGrath u. Unruh 1987 [45]; Pothmann 1988a, b [55, 56]; Ross and Ross 1988 [62]; Zimmermann 1989a, b [76, 77]; Weinmann 1989 [69]; Berde 1990 [7]; Fitzgerald 1990 [19]). War es bisher weltweit fiblich, Kinder als vermindert sehmerzempfindlich anzusehen und die Reaktionen Neugeborener als subkortikal (und damit unbewuBt) ab- laufende Reflexe einzustufen (z.B. Levy 1960 [41]; Mers- key 1970 [47]), wird heute anerkannt, daB Kinder 8ehmerzen wahrnehmen und erleben k6nnen, mit einer Auspr/igung entspreehend ihrer Entwicklungsstufe (z.B. Lavigne et al. 1986 [38]; Craig et al. 1988 [13]; Gaffney 1988 [22]). Daraus wird die Forderung hergeleitet, bei Kindern einschlieBlich des Neugeborenen An/isthesie
und Analgesie mit den gleichen MaBst/iben wie bei Er- wachsenen durchzuffihren [39, 63]. Schmerzen bei Neu- geborenen und Kleinkindern k6nnen nur fiber das Ver- halten und physiologische Parameter erfaBt werden, mit fortschreitender Entwicklung des Kindes treten kogni- tive und sprachliche AuBerungen hinzu [44, 51, 52, 55, 62, 67].
Auch dem Neugeborenen wird die F/ihigkeit, Schmerzen zu erleben, zugesprochen [1, 54, 59], und neuerdings wird diese F/ihigkeit aueh in die prfinatale Lebenszeit extrapo- liert - Schmerz beim Fetus, ist das eine begrfindete Hy- pothese? Die Antwort auf diese Frage ist vor allem rele- vant im Hinblick auf schmerztherapeutische und an/is- thesiologische MaBnahmen beim Schwangerschaftsab- bruch, bei der fetalen Chirurgie und bei Eingriffen an Frfihgeborenen. In einer kritischen und kreativen f0ber- sichtsarbeit haben Anand und Hickey [2] die Frage der Schmerzempfindlichkeit des Feten diskutiert und grund- s/itzlich mit einem Ja beantwortet. Inhalt und Aussage dieser Arbeit sind auch in einer deutschsprachigen Arti- kelserie wiedergegeben [10, 11]. In der nachfolgenden Obersicht sollen physiologische und verhaltensbiolo- gische Fakten und Argumente zur Frage der Schmerz- empfindlichkeit von Neonat und Fetus gesichtet und be- wertet werden. Die Ergebnisse sind als Synopsis in Abb. 1 zusammengestellt.
Schmerz und Nozizeption
Schmerz wurde lange Zeit ausschlieglich als ein Phfino- men der subjektiven Erlebniswelt angesehen, das Be- wuBtsein als eine notwendige Bedingung vor~iussetzt. Nach dieser heute als fiberholt anzusehenden Sichtweise kann es also keinen Schmerz geben, wenn das BewuBt- sein ausgeschaltet ist (Narkose) oder wenn es noch nicht bzw. nur auf einer niedrigen Stufe entwickelt ist (Tier, Neonat). Bei dieser Auffassung werden die Kriterien des Schmerzes ganz an der bewugten, verbal mitteilbaren, also kognitiven Erlebniswelt des erwachsenen Menschen orientiert.
Verhaltenskunde und Physiologie haben sich von diesem eingeschr/inkten Schmerzbegriff gel6st [14, 74]. Bei ge- nauer Betrachtung der Reaktionen und Verhaltenswei- sen yon Mensch und Tier in den obengenannt~n Phasen ,,ohne Bewugtsein" wird n/imlich deutlich, dab wir bei und nach Reizen, die der vollbewuBte Mensch als schmerzhaft erlebt, offensichtlich auch unbewugte k6r- perliche Schmerzreaktionen feststellen k6nnen. Es han- delt sich dabei vor allem um Ablfiufe bei der Motorik (z.B. Wegziehreflex) und bei den vegetativen Reaktionen (z.B. Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg, ACTH-Aus- schiittung), die auch als Begleiterscheinungen oder als integrale Bestandteile des normalen, bewuBten Schmerz- geschehens beim Erwachsenen auftreten k6nnen.
Um solche k6rperlichen Reaktionen ohne Berficksichti- gung der Frage des Bewugtseins wissenschaftlich ange- hen zu k6nnen, hat die Physiologie das Konzept der

124 Obersichten
0 5 10 15 20 25 30 35 40 (45)
I Innervation Haut, Schteimh~iute
Sinneskorpusket Haut
I Synapsen im Tr|geminuskern]
Spinate Neurone I Spinate Substanz P
Sp|nate Synapsen [ ] Nyetin spinate Bahnen
Endorphin Hypophyse [ [ [ [ St ressakt i vi erung Hypophyse
Cortexneurone, Rigration I 5-HT-Rezeptoren Cortex
Cortexneurone, Dendri tenbi tdung Thatamocorticale Synapsen
I EEG-Huster
Evozierte Cortexpotent late Sch [ af -Wach- EEG
Rot. Reakt. auf Ltppenreiz Not. Reakt. auf Handreiz
Rot. Reakt. auf K6rperreiz
Schwangerschaftswoche (post conceptionem)
Differenziertes Bevegungsrepertoire lntegr, mot.-veget. Reaktionen
Reaktion auf akust. Reiz Fetate "StreS"-Reaktion bei akust. Reizung
Konditionierte Reaktionen bei Fr~hgeborenen
J [ ~ Nozizeptive Reaktionen des I
Neonaten
0 5 10 15 20 25
Abb. 1. Entwicklung des somatosensorischen Systems beim menschlichen Feten. Synopsis der Ergebnisse verschiedener histolo- gischer, physiologischer und verhaltensbiologischer Untersuchun- gen. Der Anfang der Schriftzeile gibt den zeitlichen Beginn der
,,Nozizeption" eingefiihrt [74]. Die Nozizeption schliel3t vor allem auch viele Funktionen des Nervensystems ein, also die Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung von potentiell sch~idlichen Reizen und Zust~inden (noxische Reize, Noxen). Solche Reize ffihren zur Erregung senso- rischer Nervenendigungen, den Nozizeptoren, die als ,,Schadensfriihmelder" in allen Organen enthalten sind. Ihre Erregungen werden fiber donne Fasersysteme, die A-delta- und C-Fasern, zum Riickenmark geleitet, dort auf spinale sensorische und motorische Neurone umge- schaltet und in motorische und sympathische Reflexe integriert. Ober aufsteigende Bahnen wird die neurale Information aus den Nozizeptoren zum Hirnstamm und Endhirn weitergeleitet. Durch Aktivierung von Hypo- thalamus und Hypophyse wird eine neurohumorale Stregreaktion ausgel6st.
30 35 40 (45) Schwangerschaftswoche (post concept.) jeweiligen Entwicklungsstufe an. Die Zeitangabe ,,Schwanger- schaftswoche" bezieht sich auf ,,post conceptionen" (p.c.), Litera- turangaben wurden, soweit m6glich, auf ,,p.c." umgerechnet.
Diese neuralen Vorgiinge im peripheren und zentralen Nervensystem funktionieren fast alle auch unter Nar- kose. Mit steigender Narkosetiefe werden die zentralner- v6sen Erregungen abgeschwficht, ebenso die moto- rischen, sympathischen und neurohumoralen Reaktio- nen. Zu den auch unter Narkose funktionierenden Vor- g/ingen geh6rt zum Beispiel die Aktivierung von komple- xen Hemmungsvorg/ingen im Zentralnervensystem also die ,,k6rpereigene Schmerzabwehr", die biochemisch vor allem mit den endogenen Opioiden assoziiert ist. Bereits bei einer geringen Narkosetiefe wird die bewuBte Schmerzwahrnehmung ausgeschaltet. Die peripheren sensorischen Erregungsmechanismen bleiben dagegen auch durch tiefe Narkose weitgehend unbeeinfluBt. An diesen Beispielen wird deutlich, dab viele physiologische Teilaspekte des Schmerzgeschehens unter Ausklamme-

Obersichten 12 5
rung des psychischen Zustandes ,,Bewul3tsein" analy- siert werden k6nnen. Weil also die meisten Vorgfinge im Nervensystem bei noxischen Reizen also auch unter Narkose normal oder nur wenig verfindert ablaufen, konnte der grSl3te Teil unseres physiologischen, pharma- kologischen und biochemischen Wissens fiber den Schmerz an narkotisierten Versuchstieren erarbeitet wer- den.
Es ist sinnvoll, zunfichst unter dem oben eingeffihrten Ansatz der Nozizeption auch die Situation des Neonaten und des Feten im Hinblick auf ein neurophysiologisches Schmerzsystem anzugehen. Erst nach Kl~irung dieser Grundfrage k6nnen wir uns der Frage zuwenden, ob bzw. ab wann wir auch vom ,,Schmerzerlebnis" sprechen kfnnen, das ein (wie immer verstandenes oder geartetes) Bewul3tsein voraussetzt.
Motorisches Verhalten des Feten
Bei extrauterinen menschlichen Feten (bei Aborten oder Frfihgeburten) k6nnen mit Tastreizen bereits nach 7 Wochen Gestationsdauer von den Lippen, und nach 14 Wochen praktisch vonder gesamten Hautoberfliiche, motorische Reflexe ausgel6st werden [30, 31, 33, 34, 48]. Mit zunehmender Gestationsdauer werden aul3er einfa- chen Wegziehreflexen auch Greifreflexe, kardiovasku- lfire Reflexe, Schluckreflexe, Weg- und Hinwendungen beobachtet, die eine Integration oberhalb der spinalen Ebene erfordern [27, 43]. Die M6glichkeit der Konditio- nierung (als Ausdruck von Lernvorgfingen) bei somato- sensorischen Reizen wurde von Humphrey [33] unter- sucht. Nach ihren Ergebnissen funktioniert bereits bei Frfihgeborenen, 3 Monate vor der Zeit, eine Konditio- nierung mit Pawlow-Paradigma (Reizpaarung). Auf der Basis solcher Beobachtungen ist eine Reflextheorie feta- ler Bewegungen entstanden, bei der also die Bewegungen iiberwiegend als Reflexantworten bei sensorischen Rei- zen angesehen wurden.
Mit der Ultraschalldiagnostik haben Prechtl und Mitar- beiter systematisch die Entwicklung yon spontanen Be- wegungsmustern beim Feten in seiner normalen, unge- st6rten Umgebung untersucht [16, 58]. Mit dieser Me- thode konnten sie in der 7. Woche erste Bewegungen erkennen. Ab der 9. Woche war bereits eine Klassifika- tion der Bewegungen in Bewegungsmuster m6glich, wie sie auch ffir die postnatalen Bewegungen verwandt wer- den konnte. Ab der 14. Woche zeigt der Fetus ein diffe- renziertes Bewegungsrepertoire, zu dem komplexe Ab- l~iufe wie z.B. Saugen, Schlucken, Gfihnen und Daumen- lutschen geh6ren. Aus diesen Arbeiten entstand die neue Sichtweise, dab viele Bewegungen des Feten auf endogen irn Zentralnervensystem entstehenden und offensichtlich spontan, ohne erkennbare fiul3ere Reize, ablaufenden motorischen Programmen beruhen.
Durch Kombination von Herzfrequenzmessungen mit sonographischen Registrierungen der K6rper-, Atem- und Augenbewegungen konnten integrierte neuromoto- risch-vegetative Reaktionen erfal3t werden [3]. Ab der
24. Woche wurden so passive und aktive Phasen unter- schieden. Nach akustischer Reizung (Klingel, Larynxvi- brator) wurden kurz- und langdauernde fetale Reaktio- nen beobachtet [4]. Vor der 26. Woche reagierten nur etwa 20% der Feten, nach der 26. Woche stieg der Anteil der reagierenden Feten auf fiber 50%. Die langdauernde Verhaltensantwort wird auch als fetale Strel3reaktion ge- deutet [4, 66] und vereinzelt mit ,,fetal well-being" inter~ pretiert [60]. Diese Interpretation kann jedoch angezwei- felt werden, da auch bei hypoxischen Feten lang- dauernde Reaktionen der Herzfrequenz nach akustischer Stimulation beobachtet wurden. Sonographische Mes- sungen k6nnen auch zur pr/inatalen Diagnose neurolo- gischer Schfiden verwendet werden [5, 72].
Die Ffihigkeit des Feten zur Konditionierung, an Frfih- geborenen nachgewiesen [33], lfil3t es als naheliegend er- scheinen, dab Lernvorg/inge fihnlicher Art auch stfindig in utero unter natfirlichen Bedingungen ablaufen. Unter- suchungen zum Erkennen der mfitterlichen Stimme ge-
�9 ben hierffir Evidenz [15]. Das Neugeborene konnte dutch eine geeignete Apparatur, die fiber die Saugt/itig- keit des Kindes beeinflul3t wurde, wfihlen, ob es ein Ton- band mit der Stimme der Mutter oder einer anderen Stimme h6ren wollte. Die mfitterliche Stimme wurde da- bei signifikant bevorzugt. Dieses Ergebnis wurde von den Autoren als intrauterines Lernen interpretiert. Da die Stimme der Mutter w/ihrend der Monate der Schwangerschaft besonders hfiufig vorkommt, wird sie am besten und nachhaltigsten gelernt und kann auch postnatal vom Kind als besonders vertraute akustische Umgebung erkannt werden. Offensichtlich verarbeitet der Fetus bereits auditorische Sinnesinformationen zu langfristigen Gedfichtnisinhalten, was von den Autoren auch im Sinne einer vorgeburtlichen Pr/igung gedeutet wurde. Prfigungen und Lernvorgfinge wurden auch im Bereich der oft hochdifferenzierten artspezifischen Laute und Ges~nge bei der fetalen Entwicklung yon V6geln beschrieben.
Aus diesen Beispielen lfil3t sich folgern, dab das beob- achtbare motorische Verhalten des Feten weit mehr ist als stereotypes reflexhaftes Geschehen, dab hier vielmehr komplexe Bewegungsgestalten ablaufen, wie wir sie aus der postnatalen Zeit kennen, und dab bereits Lernvor- gfinge die Spuren der ersten Sinneserfahrungen festhal- ten. Diese quantitativen Ergebnisse von Verhaltensreak- tionen best/itigen auch die Kontinuitfit des Verhaltens zwischen den pr~i- und postnatalen Lebensabschnitten, die yon Prechtl seit langem postuliert und dokumentiert wurde [57].
Neurale Entwicklung des somatosensorischen und nozizeptiven Systems
Die Literatur fiber die embryonale Entwicklung der Sin- nesorgane bei S/iugern einschliel31ich des Menschen wurde 1975 von Bradley u. Mistretta in einem ()ber- sichtsartikel [9] dargestellt. Die Autoren belegen ein- drucksvoll, dab sich alle Sinnesorgane sowohl anato-

126 .Obersichter~
misch als auch funktionell bereits pr~inatal weitgehend entwickeln, einschliel31ieh der zugeordneten zentralner- v6sen sensorischen Zentren. Die Darstellung schlieBt zwar das somatosensorische System ein, Angaben fiber die Entwicklung des Schmerzsystems fehlen jedoch v611ig - offensichtlieh gab es bis 1975 hierzu noeh keine Unter- suchungen.
Eine vergleichende Darstellung der pr/inatalen verhal- tensbiologischen Entwicklung kommt zu dem Ergebnis, dab bei der Geburt besonders die Systeme der Verhal- tenssteuerung gut funktionsfiihig sind, die Oberlebens- wert haben [27]. Nach diesem Prinzip mfil3te das Sehmerzsystem bei allen Spezies bereits vor der Geburt gut ausgebildet werden. Der Vergleieh von 9 Spezies von der Maus zum Mensehen zeigt, dab das AusmaB der pr/inatalen Reifung der Sinnessysteme mit der Gesta- tionsdauer zunimmt. Beim Menschen ist somit wegen der langen Gestationszeit die Entwicklung der senso- rischen Systeme bei der Geburt besonders weir fortge- sehritten [24].
W~ihrend der Ontogenese des Nervensystems entsteht bei der Somatosensorik zuerst das entwicklungsgeschicht- lich alte System der nichtmyelinisierten (C-)Fasern, erst danach bilden sich die myelinisierten (A-)Fasern. Gerade die C-Fasern sind bei nozizeptiven Systemen wesentliche Funktionsbestandteile [70], die A-Fasern geh6ren dage- gen vor allem zum Tastsinn. Das neuronale nozizeptive System sollte also in seiner Entwicklung dem Tastsinn keineswegs nachfolgen, sondern diesem eher vorauseilen. Deshalb ist die Vermutung naheliegend, dab ein pr/inatal funktionierendes somatosensorisches System bei allen S/~ugerspezies auch nozizeptive Funktionen einschlieBt, vor allem bei solchen mit langer Gestationsdauer.
Neuere tierexperimentelle Untersuchungen geben di- rekte Hinweise ffir eine prfi- und perinatale Entwicklung des nozizeptiven Systems. So konnten bei Rattenem- bryonen polymodale kutane Nozizeptoren (Schmerzsen- soren) funktionell identifiziert werden, die unter den af- ferenten nichtmyelinisierten (C-)Fasern etwa 20% aus- machen [18]. Histologische Studien des somatosenso- rischen Systems der Ratte zeigen, dab in der Substantia gelatinosa des Riickenmarks, der ersten zentralnerv6sen Umschaltstation ffir nozizeptive Informationen, ein gro- 13er Teil der propriospinalen synaptischen Verbindungen bereits prfinatal gebildet werden [6]. Auch im Hirnstamm und im thalamokortikalen System der Somatosensorik (einschliel31ich Trigeminussystem) werden die synap- tischen Verbindungen bei der Ratte schon vor der Ge- burt ausgebildet.
Histochemisch wurde bei der Ratte im Embryonalsta- dium der bei der Schmerzverarbeitung mitwirkende Neurotransmitter Substanz P in den Spinalganglienneu- ronen und in der Substantia gelatinosa des Rfieken- marks identifiziert, gleichzeitig treten auch andere Neu- ropeptide (z.B. Somatostatin, Neurotensin) und Opioide (Ekephalin) im Rfickenmark auf [65]. Bei neonatalen Ratten wurden neurophysiologisch in den sensorischen Neuronen des Rfickenmarks postsynaptische Antworten auf elektrische Nervenreize abgeleitet [18].
Noxische mechanische und thermische Hautreize ffihr- ten bei neugeborenen Ratten zu Wegziehreflexen, die wesentlich st/irker waren als bei erwachsenen Tieren [2% wahrseheinlieh wegen der sich erst sp/iter entwickelnden Hemmungsmechanismen. Folgt man dem von Gottlieb [24] formulierten Prinzip, dab bei l~ngerer Gestations- dauer die Entwicklung von Nervensystem und Verhalten in immer frfihere Phasen des intrauterinen Lebens ver- legt erscheinen, dann kann man annehmen, dab diese peripheren und spinalen nozizeptiven Mechanismen beim menschlichen Feten schon sehr frfih auftreten, rela- tiv zur Dauer der Schwangerschaft.
Tats/ichlich erreichen beim menschlichen Feten die aus- wachsenden Neuriten der Spinalganglien, die die senso- rische Hautinnervation bilden, sp/itestens nach 9 Wo- chen das Epithel, nach 12 Wochen zeigen sieh histolo- gisch Ver~inderungen der Epithelzellen unter dem tro- phischen EinfluB der Innervation [9]. Die weitere Ent- wicklung der sensorischen Innervation der Haut und Schleimh/iute ist in der 20. Woche abgeschlossen. Die Pacini-K6rperchen, funktionell als schnell adaptierende Mechanorezeptoren identifiziert, bilden sich wfihrend diesem Zeitabschnitt, Merkelzellen und Meissner-Kor- puskel, die ebenfalls zu den Mechanorezeptoren des Tastsinns geh6ren, sind nach 16-24 Wochen vorhanden.
Die ffir die spinale Verarbeitung und Weiterleitung von schmerzbezogenen Informationen notwendigen synap- tischen Verbindungen im Rfickenmark des menschlichen Feten bilden sich zwischen der 13. und 30. Woche, im spinalen Trigeminuskern der Medulla oblongata bereits ab der 7. Woche [32]. Ab der 13. Woche bilden sich auch die vom Rfickenmark zum Gehirn (Thalamus) wei- terffihrenden Leitungsbahnen aus [50, 73]. In der GroB- hirnrinde ist in der 20. Woche die Endzahl v o n 1 0 9 Ner- venzellen erreicht, die synaptisehen Verbindungen mit den sensorischen Fasern aus dem Thalamus bilden sich ab der 22. Woche.
Die Funktionsreifung des Gehirns kann auch fiber das EEG verfolgt werden. Ab der 20. Woche erscheinen nacheinander immer variablere und differenziertere EEG-Muster. In der 30. Woche zeigen sich im EEG Schlaf- und Wachphasen, durch externe Reize kann eine Schlafphase beendet werden. Evozierte Kortexpotentiale k6nnen ab der 29. Woche registriert werden, auditorisch evozierte Potentiale sind mit der Magnetelektroenzepha- lographie spfitestens ab der 34. Woche nachweisbar [8]. Bei Lammfeten konnten bereits nach 55 Tagen (yon 150 Tagen Gestationsdauer) durch kleine Tastreize Kortex- potentiale (aueh von einzelnen Neuronen) evoziert wer- den, deren Latenz mit zunehmender Gestation kfirzer wurde. Die Ausl6sbarkeit von evozierten Kortexpoten- tialen zeigt an, ab wann das betreffende Sinnessystem funktionell zur Hirnrinde durchgeschaltet ist.
Auch histochemische Untersuchungen belegen die frfihe Entwicklung des nozizeptiven Systems beim menschli- chen Feten. Substanz P, ein Neuropeptid, das in den sensorischen Neuronen der Spinalganglien enthalten ist und als Neurotransmitter ffir nozizeptive Informationen im Rfickenmark angesehen wird, erscheint zwischen der

Obersichten
12. und 16. Woche [12]. Auch die Rezeptoren filr Sub- stanz P im Hinterhorn des Rilckenmarks bilden sich w~ihrend dieses Entwicklungsabschnittes.
Eine andere Gruppe von Peptiden, die Opioide, haben zahlreiche Funktionen, zu denen auch antinozizeptive und schmerzd~impfende Wirkungen auf das Nervensy- stem geh6ren, z.B. unter Stre6situationen (Strel3-Anal- gesie). Das inhibitorische Opioid Enkephalin konnte in der 24. Schwangerschaftswoche im Rilckenmark nachge- wiesen werden, es entsteht also deutlich sp~iter als Sub- stanz P [12a, 43 a]. Ober die Entwicklung der Opioidre- zeptoren im Zentralnervensystem des menschlichen Fe- ten ist wenig bekannt. In der Hypophyse sind voll funk- tionsf'~ihige Endorphin-haltige Zellen spfitestens ab der 15. Woche entwickelt, ab der 20. Schwangerschafts- woche nimmt die Konzentration von #-Endorphin und fl-Lipotropin sprunghaft zu [17c]. Ebenfalls ab der 20. Woche reagiert die Hypophyse auf endokrine (z. B. ACTH) und ~iu6ere Stimuli mit einer verst~irkten Syn- these und Freisetzung von #-Endorphin und anderen Opioidpeptiden [17 b, 17 d, 23 b]. Auch unter der Geburt und bei anderen offensichtlichen Strel3reaktionen kommt es zur Freisetzung von #-Endorphin (s. unten).
Noz&eptives Verhalten bei Feten und Neonaten
Wie bereits in der Einleitung er6rtert, wurde bisher bei der Frage des Schmerzes dem bewul3ten Wahrnehmen eine entscheidende und unabdingbare Rolle zugewiesen; da Bewul3tsein beim Feten (und Neonaten) fehle, so die g~ingige Ansicht, wurde die Frage der Schmerzempfind- lichkeit bisher kaum gestellt. Dabei wurde jedoch zu sehr auf das Kriterium ,,sprachlich orientiertes BewuBtsein und Denken" abgehoben.
Was k6nnen wir, zun/ichst unter Ausklammerung der schwierigen Frage des BewuBtseins, beim Neonaten und Feten an nozizeptivem Verhalten erkennen ? Hierzu mils- sen wir die Entwicklung des durch somatische Reize aus- gel6sten Verhaltens untersuchen. Bei extrauterinen menschlichen Feten (Aborte, Frilhgeburte) konnten bei Reizversuchen mit Tasthaaren bereits nach 7 Wochen Gestationsdauer von den Lippen motorische Reflexe ausgel6st werden, nach 10,5 Wochen von der Hand und nach 14 Wochen praktisch vonder gesamten Hautober- fl~iche. Damit beginnt bei der pr~inatalen Entwicklung der Sinnesorgane als erstes die sensorische Funktion der Haut [24].
Untersuchungen und Beobachtungen an Feten mit dem Ziel, nozizeptive Reaktionen zu erkennen, sind noch sehr sp/irlich. Anekdotische Schilderungen berichten, dab ab der 16. Schwangerschaftswoche bei der Amniozentese Reflex- und Stregreaktionen auftreten k6nnen: Der Fe- tus soil mit heftigen Bewegungen und Anstieg der Herz- frequenz auf die Berilhrung durch die eindringende Na- del reagieren [68]. Auch die Curarisierung zur fetalen Chirurgie scheint filr den Feten aversiv zu sein: Beim
127
Nachlassen der L/ihmung treten heftige Bewegungen auf [711.
Bei den sonographischen Untersuchungen der integrier- ten neuromotorisch-vegetativen Reaktionen ([3], siehe oben ,, Motorisches Verhalten des Feten") wurden etwa ab der 25. Woche auch langdauernde Verhaltensantwor- ten registriert, deren H/iufigkeit mit der Gestationsdauer zunahm. Sie werden als ,g, ul3erung einer St6rung des ,,fe- tal well-being", also als eine Art fetale Stre6reaktion, gedeutet [4, 60, 66].
Ober eindeutig nozizeptive Reaktionen liegen neuer- dings umfangreiche Ver6ffentlichungen von Untersu- chungen an Neugeborenen vor, bei denen chirurgische Eingriffe ohne Narkose ausgefilhrt wurden. So wurden z.B. bei diagnostischen Hautpenetrationen und Zirkum- zisionen motorische Fluchtreaktionen, mimische AuBe- rungen, Vokalisationen [26, 36, 40, 52, 53], Blutdruck- und Herzfrequenzanstiege und humorale StreBreaktio- nen [1, 2, 59] beobachtet oder quantitativ untersucht, die sich nicht wesentlich von nozizeptiven Reaktionen anderer S/iugetiere [17, 75] oder gr6Berer Kinder [13, 37] unterscheiden.
Bei Neonaten k6nnen durch invasive Eingriffe auch langdauernde Verhaltens/inderungen ausgel6st werden (Obersichten siehe [2, 10, 11, 71]). So konnte z.B. noch 22 h nach einer Beschneidung ein ver/inderter Verhal- tenszustand erfagt werden. Nach peripheren traumati- sierenden Eingriffen lieg sich eine langdauernde Hyper- sensitivit/it der Reaktionen auf nachfolgende Reize nachweisen, durch eine Lokalan/isthesie vor dem Trauma konnte diese Hypersensitivit/it v611ig vermieden werden [21].
Die langfristigen Verhaltens/inderungen nach Zirkumzi- sion werden als Beweis filr Ged/ichtnis gewertet, das auch aus vielen anderen Beobachtungen am Neugebore- nen geschlossen werden kann [49]. Auch die weiter oben er6rterten Konditionierungsversuche an Frilhgeborenen und das Erkennen der miltterlichen Stimme sprechen dafilr, dab bereits beim Feten Lernvorg/inge ablaufen und Ged/ichtnisinhalte gebildet werden.
Unter der Geburt und anderen StreBsituationen des Fe- tus und des Neonaten kommt es zu einer starken Aus- schilttung der Hypophysenhormone, darunter auch der Opioide wie #-Endorphin, ins Plasma [17a], die Werte normalisieren sich erst innerhalb von 5 Tagen wieder. Diese Aktivierung unterbleibt weitgehend bei der Ent- bindung durch Kaiserschnitt. Auch spontane und Pro- staglandin-induzierte Aborte fiihren bereits ab der 20. Schwangerschaftswoche zur erh6hten Aktivierung der hypophys/iren Opioide [23 a, 17d]. Auch bei chirur- gischen Eingriffen bei Frilh- und Neugeborenen werden #-Endorphin und andere hormonale Strel3faktoren ver- st/irkt freigesetzt, was durch ausreichende An/isthesie vermieden werden kann (Anand und Aynsley-Green 1988). Durch eine ausreichende An/isthesie werden auch die Risiken postoperativer Komplikationen herabge- setzt. Deshalb wird heute vermehrt gefordert, auch bei Frilh- und Neugeborenen immer fiir eine konsequent

128. Obersichten
durchgeffihrte An/isthesie und Analgesie zu sorgen (Le- nard 1986; Meier 1987; Brosch und Rust 1989a, b).
Als Indikator ffir StreB und Schmerz bei Neonaten und Kleinkindern wird auch das (emotionale) palmare Schwitzen gewertet, es kann durch noxische Reize ausge- 16st werden [23, 28]. Es entwickelt sich bereits pr/inatal, bei Frfihgeborenen sieht man es etwa ab der 37. Schwan- gerschaftswoche.
Schmerz beim Feten ?
Die bisher vorherrschende Interpretation der vorstehend er6rterten verh/iltnism/iBigen nozizeptiven Zeichen war, daB es sich dabei doch eher um Reflexe handelt, ver- gleichbar etwa zur Situation beim Tier, denen kein seeli- sches Erleben zugrunde liegen wfirde. Dieser Auffassung wird zunehmend widersprochen, sowohl im Hinblick auf die Tiere als auch der Neugeborenen.
Die neuere Tierverhaltensforschung gibt n/imlich Evi- denz, dab BewuBtsein keine grunds/itzliche Sonderstel- lung beim Menschen hat, daB vielmehr eine evolution/ire Kontinuit/it besteht [25]. BewuBtsein ist demnach spe- ziesspezifisch, es kann fiber das Verhalten erschlossen werden. So k6nnen Affen sich selbst im Spiegel erken- nen, alle S/iugetiere k6nnen lernen, angenehme und unangenehme Situationen vorauszusehen (und sich dar- an zu erinnern).
Mit dem Ansatz des Vermeidungslernens kann man bei Tieren negative (aversive) emotionale Zust/inde und die Erinnerungen daran fiber Verhaltens/iuBerungen abfra- gen. Dieser Ansatz bietet eine M6glichkeit, fiber die au- tomatischen reflektorischen Abwehrbewegungen hinaus- gehend auch Leiden und Schmerz als F/ihigkeiten des Tieres zu operationalisieren [14]. Die Ffihigkeit, sich an frfihere Erlebnisse zu erinnern, ist eine entscheidende Voraussetzung fiir jede Art von BewuBtsein. Die Ge- d/ichtnisinhalte k6nnen bei Tieren zur Handlungsmoti- vation, zur Ausl6sung von Angstverhalten und zum Er- scheinungsbild der gelernten Hilflosigkeit [64] aktiviert werden.
Das neue Tierschutzgesetzt unterstellt deshalb, dab Tiere unter Schmerz und StreB leiden k6nnen und verbietet die Zuffigung solcher Reize und Situationen grunds/itz- lich. Eine begrenzte Schmerzzuffigung kann bei Ver- suchstieren unter strenger ethischer Abw/igung geneh- migt werden, wenn z.B. hochrangige Fragen der biome- dizinischen Forschung anders nicht gel6st werden k6n- nen. Ohne Narkose dfirfen keine Eingriffe durchgeffihrt werden, jedoch ist das schmerzlose T6ten (pl6tzlich, ohne eine Ankiindigung ffir das Tier, oder durch Ein- schl/ifern) auch ohne Narkose erlaubt.
Obertr/igt man die Annahme einer (nichtsprachlichen) Form yon BewuBtsein bei Tieren auch auf den menschli- chen Neonaten und Feten, dann mfiBte man auch hier davon ausgehen, dab die F/ihigkeit zur Ged/ichtnisbil- dung eine entscheidende Entwicklungsstufe ist, bei der man Schmerzerleben annehmen, oder zumindest nicht
ausschlieBen kann. In den vorausgehenden Abschnitten wurden Ergebnisse er6rtert, die bereits beim Feten ver- haltensm/iBige Konditionierungen und langdauernde Anderungen physiologischer Parameter und des Verhal- tens nach Eingriffen zeigen. Damit ist die Voraussetzung der Ged/ichtnisbildung sp/itestens ab der 28. Gestations- woche erfiillt. Das offensichtliche Problem, dab wir uns in der sp/iteren Lebensphase an solche frfihkindlichen Erlebnisse nicht mehr erinnern k6nnen, wird durch die Annahme eines entwicklungsgeschichtlich alten ,,proce- dural memory" umgangen, das ffir das BewuBtsein des Erwachsenen nicht zug/inglich ist [42].
Eine/ihnliche Argumentation ergibt sich auch aus einer entwicklungsneurologischen Sichtweise. In der perinata- len Periode ist die Plastizit/it des Zentralnervensystems besonders groB, deshalb miiBten von starken Erregungs- und StreBsituationen langfristig pr/igende, wenn nicht gar sch/idliche Einwirkungen auf Nervensystem und Verhaltensentwicklung ausgehen k6nnen [2, 61]. Eine fihnliche Theorie wurde auch in den psychodynamischen Konzepten der Psychopathologie aufgestellt, bei der die Entstehung psychiatrischer Krankheiten frfihkindlichen Schmerzerlebnissen zugeschrieben wird [29, 35]. Beide Hypothesen sind letzten Endes Varianten der Grundan- nahme, daB im fetalen und neonatalen Lebensabschnitt langfristige Engramme im Zentralnervensystem gebildet werden.
Die Frage nach dem Schmerzerlebnis des Feten und Neonaten kann man letztlich jedoch nicht schlfissig be- antworten. Aus der Vielzahl von Verhaltensbeobachtun- gen 1/iBt sich jedoch nicht ausschliel3en, dab bereits beim Feten Schmerzerlebnisse bestehen k6nnen, wenn man die gleiche Logik der Argumentation wie bei den Fragen nach BewuBtsein und Schmerzerleben des Tieres zul/iBt (siehe oben). Nachfolgend sind die Argumente zusam- mengestellt, die mir bei Oberlegungen zu dieser Frage wichtig erscheinen:
1. Die histologischen und physiologischen Voraussetzun- gen des Nervensystems fiir die Durchschaltung nozizep- tiver Reize bis zum Kortex sind ab der 22. Gestationswo- che erffillt.
2. Die Ausschfittung yon Opioiden aus der Hypophyse durch externe Reizsituationen (Geburt, Abort) setzt etwa ab der 20. Schwangrschaftswoche ein, sie wird als neuroendokrine StreBantwort angesehen.
3. Die Reichhaltigkeit und Reife des Bewegungsrepertoi- res beim Feten zeigt, daB das ganze Nervensystem bei der Bewegungssteuerung mitwirkt und daB es sich dabei nicht um einfache, stereotype Reflexe handelt.
4. Beim Neugeborenen ist die F/ihigkeit zur Ausbildung von nozizeptiven Reaktionen und StreBreaktionen phy- siologisch und verhaltensm/iBig gesichert. Wegen der Kontinuit/it der Funktion des Nervensystems vor und nach der Geburt kann gefolgert werden, dab die nozizep- tiven Reaktionen bereits pr/inatal reifen. Die wenigen verffigbaren Beobachtungen und Untersuchungen an Frfihgeborenen stfitzen diese Annahme.

Obersichten .129
5. Das neuromotor ische-vegeta t ive Verha l tensmuster des Fe ten bei Vibra t ionsre izen zeigt ab der 26. Woche zunehmend eine l angdaue rnde Verha l t enskomponen te , die als Anzeichen fiir gest6rtes W o h l b e f i n d e n (oder als Strel3reaktion) gedeutet werden kann .
6. Beim Feten k a n n m a n sp~itestens ab der 28. Gesta- t ionswoche Lernvorgfinge fiber Kond i t ion ie rungsve r su - che nachweisen. D a m i t ist eine u n a b d i n g b a r e Vorausset- zung • r eine (einfache) Ar t des BewuBtseins erffillt.
Diese Obersichtsarbeit beruht auf Recherchen, die der Autor als Mitglied der Kommission ,,Fetale Analgesic" des Wissenschaft- lichen Beirats der Bundesfirztekammer unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Bachmann, Miinster, get~tigt hat. Den Kommissionsmitglie- dern und Frau Priv.-Doz. Dr. Birgit Arabin, Berlin, m6chte ich fiir viele Anregungen danken.
Literatur I. Anand KJS, Aynsley-Green A (1988) Does the newborn infant
require potent anesthesia during surgery? Answers from a ran- domized trial of halothane anesthesia. In: Dubner R, Gebhart GF, Bond MR (eds) Proceedings of the Vth World Congress on Pain. Pain research and clinical management, vol 3. Elsevier, Amsterdam, pp 329-335
2. Anand KJS, Hickey PR (1987) Pairr a~cl its effects in the human neonate and fetus. N Engl J Med 317:1321-1329
3. Arabin B, Riedewald S, Zacbarias C, Saling E (1988) Quantita- tive analysis of fetal behavioural patterns with realtime sono- graphy and the actocardiograph. Gynecol Obstet Invest 26:211-218
4. Arabin B, Zacharias C, Riedewald S, Bliicher U, Saling E (1989) Analyse fetaler Reaktionen auf akustische Reize mit un- terschiedlicher Registriertecb~. Geburtshilfe Frauenheilkd 49: 653-657
5. Arduini D, Rizzo G, Caforio L, Mancuso S (1987) Develop- ment of bebavioural states in hydrocephalic fetuses. Fetal Ther 2:135-143
6.. Beal JA, Bicknell HR (1985), Development and maturation of neurons in the substantia geIatinosa (SG) of the rat spinal cord. Irt: Rowe M, Willis WD (eds) Development, organization, and processing in somatosensory pathways. Liss, New York, pp 23- 30
7. Berde CB (1990), The treatment of pain in children. (Plenarvor- trag beim VIth World Congress on Pain, Adelaide 1990) Pain [Suppt]; 5: $3-$4
8. Blum T, Saling E, Bauer R (1985) First magnetoencephalo- graphic recordings of the brain activity of a human fetus. Brit J Obstet Gynaecol 92:1224-1229
9. Bradley RM, Mistretta CM (1975) Fetal sensory receptors. Physiol Rev 55: 352-382
10. Brosch R, Rust M (1989a) Schmerz und Anfisthesie bei Friih- und Neugel~enen~ Teil, I. An~sthesiologie I~ntensivmed 10: 287-291
11. Brosch R, Rust M (1989b) Schmerz und An/isthesie bei Friih- und Neugeborenen, Teil II. Aniisthesiologie Intensivmed 11 "334--338
12. Charnay Y, Paulin C, Chayvi~ll~ JiA, Dubois PM (1983) Distri- bution of substance P-like immunoreactivity in the spinal cord and dorsal root ganglia of the huma~ foetus and. infant. Neu- roscience 10:41-55
12a. Charnay Y, Paulin C, Dray F, Du, bois PM (1984) Distribution of enkephalin in human foetus and iafaat spinal cord: an ira, munofluorescence study. J Co,m~p, Neur01 223:415-423
13. Craig KD, Grnnau RVE, Branson, Sl~f (I988) Age-related as- pects of pain: pain in children. In: Dubner P, Gebhart GF, Bond MR (eds) Proceedings of the Vth World Congress on Pain. Pain research and clinical management, vol 3. Elsevier, Amsterdam, pp 317-328
14. Dawkins MS (1982) Leiden und Wohlbefinden bei Tieren. Ulmer, Stuttgart
15. De Casper A J, Fifer WP (1980) Of human bonding: newborns prefer their mothers' voices. Science 208 : 1174-1176
16. De Vries JIP, Visser GHA, Prechtl HFR (1986) Fetal behaviour in early pregnancy. Eur Obstet Gynecol Reprod Biol 21 : 271-276
17. Duncan IJH, Molony V (eds) (1986) Assessing pain in farm animals. Commission of the European Communities, Luxem- bourg
17a. Facchinetti F, Lanzani A, Genazzani AR (1989a) Fetal inter- mediate lobe is stimulated by parturition. Am J Obstet Gynecol 161 : 1267-1270
17b. Facchinetti F, Storchi AR, Furani S, Radi D, Genazzani AR (1988) Pituitary changes of desacetyl-a-melanocyte-stimu- lating hormone throughout development. Biol Neonate 54:86-92
17c. Facchinetti F, Storchi AR, Petraglia F, Garuti G, Genazzani AR (1987) Ontogeny of pituitary fl-endorphin and related pep- tides in the human embryo and fetus. Am J Obstet Gynecol 156:735-739
17d. Facchinetti F, Storchi AR, Petraglia F, Genazzani AR (1989b) Presence of acetylated and shortened endorphins in human fetal pituitary gland. Pediatric Research 25:652-655
18. Fitzgerald M (1987) The functional development of C fibers and their central connections. In: Schmidt RF, Schaible H-G, Vahle-Hinz C (eds) Fine afferent nerve fibers and pain. VCH, Weinheim, pp 53-65
19. Fitzgerald M (1990) The developmental biology of pain. (Pte- narvortrag beim VIth World Congress on Pain, Adelaide 1990) Pain [Suppl] 5: S1
20. Fitzgerald M, Gibson S (1984) The postnatal physiological and neurochemical development of peripheral sensory C fibers. Neuroscience 13 : 933-944
21. Fitzgerald M, Millard C, Mclntosh N (1989) Cutaneous hyper- sensitivity following peripheral tissue damage in newborn in- fants and its reversal with topical anaesthesia. Pain 39:31-36
22. Gaffney A (1988) How children describe pain: a study of words and analogies used by 5-14-year-olds. In: Dubner R, Gebhart GF, Bond MR (eds). Proceedings of the Vth World Congress on Pain. Pain Research and Clinical Management, vol, 3. Else- vier, Amsterdam, pp 341-347
23. Gedaly-Duff V (1989) Palmar sweat index use with children in pain research. J Ped Nursing 4: 3 8
23a. Genazzani AR, Petraglia F, Di Meo G, Santoro V, Facchi- netti F, Segre A (1987) Prostaglandin-induced mid-pregnancy abortion increases plasma and amniotic fluid levels offl-lipotro- pin and ]~-endorphin. Gynecol Obstet Invest 24: 23-27
23b. Gibbs DM, Stewart RD, Liu JH, Vale W, Rivier J, Yen SSC (1982) Effects of synthetic corticotropin-releasing factor and dopamine on the release of immunoreactive fl-endorphin/ p-lipotropin and melanocyte-stimulating hormone from hu- man fetal pituitaries in vitro. J Clin Endocrinol Metab 55: 1149-1152
24. Gottlieb G (1976)Conceptions of prenatal development: be- havioral embryology. Psychol Rev 83 : 215-234
25. Griffin DR (1981) The question of animal awareness - evolu- tionary continuity of mental experience. Kaufmann, Los Altos
26. Grunau RVE, Craig KD (1987) Pain expression in neonates: facial action and cry. Pain 28 : 395-410
27. Hall WG, Oppenheim RW (1987) Developmental psychobiol- ogy: prenatal, perinatal and early postnatal aspects of behavior- al development. Ann Rev Psychol 38: 91-128
28. Harpin VA, Rutte~ N (1982) Development of emotional sweat- ing in the newborn-infant. Arch Dis Child 57:691-695
29. Holden EM (1977) Primal pathophysiology. J Psychosom Res 21 : 341-350
30. Hooker D (1952) The prenatal origin of behaviour. Kansas University Press, Lawrence
31. Hooker D (1954) Early human fetal behavior with a prelimi- nary note on double simultaneous fetal stimulation. In: Hooker

130 ....... O b e r s i c h t e r ~
D, Hare CC (eds) Res Publ Ass Nerv Ment Dis, vol 33. Wil- liams & Wilkins, Baltimore, pp 98-113
32. Humphrey T (1953) The trigeminal nerve in relation to early human fetal activity. In: Hooker D, Hare CC (eds) Res Publ Ass Nerv Ment Dis, vol 33. Williams & Wilkins, Baltimore, pp 127-154
33. Humphrey T (1964) Some correlations between the appearance of human fetal reflexes and the development of the nervous system. Progr Brain Res 4:93-135
34. Humphrey T (1978) Function of the nervous system during prenatal life. In: Stave U (ed) Perinatal Physiology. Plenum, New York, pp 651-683
35. Janov A (1971) The anatomy of mental illness. Putnam's Sons, New York
35. Janov A (1984) Friihe Prfigungen. Fischer, Frankfurt 36. Johnston CC, O'Shaughnessy D (1988) Acoustical attributes
of infant pain cries: discriminating features. In: Dubner R, Gebhart GF, Bond MR (eds) Proceedings of the Vth World Congress on Pain. Pain research and clinical management, vol 3. Elsevier, Amsterdam, pp 336-340
37. Johnston CC, Strada ME (1986) Acute pain response in infants: a multidimensional description. Pain 24:373-382
38. Lavigne JV, Schulein M J, Hahn YS (1986) Psychological as- pects of painful medical conditions in children, I : Developmen- tal aspects and assessment. Pain 27:133 146
39. Lenard HG (1986) An~sthesie bei Friih- und Neugeborenen. Dtsch Med Wochenschr 111 : 1747-1749
40. Levine JD, Gordon NC (1982) Pain in prelingual children and its evaluation by pain-induced vocalization. Pain 14: 85-93
41. Levy DM (1960) The infant's earliest memory of inoculation: a contribution to public health procedures. J Gen Psychol 96: 3-46
42. Lipsitt LP (1977) The study of sensory and learning processes of the newborn. Clin Perinatol 4:163-186
43. Lux Flanagan G (1963) Die ersten neun Monate des Lebens. Rowohlt, Hamburg
43 a. Marti E, Gibson S J, Polak JM, Facer P, Springall DR, Van Aswega G, Aitchison M, Koltzenburg M (1987) Ontogeny of peptide and amino-containing neurons in motor, sensory and autonomic regions of rat and human spinal cord. J Comp Neu- rol 266: 332-359
44. McGrath PA (1987) An assessment of children's pain: a review of behavioral, physiological and direct scaling techniques. Pain 31 : 147-176
45. McGrath P, Unruh A (1987) Chronic Pain in Childhood. Pain research and clinical management, vol 1. Elsevier, Amsterdam
46. Meier H (Hrsg) (1987) Analgesie bei Kindern. Indikationen, Applikationsformen, Nebenwirkungen. Perimed, Erlangen
47. Merskey H (1970) On the development of pain. Headache 10:116-123
48. Minkowski M (1928) Neurobiologische Studien am menschli- chen Foetus. Handbuch Biol Arbeitsmeth Abt V, Teil 5B, S 511-618
49. Moscovitch M (1984) Infant memory: its relation to normal and pathological memory in humans and other animals. Ple- num, New York
50. Okado N (1981) Onset of synapse formation in the human spinal cord. J Comp Neurol 201:211-219
51. Owens ME (1984a) Pain in infancy: conceptual and methodo- logical issues. Pain 20: 213-230
52. Owens ME, Todt EH (1984b) Pain in infancy: neonatal reac- tion to a heel lance. Pain 20: 77-86
53. Peiper A (1926) Untersuchungen fiber die Reaktionszeit im S/iuglingsalter. II. Reaktionszeit auf Schmerzreiz. Monatsschr Kinderheilkd 32: 42-53
54. Porter F (1989) Pain in the newborn. Clin Perinatol 16:549-564 55. Pothmann R (Hrsg) (1988 a) Chronische Schmerzen im Kindes-
alter. Diagnose und Therapie. Hippokrates, Stuttgart
56. Pothmann R (1988b) Schmerz und Schmerztherapie bei Kin- dern. Der Schmerz 2: 3-8
57. Prechtl HFR (ed) (1984) Continuity of neural functions from prenatal to postnatal life. Spastics Internat Med Publ, London
58. Prechtl HFR (1989) Fetal behavior. In: Hill A, Volpe JJ (eds) Fetal neurology, Raven, New York, pp 1-16
59. Purcell-Jones G, Dormon F, Sumner E (1988) Paediatrics an- aesthetist's perceptions of neonatal and infant pain. Pain 33:181-187
60. Querleu D, Boutteville C, Renard X, Crepin G (1985) Sound stimulation test and fetal wellbeing. Am J Obstet Gynecol 151:829
61. Richards MPM, Bernal JF, Brackbill Y (1976) Early behaviour- al differences: gender or circumcision? Dev Psychobiol 9: 89-95
62. Ross DM, Ross SA (1988) Childhood pain. Current issues re- search and management. Urban & Schwarzenberg, Baltimore Mfinchen Wien
63. Schechter NL, Allen DA, Hansen K (1986) Status of pediatric pain control: comparison of hospital analgesic usage in children and adults. Pediatrics 77 : 11-15
64. Seligman MEP (1975) Helplessness: on depression, develop- ment and death. Freeman, San Francisco
65. Senba E, Shiosaka S, Hara Y, Inagaki S, Sakanaka M, Takat- suki K, Kawai Y, Tohyama M (1982) Ontogeny of the peptid- ergic system in the rat spinal cord: immunohistochemical analy- sis. J Comp Neurol 208:54-66
66. Serafini P, Lindsay M, Nagey D, Pupkin M, Tsang P, Cren- shaw C (1984) Antepartum fetal heart rate response to sound stimulation: the acoustic stimulation test. Am J Obstet Gynecol 48:41
67. ThompsOn KL, Varni JW (1986) Developmental cognitive-bio- behavioral approach to pediatric pain assessment. Pain 25 ~. 283-296
68. Vatman HB, Pearson JF (1980) What the fetus feels? Brit Med J 1980:233-234
65. Weinmann H-M (Hrsg) (1989) Aktuelle Neuropfidiatrie 1988. Springer, Berlin Heidelberg New York
70. Willis WD (1985) The pain system. Karger, Basel 71. Wisser J, Hepp H (1989) Zur Schmerzempfindlichkeit des unge-
borenen Kindes. Schriftenreihe der Juristenvereinigung Lebens- recht e.V., Nr. 6, S. 55-69
72. Wisser J, Krone S, Strowitzki T, Knitza R (1989) Ultraschall- embryologie des Zentralnervensystems als Grundlage der Sono- pathologie. Arch Gynecol Obstet 245, 69-70
73. Wozniak W, O'Rahilly R, Olszewka R (1980) The fine structure of the spinal cord in human embryos and early fetuses. J Hirn- forsch 21 : 101-124
74. Zimmermann M (1984) Physiologie von Nozizeption und Schmerz. In: Zimmermann M, Handwerker HO (Hrg) Schmerz. Konzepte .und ~irztliches Handeln. Springer, Berlin Heidelberg New York, S 1-43
75. Zimmermann M (1985) Behavioral investigations of pain in animals. In: Wegner RM (ed) 2nd European Symposium on Poultry Welfare. Federal Agricultural Research Centre, Braunschweig-V61kenrode, pp 28-38
76. Zimmermann M (1989a) Neuro- und Psychophysiologie des Schmerzes bei Kindern. Der Schmerz 3 : 73-79
77. Zimmermann M (1989b) Neurofisiologia e psicofisiologia del dolore nei bambini. In: Tiengo M (ed) Seminari sul dolore, vol I. Universita di Milano Centro Studi sull'Analgesia, Mi- lano, pp 17-34
Prof. Dr. Manfred Zimmermann Abteilung ffir Physiologie des Zentralnervensystems II. Physiologisches Institut der Universitfit Heidelberg Im Neuenheimer Feld 326 W-6900 Heidelberg Bundesrepublik Deutschland