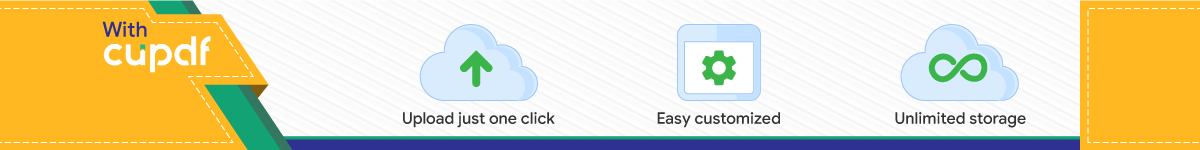
Das Buch
Eine »Ästhetik des Humanen«, wie man sie in seinen Romanenund Erzählungen findet, hat Böll nur einmal ausführlicher for-muliert: In seinen »Frankfurter Vorlesungen«, die er 1964 hielt.Worum es dabei geht, sagt er gleich im ersten Satz: um »dasWohnen, die Nachbarschaft und die Heimat, das Geld und dieLiebe, Religion und Mahlzeiten«. Fast die gleichen Worte ste-hen am Anfang von »Heimat und keine«, einem prägnantenText über die eigentümliche Heimatlosigkeit der Menschen imwestlichen Deutschland. Es gibt zwei Köln, die »heimatlich«waren: das Vorkriegsköln und das zerstörte Köln, in das wir1945 zurückzogen, heißt es da. Auch diese zweite Heimat abersei »schon wieder verloren«. Die Jahre 1967/68 bringen andereStichworte: der »Prager Frühling« und sein jähes Ende beimEinmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen, die Studentenrevol-te und — zum ersten Mal — der gefährliche Einfluß des Springer-Konzerns. Dabei steht Bölls private Reportage aus Prag (»DerPanzer zielte auf Kafka«) gleichrangig neben seinem öffentli-chen Auftreten gegen die Notstandsgesetze. Aber seine Bitter-keit angesichts der »schlüpfrigen Hast«, mit der Kiesinger, Bar-zel und Schmidt die Notstandsregelung durchpauken, ist we-sentlich größer.
Der Autor
Heinrich Böll, am 21. Dezember 1917 in Köln geboren, warnach dem Abitur Lehrling im Buchhandel. Im Krieg sechs JahreSoldat. Danach Studium der Germanistik. Seit 1949 veröffent-lichte er Erzählungen, Romane, Hör- und Fernsehspiele, Thea-terstücke und war auch als Übersetzer aus dem Englischen tä-tig. 1972 erhielt Böll den Nobelpreis für Literatur. Er starb am16. Juli 1985 in Hürtgenwald.
Heinrich BöllSchriften und Reden
Zur Verteidigung der Waschküchen. 1952- 1959 (io6o I)Briefe aus dem Rheinland. 1960-1963 (10602)Heimat und keine. 4 42 ( 4 )19_4-19_ , 1 0 _03,Ende der Bescheidenheit. 1969-1972 (10604)Man muß immer weitergehen. 1973-1975 (1o6o5)Es kann einem bange werden. 1976-1977 (Io6o6)Die »Einfachheit« der »kleinen« Leute. 1978-1981 (10607)
Schriften und Reden1964-1968
entnommen aus:Heinrich Böll WerkeEssayistische Schriften und Reden 2
1964-1972Herausgegeben von Bernd BalzerVerlag Kiepenheuer & Witsch, Köln (1978)ISBN 3-462-01259-2 (Leinen)ISBN 3-462-01258-4 (Broschur)
November 1985Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG,MünchenLizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung desVerlages Kiepenheuer & Witsch, KölnUmschlaggestaltung: Celestino PiattiGesamtherstellung: C. H. Beck'sche Buchdruckerei,NördlingenPrinted in Germany ISBN 3-423-10603-4
Inhalt
Editorische Vorbemerkung zur Werkausgabe 1978 7Editorische Vorbemerkung zur Taschenbuchausgabe 1985 8
Vorwort zu »Schalom« ( 1 964) 9Die humane Kamera (1964) 12
Zu Reich-Ranickis »Deutsche Literatur in West und Ost«
( 1 964) 14Gesinnung gibt es immer gratis (1964) 17Uber Balzac (1964) 21
Gefahr unter falschen Brüdern (1964) 24Unversehrter Prometheus (1964) 28Unbefangenheit und Noblesse (1964) 29Frankfurter Vorlesungen (1964) 30Unterwerfung gefordert (1964) 89Uber Melita Maschmann, »Fazit« (1964) 96Die Befreiten erzählen (1964) 100Weggeflogen sind sie nicht (1964) 104Silvester-Artikel (1964) io6Heimat und keine (1965) 109Wort und Wörtlichkeit (1965) 113Raderberg, Raderthal (1965) 116Brendan Behan (1965) 125Jugendschutz (1965) 129Stichworte (1965) 133Über Jürgen Becker, »Felder« (1965) 149Christen im Korea-Krieg (1965) 152Epitaph für Walter Widmer (1965) 157Angst vor der »Gruppe 47«? (1965) 159Mauriac zum achtzigsten Geburtstag (1965) 170Keine so schlechte Quelle (1965) 173Ein letzter Deutscher (1965) 182Stellungnahme (1965) 186Das wahre Wie, das wahre Was (1966) 187Vorwort zu »Unfertig ist der Mensch« (1966) 193Was ist eine christliche Grundlage? (1966) 198Das Zeug zu einer Äbtissin (1966) 201
Eine ganze Provinz besetzt (1966) 205
Der Rhein (1966) 209Brief an einen jungen Nichtkatholiken (1966) 212Die Freiheit der Kunst (1966) 224An einen Bischof, einen General und einen Minister desJahrgangs 1917 (1966) 229Die armen r. k.s. (1967) 245Einführung in »Dienstfahrt« (1967) 249Dreizehn Jahre später (1967) 251Joseph Caspar Witsch (1967) 257Warum so zartfühlend? (1967) 259You enter Germany (1967) 263Hinweis auf Josef W. Janker (1967) 266Offene Antwort an die 329 tschechoslowakischen Schrift-steller, Intellektuellen und Künstler (1967) 270Georg Büchners Gegenwärtigkeit (1967) 272Die Studenten sollten in Klausur gehen (1968) 279Plädoyer für einen Freund (1968) 281Radikale für Demokratie (1968) 283Dunkel und trickreich (1968) 287Notstandsnotizen (1968) 289Mit vierzig Mark begannen wir ein neues Leben (,19- . 294Taceat Ecclesia (1968) 295Ein Brief aus Prag (1968) 299Der Panzer zielte auf Kafka (1968) 301Über die Gegenstände der Kunst (1968) 313Über Günter Eichs »Maulwürfe« (1968) 318»Weh is' mir« (1968) 320Es wäre ein Skandal für diese Stadt (1968) 324
Quellennachweise und Anmerkungen
325
Register 3 32
Editorische Vorbemerkung zur Werkausgabe 1 97 8
Die Bände Essayistische Schriften und Reden 1-3 enthalten diezwischen 1952 und Juni 1978 entstandenen Arbeiten dieses Gen-res. Ihre Zahl ist größer, als zu erwarten war: trotz WernerLengnings verdienstvoller bibliographischer Arbeit (W. L., DerSchriftsteller Heinrich Böll. Ein biographisch-bibliographischerAbriß) war doch eine Reihe von Aufsätzen, Rezensionen, etc.unentdeckt geblieben; einiges lag auch — bislang unveröffentlicht— in Heinrich Bölls Archiv.Dennoch ist diese Sammlung nur nahezu vollständig: So konnteetwa die mehrfach geübte Praxis, private Briefwechsel ohne Zu-stimmung Bölls zu publizieren, nicht durch die Aufnahme sol-cher Briefe in die Werkausgabe nachträglich autorisiert werden.Dazu waren Versprechungen zu respektieren, wie Böll sie z. B.Bischof Scharf gegenüber (vgl. Ich habe die Nase voll, 1974) öf-fentlich geäußert hat, wobei die Offentlichkeit des Versprechensnicht das Entscheidende war, wie das Fehlen einiger Texte in die-sen Bänden belegt.Verzichtet wurde schließlich auch auf Texte (zumeist Resolutio-nen, Aufrufe, öffentliche Erklärungen), die Böll zusammen mitanderen Persönlichkeiten verfaßt, die er zum Teil auch nur mit-unterzeichnet hat.Ein weiteres »Defizit« ist nur scheinbar: bei verschiedenen inden Bibliographien verzeichneten Titeln handelt es sich — wie sichbei den Vorbereitungen zu dieser Ausgabe herausstellte — nichtum selbständige Veröffentlichungen, sondern um Nachdruckeunter verändertem Titel.Auf eine Differenzierung der Texte in Aufsätze, Kritiken, Re-den, Feuilletons etc. wie in den früheren »Schriften«-Ausgabenwurde hier bewußt verzichtet, um für den Leser den Nachvoll-zug des »Fortschreibungsprozesses« nicht zu erschweren, in dendas gesamte Werk Heinrich Bölls einbezogen ist.Diese Absicht bestimmte auch das Prinzip der Reihenfolge, diesich grundsätzlich an der Chronologie der Erstveröffentlichun-gen orientiert. Bislang nicht publizierte ältere Texte wurden frei-lich ihrer Entstehungszeit entsprechend eingeordnet, und beiArtikelserien, Briefwechseln etc. wurde der sachliche Zusam-menhang über das Prinzip einer rigiden Chronologie gestellt.
8 EDITORISCHE VORBEMERKUNG
Das Quellenverzeichnis macht die entsprechenden Abweichun-gen von der zeitlichen Reihenfolge deutlich; es ist überdies fürdie folgenden Bände erweitert um einige Anmerkungen vorallem in den Fällen, in denen die Kenntnis an Böll gerichteter-Artikel oder Briefe für das Verständnis der Repliken unabding-bare Voraussetzung ist.Textgrundlagen für diese Ausgabe waren — soweit vorhanden —die früheren bei Kiepenheuer & Witsch erschienenen Ausgaben,sonst die jeweilige Erstveröffentlichung — in wenigen Fällen dasOriginalmanuskript.
Bernd Balzer
Editorische Vorbemerkung zur Taschenbuchausgabe1985
Die ersten fünf der auf insgesamt neun Bände konzipiertenTaschenbuchausgabe Schriften und Reden. 1952-1985 folgen inWortlaut und Chronologie der Werkausgabe EssayistischeSchriften und Reden i—, die 1978 im Verlag Kiepenheuer &Witsch erschienen ist. Einige offensichtliche Druckfehler wur-den stillschweigend beseitigt und aufgrund der eigens für dieTaschenbuchausgabe erstellten Register einige Unstimmigkei-ten in den Schreibweisen von Eigennamen ausgeräumt.
Vorwort zu »Schalom«
Die zeitgenössische Literatur eines Landes bietet die notwendi-gen Ergänzungen zu einem Bild, das in Diskussionen, Minister-reden, im diplomatischen Stil, in Import- und Exportziffern alsoberflächlich hingetupftes Selbstporträt immer den Plakaten vonReisegesellschaften gleicht. Vergleicht einer das Frankreich deGaulles mit der Literatur, die in dessen Epoche entstand, dieimmer noch gewahrte Würde Englands mit der Literatur derzornigen jungen Frauen und Männer oder die Gegenwartslitera-tur der Bundesrepublik mit dem optimistischen Selbstporträt,das sich aus Wohnungsbaustatistiken, auf Industriemessen, inExport und Tüchtigkeit ergibt — es entsteht nicht nur, was man»Gefälle« zu nennen beliebt, es bildet sich Hintergrund, neueDimensionen entstehen. Staatsmänner lächeln immer, kommenvon Reisen immer »in voller Übereinstimmung« mit irgend je-mand zurück, sie bieten auf dem Flugplatz das Standardge-schenk: ein (oft etwas mühsames) Lächeln der Zuversicht, dasnicht immer auf Heuchelei beruht, oft nur eine Erscheinungs-form der hinter schneeweißen Zähnen wartenden VerzweiflungistDer Staat Israel, jung, von einem uralten Volk neu besiedelt undbewohnt, gibt sich nach außen wie alle modernen Staaten: zuver-sichtlich, gerüstet, er gibt sich rational, lächelnd in feindseligerNachbarschaft, wo aus allen Himmelsrichtungen drohendeRednerfäuste sich gegen ihn erheben. Hohe technische Intelli-genz plant dort, macht verwüstete Erde untertan, widerlegt demOrient seine Apathie. Die Literatur Israels, wie sie aus diesemSammelband spricht, zerstört das Bild nicht, nur kommt eskaum darin vor, und so ergänzt sie es. In der Erzählung DieNacht von Sarona von Schamir steht der Satz: »Er hatte das Le-ben seiner Generation in seinem Fleisch« ; eine bessere Defini-tion für Zeitgenossenschaft habe ich bisher nicht gefunden, keinebessere Beschreibung eines politischen Apparatschiks als in Me-geds Erzählung Das Begräbnis. Daß eine so selbstverständlicheSchilderung der Inhumanität jeglichen Parteiapparats aus einemLand kommt, dessen innenpolitisches Leben naturgemäß erstrecht kurz ist, könnte für befangene mittel- und osteuropäischeAutoren eine Ermunterung sein, mit naiver Bitterkeit, ohne
1964
Rücksicht auf jeweils bevorstehende Wahlen, sich am gleichenThema zu versuchen. Die Problematik jeden kriegerischen oderauch nur kämpferischen Tuns, selbst für ein unanfechtbares oder-unangefochtenes Ziel — besser als in Yishars Erzählung Der Ge-fangene läßt sie sich kaum in Sprache fassen. In Appelfelds Er-zählung Berta wird Wolle zu Strickwerk, Strickwerk, wieder zuWolle aufgeribbelt, wird wieder zu Strickwerk. Muß ein solchesSprachbild interpretiert werden, wenn die Erzählung in einemLand geschrieben ist, dessen Wappen aus Fleiß, Planung, Zuver-sicht besteht?Ein großer Autor wie Samuel Jos. Agnon bedarf keiner Einfüh-rung, keiner Auslegung, aber vielleicht muß er davor geschütztwerden, in die Ecke der »Kafkaesken« geschoben und allzuleichtfertig eingeordnet zu werden. Unterbrochene Tradition,verlegerische Zufälle, verlorene Zusammenhänge verführenleicht zu Irrtümern. Agnon ist Zeit- und Altersgenosse Kafkas,seine Prosa hat einen von Kafka völlig verschiedenen Rhythmus.In seiner Erzählung Im Wald und in der Stadt teilt er mit dem Le-ser die uralte Gewaltlosigkeit, die Bitterkeit, den Humor und dieMilde— Milde auch gegen Mörder—, die sich auf der endlosen Su-che nach einem bewohnbaren Land gebildet haben.Bitterkeit und Humor sind die einzigen Wegzehrungen des jüdi-schen Volkes gewesen, beides noch nicht verloren, eins ohne dasandere nicht denkbar. Nun ist das bewohnbare Land gefunden,bedroht, nicht nur von Rednerfäusten. Das Land hat kaum soviel Einwohner wie Westberlin, hat wie dieses seine Mauer, es istein bewegtes Land, wo Intellektuelle zu Arbeitern und Bauernwerden, während anderswo Arbeiter in langwierigen Kursenden Status des Intellektuellen zu erreichen trachten; wo Pazifi-sten die Armee verteidigen, während anderswo alte Militaristenan Armeen zu zweifeln beginnen. Was über die äußere Lage Isra-els mitzuteilen wäre, ergibt sich aus seiner Entstehung, seinerkurzen Geschichte, der geographischen Lage, dem Export, Im-port, aus Reiseberichten, Diskussionen, aus Begeisterung undEnttäuschung. Die Mitteilungen der Literatur sind ganz andererArt, nicht nur in Israel. Staatsmännern, gleichgültig von welcherHimmelsrichtung aus man sie östlich oder westlich nennen mag,schwebt immer'etwas vor, das dem »sozialistischen Realismus«in seiner administrierten Form gleicht, eine Literatur, die Lei-stungen anerkennt, statistische Zuversicht stiftet, Fahnen
VORWORT ZU -SCHALOM. II
schwenkt, auf Schultern klopft und das Lächeln auf dem Flug-platz tatsächlich als ein Zeichen »voller Obereinstimmung« hin-nimmt.Eine Sammlung wie die vorliegende ist nicht nur eine notwen-dige Ergänzung, sie bietet Teilnahme und Mitteilungen ganz an-derer Art, als Berichte und Vorträge, Diskussionen sie bietenkönnen. Niemand wird in Israel Appelfelds Berta finden, AlonisFerienbäcker, aber vielleicht könnte er dem älter gewordenenKnaben aus Agnons Erzählung Im Wald und in der Stadt begeg-nen, der, inzwischen bärtig und weißhaarig, die Erinnerungenan viele Pogrome in Leib und Seele, in der Schrift liest und Mit-leid mit dem Mörder empfindet, der von Gendarmen, derenMünder »vor Furcht oder vor Heldentum« gekrümmt sind, ab-geführt wird. Nicht obwohl, sondern weil sie wirklicher sind alsalles, was Kameras erfassen und Diskussionen ergeben können,wird man sie nicht finden. Die Literatur eines Landes machtnichts, was außer ihr an Darstellungen und Annäherungsversu-chen geschieht, überflüssig, sie gibt den Hintergrund und dieDimensionen ab für alles, was im Vordergrund geschieht. Zähltman an israelischer Literatur hinzu, was nicht in diesem Bandvertreten sein kann, wird man vielleicht besser begreifen, wievielfältig die Spannungen in einem so kleinen Land sein müssen,in dem so viel uralte Bitterkeit und uralter Humor Wohnung ge-funden haben.
Die humane Kamera
Es gibt große Augenblicke der Fotografie. Wenn die Kameradem geschichtlichen Augenblick begegnet, zur Stelle ist, wennim einzelnen Schicksal das allgemeine zum Bild werden kann,ohne das einzelne Schicksal im Vorgang des Fotografierens zuverletzen. Wo die Kamera zudringlich wird, ihr Instrument, dasObjektiv, zum Instrument des Subjekts, des Fotografen wird,der darauf aus ist, den Menschen zu ertappen, zu denunzieren,zu entlarven, überschreitet die Fotografie ihre ästhetische undgleichzeitig ihre moralische Grenze. Wer am Schlüsselloch lau-ert, entdeckt natürlich den Menschen in seiner Gebrechlichkeit.Die Verwechslung von Tabu und Geheimnis ist längst selbstver-ständlich geworden. Im Tabu verbirgt sich Magie, im Geheimnisnicht. Religion, Liebe, Schlaf sind nicht magisch, sondern ge-heimnisvoll, wie das Alltägliche geheimnisvoll ist: wie Menschenmiteinander essen, sich kleiden, ihr Brot verdienen. Familie, Be-ruf, Freundschaft. Diesen Geheimnissen kann sich die Fotogra-fie nur nähern, wenn im einzelnen Schicksal, ohne daß es verletztwird, das Allgemeine sichtbar gemacht werden kann. Es gehörtnicht viel dazu, private Geheimnisse zu erfahren und sie preiszu-geben. Gewiß würde es weder großen technischen Verstandnoch viel Geschicklichkeit erfordern, in einen Beichtstuhl einMikrofon einzubauen, an der Mitteilung von Geheimnissenteilzunehmen, diese möglicherweise über irgendeinen Senderhinauszuschicken. Wird derart Erfahrenes oder Erlauschtes demhochwohllöblichen Publikum dargeboten, beweisen Film-, Fo-tokamera und Tonband, daß sie verräterisch sind, Denunziationihr Ziel ist. Es geht ja nicht um Wahrheit, nicht einmal um »Ob-jektivität«, sondern um die hämische Teilnahme an des Men -schen Gebrechlichkeit. Moral der Fotografie? Das scheint lä-cherlich, wo das »Objektiv« am Werk ist. Die große Täuschungder Fotografie liegt in der Vor-Täuschung »objektiver Wirklich-keit«. Es entscheidet ja nicht das Objektiv, sondern das Auge desFotografen, außerdem dessen Auswahl, Chemikalien, Vergrö-ßerung, Verkleinerung, Papiersorten. Die »Wirklichkeit« hatalso einige Veränderungsprozesse hinter sich. Vielleicht warendie Fotografien in den Alben unserer Väter und Großväter ehrli-cher: die erkennbare Kulisse, die Künstlichkeit der Pose, der
DIE HUMANE KAMERA 13
Komposition, des Arrangements war humaner als der Schnapp-schuß. Im Wort Schnappschuß sind zwei Gewaltverben, schie-ßen und zuschnappen, vereint. Wenn technisch perfektes Foto-grafieren in jedermanns Hand gegeben ist, ist Orwells GroßerBruder ja fast allgegenwärtig. überall Augen: künstliche, magi-sche Augen, die Ölheizungen und Garagentore, Produktion undPassage kontrollieren. Täglich werden Fotos um Fotos gemachtund verschlungen, bewegte, unbewegte, ein großer Ausverkauf,der auf Kosten des menschlichen Auges geht, in einem doppeltenSinn, auf Kosten seiner Fähigkeit zu sehen und seiner Humani-tät. Als Erinnerungsstück ins Album geklebt, mag's in einigenJahren Rührung hervorrufen, festgehaltene Augenblicke: Ge-burt, Hochzeit, Tod. Es gibt Augenblicke, in denen auf einerFotografie der Sinn einer Landschaft, ihr Atem spürbar wird, einPorträtierter »erkannt« wird oder der geschichtliche Augenblickvors Objektiv kommt: ein Kind in Uniform, Frauen, die auf demSchlachtfeld nach ihren Toten suchen ; wo Weinen mehr als pri-vat, das Weinen der Menschheit ist. Da werden nicht Geheim-nisse verraten, das Geheimnisvolle der menschlichen Existenzwird sichtbar. Es ist nicht sensationell, verdient kein Aufsehenoder Aufhebens, wenn ein professioneller Tunichtgut die jewei-lige Sitte oder jeweilige Scham verletzt. Sensationell ist der kleineChinesenjunge, der sich mit ungeheurem Ernst über die Blech-büchse beugt, aus der er seinen Reis ißt. Die Exotik des Mensch-lichen liegt nicht im nationalen oder rassischen Unterschied, sieliegt im sozialen Unterschied. Die humane Kamera wird entdek-ken, daß die Menschen nicht überall gleich, sondern überallMenschen sind, deren Menschwerdung gerade erst begonnenhat.Der Sinn dieser Weltausstellung der Fotografie könnte darin lie-gen, Nachdenklichkeit gegenüber dem Fotografieren zu erwek-ken. Ob ertappt, entlarvt, denunziert werden soll, ob die Ka-mera das Auge des Großen Bruders ist, oder ob hinter dem Ob-jektiv ein Mensch steht, dessen Menschwerdung schon begon-nen hat, der das Geheimnis respektiert, wenn er das Geheimnis-volle sichtbar machen will.
Zu Reich-Ranickis»Deutsche Literatur in West und Ost«
Es fällt mir auf, daß Reich-Ranicki in seinem kleinen Vorwortunter anderem von Ordnen, Werten, Postulieren spricht, seineWertmaßstäbe, Ordnungen, Postulate aber nicht nennt. Mögli-cherweise sind sie in der Sammlung als Ganzem verborgen, wä -ren herauszukristallisieren; um aber diese Kristallisation zu voll-ziehen, müßte ich Unmögliches vollbringen: mich nicht nurrasch mit den hier versammelten Kritiken, gleichzeitig auchrasch mit allen behandelten Autoren und allen ihren Büchernauseinandersetzen. Unmöglich. Meine Kenntnis der sogenann-ten Gegenwartsliteratur ist lückenhaft. Ich erwarte kein Be-kenntnis, nicht das Dartun einer Gesinnung, auch nicht — was sounbescheiden nicht wäre — Offenbarung einer Ästhetik oder ei-ner Doktrin. Eine Art Modellkritik wäre mir als Vorwort so an-gebracht wie ausreichend erschienen: ein besprochenes Werk,ein porträtierter Autor, von dem Reich-Ranicki sagen würde: Sostelle ich es mir unter der und jener Voraussetzung vor. Ordnen,werten, postulieren, da müssen einige Voraussetzungen beste-hen, sonst bleiben es leere Worte, besonders bei einem Kritiker,der Gesinnungen mit ihrer jeweiligen ästhetischen Erschei-nungsform zu konfrontieren unternimmt.Ich weiß nicht, ob Kritiker gut beraten sind, wenn sie solchenSammlungen zustimmen. Enormer Fleiß, im allerbesten Sinnkindlicher Eifer, wahrhafte Literaturbesessenheit, eine wache,rasch aufarbeitende Intelligenz, der jede Neuerscheinung (be-stimmter Autoren) zum Ereignis wird — das alles vereint sich hiermit der (wie ich hoffe, manchmal bitteren) Notwendigkeit, raschzu urteilen; aber hat diese Eile nicht schon einige Male Korrektu-ren notwendig gemacht? Und hat eine Publikation als Buch nichteine Endgültigkeit, die Korrekturen unmöglich macht? Zeit ver-streichen lassen, Geduld üben, warten. In dieser Epoche des ra-schen Verschleißes sollte, meine ich, gerade die mutige, die so-genannte Tageskritik den Tag nützen, ihre Stunde aber abwar-ten.Es fällt mir auf, daß Reich-Ranicki besonders streng mit seinenAltersgenossen ins Gericht geht; er müßte doch wissen, daß de-ren Ausgangsposition fast hoffnungslos war: eine geschlagene,
•DEUTSCHE LITERATUR IN WEST UND OST• I5
fast ausgelöschte Sprache nicht nur schreibbar, sie auch lesbar zumachen (Luftfotos des zerstörten Warschau, Berlin, Hamburgund Köln würden diese Ausgangsposition gut illustrieren!). Esliegen nicht zwölf Jahre zwischen 1933 und 1 945 , es sind Jahr-hunderte eines Interregnums; es liegen nicht zwölf Jahre zwi-schen 1945 und 1957, es sind Jahrhunderte, Abgründe unter-schiedlicher Zeitgenossenschaft (und unterschiedlicher Bega-bung natürlich), etwa zwischen Andersch und Grass, Schnurreund Johnson.Sollte es wirklich meine Sache sein, meinem Zeit- und Altersge-nossen Reich-Ranicki, der das Warschauer Getto überlebt hat,den Gedanken nahezulegen, daß den Nachgeborenen manchesals platte Passivität erscheint, was Passion gewesen sein könnte?Daß, wenn man sich fast ausschließlich auf psychologische Ter-mini ver- und einläßt, Aktion wie Passion wie Erscheinungsfor-men der Hysterie wirken können? Ein Abgrund, der nicht alleinmit dem Wortpaar Glaube-Unglaube überbrückt werden kann;manchem religiös Ungläubigen bleibt, wenn er hingerichtetwird, nach der Aktion nur die Passion, und gar mancher, derhingerichtet wurde, erschien nicht nur seinen Henkern, auchmanchem auf- und abgeklärten Außenstehenden als kompletthysterisch, und sie fügten hinzu, seine Aktion wäre so sinnlosgewesen wie seine Passion. Werten, ordnen, postulieren, Ab-gründe bemerken; nicht diskutieren, wie weiterhin gesagt wird;Kritiken sind keine Diskussion mit dem Autor, es gibt keineDiskussion zwischen Kritiker und Autor — mißglückte Versu-che, Ausnahmen zu machen, beweisen die Unabänderlichkeitder Regel.Es fällt mir auf, daß in einem Buch mit dem Titel Deutsche Lite-ratur in West und Ost eine Autorin wie Luise Rinser an ihremletzten, möglicherweise tatsächlich mißglückten Roman, den ichnicht kenne, »abserviert« wird, und das erscheint mir alsschlechthin unzulässig. Die Autorin des Jan Lobel, der Gläser-nen Ringe hat, wenn man schon für angebracht hält, was wohlunter Eingeweihten Totalverriß genannt wird, dann einen mitPomp, mit allem »Drum und Dran« verdient. Eine Rezensionkann polemisch sein, böse meinetwegen, rechthaberisch sogar,aber in einem Buch mit dem Titel Deutsche Literatur in West undOst wirkt der Abdruck der Rezension von Die vollkommeneFreude als ein peinliches, deplaciertes Füllsel, das manches, in
6 1964
den wichtigeren Teilen des Buches an den Gesamtporträts er-worbene Verdienst zerstört.Nun endlich, zum Schluß, will ich, rasch auf dem Pegasus dahin-reitend, zu voltigieren versuchen und mit geschlossenen Augenund mit (wahrscheinlich so ge- wie erzwungener) Eleganz dieletzte Hürde nehmen, das heißt: nicht so tun, als wäre ich in die-sem Buch unerwähnt. Es wird da — unter vielem, vielem anderen,über das zu diskutieren ich nicht fähig bin — gesagt, ich hätte »mitder Entwicklung nicht Schritt gehalten«, und ich nehme mir die-ses Wörtchen heraus, weil ich vermute, daß Reich-Ranicki damitrecht hat. Mit dem gebotenen und gebührenden Freimut erkläreich: Schritt halten konnte ich nie, Schritt machen ebensowenigund wäre doch zu letzterem geradezu prädestiniert gewesen,meiner (Körper-)Größe wegen; allerorten und allerseits habeich, bei böswilligen Leutnants ohnehin (und aus mancherleiGründen), aber sogar bei wohlwollenden und wohlmeinenden,Wut und Ärger, Zorn und Mißfallen erregt und mußte immerhinter den Allerkleinsten herlaufen, nicht im Schritt, diesenschon gar nicht machend, wo ich doch hätte an der Spitze mar-schieren, Schritt sowohl machen wie halten müssen; freimütigfüge ich hinzu, daß ich mich da hinten relativ wohl gefühlt,konnt' ich mich doch des Singens und Tirilierens enthalten, hatt'auch Distanz genug, vor Schulterklopferei wie Schelterei be-wahrt zu bleiben, blieb auch dahinten mehr Zeit, nachzudenken,sogar zu träumen — und das schon lange, bevor ich mich ent-schloß, die höchst ehrenwerte Laufbahn eines Moralisten zu er-greifen. Wortwörtlich aufgefordert, »mit der EntwicklungSchritt zu halten«, wurde ich zuletzt vor fast genau siebenund-zwanzig Jahren, als ein Schulkamerad, wohlwollend, fast schongütig, mich aufforderte, nun doch endlich, so kurz vor dem Ab-itur, in die Hitlerjugend einzutreten; ich tat's nicht, nicht nur ausmoralischen Gründen (weil ich zu wissen glaubte, wohin dieEntwicklung führte), nicht nur aus politischen Gründen, auchaus ästhetischen: ich mochte diese Uniform nicht, und die Mar-schierlust hat mir immer gefehlt; fünf Jahre vorher war ich, weildort plötzlich Gleichschritt geübt wurde, nach einem kurzen,rasch vorübergehenden Anfall von Organisationsfreudigkeit auseinem katholischen Jugendklub ausgetreten. Wohin die heutigeEntwicklung mich, würde ich Schritt mit ihr fassen, führenkönnte, weiß ich nicht; selbst wenn ich's wüßte, Schritt haltenmag und kann ich nicht.
Gesinnung gibt es immer gratis
Plädoyer für freigelassene Autoren, Leser und Romanfiguren
Mit meinen Romanfiguren habe ich eine geheime Abmachunggetroffen: Ich gebe keine Auskunft über sie; mit mir selbst eineAbmachung neueren Datums; sie ist das Resultat vieler, meistensmißverstandener Äußerungen über die sogenannte Werkstatt; esist schließlich vollkommen gleichgültig, ist auf eine absurdeWeise sekundär, wissen zu wollen, woran ein Schriftsteller ar-beitet, wie er arbeitet. Wichtig an der Werkstatt ist nur, was ausihr herauskommt.Ob einer, während er arbeitet, an faulen Äpfeln riechen, an denFingernägeln kauen, ob er Jazz oder Bach hören muß, Wasseroder Stärkeres trinkt, kurz gesagt: seine Attitüden sind von einerhimmelschreienden Gleichgültigkeit; es gibt schließlich Leutegenug, die ein interessantes Privatleben führen und höchstLangweiliges zu Papier bringen. Wir hören immer — vielleichtstimmt es —, daß Faulkner gern und viel Whisky getrunken hat,aber daß man durch Whiskytrinken kein Faulkner wird, durchAn-Äpfeln-Riechen kein Schiller, ist so banal wie die ermüden-de, immer und immer wiederholte Feststellung, daß Form ohneInhalt nur schwer wahrnehmbar, Inhalt ohne Form nicht zu-mutbar sei. Mit dieser Banalität sollten wir einander verschonen,solange wir nicht erklären können, was Form nur sei.Wir können's nicht erklären. Die Manifeste der Engagierten sindmeistens so peinlich wie die Gegenerklärungen derer, die sich fürnicht engagiert erklären. Ich weiß nur, daß Betrug stattfindet,wenn ein Autor um seiner (jeweilig) guten Gesinnung wegen ge-lobt, ihm die Form, in der er diese bietet, verziehen wird; wenneiner um seiner (jeweilig) bösen Gesinnung wegen getadelt wird,die möglicherweise gute Form in einem Nebensatz abgetanwird.Wenn es wahr wäre, daß gute Literatur und gute Gesinnung ein-ander bedingen, brauchte ja über die (jeweilig) gute Gesinnungkein Wort mehr verloren zu - werden, dann müßte ja gute undschlechte Gesinnung an ihrer Form allein erkannt werden kön-nen. Alle Doktrinen, auch die Religionen, die sich meist auf einpaar doktrinäre Formeln reduzieren, müßten ihre eigene Ästhe-tik entwickeln und vorlegen, öffentlich bekanntgeben. Das wäre
18 1964
eine verhältnismäßig klare Sache, weil sich zeigen würde, daß esfreie Kritik gar nicht gibt.Ich habe Grund genug zu der Annahme, daß viele sich Wirklich-keit ungefähr so vorstellen wie eine große Regentonne, die einAutor vor dem Haus stehen hat, aus der er nach Belieben ab-zapft: wenig — eine Kurzgeschichte; mehr — eine Novelle; sehrviel — einen Roman.Daß selbst in den primitivsten Formen der Literatur, in allemGeschriebenen, in jeder Reportage (es gibt deren von höchstemRang) Verwandlungen stattfinden, Zusammensetzung (Kompo-sition) stattfindet, daß ausgewählt, weggelassen, Ausdruck ge-sucht (und nicht immer gefunden) wird — solche Binsenwahrhei-ten scheinen fast unbekannt zu sein. Wirklichkeitsgetreu istnicht einmal eine Fotografie: Sie ist ausgewählt, hat einige che-mische Prozesse hinter sich, wird reproduziert. Wenn einer ineinem Roman Wirklichkeitstreue, Lebensnähe entdeckt, ent-deckt er verwandelte und geschaffene Wirklichkeit und Lebens-nähe. Wer Spannung vermißt oder sucht, sei daran erinnert, daßRomane mit viel Spannung, Handlung, Inhalt meistens gelesenwerden, wenn einer einschlafen möchte, während die von derHandlung unabhängige geistige Spannung einen weiterlesen, garnicht mehr ans Schlafen denken läßt.Mich jedenfalls spannt die vielfach verschnörkelte, in Musternund Rhythmen gebotene Spannung mancher Erscheinungsformdes Nouveau roman mehr als so manche ständig wiederholte Ge-sinnungs-Selbstverständlichkeit, die sich nur auf die Schulterklopfen läßt: brav gemacht, junger Freund. Kein Autor solltesich seine Gesinnung honorieren lassen. Nichts ist ja peinlicher,als wenn einer wegen etwas gelobt wird, das selbstverständlichund natürlich auch gratis gegeben wird: seine Gesinnung. Das istja fast, als würde einer seiner hübschen Locken wegen gelobtoder wegen seiner Glatze getadelt.Wer es sich leichtmachen möchte, den Autor in einem Romanoder einer Erzählung zu suchen, sollte es sich nicht zu leicht ma-chen: manchmal versteckt er sich hinter einem Kellner, einerKassiererin, hinter, nicht in; oder er sitzt in einer Milchfla-sche.Es gibt genug durchaus legitime Bereiche bloßer Gesinnungslite-ratur: Erbauung aller Art, gegen die nichts einzuwenden ist ; siehat eine wichtige und ehrenvolle Funktion : für Kinder, Engel,
GESINNUNG GIBT ES IMMER GRATIS 19
kindliche Erwachsene; es ist das Recht der Präzeptoren, Pädago-gen, Pfarrer, Funktionäre, den ihnen jeweils Anvertrauten dasJeweilige zu empfehlen, es gibt nicht nur Erbauung für die Chri-sten, die derentwegen oft und immer zu Unrecht verspottet wor-den sind. Es gibt atheistische, demokratische, gibt ganze Ge-birge marxistischer Erbauung, und überall gibt es die Zeigefin-gerschwenker, Leute, die empört, beunruhigt, verzweifelt dieHände ringen, wenn etwas, das ihrer Gesinnung nicht paßt, sichals formal glänzend und somit gefährlich erweist; die Formspannt den Geist des Menschen, der Inhalt das Herz und dieNerven.Wer den ihm jeweils Anvertrauten die jeweilige Erbauung emp-fiehlt, sollte nur wissen, daß mündige Leser ein Recht auf Span-nung durch Form haben. Und Mündigkeit gebührt nicht nur denChristen, ich wünsche sie auch allen anderen: den Marxisten,Atheisten und was es an Mischungen alles geben mag.Ich plädiere für eine Literatur der Freigelassenen für Freigelasse-ne, ich plädiere für freigelassene Romanfiguren; der einzigeZwang, dem sie unterliegen sollen, ist der Formzwang, den jederAutor nur selbst bestimmen kann, den er mit sich selbst ausma-chen muß. Vielleicht würde dann ein freigelassener Atheist an-fangen, den Rosenkranz zu beten, ein freigelassener Pfarrer alsFlickschuster sein Brot verdienen, was dem Autor die formaleChance böte, einen Kontrapunkt zur Liturgie in der frommenMonotonie des hämmernden Schusterhammers zu finden.Ich sehe nicht ein, daß ich mich irgendeiner Gesinnung wegenlangweilen soll. Nichts muß langweilig sein, auch Religion nicht.Alle Spannung ist geistigen Ursprungs (die Spannung der Krimi-nalromane — meistens, es gibt solche von hohem Rang — ist nerv-lichen Ursprungs; sie sind alles zwischen Droge und Toni-kum).Lange genug sind wir Schriftsteller von Doktrinären gepiesacktworden, die ihre jeweilige Doktrin gegen eine beliebig zu wäh-lende Ästhetik, diese gegen eine (jeweils) für böse gehaltene Ge-sinnung ausspielen. Gepiesackt worden sind wir auch von sol-chen, die wissen, wie schwer es ist, Form zu finden; die wissen,daß wir Wirklichkeit nicht in einer Regentonne vor dem Hausstehen haben, rasch mit einer Tasse, einem Krug, einem Eimerhinauslaufen, um die gewünschte Quantität zu liefern (»Darf esetwas mehr sein?«). Für unsere Gesinnung, die jeweilige, versteht
Top Related