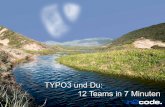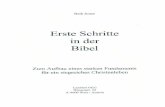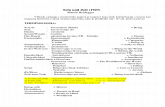08_neuland_maerz12
-
Upload
juso-kanton-zuerich -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of 08_neuland_maerz12
Zeitschrift der JUSO Kanton ZürichMärz 2012, Nr. 8, www.juso.orgneuland
SteuergerechtigkeitWohlstand fair verteilen
Seite 3
Demokratie Gegen Scheinvorwürfe und VerboteSeite 6
Weltwoche Dreckschleuder der Rechten
Seite 7
BanksyEigentlich sollte jedes Mitglied der JUSO
Banksy kennen. Schliesslich ist sein wohl berühmtestes Werk (der Blumen werfende Demonstrant) immer wieder in verschiede-ner Form auf der JUSO-Website zu sehen. Banksy ist ein gesellschaftskritischer Künst-ler. Ob Überwachungsstaat, Queen, Bur-ger-King oder Konsumgesellschaft, Bank-sy verarbeitet, kritisiert oder karikiert al-les in seinen Werken. Der britische Künstler stammt aus der Sprayerszene. Er schreibt aber auch Gedichte, malt, dreht Filme oder macht Skulpturen. Mittlerweile ist er so be-kannt, dass er Ausstellungsmöglichkeiten in berühmten Museen bekommt.
Tommy VercettiTommy Vercetti ist ein Rapper aus Bern.
Sein zweiter Platz am Schweizer Ultimative Battle 2003 bezeugt seine Qualität. Kombi-niert mit einer ungewöhnlichen Stimme und sehr philosophischen Texten (und Marx-Zi-taten), ist er wohl einer der besten Rapper der Schweiz. 2010 gewann er mit seinem ge-nialen Album « Seiltänzer » den literarischen Anerkennungspreis des Kantons Bern. Im Dezember 2011 brachte Vercetti mit Manil-lio, CBN und Dezmond Dez als Rap-Com-bo «Eldorado FM» ihr viertes gemeinsames Album gratis im Internet heraus. Auf die-sem gibt auch Greis ein Feature. Zudem fin-det im schlicht genialen Track «Ikaurs Mind-state» auch die JUSO kurz Erwähnung. Das macht « Eldorado FM 4 » zu einem absolu-ten MUSS.
Zaster und Desaster: Neue Storys aus der Welt der Abzocker von René ZeyerWer sich gerne über Banker aufregt und
mehr Insider-Wissen haben will, sollte un-bedingt mal einen Blick in dieses schockie-rende Buch werfen. Zahlreiche Schicksa-le von Bankangestellten werden abgebildet. Erstaunlicherweise empfindet man manch-mal sogar Mitleid mit den armen Bankern die entlassen oder verhaftet werden und sich ihren Luxus nicht mehr leisten können.
Kulturtipps
2neulandMärz 2012
Sa-So, 17.-18.03.2012Jahresversammlung JUSO Schweiz
Progr, Bern
Di, 27.03.2012Parteitag JUSO Kanton Zürich
Zeit: 18.00 UhrGartenhofstr. 15, Zürich
Fr, 30.03.2012PolitZnacht JUSO Stadt Zürich
Zeit: 19.00 UhrGartenhofstr. 7, Zürich
Fr-Mo, 06.-09.04.2012Osterlager JUSO AG, GR, ZH
S-chanf GRZusammen mit der JUSO Aargau und
der JUSO Graubünden organisiert die JUSO Kanton Zürich über Ostern ein La-ger mit spannenden Workshops und gu-ten Partys. Anmelden kann man sich über die Website.
Di, 10.04.2012Vollversammlung JUSO Unterland
Zeit: 19.30 UhrRathausstube, Bülach
Di, 17.04.2012Vollversammlung JUSO Stadt Zürich
Zeit: 19 UhrGartenhofstr. 15, Zürich
JUSO-AgendaGenossInnen des Quartals
Seit Jahren finden in Dresden je-weils um den Jahrestag des Bombar-dements der Stadt während des zwei-ten Weltkriegs Gedenkaufmärsche von Neonazis aus ganz Europa statt. Indem sie die gefallenen Nazis als Opfer dar-stellen und damit die eigentlichen Op-fer des Nationalsozialismus verhöh-nen, versuchen sie, die Geschichte zu verdrehen. Doch es regt sich Wider-stand: Das Bündnis «Dresden Nazifrei» ist dank der Mobilisierung tausender GegendemonstrantInnen seit 2010 je-des Jahr in der Lage, den bis dahin un-beachteten und breit tolerierten Nazi-aufmarsch zu verhindern. So liessen auch dieses Jahr mehr als 10 000 An-tifaschistInnen – darunter auch JUSOs aus der Schweiz – keine rechtsradikale Kundgebung zu. Und selbst die massi-ve Repression seitens deutscher Behör-den, welche sogar bis zur Aufhebung der Immunität linker Bundestagsabge-ordneter geht, wird die Bewegung nicht stoppen können. Der Einsatz aller be-teiligten AktivistInnen verdient unsere Anerkennung, deshalb sind sie alle Ge-nossInnen des Quartals. «No pasaran!» Kein Fussbreit den Faschisten!
Arschlöcherdes Quartals
Die Qual der Wahl! Der Polizist beim WEF, der einem friedlichen De-monstranten Pfeffer ins Gesicht sprüht, die SVP Widen, die rassistische Fo-tos hoch lädt oder die Novartis, die ihre Angestellten wie Dreck behandelt. Was die Novartis getan hat übertrifft die anderen Beispiele bei weitem: Sie hat einen Gewinn von 8 Mia Franken gemeldet und am gleichen Tag eine Streichung von ca. 1100 Stellen in der Schweiz angekündigt! Es haben glück-licherweise nicht alle ihren Job ver-
loren, doch die Angestellten mussten mächtig um ein Minimum an Gerech-tigkeit kämpfen. Nur mit Zugeständ-nissen wie einer Erhöhung von einer 37,5 auf eine 40 Stundenwoche und mit Steuererleichterungen im Kanton Waadt konnte der Standort in Nyon gerettet werden!
In Basel werden trotz lauter Pro-teste gut 250 Stellen abgebaut und das auch in der Forschung. Die Angestell-ten, die ihre Arbeit verlieren, waren Vollbeschäftigte und es trifft sie be-sonders hart. Das Verhalten der No-vartis ist zukunftsweisend und zeigt, wie profitorientiert, gierig und rück-sichtslos das Unternehmen gegen sei-ne Beschäftigten vorgeht – das alles, obwohl es Novartis blendend geht
3neulandMärz 2012
Die Verteilung von Reichtum ist nicht nur unfair sondern ein Problem für den Markt. Ein stets wiederholtes Mantra der Wirtschaftsliberalen ist, dass der Markt das Geld umvertei-le und deswegen mehr Reiche in der Schweiz insgesamt mehr Wohlstand bedeuteten. Wohlhabende haben allerdings die Tendenz, mit ihrem Reichtum überfordert zu sein und legen es daher auf dem Finanzmarkt an. Gerade dort ist zu viel Kapi-tal aber schädlich: es werden immer mehr und immer schnel-ler neue Finanzprodukte bzw. Papiere mit noch höheren Ren-diten geschaffen. Dadurch wird die Spekulation angeheizt und die Anleger investieren zunehmend in risikobehaftete Anlage-möglichkeiten. Genau das ist 2008 mit der Immobilienblase ge-schehen.
Die freie Marktwirtschaft bringt es also nicht hin, Reich-tum sozial gerecht zu verteilen. Im Gegenteil: sie schafft Kri-sen. Es gibt ein traditionell linkes Modell zur Umverteilung von oben nach unten – eine soziale Steuerpolitik. Gegen dieses de-mokratische Instrument gibt es von bürgerlicher Seite hefti-ge Abwehr. Seit jeher werfen die Liberalen dem Staat vor, er sei wirtschaftlich ineffizient, da er dazu tendiere, riesige, geld-verschlingende Apparate aufzubauen und dass er ausserdem zu Korruption neige. Dass der Markt nicht besser wirtschaf-tet ist spätestens seit der Krise von 2008 offensichtlich. Wäh-rend beim zweiten Modell reiche Private so viel Vermögen ak-kumulieren können wie möglich und frei darüber entscheiden können, bietet das erste Modell eine Möglichkeit, demokratisch über erwirtschaftetes Geld zu verfügen. Bedingung dafür ist natürlich ein transparenter Staatshaushalt und Mitbestimmung – Partizipation – der in der Schweiz lebenden Menschen.
Seit über 15 Jahren ist der Steuersatz in der Schweiz auf fast allen Ebenen massiv gesunken, die Staatskasse wurde möglichst schlank gehalten. Während die Summe aller versteu-erten Reingewinne im Jahr 1990 noch 38.7 Milliarden Franken betrug, stieg dieser bis 2006 auf 231.3 Milliarden Franken. Dem gegenüber ist der Steuersatz auf diese Gewinne von 19.3 Pro-zent auf 7.1 Prozent gesunken. Nachdem gespart wurde und Steuern gesenkt, fehlt nun dem Kanton Zürich das Geld, um die Personalvorsorge der öffentlich Angestellten, die BVK, zu sanieren. Es ist gar kein real erspartes Geld in der Staatskasse. Das einzige was man so erreicht hat, sind weniger Ausgaben für den Service Public. Darin ist aber alles, was den Lebens-standard der Schweiz ausmacht: Bildung, Gesundheit etc. Die-se Entwicklung muss gestoppt werden! Die Unternehmens-, die Erbschafts-, Kapitalgewinnsteuer und so weiter müssen erhöht werden. Damit können endlich die Bildung verbessert und der Ausstieg aus der AKW-Technologie finanziert werden. Wohl-stand bedeutet hoher Lebensstandard und dieser muss einge-fordert werden!
Die meisten Fakten und Zahlen stammen aus dem Sammel-band « Richtig Steuern », herausgegeben von Hans Baumann und Beat Ringger für das Denknetz im September 2011. Auch das Bundesamt für Statistiken hat hilfreiche Angaben.
Lena Lademann Weltweit geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf – auch in der Schweiz bekommt man dies immer deutlicher zu spüren. Seit der Finanzkrise ist die Angst der Angestellten vor Arbeitslosigkeit an erste Stelle getreten und die Prognosen für die Wirtschaft se-hen düster aus. Unter solchen Umständen fordern Unternehmen wie Novartis von ihren Angestell-ten, dass sie «länger arbeiten», was übersetzt mehr unbezahlte Überstunden bedeutet. Gleichzei-tig kassieren die Manager derselben Unternehmen weiter Boni ein. Dieser Ungerechtigkeit muss die Stirn geboten werden!
Wie sich Wohlstand gerechter steuern
lässt
Yves Chopard Die Ausgaben für un-ser Gesundheitssystem steigen. «Kosten senken» lautet das Credo der Bürgerlichen. Mit der Einführung der Fallpauschale wur-de ein weiterer bürgerlicher Sparvorschlag verwirklicht. In der vorangegangenen Dis-kussion wurde immer wieder behauptet, die Fallpauschale hätte keine negativen Auswir-kungen auf das Gesundheitssystem. In der Praxis sieht dies jedoch anders aus. Seit der Einführung sind Spitäler gezwungen, Pati-enten früher nach Hause zu schicken oder an Rehakliniken weiterzugeben. Die Kosten werden also auf die Rehakliniken und die Spitex abgeschoben.
Es gäbe durchaus andere Sparmög-lichkeiten, die ohne Abwertung des Ge-sundheitssystems auskämen. Zwei Ansät-ze wären beispielsweise die zu hohen Me-dikamentenpreise und die Ausgaben der Krankenkassen für Marketing. Letzteres versucht die SP mit der Einführung der Ein-heitskasse zu berichtigen. Damit soll der
4
Lucia Thaler Inspiriert vom Arabischen Frühling begann sich im letzten Sommer in New York gleichfalls eine Bür-gerbewegung zu formieren. Eine anfangs kleine Demonstration führte zur Besetzung eines Parks nahe der Wall Street, der sich immer mehr Menschen anschlossen. Eine Zeltstadt wurde aufgebaut und ein reger Di-alog über die grossen Probleme unserer Zeit und deren Lösungsansätze fand seinen Anfang. Mit Hilfe des Internets schlossen sich weltweit bald Tausende den friedlichen Protesten an und gründeten Ableger von Occupy Wall Street. Der 15. Oktober wur-de zu einem grossen Aktionstag, in dessen Folge in vielen weiteren Städten Camps ent-standen. Die Bewohner und weiteren Akti-vistinnen luden Passanten zum mitdenken und mitreden ein. Die ganze Bewegung ist über das Internet in Solidarität miteinander verbunden. Überall kämpfen die AktivistIn-nen für echte Demokratie, in der die Inter-
essen der Menschen im Vordergrund ste-hen und nicht die der Wirtschaftselite.
Es erstaunt nicht, dass sich der Pro-test so weit verbreitete. Schliesslich leiden die Menschen weltweit unter dem kapita-
listischen Wirtschaftssystem, das zu einer enormen Ungleichverteilung des Vermö-gens geführt hat. Das reichste und mäch-tigste 1%, das sich rücksichtslos durch Aus-beutung von Mensch und Natur auf Kosten aller anderer bereichert, besitzt so viel wie die übrigen 99% der Bevölkerung zusam-men. Immer weniger Leute sind bereit, das einfach hinzunehmen und weiter still zuzu-sehen, wie mit unseren Steuergeldern Ban-ken gerettet und die Menschen daneben ignoriert werden.
Nach der brutalen Auflösung von vie-len Zeltstädten durch die Polizei wurde es in letzter Zeit etwas ruhiger um die Occupy-Bewegung. Mit den sinkenden Temperatu-ren kam es zu einem Winterschlaf. Aber die Probleme sind noch lange nicht gelöst und mit dem Frühling kommt auch wieder das Zeltwetter.
Besetzen um zu verändern
neulandMärz 2012
Wettbewerb unter den Krankenkassen und damit verbundene Ausgaben verschwinden.
Das Problem der teuren Medikamen-te wird durch die Pharmaunternehmen ver-ursacht. Der Selbstbehalt bei der Wahl ei-nes teuren Originalpräparats beträgt zwar 20 statt 10 Prozent, es ist aber nach wie vor eine Lücke vorhanden: Wenn das Original-präparat durch den Arzt verschrieben wird, muss die Krankenkasse die vollen Kos-ten übernehmen. Diese Lücke wird von der Pharmaindustrie ausgenutzt. Sie schaffen fi-nanzielle Anreize für Ärzte, damit teurere Medikamente verschrieben werden. Eini-ge Pharmaunternehmen zahlen Ärzten Geld für «Praxiserfahrungsberichte», damit die-se die teuren Medikamente verschreiben. Diese Berichte haben keinen wissenschaft-lichen Nutzen und dienen nur dem Marke-ting. Durch die hohen Medikamentenprei-se steigen natürlich die Krankenkassenbei-träge. Es wird also einmal mehr auf Kosten der Prämienzahler Profit gemacht.
Seite 5
Illustration Felix Thaler. Felix studiert Informatik, ist 21 und
aus Uster. Als Hobby kreiert er gerne Bilder und Filme am Computer.
Wir möchten in jeder Ausgabe einer jungen Illustratorin / einem jungen Illustra-toren die Gelegenheit geben, ihr/sein Schaf-fen zu präsentieren. Wärst du daran inter-essiert, auf Seite 5 ein Werk von dir zu se-hen? Dann melde dich bitte bei [email protected].
Sparen im Gesundheitssystem auf Kosten der Prämienzahler
Im Schein verirrt,aber auf dem
richtigen Weg
6neulandMärz 2012
David Gallusser Richtig, vieles liegt im Argen. Und ja, wir können und wollen es gemeinsam ändern. Das wird im Papier «Für eine radikale Demokratie», welches an der Jahresversammlung der JUSO Schweiz diskutiert wird, unmissverständlich klar. Trotz-dem muss am Entwurf noch gearbeitet werden.
Die heutige politische Ordnung zemen-tiert Privilegien für wenige auf Kosten der Mehrheit. Sie lässt Superreiche und Spit-zenverdienerInnen immer mehr kassie-ren, während sich Mittelstand und die Ha-benichtse mit Brosamen begnügen müs-sen. Menschen werden aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder ihrer Se-xualität diskriminiert. Zugleich wird unser Lebensraum wegen den Interessen Ein-zelner zunehmend zerstört.
Auf diese willkürlichen Ungleichhei-ten aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass sie einer demokrati-schen Gesellschaft widersprechen, ist die Stärke des vorliegenden Entwurfs. Demo-kratie geht von der Gleichheit der Men-schen aus und spricht gerade deswegen allen die selben Rechte in der politischen Mitsprache zu. Nicht gerechtfertigte Un-gleichheiten sind also richtigerweise als undemokratisch zu verstehen und zu be-kämpfen – egal, in welcher Form sie sich zeigen. Damit macht das Papier auch gut nachvollziehbar, dass sich die JUSO nicht nur die Bekämpfung einzelner Missstän-de auf die Fahne schreiben kann, sondern gegen jegliche ungerechtfertigten Privile-gien kämpfen muss.
Von wegen «Scheindemokratie»
Trotz der Stärken hat der Entwurf viel Nachholbedarf. Allen Unzulänglichkeiten voran betrifft das die «Scheindemokra-tie». Damit wird unsere heutige Ordnung
bezeichnet. Auch wenn es viel zu kritisie-ren gibt, schiesst der Begriff übers Ziel hinaus. Er verneint nämlich all die demo-kratischen Errungenschaften, für die sich Generationen vor uns erfolgreich gewehrt haben. Darunter fallen wichtige Freihei-ten, wie das Recht seine Meinung zu äus-sern, sich zu versammeln oder zu wäh-len. Dazu gehören ebenso grundlegende, wenn auch sicherlich noch unvollständi-ge soziale Rechte, wie eine AHV zu er-halten, zu streiken oder zur Schule ge-hen zu können. Sie können nicht einfach als Schein verschrien werden. Sie sind real und wichtig. Mit ihrer Geringschät-zung wird all jenen Kräften in die Hände gespielt, die weniger Demokratie im All-gemeinen und soziale Rechte im Beson-deren wollen. Letztlich wird so an der Grundlage dessen gesägt, worauf eine demokratischere Gesellschaft aufgebaut werden soll.
Verbote und weiterer Nachhobedarf
Ebenso fragwürdig sind gewisse Re-zepte im Entwurf: Dazu gehören die er-staunlich vielen Vorschriften und Verbo-te, die angeblich gebraucht werden um Freiheit zu bringen. Paradebeispiel ist der Stimmenzwang, der vermeintlich als Lö-sung für die niedrige politische Beteili-gung präsentiert wird.
Die vorgeschlagenen Alternativen sind zudem oft vage und unausgegoren. Das betrifft insbesondere die Vorschläge zur Wirtschaftsdemokratie – die Antwort auf den Kapitalismus. Es bleibt zum Bei-spiel offen, wie wir die Kapitalmacht zu-rückdrängen können. Ernstzunehmende Vorschläge wie MitarbeiterInnen-Gesell-schaften, Genossenschaften, ein demokra-tischer Service Public oder Wirtschafts-Räte werden leider nicht diskutiert.
Schliesslich wird zwar richtigerwei-se angetönt, dass wir für eine radikale Demokratie alle jene zusammenbringen müssen, die – angefangen beim kosova-rischen Maurer bis zur queeren Umwelt-Aktivistin – den Kürzeren ziehen. Unge-klärt bleibt, wie wir die Differenzen unter ihnen überbrücken und konkret die «gros-se Mehrheit der Bevölkerung» überzeu-gen. Eine Antwort könnte darin liegen, glaubhaft zu machen, dass die Mehrheit mit mehr Demokratie gewinnt – und sich dafür gemeinsam gegen die stellen muss, die von den undemokratischen Verhältnis-sen profitieren.
7neulandMärz 2012
Jonas Banholzer Spätestens seit dem Besuch des umstrittenen Predi-gers Reinhard Bonnke – auch «Mähdre-scher Gottes» genannt – hat wohl jedeR schon einmal vom International Christian Fellowship, kurz ICF, gehört. Die Kirche, welche sich zwar modern gibt, in Wirk-lichkeit aber erzkonservative Werte ver-mittelt, zieht die Jugendlichen in Massen an. Grund genug, einmal persönlich an einer «Celebration» Teil zu nehmen – so wird der Gottesdienst des ICF genannt.
Schon am Eingang der Music Hall – inzwischen ist der ICF umgezogen – wird deutlich, dass man hier keine «nor-male» Kirche betritt. Begrüsst wird man vom «Welcome Team» (gewöhnt euch schnell an die Anglizismen), wel-
Ursula Näf Als Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand zurücktrat, wusste man nicht, welche Rolle ihm betreffend der Dollarkäufe seiner Frau zukam. Fest stand jedoch, dass ein Mann als Sieger vom Platz ging, den man entweder liebt, oder hasst: Christoph Blo-cher. Er hat die Schlammschlacht gegen Hildebrand einge-leitet. Das Motiv ist offensichtlich: Hildebrand machte sich stark für eine Grossbanken-Regulierung, was der Klientel der SVP gar nicht gefiel.
Der Chefideologe der SVP konnte in der Hildebrand-Affäre eine seiner Lieblingsrollen einnehmen: der Skan-dalaufdecker. Ausgeführt wurde Hildebrands Todesstoss von der Weltwoche, die in innigster Beziehung zu Blocher steht. Sie schwärzt an, empört sich, diffamiert, in frem-denfeindlichen, isolationistischen und rassistischen Tö-nen. Und hin und wieder produziert das SVP-Propaganda-blatt auch gerne eine Politleiche: Auf Zuppiger folgt Hilde-brand. Warum Blocher hingegen für viele überhaupt noch
ches wohl ein Auge für erstmalige Besu-cher beim ICF entwickelt hat. Einmal in der Halle angekommen, meint man sich eher in einem Sportstadion, denn in ei-ner Kirche zu befinden. Zu Beginn wird ausgiebig «geworshipt», also mit Live Band Lieder gesungen, welche – abgese-hen von den Texten – glatt aus den Pop-Charts stammen könnten. Wagt man ei-nen Blick um sich herum, ist man erst einmal verwundert. 16-jährige Mädchen am Weinen, andere auf den Knien und viele tanzen mit den Händen in der Luft. Grosse Emotionen also bereits beim ers-ten Lied. Ob diese nur gespielt sind oder wirklich echt, sei einmal dahin gestellt. Dann die Predigt mit dem Thema «Wur-zeln und Flügel». Die Kernaussage: Wer die Wurzeln seines Lebens in Jesus ge-
glaubwürdig ist, ist rätselhaft, hat er doch selbst monatelang gelo-gen was seine Beteiligung bei der BaZ anbelangt, sich über zwie-lichtige Wege die Ems Chemie ergattert, ist Milliardär, aber gibt sich trotzdem als Volksvertreter aus etc. Es scheint, dass nichts Blochers Worte trüben kann.
Die Bedeutung von Hildebrands erzwungenem Rücktritt geht über seine Person hinaus: Eine Partei hat so lange Dreck gewor-fen, bis der Chef der Nationalbank nur schon aufgrund des Ver-dachtes nicht mehr tragbar war. Die Unschuldsvermutung als wichtiger Grundsatz unseres Rechtsstaates wurde somit schnell und einfach ausgehebelt. Die SVP zieht alle Register, um das zu beseitigen, was sich gegen ihre Politik wendet. Die grösste Par-tei der Schweiz handelt zutiefst undemokratisch. Das ist der wah-re Skandal!
Was würde Blocher dazu sagen? Wahrscheinlich: «Es gibt eine Zeit zum Reden und eine Zeit zum Schweigen.» Wir freuen uns auf das Schweigen.
funden hat, dem werden Flügel verlie-hen. Interessant ist dabei eine kleine Ge-schichte des Pastors: Ein Kollege habe ihn gefragt, weshalb das ICF immer wei-ter wachsen möchte. Darauf habe er ge-antwortet: «Weisst du, eigentlich wollen wir gar nicht wachsen. Aber was gut ist, lässt Gott eben wachsen!»
Zum Schluss fällt natürlich die Bemer-kung, dass die Kirche nur von den Spen-den der Mitglieder lebt und Gott eigent-lich möchte, dass jeder seinen «Zehnten» abgibt. Selbstverständlich ist der Beitrag aber freiwillig (kann sich jeder denken, wie man sich als nichtzahlendes Mitglied fühlt).
Zu Besuch beim ICF Zürich – ein Erlebnisbericht
Schlammschlacht fordert Opfer
Luc Froidevaux Die Dunkelheit der Nacht umfängt meine Seele und erstickt die letzten Lichtstrah-len in meinem Herzen. Ich sitze am Fenster meiner Zel-le und starre in die Nacht hinaus, doch beobachte ich die Szenerie nur zum Schein. Die Glut meiner Zigarette lässt die Gitter des Lebens in rotem Licht erglühen und ich werde mir wieder meiner Gefangenschaft bewusst. Gefangen mit offenen Türen, die Welt als Hof, und doch ist die Freiheit so fern. Ich nehme den letzten Zug der Zigarette und schnippe sie aus dem Fenster, wo sie in der Tiefe der Nacht verschwindet.
Langsam geht die Sonne auf, erhellt den Himmel und färbt den Horizont blutrot. Es ist Zeit aufzubrechen, denke ich mir, nehme meine sieben Sachen und bin-de sie mir wie ein Kleinkind auf den Rücken. Ich wer-de die Freiheit erringen, heraus aus dem goldenen Kä-fig, die wahre Freiheit meines Herzens. Die Gänge sind leer und der Beton strahlt die Kälte der Einsamkeit aus, welche sich mir bis auf die Knochen über den Körper
legt. Die Leuchtstoffröhren flackern als ich vorbeige-he und die Treppe auf den Turm nehme. Tritt für Tritt kämpfe ich mich hoch, mein persönliches Glück zu er-reichen. Schon nach kurzer Zeit tritt mir der Schweiss auf die Stirn und ich sehne mich nach der Bequemlich-keit meiner Zelle. Ja, eine Zelle, doch warm und gemüt-lich. Gefangen oder doch in Sicherheit? Ich verdränge die Gedanken meiner Trägheit, zu lange haben sie mich zurückgehalten, zu lange habe ich ein aufgewärmtes Glück gelebt. Vorgefertigt ohne mich zu kennen, mit al-len Möglichkeiten doch keine, die ich möchte.
Schweissdurchnässt erreiche ich das Dach, die letz-ten Sterne scheinen durch den dunkelblauen Himmel, die ersten Sonnenstrahlen erreichen mein Gesicht und wärmen mich zum ersten Mal seit Jahren. Ich schlies-se meine Augen, breite meine Schwingen aus und flie-ge davon.
Lexikon
Austerität, die; (lat.: austeritas: Strenge, Ernst) A. bezeichnet eine strenge staatliche Sparpolitik, welche mittels Einsparung laufender Ausgaben und/oder zu-sätzlichen Belastungen der Abgabenzahler eine Sanie-rung des Staatshaushalts bewirken soll. Begriff i.d.R. für Sparmassnahmen in Staaten verwendet, welche ih-ren Verpflichtungen gegenüber Schuldnern nicht mehr nachkommen können oder im Verdacht stehen, dies nicht mehr zu können. A.-massnahmen werden oft-mals den betreffenden Staaten von aussen, durch In-stitutionen wie dem IWF (Internat. Währungsfonds), aufgezwungen: Staaten, die als nicht kreditwürdig gel-ten, erhalten nur noch vom IWF Kredite; diese Kredi-te sind aber an die Erfüllung von A.-massnahmen ge-knüpft.
A.-politik ist problematisch, da sie sozial verhee-rende Auswirkungen zeitigt. Ausserdem drosselt sie das Wirtschaftswachstum in einem Staat und kann zu Deflation führen, was die Schuldenlast erhöht und die Einnahmen reduziert. A.-massnahmen verschärfen deshalb das Problem, das sie zu lösen vorgeben.
Kurzgeschichte: Der Aus bruch
8neulandMärz 2012
Impressum:
Herausgeberin: neuland ist das offizielle Publikati-onsorgan der JUSO Kanton Zürich und ihrer Sektionen: JUSO Kt. Zürich; Postfach 3015; 8021 Zürich;
www.juso.org.Redaktion (erreichbar unter [email protected]):
Lena Lademann, Rachel Plüss, Yves Chopard, Seve-rin Pomsel, Luzi Borner, Lucia Thaler, Samuel Haffner, Marco Geissbühler, Dario Schai, Jonas Banholzer, La-rissa Schüller.
Layout: Elephant at Work Design, Samuel VonäschDruck: spescha e grünenfelder, IlanzAuflage: 1000 Ex.Abos: Mitglieder der JUSO Kanton Zürich erhalten
neuland gratis zugestellt. Alle anderen können unter www.juso.org/neuland_soli für einen Beitrag von min. 50 Franken ein Jahresabo bestellen.