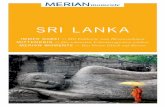68er - Die Ewigen Rebellen
Transcript of 68er - Die Ewigen Rebellen

68ER
Die ewigen Rebellen
Der Tod des Studenten Benno Ohnesorg machte aus einer lustigen Revolte den Aufstand der 68er, der
Deutschland veränderte. Die Erfolge und Mißerfolge dieser Kulturrevolution beleben und lähmen die
Republik bis heute.
Aus Sicht der Studenten war noch im Jahr 1968 die Vergangenheit
erschreckend gegenwärtig, sie hielten die Nachkriegsrepublik für faschistoid.
War die Revolte von 1968, wie konservative Kritiker behaupten, ein einziger
monströser Irrtum? Wird dem Mythos vom berechtigten Aufruhr der Linken
der Garaus gemacht? Oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die
Geschichte wiederholt?
DPA
Demonstration gegen den Vietnamkrieg
68erDie ewigen Rebellen
1. 68er: Die ewigen Rebellen vom 24.09.2007 - 538 Zeichen
SPIEGEL ONLINE
2. RAF-Serie (III): Wie alles anfing: "High sein, frei sein" vom
24.09.2007 - 24392 Zeichen
DER SPIEGEL Seite 98
3. ESSAY: DIE ERSCHÖPFTE GENERATION vom 30.12.2002 -
13629 Zeichen
DER SPIEGEL Seite 134
4. DIE GEGENWART DER VERGANGENHEIT SERIE - TEIL 17NACHGEHOLTES ERSCHRECKEN: UND IN DEN HERZENASCHE vom 27.08.2001 - 23619 Zeichen
DER SPIEGEL Seite 156
5. DEBATTEN: Zorn auf die roten Jahre vom 22.01.2001 - 15657
Zeichen
DER SPIEGEL Seite 192
6. Die Tage der Kommune vom 30.06.1997 - 27321 Zeichen
DER SPIEGEL Seite 100
7. SPIEGEL-GESPRÄCH: "Die schießen auf uns alle" vom
23.06.1997 - 18389 Zeichen
DER SPIEGEL Seite 106
8. Am Ende des langen Marsches vom 16.06.1997 - 29734 Zeichen
DER SPIEGEL Seite 110
9. Einer, der gern saß vom 09.06.1997 - 31211 Zeichen
DER SPIEGEL Seite 72
10. DIE ACHTUNDSECHZIGER: Vollstrecker desWeltgewissens vom 02.06.1997 - 35327 Zeichen
DER SPIEGEL Seite 108
11. SPD: Die ewigen Rebellen vom 13.11.1995 - 20152 Zeichen
DER SPIEGEL Seite 26

Die Stimmung schwankte zwischenWut und Verzweiflung. Am Abenddes 2. Juni 1967 hatten sich in der
Zentrale des Sozialistischen DeutschenStudentenbundes (SDS) am Kurfürsten-damm Dutzende junge West-Berliner ver-sammelt. Unter den Studenten, die überdie dramatischen Ereignisse des Tages spra-chen, war auch die 26 Jahre alte Dokto-randin der Germanistik Gudrun Ensslin.„Mit denen kann man nicht diskutieren“,rief sie. „Das ist die Generation von Ausch-witz!“ Ihr Gesicht war bleich.
Die Pfarrerstochter schlug vor, eine Polizeikaserne zu stürmen, um sich zu be-waffnen. Wie ein „Todesengel“ erschiensie einem Studenten. Ensslin hatte zuvormiterlebt, wie Polizisten Demonstrantenblutig schlugen, die vor der DeutschenOper gegen den iranischen Diktator SchahMohammed Resa Pahlewi protestierten.
Ihre militante Idee stieß auf Ablehnung,doch ihr Wort von der „Generation vonAuschwitz“ hallte nach. Die Studentenstießen immer wieder auf Verbindungs-linien zwischen Nazi-Deutschland und der Bundesrepublik.
So fanden sie heraus, dass die Planungfür den brutalen Polizeieinsatz am Abenddes 2. Juni 1967 dem Kommandeur derWest-Berliner Schutzpolizei Hans-UlrichWerner oblag. Der vormalige NSDAP-Par-teigenosse hatte sein Handwerk im Zwei-ten Weltkrieg bei der „Bandenbekämp-fung“ in der Ukraine und in Italien ge-lernt. Der Reichsführer SS, HeinrichHimmler, hatte ihn für seinen Einsatz mitdem Eisernen Kreuz ausgezeichnet.
Schon das zeigt: Die Geschichte derRAF, die die Bundesrepublik im Herbst1977 an den Rand des Ausnahmezustandesbrachte, ist eine sehr deutsche Geschichte.
98 d e r s p i e g e l 3 9 / 2 0 0 7
„High sein, frei sein“Der erste Schuss fiel am 2. Juni 1967 in West-Berlin. In der Konfrontation mit derStaatsgewalt radikalisierte sich die Studentenbewegung. Die Befreiung Andreas Baadersim Mai 1970 markierte die Geburtsstunde der RAF. Von Michael Sontheimer
Polizeieinsatz gegen Anti-Schah-Demonstranten am 2. Juni 1967 in West-Berlin: Von einem alten Nazi geplant
SPIE
GEL T
V
Polizei-Opfer Ohnesorg, Studentin DollingerEin Schuss in viele Köpfe
ULLS
TEIN
BIL
DER
DIE
NS
T

Zwar formierten sich in den siebzigerJahren in vielen westlichen Industrielän-dern nach dem Zerfall der Studentenbe-wegungen terroristische Gruppen. „Aberin Westdeutschland“, stellt die englischeAutorin Jillian Becker fest, „wurde die Be-wegung vor allem eine gewalttätige Ge-genreaktion auf den totalitären Staat dervorangegangenen Generation.“ Becker gabihrem Buch über die RAF deshalb den Ti-tel: „Hitler’s Children“, Hitlers Kinder.
Niemand konnte am 2. Juni 1967 vor-aussehen, dass an diesem Tag in West-Ber-lin eine Eskalation begann, die einen 23Jahre währenden Krieg der RAF gegen denStaat hervorbringen würde; einen Feldzug,der über 50 Menschen das Leben kostensollte. Erst viel später auch wurde klar,dass nahezu alle, die in den Terrorismusabrutschten, zuvor auf Demonstrationenvon Polizisten verprügelt worden waren.
„Die Bullen rannten auf uns zu wie dieWahnsinnigen“, erinnert sich Bommi Bau-mann an den 2. Juni 1967. „Sie haben gleichlosgeknüppelt, auf Frauen, auf alte Leute,immer sofort auf die Köpfe.“ Baumannzählte 1972 zu den Gründern der anarchis-tischen Stadtguerillatruppe „Bewegung 2. Juni“, die mit der RAF konkurrierte.
Polizei-Greiftrupps in Zivil versuchten,sich unter den flüchtenden Demonstran-ten vermeintliche Rädelsführer zu schnap-pen. Zu einem dieser Trupps zählte derKriminalbeamte Karl-Heinz Kurras, derauf einem Parkplatz Demonstranten nach-setzte. Dorthin lief auch der Student Ben-no Ohnesorg. Unter welchen UmständenKurras dann Ohnesorg mit einem Kopf-schuss aus seiner Pistole tötete, wurde nievollständig aufgeklärt*.
Es spricht allerdings vieles dafür, dassKurras Ohnesorg in den Kopf schoss, wäh-rend der Student gerade von Polizisten ver-prügelt wurde. Jedenfalls hörten Zeugen,wie ein Kollege Kurras anherrschte: „Bist duwahnsinnig, hier zu schießen“ – und Kurrasantwortete: „Die ist mir losgegangen.“
Am Morgen nach dem Todesschuss tratein weiterer Akteur in Aktion, den Ex-Innenminister Gerhart Baum als „entschei-dend für die Eskalation zum Terrorismus“bezeichnet: der Axel-Springer-Verlag. Erkontrollierte über zwei Drittel der Tages-presse in West-Berlin. „Wer Terror produ-ziert“, kommentierte die „B.Z.“ in groteskerVerkehrung des Geschehens, „muss Härte inKauf nehmen.“ Die „Bild“-Zeitung geißeltedie „SA-Methoden“ der Studenten.
Fritz Teufel von der Kommune 1, denPolizisten vor der Oper brutal zusammen-geschlagen hatten, wurde des schwerenLandfriedensbruchs beschuldigt und überzwei Monate in Untersuchungshaft gehal-ten. Der Todesschütze Kurras musste hin-gegen keinen einzigen Tag hinter Gitterndarben. Er wurde wegen „fahrlässiger Tö-tung“ angeklagt, aber freigesprochen undarbeitete bis zu seiner Pensionierung alsKriminalbeamter weiter. Otto Schily, deran der Oper mitdemonstriert hatte, erin-nerte sich später: „Mein Glaube an dieRechtsstaatlichkeit, an die Unabhängigkeitdes Gerichts, der ging damals ziemlich denBach runter.“
Das Foto vom 2. Juni 1967, das zur Iko-ne wurde, zeigt die Studentin FriederikeDollinger, wie sie neben ihrem tödlich ver-wundeten Kommilitonen kauert. Das Er-lebnis habe sie „in eine mir eigentlichfremde Radikalität“ getrieben. „Der Sounddieser Jahre“, sagt der Verleger Klaus Wa-genbach, „war die Wut auf den Staat.“ DerSchuss auf Benno Ohnesorg war ein Schussin viele Köpfe. Er war die Initialzündungfür die Studentenbewegung.
Kurz nach dem Tod Ohnesorgs traf sichGudrun Ensslin mit Gleichgesinnten, um
* Eine Rekonstruktion liefert das gerade erschienene Buch von Uwe Soukup: „Wie starb Benno Ohnesorg? Der2. Juni 1967“. Verlag 1900, Berlin.
d e r s p i e g e l 3 9 / 2 0 0 7 99
AS
TR
ID P
RO
LL
Liebespaar Ensslin, Baader auf der Flucht in Paris (1969): Der Romantik der Illegalität verfallen
Die beiden waren ein Paar, das Himmel undHölle in Bewegung setzten konnte.

eine Aktion gegen den Regierenden Bür-germeister Heinrich Albertz zu planen. Er trug die politische Verantwortung fürden Polizeieinsatz. Es wurden T-Shirts mit einzelnen Buchstaben bemalt. Vornstand „ALBERTZ !“ hinten „ABTRETEN“.Ensslin trug das Hemd mit dem Ausru-fungszeichen.
Bei einem Treffen dieser „Buchstaben-ballett“-Aktivisten stieß Ensslin bald aufeinen Mann, der sich bislang vorwiegendin Künstlerkneipen und Schwulenbars her-umgetrieben hatte. Er war vier Jahre zuvoraus München in die Mauerstadt gekom-men: Andreas Baader. Obwohl er undEnsslin in festen Beziehungen lebten undkleine Kinder hatten, knisterte es sofortzwischen ihnen.
Gudrun Ensslin, das vierte von sie-ben Kindern eines protestantischen Pfar-rers von der Schwäbischen Alb, war 1964 nach West-Berlin gezogen. Ein Jahrspäter arbeitete sie für Günter Grass’ Initiative zur Unterstützung der SPD. Als sich die Sozialdemokraten aber mit der CDU auf die Große Koalition unterFührung des Ex-NSDAP-ParteigenossenKurt Georg Kiesinger einließen, wand-te sich die Studentin enttäuscht von ih-nen ab.
Ensslin war eine kühle Intellektuelle.Als sie erstmals in Haft war, erregte siedie Bewunderung der Gefängnisdirek-torin, „weil sie so absolut ist, notfalls mitdem Leben für ihre Überzeugung ein-tritt“.
Baader war drei Jahre jünger als Ensslin,körperlich präsent und ebenso unver-schämt wie charmant. Er motzte unent-wegt, war direkt und vulgär, konnte sich instundenlangen Monologen ergehen. Den
Verleger Wagenbach erinnerte er an „ei-nen kleinen Zuhälter“; die meisten Män-ner konnten ihn schwer ertragen. „Dochbei Frauen“, so ein Ex-RAF-Mann, „hatteer einen Stich.“
Baader ging nicht arbeiten, hatte nieGeld und ließ sich aushalten. Aberder Künstlerin, mit der er zusam-
menlebte, bevor er Gudrun Ensslin traf,prophezeite er: „Eines Tages wirst du michauf dem Cover des SPIEGEL sehen.“
„Gudrun und Andreas“, erinnert sichderen einstige Freundin Astrid Proll, „er-gänzten sich genial.“ Die beiden waren einPaar, das Himmel und Hölle in Bewegungsetzen konnte, sie bildeten später die Dop-pelspitze der RAF.
Der 2. Juni 1967 hatte auch Bohemienswie Baader politisiert. Astrid Proll, derenälterer Bruder Thorwald sich mit Baaderangefreundet hatte, fuhr die beiden undderen Freunde nachts durch West-Berlin.Sie brüllten aus dem Fenster: „Wirschlagen alles kaputt, wir schlagenalles kaputt!“
Nach einer der vielen Demon-strationen murrte Baader: „Jetztlaufen wir hier durch die Gegend,und das war es dann. Das bringtdoch nichts. So ändert sich nie et-was.“ Da er den theoretisch ver-sierten Studenten nicht gewach-sen war, drängte er auf radikaleAktionen. Einmal schlug er vor,den Turm der Gedächtniskirche indie Luft zu sprengen.
Die romantisch verklärte Idee,der die Studenten, aber auchSchüler und Lehrlinge reihenwei-se verfielen, hieß Revolution. Sie
bewunderten Fidel Castro, noch mehr dencoolen Ché Guevara, und Mao Zedong,dessen Rote Garden in der chinesischenKulturrevolution alles Alte bedenkenlosabräumten. Das passte gut zum Misstrauengegen die eigenen Eltern, die über dieNazi-Jahre schwiegen.
Zu diesem Schweigen kam der klein-bürgerliche Muff der Adenauer-Jahre. DieEltern standen unter Generalverdacht.„Trau keinem über 30“, hieß die Parole.
Im Sommer 1968 war mehr als die Hälf-te aller Studenten zum Demonstrieren aufdie Straße gegangen. Nahezu zwei Drittelaller Studenten und Gymnasiasten im Al-ter von 17 bis 25 standen laut einer Um-frage dem Parteiensystem misstrauisch ge-genüber; ein Drittel hing marxistischenIdeen an.
Zutiefst erschüttert wurden die Rebellenin der gesamten westlichen Welt von denBildern aus Vietnam. Der Saigoner Poli-zeichef, der auf offener Straße einen Viet-
100 d e r s p i e g e l 3 9 / 2 0 0 7
Vietnamesische Kinder nach US-Napalmeinsatz (1968)„Ohne Krieg keine RAF“
SPIE
GEL T
V
Inhaftierte Ensslin (2. v. r.) bei Gegenüberstellung in Frankfurt am Main 1968: Kühle Intellektuelle
BU
ND
ES
AR
CH
IV (
L.
+ R
.);
AP (
M.)
Frankfurter Kaufhaus nach dem

cong mittels Kopfschuss tötet; das Massa-ker von My Lai.
Dass die Supermacht der westlichenWelt im Namen der Freiheit mehr als eineMillion vietnamesische Zivilisten umbrach-te, war für die Jugend in San Francisco, Paris oder Berlin unerträglich. Als sich die Neue Linke im Februar 1968 in Berlinzum Vietnam-Kongress versammelte, wa-ren nicht nur Baader und Ensslin dabei,sondern die meisten, die später mit ihnenin den Untergrund gingen. „Ohne den
Vietnam-Krieg“, sagte der RAF-MannKlaus Jünschke später, „hätte es uns nichtgegeben.“
Im März 1968 brachen Baader, Ensslinund Proll mit einem weißen Ford-Straßen-kreuzer nach München auf, wo sich ihnender Schauspieler Horst Söhnlein anschloss.Nachts in den Kneipen fabulierten sie da-von, ein Fanal zu setzen. Das taten sie kurzdarauf in Frankfurt.
Ein paar Minuten vor Ladenschluss de-ponierten sie in zwei Kaufhäusern jeweilszwei Brandsätze. Kurz vor Mitternachtbrach das erste Feuer aus. Der Schaden,vor allem durch Löschwasser, betrug lautVersicherung 673204 Mark. Niemand wur-de verletzt. Schon zwei Tage später ver-haftete die Polizei das Quartett.
Während die Brandstifter in Untersu-chungshaft saßen, sorgte ein Neonazi fürdie weitere Radikalisierung der Neuen Lin-ken: Am 11. April 1968 fuhr der Anstrei-cher Josef Bachmann von München nachWest-Berlin. Er suchte Rudi Dutschke, den
charismatischen Kopf der Bewegung, undtraf ihn auf dem Kurfürstendamm vor demSDS-Zentrum. „Du dreckiges Kommunis-tenschwein“, rief er, bevor er dreimal aufDutschke schoss.
In Ost-Berlin dichtete Wolf Biermanndaraufhin ein Lied. „Die Kugel Nummereins kam aus Springers Zeitungswald“,hieß es darin. Das Fazit des späteren Kul-turkorrespondenten des Springer-Blattes„Welt“: „Wenn wir uns jetzt nicht wehren,wirst du der Nächste sein.“
Noch am Abend des Mordanschlages,den Dutschke nur knapp überlebte, zogenüber tausend Demonstranten zum Sprin-ger-Hochhaus in der Kochstraße. Mit dabeiwar die Hamburger Journalistin UlrikeMeinhof, Kolumnistin des linken Monats-magazins „Konkret“.
Die Studentenrevolte griff jetzt vonWest-Berlin auf die gesamte Westrepubliküber. Über 20000 Polizisten wurden auf-geboten, um die „Osterunruhen“ nieder-zuschlagen. In 27 Städten versuchten wü-tende Demonstranten, die Auslieferung derSpringer-Zeitungen zu verhindern. Es kamzu den größten Straßenschlachten seitGründung der Republik.
Im Oktober 1969 eröffnete das Landge-richt Frankfurt die Hauptverhandlung ge-gen die vier Kaufhausbrandstifter. Als Ver-teidiger reisten zwei fähige junge Anwälteaus Berlin an: Otto Schily und Horst Mah-ler. Zwei der Brandstifter steckten sich aufder Anklagebank als Hommage an ChéGuevara dicke Zigarren an. Der aus Frank-
reich ausgewiesene Dany Cohn-Bendithielt eine Rede und wurde wegen Störungder Verhandlung in Ordnungshaft genom-men (siehe Interview Seite 102).
Ulrike Meinhof besuchte Ensslin im Ge-fängnis und war sofort fasziniert von ihr.Sie weigerte sich aber, über ihre Gesprächemit Ensslin und Baader zu schreiben.„Wenn ich das tue“, sagte sie, „kommendie nie aus dem Gefängnis.“
Vor Gericht jedoch erklärte Ensslin, siehätten keine Menschen gefährden wollen.„Wir taten es aus Protest gegen die Gleich-gültigkeit, mit der die Menschen dem Völ-kermord in Vietnam zusehen.“ Und sieverkündete, ganz im Geiste Martin Lu-thers: „Wir haben gelernt, dass Reden ohneHandeln Unrecht ist.“
Ende Oktober 1968 wurden die vier we-gen „menschengefährdender Brandstif-tung“ zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt.Während sie sich in der Haft langweilten,besetzten in München Studenten das In-stitut für Zeitungswissenschaften, um ge-gen den Vietnam-Krieg zu protestieren.Eine 20 Jahre alte Aktivistin erhielt dafür ei-nen Strafbefehl wegen „erschwerten Haus-friedensbruchs“. In einem Bericht der Fami-lienfürsorge heißt es: „M. tut der Vorfallleid. Sie hat sich vorgenommen, dass Der-artiges nicht mehr vorkommen sollte.“ AusBrigitte Mohnhaupts Vorsatz wurde nichts.Sie schloss sich zwei Jahre später der RAFan und übernahm im Frühjahr 1977 die Füh-rung der zweiten Generation der Gruppe.
Mitte Juni 1969, nachdem die Brandstif-ter 14 Monate hinter Gittern verbracht hat-ten, erwirkte ihr Anwalt Horst Mahler fürsie Haftverschonung. Als sie die wiederge-
* Links: Baaders Mittäter Thorvald Proll.
101
„Du dreckiges Kommunistenschwein“, rief
Brandanschlag: Zigarren für Ché
FO
TO
CR
ED
IT
Brandstifter Baader (r.) bei Gegenüberstellung in Frankfurt am Main 1968*: Direkt und vulgär

102 d e r s p i e g e l 3 9 / 2 0 0 7
„Immer radikaler“Dany Cohn-Bendit, 62, über Baader, Ensslin und die Entstehung der RAF, die VerehrungChé Guevaras und die Verantwortung der Studentenbewegung für den Terrorismus
SPIEGEL: Herr Cohn-Bendit, Sie habenAndreas Baader und Gudrun Ensslin imOktober 1968 beim Prozess wegen derKaufhausbrandstiftungen in Frankfurt erlebt. Welchen Eindruck hatten Sie vonihnen?Cohn-Bendit: Ich habe damals im Ge-richtssaal erklärt: „Die gehören zu uns.“Das war nicht gerade das Schlaueste, wasman hätte sagen können, aber ich sah ihreAktion als Happening. Die Kaufhaus-brandstiftung war für mich eine Aktionvon Leuten, die bekifft waren und die Fol-gen ihrer Tat nicht bedacht hatten. SPIEGEL: Sie konnten sich demnach nichtvorstellen, dass Baader und Ensslin baldtödliche Bomben legen würden? Cohn-Bendit: Heute sind wir schlauer, aber mir erschienen sie damals nicht als angehende Terroristen. Ich habe GudrunEnsslin im Gefängnis besucht; sie saß inFrankfurt-Preungesheim unter der Obhutder großen liberalen Reformerin des Straf-vollzugs, Helga Einsele. Wir haben zu drittKaffee getrunken. Es war sehr nett, undich dachte: Gudrun ist im Grunde die per-fekte Sozialarbeiterin. SPIEGEL: Ensslin und Baader haben nachihrer Haft zunächst eine Kampagne ge-gen die antiquierten geschlossenen Erzie-hungsheime für Jugendliche gemacht. Cohn-Bendit: Im Zusammenhang mit diesersogenannten Heimkampagne habe ichauch Baader kennengelernt. Die Kampa-gne war einerseits getragen von dem so-
zialen Impetus, diesen Jugendlichen eineChance zu geben, andererseits von dertotalen Instrumentalisierung der Jugend-lichen. Ich habe Baader und Ensslin ge-sagt: Lasst diese Jugendlichen in Ruhe.Daraufhin zückte Baader seine Mao-Bi-bel und sagte: „Sie sind die Speerspitzedes revolutionären Proletariats.“ Da wur-de mir klar, dass er vor nichts zurück-schrecken würde, um andere Menschenfür seine Zwecke zu funktionalisieren. SPIEGEL: Fürchteten Sie da, dass Baaderund Ensslin morden würden?Cohn-Bendit: Nein. Französische Freunde,die Baader zusammen mit Ensslin dannnach Paris gebracht haben, sagten mir allerdings: So einen Kotzbrocken wie Baader hätten sie noch nicht erlebt; eingrauenhafter Typ. Er sei mit der Attitüdeaufgetreten: „Ich werde eine große Rolleim revolutionären Prozess der nächstenJahre spielen. Die Welt gehört mir, und ihrhabt euch mir unterzuordnen.“ SPIEGEL: Warum verliebte sich Ende dersechziger Jahre ein wesentlicher Teil derJugend in die Idee der Revolution, die jameist Gewalt impliziert? Cohn-Bendit: Wir sagten damals: So wiedie Welt ist, wollen wir sie nicht. Und wirsagten: Wir wollen die Welt selbst ge-stalten. Wir sind dazu fähig. Unsere El-tern und Großeltern haben geschichtlichversagt. SPIEGEL: Warum adaptierten die Rebellendie alte Ideologie des Marxismus?
Cohn-Bendit: Der Marxismus stellte eineradikale Kritik an der herrschenden Ge-sellschaftsordnung dar, und in West-deutschland beispielsweise war er auf-grund des Kalten Krieges tabuisiert. Daaber der real existierende Sozialismus inOsteuropa auch keine attraktive Alterna-tive war, flüchteten die einen nach Kuba,die anderen nach China, nach Vietnam,nach Albanien. Wir Libertären flüchtetenin die Geschichte – zu den Anarchistendes Spanischen Bürgerkriegs. Aber wirwaren alle nicht in der Lage, aus unsererberechtigten Kritik eine zukunftsfähigeund unseren Gesellschaften entsprechen-de Alternative zu entwickeln. SPIEGEL: Wie konnte eine anfangs anti-autoritäre Bewegung so schnell totalitäreund antidemokratische Ideen bis hin zumTerrorismus übernehmen? Cohn-Bendit: Der größte Star der antiauto-ritären Bewegung war Ché Guevara, dereinen ebenso radikalen wie autoritärenAnsatz vertrat. Er wollte den „Neuen Men-schen“ schaffen, und zwar mit Gewalt.Dabei wurde Ché mehr wie eine Pop-Iko-ne verehrt und diente als ein Objekt se-xueller Projektion. Die Bewunderung fürihn, Mao Zedong oder Ho Tschi-minh –das waren doch alles Projektionen unseresWunsches nach Emanzipation und Be-freiung. Der Realitätsgehalt ihrer Texteund das, was sie wollten und taten, wurdenicht geprüft. Wir nahmen sie als Meta-phern unserer Wünsche.
BERT B
OS
TELM
AN
N /
BIL
DFO
LIO
(L.)
; K
URT W
EIN
ER
(R
.)
Grüner Cohn-Bendit, als Demonstrant (1968): „Moralische Mitverantwortung für die RAF“

wonnene Freiheit in Frankfurt mit einerParty in einem Künstleratelier feierten, setz-ten sich Baader, Ensslin und andere einenSchuss Opiumtinktur – und infizierten sichprompt mit der unheilbaren Hepatitis C.
Die Studentenbewegung hatte da ihrenZenit schon überschritten. Hunderte Stu-denten waren von Strafverfahren wegenDemonstrationsdelikten bedroht. Die brei-te Bewegung spaltete sich in Polit-Sekten,die das Proletariat missionieren wollten.Baader, Ensslin und die beiden Proll-Ge-schwister schlossen sich lieber der soge-nannten Heimkampagne von Pädagogik-studenten an, die die geschlossenen Erzie-hungsheime abschaffen wollten.
Die Brandstifter sammelten Geld für dieHeimzöglinge, besorgten Lehrstellen. Ul-rike Meinhof tauchte wieder auf undmachte Rundfunksendungen über die er-folgreiche Kampagne. Einer der vielen ausHeimen ausgebrochenen Jugendlichen, derin Frankfurt von Baader und Ensslin in ei-ner Wohngemeinschaft aufgenommenwurde, hieß Peter-Jürgen Boock. Acht Jah-re später wurde er zu einer führenden Fi-gur der zweiten Generation der RAF.
Im November 1969 lehnte der Bundes-gerichtshof die Revision gegen das Brand-stifter-Urteil ab. Gudrun Ensslin hatte fürdiesen Fall schon alles vorbereitet. Sie undBaader gingen über die Grüne Grenze nachFrankreich. Obwohl sie noch nicht auf derFahndungsliste standen, ließen sie in Ams-terdam manipulierte Papiere besorgen. Siewaren der Romantik der Illegalität verfal-len. In Paris kauften sie sich auf einemFlohmarkt schwarze Lederjacken, trankenabends in den Cafés weißen Rum und Ab-sinth. Eine Zeitlang lebten sie in der Woh-nung des Revolutionstheoretikers Régis De-bray, der auf dem Weg zu Ché Guevara inden Dschungel gefasst und in Bolivien in-haftiert worden war.
Astrid Proll kam mit ihrem weißen Mer-cedes 220 SE nach Paris. Zusammen mit
dem flüchtigen Paar fuhr sie zuerst nachZürich, dann über Mailand nach Rom.Nach einem Ausflug nach Sorrent und Si-zilien, nach LSD-Trips und Langeweile, be-kam das Paar in Rom Besuch aus der Hei-mat: Horst Mahler schlug ihnen vor zu-rückzukehren. In Berlin sei eine Stadt-guerillagruppe im Aufbau.
Anfang 1970 zog das Paar bei UlrikeMeinhof ein, die nach ihrer Scheidung inder Mauerstadt lebte. Sie hatte den Über-gang „vom Protest zum Widerstand“ ge-fordert; jetzt war sie langsam bereit, ihrenWorten Taten folgen zu lassen.
Horst Mahler – die bizarrste Figur dergesamten RAF – hatte, wie bislangunbekannte Quittungen zeigen, noch
ein halbes Jahr zuvor, im Sommer 1969,der NPD drei Spenden zukommen lassen.Jetzt trieb er den Aufbau einer kommunis-tischen Guerilla-Gruppe voran. Der Sprin-ger-Konzern hatte zivilrechtlich gegen ihndurchgesetzt, dass er mehr als 75000 Markfür die Schäden bei der Blockade des Kon-zerngebäudes nach dem Dutschke-Attentatzahlen sollte. Seine bürgerliche Existenzwar ruiniert.
In West-Berlin hatte sich mittlerweilerund um ein paar Kommunen eine anar-chistische Subkultur etabliert. Ein „Zen-tralrat der umherschweifenden Hasch-rebellen“ mobilisierte Hippies für militanteAktionen. Aber es ging noch mehr umSpaß als um ernsthafte Politik: „High sein,frei sein, Terror muss dabei sein!“
Als „Tupamaros West-Berlin“ hatten dieAnarchisten im Herbst 1969 die erstenBomben gelegt. Einige der Tupamarosschlossen sich später der RAF an, anderegründeten die „Bewegung 2. Juni“. DieGründer der RAF wollten „an der Basis“arbeiten, im Märkischen Viertel, einer Tra-bantenstadt, das Proletariat aufwiegeln –und gleichzeitig illegal agieren. Gegen Baa-der und Ensslin aber waren inzwischen, da
d e r s p i e g e l 3 9 / 2 0 0 7 103
SPIEGEL: Welche Rolle spielte die harteReaktion von Polizei und Justiz auf dieStudentenbewegung bei der Entstehungdes Terrorismus?Cohn-Bendit: Der 2. Juni 1967 offenbartewohlanständigen Studenten, wie schnellman zum Staatsfeind werden kann, wieschnell die etablierte Gesellschaft mit ih-rer Propagandamaschine, allen voran dieZeitungen Axel Springers, einem denKampf erklären kann. Dazu kam, dassüber die vollkommen berechtigte Kritikam Krieg der Amerikaner in Vietnam jeg-liche Diskussion abgeblockt wurde. Dasführte zwangsläufig zu einer Entfremdungund Radikalisierung. SPIEGEL: War die Eskalation nicht mehrzu stoppen? Cohn-Bendit: Das ist schwer zu sagen. Aufjeden Fall haben sich die etablierte Politikund die Justiz beim Kampf gegen die RAFauch radikalisiert. Es gab keinen Momentdes Einhaltens und Überlegens mehr. Vonder RAF war das nicht zu erwarten, aberden Vertretern des Staates sollte man eineandere Vernunft unterstellen. HeinrichBöll machte den hilflosen Versuch, freiesGeleit für Ulrike Meinhof zu fordern. Erwurde als „Sympathisant“ der RAF an-gegriffen. SPIEGEL: Gibt es ein spezifisch deutschesMoment bei der RAF? Cohn-Bendit: Es ist zumindest auffallend,dass die drei Länder, in denen vor bald 40 Jahren die größten und härtesten ter-roristischen Gruppen der westlichen Weltentstanden, Deutschland, Italien und Ja-pan waren – also die Achsenmächte desZweiten Weltkriegs mit faschistischer Ver-gangenheit. SPIEGEL: Inwiefern sehen Sie die Terroris-ten in einer faschistischen Tradition? Cohn-Bendit: Einerseits hat die JapanischeRote Armee in Kamikaze-Manier, langevor den Islamisten, die ersten Selbstmord-attentate verübt, etwa 1972 auf dem is-raelischen Flughafen Lod. Auch die mo-ralisierende Rigidität der RAF hat etwasvon der Haltung: Am deutschen Wesensoll die Welt genesen. Aber der entschei-dende Mechanismus war ein anderer, ent-gegengesetzter: Junge Menschen habenversucht, den Kampf gegen den Faschis-mus, den ihre Eltern nicht geführt haben,nachzuholen. SPIEGEL: Muss sich die Neue Linke dersechziger Jahre für den Terrorismus dersiebziger Jahre mitverantwortlich fühlen? Cohn-Bendit: Die ideologischen Versatz-stücke der RAF stammen aus der Kon-kursmasse unserer Revolte. Zudem habenwir nicht klar auseinandergehalten – washeißt Widerstand in einem faschistischenStaat, was ist Widerstand in einer Demo-kratie? Wir können uns deshalb von einerpolitischen und moralischen Verantwor-tung für die RAF nicht freisprechen.
Revolutionsidol Ché Guevara (1963): „Objekt sexueller Projektion“
REN
E B
UR
RI
/ M
AG
NU
M /
AG
EN
TU
R F
OC
US

sie die Ladung zum Strafantritt ignorierthatten, Vollstreckungshaftbefehle ergangen.
Die Gruppe hatte ein großes Problem:Sie wollte den bewaffneten Kampf auf-nehmen, hatte aber keine Waffen. HorstMahler wandte sich deshalb an einenMann namens Peter Urbach. Der hatte sichschon der Kommune 1 angedient undBrandbomben geliefert. Auch der Prototypfür die Brandsätze, die in den FrankfurterKaufhäusern zum Einsatz gekommen wa-ren, stammte von ihm. Das Dumme warnur: Urbach war Mitarbeiter des BerlinerLandesamts für Verfassungsschutz.
Obwohl die Tupamaros Mahler vor demAgent provocateur gewarnt hatten, gingdieser auf Urbachs Vorschlag ein, zusam-men mit Baader und zwei weiteren Ge-nossen auf einem Friedhof am Stadtrandnach Pistolen zu graben, die angeblich dortversteckt lagen. Auf dem Weg dorthinnahm die Polizei Baader fest.
Als Baader wieder im Gefängnis saß,wurde ein neuer Plan zur Waffenbeschaf-fung gefasst. „Wir wollten uns“, so ein Ex-RAF-Mann, „an der Mauer in Kreuzbergzwei Polizisten schnappen und ihnen dieUniformen und Maschinenpistolen abneh-men.“ Mahler und zwei Genossen warte-ten an einer dunklen Ecke in Kreuzbergauf eine Doppelstreife. Doch als die Grenz-patrouille sich näherte, verlor Mahler dieNerven, sprang aus dem Auto und ver-masselte den Überfall. Gudrun Ensslin be-schimpfte die drei Männer anschließendals „unfähige Macker“.
Sie war wild entschlossen, ihren Gelieb-ten zu befreien. Um endlich an Schuss-waffen zu kommen, gingen zwei Frauender Gruppe in eine Kneipe namens Wolfs-schanze, einen schummrigen Treffpunktvon Nazis und Kriminellen. Bei einem ausder DDR freigekauften Zuchthäusler er-warben sie für 2000 Mark zwei Pistolen.Zudem wurden zwei Kleinkalibergewehreangeschafft.
Ulrike Meinhof brachte den linken Ver-leger Wagenbach dazu, einen Vertrag auf-zusetzen, nach dem sie und Baader ein
Buch über „randständige Jugendliche“schreiben sollten. Mit diesem Vertrag be-antragten Meinhof und Baaders AnwaltMahler bei der Leitung der Justizvollzugs-anstalt Tegel die Ausführung Baaders indas Deutsche Zentralinstitut für SozialeFragen – angeblich, um dort nicht ausleih-bare Zeitschriften zu studieren.
„Ich war für die Befreiung“, erinnertsich Wagenbach, „denn Baader war unge-recht behandelt worden.“ Gleichzeitig warer „absolut dagegen, dass Ulrike Meinhofin den Untergrund geht“. Da sein Verlagüberwacht wurde, machte er mit der Jour-nalistin einen Spaziergang. Wagenbachfand die Idee des bewaffneten Kampfs ab-surd. „So viele gute Federn wie dich gibt esnicht“, bestürmte er Meinhof. Doch er er-reichte sie nicht mehr.
Zunächst bestand die Gruppe, die Baa-der befreien wollte, aus fünf Frauen.Sie befürchteten, von den Bewachern
Baaders nicht für voll genommen zu wer-den. Also beschlossen sie, einen Mann mit-zunehmen.
Ausgerechnet dieser Mann schoss, un-mittelbar nachdem er als letzter zusammenmit Gudrun Ensslin in das Institut gekom-men war, auf einen 62 Jahre alten Ange-stellten. Das Projektil durchschlug dessenOberarm und blieb in der Leber stecken.Nachdem das Kommando in den Lesesaalgestürmt war, in dem Baader und Meinhofarbeiteten, kam es zu einem wilden Hand-gemenge mit den beiden bewaffneten Jus-tizwachtmeistern.
Es fielen sechs Schüsse, ein Wachtmeis-ter wurde durch Tränengas im Gesicht ver-letzt. Baader sprang aus dem Fenster; Ul-rike Meinhof sprang in Panik hinterher.
Meinhof blieb einen Tag lang verschwun-den. Als sie wieder zur Gruppe stieß, trugsie eine blonde Perücke und wirkte ver-stört. An den Litfaßsäulen prangten baldFahndungsplakate mit großen Fotos vonihr.
„Wir waren irre sauer auf Ulrike“, sagtein Ex-RAF-Mann. Sie musste jetzt ver-
steckt werden, doch es gab noch keinekonspirativen Wohnungen. Zudem galt es,ihre beiden Töchter zu versorgen.
Die erste Aktion der RAF, der Auftaktfür den Guerillakampf, war also nur sehrbedingt geglückt. Obwohl man die Waffennicht benutzen wollte, war geschossenworden: ein Muster, das sich in den fol-genden Jahren wiederholen sollte.
Eine Woche nach der Aktion dokumen-tierte das Berliner Anarchistenblatt „Agit883“ eine von Ulrike Meinhof verfasste Er-klärung. „Die Baader-Befreiungs-Aktion“,hieß es darin, „haben wir nicht den intel-lektuellen Schwätzern zu erklären, son-dern den potentiell revolutionären Teilendes Volkes.“ Der Text endete mit dem Auf-ruf: „Das Proletariat organisieren. Mit dembewaffneten Widerstand beginnen! DieRote Armee aufbauen!“
Die RAF hatte ihr Leitmotiv der nächs-ten zehn Jahre gefunden: Bis zum „Deut-schen Herbst“ 1977 sollte es immer wiederdarum gehen, Andreas Baader aus demGefängnis zu holen. Besonders die zwei-te Generation der Gruppe agierte überweite Strecken als Baader-Befreiungs-Fraktion.
Auch die Fixierung auf die Staatsgewaltwar schon angelegt. In einer vom SPIE-GEL veröffentlichten zweiten Erklärunghieß es: „Wir sagen: Der Typ in der Uni-form ist ein Schwein, das ist kein Mensch,und so haben wir uns mit ihm auseinan-derzusetzen. Es ist falsch, überhaupt mitdiesen Leuten zu reden, und natürlichkann geschossen werden.“
Der Sound war unversöhnlich und bru-tal. „Entweder Schwein oder Mensch“,brachte es der RAF-Mann Holger Meinsspäter auf den Begriff, „dazwischen gibt esnichts.“ Das wahnhafte Weltbild warschwarzweiß. Und einzig die RAF war imBesitz der Wahrheit.
104 d e r s p i e g e l 3 9 / 2 0 0 7
Im nächsten Heft:Im Untergrund – 1972 griffen die RAF-Gründer an. Doch sie wurden innerhalbweniger Wochen gefasst.
FO
TO
S:
SPIE
GEL T
VRechtsanwalt Mahler (1967), Journalistin Meinhof (um 1969): „Das Proletariat organisieren – mit dem bewaffneten Widerstand beginnen“

d e r s p i e g e l 1 / 2 0 0 3
Diese Regierung ist die Regierung meiner Generation. ImAdenauer-Deutschland aufgewachsen, als Studenten oderSchüler von dessen geistiger Öde und politischen Enge ab-
gestoßen, in der Opposition gegen Vietnam-Krieg, Notstandsgesetzeund Berufsverbote, in der Begeisterung für den Prager Frühling unddie Demokratisierung der Gesellschaft zu politischem Bewusstseingekommen, hat die 68er-Generation ihre Heimat zunächst in dersozial-liberalen Koalition, dann oft in kommunistischen und spon-tanistischen Gruppen und schließlich teils in der SPD und teils beiden Grünen gefunden. Auf die eine oder andere Weise ist sie zumlangen Marsch durch die Institutionen aufgebrochen; da sie die Ver-hältnisse nicht umstoßen konnte, galt es, sich in ihnen einzurich-ten, um sie von innen anders zu gestalten. Unter Helmut Schmidtwar sie dazu zu jung, gegen Helmut Kohl lange zu schwach.
Bei der Wahl 1998 galt es jetzt oder nie; ich erinnere mich anÄußerungen von Joschka Fischer bis Oskar Lafontaine, dass dieseGeneration, wenn sie jetzt nicht an die Regierung komme, bis zurnächsten Wahl von dernächsten Generation ge-wissermaßen überholtwerde. Sie kam an dieRegierung. Und trotz derEnttäuschung über ihreLeistung wurde die Re-gierung wieder gewählt.Die Wähler gaben ihreine zweite Chance.
Die Regierung hat sienicht ergriffen. Statt mitden notwendigen Refor-men begegnet sie denSchwierigkeiten, in de-nen Deutschland steckt,mit Flickwerk. Weil dieReformen neue Konzep-tionen der Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen und der Ein-forderung individueller Verantwortung voraussetzen würden, aufdie die Gesellschaft eingestimmt werden müsste und nicht ohneKonflikte eingestimmt werden könnte. Weil die organisierten In-teressen sich den Reformen sperren: Pharmaindustrie und Ärzte-schaft der Gesundheitsreform, Gewerkschaften der Arbeitsmarkt-und Rentenreform und wer gerade etwas zu verlieren hat der Steu-erreform. Weil das konzeptionslose Erhöhen dieser und jener Steu-er, wenn die Betroffenen zu wirksamem Widerstand zu schwachsind, einfacher ist als eine Sparkonzeption. Weil es auch ohne Kon-zeptionen und Reformen irgendwie weitergeht. Weil die Wirtschaftzur nächsten Wahl vielleicht schon wieder kräftiger läuft. Die Grün-de sind nachvollziehbar wie auch die leeren Phrasen, das Ver-schweigen und Beschönigen, die ausweichenden Antworten, diehohlen Entschlossenheitsposen und -gesten, mit denen die Regie-rung das Flickwerk präsentiert – so machen es Regierungen eben,wenn sie nicht weiterwissen.
Aber als Politik der Generation, die antrat, Staat und Gesellschaftzu reformieren, die falsche Harmonie verachtet und Konfliktfähig-keit und -bereitschaft verlangt hat, die Phrasen und Posen ver-spottet hat, die Ehrlichkeit gefordert, sich der eigenen Ehrlichkeit
gerühmt und Politik überhaupt unter hohen moralischen Anspruchgestellt hat, ist es kläglich. Früher hat diese Generation die Gesell-schaft mit ihren Visionen einer neuen, anderen, besseren Weltüberfordert – um sie jetzt zu unterfordern und nicht einmal die vor-handene Reform- und auch Opferbereitschaft anzusprechen und ab-zurufen. Früher hat sie über die Schere im Kopf gehöhnt, die einendie Gedanken, die die Gesellschaft zensieren oder sanktionierenwürde, nicht einmal mehr denken lässt – jetzt verzichtet sie darauf,die Reformen, die auf den Widerstand der organisierten Interessenstoßen würden, auch nur zu thematisieren und zu diskutieren.Früher hatte sie ein tiefes Misstrauen gegen alle Verhältnisse undjede Herrschaft, die sich verselbständigt hatten und nur um ihrerselbst willen existierten – aber bei der letzten Wahl war kein Pro-gramm mehr erkennbar, außer dem, dass der Kanzler Kanzler blei-ben und die Regierung weiterregieren wollte. Der Marsch in die In-stitutionen hatte Erfolg. Aber zum Marsch durch sie, zum Marschzu einem Ziel hinter dem, was schon ist, reicht es nicht mehr.
Die Generation ist er-schöpft. Nicht nur in derPolitik – von den enga-gierten Lehrern meinerGeneration sind vieleausgebrannt und pensio-niert; die ehedem kriti-schen Anwälte und Ärz-te sind im vorgerücktenAlter vielleicht freizeit-und lebensqualitätsbe-wusster, aber nicht we-niger angepasst als ihreunkritisch angetretenenKollegen; bei den Jour-nalisten ist an die Stellefrüheren kritischen Auf-begehrens die besser-
wisserische Attitüde getreten; und den Theologen ist über die Jah-re mit dem Amt des Pfarrers, Dekans und Bischofs das entspre-chende Amtsverständnis zugewachsen und vom kritischen Anfanglediglich eine gewisse religiöse Unverbindlichkeit geblieben.
In meinem eigenen Beruf sieht es nicht besser aus; die Juristen,die die Professoren meiner Generation und ich selbst ausgebildethaben und zu kritischen Juristen ausbilden wollten, sind so posi-tivistisch geraten, wie es je positivistische Juristen gab, nur nichtmehr auf das Gesetz eingeschworen, sondern auf das Bundes-verfassungsgericht, und wir haben uns damit abgefunden.
Was hat meine Generation erschöpft? Und weil Erschöp-fung das Ergebnis von Überforderung ist – was hat sieüberfordert?
Die sie prägenden späten sechziger und frühen siebziger Jah-re waren Jahre leichter früher Erfolge. Sitzungen sprengen, Lehr-veranstaltungen und Gottesdienste umfunktionieren, Schüler an-politisieren, den Wehrdienst verweigern oder mit langen Haarenableisten, Krawatten- und Jackettzwänge aufkündigen, Ortsver-eine übernehmen, in Parteiämter und -gremien aufsteigen, zumProfessor ernannt und zum Prorektor oder Vizepräsidenten einer
134
Kultur
E S S A Y
Die erschöpfte GenerationV o n B e r n h a r d S c h l i n k
MIC
HAEL E
BN
ER
/ M
ELD
EPR
ES
S
JEN
S S
CH
ICK
E /
AC
TIO
N P
RES
S
TH
OM
AS
GRABK
A /
AC
TIO
N P
RES
S
Politiker Schröder, Wieczorek-Zeul, Fischer: Zweite Chance vertan?

Universität gewählt werden, die Diplom- oder Doktorarbeit beiSuhrkamp verlegen – die ersten Schritte in die Welt des öffentli-chen Auftretens, des beruflichen und politischen Handelns warenmühelos. Sie durften auch keine Mühe kosten, sondern musstenSpaß machen; anders wären es Schritte in die Entfremdung ge-wesen. Bis heute stehen Mühe und Spaßdefizit unter Verdacht,und Lafontaine und Gregor Gysi wahrten, als sie die schwierigenMinisterämter lustlos aufgaben, ein Erbe der 68er-Generation.
Die ersten Schritte waren mühelos, weil die Verhältnisse zunächstzu verunsichert waren, dem Anspruch der 68er-Generation etwasentgegenzusetzen. Von den Universitäten bis zu den Parteien, vonden Kirchen bis zur Bundeswehr herrschte das Gefühl, das Alte hät-te sich wenn nicht in den Inhalten, so doch in den Formen überlebtund müsse Neuem weichen. Berufsverbote, Verschärfungen desVersammlungs- und Strafrechts und die informationelle und säch-liche Aufrüstung der Polizei setzten erst später ein. Aber so verun-sichert die Verhältnisse zunächst auch waren, hatten sie doch ihrenBestand und die Festigkeit langen Gewachsen- und Bewährtseins.Daher konnten die ersten Schritte getrost eher zerschlagen als ge-stalten; die Verhältnisse warenzu stabil, als dass das Zer-schlagen wirklich Erfolg gehabtund die Verantwortung auf-gebürdet hätte, an der Stelle des zerschlagenen Alten etwasNeues zu gestalten. Wie um dieBürde brachte diese formative Erfahrung die 68er-Generation frei-lich auch um die Freude früher Gestaltungsverantwortung.
Dabei wurde in den späten sechziger und frühen siebziger Jah-ren politisch durchaus mehr gestaltet als von der 68er-Generationzerschlagen. Unter der sozial-liberalen Koalition hat die Bundes-republik Deutschland ein anderes Gesicht bekommen; der So-zialstaat in seiner heutigen Gestalt wurde vollendet, im Bereichschulischer und universitärer Ausbildung wurden Plätze undChancen geschaffen, und Strafrecht und Strafvollzug wurden li-beralisiert. Dies ist denn auch die nächste prägende Erfahrung der68er-Generation geworden: Politischer Aufbruch besteht im Leis-ten und Fördern, im Eröffnen neuer Chancen und Optionen. Erkostet und darf kosten und ist bestenfalls, wie die Strafrechts-, aberschon nicht mehr die Strafvollzugsreform, kostenneutral.
Dass überfälliges politisches Gestalten darin bestehen könnte,zu sparen statt auszugeben, Verzicht zu verlangen statt Wohlta-ten zu gewähren, Härte statt Anteilnahme und Hilfsbereitschaftzu zeigen, ist nichts, womit die 68er-Generation politisch groß ge-worden ist. Sie hat das Gegenteil davon gelernt.
Ihre marxistische Prägung hat es sie besonders bereitwilliglernen lassen. Dass unter den Bedingungen des Kapitalismuseigentlich für alle genug da sei, dass Mangel nur ein Problem dergerechten Verteilung und dass diese nur ein Problem der richti-gen Eigentums-, ökonomischen und politischen Ordnung sei, istintegraler Bestandteil der Marxschen Theorie und wurde in jenenJahren in den entsprechenden Lektüre- und Studienkreisen auf-genommen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Be-dürfnissen – weil man niemanden verdächtigen mochte, von sei-nen Fähigkeiten keinen Gebrauch zu machen, gab es weder ge-genüber den schlecht Gestellten der eigenen Gesellschaft noch imVerhältnis der Ersten zur Dritten Welt eine Rechtfertigung für dasVorenthalten von Leistungen und Förderungen. Das war schönempfunden, und diese Empfindsamkeit wirkt bis heute und trägtgegenüber Arbeitslosen, Empfängern von Sozialhilfe, Krankenund Alten eine besondere Behutsamkeit bei der Zumutung vonArbeit, Ortswechsel, eigenem Einsatz und eigener Leistung.
Überhaupt ist die 68er-Generation eine sensible Generation. Siemöchte gemocht werden und fühlt sich leicht verkannt. In denStürmen der späten sechziger und frühen siebziger Jahre war auf-fällig, dass, so heftig auch agitiert und agiert wurde, doch die Er-wartung bestand, die Opfer der Agitationen und Aktionen müsstenderen Wahrheit und gute Absicht erkennen und anerkennen. Oftverhielten die Opfer sich auch entsprechend. Wo sie es nicht taten,
wo sie sich vielmehr verteidigten und zurückschlugen, wurde dar-auf empört reagiert wie auf eine Ungerechtigkeit.
Ähnlich empört reagiert die alte und neue Regierung auf dieKritik der Regierten. Dass sie in den letzten vier Jahren eigent-lich gut gearbeitet habe und dass die gute Arbeit nur nicht rich-tig gesehen und gewürdigt worden sei, dass auch der neue Startzwar schwierig und holprig, aber letztlich richtig gewesen sei undnur von den Medien geschmäht werde – die Mitglieder der Re-gierung glauben es wirklich. Vermutlich hat auch, wie angesichtsdes Einschwenkens der neuen Regierung auf viele Vorstellungenund Forderungen der Gewerkschaften angenommen wurde, derKanzler sich vom Verhalten der Wirtschaft im Wahlkampf wirk-lich kränken und von dem der Gewerkschaften wirklich aufrich-ten lassen, als gehe es in der Politik um Mögen und Gemocht-Wer-den. Vielleicht sind sogar die populistischen Aktionen des Kanz-lers nicht nur aus politischem Kalkül zu verstehen, sondern auchaus dem Bedürfnis, gemocht zu werden.
Aber der Primat des Populistischen gegenüber dem Program-matischen, des Kurzfristigen gegenüber dem Langfristigen, des-
sen, was ankommt, gegen-über dem, was aneckt, hatnoch einen tieferen Grund.Die Generation hat kein Pro-gramm, um dessentwillen siedas kurzfristige Anecken inKauf nehmen könnte. Sie war
nie gut mit Programmen. In ihren prägenden Jahren pflegte sieRevolutionshoffnungen, marxistische und utopistische Phanta-sien, grandiose gesellschaftliche Visionen, die der Wirklichkeit soinkongruent waren, dass sie sich nicht zu praxisleitenden Pro-grammen kleinarbeiten, sondern nur aufgeben ließen. Danach gabes noch den sozialistischen Osten. Zwar war der Sozialismus desOstens nie das Programm der 68er-Generation. Freiheit, Demo-kratie und Rücksicht auf die Umwelt, die im Osten fehlten, wa-ren ihr unverzichtbar. Aber wie defizitär der Sozialismus desOstens auch war, schien seine Existenz doch zu belegen, dass esfür Freiheit, Demokratie und Rücksicht auf die Umwelt andere,egalitärere und solidarischere ökonomische und politische Be-dingungen geben könne als im Kapitalismus des Westens.
Das gab linker Politik kein Programm, steckte aber einen Ho-rizont ab, innerhalb dessen sie ihre theoretische Vergewisserungund programmatische Orientierung suchen konnte. Mit dem Endedes Ostens ist dieser Horizont verschwunden und sind Pragma-tismus und Populismus geblieben.
Die prägenden politischen Erfahrungen der 68er-Genera-tion – verwöhnend-mühelose erste Schritte ins öffentlicheLeben, als frühe politische Praxis eine verantwortungs-
und perspektivenarme Praxis des Zerschlagens statt des Gestal-tens, als Vorbild ein verführerisches Vorbild des Ausgebens stattdes Haushaltens, das Einüben einer Sensibilität, die nicht freivon Selbstgerechtigkeit und Wehleidigkeit ist, das Verbrauchen dertheoretischen und programmatischen Kraft im Bauen von Luft-schlössern –, diese Erfahrungen sind heute in vieler Hinsichtunbrauchbar, in mancher kontraproduktiv. Die Generation isterschöpft, weil sie überfordert ist, und sie ist überfordert, weil sie wenig mitbringt, womit sie den anstehenden Anforderungenbegegnen könnte.
Das ergibt keine gute Prognose für die wieder gewählte Regierung.Woher sollte ihr die Kraft zur Bewältigung der gegenwärtigenSchwierigkeiten zuwachsen? Aus der Besinnung auf den reformeri-schen Elan und moralischen Anspruch des Anfangs? Aus der Ein-sicht in die vorhandene Reform- und auch Opferbereitschaft? Ausdem stolzen und trotzigen Wunsch, die Bilanz der Generation, de-ren Regierung sie ist, doch noch positiv zu wenden? Es ist die Re-gierung meiner Generation, und ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Schlink, 58, lebt als Professor für Öffentliches Recht und Rechts-philosophie sowie als Schriftsteller („Der Vorleser“) in Berlin.
135d e r s p i e g e l 1 / 2 0 0 3
VIELE ERFAHRUNGEN DER 68ER
SIND FÜR HEUTIGE PROBLEME UNBRAUCHBAR,MANCHE SOGAR KONTRAPRODUKTIV.

Die Vergangenheit zu bewältigen istzur deutschen Lebensform gewor-den. Die Debatten oder Skandale,
die sich alljährlich an Revisionen oder Ver-schärfungen des gültigen Geschichtsbildesentzünden, sind, wie Peter Sloterdijk la-konisch bemerkt, „Rituale der Labilität“, indenen die bundesdeutsche Gesellschaft„das stärkste Wir-Gefühl erreicht“.
Mit der Fischer-Debatte zu Beginn die-ses Jahres ist den unbewältigten deutschenVergangenheiten Ost und West noch einedritte hinzugefügt worden. Jetzt soll es alsoum die Geschichte jener Generation ge-hen, die mit der ihrer Eltern einst so hartabgerechnet hatte. Auch sie steht plötzlichunter biografischem Rechtfertigungsdruck– wo sie sich gerade so schön in die Rolleeingelebt hatte, die Heldin einer zweiten,wenn nicht gar der eigentlichen Gründungder Republik anno 1968 gewesen zu sein.
Die Fischer-Debatte trug nicht zufälligZüge einer ironischen Reprise. Als Räche-rin ihrer verratenen Jugend trat die Toch-ter Ulrike Meinhofs auf, die – wie einst Be-ate Klarsfeld gegen Kanzler Kurt-GeorgKiesinger – auf offener Medienbühne einenPrivatfeldzug gegen Vizekanzler JoschkaFischer eröffnete, um ihn stellvertretendfür die Generation ihrer Eltern zu brand-
ses“ in Frankfurt dürften es genauso gese-hen haben.
Die Forderung, sich heute von alldem „zudistanzieren“, wie es die schwarz-gelbe Op-position von Fischer, Jürgen Trittin und an-deren prominenten „Ex-Militanten“ des rot-grünen Lagers verlangt, ist eher allzu billig.Produktiver, auch schmerzhafter ist es, sichnoch einmal zu vergegenwärtigen, wie undin welchem Grad ein beträchtliches Seg-ment der Nachkriegsgeneration damals inden Bannkreis der Vorstellung geriet, dassStaat und Gesellschaft der Bundesrepublikeinem verhängnisvollen Wiederholungs-zwang unterlägen: hin zum Faschismus.
Die Passionaria des Widerstands gegendiese „deutschen Verhältnisse“ (wie manbedeutungsvoll sagte) war eben UlrikeMeinhof. Wie keine andere schien sie dieKontinuität eines Antifaschismus zu ver-körpern, der die Terroristen nach demScheitern der Studentenrevolte aus Ver-zweiflung zu den Waffen greifen ließ. IhrTod, mit dem der blutige Showdown des„deutschen Herbstes“ 1977 eröffnet wurde,erschien aus dieser Perspektive als die Voll-endung ihres Kampfs.
Die vielen Kampagnen und Hunger-streiks gegen „Isolationsfolter und Vernich-tungshaft“ für die inhaftierten Terroristen
marken. In Internet-Botschaften, die vonFerne an Kommando-Erklärungen derRAF erinnerten, forderte Bettina Röhl vomBundespräsidenten, wegen des „Staats-notstands“ tätig zu werden, da mit Fischerder Repräsentant einer „Gewaltgruppe“an die Hebel der Macht gelangt sei.
Der Punkt, an dem ihre Affekte – stell-vertretend und rein assoziativ – auf Fischerübergesprungen sind, ist die Frankfurter„Meinhof-Demonstration“ vom 10. Mai1976, einen Tag nach dem StammheimerSelbstmord Ulrike Meinhofs. In dieser ge-waltsamen Straßenaktion, bei der ein Po-lizist nach einer Molotowcocktail-Attackeums Haar bei lebendigem Leibe verbranntwäre, kulminierten alle Zwangsgedanken,von denen die radikalen Linken der sieb-ziger Jahre beherrscht waren.
Auch Joschka Fischer ging in seiner Rö-merberg-Rede zwei Wochen später, in derer im Namen der Sponti-Militanten dieGrenze zu den Terroristen zog und die„Genossen im Untergrund“ aufrief,„Schluss zu machen mit ihrem Todestrip“,von der fixen Vorstellung aus, dass „Ulri-ke im Knast von der Reaktion in den Todgetrieben, ja im wahrsten Sinne des Wor-tes vernichtet“ worden sei. Die 10000 Teil-nehmer des „Anti-Repressions-Kongres-
156
UND IN DEN HERZEN ASCHEAus Sicht der Studenten war noch im Jahr 1968 die Vergangenheit
erschreckend gegenwärtig, sie hielten die Nachkriegsrepublik für faschistoid. Woher rührte
diese fast wahnhafte Verkennung der Wirklichkeit? / VON GERD KOENEN
DIE
GEG
ENW
ART
DER
VER
GA
NG
ENH
EIT
Terroristen-Gefängnis Stammheim, Gefangene Meinhof (1975)Auschwitz-Gedanken im Toten-Trakt
SÜ
DD
. VER
LAG
(L.)
; N
PS
(R
.)

d e r s p i e g e l 3 5 / 2 0 0 1
beriefen sich auf einen beklemmenden Textaus dem Gefängnistrakt in Köln-Ossendorf,den Ulrike Meinhof nach ihrer Verhaftung1972 schrieb. Das Stenogramm ihrer Selbst-beobachtungen war, so schien es damals,von unhinterfragbarer Authentizität: „dasGefühl, es explodiert einem der Kopf …das Gefühl, es würde einem das Rücken-mark ins Gehirn gepresst … das Gefühl,man stünde ununterbrochen, unmerklich,unter Strom, man würde ferngesteuert …“
Nachher schrieb sie: „Der politische Be-griff für toten Trakt, Köln, sage ich ganzklar, ist das Gas. Meine Auschwitzphanta-sien da drin waren … realistisch.“
mus“ unter den Augeneiner manipulierten Öf-fentlichkeit dabei sei,Methoden einer kli-nisch „sauberen“ Folterdurch Isolation als„Modell für die Be-handlung von ‚Staats-feinden‘“ zu erproben.Bei diesen Technikeneiner „sensorischenDeprivation“ handeltees sich, wie der nieder-ländische PsychiaterSjef Teuns im selbenHeft erläuterte, um einewissenschaftlich ausge-klügelte Methode „derverzögerten Auslö-schung von Leben“, diedie alten, primitivenMethoden von Aushun-gerung, Erschießungund Vergasung abgelösthabe. Die Behandlungder politischen Gefan-genen in den Gefäng-nissen der Bundesrepu-blik sei nur die experi-mentelle Vorbereitungauf einen „tendenziel-len Massenmord à laAuschwitz“.
Dieser Zwangsge-danke gab den selbst-
mörderischen Hungerstreik-Aktionen derRAF-Gefangenen die Aura einer sich selbsterfüllenden furchtbaren Wahrheit. Schonbei der ersten Hungerstreik-Erklärung vomMai 1973 – verfasst von Andreas Baader,Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin – ginges im Kern nicht um Erleichterungen desHaftregimes, eher um das Gegenteil: „Je li-beraler die Schweinerei gehandhabt wird –unaufdringlich, locker, nett – … kurz: jepsychologischer, desto effektiver, tiefer dieVernichtung der Persönlichkeit des Gefan-genen.“
Diese Argumentation traf sich mit demZeit- und Lebensgefühl der politischen Ge-
Ein beträchtlicher Teil der linken und li-beralen Öffentlichkeit war bereit, sich die-se suggestive Vorstellung mehr oder weni-ger zu Eigen zu machen. Das „Kursbuch“,das intellektuelle Leitorgan der Neuen Lin-ken, erschien im Mai 1973 unter dem Titel:„Folter in der BRD. Zur Situation der po-litischen Gefangenen“.
Im Vorwort stellte der Herausgeber KarlMarkus Michel fest, dass der als Reformis-mus maskierte „strukturelle Staatsfaschis-
* Oben: Plakatdarstellung des im Hungerstreik gestorbe-nen RAF-Terroristen Holger Meins und eines KZ-Häft-lings; unten links: nach Freitod im Gefängnis Stammheim;unten rechts: bei Hausbesetzerdemonstration in Frankfurt.
157
SERIE – TEIL 17 ❚ NACHGEHOLTES ERSCHRECKEN
RAF-Hungerstreik-Unterstützer in Frankfurt (1977)*: Aura einer sich selbst erfüllenden Wahrheit
SÜ
DD
. VER
LAG
Toter Häftling Baader (1977), vermummter Straßenkämpfer Fischer (1973)*: Märtyrer eines dritten Weltkriegs?
LUTZ K
LEIN
HAN
S /
FA
Z (
R.)

d e r s p i e g e l 3 5 / 2 0 0 1
neration, aus der die RAF-Leute selbst ka-men. Man kann das nicht außer Kritik stel-len, muss es aber als eine psychische Realitätanerkennen: Alle noch so erprobten insti-tutionellen Verfassungsregeln, alle noch sotief greifenden sozialen Strukturverände-rungen und alle noch so rasanten kulturel-len Wandlungsprozesse hatten den hartenKern des Misstrauens nicht auflösen kön-nen, den große Teile der bundesdeutschenNachkriegsgeneration gegen die eigene Ge-sellschaft und die Bonner Republik hegten.
Die prägende Erfahrung dieser Genera-tion war die massive „Rückkehr der Ver-gangenheit“ Anfang der sechziger Jahre.Man kann den Beginn fast genau datieren:auf die Welle der neonazistischen Synago-gen- und Friedhofsschändungen im Winter1959/60.
In die internationale Empörung misch-ten sich die systematischen Kampagnen derSED gegen „Bonner Altnazis“ (Fälschungeneingeschlossen), mit denen die Errichtungdes „antifaschistischen Schutzwalls“ in Ber-lin flankiert wurde. Innen- und Kultusminis-ter der Bundesrepublik beschlossen darauf-hin 1962 eine verstärkte „Erziehung zur De-mokratie“ als Auseinandersetzung mit demTotalitarismus, worunter (mit Zustimmungdes Kommissionsmitglieds Max Horkhei-mer) Kommunismus und Nationalsozialis-mus gleichermaßen verstanden wurden.
Die Erinnerung an die nationalsozialisti-schen Massenverbrechen, und insbesonde-re an den Judenmord, wurde durch den Je-rusalemer Eichmann-Prozess 1961 drastischaktualisiert und beschäftigte die jugendlichePhantasie, gerade wegen der von HannahArendt so bezeichneten „Banalität des Bö-sen“, verkörpert durch die farblose Aller-weltsfigur eines deutschen Spießbürgers. Ineiner Serie von Strafprozessen wurden zurselben Zeit NS-Täter, vor allem KZ-Scher-gen, vor die bundesdeutschen Gerichte ge-bracht. Das wichtigste und spektakulärsteVerfahren war der Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 1965.
Die Diskussion über die „Schuldfrage“kreiste zunächst darum, wie viel Verant-
Moralische Empörung und narzisstischeKränkung flossen zusammen.
Immerhin zeigte sich früh, dass ent-schiedene nationale (Selbst-)Kritik für unsNachgeborene auch narzisstischen Gewinnbedeuten konnte. Alle Besucher, von JohnF. Kennedy bis zu General de Gaulle, rich-teten feierliche Appelle an die „deutscheJugend“, von der die Zukunft des freienEuropa abhängen werde.
Überhaupt bedurfte es keines besonde-ren Raffinements, um zu bemerken, dassalle Hypotheken der Vergangenheit aucheine Art moralisches Negativkapital wa-ren. Die „heimatlosen Intellektuellen“ ausder Generation der Flakhelfer machtenvor, wie sich aus dem Fundus tragisch-pathetischer Unglücks- und Bedrohungs-gefühle ein eigentümlicher neudeutscherAvantgardismus entwickeln ließ.
In seinen Betrachtungen über „Politikund Verbrechen“ zog Hans Magnus En-zensberger die Eindrücke des Eichmann-Prozesses und der Kubakrise zusammenund bezeichnete das Arsenal der zeit-genössischen atomaren Vernichtungsmittel,speziell der USA, als „die Gegenwart unddie Zukunft von Auschwitz“. HannahArendt, auf die er sich dabei berief, protes-tierte in einem Brief gegen diese Gleich-setzung und bemerkte, sie werfe dem Au-tor nicht vor, dass er die deutsche Verant-wortung für Auschwitz bestreite, wohl aber,dass er sich „dafür noch eine Feder an den
wortung die Deutschen für den Ausbruchdes Ersten Weltkriegs trügen. Daraus ergabsich eine fatale, lastende Kontinuität zwi-schen 1914 und 1939, von Verdun undBrest-Litowsk bis Stalingrad und Ausch-witz.
Das alles war, ob wir es wollten odernicht, unsere Geschichte, aus der es keinenAusstieg gab. Dieses Bewusstsein bedeu-tete eine fundamentale Erschütterung des-sen, was Norbert Elias die „Wir-Schicht“ ei-ner Gesellschaft nannte – den Verlust deskindlichen Urvertrauens in die Gemein-schaft, aus der wir stammten und in der wir
aufwuchsen. Für die Her-anwachsenden, sofern siediese historisch-moralischeErblast verspürten, hießdas, dass sie sich in einemVakuum bewegten undIdeale und Vorbilder erstfinden mussten.
Die erste, vitale Reakti-on war wütende Distan-zierung. „Sie“ (die Älte-ren, die Eltern) hatten unsdas schließlich einge-brockt. Ihretwegen warenwir genötigt, uns ewig zurechtfertigen, standen wirnicht nur als die Verliererzweier Weltkriege, son-dern als die Verbrecherder Weltgeschichte da.
158
SERIE – TEIL 17 ❚ NACHGEHOLTES ERSCHRECKEN
DIE
GEG
ENW
ART
DER
VER
GA
NG
ENH
EIT
Beschmierte Kölner Synagoge (1959)Rückkehr der Vergangenheit
SÜ
DD
. VER
LAG
Demonstration gegen Notstandsgesetze in Bonn (1968): Verweigerung gegen das
UPI
/CO
RBIS
/PIC
TU
RE P
RES
S

d e r s p i e g e l 3 5 / 2 0 0 1
Hut stecken“ wolle.Und mit spitzer Intui-tion fügte sie hinzu:„Oh, Felix Culpa!“ –oh, glückliche Schuld.
Damit war erstmals die Tendenz unterden jüngeren linken, antifaschistischenDeutschen benannt, die sich „Auschwitz“als eines negativen Mythos und einer uni-versellen politischen Formel bemächtigten.Diese Formel wies – und darin lag der Ge-winn – einen Ausweg aus der unerträgli-chen Spannung, in die jeder versetzt wur-de, der ernsthaft versuchte, sich die Ver-brechensgeschichte des Dritten Reichs „zuEigen“ zu machen. Schließlich handelte essich um Geschehnisse, die jedes mensch-liche Maß überstiegen und nur Taubheit,Horror und Scham hinterließen. „Und inden Herzen Asche“, wie Wolf Biermanndamals sang.
Die generationstypische Reaktion be-stand in den sechziger Jahren in der Iden-tifikation mit den Opfern. Auch wir warenim Grunde „Verfolgte des Nazi-Regimes“!Rudi Dutschke, der als Jugendlicher phan-
Selbstdeklaration der Jugendbewegung1967/68 als „antiautoritär“ bezeichnete jaweniger ein spontanes Lebensgefühl alseine ganze theoretische Weltsicht. Damitwar eine radikale politische Opposition ge-gen einen „autoritären Staat“ und einebürgerlich-kapitalistische Gesellschaft ge-meint, deren Macht- und Ausbeutungs-strukturen sich in der „autoritären Per-sönlichkeit“ ihrer Subjekte verankert habe.
Der Schuss vom 2. Juni 1967 (der Tod desStudenten Benno Ohnesorg durch denaußer Kontrolle geratenen Polizisten Karl-Heinz Kurras) vereinte denn auch Zehn-tausende in dem Gefühl, dass „sie“ jetzt be-gonnen hatten, auf „uns“ zu schießen. Vonnun an war Bundespräsident Heinrich Lüb-ke ein „KZ-Baumeister“ und Kanzler Kurt-Georg Kiesinger ein „Altnazi“, waren dieNotstandsgesetze ein zweites „Ermächti-gungsgesetz“ und die Große Koalition un-mittelbare Vorstufe für ein „neues 33“.
Natürlich war die reale Bundesrepublikunübersehbar anders. Sie befand sich ineinem anhaltenden Modernisierungsschub.Schon die Große Koalition baute die staat-lichen Sicherungen der „sozialen Markt-wirtschaft“ weiter aus und überwand miteiner „neuen Ostpolitik“ die Rolle desLandes als Frontstaat. Nicht nur die rest-lichen Vertreter eines „Revanchismus“schienen weitgehend in die Nachkriegs-republik integriert, sondern eine Mehr-heit der Bundesbürger schrieb den ande-ren deutschen Staat hinter der Mauer alshistorische Konkursmasse ab, um neuenUfern zuzustreben.
Gerade in dieser chamäleonhaften Rea-litätstüchtigkeit konnte man allerdings auchetwas Abgründiges und zugleich Unan-ständiges sehen. Und nicht nur die 68erJugend, auch ein Großteil der internatio-nalen Öffentlichkeit misstraute dieser „De-mokratie ohne Demokraten“, wie es da-mals noch oft hieß, einem mit schiererWirtschaftskraft vollgepumpten, undefi-nierbaren Mutanten, dessen politische Zu-kunft, so schien es, völlig offen lag.
Dennoch: Der durchschlagende Erfolgder jugendlichen Protestbewegung damalsist damit noch nicht erklärt. Ihre Aktionenwaren, wie Walter Jens im Sommer 1967feststellte, „zum Generalthema des deut-schen Fernsehens“ geworden. Allein achtSPIEGEL-Titel in den Jahren 1967/68 galten der Studentenbewegung und der Außerparlamentarischen Opposition.Kaum anders hielten es die „Zeit“ oderdie großen Tageszeitungen, einschließlichder Springer-Presse, die sich (zumal in derFrontstadt West-Berlin) in einen Clinchverwickelte, der letztlich zu ihren Unguns-ten ausging. Das „Establishment“, die Pro-fessoren, die Journalisten, die Politiker,suchte die Diskussion mit den antiauto-
* Oben: 1941 in Peenemünde mit Rüstungsminister FritzTodt (M.) und Oberstleutnant Walter Dornberger, Leiterdes Raketenbauprogramms (r.); unten: nach Beate Klars-felds Angriff auf dem CDU-Parteitag 1968 in Berlin.
tasiert hatte, er sei in Wahrheit der Sohn ei-nes versteckten Juden, sprach als BerlinerStudentenführer wiederholt davon, dassdie Herrschenden die Demonstranten „zuJuden machen“ wollten, wobei aber dieStudenten nicht die Rolle wehrloser Opferspielen würden.
Zur Identifikation mit den Opfern gehör-te komplementär die scharfe Abgrenzungvon den Tätern. „Machen wir Schluss da-mit … dass die ganze Nazi-Scheiße von ges-tern weiterhin ihren Gestank über unsereGeneration bringt“, hieß es 1967 etwa in ei-nem Berliner Flugblatt, das einen „Auf-stand gegen die Nazi-Generation“ prokla-mierte. Damit wurde, fast in Umkehrungder völkischen „Blutsbande“, eine quasibiologische Trennlinie gezogen.
Dazu kam die umfassende Politisierungund Ideologisierung im Gefolge derGroßen Koalition seit 1966. Schon die
159
Attackierter Kiesinger*Als „Altnazi“ geohrfeigt
SÜ
DD
. VER
LAG
ULLS
TEIN
BIL
DER
DIE
NS
T
Establishment
„Die Isolationsfolter wird zur Disziplinierung eingesetzt gegen jeden, der im Gefängnis gegen diefortdauernden Missstände Widerstand leistet.“ Aus einem Aufruf von RAF-Strafverteidigern
Ingenieur Lübke, NS-Prominenz*Als „KZ-Baumeister“ geschmäht

d e r s p i e g e l 3 5 / 2 0 0 1
ritären Rebellen, die sich umso mehr in„Großer Verweigerung“ übten.
So glich die Revolte jenseits der West-Berliner Frontstadterhitzungen (die einereigenen Dynamik unterlagen) weithin einerFlucht aus einer fürsorglichen Belagerung.Das wahre Schreckenswort hieß: „Integra-tion“. Alle Strategien der „Provokation“zielten darauf ab, die Herrschenden endlichzu zwingen, ihre Maske der „repressivenToleranz“ fallen zu lassen.
Als Anti-Autoritäten zitierte die 68er Ge-neration eine Reihe lebender oder toterGroßtheoretiker, aus deren Schriften sie ei-nen ganz eigenen marxistisch-freudiani-schen Jargon revolutionärer Eigentlichkeitkreierte – ein „jüdisch-intellektuelles Rot-welsch“ (so Reimut Reiche), das als Sprache
der „Bewusstmachung“ und damit als in-formelles Erkennungszeichen diente.
Dabei waren diese Akte wild entschlos-sener Aneignung, namentlich im Falle derVäter der „Kritischen Theorie“, eher Akteintellektueller Enteignung. Gerade die Tex-te aus den dreißiger Jahren, die Max Hork-heimer und Theodor W. Adorno als Teil ih-rer politischen Irrtumsgeschichte nicht wie-dergedruckt sehen wollten, fanden sich nunals Raubdrucke auf den Büchertischen derStudentenbuchhandlungen. Gerade diese„Stellen“ mussten nun als politische Schlüs-selzitate herhalten, vor allem die formelhaftverkürzte Sentenz: „Wer aber vom Kapita-lismus nicht reden will, muss vom Faschis-mus schweigen.“
Denn darum ging es eigentlich: SämtlicheAnalysen der bürgerlichen Gesellschaft ver-wandelten sich in den Augen ihrer jugend-
tionalen Vietnam-Kongress in West-Berlinim Februar 1968 skandiert, die trotzkisti-sche oder maoistische Gruppen vertraten.„Weder Frankreich noch Italien, nochDeutschland konnten es den USA verzei-hen, dass sie sie vom nationalsozialistischenund faschistischen Joch befreit hatten“,schrieb der Philosoph Pascal Bruckner.
Gerade der Vergleich mit Frankreich isterhellend. Dort speiste sich die Oppositiongegen das autoritäre Regime Charles deGaulles im Besonderen und den westlichenNeokolonialismus im Allgemeinen aus ei-nem Fonds frischer, lebendiger Erfahrun-gen und Enttäuschungen, aber auch posi-tiver nationaler Traditionen. In Deutsch-land dagegen fehlte derlei Verbindendesund Verbindliches. Hier dominierte in der
Opposition zur eigenen Gesellschaft undGeschichte das Abstrakte und Absolute.
Als archimedischer Punkt, von dem ausdie korrumpierte Bourgeoiswelt der Elternaus den Angeln gehoben werden sollte,diente allen radikalen Jugendbewegungendieser Zeit neben der mythischen Retter-figur des roten Proletariers die Konstruk-tion einer revolutionären „Dritten Welt“.Der Satz Ché Guevaras, des Märtyrers die-ses dritten und aus Sicht seiner Bewunde-rer gerechten Weltkrieges, wonach keinehöhere Ehre denkbar sei, als den Kampf imLeib der Bestie selbst, dem Imperialismus,aufzunehmen, wirkte wie ein Testament.
So ist es kein Zufall, dass gerade nachdem „Machtwechsel“ 1969 ein Großteil deraußerparlamentarisch Bewegten sich imunüberschaubaren Geflecht linksradikalerGruppen und Initiativen einigelte. Ein
lichen Nachbeter in Faschismus-Theorien.Der Kapitalismus im Stadium seiner histo-rischen Überfälligkeit, also seit mindestenseinem halben Jahrhundert, führte demnachin jeweils neuen, offenen oder verdecktenFormen unweigerlich zur offenen oder ka-schierten Diktatur der Bourgeoisie, alsozum Faschismus. Die konkrete Auseinan-dersetzung mit der Verbrechensgeschichtedes Nationalsozialismus löste sich damit aufin den Kampf gegen das eigentlich totalitä-re System: den Kapitalismus.
Das bedeutete inmitten aller politischenVerschärfungen eine enorme psychischeEntlastung. Denn die antikapitalistischeAnalyse erklärte nicht nur, und nicht einmalin erster Linie, die Verhältnisse in Deutsch-land (West), sondern in der „freien Welt“ im
Ganzen, und vor allem in den USA. Denndie waren, wie der mörderische Krieg in Vi-etnam und die brennenden Ghettos deramerikanischen Großstädte selbst zu be-weisen schienen, das Zentrum des moder-nen Weltfaschismus und Weltimperialismus.Die „alten Nazis“ und verräterischen Sozi-aldemokraten in Bonn waren in dieser Lo-gik die willigen Helfer der falschen Befrei-er, die jetzt als Beherrscher der freien Welterschienen.
Der Vietnamkrieg diente 1968 als Kris-tallisationskern einer „Internationale derJugend“. Die Parole „USA-SA-SS“ wurdeauch von den hypermilitanten französischenund italienischen Teilnehmern am Interna-
* Links: 1939 in Polen beim Einsatz einer deutschen Poli-zei-Einheit; rechts: Vietcong-Verdächtige mit Angehöri-gen der südvietnamesischen Armee und US-Soldat 1965.
160
SERIE – TEIL 17 ❚ NACHGEHOLTES ERSCHRECKEN
BPK
(L.)
; TIM
PAG
E /
CO
RBIS
/ P
ICTU
RE P
RES
S (
R.)
DIE
GEG
ENW
ART
DER
VER
GA
NG
ENH
EIT
Verhöhnter Jude, gefangene Vietnamesen*: „Wer vom Kapitalismus nicht reden will, muss vom Faschismus schweigen“

langes „rotes Jahrzehnt“ hindurch be-herrschten sie in den siebziger Jahren nichtnur die Straßen und Plätze der großenStädte – vor allem in Hamburg, Frankfurtund Berlin –, sondern auch viele intellek-tuelle und künstlerische Foren der Repu-blik. Daneben bildete sich der „Unter-grund“ der Terroristen, die mit Gewalt aus-agierten, was auch andere „im Prinzip“ fürnotwendig hielten, aber aus taktischenoder praktischen Gründen nicht bereit wa-ren zu tun.
Aber wie der Argentinier Guevara hin-ter seinem Image eines selbstlosen Mensch-heitsrevolutionärs den weißen Latino-Chauvinisten und Yankee-Hasser nie ver-bergen konnte, so hatten auch seine deut-schen Jünger ihre allzu deutschen Motive.
Ab Sommer 1969 ergosssich ein Strom deutscherRevolutionstouristen in diepalästinensischen Ausbil-dungslager. Und der be-waffnete Kampf in Deutsch-land sollte ausgerechnet am9. November 1969 mit ei-nem Sprengstoffanschlagauf das Jüdische Gemein-dezentrum in West-Berlineröffnet werden. Die Bom-be, deren Zünder jedochfalsch eingestellt war, hättevermutlich etliche Besucherder Gedenkfeier an dasNazi-Pogrom vom Novem-ber 1938 zerfetzt. Das be-gleitende Flugblatt prokla-mierte das Ende des „hilf-losen Antifaschismus“, derdas „Produkt des deutschenSchuldbewusstseins“ sei. Esrief zur klaren und einfa-chen Solidarisierung mitden Fedayin und zur Grün-dung „einer revolutionärenBefreiungsfront in den Me-tropolen“ auf.
Auf diese Weise begabensich sämtliche westdeut-
schen bewaffneten Gruppen – die RAF, der„2. Juni“, die „Revolutionären Zellen“ –über ein Jahrzehnt hinweg in eine regel-rechte Symbiose mit den extremsten paläs-tinensischen Terrorgruppen. Die Pro-grammschrift dazu hatte wiederum UlrikeMeinhof geliefert.
Eine Schlüsselszene dieser Zeit: In Köln-Ossendorf, ihrer imaginären „Gaskammer“also, verfasst sie im Herbst 1972 eine langeErklärung zur „Aktion des Schwarzen Sep-tember“, bei der ein palästinensischesKommando israelische Sportler währendder Olympischen Spiele in München alsGeiseln nahm. Ulrike Meinhof rühmte dasals exemplarische revolutionäre Tat, die„gleichzeitig antiimperialistisch, antifa-schistisch und internationalistisch“ gewe-sen sei, da sie die enge Komplizenschaftzwischen den „Charaktermasken des
(Selbst-)Opfer der Kinder gesühnt wird, in der antiken Legende von Ödipus fin-den will oder, wie unlängst Stephan Wack-witz, eher in Shakespeares Hamlet unddem abgründigen Todesspiel im HauseDänemark: Alles läuft darauf hinaus, dassmaßgebliche Teile dieser ersten deutschenNachkriegsgeneration das Drama der„unbewältigten Vergangenheit“ noch ein-mal in fieberhaften Tagträumen undgewaltsamen Ausbrüchen durchgespielthaben. Ein Generationsbruch nach demZivilisationsbruch.
Erst mit dem Fall der Mauer 1989 ist dasGros der Teilnehmer dieses imaginärenlangen Marsches, wie in einer anderen,zweiten Wiedervereinigung, auf dem Bo-den dieser Republik angekommen.
‚Rechtsstaats Bundesrepublik‘“ als Nach-folgestaat des Dritten Reichs und „IsraelsNazi-Faschismus“ entlarvt habe.
Als Tiefpunkt aller deutsch-palästinensi-schen Aktionen gilt zu Recht die Entführungeiner aus Tel Aviv kommenden Maschinenach Entebbe (Uganda) im Juni 1976, beider die deutschen Terroristen Wilfried Böseund Brigitte Kuhlmann jüdische Passagiereselektieren halfen, die erschossen werdensollten. Aber Entebbe war nur eins von vie-len mörderischen Projekten dieser Art – bishin zu den Attentatsplänen gegen promi-nente Vertreter der jüdischen Gemeinden inder Bundesrepublik, die Hans-JoachimKlein bei seinem Ausstieg aus dem bewaff-neten Untergrund 1977 publik machte undso womöglich verhinderte.
Aber was führte das Gros der deutschenTerroristen von „Auschwitz“ nach Enteb-be? Mit der probaten Formel vom „linkenAntisemitismus“ ist wenig gewonnen.Tatsächlich handelte es sich weniger umeine „Wiederkehr des Verdrängten“, alsvielmehr um brachiale Versuche der Be-freiung von der Last der deutschen Ge-schichte. Und die neue Freiheit musste sichgerade im Angriff auf diejenigen bewähren,die für die Kränkung des Selbstbildes alsDeutsche sorgten: die Juden, die man jetztnur als „Zionisten“ bezeichnete.
Aber nach derselben Logik waren es auchdie „alten Nazis“ und die „Generation vonAuschwitz“, von deren lastender Präsenzman sich zu befreien suchte. So kulminiertdie Geschichte des deutschen Terrorismus –und mit ihm des Linksradikalismus diesesJahrzehnts – schließlich in einer Aktion, inderen Zentrum eben nicht Heinz Galinskials Repräsentant der jüdischen Gemeindenstand, sondern Hanns Martin Schleyer als„Boss der Bosse“ und „alter Nazi“ dazu.
Ob man das mythisch-metaphorischeAbbild dieses Vatermords, der mit dem
Entführter Arbeitgeber-Chef Schleyer (1977)Suche nach Charaktermaske
Olympia-Attentäter in München (1972)Als revolutionäre Tat gerühmt
PAN
DIS
/ T
ELEPR
ES
S
161d e r s p i e g e l 3 5 / 2 0 0 1
GERD KOENENbefasst sich als freierPublizist mit politikge-schichtlichen Themenin Europa. HistorikerKoenen, 56, schriebüber Führerkult undMachtapparate in derUdSSR („Utopie derSäuberung“). In sei-nem jüngsten Buch„Das rote Jahrzehnt“ lieferte der frühereLinks-Aktivist eine Polemik gegen die radika-len Gesellschaftsveränderer von 1968.
AR
GU
M
Im nächsten Heft lesen Sie: Teil 18
NAZI-JAGD MIT HINDERNISSENWeltweit dauert die Verfolgung von NS-Verbrechenan. Allzu lange haben Politik, Justiz und sogarkirchliche Stellen die Täter vor Strafe geschützt.

d e r s p i e g e l 4 / 2 0 0 1
siebziger Jahren zur Ikone des ewigenStraßenkämpfers, der Steine wirft und sichmit Polizisten prügelt (SPIEGEL 3/2001).
So entstand auch das Zerrbild eines lin-ken „Gewaltmilieus“, in dem Schlagen undTreten zur normalen Alltagsbeschäftigungzu gehören schien. Zur historischen Wahr-heit gehört aber auch, dass es brutale Polizeieinsätze gab, bei denen das Ein-prügeln auf am Boden liegende Demon-stranten, unter ihnen Frauen, keine Sel-tenheit war.
In einer Aktuellen Stunde des Deut-schen Bundestages wurde nun jener„Oberrealo“, der ein Jahrzehnt lang diePartei der Grünen unter Mühen zur un-zweideutigen Anerkennung des parlamen-tarisch-demokratischen Rechtsstaats undseines Gewaltmonopols gedrängt hat, alsSympathisant von Terroristen verdächtigt,in dessen Wohnung womöglich von „Car-los“ stammende Maschinengewehre samtSprengstoff gelagert worden seien – aberauch als Spitzel des Verfassungsschutzes,der sich im Jahre 1976 so vor weiterer Straf-verfolgung habe freikaufen können.
192
W.KUNZ / BILDERBERG / XXP (li.); MCBRIDE / FOCUS PLUS / XXP (Mi.); STAATSARCHIV HAMBURG / DER SPIEGEL / XXP (re.)
L.
CH
APER
ON
„Das sind keineJugendsünden …In dieser Biogra-fie steckt einStück Überschrei-tung jeglichendemokratischenRechtsstaates. “ Wolfgang Gerhardt,
FDP-Vorsitzender
Während der gut zweistündigen Live-Übertragung der erregten Parlamentsde-batte am Mittwoch vergangener Woche,eine Mischung aus Mini-Purgatorium,gemäßigter Urschrei-Therapie und Stupa-Sitzung, schalteten über 700 000 Zuschau-er den Ereignissender Phoenix ein – bei der zweiten (!) Wiederholung am spätenAbend waren es zeitweise gar 1,5 Millio-nen, insgesamt fast eine Verzehnfachungder durchschnittlichen Einschaltquote.
Dass Fischer eine geradezu phantasti-sche Projektionsfläche abgibt, die Hass und
D E B A T T E N
Zorn auf die roten JahreDie Polemik gegen die militante Vergangenheit von Joschka Fischer wird zum Strafgericht über eine
ganze Generation: Die Revolte von 1968, so konservative Kritiker, war ein einziger monströser Irrtum.Wird dem Mythos vom berechtigten Aufruhr der Linken der Garaus gemacht? Von Reinhard Mohr
Schon jeder distanzierte Beobachter,der über Silvester Urlaub vom kaltenReich der deutschen Leitkultur mach-
te und erst in diesen Tagen zurückkehrte,musste sich die Augen reiben: Eine bizar-re Metamorphose hatte sich des deutschenAußenministers bemächtigt, ein rasender,surreal anmutender Paradigmenwechsel,der die Republik bewegte.
Joschka Fischer, dem Kritiker von linksbis rechts im Zweifel stets die verwerflicheAnpassung an die bürgerliche Gesellschaftvorhielten, stand plötzlich als unverbes-serlicher Gewalttäter am Pranger – alsreueloser, ja sündenstolzer Ex-Revolu-tionär, der seinen schwarzen Kampfdressaus alten Sponti-Zeiten im Geiste noch un-term feinen Dreiteiler trägt. Nicht wenigewerfen ihm nun beides zugleich vor: seineVergangenheit und seine Gegenwart.
Eben noch gab er das Bild des Verrätersrevolutionärer Ideale ab, der seine mili-tante Geschichte längst hinter sich gelassenhat und wie selbstverständlich mit denGroßen dieser Welt parliert, und schonmachten ihn ein paar Fotos aus den frühen

Sympathie auf sich zieht, das ist nicht neu– und es ist auch nicht überraschend, dasser zeitweise selbst Boris, Babs & BSE vonPlatz 1 der Schlagzeilen verdrängte.
Neu an der teils hysterischen Debatteüber Fischers Rolle in der FrankfurterSponti-Szene ist der Gestus der pharisäer-haften Teufelsaustreibung, mit der samt derPerson gleich eine ganze Epoche – und eineganze politische Generation – ex post undin einem Aufwasch erledigt werden soll.
Eine „Verortungsdebatte der BerlinerRepublik“ nennt dies sprachsensibel Wolf-ram Weimer, Chefredakteur der „Welt“,neben Scharfrichter Johann Michael Möl-ler daselbst einer der leitenden Oberförsterbei der Joschka-Jagd.
Das politische Ziel ist klar: Dem 68er-Mythos vom zornigen, im Kern berechtig-ten Aufruhr der Linken gegen ein politischrepressives, geschichtsvergessenes undauch sexuell verklemmtes Establishmentsoll der Garaus gemacht werden.
Recht auf die zweite Zwischenfrage an denAußenminister.
Der zuständige Sprecher der nachgebo-renen „Generation Golf“, Florian Illies, 29,nannte Fischer in der „FAZ“ zwar einen,der „in seiner staatsmännischen Arroganz,seiner Wichtigtuerei ... oft unerträglich“sei „und jedenfalls niemand, dem manSympathien entgegenbringen müsste“ –doch vehement wandte Illies sich gegendas „gnadenlose Anständigkeitspathos“der neuen „christdemokratischen Tugend-wächter“, die nun in „merkwürdigerSelbstgerechtigkeit“ alles unter einen „Sitt-lichkeitsverdacht“ stellten, was dem „deut-schen Kontinuitätswahn“ zu widerspre-chen scheine.
Der neueste Aufstand der Anständigensignalisiert: Die Studentenrevolte, auchwenn sie damals ein weltweites Ereignisvon Paris bis San Francisco war, ist in derchristdemokratischen Interpretation nurals ein einziger gewalttätiger Irrtum der
Seit die deutsche Linke beim Fall derMauer 1989 eine überaus schlechte, zu-weilen peinliche Figur gemacht hat, wirdversucht, rückwirkend auch mit demgroßen Rest aufzuräumen, mit jenen Jahren, da der Zeitgeist so links war wie der Grieche an der Ecke und der Suhr-kamp Verlag; mit einer Zeit, als RCDS-Vorsitzende einfach nur ignoriert odergleich aus dem Saal getragen wurden –wie MdB Friedbert Pflüger erregt seinepersönliche Erfahrung mit den 68ernresümierte.
Jetzt ist die Rache der Braven für diesefortdauernde Schmach angesagt, der An-griff der immer schon guten Gegenwart aufdie böse übrige Zeit. Erst recht dann, wenndie Immer-schon-Anständigen stets vonNeuem daran erinnert werden, dassdas Leben vieler irrender Rebellen voneinst aufregender war – und ist – als Kreis-versammlungen der Jungen Union und dieCDU-Hinterbank im Bundestag mit dem
d e r s p i e g e l 4 / 2 0 0 1 193
Kultur
AP
F. O
SS
EN
BR
INK
A.
ALT
WEIN
/ D
DP
„Ich habe damalsUnrecht getanund mich dafürzu entschuldigen… Ich habe michaus Überzeugungzum Demokratengewandelt.“
„Sie wollen nichturteilen, Sie wol-len verdammen …Sie wollen seinepolitische Exis-tenz vernichten –Sie werden esnicht erreichen. “
„Er soll Buße tun.Der Staat hat inden siebziger Jah-ren keine Fehlergemacht.“
Gerhard Schröder,Bundeskanzler, SPD
Angela Merkel,CDU-Vorsitzende
Joschka Fischer,Außenminister, Die Grünen
Demonstration gegen den Vietnamkrieg in Berlin (1968), lebende Installation „Weltuntergang“ (1970), Studentenprotest in Hamburg (1967)
Kampf gegen ein erstarrtes, geschichtsvergessenes, verklemmtes Establishment

d e r s p i e g e l 4 / 2 0 0 1
Geschichte akzeptabel. Nach dem Willender CDU-Vorsitzenden Angela Merkelkann es nur ein politisch korrektes Ver-hältnis zu 68 geben – das der eindeutigen„Distanzierung“.
Diese Mischung aus Chuzpe und unbe-schwerter Kenntnislosigkeit kommentierteder Berliner „Tagesspiegel“ mit den Wor-ten, hier werde den 68ern tatsächlich zumVorwurf gemacht, „dass es sie überhauptgegeben hat“ – obwohl „die BRD zu jederZeit die beste aller möglichen Welten war“.Logo: „Genauso steht es in FähnleinführerFieselschweifs Pfadfinderhandbuch.“
Doch im überhitzten Fieber der Treib-jagd, die so gar nicht zum christlichenForderungskanon von Beichte, Reue, De-
mut und Buße passen will, ist der konser-vativen Opposition ein schlichtes Faktumentgangen.
„1968“ war bis vor wenigen Tagen nochein historisches Datum, das die Schülerin-nen und Schüler von heute nur zum Gäh-nen reizte, der „Generation Golf“ am iMacnormalerweise nicht einmal mehr ein mü-des Lächeln abringt und den ergrauten Ve-teranen nur noch zu ganz hohen FeiertagenAnlass bietet, bei Rotwein und toskani-schem Ziegenkäse von jenen alten Zeitenzu reden, da die Samstagsdemo mit oderohne Straßenkampf fester Bestandteil desAlltagslebens war, das sich im Übrigen zwi-schen Wohngemeinschaft, Uni, Druckkol-lektiv, Badesee, Grüneburgpark und Stadt-teilplenum bewegte.
Nicht zu vergessen: Der „typische 68er“,ob als Lehrer, Müsliman oder zotteligerGlobetrotter, wurde zur reinen Karikatur,zum unerschöpflichen Reservoir für Kaba-rett und Comedy.
Doch deutsche Vergangenheitsbewälti-gung, recht verstanden, folgt ihren eigenenehernen Gesetzen: dem ewigen Konti-nuitätsverdacht (neuer Faschismus versuslinker Terror) und einem moralischen Ri-
„68“ hätten instruktive Lektüre bis zumnächsten Bundestagswahlkampf.
Doch jenseits all dessen gibt es ein ganzanderes, nicht kriminalistisches Geheim-nis der Vergangenheit, jenes „schwarzeLoch“ der kollektiven Erinnerung, das derHistoriker, Autor und Ex-Maoist GerdKoenen, 56, in seinem Buch über die sieb-ziger Jahre „Das rote Jahrzehnt“ (erscheintim April bei Kiepenheuer & Witsch ) zu be-schreiben versucht.
Schon 1980 schrieb Hans Magnus En-zensberger, wie stets allen anderen zuvor-kommend, ein Gedicht unter dem Titel„Andenken“:
Also was die siebziger Jahre betrifftkann ich mich kurz fassen …Widerstandslos, im großen und ganzen,haben sie sich selbst verschluckt …
Dass irgendwer ihrer mit Nachsichtgedächte, wäre zu viel verlangt.Und tatsächlich, wenn es heute darum
geht, sich die damaligen „revolutionären“Motivationen noch einmal zu vergegen-wärtigen, sich zu fragen, „woher diese vonlebendigen Erfahrungen und Interessenfast unberührte, abstrakte Theorie- undOrganisationswut, diese jederzeit abrufba-re Militanz und Empfänglichkeit für welt-revolutionäre Phraseologien eigentlich ka-men“ (Koenen), dann spürt jeder Ex-Akti-vist dieses schwarze Loch, die Schwierig-keit und auch den Unwillen, sich in die sofern scheinende Zeit zurückzuversetzen.
Und es stimmt ja auch: Da wurde trotzaller biografischen und politischen Brüchemanches verdrängt und verklärt, schlichtvergessen oder zum Stoff herzerwärmen-der Anekdoten verarbeitet.
Immerhin, einen sachdienlichen Hinweisfür die Suche nach der verlorenen Zeit, nachihrem Geschmack, ihrer Verrücktheit undeigentümlichen Anziehungskraft liefert Koe-nen bereits im Vorwort seines Buches:
Der imaginäre Anschluss an die „wirk-liche Geschichte“, den wir so fieberhaftsuchten, war also eine Flucht aus der un-
gorismus, der selten Gefahr läuft, sich ein-mal selbst praktisch bewähren zu müssen.
Außer Hitler (und der Nazi-Herrschaft)ist kein Ereignis der jüngeren deutschenGeschichte derart ausgiebig, leidenschaft-lich und ergebnislos diskutiert worden wiejene letzte „Revolution“, die heute so weitentfernt scheint wie der Mond.
Zu jedem runden Jahrestag – der letztewar 1998 – ergoss sich eine Flut von his-toriografischen, selbstreflexiven und ideo-logiekritischen, aber auch literarischenWerken auf den Büchermarkt: von Bom-mi Baumanns militantem Szene-Bekennt-nis „Wie alles anfing“ (1975) über PeterMoslers „Was wir wollten, was wir wur-den“ (1977) bis zu F. C. Delius’ Roma-
nen und Peter Schneiders Essays.
Zahllose Fernseh-Dokumentationen,„Arte“-Themenabende und TV-Diskussi-onsrunden zur besten Sendezeit – unver-gessen 1978: Rudi Dutschke und DanielCohn-Bendit im mehrstündigen verbalenNahkampf mit Matthias Walden und KurtSontheimer – rückten immer wieder diegroße Auseinandersetzung über parla-mentarische und außerparlamentarischeOpposition, über Demokratie, Gewalt unddas Recht auf zivilen Ungehorsam, Kapi-talismus und Entfremdung in den Mittel-punkt der streitenden Öffentlichkeit.
Ganze Bibliotheken von Sekundärlite-ratur beschäftigen sich mit nahezu jedemAspekt der Revolte und ihren Ausläufern– allein der Hamburger Politikwissen-schaftler Wolfgang Kraushaar füllt mit sei-nen minutiösen Analysen der Epoche meh-rere Regalmeter (zuletzt: „1968 als Mythos,Chiffre und Zäsur“).
Und wären es nur all die „Kursbücher“,1965 von Hans Magnus Enzensberger ge-gründet, jene laufende Chronik des Den-kens und Fühlens der neuen Linken, gernauch die einschlägigen Artikel im „Pflas-terstrand“, in „Konkret“ und der „Tages-zeitung“ – die verspäteten Kämpfer gegen
194
Kultur
Terroristenmord: Schleyer-Entführung in Köln (1977)
Friedlicher Protest: Lichterkette gegen den Bau einer
Bahntrasse zwischen Hamburg und Bremen (2000)

d e r s p i e g e l 4 / 2 0 0 1
erträglichen Leichtigkeit unserer eigenenLebenswelt, der wir nicht trauten, zurückin das Zeitalter der Weltkriege und Bür-gerkriege, das uns viel „realer“ und ge-genwärtiger erschien.
Die Frankfurter Spontis allerdings woll-ten, trotz aller Leidenschaft für Theorieund Endlosdiskussion, von dieser Fluchtin das Zeitalter der russischen Revolutionwenig wissen. Sie schufen sich im Lauf derJahre, die der Auflösung der alten Apo und des SDS folgten, ihre eigene Lebens-wirklichkeit.
Das Leben im Kollektiv, ob Wohnge-meinschaft, Alternativprojekt oder Sponti-Plenum, war Mitte der siebziger Jahre fürTausende von „Genossinnen und Genos-
sen“ der Normalfall geworden. Es war derVersuch frei nach Adorno, „ein richtigesLeben im falschen“ zu führen, eine sub-kulturelle, durchaus hedonistische, le-bensbejahende Gegengesellschaft zu jenemzerstörerischen Kapitalismus zu etablieren,der samt seinem Staat zum Feind erklärtwurde – ganz egal, wer gerade Bundes-kanzler war.
Denn „das Ganze war das Unwahre“,und die Wirklichkeit hatte keine Chancegegen die Ideologiekritik, schon gar nichtgegen die unstillbare Sehnsucht nach dem„ganz Anderen“.
Die Zauberworte hießen „Theorie undPraxis“, „System“, „Widersprüche“, „dia-lektischer Umschlag“, „Massen“, „Basis“,„Kampf“, „Bewegung“, „Identität“, „Ent-fremdung“ und „Betroffenheit“.
Alles war irgendwie politisch, doch dasPolitische war immer auch privat – wieauch umgekehrt. Alles war falsch, und al-les musste anders werden.
Die Befreiung der Sexualität, neben demDauerkonflikt mit der Elterngeneration (in-klusive alter Nazis) großes Thema schon1968, differenzierte sich allmählich in dieunendlichen Probleme der „Beziehungs-
Selbst ein berühmter Philosoph wie Her-bert Marcuse schrieb damals eine teilskitschig wirkende Befreiungsprosa, und dieungezählten schriftlichen Zeugnisse dieserEpoche sind für viele Zeitgenossen immerwieder Quell ungläubigen Staunens undpeinvoller Erinnerung, aber auch großerHeiterkeit.
1979 resümierte Joschka Fischer imFrankfurter „Pflasterstrand“:
Unsere Revolution gab es einfach nicht,weder hier noch in Vietnam, Persien oderChina, es gab und gibt sie lediglich inuns. Mit Revolution verbanden wir nie-mals nur einen politischen Umsturz, ei-nen anderen Staat, eine andere Macht-und Eigentumsverteilung, sondern viel-mehr die Verneinung all dessen. KeinStaat, keine Macht und kein Eigentum.
Und so war diese Revolution der NeuenLinken von Anfang an eine unpolitischeRevolution, eine Revolution gegen die Po-litik, und entsprechend unwirklich (abersehr wirksam!) fiel sie dann auch aus.
Ist die „Freiheitsrevolte“ (Fischer) von68 in Wahrheit also eine große Lüge, einreiner Mythos – oder hat sie, obwohl sienicht „demokratisch“ war, das Land den-noch demokratisiert und liberalisiert, wiees der bisherige Konsens der „Berliner Re-publik“ nahe legt?
Eine unaufgeregte und pragmatischeAntwort kommt wieder einmal aus demWesten – in diesem Fall von einem Deut-schen, der britischer Staatsbürger gewor-den ist: Lord Ralf Dahrendorf, der als „Ba-ron of Clare Market in the City of West-minster“ im Londoner Oberhaus sitzt.
Vergangene Woche sagte er: „1968 wareine verständliche Revolte in einer verfah-renen Situation“.
In jenen wilden Tagen war Dahrendorfeiner der herausragenden politischen Antipoden des Studentenführers RudiDutschke.
Was den Rest der Geschichte betrifft:Der Kampf geht weiter. ™
kiste“ aus. Auch die wurde zuweilen öf-fentlich ausgepackt in jener Sponti-Szene,die die Beteiligten nur englisch „scene“aussprachen, beinah so wie „family“ und„good vibrations“. Die Frauenbewegungattackierte die Machos und erzwang De-batten über Macht, Lust und Geschlechtin den selbst gebauten Hochbetten zwi-schen Bornheim und Westend.
Und die Musik. Die Musik war überall –von den Rolling Stones über Velvet Un-derground bis zu den Doors. Sie verliehden Dingen Flügel. Ansonsten lauerteüberall die „Repression des Staatsappara-tes“, dem manchmal nur mit „Gegenge-walt“ ein wenig beizukommen war. Trotz„Putzgruppe“: Meistens lief man vor den
Knüppel schwingen-den Polizeihundert-
schaften weg, so schnell es ging. Hilfreichwar immerhin der Aufbau von „Gegenöf-fentlichkeit“. Aus Flugblättern und Infoswurden Zeitungen und Zeitschriften. Einehieß „Informationsdienst zur Verbreitungunterbliebener Nachrichten“, kurz „ID“.
„Wir konnten mit dem Lächeln der Frei-heit den größten Unsinn sagen“, bemerk-te Daniel Cohn-Bendit, und es ist wederKoketterie noch Sündenstolz, wenn derEx-Frankfurter Wolfgang Kraushaar fest-stellt: „Im Grunde wäre seinerzeit ein Eth-nologe am besten geeignet gewesen, dieauf einer Art von Tribalismus gründendenVerkehrsformen zu analysieren.“ „Ver-kehrsformen“, auch ein altes Zauberwort.
Der Übergang von der antiautoritärenRebellion der späten sechziger Jahre in dieunterschiedlichsten Strömungen der radi-kalen „Neuen Linken“ – von den maoisti-schen „K-Gruppen“ bis zu den „Spontis“und der terroristischen „RAF“ – zu Be-ginn der Siebziger brachte eine Flut selbst-suggestiver, aktionistischer Theorie hervor.
Ihre wortreiche Unbedingtheit und Ra-dikalität, ihre Mischung aus Endzeitstim-mung und Erlösungsglaube ist heute kaumnoch nachzuvollziehen.
195
Anti-Atom-Protest: Gerhard Schröder in Gorleben (1980)
Demonstration der Spaßgesellschaft: Love Parade in Berlin (1999)
Eine historische Zäsur und ihre FolgenSPIEGEL TV (li.); DPA (Mi. li.); PANFOTO / DER SPIEGEL / XXP (Mi. re.); ULLSTEIN BILDERDIENST (re.)

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 7 / 1 9 9 7
Natürlich gibt es Erfindungen, diebraucht kein Mensch, wie zum Beispiel fertiggemixten Whiskey-
Cola in der Dose, UV-durchlässige Bade-anzüge oder Duftbäume am Autorück-spiegel – aber gibt es wirklich Leute,die den Sinn von Toilettentüren bezwei-feln?
Gab es – die Leute von der K 1 und spä-ter in den Siebzigern viele junge Men-schen, die wie ihre Helden Kommunar-den wurden und die Toilettentüren ein-traten, zersägten oder einfach aushängtenund auf den Speicher trugen.
Was ist so schlecht anToilettentüren? „Sie er-möglichen, daß sich einerzurückziehen kann, sieschaffen Privatsphäre. Wirwollten die Privatsphärevernichten“, sagt RainerLanghans, damals Deutsch-lands schönster Kommu-narde, heute einziger Mannin einem Münchner Haremvon fünf Frauen.
Die Kommune 1 gab esnicht lang, nicht mal 35 Mo-nate dauerte sie, von An-fang ’67 bis November ’69,aber ihr Einfluß auf denAlltag der Bundesrepublikwar groß. Hier wurde wiein einem Schaufenster demRest-Deutschland vorge-spielt, was modernes LebenEnde der sechziger Jahresein sollte: alle auf einer Matratze schlafen,nicht arbeiten, die Spießer ärgern, Weltre-volution machen, Spaß haben, ein neuer,besserer Mensch werden und niemals imLeben mit Stolz eine Krawatte tragen.
Und wie es sich für ein neues Lifestyle-Programm gehört, verkaufte es die K 1 denLeuten in einer neuen Sprache – der Psy-cho-Soziosprache, einem aufgeblasenenAkademikerdeutsch, mit dessen Restenheute Gefühlsspezialisten wie Hans Meiserund Jürgen Fliege in ihren Nachmittags-talkshows herumhantieren: Von „Zweier-beziehungen“ war die Rede, von „Frustra-tionen“, von „Arbeitsschwierigkeiten“,vom „autoritären Charakter“ und „Ge-fühlspanzerungen“ und vom „US-Impe-rialismus“, der an dem ganzen Schlamas-
prall gefüllten Fleischtheken zwischen 25Sorten Wurst wählen zu können oderWeihnachtsbäume an die GIs in Vietnamzu schicken, wo in einem makaberen Kriegangeblich die Freiheit West-Berlins vertei-digt wurde.
Und diese Leute trafen sich nicht wieheute in Cafés, Diskotheken und im Inter-net, sondern sie hatten das Gefühl, daßsich in der Gesellschaft etwas ganz Großesändern müsse und gingen in den Soziali-stischen Deutschen Studentenbund (SDS).
Auch dort waren sie bald unzufrieden.Es nervte sie, daß ihr privates Leben, ihr
Angstschweiß vor den Re-feraten, ihre erstarrten El-ternhäuser, ihr Liebeskum-mer keine Rolle spielendurften in den Diskussio-nen über die Akkumulati-on des Kapitals und die an-deren theoretischen Musts,die damals für einen mo-dernen jungen Menschenso wichtig waren wie heu-te die Wahl der richtigenTurnschuhmarke. „Wasgeht mich der Vietnam-krieg an“, sagte Kunzel-mann, „solange ich Orgas-musschwierigkeiten habe.“
Die Erlösung sollte dieKommune bringen. Lebenund Arbeiten und Revolu-tion in einem. Pauschal-ticket in die neue Freiheit,Rückweg ausgeschlossen.
„Ihr müßt euch entwurzeln“, rief DieterKunzelmann, der Einpeitscher für die Ideeder revolutionären Gemeinschaft.Weg miteuren Stipendien. Weg mit eurer Sicher-heit. Weg mit eurer alten Persönlichkeit.Weg mit der Liebe – alles bürgerlicheWahnvorstellungen. Später im Kommune-jargon hieß das: „Revolutionierung des All-tags, Abschaffung des Privateigentums,Brechung des Leistungsprinzips, Prokla-mation des Lustprinzips“.
Von Anfang an war Dieter Kunzelmanndas, was der Apo-Theoretiker Bernd Ra-behl als den „Patriarchen der Kommune“bezeichnete. Er entschied, was gemachtwurde, wie es gemacht wurde und wann esgemacht wurde. „Kunzelmann“, sagt Rai-ner Langhans heute, „stand ganz oben in
sel schuld sei, weshalb über den „Trans-missionsriemen“ Dritte Welt die „Revolu-tion“ in die Erste Welt getragen werdensollte, und alles würde gut werden.
Tolles Programm, aber natürlich hattendie 16 Leute, die im Sommer 1966 in einerGroßbürgervilla am Kochelsee ein paar Ta-ge herumsaßen, sich vom Hausmeisterehe-paar Schweinebraten auftischen ließen, aufden vor der Tür aufragenden Bergen her-umkletterten und Fußballweltmeisterschaftschauten, noch keine Ahnung, daß ein paarvon ihnen damit später zu den Popstars derStudentenrevolte werden sollten.
Der bayerische Sommer war blau undwunderbar, aber er konnte nichts daranändern, daß die 16 jungen Leute litten. Siewaren großgeworden in einem Land, indem Alt-Nazis als Richter und Lehrer be-schäftigt waren und die Deutschen wiederihren zwei Lieblingsbeschäftigungen nach-gingen: stur arbeiten und sich selbst be-mitleiden.
Gut 20 Jahre nach Kriegsende sah diedeutsche Vergangenheit ungefähr so aus:Verführt worden, dann alles verloren, dannalles wieder aufgebaut, und jetzt kommendie Langhaarigen und wollen alles wiederkaputtmachen.
Nicht wirklich erstaunlich also, daß esein paar junge Leute gab, die mehr vom Le-ben wollten, als in einem Polizeistaat vor
100
Die Tage der Kommune
Die 68er (V): Sie tranken Jasmintee, diskutierten nonstop und hielten Sexvor allem für ein Problem – die Mitglieder der Kommune 1 wurden zu Popstars der
Studentenrevolte und veränderten den deutschen Alltag. Von Thomas Hüetlin
Politaktionisten Kommune 1 (1967): „Ihr müßt euch entwurzeln“
SÜ
DD
. VER
LAG

d e r s p i e g e l 2 7 / 1 9 9 7
der Nahrungskette, und wenn einer vielweiter unten stand als er, dann wurde esfür den schnell ungemütlich.“
Kunzelmann war nicht gerade das, wasman einen schönen Menschen nennt. Sei-ne roten, wollenen Haare fielen ihm vorneschon früh aus, ein dichter Vollbart umgabsein Gesicht, in dem eine Nase groß wieeine Maurerkelle thronte. Dazu ging er ge-beugt wie ein Schrat, dabei voller Energie.Wenn er redete, wirbelten seine Arme her-um wie Windmühlenflügel.
Sein Vater hatte eine Sparkasse im ka-tholischen Bamberg geleitet, und seineSchulzeit hatte Kunzelmann eigentlich nurdazu gedient herauszufinden, daß er eingeborener Umstürzler sei.Am 14. Juli 1939,genau 150 Jahre nach der Erstürmung derBastille, geboren zu sein genügte ihm alsIndiz. Bald darauf warf er einen brennen-den Adventskranz aus dem Fenster in denSchulhof.
Eine Banklehre brach er ab, Ende derfünfziger Jahre zog er nach Paris, wo er mitdem späteren Modephilosophen JeanBaudrillard unter den Brücken lebte. „Wirhaben ihm immer Geld vom Pflastermalengegeben“, erinnert sich Kunzelmann, „da-mit er ein Baguette holen soll, und er ist indie Rue St. Denis gegangen und für diesesGeld in den Puff.“
* Links: Langhans, Obermaier.
ten. Die Gruppe verachtete das normaleLeben als ein Reich der Wiederholung, derBelanglosigkeit, der Depression und derLangeweile. Arbeit galt als das letzte, erstnach der sozialen Revolution sollte ein gu-tes Leben möglich sein. Bis dahin gab esnur ein Ziel: das leere Gerede und die Tra-ditionen der Bürger zur Explosion bringen
und darüber laut lachen. OhneRücksicht auf Stil, Rhythmus undandere bourgeoise Einschränkun-gen reimte Kunzelmann deshalbVerse wie: „Kuba, Kongo, Vietnam– die Blutspur des Imperialismus istlang“.
Dazu ließ er sich von zwei Frau-en aushalten. Die eine arbeitete ineinem Animierlokal; die andere,Dagmar Seehuber, jobbte tagsüberals Sekretärin, abends gehörte ihreSchreibkraft und der Rest demChefideologen. Wenn die Frauenschon nichts zu melden hatten –wenigstens das Pinkeln war unisex.Frauen wie Männer, erinnert sichLothar Menne, heute Geschäfts-führer bei Hoffmann und Campe,mußten zum Pinkeln das Wasch-becken in der Ecke der Kellerwoh-nung benutzen.
Am Kochelsee hatte der Situa-tionist Kunzelmann dazu gedrängt,so bald wie möglich eine Kommune
Anfang der sechziger Jahre wechselteKunzelmann nach München und sorgte so-fort für Ärger, manchmal im Dienste derWahrheit, manchmal nur aus Spaß am Är-ger. Er hatte sich inzwischen den Situatio-nisten angeschlossen, einer kleinen, super-elitären Künstlerbewegung, die als Nach-fahren der Dadaisten den Umsturz plan-
101
Psychogruppe Kommune 1 (1968)*: Haschisch rauchen war revolutionär, Bier konterrevolutionärBOKELBERG
Apo-Playboy Teufel (1968)„Alle zwei Tage eine andere Schülerin“
W.
KO
HN

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 7 / 1 9 9 7
zu bilden, aber es dauerte doch bis AnfangFebruar 1967, ehe ein paar Leute bereit wa-ren, sich wirklich unter dem Kommandodes Psychoterroristen zu neuen Menschenformen zu lassen. Die meisten aus der Ko-chelseegesellschaft fanden Gründe, sich zudrücken. Rudi Dutschke durfte nicht ein-ziehen, weil seine Frau Gretchen Sexorgi-en witterte; Bernd Rabehl wollte nicht ein-ziehen, weil er fürchtete, daß alle auf seineFrau scharf seien; und Lothar Menne flüch-tete nach Mexiko, wo er als Guerrillero ar-beiten wollte. „Immer noch besser als in ei-nem Zimmer mit Kunzelmann“, dachte sichMenne.
Die Menschen, die sich dann Anfang Fe-bruar in die leere Dachwohnung desSchriftstellers Uwe Johnson einsperrten,waren die, die den Absprung nicht recht-zeitig geschafft hatten und dazu minde-stens ein existentielles Problem hatten.
Der Student Ulrich Enzensberger warder kleine Bruder des großen DichtersHans Magnus; der Student Rainer Lang-hans litt an großen Liebesdepressionen;der Student Fritz Teufel fand keine Freun-din; die Sekretärin Seehuber war Kunzel-mann verfallen; die Studentin DorotheaRidder fühlte sich einsam und wollte „ein-fach Menschen anfassen“.
* 1967 im Sarg anläßlich einer Gedenkfeier für den ehe-maligen Reichstagspräsidenten Paul Löbe in Berlin.
hier hatte Kunzelmann im Frühjahr ’67 dierettende Idee: eine Aktion gegen den US-Vizepräsidenten Humphrey während sei-nes Berlin-Besuchs am 6. April.
Warum gerade Humphrey? Zuerst ein-mal saß er natürlich ziemlich weit oben imverhaßten amerikanischen Machtapparat,zudem sah er völlig bescheuert aus, fandenwenigstens die Kommunarden. „Wie eineWitzfigur aus einem amerikanischen Slap-stickfilm“, sagte Dieter Kunzelmann. „Soeiner braucht eine Torte ins Gesicht.“
Die Aktion fand nicht statt, und wahr-scheinlich wäre die K 1 bestenfalls ein zei-gefingerschwingender Haufen von Hinter-hofkabarettisten geworden, hätten nichtein paar Polizisten die Kommunarden er-wischt, als sie mit Farbstoff, Pudding undMehl gefüllte Tüten im Berliner Grunewaldherumwarfen. Danach wurden die Mäch-tigen und die Presse der Mauerstadt so hy-sterisch, als marschierten die Rote Armee,die Rolling Stones und King Kong ge-meinsam auf dem Kurfürstendamm her-um.
Die Kommunarden, stand im Polizei-bericht, hätten „Anschläge mittels Bom-ben, mit unbekannten Chemikalien ge-füllten Plastikbeuteln oder mit anderengefährlichen Tatwerkzeugen wie Steinengeplant“. Die Zeitung der abend melde-te: „Maos Botschaft in Ost-Berlin liefertedie Bomben gegen Vizepräsident Hum-
In Johnsons kleiner Wohnung hatten dieKommunarden Matratzen ausgebreitet,und sonst gab es nicht viel, was sie von derZertrümmerung ihrer bürgerlichen Restehätte ablenken können.
Jeder beobachtete jeden, man durftenicht raus, und wenn morgens einer in denMilchladen mußte, dann wurde ihm einzweiter als Wächter mitgeschickt. Anson-sten kannte die Totaltherapie keine Uhr-
zeiten. „Wenn man umfiel vor Müdigkeit“,sagt Rainer Langhans, „wurde man wiederhochgerissen.“ Einschlafen war bürgerlich.
Besitz in jeder Form war noch schlim-mer. Deshalb zog Kunzelmann gern einfachdie Kleider anderer Kommunemitgliederan, deshalb beschimpfte er Dagmar vonDoetinchem de Rande, nur weil sie dieFreundin von Enzensberger war, als Klette.In SDS-Kreisen hieß das Patientenkollektivbald nur noch „die Horrorkommune“. Fürdie Patienten ein Kompliment. Noch heuteschwärmt ein Mann wie Rainer Langhansvom „Dreiklang der totalen Kontrolle, dertotalen Intensität und der totalen Zer-störung“. Politisch wurde die Kommuneals kleine Psychosekte isoliert – aber auch
103
ULLS
TEIN
In SDS-Kreisen hieß das Kollektiv bald nur noch die
„Horrorkommune“
K-1-Patriarch Kunzelmann*: „Wenn einer in der Nahrungskette weiter unten stand als er, wurde es für den schnell ungemütlich“

Gesellschaft
phrey.“ Elf Kommunarden mußten ins Ge-fängnis.
Die Bombe, die nie gezündet wurde, er-wies sich als Volltreffer. Vorher waren De-monstrationen Umzüge gewesen, mit„ernsthaften, traurigen, ohnmächtigenSchilderwäldern (Langhans)“. Jetzt gelanges ein paar Ausgeflippten, den Staat aus-sehen zu lassen als das, was er war: eineBande von Frühvergreisten mit Panik imGenick.
Die Kommunarden stiegen auf zu Medienstars. Schnell hatten die bekannte-sten ein Image: Rainer Langhans, der schö-ne Held, Fritz Teufel, der seelenvolleClown, Dieter Kunzelmann, der An-tichrist, das schlimmste Monster, seitChruschtschow mit seinem Schuh in derUno-Versammlung auf dem Tisch herum-geklopft hatte. The Good, the Bad and theUgly – die Italo-Western, mit denen sieoft ihre Abende verbracht hatten, warennun Wirklichkeit.
Jeden Morgen besorgten sich die noto-rischen Bürgerschrecks jetzt Zeitungen,schnitten eitel die Artikel ihrer Heldenta-ten aus, klebten sie in Aktenordner ein undüberlegten, was sie anstellen mußten, umin der nächsten Ausgabe wieder die Schlag-zeilen zu liefern. „Erst blechen, dann spre-chen“, stand groß im Flur ihrer neuenWohnung im Rotlichtviertel StuttgarterPlatz geschrieben.
ihnen nur noch die richtigen Leichen un-terjubeln: Albertz, Büsch, Duensing, denSenat mit seiner Polizei und Justiz, sie allewerden wir am Mittwoch feierlich in ge-bührendem Rahmen begraben.“
Außer Emigrationsaufforderungen(Macht doch rüber), erprobten deutschenLösungsvorschlägen (Vergast sie) warendas Ergebnis dieser Aktionen natürlichHaft- und Geldstrafen.Wenn sie davon er-zählen, bekommen die Kommunardennoch heute vor Aufregung feuchte Augen:Beweis erbracht, so ist er, der deutscheSpießer. So ist er, der deutsche Staat. So ister, der Kapitalismus.
Sie genossen es, gehaßt zu werden. „Mirzum Beispiel macht es Spaß, wenn sich Ge-richte mit mir beschäftigen“, sagte RainerLanghans. „Es macht mir Spaß, Richter an-zubrüllen oder die Justizdiener und denStaatsanwalt zu ärgern, einfach durch dieArt, wie wir uns kleiden. Ihnen Fallen zustellen, in die sie reinlaufen.“
Auf einmal waren aus einem Haufenverklemmter Anarchisten mit einem Sex-problem die Helden der deutschen Ge-genkultur geworden. Der Dichter PeterHandke schrieb: „Die Kommune in Berlin,mit Fritz Teufel als Oberhelden, ist die ein-zige Nachfolgerin Brechts.“ Kunzelmannund Co. regierten die Straßen, sie hieltendie Universität in Schach, sie verhöhntenden SDS als „kleinkarierte Karriereorga-
Ein Interview kostete ein Abendessenbeim Chinesen oder ein Honorar von 1000Mark aufwärts. Auf diese Weise konntensie es verkraften, daß manche ihrer Elternkeine Lust mehr hatten, die Streiche derneuen Staatsfeinde zu finanzieren. „Letzt-mals einige Zeilen von mir. Dein Denkenist derart irreal, daß ich mich frage, ob Dunicht ein Fall für den Psychiater bist. Dervon mir geleistete Zuschuß entfällt mit so-fortiger Wirkung“, schrieb zum Beispiel
Kunzelmanns Vater. Der Brief wurde wiealle Briefe in der Kommune erst gemein-sam verlesen, dann verhöhnt, dann veröf-fentlicht.
Die Kommunarden machten ihrenSchlagzeilenjob mehr als gut.Wo immer sieein Tabu ahnten, traten sie zu, und wenndie Bürger schrien vor Wut und Empörung,dann klang das in ihren Ohren wie Musik.
Als eine Gedenkfeier für den ehemali-gen Reichtstagspräsidenten Paul Löbestattfand, tauchte zum Beispiel ein Sarg imGetümmel auf. Der Deckel ging auf, herausstieg Dieter Kunzelmann und warf mitFlugblättern um sich. „Das von uns lang er-sehnte Staatsbegräbnis ist da! Wir müssen
„Es macht mir Spaß, Richter anzubrüllen oder die
Justizdiener zu ärgern“

nisation“, die Arbeit als „Schande“, dieArbeiter als „Blödmänner mit ihren Kühl-schränken“ und die DDR als „bürgerlichenIdiotenhaufen“. Trotzdem fuhren sie gernrüber in die chinesische Botschaft, ließen
* Pressekonferenz zu Teufels Entlassung im Republika-nischen Club 1967. Das Bild von Michael Ruetz ist demBuch „1968“ entnommen, das im November 1997 bei2001 erscheint.
getrunken und, wenn etwas unklar war,im Theorieregal (die Belletristik war längstmit den Kommunekindern Grischa undNasser in eine Rumpelkammer verbanntworden) bei Wilhelm Reich nachgeschla-gen.
Jetzt war der Sex da. Und es gab sofortProbleme. „Der Fritz“, erinnert sich Rai-ner Langhans, „hat sich mit den Mädchenins Zimmer eingeschlossen, und zwar allezwei Tage mit einer anderen Schülerin. Erhatte viel nachzuholen.Aber er wollte sei-ne Erfahrungen nicht mit uns diskutieren.Er ließ uns nicht teilhaben. Das ging natür-lich nicht.Außerdem mußten wir dann im-mer die verheulten, abgelegten Schülerin-nen trösten, die auf dem Sofa saßen.“ Kla-re Sache: Fritz Teufel flog raus aus derKommune.
Langhans hatte jetzt nur noch Kunzel-mann neben sich, aber was den Starkultauf den Demonstrationen anging, warKunzelmann, den sie nur „Opa“ nannten,kein Gegner. Zwei Maoistinnen aus derProvinz schrieben an die K 1: „Kommu-narde Kunzelmann! Du bist das parasitä-re Element der Kommune 1. Du wirkst wieein Rentner und trägst auch dementspre-chende Kleidung (bei uns sehr populär,Kunzelmann-Look). Als asozialer Anal-phabet fällst Du den anderen Kommunar-den zur Last. Solltest Du und Baby En-zensberger aus der Kommune austreten,
sich kistenweise Mao-Bibeln schenken, diesie im Westen an die außerparlamentari-schen Nachzügler verhökerten.
Vor ihrer Haustür saßen nun 14jährigeMädchen herum, und Fritz Teufel lief zurBestform auf – er entwickelte sich zum er-sten Playboy der Apo.
Bis dahin hatten die Kommunarden vorallem über Sex diskutiert, dazu Jasmintee
M.
RU
ETZ /
ZW
EIT
AU
SEN
DEIN
S
Provokateure Kommune 1*: Wenn die Bürger schrien vor Wut, klang das wie Musik

d e r s p i e g e l 2 7 / 1 9 9 7
kämen wir sofort nach Berlin und tre-ten bei.“
Überhaupt war der Briefkasten der K 1jetzt immer sehr voll mit Post von Leutenauf der Suche nach Gerechtigkeit. Rent-ner, die die U-Bahn-Preiserhöhung uner-hört fanden. Hausfrauen, die Streit hattenmit den Nachbarn. Schüler, die dachten, siehätten zu Unrecht schlechtere Noten be-kommen als ihre Mitschüler. „Wir warenauf einmal die Anlaufstelle für alle Unzu-friedenen“, sagt Rainer Langhans, „wir wa-ren überlastet und haben nur noch mit ei-nem Kinderpoststempel ‚Weiter so’ aufPostkarten gestempelt.“
Im Winter ’68 wurde Langhans dasgroße Straßentheater zu anstrengend. Erwollte sich wieder mehr um sein Ego küm-mern, er wollte sich noch mehr befreien,der Kampf gegen den Kleinbürger in sichselbst und den Kleinbürger im jeweils an-deren war noch lange nicht abgeschlossen.Und in diesem langen Krieg war er zumGefangenen seines eigenen Ruhms gewor-den.
Die neue radikale Reise nach innen soll-te in neuen Räumen stattfinden, weshalbLanghans in Moabit für 800 Mark im Mo-nat eine ehemalige Schreinerwerkstatt an-mietete. Oben wurde ein Matratzenlagerrund um einen Tisch gebildet, unten wur-den die Fenster für einen weiteren Ge-meinschaftsraum zugemauert. Die Nach-barn sollten nichts mitbekommen, wenndie Kommune mit LSD und psychedeli-scher Musik die Tages- und Nachtzeitenebenso abschaffte wie die Druckmaschineund das Archiv, von dem keiner mehr et-was wissen wollte. Alles wurde nun mit-einander geteilt, das Stöhnen auf den Ma-tratzen ebenso wie der Mundgeruch unddie miese Laune sowieso. Alles wurde dis-kutiert und auf Kommunenorm gebracht.Haschisch rauchen war revolutionär. Bierkonterrevolutionär. Schwarzer Krauser re-volutionär. Reyno konterrevolutionär.
Demonstrationen waren definitiv nichtmehr revolutionär. Denn allmählich ahntensie, daß die Revolte vielleicht einem Hau-fen Lehrern, Journalisten und anderenPädagogen später einmal helfen könne,Karriere zu machen, aber daß der Aufstandlängst aufgehört hatte, mehr zu sein alseine Art Evangelischer Kirchentag mit Was-serwerfern. Wann immer sich noch poli-tisch Aufgeregte in die Kommune verirrtenund riefen, „Mensch, auf dem Ku’dammist wieder was los, kommt mit“, dann blie-ben die Kommunarden liegen. „Wir habendenen gesagt: Kommt Jungs, da hinten ste-hen noch ein paar rote Mao-Bibeln. Mitdenen könnt ihr rumwerfen.“
Auf den „Essener Songtagen“ im Som-mer hatte Rainer Langhans dann eine Er-scheinung. Er schaute auf die Bühne undsah eine wunderschöne Frau, die ein PaarRasseln schüttelte und einen LSD-Triplutschte. „Sie sah aus wie ein Engel“, er-innert er sich. „So etwas war mir noch nie
begegnet. Ich meine, ich kam aus Berlin, dalaufen alle im Kampfanzug rum.“ Der En-gel hatte einen Namen: Uschi Obermaier,Fotomodell aus München, 21 Jahre alt.
In den Augen von Kunzelmann kam derEngel eher aus der Spießerhölle, und dieAffäre, die Uschi Obermaier mit Langhansbegann, war der Anfang vom Ende derKommune. Was Richtern, Polizisten, Poli-tikern und Zeitungsschreibern, den ganzenalten berechenbaren Autoritäten, nicht ge-lang, das schaffte ein Mädchen: Ihre völligunreflektierte Lebenslust, ihr absolutesDesinteresse an allem Politischen – das warmehr, als die Kommunarden, allen voranKunzelmann, verkraften konnten. Ihr He-donismus machte aus dem Provokateurendgültig einen alten, häßlichen Spinner.„Der war am Ende völlig unerträglich“,sagt Bommi Baumann. „Den ganzen Taghat er nur noch rumgekräht mit dieser ex-tremen Nervensägenstimme. Jeder solltenur noch Schwarzer Krauser rauchen.“Außerdem begann Kunzelmann, Heroin zuspritzen. Statt der Sprung auf den Wasser-werfer lieferte ihm jetzt der Drogenblitzden Rausch.
Der kränkelnde Patriarch zog in seinevorerst letzte Schlacht, und sein Gegnerwar diese Frau. „Du hast Coca-Cola ein-gekauft“, hieß es, „und den Imperialistendas Geld in den Rachen geworfen.“ Oftmachte er sich nicht einmal mehr dieMühe, seinen Haß zu begründen: „Du bistso blöd. Hau endlich ab.“
Aber Uschi, von der Langhans sagte, siesei das „tollste Körperprogramm“ gewe-sen, das er je erlebt habe, blieb und lehntedie kunzelmannsche Weltordnung ab. „DerUnterschied zwischen Kapitalismus undKommunismus ist mir scheißegal“, sagtesie. Und wenn jemand auf die Idee kam, ihrden Tip zu geben, das alles einmal nach-zulesen, gähnte sie nur mit ihrem bezau-bernden Mund: „Buchstaben sind mir zuunattraktiv.“
Ihre Arbeit bestand darin, schön zu sein.Wenn die anderen ihre Räusche ausschlie-fen, weil Kunzelmann wieder nächtelangauf Heroin deliriert hatte, was er alles mitwelcher Bombe in die Luft sprengen woll-te, stand Uschi auf und putzte sich im Ba-dezimmer der Kommune – einem drecki-gen Waschbecken ohne Spiegel, mit einemWasserhahn, aus dem nur eiskaltes Wasserkam. Dann legte sie sich wieder nebenihren Rainer, für den sie gut aussehen woll-te. „Mein Vater“, sagt Uschi Obermaier,„hatte sich immer darüber beklagt, daß ermit schönen Frauen schlafen ging und ne-ben bleichen, verschmierten Hexen er-wachte; das hatte ich mir gut gemerkt.“
Das genügte Langhans natürlich nicht,und er mußte aus seiner schönen Gelieb-ten auch noch eine Zukunftstheorie for-mulieren: „Seht her“, sagte Langhans, „sieist gesund, anmutig und völlig eins mit sichselbst. Das ist der unentfremdete Menschder Zukunft. Sie ist lebendige Politik.“ Und
108
K-1-Starlet Obermaier (1968)„Buchstaben sind mir zu unattraktiv“
FO
TO
S:
G.
MAN
GO
LD

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 7 / 1 9 9 7
wenn Kunzelmann schimpfte, das sei dergrößte Mist, den er je gehört habe, fügteLanghans hinzu: „Die Revolution für eineFrau zu verraten ist immer gerechtfertigt.“
Es lebte sich auch gut mit dem Verrat.Denn mittlerweile füllte die Instinktfraudie Kommunekasse im Alleingang mitihren Fotomodell-Honoraren, die ihr Ma-nager und Geliebter Langhans aushandel-te. Unter 1000 Mark am Tag stand Uschinicht mehr auf, wenn Rainer es so wollte.„Vor der Kommune war sie ein Mädchenmit einem schönen Busen“, begründeteLanghans die plötzliche Kostenexplosion.„Danach war sie das Mädchen. Die Kom-mune hat sie zum Star gemacht.“
Während Kunzelmann den bewaffnetenKampf wollte, hatten sich Langhans undObermaier längst mit dem Kapitalismusausgesöhnt. Sie planten den Aufbau einesPopkonzerns, wollten Straßenkrieger alsStars vermarkten und dazu Popvideos dre-hen. Die Subversionsstrategien der sechzi-ger Jahre waren für beide nur noch alterQuatsch, sie träumten vom genußvollenGleiten am Rande des Kapitalismus – eineneue Boheme-Idee, die in New York zurgleichen Zeit Andy Warhol zu großemWohlstand verhalf und später die hedoni-stisch-dekadenten siebziger Jahre prägensollte. „Kommerzialisierung“, schrieb Rai-ner Langhans über das neue künstlicheSubkultur-Paradies, „ist die positive Bedin-gung einer neuen Gesellschaft. Popkultur istdie erstrebenswerteste Existenz auf Erden,da weitgehend von Repressionen befreit.“
Im Sommer 1969 war es dann soweit.Rainer Langhans und ein paar Kommu-narden nahmen Kunzelmann an Händenund Füßen und trugen ihn vor die Eisentür.„Unfaßbar, was der Mann anhatte, als wirihn rauswarfen“, sagt Baumann. Er trugeine lange Männerunterhose, freien Ober-körper, eine Frackjacke und dazu einenSchlips mit Paisley-Mustern.“
Es war das Ende der Kommune. Lang-hans, Uschi Obermaier und ein paar na-menlose Gestalten, von denen Baumannnur noch weiß, daß sie Felle trugen, aufHaufen saßen und trommelten, hieltennoch ein paar Monate aus, und weil Lang-hans eben Langhans ist und nicht AndyWarhol oder Mick Jagger, blieb die Sachemit dem Popkonzern eine mühsam zu-sammengebogene Theorie ohne Bilder,ohne Mode, ohne Musik – eben eine Idee,die nicht wirklich poppte. Die 35 MonateRuhm liefen für Langhans ab.
Die Arbeit der Kommune war sowiesogetan.Wie im Zeitraffer hatte sie zwei Jahr-zehnte deutschen Zeitgeist – vom politi-schen Aufbruch direkt in die Psychogrup-pe – gelebt und in rasantem Tempo dasDasein jenseits der bürgerlichen Kleinfa-milie vorgeführt. Nur im Grunde ging es zu
* Am Flughafen Berlin-Tempelhof im November 1969vor ihrem Flug nach München mit Adelheid Schuster-Opfermann (l.).
die Rocker jetzt nicht mehr, denn sie wa-ren der Meinung, der stern habe Ober-maier und Langhans 50000 Mark für eineTitelgeschichte über die Kommune gezahlt.
„Wir holen unseren Teil von den Koh-len ab“, sagte der Anführer Rudi. „20Riesen sind für uns.“ Als Langhans anfingzu erklären, sie hätten insgesamt nur 20000 Mark bekommen, rissen die zweianderen die Matratzen hoch, zerfetzten dieDecken und trampelten auf den Schall-platten herum. Es kam zur Schlägerei, beider sich Langhans ein blaues Auge einfing.Als sich die Nachricht herumsprach, freu-ten sich die linksradikalen Kampfgenossenvon einst: „Jetzt haun se ab.“
Langhans und Obermaier fanden eineNacht Asyl bei Hans Magnus Enzensber-ger. Am nächsten Tag trug Langhans eineSonnenbrille und flog mit Uschi im Pan-Am-Jet Nummer 741 nach München, wo erbis heute seine Suche nach dem weibli-chen Prinzip fortsetzt.
Uschi Obermaier sagt: „Wir müssen denRockern dankbar sein. Unsere Fabrik warimmer mehr zu einer Pennerherberge ge-worden.“ Sie heiratete später den RockerDieter Bockhorn und wohnt heute verwit-wet als Schmuckdesignerin in Los Angeles.
Beide, Langhans und Obermaier, habenzu Kunzelmann keinen Kontakt mehr. NachJahren im Untergrund war Kunzelmann fürkurze Zeit AL-Abgeordneter. Anfang desJahres wurde er zu sechs Monaten Haftverurteilt, weil er auf dem Kopf von BerlinsBürgermeister Eberhard Diepgen ein Eizerschlagen hatte mit den Worten „FroheOstern, du Weihnachtsmann“. ™
wie überall: Wer hat die Macht, und wermuß abends den Müll heruntertragen?
Wahrscheinlich ist auch daran, wie an al-lem, die Gesellschaft schuld. „Kommunar-den“, sagt die Veteranin Dagmar von Doe-tinchem de Rande, „verhalten sich oft wieder Angeklagte, der seine Mutter und sei-nen Vater umgebracht hat und im Ge-richtssaal aufsteht und sagt: ‚Ich möchtedas Gericht zu meiner Verteidigung daraufhinweisen, daß ich Vollwaise bin.‘“
Am Ende hat die Kommune sogar denKapitalismus modernisiert: Ein „unmögli-ches Möbelhaus aus Schweden“ hatte es
danach leicht mit dem Verkauf von Fich-tenholzwohnzimmern, und eine Genera-tion von Kindern moderner Eltern hattees schwer, weil Papa auszog und wiedereinzog und wieder auszog und sie dazuSauerkrautsaft trinken mußten und die„offene Beziehung“ schon im Kinderladendiskutiert wurde. Viele Leser von Stadt-zeitschriften halten diese Art des Auf-wachsens bis heute für das Nonplusultra.
Das Abrißunternehmen der Urkommu-ne, der K 1, kam an einem Novembermor-gen in Form von Rudi, Krawallo und Huka– drei Rockern aus dem Märkischen Vier-tel. Langhans hatte sie Wochen zuvor an-gesprochen, in der Hoffnung, sie könntenihm ein paar der zerlumpten Gestaltenvom Hals schaffen, aber das interessierte
109
K-1-Flüchtlinge Langhans, Obermaier*: „Jetzt haun se ab“
K.
MEH
NER
Rocker zerfetzten die Decken und trampelten auf
Schallplatten herum

SPIEGEL: Frau Reiche, Herr Baumann, HerrMeyer, Sie erklärten als Mitglieder der„Bewegung 2. Juni“ der Bundesrepublikden Krieg. Haben Sie wirklich geglaubt, indiesem Land ließe sich eine Revolutionmachen?Baumann: Sonst hätten wir es nicht ver-sucht. Aber wir sind nicht von heute aufmorgen auf die Straße gerannt und habendie Revolution ausgerufen.Reiche: Wir wurden ja auch nicht gewalt-tätig geboren.SPIEGEL: Es fing mit Rock’n’Roll, langenHaaren und Drogen an, aber schließlichhaben Sie Bomben gelegt. Warum?Baumann: Weil der 2. Juni ’67 kam. DieKugel aus der Knarre von diesem Krimi-nalbeamten Kurras, die Benno Ohnesorgtötete – die hat wirklich alles verändert.Als sich noch in derselben Nacht vieleLeute im SDS-Zentrum am Ku’damm tra-fen, schrie Gudrun Ensslin: „Das ist dieGeneration von Auschwitz. Damals habensie die Juden umgebracht, jetzt fangen siean, uns umzubringen. Wir müssen unswehren. Wir müssen uns bewaffnen!“SPIEGEL: Und dieser hysterische Auftritt ei-ner Pfarrerstochter hat Sie überzeugt?Baumann: Moment mal. Wir waren immerschon angepöbelt worden: „Euch Lang-haarige müßte man vergasen.“ Aber zu ei-nem Rentner, der so einen debilen Spruchabläßt, kann man noch „Idiot“ sagen undweitergehen. Am 2. Juni ’67 haben wir ge-sehen: Die meinen es ernst. Da lag ein To-ter, den konnte man nicht mehr wegdisku-tieren. Als ich den Sarg sah, bei OhnesorgsÜberführung nach Hannover – da habe icheinen Knacks gekriegt.Reiche: Ich dachte auch: Jetzt ist es wiedersoweit. Die erschießen uns jetzt. Dieschießen auf uns alle.Baumann: Ein knappes Jahr später, Ostern’68, nach dem Attentat auf Rudi Dutschke,stand ich vor dem Springer-Haus, sah dieAutos brennen und dachte zum erstenmal:Man kann sich wehren. Dieser Dreck wirdam nächsten Tag nicht ausgeliefert.
Das Gespräch führten die Redakteure Michael Sonthei-mer und Barbara Supp.
SPIEGEL: Sie, Herr Meyer, waren damalsnoch Jungarbeiter in Trier.Meyer: Wir haben den Feuerzauber beiSpringer im Fernsehen mitgekriegt unddachten: Das isses! Da fühlten wir unsbemüßigt, bei uns in der Provinz auch et-was zu tun. Die ersten Molotowcocktailsflogen. Einer davon ins Rektorat des Fried-rich-Wilhelm-Gymnasiums, in dem einstKarl Marx zur Schule ging.Reiche: Für mich stellte sich irgendwanndie Frage: Willst du immer nur in der zweiten Reihe stehen, Beifall klatschenund die anderen die Arbeit machen las-sen, oder willst du nicht auch mal was tun?SPIEGEL: Damals gab es eine Menge jungerLeute, die „mal was tun“ wollten, auch et-was Illegales, die aber trotzdem nicht gleichTerroristen wurden.
S P I E G E L - G E S P R Ä C H
„Die schießen auf uns alle“
Die 68er (IV): Was als lustiger Aufstand gegen den Obrigkeitsstaat begonnen hatte, schlug nach dem Tod Benno Ohnesorgs um in eine Revolte, als deren bewaffnete
Vollstrecker sich Gruppen wie die „Bewegung 2. Juni“ mißverstanden – die Ex-Guerrilleros Bommi Baumann, Till Meyer und Anne Reiche erklären ihren Irrweg.
Entführter Berliner CDU-Chef Lorenz (1975): „Willst du nicht auch mal was tun?“
ULLS
TEIN
d e r s p i e g e l 2 6 / 1 9 9 7106

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 6 / 1 9 9 7
Baumann: Willy Brandt hat uns 1970 mitseiner Amnestie das Wasser abgegraben.Mit ihr waren die Studenten, die Bürger-kinder, die Anklagen wegen Landfriedens-bruchs am Hals hatten, plötzlich nicht mehrkriminell. Sie konnten sagen: Vielen Dank,wir gehen zurück zu Papi. Sie sind Profes-soren geworden, bekamen einen Postenund sagten grinsend: „Ihr wart ja dämlich.“SPIEGEL: Und? Waren Sie dämlich?Baumann: Vielleicht sind Idealisten immerdumm. Aber wir haben etwas versucht,und das war legitim. Die ganze Welt warEnde der sechziger Jahre im Aufbruch. InAmerika brannten die Ghettos derSchwarzen, in Osteuropa, in Warschau,Prag oder Belgrad demonstrierten die Stu-
nehmen wird“. Opfer waren offenbar ein-kalkuliert.Meyer: Es war uns klar, daß es Tote gebenwürde. Auf beiden Seiten. So dachten wirdamals. Und manches davon kommt ei-nem heute zynisch vor.Baumann: Man darf auch nicht vergessen,daß die Mollies bei Springer und die erstenKnarren von Peter Urbach stammten, derim Dienst des Verfassungsschutzes stand.SPIEGEL: Die „Bewegung 2. Juni“ war an-archistisch und weniger elitär als die RAF.Trotzdem fanden Sie genausowenig die„Massenbasis“, die Sie gesucht haben, wieBaader, Ensslin, Meinhof und Co.Baumann: Wir haben uns schon bemüht,mehr mit der normalen – linken – Szene
Kontakt zu halten als die RAF. Wir warennoch in Kreuzberg unterwegs, Anfang dersiebziger Jahre, als die ersten Hausbeset-zungen losgingen.Wenn du dich als Illega-ler, der auf dem Steckbrief steht, am 1. Maiauf den Mariannenplatz stellst und Würst-chen brätst, ist das ein bißchen vermessen.Wir haben es trotzdem gemacht.SPIEGEL: Daß die Proletarier nicht mitzie-hen würden, war Ihnen als Proletariernnicht klar?Baumann: Den deutschen Arbeitern ginges damals ja noch prächtig. Die freuten sichüber ihre Urlaubsreise nach Spanien, ihreschönen Autos und die neue Couchgarni-tur.Von der Revolution haben sie nicht un-bedingt geträumt.Meyer: Was ziemlich ernüchternd war.Baumann: Obwohl wir auch nette, volks-nahe Aktionen organisiert haben. Als zum
denten. Und der Vietcong brachte den US-Imperialismus, die Militärmacht Nummereins, an den Rand einer Niederlage.Meyer: Moralisch war der Widerstand füruns damals völlig legitim. Die Amerikanerwurden uns mit der Parole „Die FreiheitBerlins wird in Vietnam verteidigt“ alsFreunde verkauft. Die westdeutsche Politikhat sich ohne jedes Wenn und Aber hinterderen dreckigen Krieg in Vietnam gestellt,und wir sahen im Fernsehen täglich dieMassaker. Das war nicht zu ertragen.SPIEGEL: Im „Programm der Bewegung 2. Juni“ aus dem Jahr 1972 wird zum „re-volutionären Kampf“ gegen das „Regimeder Schweine“ aufgerufen – und an-gekündigt, daß der „revolutionäre Tod zu-
107
Brennende Autos des Springer-Konzerns Ostern 1968 in Berlin: „Der Dreck wird nicht ausgeliefert“U
LLS
TEIN
Kinder des 2. Juni ’67waren Anne Reiche, Till Meyer undBommi Baumann. Sie zählten zumKern der linksradikalen Subkultur inWest-Berlin, die sich nach dem To-desschuß auf den Studenten BennoOhnesorg am 2. Juni 1967 als „um-herschweifende Haschrebellen“ und„Blues“ rasant radikalisierte. 1972gründeten sie die „Bewegung 2. Juni“,deren spektakulärste Aktion die Ent-führung des Berliner CDU-PolitikersPeter Lorenz war. Für ihren Einsatzkassierten die drei zusammen rund 30Jahre Gefängnis. Heute studiert Rei-che in Hamburg Architektur, Meyerist Journalist, und Baumann arbeitetin Berlin als Bauleiter.U
. M
AH
LER
/ O
STK
REU
Z

Gesellschaft
Beispiel 1971 mal wieder in West-Berlin dieFahrpreise erhöht wurden, sind wir losge-zogen, haben Hunderte Tuben mit Metall-leim geholt und gesagt: Schmiert die Fahr-scheinautomaten zu. Das hat Spaß ge-macht. Es gab passende Aufkleber, und dieBand von Rio Reiser,Ton Steine Scherben,machte einen schönen Song dazu.SPIEGEL: Gleichzeitig ist die „Bewegung 2.Juni“ auch mit Toten verknüpft …Baumann: … zunächst mit Benno Ohnesorg.Der Name wurde auf einer Sitzung im Jahr1972 gewählt. Peter-Paul Zahl schlug „Be-wegung 14. Mai“ vor, den Tag der Befreiungvon Andreas Baader durch ein ziemlich di-lettantisches RAF-Kommando. Anne undich sagten, so ein Schwachsinn, und plä-dierten für den 2. Juni. Damit immer klar-gestellt war: Der Staat hat zuerst geschos-sen. Und: Immer, wenn von uns die Redewar, mußte erklärt werden, daß ein deut-scher Polizist einen Studenten getötet hat.SPIEGEL: Schon bald hat die „Bewegung 2.Juni“ auch eine Blutspur hinter sich her-gezogen: Sie hat den Bootsbauer Belitz aufdem Gewissen, der im britischen Jachtklubeinen Feuerlöscher fand, der in Wirklich-keit eine Bombe war. Als er sie untersuch-te, explodierte sie. Den Richter Günter vonDrenkmann, der bei einer mißglücktenEntführung erschossen wurde; UlrichSchmücker, den ein Exekutionskommandoliquidierte*.Baumann: Es sind Dinge geschehen, die imnachhinein in keiner Weise zu rechtfertigensind, für die man sich bei den Angehörigenentschuldigen muß – was wir hier in allerForm noch einmal tun sollten.Meyer: Zur Zeit von Drenkmann undSchmücker, 1974, warst du, Bommi, schonausgestiegen und saßest wahrscheinlich kif-
fend in Afghanistan, und du,Anne, warst imKnast. Ich hab’ das draußen erlebt und hat-te wegen Schmücker Krach mit Teilen derGruppe. Diesen Mord hat nicht die „Bewe-gung 2. Juni“ zu verantworten, sondern eineSympathisanten-Truppe namens „Schwar-zer Juni“. Ich habe gesagt: „Blödsinn! Wofangen wir an, und wo hören wir auf, wennwir jetzt Verräter erschießen?“ Das habeich auch nach außen vertreten und bin da-für schwer kritisiert worden. Der Tod vonDrenkmann war auch nicht geplant.SPIEGEL: Die Guerrilla kreiste schon baldnur noch um sich selbst: Der BerlinerCDU-Chef Peter Lorenz wurde entführt,um fünf Genossen freizupressen; Sie, HerrMeyer, wurden aus der Untersuchungshaftin Moabit rausgeholt – das war eine „Be-
* Der Student Ulrich Schmücker, der sich mit dem Ver-fassungsschutz eingelassen hatte, wurde am 4. Juni 1974in Berlin von Sympathisanten der „Bewegung des 2.Juni“ erschossen.
Meyer: Du darfst nicht vergessen: Wir wa-ren Mitte der siebziger Jahre schon ziem-lich isoliert und hatten einen unheimlichenFahndungsdruck im Nacken. Wir hattenaber auch andere Pläne, beispielsweise eineKampagne gegen Gerichtsvollzieher, diein Berlin reihenweise Wohnungen räum-ten und die Leute auf die Straße setzten.SPIEGEL: Ein kleiner Gerichtsvollzieher istja wohl eher ein Mann aus dem Volk.Meyer: Nein, ein Gerichtsvollzieher war füruns erst mal ein skrupelloses Schwein, daseiskalt die Leute rausschmeißt.Baumann: Vom Definieren: „Der ist Mensch,und der ist Schwein“ sollten wir uns ein fürallemal verabschieden.
freit-die-Guerrilla-Guerrilla“, die ihren Pri-vatkrieg gegen den Staat geführt hat.Meyer: Nein, und nochmals nein.Baumann: Doch, das war die Auseinander-setzung, „wir und die Justiz“, sonst nichts.Wir haben in den frühen siebziger Jahrenmit Andreas Baader diskutiert, Hanns-Martin Schleyer zu entführen, um die For-derungen der streikenden Mercedes-Ar-beiter durchzusetzen. Da hat die RAF abgelehnt und gesagt: Das sollen die Ar-beiter doch selber machen! Als es danndarum ging, Baader, Ensslin und andereaus dem Stammheimer Knast zu holen,hat man Schleyer entführt – da ging esplötzlich.
108
„Wir waren isoliert und hatteneinen unheimlichen
Fahndungsdruck im Nacken“
d e r s p i e g e l 2 6 / 1 9 9 7

Reiche: Früher haben wir uns das einfachangemaßt.Baumann: Aber das war ein krasser Fehler.Damit geht die Menschschlichkeit denBach runter, und in Deutschland sollte manso was schon gar nicht machen. Selektierthat die SS auf der Rampe in Auschwitz.Damit habe ich nichts am Hütchen.Reiche: Ich hatte eigentlich schon 1972 einePhase, in der es mir gedämmert hat, daß esmit dem bewaffneten Kampf nicht so läuft,wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich woll-te neu überlegen, was ich tun will. Aberdann kam ein neuer Haftbefehl gegenmich, und ich kam wieder in den Knast. Ichhabe festgehalten an dem, was wir hätten
neu überdenken und diskutieren müssen,um die Haft zu überleben.SPIEGEL: Wenn die Justizverwaltung Siefrüher in den Normalvollzug geschickt hät-te – wäre dann für Sie früher Schluß ge-wesen mit der Guerrilla?Meyer: Ich glaube nicht. Es waren politischeErkenntnisse, die dazu führten, daß ich mirAnfang der achtziger Jahre gesagt habe:Das waren jetzt fast 15 Jahre Guerrilla –und was kam dabei heraus?SPIEGEL: Als Bommi Baumann schon 1974zum Ende des bewaffneten Kampfs auf-rief, wurde ihm das sehr übelgenommen.Meyer: Stimmt. Über dieses berühmte spie-gel-Interview – „Freunde, schmeißt die
Knarre weg“ – waren wir gar nicht glück-lich.Wir haben gesagt: Der Drecksack, jetztfängt der an zu diffamieren und zu er-zählen. Er ist ein Verräter.Baumann: Wer kämpft, kann natürlich nichtakzeptieren, daß jemand sagt: „Hört auf“.Andererseits wäre es ganz günstig gewe-sen, wenn nicht nur ich das so gesehen hät-te. Dann wären ein paar Leute, die heuteauf dem Friedhof liegen, noch unter uns.Meyer: Damals wurde über Bommis Inter-view nicht einmal diskutiert.Baumann: Ich war schon nicht mehr inDeutschland. Es war mein Abschied, undich habe es als meine Pflicht angesehen,nicht still und heimlich aufzuhören, son-dern das öffentlich zu erklären. Schließ-lich habe ich ein paar Leute für den be-waffneten Kampf angeworben. Till Meyerzum Beispiel, Inge Viett oder VerenaBecker. Anne nicht, die war sowieso vonAnfang an dabei.Meyer: Wir haben ein harsches Flugblattgegen Bommi verbreitet. Aber erschießenwollten wir ihn natürlich nicht.
Baumann: Sehr freundlich.SPIEGEL: Bommi Baumann hat zehn Jahrefrüher als Till Meyer festgestellt …Meyer: … daß der bewaffnete Kampf ge-scheitert ist. Und das ist er auf der ganzenLinie.Wir hatten keinen Rückhalt.Wir ha-ben an den Massen vorbeiagiert.Reiche: Mir ist inzwischen klargeworden –und das war ein langer Prozeß –, daß duKrieg nicht mit Krieg bekämpfen kannstund Gewalt nicht mit Gewalt.Baumann: Das ist eine Voraussetzung füreine zivile Gesellschaft.Meyer: Aber der Kapitalismus ist eine Ge-waltherrschaft. Er baut auf Gewalt, und esgibt das legitime Recht, von unten Gegen-gewalt anzuwenden. Mit Wattebällchenkann man keine Revolution machen.Reiche: Aber ’ne Knarre überzeugt auchnicht. Was richtig ist, kann nur durchmenschliche Auseinandersetzung rausge-funden werden, nicht durch bewaffnete.Alle Rüstungsproduktion sollte eingestelltwerden.Meyer: „Die politische Macht kommt ausden Gewehrläufen“, hat Mao Tse-tung ge-sagt. Das bleibt historisch richtig.Reiche: Ich will keine Macht über andere.Baumann: Ich bin jedenfalls nicht der Mei-nung, daß wir eine neue Guerrilla gründensollten. Natürlich bereichern sich hier we-nige immer hemmungsloser und immer wi-derlicher.Aber du brauchst eine breite Be-wegung. Gewalt übt immer nur eine Hand-voll aus.Reiche: Ich habe inzwischen die Erfahrunggemacht, daß es viel mehr bringt, wennsich die Leute zu Interessengruppen zu-
109
„Der Drecksack, jetzt fängt der an zu erzählen – er
ist ein Verräter“
d e r s p i e g e l 2 6 / 1 9 9 7

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 6 / 1 9 9 7
sammentun. Ich lebe seit 1984 in der Ha-fenstraße in Hamburg, und wir haben esgeschafft, unser Projekt zu verteidigen. Esist hart erkämpft worden, aber jetzt habenwir die Häuser, als Genossenschaft. Es istein Beispiel, daß ein selbstbestimmtes Le-ben heute möglich ist. Aber du kriegst esnatürlich nicht nachgeschmissen.SPIEGEL: Sie sind offensichtlich bescheide-ner geworden.Reiche: Wir sind auch klüger geworden. Ichärgere mich, daß ich früher einfach nichtgenug gewußt habe. Beispielsweise physi-kalische Gesetze wie e=mc2 – warum warmir das nicht früher klar? Schnelligkeit al-lein genügt nicht. Du mußt die Masse ha-ben.Meyer: Mit einem solchen Laisser-fairekann ich nichts anfangen. In den USA es-sen vielleicht 50 Millionen Amis sauberenJoghurt und leben alternativ, aber dadurchändert sich nichts an dem Rassismus undder Ausbeutung in ihrem Land.Reiche: Ich bin nicht für ein Laisser-faire, solebe ich nicht. Hast du was gegen Leute, diesauberen Joghurt essen?Baumann: Moment mal, in Deutschland gehtes um etwas mehr als um sauberen Joghurt.Es gibt immer noch eine faschistische Ge-fahr in diesem Land. Und wir haben nochein paar andere Probleme wie die Mas-senarbeitslosigkeit und den daraus resul-tierenden sozialen Abstieg von Millionen.Da reicht es nicht zu sagen: Die Hafen-straße haben wir gekriegt, und da hintensetzen sie noch einen neuen Fahrradwegdurch. Das ist mir ein bißchen zuwenig.Reiche: Das sage ich nicht. Aber ich findedich überheblich. Was machst du denn?Baumann: Im Moment bereite ich ein Buchüber Drogen vor. Davon verstehe ich einbißchen, schließlich war ich auch 25 JahreJunkie. Aber worum es mir jetzt geht: Mir
Schmuddelecken leisten – solange man ihmnicht wirklich auf die Füße tritt.Baumann: Du meinst, mit Jesuslatschenkann man nicht gut auf die Füße treten?Meyer: Sicher nicht – aber wenn wenn dues tust, kriegst du die geballte Macht desStaats zu spüren. Das passiert nicht, so-lange du um Grünanlagen kämpfst.Reiche: Ich will aber gar nicht die geballteMacht des Staats zu spüren kriegen. Ichwill eine andere Gesellschaft, sicher. EineGesellschaft ohne Knäste zum Beispiel.Meyer: Träumerin.SPIEGEL: Sie, Herr Meyer, haben es schonimmer mehr mit dem Realsozialismus ge-halten, sind in jungen Jahren in die DKPeingetreten und haben 1986, nach 13 JahrenHaft, wieder heimgefunden.Meyer: Ich habe sogar überlegt, in die DDRüberzusiedeln …SPIEGEL: … so wie Viett und neun andereRAF-Kollegen. Statt dessen haben Sie dannin West-Berlin für die Stasi gespitzelt.Meyer: Quatsch, ich habe niemand persön-lich bespitzelt. Nein, ich habe aus zwei
Gründen mit denen zusammenge-arbeitet: Die Bundesrepublik weiterangreifen und die DDR verteidigen.Reiche: Als ich mir Mitte der sech-ziger Jahre Ost-Berlin und einbißchen die DDR angeguckt habe,hielt ich das absolut nicht für denbesseren Staat. Ich denke, wenn ichdort geboren worden wäre, wäreich genauso in der Kiste gelandet.Baumann: Richtig. Ich bin aus bei-den deutschen Staaten getürmt,habe in beiden im Knast gesessen,mein Buch „Wie alles anfing“ ha-ben beide deutsche Staaten verbo-ten. Darauf bin ich stolz.Meyer: Und mir ist zum zweitenmalim Leben eine Bastion weggebro-
chen; erst die Guerrilla, dann die DDR.Jetzt sitze ich da und schaue, was ich tunkann: ein bißchen politische Arbeit, weilich finde, daß die letzten elf RAF-Gefan-genen aus dem Knast müssen, jetzt, da derKrieg vorbei ist. Und als Journalist versu-che ich, dafür zu sorgen, daß die Herr-schenden wenigstens ihre eigenen Gesetzeeinhalten. Zur Zeit gibt es ein Vakuum, undman muß darauf achten, daß es nicht vonrechts gefüllt wird. Falls die aber mal aufTritt sind, wissen wir, was wir zu tun haben.Baumann: Wenn eine faschistische Macht-ergreifung droht, greife ich auch wiederzur Waffe. Darf ich noch etwas sagen?SPIEGEL: Bitte.Baumann: Ceterum censeo, Kohl muß weg.Und jetzt will ich noch Ihr Ceterum censeohören.SPIEGEL: Frau Reiche, Herr Baumann, HerrMeyer, wir danken Ihnen für dieses Ge-spräch.
Im nächsten HeftDie Tage der Kommune 1 und ihr Einflußauf die bundesdeutsche Alltagskultur
erscheint dieses Land wie in der Lei-chenstarre. Kohl sitzt auf seinem Thron,und nichts tut sich. Er muß weg. Ich binschon soweit, daß ich SPD wählen würde.Reiche: Wie bitte? Ankreuzen und die Ver-antwortung abgeben?SPIEGEL: Horst Mahler sagt, er fürchte, daßes bald wieder eine Stadtguerrilla gebe.Baumann: Das könnte auch eine Stadt-guerrilla von rechts sein, und was ist dann,Herrschaften? Millionen hätten gute Grün-de, auf die Straße zu gehen. Ich habe erlebt, daß Bauingenieure für 1300 MarkSteine schleppen sollten und Tränen derFreude darüber vergossen haben, daß sieüberhaupt noch einen Job bekamen.Reiche: Der Staat ist bankrott, auf derganzen Linie, nicht nur finanziell. Es kannalles besser organisiert werden – ohneStaat – oder erst mal mit viel weniger Staat.Und jetzt tu doch nicht so, als würde nir-gends etwas passieren. Ich muß doch nichtauf Leute runtergucken, die auf Jesuslat-schen stehen. Laß anderen ihre Freude!Meyer: Anne, du weißt doch: Das Kapitalkann sich allerhand Spielplätze und
112
Wiedervereinigungsgegner Meyer (1990): „Die DDR verteidigen“
H.
P. S
TIE
BIN
G
Baumann als Bauleiter: „Kohl muß weg“
U.
AR
EN
S

d e r s p i e g e l 2 5 / 1 9 9 7
Die Stimme des greisen Altrechtenvon der CDU, Alfred Dregger, zit-tert schon mal ein wenig, wenn er
im Deutschen Bundestag redet. Am 13.März dieses Jahres schrillt sie vor Em-pörung: „Halten Sie doch einmal die Klap-pe, Herr Fischer!“ Aus der ersten Reihebellt es zurück: „Ein unsäglicher Dreck,den Sie hier absondern!“
Empört blickt der schneidige alte Herrzum Präsidiumstisch empor.
spiel zur umstrittenen Beteiligung der Vä-ter und Großväter an den Verbrechen derNazis im „Vernichtungskrieg“ der Wehr-macht noch immer an die Schmerzgrenzegeht und darüber hinaus – niemanden inBonn hat es überrascht.
Klar auch, daß bei dieser Gelegenheiteinmal mehr die klassische Kontroversevon 1968 zur Aufführung gelangen würde– Offizier der Hitler-Wehrmacht gegen An-tifaschisten der nächsten Generation. Zwar
Ist denn hier keiner, der den Flegel imPolizeigriff abführt? Oder wenigstens das„schlechte Benehmen“ tadelt? Die Präsi-dentin aber weist den Redner nur kühl dar-auf hin, „daß die angemeldete Redezeitweit überschritten ist“. Es amtiert: AntjeVollmer.
Daß die Debatte über die Wehrmachts-ausstellung „sehr schwierig“ (Vollmer)werden würde, daß über 50 Jahre nachKriegsende das parlamentarische Nach-
110
Die 68er (III): Die Generation von ’68 hat das Denken in Deutschland verändert, Rebellen von einst sitzen in den Parlamenten und Parteien – aber
Helmut Kohl regiert immer noch. Von Jürgen Leinemann
Am Ende des langen Marsches
Osterdemonstration in Berlin 1968: Generationen, die von sich reden machen, wirken auch durch ihre ästhetische KraftG. ZINT

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 5 / 1 9 9 7
nur als Kammerspiel, nicht mehr als Stra-ßenschlacht, dafür aber in hessischer Star-besetzung: Django Dregger gegen denSpontifex Maximus Fischer.
Solche Szenen wiederholen sich seit1983, als mit den Grünen der Kulturbruchins „Hohe Haus“ am Rhein einzog (Fi-scher: „Wie hoch?“), mit abnehmender In-tensität. Auch daran, daß die Regeln desUmgangs von einer Präsidentin ausgelegtund überwacht werden, die in den siebzi-ger Jahren als Aktivistin der „Liga gegenden Imperialismus“ den Staatsfeinden zu-gerechnet wurde, nimmt niemand mehrAnstoß.
Die einstigen Rebellen gehören längstin den Bonner Alltag. Sie haben ihr Le-bensgefühl mitgebracht und die Verkehrs-formen entsteift. „In keinem europäischenParlament geht es so locker zu wie beiuns“, behauptet der Alt-68er Karsten Voigt.
Tatsächlich entkrampft sich auch dieWehrmachtdebatte schnell, weil die näch-sten Redner die Rituale der Schuldzuwei-sung durchbrechen und mit persönlichenBemerkungen die kalte Unverbindlichkeiteines Pseudo-Historikerstreits vermeiden.„Dieser Krieg läßt uns alle nicht los“, be-kennt der SPD-Abgeordnete Freimut Duve.
Die Grüne Christa Nickels sagt: „Ichglaube, das Beste, das uns passieren könn-te, wäre, wenn wir ein Klima in Deutsch-land bekämen, in dem die Väter und Müt-ter und ihre Kinder – ich bin ein Nach-kriegskind und mittlerweile 45 Jahre alt –endlich einmal in aller Ruhe miteinanderdarüber reden könnten, was mit ihnen pas-siert ist und warum das so gekommen ist.“
Natürlich muß dieses Gespräch nicht erstbeginnen. Seit Jahrzehnten läuft es auf vie-len Ebenen. Aber daß „solche Identitäts-debatten“ (Fischer) auch im DeutschenBundestag möglich sind, das ist politischdas entscheidende Verdienst der 68er.
Viele sind es nicht, die sich aus denStraßenschlachten von vor 30 Jahren bis inspolitische Establishment vorgekämpft ha-ben. Es ist ja auch nicht das Ziel der außer-parlamentarischen Opposition gewesen,selbst im Bonner Bundestag aufzutreten.Deshalb neigen die „alten Comandantesder Bewegung“ (Vollmer) dazu, die Duvesund die Nickels, die Fischers und Vollmersals Mit- und Nachläufer zu begönnern.
Doch 68er sind die auch. Nicht nur des-halb, weil sie, was die Hauptsache ist, sichselbst dazurechnen. Sondern weil allen ge-meinsam ist, daß die Geschehnisse undErlebnisse der heißen Monate vor 30 Jah-ren sie existentiell verändert haben. Allehaben damals begriffen, „daß Politik nottut“, wie der Hanseat Knut Nevermanneine Schiffahrtsweisheit abwandelt.Und wie der studentische Rebell Never-mann, der heute die Hamburg-Vertretung
* Bei seiner Vereidigung zum hessischen Umwelt- und Energieminister durch Ministerpräsident Holger Börneram 12. Dezember 1985.
Die Revolte von ’68, das ist eben auchein Medienereignis gewesen. Und wo die-se Bewegung mehr bewegt hat als sichselbst, da geschah das vor allem durch dieMacht der Bilder. Idealistische Generatio-nen, die von sich reden machen, wirkenimmer auch durch ihre ästhetische Kraft.
Wenn also – wie Fischer heute glaubt –„68 zum Bestandteil des Gründungsmy-thos dieser Republik geworden ist“, dannhat sein persönliches Image – sein kalku-lierter antiautoritärer Gestus, die Rotzig-keit seiner Rede, das provozierende Outfit,
in Bonn leitet, haben sie alle einen Berufaus ihrer Leidenschaft gemacht.
Zur Symbolfigur ist Joseph Fischer geworden, der schandmäulige Grüne,der – nach einer halben Bundestagspe-riode – im Landtag von Wiesbaden seinenAmtseid als alternativer Minister in Turn-schuhen, Jeans und Sakko vom Trödel-markt ablegte. Nichts hat deutlicher denendgültigen kulturellen und politischen Durchbruch der 68er ins Establishmentder Bonner Republik signalisiert als dieseSzene.
111
Bundestagsvizepräsidentin Vollmer: „Jede Sache, die wir anpackten, konnten wir gewinnen“
F. D
AR
CH
ING
ER
Grüner Fischer (r.)*: Kalkulierter antiautoritärer Gestus
DPA

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 5 / 1 9 9 7
kurz, seine Selbststilisie-rung zum wandelnden Re-gelverstoß – damit mehr zutun als seine Heldentatenin der Frankfurter Hausbe-setzer-Szene und seine un-bestreitbaren politischenGaben und Talente.
Tatsächlich ist der ent-laufene Gymnasiast Fischer– „mit großen, glänzenden,gläubigen Augen“ – am 3.Juni 1967 eher zufällig indie Demo geraten, die vordem Stuttgarter Schloß denTod Benno Ohnesorgs be-trauert. Er ist zu jung, umgleich ganz vorn dabeizusein, was ihm vie-les erspart. Er ist aber andererseits von derPolitik, in die er geraten ist, viel zu beses-sen, als daß er – wie die Mehrheit – hättehängenbleiben können zwischen satter Ar-riviertheit und gescheiterten Träumen. Soverkörpert „Joschka“ heute das Lebens-gefühl einer ganzen Generation: „Wir, dieKinder der Henker von Auschwitz und dieder Helden von Stalingrad.“
Wir – das reicht von Fritz Teufel über Ul-rike Meinhof bis Edmund Stoiber (CSU)und Klaus-Rüdiger Landowsky (CDU). Mitden Jahren ist die Zahl derer, die sich als68er fühlen, mächtig angewachsen. Auch
Vortragsabende zum Thema: „Die 68erund der Verschleiß.“
Mal platzt er – gestaltet von Leutnant a.D. Hermann Scheer, Agitator des Soziali-stischen Hochschulbundes – als großerRäuberhauptmannsauftritt in das Ritual ei-ner biederen Parteiveranstaltung. „Wie re-det ihr eigentlich? In Heidelberg ist Revo-lution!“ donnerte der für die staatstragen-den Bonner Würdenträger verwegen inLederjacke gekleidete Student 1969 in dieGodesberger Stadthalle, wo die Sozialde-mokraten einen jugendpolitischen Kongreßabhalten. Nun sitzt der Baden-Württem-berger schon seit 17 Jahren im Bundestag.
Klär (50) und Scheer (53) geraten schnellin den Bann – Klär später sogar in denDienst – jenes Mannes, der die Aufbruch-stimmung im Lande zum politischenMachtwechsel zu nutzen versteht – WillyBrandt.
Dem von der Union als Vaterlandsver-räter verteufelten Emigranten gelingt es,den Geist des Aufbruchs zur Regierungs-politik zu bündeln: „Mehr Demokratie wa-gen“. In Mainz legt im selben Jahr 1969Helmut Kohl seinen Amtseid als Minister-präsident ab. Zwar gilt auch er als aufsäs-siger junger Mann in der Union, zu den68ern aber wird er sich nie rechnen.
Die neue SPD unter Brandt zieht vieleApo-Leute an. Nicht wenige, wie die spä-
der bayerische Minister-präsident will durch dasEngagement der linkenStudenten, von der Em-phase des Aufbruchs ange-steckt worden sein, wenner sich auch heftig in dieentgegengesetzte politischeRichtung bewegt. Und derBerliner CDU-Fraktions-vorsitzende Landowsky,rechter Aufwiegler bis heu-te, kann sich berauschen an„Landsergeschichten“ ausder Studentenzeit, in denensein Freund EberhardDiepgen, heute Regieren-
der Bürgermeister, einst Asta-Vorsitzen-der, als ein Verlierer der heraufziehendenRevolte dasteht – er wird abgewählt.
In die Bonner Idylle, dieses Treibhauseines katholisch versüßten Wilhelminis-mus, dringt der Geist des Aufruhrs im Jah-re 1968 mit pathetischen Gesten.
Mal kommt er – wie bei der großen Not-standsdemo – in Gestalt des damaligen Un-teroffiziers und späteren SDS-AktivistenKarl-Heinz Klär mit „Ho-Ho-Ho-Tschi-Minh“-Gebrüll im Sturmschritt über dieBeueler Brücke. Heute ist StaatssekretärKlär Chef der rheinland-pfälzischen Lan-desvertretung in Bonn und veranstaltet
112
Grüner Schlauch (1994): Jede Art von staatlicher Autorität muß sich immer wieder neu begründen
K.
HO
LZN
ER
/ Z
EIT
EN
SPIE
GEL
Student Schlauch (1968)

d e r s p i e g e l 2 5 / 1 9 9 7
teren Bundestagsabgeordneten ManfredCoppik und Ottmar Schreiner, HertaDäubler-Gmelin und Gert Weisskirchen,machen zugleich bei der Apo und in derSPD mit. Wer es indes als „Lebenserfolg“ansah, Kanzler werden zu wollen, der hat-te damit schlechte Karten, spottet HertaGäubler-Gmelin heute: „Ein Karriere-Be-förderungsverein für Bonn war die Stu-dentenbewegung nicht gerade.“
Es sind vor allem die Jusos, bei denensich – wie es der 1969 zum Vorsitzenden ge-wählte Karsten Voigt ausdrückt – die „Zer-fallsprodukte“ der Apo sammeln, gut100000 junge Genossen laufen der SPD indieser Zeit zu. Die fühlen sich alle als 68er.
Ohne diesen „Push von außen“, soVoigt, grauhaarig inzwischen und unge-mein staatsmännisch im Habitus, wären„Typen“ wie er in der SPD nie etwas ge-worden. Seit 1976 ist er nun schon Abge-ordneter des Deutschen Bundestages.
Doch die Zeit, da den Apo-Aktivistenin Bonn die Türen offenstehen, währt nichtlange. Schon Anfang der siebziger Jahrehat die politische Elite der Studentenbe-wegung begonnen, sich in sektiererischen„Search and Destroy“-Bewegungen zu zer-splittern und haßerfüllt zu bekämpfen. Kei-ner, der an diesen Sekten-Kriegen zwi-schen maoistischen, revisionistischen,trotzkistischen und spontaneistischen Ka-dern beteiligt ist, hat für die SPD, auch dievon Willy Brandt, mehr übrig als mildeVerachtung. „Nie wäre mir eingefallen, beiden Jusos mitzumischen“, sagt Fischer.Und auch Antje Vollmer bekennt: „Willyhat mich damals nicht so sehr beein-druckt.“ Die SPD ist ihr einfach nicht neugenug. Sie habe „etwas Kreatives“ ge-braucht, eine Art „kulturellen Urschrei“.
Es wird dann eher ein Hilferuf. DennAntje Vollmers Irrlichtern zwischen altenund neuen Idealen, ihre lebensgefährlicheSuche nach Neuanfang und Zugehörigkeit,drohte im Ghetto zu enden. „Ohne denTod Ohnesorgs hätte ’68 eine sehr vielleichtere Sache werden können“, sagt sieheute. „Aber da hat auf beiden Seiten et-was sehr Deutsches zugeschlagen, alleskriegte eine tödliche Zuspitzung.“
wir auch gewinnen, das wollten wir dochmal sehen. Das war wie im Rausch.“
Selbstexperimente. Intellektuelle Aben-teuer. Nervenkitzel. Zwischen Schwärmereiund Katzenjammer verläuft ein schmalerGrat. Ihre akademischen Prüfungen absol-viert die Theologin nebenher – ’68 erstesStaatsexamen, ’71 zweites Staatsexamen,’73 Dissertation.Während sie als Geistlichein Berlin arbeitet, gerät sie über einenFreund, der in den „Roten Zellen“ aktivist, an die „Liga gegen den Imperialismus“.Antje Vollmer müht sich.Aber sie und auchdie Genossen haben das Gefühl, daß sie indie Marx-Lesezirkel nicht ganz reinpaßt.
So gerät sie, wie Tausende in diesen Jah-ren, in einen existentiellen Lebensbruch,mit dem sie bis heute nicht ganz fertig ist.Krankenhausaufenthalte und Arbeitslosig-keit folgen. Sie wird in eine schlimme Iso-lation getrieben.
„Die 68er sind in den siebziger Jahrenausgegrenzt worden“, sagt Tilman Fich-
Die evangelische Studentin Antje Voll-mer aus Westfalen, Jahrgang 1943, hat inBerlin, Heidelberg,Tübingen und Paris Phi-losophie und Theologie studiert und ist ge-rade zum Examen nach Berlin zurückge-kehrt, als sie im Radio von Ohnesorgs Todhört. „Neugier und ein moralischer Im-puls“ treiben sie auf die Straße.
In ein Messingamulett, das sie damalsfindet, fügt sie Miniporträts ihrer Idole ein:einen schwarzen Franz Kafka und einenroten Karl Marx. Die Erinnerung an denidealistischen Höhenflug dieser Zeit hängtbis heute in ihrem Wohnzimmer an derWand. Und noch immer schwingt etwas mitvon der ungeheuren emotionalen Intensi-tät, wenn die Präsidentin erzählt: Dutschkeauf der Kirchenkanzel. Ein entrückt-hoch-mütiger Mahler, „ein Herr“, in der Aula derTU. Ein in seiner Erregung tapfer gegen Gewalt anstotternder Tilman Fichter. „Eswar immer Sommer“, sagt Antje Vollmer.„Jede Sache, die wir anpackten, konnten
113
Bürgermeister Diepgen (1996): Verlierer der Revolte
A.
SC
HO
ELZEL
Asta-Vorsitzender Diepgen (r., 1963)
G.
JUN
G

Gesellschaft
ter. Die Ausgegrenzten haben sich radika-lisiert. Antje Vollmer: „Je härter derAußendruck, desto entschiedener setztensich intern die härteren Flügel durch, alsodie RAF.“ Die „Baader-Meinhof-Bande“wächst sich zur Staatsbedrohung aus.
Antje Vollmer versucht der Konfronta-tion auszuweichen, indem sie sich nach ei-nem weiteren Examen als Diplom-Pädago-gin nach Bethel zurückzieht. Ihr Mißtrau-en gegenüber der etablierten Politik über-dauert sogar ihren Einzug in den Bundes-tag.Als sie 1983 für die Grünen nach Bonnkommt, gehört sie der Partei noch nichtan. Den Eintritt holt sie erst zwei Jahrespäter nach. Ihre politische Fürsorge abergilt heute allen, die sich am Rand der Ge-sellschaft radikalisieren – von der RAF biszu den Sudetendeutschen Landsmann-schaften.
Gewiß, der „Radikalenerlaß“, mit demvom Staatsdienst ausgeschlossen werdensoll, wer einer „extremen Organisation“angehört, wird schon im Januar 1972 ver-abschiedet, zur hohen Zeit Willy Brandtsalso. Und doch greift das Klima der öf-fentlichen Einschüchterung, der Militari-sierung des Staates gegen alle „System-gegner“ erst richtig nach 1974, als der Frie-densnobelpreisträger zurückgetreten ist.
Schon im Juli 1972 rät der damals nochamtierende Bundespräsident Gustav Hei-nemann dem „roten Rudi“ Dutschke da-
von ab, sich politisch bei den Sozialdemo-kraten zu betätigen. Bei einem privatenTreffen im Hause des Theologen HelmutGollwitzer in Berlin nennt er die SPD„eine Partei von Unteroffizieren“ und er-muntert Dutschke, die außerparlamenta-rische Arbeit nicht aufzugeben – Heine-mann: „Ihr werdet wohl erst Häuser be-setzen müssen, ehe wir ein anderes Miet-recht bekommen.“
„Die wirklich konservative Wende be-gann mit dem Wechsel zu HelmutSchmidt“, davon ist Manfred Coppik, Bun-destagsabgeordneter der SPD seit 1972,noch heute fest überzeugt. Zusammen mitseinem politischen Freund Karl-HeinzHansen und ein paar anderen Sozialde-mokraten – Erich Meinike, Dieter Latt-mann, Klaus Thüsing, Olaf Schwencke –,aber nie mehr als vier, weil sonst die Re-gierungsmehrheit dahin gewesen wäre,versucht der linke Anwalt aus Offenbach,„den furchtbaren Kreislauf von Terror,Angst, Repression, Abbau von Freiheits-rechten und neuem Terror zu unterbre-chen“, indem er gegen die Anti-Terror-Ge-setze stimmt. Eigentlich sei das „biederesozialdemokratische Politik“ gewesen, fin-det Coppik. Aber nicht im DeutschenHerbst. Am Ende wird er – wie auch Han-
bruchs von ’68 für mehr Demokratie undeine andere Republik beflügelt – zur Dis-kussion über die SPD, der manche an-gehören. Es wird eine Abrechnung. ObHeinrich Böll oder Eugen Kogon, ClausPeymann oder Jürgen Flimm, Petra Kellyoder Otto Schily, Erhard Eppler oder OskarLafontaine – alle wünschen sich die regie-renden Sozialdemokraten ins Lager derFriedensdemonstranten. Helmut Schmidtund die Seinen aber feiern mit Reagan.
Ist ihnen jedes Gespür abhanden ge-kommen? Zur Mittagspause versichertEgon Bahr dem selbstkritischen BerlinerEx-Bürgermeister Heinrich Albertz, dernach seiner katastrophalen Polizeiaktion
sen – aus der Partei hinausgeekelt, zu derbeide inzwischen zurückgefunden haben.
Je länger die Regierung Schmidt im Amtbleibt, desto grimmer wird das aus Terro-ristenfurcht stacheldrahtbewehrte Bonnzur gesellschaftlichen Isolierstation. ImSommer 1982, als der amerikanische Prä-sident Ronald Reagan die Stadt besuchtund 350000 Demonstranten gegen ihn unddie geplante Raketen-Aufrüstung der Natodemonstrieren, versammmeln sich auf Ein-ladung des Kanzlertreuen Egon Bahr unddes Grafikers Klaus Staeck drei DutzendSchriftsteller, Künstler, Professoren, Thea-terregisseure und andere Geistesschaffen-de – alle einmal von der Euphorie des Auf-
116 d e r s p i e g e l 2 5 / 1 9 9 7
„Ihr werdet wohl erst Häuser besetzen müssen, ehe
ein anderes Mietrecht kommt“

gegen die Studenten 1967 zurückgetretenwar: „Bis jetzt, Heinrich, habe ich nochnichts Neues gehört.“ Da zieht ihn Albertzzu sich heran und flüsterte: „Egon, wenndu hier heute nichts Neues gehört hast,dann wirst du niemals mehr etwas Neueshören.“
Es ist aber schon zu spät. Knapp ein hal-bes Jahr darauf ist die Regierung Schmidt-Genscher am Ende.
Die Folge scheint paradox: Zusammenmit dem durch Wahl bestätigten CDU-Kanzler Helmut Kohl zieht am 29. März1983 auch die bunte Truppe der „Grünen“in den Deutschen Bundestag ein, mit Man-delzweigen und Forsythien. Der schmale
Keil in der Mitte des Plenums, zwei Sitzebreit, 14 Reihen tief, den die 27 alternativenAbgeordneten besetzen, symbolisiert ei-nen scharfen Riß in der Nachkriegsge-schichte.
Die neue Partei versteht sich zu Rechtauch „als Instrument zur Resozialisierungder 68er für die bundesdeutsche Politik“(Vollmer). Denn tatsächlich profitierenbald auch die Alt-68er der SPD von denNeulingen. „Seit ihr im Parlament seid,kann ich viel besser agieren“, vertraut Ex-Juso Ottmar Schreiner einem Grünen an:„Die hören mir jetzt endlich mal zu.“
Ganz so selbstverständlich aber, wie esan diesem Tag scheint, ist der Weg der Apo-
Linken von der Revolte gegen das Systemzur Mitarbeit im Parlament nicht gewesen.Der Grüne Jürgen Treulieb, Jahrgang ’43,einer der engsten Freunde Rudi Dutsch-kes aus den großen SDS-Jahren in Berlin,ist zunächst sogar „richtig entsetzt“. Er seimit Dutschke in einen Konflikt geraten,„als er so um ’78 mit der Idee kam, wirmüßten bei den Grünen mitmachen“.Treu-lieb wittert Blut und Boden.
Heute sagt Jürgen Treulieb, der noch im-mer Mitarbeiter der Fraktion in Bonn ist:„Der Rudi hatte den richtigen Riecher. Undwenn auch vieles dazugekommen ist undmanches wie Kraut und Rüben durchein-andergeht – ohne die alte Apo wären dieGrünen nicht denkbar.“
Die „mittelbaren Effekte“ (Däubler-Gmelin) der Bewegung haben die deutscheGesellschaft zu dieser Zeit schon nachhal-tig verändert. So vollmundig Helmut Kohlauch prahlt, er werde mit einer „geistig-moralischen Wende“ die Entwicklung seit
’68 wieder zurückdrehen – er schafft esnicht einmal in der eigenen Partei. Im Ge-genteil: Eine Gruppe von Unionspolitikernoutet sich in Bonn als „alternative 68er“.Der Frankfurter Sozialphilosoph JürgenHabermas hat es auch keineswegs nur iro-nisch gemeint, als er die Karriere von RitaSüssmuth als den greifbarsten Erfolg der68er bezeichnete.
„Draußen im Lande“, wie sie in Bonn sa-gen, wenn sie das richtige Leben meinen,regt sich die Politik in Form von „neuen so-zialen Bewegungen“. Und keiner verstehtes so gut wie der Saarbrücker Oberbürger-meister Oskar Lafontaine, den Anti-Rake-ten-Protest gegen den Atomstaat generellzu mobilisieren. Mit seiner Mischung ausKompetenz und Unverfrorenheit beutet derSaarländer die Energien und Emotionenbeider Bewegungen aus – die der Studen-tenrevolte und die der Grünen.
„Der Oskar“ – frech und akademischanmaßend, lebensprall und demagogisch –symbolisiert ein neues Selbstverständnisder 68er. Die verstehen sich inzwischen alseine Generation, die stolz ist auf ihre ge-meinsame Erfolgsgeschichte. Alterszu-gehörigkeit und ein Lebensgefühl, das sichaus der Beteiligung an einem historischenBruch speist, verdichten sich zu einem„Wir“-Gefühl, für das die tatsächliche Ak-tion zweitrangig wird.
20 Jahre nach dem Aufruhr sieht es soaus, als habe die Rebellengeneration inOskar Lafontaine, der zudem als Lieb-lingsenkel des zurückgetretenen SPD-Vor-sitzenden Willy Brandt gilt, jenen Manngefunden, der für sie den machtpolitischenDurchbruch in Bonn schafft. Er muß ein-fach nur noch Kanzler werden, eine For-
d e r s p i e g e l 2 5 / 1 9 9 7 117
„Nun fangen die Verhältnisse anzu tanzen, und die
alten 68er halten den Tisch fest“

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 5 / 1 9 9 7
malie, wie die Meinungsbefrager versi-chern.
Doch dann fällt die Mauer. Alle moder-nen politischen Themen, die einen rot-grü-nen Wahlsieg wahrscheinlich zu machenschienen, geraten über Nacht in den Hin-tergrund. Für die nationale Thematik aber,für patriotische Gefühligkeit gar, hat derSaarländer keinen Sinn. Ein Attentat lähmtihn zusätzlich.
Daß jetzt zusammenwächst, was zu-sammengehört, mochte Willy denken, „derAlte“, Lafontaine nicht. Für ihn, wie für diemeisten westdeutschen Altersgenossen be-deutet 1989 ein Bruch der Kontinuität,nicht ein Anknüpfen an Traditionen. Der„Kanzler der Deutschen Einheit“ heißtHelmut Kohl.
Ist das nun das Ende der 68er? Es istwohl das Ende eines Machtwechsels alsGenerationenprojekt. Daß die Umstürzlervon einst auf diese Situation nicht vorbe-reitet sind, bemerken sie selbst mit zuneh-mender Hilflosigkeit.Viele wenden sich ab.Resignation und Zynismus greifen um sich.Die zwei noch in Bonn aktiven alten SDS-ler – Tilman Fichter und Karl-Heinz Klär –trifft es wie ein Schock. „Nun fangen dieVerhältnisse an zu tanzen“, sagt Klär bit-ter, „und die alten 68er halten den Tischfest.“
Daß Lafontaine 1990 mit dem schlech-testen SPD-Ergebnis seit Godesberg ver-liert, betrachtet Tilman Fichter als direk-te Folge „dieser großen Verweigerung“.
Seither versucht vor allem Joschka Fi-scher, die politischen Chiffren 1968 und1989 zusammenzubringen, sie zur radikal-demokratischen Grundlage einer „Berli-ner Republik“ zu machen. ’68 stehe für„die Demokratisierung von unten“, die„innere Verwestlichung“, mit der die west-deutsche Nachkriegskultur ihren unter-gründigen Nazismus endgültig beerdigthat, sagt Fischer. 1989 beschreibe die „ein-zige erfolgreiche demokratische Revolu-tion auf deutschem Boden, die nicht vonaußen dem Land aufgezwungen wurde“.Sollte sich, fragt der Grüne, mit solchemErbe kein vernünftiger Staat machen las-sen?
Noch findet er wenig Anklang. Deutsch-land ist einfach nicht das Thema seiner Al-tersgenossen. Heinz Bude, dem Chronistender Generation, gilt ’68 sogar als der Punkt,„von dem ab sich die beiden Teile Deutsch-lands erst richtig auseinanderentwickelthaben“. Bis in den Prager Frühling hineinhieß das Ziel bei den 68ern im Westen wiebei denen im Osten – den Biermännernund Bohleys und vielen idealistischen SED-Genossen – Emanzipation. Das brutaleEnde, der sowjetische Einmarsch in die∏SSR, war ein gemeinsamer Schock.
Seither mehren sich Zweifel und Unver-ständnis. Den Wessis fehlt im Osten dieKulturrevolution, den Ossis erscheint die„autoritäre Staatsgewalt“ der Bundesre-publik, der getrotzt zu haben die 68er so
gen Revoluzzer-Haltung gegenüber Auto-ritäten und ihren Institutionen sind die mei-sten Männer nie hinausgewachsen. Längstgrau oder kahl und melancholisch gewor-den, pflegen sie weiter ihren rebellischenGestus, empfinden sich notorisch als jung.
Das kann sympatisch wirken, wenn ei-ner so vergleichsweise unambitioniert auf-tritt wie der Grüne Abgeordnete RezzoSchlauch, Jahrgang ’47, der unlängst fastOberbürgermeister von Stuttgart gewor-den wäre. Dem ist die „Spaßguerrilla“ vonAnfang an das Wichtigste an ’68 gewesen.
Die Art, wie Fritz Teufel die Justiz unddie Obrigkeit ad absurdum geführt hat, in-dem er fünf Jahre in Untersuchungshaft
* Das Bild von Michael Ruetz ist dem Buch „1968“ ent-nommen, das im November 1997 bei 2001 erscheint.
ungemein stolz macht, vergleichsweiselachhaft. Noch immer, so schreibt die Ost-Berliner Psychoanalytikerin Annette Si-mon, Jahrgang 1952, jetzt in der zeit, sei-en viele „bitter enttäuscht“ voneinander.„’68 und ’89 sind gemeinsame wichtige Da-ten, oft biographische Einschnitte, die aberauch das Trennende sehr stark markieren“.
Gemeinsam ist den Angehörigen dieserGeneration in Ost und West indes eine„merkwürdige Aggression gegenüber denNachgeborenen“, fällt Annette Simon auf.Korrespondiert die nicht trefflich mit derWut auf die Vorfahren? Die 68er sind einHalbfertigprodukt geblieben.
’68 war auch eine Rebellion der Töchterund Söhne gegen die Väter – gegen die Na-zi-Väter im Westen, gegen die Stalinisten imOsten. Aus dieser emotionalen und geisti-
118
Rheinland-pfälzischer Ministerpräsident Kohl (1970)*: Anknüpfen an Traditionen M
. R
UETZ /
ZW
EIT
AU
SEN
DEIN
S

d e r s p i e g e l 2 5 / 1 9 9 7
blieb, um dann ein Alibi zu präsentieren,womit er sich die Strafe selbst setzte – dashält Rezzo Schlauch für „einen Genie-Streich, der fortbesteht“. Solche Aktionenmachen für den grünen Anwalt heute daseigentliche politische Erbe der 68er aus:Jede Art von staatlicher Autorität muß sichimmer wieder neu begründen.
Als „Nachgereister“ der Bewegung istSchlauch erst 1994 im Deutschen Bundes-tag eingetroffen, wo er einerseits „die Un-beugsamkeit“ seines Freundes Fischer be-wundert, nicht minder aber „die Jung-schen heute“, die „gnadenlos pragma-tisch“ sind.
Er selbst ist 1968 versehentlich in denAufruhr geraten, als er mit seiner schla-genden Verbindung, dem Freiburger Bund„Sachsen-Silesia“ nach Paris reiste, „we-gen Paris, nicht wegen der Revolte“. Heu-te erscheint ihm die „Pizza-Connection“,eine informelle Gesprächsrunde von jun-gen Grünen und jungen CDU-Bundes-tagsabgeordneten, die sich – von den Fun-dis beider Fraktionen und von den Sozismißtrauisch beäugt – gelegentlich im Wein-keller eines italienischen Restaurants inBonn trifft, eine angemessen zeitgemäßeAusdrucksform des 68er-Geistes.
Daß sich Schlauch am liebsten selbstnoch den „Jungschen“ zurechnet, belu-stigt die, ärgert sie aber nicht. Denn sei-ne „Alter-Junge“-Attitüde wirkt ungleichweniger verkrampft als die Lümmel-Masche, mit der sich die Führungsfigurender SPD gern präsentieren, die – heuteum die 50 Jahre alt – noch immer „Enkel“heißen. Hätten die nicht, in der Lebens-mitte angekommen, eigentlich die Aufga-be, ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnungweiterzugeben, um das Erreichte zu tra-dieren?
Aber haben sie denn was erreicht? Nie-mand scheint es mehr zu bezweifeln alssie selbst. 30 Jahre danach bieten die ver-greisenden Jünglinge dieser Generation einseltsam verwackeltes und unscharfes Bild.Sie wirken so alt wie ihre Väter und gebensich so jung wie ihre Söhne.
Gemeinsam ist allen ein zögernder Zu-griff auf die Macht, ein ebenso nervendeswie im Grunde sympathisch halbherzigesVerhältnis zur Amtsautorität, selbst zur ei-genen. „Keiner hat wirklich seinen Frie-den gemacht mit dem deutschen Staat nachHitler“, glaubt Tilman Fichter.
Oder doch? Als kürzlich der ehemali-ge SPD-Bundestagsabgeordnete AlbrechtMüller, der 1972 die triumphale „Willy“-Wahl organisierte, behauptet: „Siege kannman machen“, hat er einen besonders auf-merksamen Zuhörer – Gerhard Schröder.
Doch scharrt der Niedersachse zuneh-mend Mikrofon-jibberich auf der Stelle, alsMüller – Jahrgang ’38, weißhaarig und un-erschütterbar in seinen Gewißheiten – inBonn seine Rezepte als Buch vorstellt.Schröder will selbst reden, vor allem aberselbst siegen.
ist er gegen „die da oben“ aufgestanden.Bis heute liebt er unkonventionelle Auf-tritte, genießt individuelle Freiräume undhat den Instinkt des Underdog für dieSchwächen der Mächtigen und die Machtder Schwachen.
Alles wahr. Dennoch zieht es GerhardSchröder vor, sich derzeit lieber als „einsehr gemäßigtes Produkt“ der 68er-Bewe-gung zu betrachten. Schließlich ist er schon1963 in die SPD eingetreten, bevor er – als
er Jura auf dem zweiten Bil-dungsweg studierte – zu denJusos stieß. Und das war, hater früher einmal gesagt,„eher ein spontaner Ent-schluß“, noch kein Akt vonsozialem Bewußtsein.
Und hat er sich nicht, alsdie Genossen aus dem kol-lektiven linken Juso-Vor-stand in Göttingen in endlo-sen Debatten den Marxis-mus-Leninismus erschlos-sen, auf die Lektüre vonKlappentexten beschränkt?Schröder konzentriert sichmehr aufs Banale, auf Pres-se, Kasse und eigenes Vor-ankommen, während denleidenschaftlichen 68ern dieErlösung der Menschheit amHerzen liegt.
„Für mich war das Studi-um 1966 ja ein ungeheuresPrivileg“, sagt Schröder heu-te, „um Politik habe ich michda nicht groß gekümmert.“Keine Teach-ins, keine Kund-gebungen. Gewiß, die Jusosentwickeln sich in dieser Zeitvon einer bloßen Jugendor-ganisation zur politischenTruppe. Und die hat er dannangeführt.
Aber „die eigentliche Ra-dikalisierung“ hat GerhardSchröder, wenn er es heuterecht betrachtet, doch nuram Rande mitgekriegt.
Andererseits, soll er deshalb bestreiten,dazugehört zu haben? Schließlich war „derModernisierungsschub“ von damals jawirklich wichtig, wenn auch die Entwick-lung nach seiner heutigen Überzeugungohne ’68 ähnlich verlaufen wäre.
„Unkonventionelle Denk- und Verhal-tensweisen“, eine Entwicklung „hin zumehr Individualität“, solche Merkmale willGerhard Schröder denn wohl doch geltenlassen als Früchte von damals. Die teilt erja auch mit Generationsgenossen wie BillClinton und Tony Blair.
Aber 68er? „Ich bin es nicht.“
Im nächsten HeftSPIEGEL-Gespräch mit den Ex-Guerril-leros der „Bewegung 2. Juni“ Till Meyer,Bommi Baumann und Anne Reiche
Sichtlich unfroh hört der Kanzler-As-pirant aus Hannover einmal mehr dasHohelied „des Alten“ und Müllers Er-folgsrezepte: „Meinungsführerschaft stattAnpassung“; „Langfristige Strategie undPhilosophie“. „Die SPD – auch eine Wert-gemeinschaft“, kurz: Vorwärts mit derPartei, nicht gegen sie.
Jajaja. Als er endlich zu Wort kommt,sagt Schröder: „Da ist ja’n bißchen was vorangegangen, damals.“ Und nicht
wenige glauben, er werde jetzt von ’68 sprechen.
Aber Gerhard Schröder meint den Slo-gan: „Wir bauen das moderne Deutsch-land“. ’68 hat er dabei natürlich mit im Sinn gehabt, erläutert er später. Ge-redet hat er aber über Karl Schiller unddessen wunderbares Verhältnis zur Wirt-schaft.
Von vielen Genossen der Apo wirdSchröder, Jahrgang ’44, durchaus als 68ergeführt. In Göttingen ist er 1966 zu den Ju-sos gestoßen, als Anwalt hat er Prozesse ge-gen Berufsverbote geführt, hat Atomkraft-gegner verteidigt und für den SPD-Rebel-len Hansen gegen den Parteiausschlußgekämpft.
Mit den meisten linken Inhalten der Be-wegung stimmte er einmal überein. Frech
119
Anwalt Schröder (1977): „Gemäßigtes Produkt“ der 68er
H.
FR
ATZER

Deutschland
Die 68er (2): Was an Spaß, Hoffnung und Gewalt in der Revolte der 68er steckte,hat keiner so konsequent, so kreativ und so trostlos zu Ende gelebt wie der Clown,
Terrorist und Fahrradkurier Fritz Teufel. Von Moritz von Uslar
Eine Ewigkeit ist das her und nochlänger – da entsichern Beamte einerSpezialeinheit hinter einer Berliner
Haustür ihre Waffen. Es ist der 13. Sep-tember ’75. Fritz Teufel hält den Schlüsselin der rechten, eine Reisetasche in der lin-ken Hand. Da grinst der Teufel nur. Das ist seine Gegenwehr. Seine Freundin Gabriele Rollnik, 25 Jahre alt, der Polizeials „Sympathisantin“ bekannt, hat sich die Sorte Tasche aufgeladen, die jede Ver-teidigung unmöglich macht. Sie kriegtnichts mehr hin. Dann fängt sie an zu weinen.
Zu der Zeit sitzen viervon sechs mutmaßlichenMitgliedern der terroristi-schen „Bewegung 2. Juni“in Untersuchungshaft. Siehaben riesige Schnauzbärtegetragen und durchgeladeneWaffen im Hosenbund; siesollen Banken ausgeraubt,einen CDU-Politiker ent-führt und den höchstenRichter Berlins erschossenhaben.
Teufel tut nicht einmal so,als wolle er Widerstand lei-sten. Der Ausweis in seinerJeansjacke ist auf den Na-men Erhard Östreich ausge-stellt, der Reisepaß auf Rai-ner Schmidt. In einem VW-Bus findet die Polizei dasDurcheinander, das Men-schen auf der Flucht beglei-tet: Kartons mit Kleidern,Büchern, vollgekritzeltemPapier, 31 000 Mark und eine Flinte mit vier Dum-Dum-Geschossen im abgesägtenLauf.
Auf dem Foto nach seiner Festnahmefehlt Teufel der Vollbart. Er grinst nichtmehr. Zum erstenmal ist er wirklich fertig.Hinter seinen Augenringen starrt er denBlick des Kurzsichtigen, dem seine Brilleverlorengegangen ist.
Da sitzt der Teufel von 1997 im abge-wetzten Knautschlack seines Wohnzim-mersessels, und es wird nicht klar, mit wemman sich unterhält, mit dem Teppichbo-den, den niedrigen Decken, dem CD-Stän-der aus Plastik, dem finsteren Mann, der
d e r s p i e g e l 2 4 / 1 9 9 7
Einer, der gern saßEuch fragen, was Ihr alles falsch gemachthabt. Ihr habt nichts falsch gemacht, son-dern immer das, was Ihr für richtig hieltet.Genau das versuche ich auf meine Weisejetzt auch.“
So schreibt man Briefe. So – knapp, ein-fühlsam und selbstbewußt – kann man El-tern klarmachen, daß man ab sofort Wich-tigeres als Arbeit zu tun hat. Teufel trittdem Sozialistischen Deutschen Studenten-bund (SDS) bei. Seine Freundin, ein poli-tisch motiviertes Mädchen, trägt roteFlauschpullover, aber sie leidet unter De-pressionen und bringt sich um.Teufels Mut-ter ist Hausfrau, sein Vater Steuerberater.Sie leben in Ludwigsburg am Neckar.
Im Januar ’67 schreibt Teufel seinen El-tern den nächsten Brief. Der Fall ist dies-mal komplizierter. Teufel faselt von einem„politischen Praktikum, außerhalb der be-stehenden politischen Parteien“ und dem„Experiment mit der Kommune, zusam-menleben, zusammen wirtschaften … malsehen, was daraus wird“.
Tatsächlich kapiert damals kein Mensch,warum ein Haufen junger Menschen, wennnicht aus Geldgründen, sich eine Wohnungteilen soll. Teufel weiß es offenbar auchnicht: Aber es hat die Zeit begonnen, in derman erst mal loslegt und später alles aus-diskutiert.
Im März ’67 ziehen Teufel und seineKumpel – Rainer Langhans, Ulrich En-zensberger, einer ist stolz darauf, kein Abitur zu haben, und heißt Dieter Kunzel-mann – in eine riesige, verwohnte Altbau-wohnung am Stuttgarter Platz. Ihre Zieleformuliert die Kommune 1 (K1), von An-fang an auf Medienrummel bedacht, wiefolgt: „Revolutionierung des Alltags, Ab-schaffung des Privateigentums, Brechungdes Leistungsprinzips, Proklamation desLustprinzips“.Vater Teufel schreibt zurück:„Natürlich verstehen wir Dich nicht. MachDir das Leben nicht schwerer als nötig.“
Der Teufel von 1997, zu Hause in einerfinsteren Wohnung: „Wir waren der An-laufpunkt, wo alle, die nicht ganz so bier-ernst bei den Demos sein wollten, sich ge-troffen haben. Vorne gab’s einen Eingang,hinten einen, und ständig hat’s geklingelt.“
Unter Kommunarden wurde lieber ge-quatscht als diskutiert: „Es ging um Viet-nam, um Theorie, die wir nur halb gelesen,
sein Zuhause vom finstersten Eck seinesWohnzimmers aus kontrolliert.
Teufel erinnert sich – das merkt mandaran, daß er tut, als wüßte er nichts mehr.Sein Haar will nicht: Der Teufel hat es ab-rasiert. Seine Jacke will nicht: Das weißeLeder hat gelbe Flecken. Das Licht willnicht: Es ist ausgeknipst. Der Wohnblock,in dem Fritz Teufels Wohnzimmer liegt,wollte noch nie: Vor 30 Jahren war derBlock neu und häßlich. Heute ist er häß-lich und alt. Hinter Fettflecken auf Nickel-brillengläsern sehen flinke Augen seinenErzählungen hinterher: „Zeit hat keine Be-
deutung. Ich bin jetzt 53 und habe sovielerlebt. Wie andere erst mit 54.“
Der Teufel spricht, aber dafür braucht erZeit: Seine Worte gehen einen langen Weg.Sprechpausen sind Sekunden lang. Amliebsten will Fritz Teufel – Ex-Studenten-führer, Ex-Kommunarde, Ex-StaatsfeindNr. 1 – davon erzählen, wie es sich in Ber-lin als Fahrradkurier lebt.
Im Dezember ’66 schreibt der StudentTeufel seinen Eltern einen Brief: „Ich binnun sicher, daß für mich ein ordnungs-gemäßer Abschluß der Universität nichtmehr in Frage kommt. Ihr werdet die Hän-de über dem Kopf zusammenschlagen und
72
Ex-Staatsfeind Teufel (1997): Soviel erlebt wie andere mit 54
M.
WEIS
S /
OS
TK
REU
Z

d e r s p i e g e l 2 4 / 1 9 9 7
angeblich aber voll verstanden hatten,Marx, Horkheimer, Adorno. Ich sage imnachhinein: Wir hatten von nichts eine Ah-nung und wußten alles besser.“ Der Alltagwurde revolutioniert, also sah jedes Zim-mer wie die Revolution aus: „Über meineMatratze habe ich ,antiautoritäres Lager‘geschrieben. Im Flur stand unser ,RoterPrint‘, die Druckmaschine. Über Aktionenhat man auf den verwanzten Sesseln imEckzimmer diskutiert. Und sonntags gab’s,wenn Teufel Laune hatte, Teufels berühm-ten Schweinerollbraten.“
Eines Abends im April ’67 – B-52-Bom-ber der Amerikaner fliegen über Nord-vietnam, Hubert Humphrey, der US-Vize-präsident, hat sich für einen Berlin-Besuchangekündigt – schleichen drei Kommune-Jungs mit Plastiktüten durch die Dämme-
Das Bild von Michael Ruetz (o.) ist dem Buch „1968“entnommen, das im November bei 2001 erscheint.
rung im Berliner Grunewald. Die Tütensind mit einem Gemisch aus der Gemein-schaftsküche angefüllt: Schokopudding, Jo-ghurt, Rauchpulver.
Kunzelmann probiert die Puddingge-schosse an Baumstämmen aus. Die anderenzwei kichern und bitten, wenn Radfahrerklingeln, um Entschuldigung. Polizisten sei-len sich aus dem nachtschwarzen Himmelab. Die drei werden festgenommen, überNacht alles, was sich in den Räumen der K1bewegt. Die berliner zeitung hat ihreSchlagzeile: „Geplant – Berlin: Bomben-anschlag auf den US-Vizepräsidenten“.
Die deutsche Presse heult auf. Der Rich-ter läßt von einem Haftbefehl gegen dieKommunarden ab. Die bild-Zeitung stelltOrdnung her: „Mit diesen Bombenlegernwerden wir fertig! Die Mehrheit der Deut-schen hat Verständnis mit dem Kampf derAmerikaner in Asien.“
Kein Mensch würde sich heute noch andas Schwachsinnsattentat erinnern, wärendamit nicht zwei Gegenspieler, Hand-lungsträger für einen Krimi, festgelegt: Derdurchgedrehte Staat, also Polizei, Justizund Presse, formieren sich auf der einenSeite. Der durchgedrehte Teufel zwischenSitzstreik,Anklagebänken und Gefängnis-zellen: Das soll die andere Seite sein. DerKrimi könnte „Deutschland, wie ein Staatseinen Verstand verlor“ heißen. Teufelschlägt „Dämonen“ als Buchtitel vor undals Untertitel „Denn sie wissen nicht, wassie tun“. Den Satz gibt es auf englisch. Daheißt er „Rebel Without a Cause“.
Fritz Teufel trägt Nickelbrille und einenVollbart. Die werden Markenzeichen. DerKleidungsstil der Kommunarden liegt ir-gendwo zwischen Lumpensammler, Gar-tenzwerg und südamerikanischer Revolu-tionär: Der paßt. Der geht als Vorbilddurch. Den finden die meisten Menschenschlichtweg ekelhaft.
Es ist der Mai ’67, als Teufel und seineKumpel unter Druck geraten, etwas wirk-
73
M.
RU
ETZ /
ZW
EIT
AU
SEN
DEIN
S
SÜ
DD
. VER
LAG
Bürgerschreck Teufel, Langhans (1968): „Bombenanschlag auf den US-Vizepräsidenten“
Richterschreck Teufel auf der Anklagebank (1967): „Wenn’s der Wahrheitsfindung dient“

d e r s p i e g e l 2 4 / 1 9 9 7
lich Verwegenes zu tun. In Brüs-sel brennt das Kaufhaus „A l’In-novation“: Das ist keine guteNachricht. Über 300 Menschenfinden in den Flammen ihrenTod. Die K1 verteilt Flugblättervor der Mensa der Freien Uni-versität.
Schlagzeile: „Wann brennendie Berliner Kaufhäuser?“ Zitat:„Unsere belgischen Freunde ha-ben endlich den Dreh heraus, dieBevölkerung am lustigen Treibenin Vietnam zu beteiligen: sie zün-den ein Kaufhaus an, dreihun-dert saturierte Bürger beendenihr aufregendes Leben, und Brüs-sel wird Hanoi. Burn, warehouse,burn!“ Darf man nicht denken, so was,nicht aufschreiben und als Flugblatt ver-teilen: Skandal.
Die Berliner Staatsanwaltschaft erhebtAnklage wegen „Aufforderung zur men-schengefährdenden Brandstiftung“. ImWortlaut klagt der Staat wegen „Anstif-tung zum vorsätzlichen Inbrandsetzen vonRäumlichkeiten, welche zeitweise demAufenthalt von Menschen dienen, undzwar zu einer Zeit, während welcher Men-schen in denselben sich aufzuhalten pfle-gen.“ Der SDS distanziert sich von der Tat.
Der Teufel von 1997: „Das war einScherz! Ein Scherz! Geht das bis heutenicht in die Köpfe rein?“
Ein Scherz hat sich also strafbar ge-macht. Von Anfang an also Mißverständ-
sorg, 27. Der Todesschütze sitztnicht einen Tag in Untersu-chungshaft. Er wird freigespro-chen. Teufel hat einen Stein ge-worfen, er hat als „Rädelsfüh-rer“ Demonstranten „aufge-hetzt“ und „Notstandsübung“gerufen – so erinnern sich zweiPolizisten. Teufel sitzt als Unter-suchungshäftling in der Haftan-stalt Moabit ein. Da bleibt er sit-zen, mit einigen Unterbrechun-gen, bis zum 22. März ’68.
Der Teufel von 1997 erinnertsich an 1967 und wie das mitdem ersten Toten der Studen-tenbewegung war: „Wir habennicht viel an den Menschen Oh-
nesorg gedacht. Man kannte ihn kaum.Aber daß er einer von uns war, war klar.Ein Blutrausch hat sich eingestellt: Wenndie uns umbringen, auf uns schießen, müs-sen wir uns überlegen, was wir dagegentun. In Gedanken war das schon die Ge-burtsstunde der Guerrilla.“
Mindestens drei Teufel saßen im Juni ’67in Untersuchungshaft – glaubt man derfinsteren Gestalt im Wohnzimmersessel,die heute ihre Geschichten gern mit „Wasdenn?“, „Wie bitte?“ und „Weiß nichtmehr!“ auf den Kopf stellt, so, als wär’s soaufregend alles nicht gewesen.
Teufel, Haßobjekt der Polizei: „Die tru-gen ausrasierte Nacken und Lederstiefel.Polizei! SA! SS! Das war der Studentenruf,und die sahen damals tatsächlich aus wie
nisse, absurde Anklagen, ein lustiges Rol-lenspiel, und mittendrin Fritz Teufel, derClown. Es kommt der 2. Juni ’67.
Gegen halb acht abends fährt der Bun-despräsident vor der Deutschen Oper inBerlin vor, 20 Minuten später der Schahvon Persien und die Kaiserin. Teufel setztsich mit Studenten auf die Straße: „Plötz-lich wurde ich an den Haaren gezogen, mitKnüppelhieben und Fußtritten traktiert.Meine Brille ging zu Bruch. Ich wurde weg-getragen. Jemand rief: ,Das ist ja der Teu-fel! Der war bei dem Sprengstoffattentatauf Humphrey mit dabei!‘“ So erklärt dasTeufel Monate später vor Gericht.
Durch eine Kugel aus der Dienstpistoledes Kriminalobermeisters Karl-Heinz Kur-ras, 39, stirbt der Student Benno Ohne-
74
AP
ULLS
TEIN
Kriegsopfer in Vietnam: „Menschengefährdende Brandstiftung“
Kommune-Happening auf dem Ku’damm zur Haftentlassung Teufels (1967): „Wann brennen die Berliner Kaufhäuser?“

Deutschland
d e r s p i e g e l 2 4 / 1 9 9 7
die SS in Polen. Man hat sich hingesetztund ist nicht aufgestanden. Dann kamendie schon mit Tütata. Die Polizei hat jaerst für Happenings gesorgt. Die wareneinfach unersetzlich. Ein Garant dafür,daß es lustig werden konnte.“
Teufel, Liebling der Medien: „Die Sprin-gerleute waren unsere Mitarbeiter. Wirbrauchten die. Die brauchten uns. Die ha-ben Feindbilder aufgebaut, Anarchismusund Terror herbeigezaubert, wo nur Farb-eier geflogen sind. Die haben uns als Geg-ner akzeptiert. Die sagten, Wirrköpfe,Spinner, Utopisten. Stimmte alles.“
Teufel, Held der Studentenbewegung:„Solidarität, das ist eine Droge, die highmacht, andererseits auch abhängig. Manwar im Dauerrausch. Vor den Gerichtensind die Wasserwerfer aufgefahren. Daswar ein Kick, aber auch zuviel Ehre für ei-nen jungen Mann.“
Der Teufel, der einfach Angst hat, sichseine Zukunft mit Blödsinn zu verbauen,mit Gefängnis, mit noch mehr Blödsinn,mit einer noch endloseren Gefängnisstra-fe, den gibt es nicht. Den gab’s wahr-scheinlich nie. Schon möglich, daß Teufelgerne im Gefängnis saß: „Ich fand es hin-nehmbar. Die müssen dich rauslassen,dachte ich. Steinewerfen, was soll der Un-sinn. Auch später: Ich wußte immer, ichkomme da wieder raus.“
In Untersuchungshaft, am 17. Juni ’67,wird Fritz Teufel 24 Jahre alt. Er ist ab so-fort: Popstar. Seine Mutter kommt kaummit der Geburtstagstorte durch. Dafür be-kommt Teufel Post von sich solidarisch er-klärenden Studenten und Mädchen, die Fo-tos und Blümchen mitschicken, aber nochzu klein zum Steinewerfen sind.
Teufel und die Justiz: Sie müssen sich re-spektiert haben – sonst hätten sie es mit-einander nicht so weit gebracht. Der Schau-kampf, in dem die Justiz ihre Würde verliert
ben Plakate mit der Aufschrift „Freiheitfür Teufel“. Teufel schreibt einen Brief anseinen Kommune-Genossen: „ … und laßtin künftigen Briefen Sachen, die doch bes-ser unter uns bleiben (die Ermordung desamerikanischen Präsidenten), unerwähnt.Ich finde, ich sitze lange genug im Knast.Euer Fritz.“
10.August ’67: Haftverschonung für Teu-fel, er soll seine Personalpapiere abgebenund sich zweimal wöchentlich bei der Po-lizei melden. Teufel: „Ich werde den Auf-
lagen unter Protest nachkom-men. Wenn mir nichts Besse-res einfällt.“
13. August ’67: Rund tau-send Studenten feiern aufdem Ku’damm, zwischen Ge-dächtniskirche und CaféKranzler, ein „Love-In“ un-ter dem Motto: „Man mußden Teufel feiern, solange erlos ist.“ Passanten flippenaus: „Schlagt sie tot! Vergastdas Pack!“
18.August ’67: Teufel will freiwillig in dieUntersuchungshaft: „Ich werde der Mel-depflicht nicht nachkommen. Ich ziehe esvor, mich zum weiteren Vollzug der U-Haftzu melden.“ Ein Sprecher der Justiz: „Soeinfach ist das nicht.“
8. September ’67: Die Haftverschonungist aufgehoben, Teufel meldet sich nicht,wird von der Polizei gesucht.
15. September: Teufel begeht seine ritu-elle Verhaftung im Schöneberger Rathausin Berlin. Mit bürgerlicher Kleidung undabrasiertem Bart verschafft er sich mit rund230 Studenten Zutritt zum Plenarsaal, wodas Stadtparlament zu Fragen der innerenSicherheit tagt. Studenten-Ruf: „Wir wol-
* Mitglieder der „Bewegung 2. Juni“: Gerald Klöpper,Ronald Fritzsch, Ralf Reinders.
und der Angeklagte seine Freiheit, bloßnicht seinen Humor, dauert neun Monate.Er läßt sich kaum in Worte fassen. Manspricht vom „Moabiter Volkstheater“. EinKritiker wird Teufel die Auszeichnung ver-leihen, der „bemerkenswerteste deutscheTheatermacher der sechziger Jahre“ gewe-sen zu sein. Auszüge aus Teufels Theater-stück:
6. Juli ’67: Der Brandstifter-Prozeß gegenTeufel und Langhans wird in Saal 500 imLandgericht Berlin unter Polizeischutzeröffnet. Rentner und Stu-denten wollen die Angeklag-ten sehen. Im Gerichtssaalkommt es auf den überfülltenZuschauerbänken zu Tumul-ten: „Grüß dich, Fritz!“ –„Wir verstehen kein Wort!“ –„Denunziant! Denunziant!“ –„Sie werden hier Idiot ge-nannt, Herr Vorsitzender!“
7. Juli ’67: Zweiter Prozeß-tag. Die K1 verteilt Flugblät-ter: „Ihr Murmelgreise undSchleimscheißer des Rechts. Wir werdeneuch die Ohren abschneiden, ihr Rechts-diener.“ Das Gericht schlägt vor, die An-geklagten psychiatrisch untersuchen undbegutachten zu lassen. Teufel: „Einver-standen. Falls Staatsanwalt und Richter sichebenfalls untersuchen lassen.“
13. Juli ’67: Zweite Anklage des Gene-ralstaatsanwalt beim Landgericht in Moa-bit, die Teufel den Steinwurf gegen einenPolizisten vorwirft. 24 Entlastungszeugenwerden nicht angehört. Teufels Verteidi-gung droht mit einem Anruf bei der Eu-ropäischen Kommission zum Schutz derMenschenrechte.
7. August ’67: In der Nacht zum 8. Au-gust legen Unbekannte eine Rauchbombein der Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-niskirche.An den rauchenden Kartons kle-
76
„Die Springer-leute brauchtenuns als Gegner,die sagten: Wirr-köpfe, Spinner,
Utopisten;stimmte alles“
FO
TO
S:
SÜ
DD
. VER
LAG
Terroristenopfer Lorenz, Terroristen vor Gericht (1980)*: „Die mir unbekannten Entführer, deren einfacher Fan ich bin“

Deutschland
len diskutieren!“ Teufel erneut in Unter-suchungshaft.
28. Oktober: Teufel organisiert von sei-ner Zelle aus die sogenannte kleine Viet-nam-Demo, tippt über 2000 Flugblätter:„Amis raus aus Vietnam! Nazis raus ausder Justiz!“ Häftlinge verteilen die Zet-tel, schwenken selbstgemalte Vietkong-Fahnen. Teufel wird daran gehindert, eineRede zu halten, und unter Buhrufen inseine Zelle abgeführt. Seine Schreibma-
schine wird beschlag-nahmt.
27. November ’67:Beginn des Prozes-ses gegen Teufel.SDS-Sprecher RudiDutschke hat zu „ra-dikalen Maßnahmengegen Justizwillkürund Terror“ aufgeru-fen. Studenten findensich unter schwarzenund roten Fahnen zu
einem Autokorso ein. Die Polizei riegeltalle Eingänge des Justizgebäudes ab. Manspricht von „umfangreichsten Sicherheits-maßnahmen seit Kriegsende“. Teufel trägtein lila Hemd, frischgewaschene Haare undden alten Rauschebart: „Ich kann mit Si-cherheit sagen, daß ich keinen Stein ge-worfen und auch nicht dazu aufgeforderthabe.“
Der Richter: „Haben Sie Handlungengegen Polizisten begangen?“ Teufel: „Alssie mich an den Haaren hochzogen undwegtrugen, habe ich ,Aua‘ geschrien.“Richter: „Nein, ich meine: getreten? Ge-bissen?“ Teufel: „Ich werde mich hüten,einen Polizisten zu beißen. Wir habennichts gegen die Polizei: im Gegenteil. Ichglaube, ein Polizist würde viel lieber, stattStudenten zu verprügeln, seinem Vorge-setzten in den Arsch treten.“
29. November: Zweiter Tag der Haupt-verhandlung. Der Angeklagte liest Zeitung.Auf die Aufforderung des Gerichts, sich zuerheben, antwortet er: „Wenn es der Wahr-heitsfindung dient.“ Als Teufel aufsteht,schwebt er über den Dingen: Fünf Wortehaben ihm Flügel verliehen. Dem Prozeßwird Teufel aus phantastischen Höhen bei-wohnen und – Zeit seines Lebens – keineBodenhaftung mehr aufnehmen. Abendsläuft die Szene in der „Tagesschau“. Kon-servative Politiker und Bürger sehen inTeufel jetzt nicht nur ein Schwein, sondernein intelligentes Schwein. Polizisten sagenaus: „Wir haben nicht gesehen, daß Teufeleinen Stein geworfen hat.“
the guardian, le monde und newyork times bringen ausführliche Berichteüber den angeklagten Kommunarden. DieMoskauer literaturnaja gazeta: „ZuHelden der Prügelszenen in West-Berlinwurde ein Lumpenpack unter Führung ei-nes gewissen Fritz Teufel. Eine Reihe vonekelerregenden Obszönitäten begleiten dieSzenen der Rowdys.“
das Leben auf dem Kontinent von auto-ritären Strukturen unterdrückt wird.“ bildam sonntag: „Mao Tse Teufel, diesermerkwürdige weiße Chinese mit den rotenApfelbäckchen, hat monatelang hinter Git-tern gesessen. Ihn auf Staatskosten zu be-herbergen und abfüttern zu lassen sollte ei-gentlich den Bund der Steuerzahler zu Pro-testen veranlassen.“
Am 8. Januar ’68 wird Teufel wegen Wer-fen von Feuerwerkskörpern festgenom-men, am 22. Januar ruft er in einem Ge-richtssaal „Scheiße! Scheiße!“, am 25.Februar wird er wegen Diebstahl einer Po-lizeimütze zu zwei Monaten Haft verur-teilt.Am 4. März erscheint Teufel zur Fort-
30. November: Teufel zum Staatsanwalt:„Sie haben die Chance, vom Kurs derRechtsbrechung zum Kurs der Rechtspre-chung überzugehen.“ Vier Tage Ord-nungshaft für Teufel.
1. Dezember: Teufel kommt überra-schend und ohne Auflagen frei. Entlas-sungs-Happening vor dem Moabiter Ge-fängnisportal: Teufel raucht Zigarre. Hip-pie-Mädchen beschenken Polizisten, diedie Ansammlung zerstreuen sollen, mitBlumen. Mutter Teufel umarmt ihren Sohn:„Verbrennt mir bloß den Teufel nicht.“
Die international herald tribune:„Tausende junge Europäer teilen Mr. Teu-fels leidenschaftliche Überzeugung, daß
78
„Ihn auf Staatskosten
abfüttern zu lassen sollte
die Steuerzahlerzu Protestenveranlassen“
d e r s p i e g e l 2 4 / 1 9 9 7

setzung des Brandstifter-Prozesses in ei-nem orangenen Gewand mit lila Man-schetten. Am 20. Juli klatscht Teufel demWirt einer Schwabinger Gaststätte eine Por-tion Leberkäse mit Ei ins Gesicht: DerMann hatte Teufels Freunde als „verwahr-lost“ bezeichnet. Die Aktion geht als„Schwabinger Leberkäskrawalle“ in dieGeschichte ein.Am 3. Oktober kündigt Teu-fel seine Mitgliedschaft in der K1.Vor einemSchöffengericht erklärt der Angeklagte:„Ich stehe zu meinen Untaten und verlan-ge die Höchststrafe für meine Verbrechen.“
Bleiben noch heute einige Fragen an denTheatermacher der Revolution: „HabenSie sich als Revolutionär gefühlt?“ Teufel
im Wohnzimmersessel: „Nee. Als Knall-depp.“ Was hat ein Knalldepp für Eltern?Jetzt kommen die Geschichten dran, dieTeufel Freude machen: „Alfred und Lotte,die haben ja eine Wahnsinnsfamilie auf dieBeine gestellt: Sechs Kinder. Ich war derletzte, der Nachkömmling, also vollkom-mener Luxus.“ – „Und? Ihr Vater? Einnetter Mann?“ – „Ein Liberaler. Aber un-geheuer mitteilsam: Wie meine Mutter sag-te, jedes Wort ein Taler, jedes Lächeln fünfMark. Er mußte ja auch den ganzen Tagkleine Zahlenreihen zusammenaddieren.“– „Man fragt sich, ob einer wie Sie eineglückliche Kindheit hatte.“ – „Aber ja!Mein Bruder Hans hieß das Kinozerus. Er
ist immerzu ins Kino gerannt und hatmich, den Kleinsten, mitgenommen. Ichdurfte alle Filme mit Caterina Valente, Peter Alexander, Conny und Peter erle-ben. Später dann Zorro und Brigitte Bardot.“
Sieht nett aus – wie Teufel plötzlich Lusthat zu erzählen: „Ich habe den Alfredschon sehr kritisch gesehen. Es gab da soeine Äußerung von ihm über die DritteWelt: ,Je mehr von dene Gelbe undSchwarze verrecke, desto besser isch dochfür uns.‘ Über den Spruch habe ich schonlange gegrübelt. Oder: ,Wenn’s doch deneFidel Caschtro endlich fidel kaschtrieredädet.‘ War eben auch schon ein Sprüche-klopfer, der Alfred.“
Wie wird man ein Linker? Muß das eineReaktion auf die Eltern sein? Liegt das inden Genen? „Wir sind zu den Nazi-Pro-zessen nach Stuttgart gefahren, und dasFürchterliche war diese Verwechselbarkeitvon Angeklagten und Richtern. Für michwaren das auf beiden Seiten: Spießer. Dieeinen hatten furchtbar Menschen gequältund massenhaft umgebracht, die anderendabei zugesehen. Ja, wieso? Wieso beein-druckt einen das?“ Der Teufel wippt – mitihm der Wohnzimmersessel: „Es ist nichtunser Verdienst, daß wir nicht im KZ ge-landet sind. Es hätte leicht passieren kön-nen, in einer anderen Zeit.“
Um was ging es ihm also – dem Stu-denten, Clown, Theatermacher? Teufelverschwindet im Dunkeln. Reglos. Sprach-los. Dann erst kann es weitergehen: „MeinGenre waren die witzigen Beiträge. Ironie,die zu oft nicht verstanden wurde. DieSchweigen auslöste. Widerspruch. Em-pörung.“ – „Aber all die Aktionen, diekönnen doch nur die Form gewesen sein:Was war der Inhalt?“ – „Ach, man hatvon einem Tag in den anderen gelebt. Esging darum, sich keine Vorschriften ma-chen zu lassen. Sich nicht dumm kommenzu lassen von Polizei und Justiz.“ – „Esging Ihnen …“ – „Um nichts. Sie haben’serfaßt, junger Mann.“
Am 16. Februar ’70 erklärt Fritz Teufeldem verdutzten Reporter eines Fern-sehmagazins: „Der Clown Teufel ist tot.Jetzt muß es krachen, diese Gesellschaftmuß zerbrechen.“ Es sieht ernst aus: Teu-fel hat den Journalisten an einen konspi-rativen Ort bestellt. Er trägt eine Sonnen-brille. Sein Bart ist abrasiert.Von Anarchi-sten gelegte Bomben explodieren – dieRAF ruft zum bewaffneten Kampf auf. Miteinigen Unterbrechungen hat Teufel zudiesem Zeitpunkt mehr als drei Jahre imGefängnis gesessen.
Im Sommer ’72 wird Teufel aus der Haft-anstalt Landsberg entlassen, da hat er zweiJahre Isolationshaft wegen angeblichemZündeln in einem Münchner Amtsgerichthinter sich. Für das Einwohnermeldeamt ister fortan „unbekannt verzogen“, für Poli-zei und Verfassungsschutz „in den Unter-grund abgetaucht“. Am 10. November ’74
79d e r s p i e g e l 2 4 / 1 9 9 7

d e r s p i e g e l 2 4 / 1 9 9 7
richtet die „Bewegung 2. Juni“ BerlinsKammergerichtspräsidenten Günter vonDrenkmann hin, ein Unfall, seine Ent-führung hatte nicht geklappt. Am 27. Fe-bruar ’75 verschwindet der Berliner CDU-Vorsitzende Peter Lorenz für fünf Tage ineinem „Volksgefängnis“ – fünf Inhaftiertewerden freigepreßt: „An einem schönenDonnerstag, es hatte gerad’ getaut, da wur-de Peter Lorenz aus Zehlendorf geklaut.“
Dieser Spottvers wird Fritz Teufel zu-geschrieben. Bei Banküberfällen hinter-läßt der „2. Juni“ Angestell-ten und Kunden Kartons mitNegerküssen: „Es ist nichteuer Geld. Laßt es euchschmecken!“ Für die Kripoglasklare Hinweise: „Da hatder Leibhaftige Regie ge-führt.“
Teufel wird als fünfter voninsgesamt sechs Tatverdäch-tigten verhaftet – nach Ro-nald Fritzsch, Gerald Klöp-per, Till Meyer, Ralf Reindersund Andreas Vogel. Gegen ihn sprechen:Mitgliedschaft in einer terroristischen Ver-einigung, Körperverletzung, Mord, erpres-serischer Menschenraub, unerlaubter Waf-fenbesitz.Aber Teufel ist in fast allen Punk-ten unschuldig. Fünf Jahre Untersu-chungshaft vom September ’75, dem Tagseiner Verhaftung, bis zum Mai ’80, derWende im Lorenz-Drenkmann-Prozeß,hätten als größter Triumph Teufels in dieGeschichte eingehen sollen. Aber es sollteanders kommen.
Teufel war kein Waffennarr. Sagt er heu-te: „Ich habe mich damals gefühlt, als hät-
Am 27. Mai ’80, dem 178. Prozeßtag,nimmt der Teufel seine Verteidigung selbstin die Hand: „Hören Sie mich? Okay. Ichhabe ein Alibi.“
Vom April ’74 bis Mai ’75 habe Teufel imRuhrpott Klodeckel hergestellt: Als einfa-cher Arbeiter unter falschem Namen – sei-ne Identität habe er sich von einem Kum-pel ausgeborgt. Zur Schicht sei er jedenMorgen mit dem Mofa gefahren, sein Mo-natsgehalt habe tausend Mark betragen.Im Betrieb habe Teufel „als Revolutionärversagt“. Es sei ihm „nicht gelungen, einenherzlichen Kontakt zu seinen Kollegen her-zustellen“. Von der Lorenz-Entführunghabe er in seiner Hinterhofwohnung ausdem Radio erfahren: „So führte ich, wiegeschildert, ein viel alltäglicheres Lebenals die mir unbekannten Entführer, dereneinfacher Fan ich bin.“
Den angeblichen Gewaltverbrecher er-kennen Fabrikarbeiter der „PresswerkAG“ aus Essen-Frintrop als ihren ehema-ligen Arbeitskollegen; die Staatsanwalt-schaft steht dem Angeklagten erst mitSkepsis gegenüber, dann mit Hochachtung,Mitleid, Ratlosigkeit, in dieser Reihenfolge,und der Angeklagte muß sich abermals ver-teidigen – diesmal gegen den Vorwurf, mitseinem Sinn für Gerechtigkeit gegen sichselber vorgegangen zu sein: „Mein Schwei-gen hat mich Kraft und Ausdauer gekostet.Es ging mir darum, überzeugend die Me-thoden des Staatsschutzes und der Justizbloßzustellen.“
Außerdem will Teufel, der Prozeßprofi,einfach keine Zeit mehr hinter Gittern ver-plempern: Fünf Jahre saß er unschuldig.Eine Staatsanwaltschaft, die jetzt noch eine
te ich ein Holzbein. Einmal bin ich von ei-nem Betrunkenen angerempelt worden.Der ist mir voll gegen die Hüfte – da hingdas Ding. Das muß dem furchtbar weh ge-tan haben, er wollte auf mich los, da hatihn seine Alte festgehalten. Die Waffe isteine ständige Gefahrenquelle. Bumms,steckst du in einer Schießerei drin undweißt nicht, warum und wieso.“
Teufel war kein Bankräuber: „Ein wich-tiger Job ist der Türsteher, der Schmieresteht, die Leute in Schach hält, die rein-
kommen. Ein furchtbarer Job.Man hält ein Schießeisen inder Hand. Was soll man ma-chen, wenn einer ausrastet?Ich weiß es nicht.“
Teufel war nicht für denUntergrund gemacht: „Sieverfolgen mal diese Spur, maljene. Du hast hier eine Woh-nung, mal da eine, die du auf-lösen mußt: Die ganze ZeitKoffer rumschleppen. DieAngst, in Paranoia zu verfal-
len. Mir war das zuviel.“ Und Teufel hatdie Gefängniszelle, logisch, gehaßt: „Manmuß nicht in den Knast, um seinen Friedenzu finden, das geht auch anderswo. DasSchlüsselklappern. Das Radioprogramm.Von morgens sechs bis abends werden ei-nem irgendwelche Hans Rosenthals in dieZelle gejagt, man konnte ’s nicht abstellen.So wird man zum Frühaufsteher. Was sichdie Gefangenen gegenseitig angetan ha-ben, war am schlimmsten, diese ständigeAufforderung zum Hungerstreik. HolgerMeins, der sich zu Tode gehungert hat: einfürchterliches Bild.“
80
„Bumms,steckst du in
einer Schießereidrin und
weißt nicht,warum und
wieso“
K.
GR
EIS
ER
Studentinnen-Happening im Hamburger Amtsgericht (1968): „Es ging darum, sich nicht dumm kommen zu lassen von Polizei und Justiz“

Deutschland
d e r s p i e g e l 2 4 / 1 9 9 7
Klage wegen angeblicher Beteiligung anBanküberfällen durchziehen wolle, führeeinen „politischen Prozeß“ – so meldetsich drohend die Presse. Teufel hat dieRichter huckepack genommen.
Teufel präsentiert der entnervten Staats-anwaltschaft sein „B-Libi“: ein Alibi min-derer Qualität, das der Angeklagte nichtbeweisen und das Gericht nicht widerlegenkann. „In der fraglichen Zeit war ichrauschgiftsüchtig und in Köln. Deshalb dieBitte an meine Todfeinde vom BKA und andie Bundesanwaltschaft, an Axel Springerund Eduard Zimmermann: Laßt Eure Ap-parate spielen! Helft mir, unverdächtigeZeugen zu finden, die bestätigen können:Des Teufels B-Libi ist sein Alibi!“
Am 30. Oktober 1980 wird Teufel rechts-kräftig zu fünf Jahren Haft wegen illegalenWaffenbesitzes und Mitgliedschaft in einerkriminellen Vereinigung verurteilt – undkommt am selben Tag frei: Mit der Unter-suchungshaft ist die Haftstrafe abgegolten.
Man könnte noch erzählen, daß Teufeleinen Bundesfinanzminister mit Zauber-tinte bespritzt hat und einer Lebensmittel-abteilung Honig und Marmelade im Wertvon 30,33 Mark gestohlen hat, daß er in be-setzten Häusern lebte und von der Sozial-hilfe und – daß er es vor gut zehn Jahrenals Fahrradkurier versuchte. Das blieb er.Der Teufel von ’97, politischer Frührentner,verdient kaum Geld, aber immerhin fährter durch den Schmutz der Straße. Sogeht’s. So kann man überleben.
Unendlich lang ist das her: Da hat einTeufel noch riesige Staubwolken inDeutschland hinterlassen. Dieser Teufelhatte phantastische Vorstellungen von der
Gefängnis saß. Ein Revolutionär bringtMenschen um. Und bringt es fertig, Men-schen zu finden, die ihm glauben. Aufgeht’s. Wir tun das für eine bessere Welt.
Man fragt sich, hat man das Leben desTeufels einigermaßen kapiert: Was will erdenn? Wo wollte er hin, der Teufel?
Der Teufel, der im Wohnzimmersesselsitzt, will jetzt Fahrrad fahren. Sofort. Soschnell ein Schrotthaufen, den man Draht-esel nennt, einen Teufel tragen kann. DerWedding liegt unter zauberhafter Nach-mittagssonne, die Wege führen durch Be-ton und Morast, durch eine Parklandschaftmit Kiefern und Mülleimern – da fährt derFahrradkurier Fritz Teufel seiner legen-dären Vergangenheit davon. Zwischendrinkann man Teufel Fragen zurufen – es gehtum Schuld, die man nicht absitzen kann.
„Ich habe mich ans Steuer von Kraft-fahrzeugen gesetzt, das war sehr fahrläs-sig. Ich bin mit einem Schießeisen rumge-laufen, das ist keine gute Sache, erst rechtnicht, Leute damit zu bedrohen.“ – „Klingtnicht so schlimm.“ – „Na ja. Es gibt eineReihe Leute, die möglicherweise nie beider RAF gelandet wären, wenn sie nicht zumeinem Bekanntenkreis gehört hätten.Die Irmgard Möller, die hat der Teufel aufden Trip gebracht.“ – „Sind Sie schuldig?“– „Weiß nicht! Meinen Sie?“ – „Also nichtschuldig?“ – „Im Zweifel für den Ange-klagten.“ Tritt in die Pedale. Und weg ist er.
Im nächsten HeftWie die Revolte von ’68 die politische Klas-se der Bundesrepublik bis heute prägt,treibt und lähmt
Revolution. Er hat seine Rechnung mit Re-voluzzern gemacht, die den Ernst einerAufgabe nur mit Spaß bei der Aktion er-tragen können. Das konnte niemand bes-ser als er.
Zwischen dem Traum von der Revolu-tion und dem Alptraum der Guerrilla liegtein schmaler Pfad: Rechts davon stehenGefängniszellen, links liegen die Gräber.
Teufel ist, Entschuldigung, kein Revolu-tionär: Ein Revolutionär redet nicht von„Spaßguerrilla“, nachdem er jahrelang im
81
Teufel als Fahrradkurier (1992)Schuld, die man nicht absitzen kann
U.
MAH
LER
/ O
STK
REU
Z
ULLS
TEIN
Teufel als Häftling, Teufel als guter Deutscher (1967): „Hören Sie mich? Okay. Ich habe ein Alibi“

d e r s p i e g e l 2 3 / 1 9 9 7
Ob sie das elegante Cape und dieOhrringe an diesem Tag getragenhat, weil sie aussehen wollte wie
eine Opernbesucherin oder weil sie damalsimmer so angezogen war, weiß FriederikeHausmann nicht mehr.
Ob er bei diesem Einsatz vor der Deut-schen Oper in Berlin eine Walther P 38
Daß ihre Hände voller Blut waren, nach-dem sie den Kopf des ohnmächtigen Stu-denten auf ihre Handtasche gebettet hatte,hat Friederike Hausmann nicht vergessen,schon deshalb nicht, weil sie ihre rotenHände immer wieder gesehen hat in ihrenTräumen. Irgendwo abgewischt hat sie ihreHände an diesem Abend, und dann hat sie
oder eine PPK 7,65 mm umgeschnallt hat-te, weiß Hartmut Moldenhauer nicht mehr.
Wann genau am Abend er vor der Opereintraf, weiß Siegward Lönnendonker nichtmehr.Aber daß zu diesem Zeitpunkt schondie Nachricht die Runde machte, ein Poli-zist sei getötet worden, das weiß Lönnen-donker genau.
108
D I E A C H T U N D S E C H Z I G E R
Vollstrecker des WeltgewissensErst der Tod des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 machte aus einer lustigen Revolte
den Aufstand der 68er, der Deutschland veränderte. Die Erfolge und Mißerfolge dieser Kulturrevolution beleben und lähmen die Republik bis heute. Von Cordt Schnibben
Rebellen-Sprecher Dutschke, Demonstranten in Berlin (1967), Studentin Hausmann mit Polizeiopfer Ohnesorg (unten): „Sitz gerade, geh zum
Gesellschaft

griff schon in der Unglücksnacht, daß da et-was Neues in Bewegung kam, weil im Re-publikanischen Club und im SDS-Zentrumdie verstörten Demonstranten zusammen-strömten und plötzlich nach Waffen ver-langten und die Kommilitonin Gudrun Ensslin vorschlug, eine Polizeikaserne zuüberfallen.
Mit jedem Jahr, das seither verging, wur-de klarer, was an diesem 2. Juni 1967 pas-siert war, und jetzt, 30 Jahre danach, blickendie Übersetzerin Hausmann, der Wissen-schaftler Lönnendonker und der LeitendePolizeidirektor Moldenhauer auf einen Tagzurück, der so etwas ist wie die Klima-scheide zwischen zwei Gesellschaften.
Bis dahin war die BundesrepublikDeutschland eine Art wilhelminischer Ob-rigkeitsstaat, in dem sich der Untertanschon dann rechtswidrig verhielt, wenn ersich öffentlich über einen Polizisten empör-te, der sich rechtswidrig verhielt; ein Land,in dem das Gitarrespielen an einem Brun-nen ausreichte, um einen Polizeiaufmarschauszulösen, und in dem junge Polizistenwie Moldenhauer gedrillt wurden, als soll-ten sie in den Bürgerkrieg ziehen.
Studenten wie Lönnendonker machtensich Anfang der sechziger Jahre schon dadurch verdächtig, daß sie Marx lasen,etwas, von dem der normale Student annahm, daß es sowieso verboten sei.Zwei Drittel der Studenten bezeichnetensich als apolitisch; die Hochschullehrerherrschten in ihren Talaren wie Fürstenüber die Fakultäten, und wenn Studentendoch mal aufmuckten, konnte einem ehr-würdigen Professor schon mal heraus-
weiter „Räuber und Gendarm“ gespielt,wie sie heute sagt, ist mit anderen Studen-ten durch die Straßen rund um denKu’damm gezogen, auf der Suche nach Po-lizisten, vor denen man weglaufen konnte.
Erst gegen Mitternacht war sie dann wie-der zu Hause, in der Wohnung, in der siezusammen mit fünf Studenten lebte, undda muß sie dann wohl noch den weißenSeidendamast aus dem Schrank geholt ha-ben, den sie sich aus Ägypten mitgebrachthatte, und sie veranstaltete eine kleine Mo-denschau, guckt mal, was das für ein tollesKleid wird.
Erst am nächsten Morgen dämmerte ihr,was für einen Abend sie erlebt hatte: daßdieser Junge im roten Hemd gestorben war,daß sie den ersten Toten der Studentenbe-wegung in den Händen gehalten hatte, daßan dem SDS-Gerede von den „Faschisten“,die überall Jagd machten auf die Studen-ten, wohl doch was dran sein mußte unddaß man sich nun wehren müsse gegen„ein neues ’33“ und daß es nun wohl vor-bei sei mit dem großen Studentenspaß, derin den Morgenzeitungen nur noch „roterTerror“ genannt wurde.
Für den jungen Polizisten Moldenhauer,der den ganzen Abend mit seiner Einheitals letzte Sicherung vor dem Haupteingangder Oper darüber gewacht hatte, daß Bun-despräsident Heinrich Lübke und dessenFrau Wilhelmine und dem persischenSchah und dessen Frau Farah Diba nichtspassiert, war die Nachricht vom Tod einesStudenten namens Benno Ohnesorg wieein Einsatzbefehl. Das würde Ärger geben,das war ihm sofort klar, und als der Bür-germeister dann auch noch für die näch-sten Tage ein generelles Demonstrations-verbot verhängte, war er auf das Schlimm-ste gefaßt. Der Haß allerdings, der ihmfortan entgegenschlug, übertraf seine Be-fürchtungen.
Lönnendonker, Student der Chemie undder Soziologie und der Mathematik, be-
109
Friseur, mach die Negermusik leiser“
M.
RU
ETZ
ULLS
TEIN
Kommunarden Obermaier, Langhans„Sie gehören alle ins Konzentrationslager“
BO
KELBER
G /
STER
N

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 3 / 1 9 9 7
rutschen: „Sie gehören alle ins Konzen-trationslager.“
Politische Betätigung an den Hochschu-len war nicht üblich, es sei denn, es wurdedes 17. Juni gedacht; Diskussionsforen ge-gen die Südostasienpolitik der USA wur-den verboten; und gegen den Vietnamkriegdemonstrierende Studenten mußten sichvon Willy Brandt davor warnen lassen,„daß wir Deutsche uns in der Weltpolitikals Lehrmeister aufspielen“. Für die Bou-levardpresse waren Demonstranten sowie-so „Rowdys“ und „Krawallmacher“, für diefaz galten die Straßenumzüge Gleichge-sinnter als „das dümmste und vergeblichsteMittel politischer Betätigung“.
Jede Menge Gebote und Verbote hattedie deutsche Sofakissendiktatur ihren jun-gen Bürgern zu bieten – sitz gerade, gehzum Friseur, mach die Negermusik leiser,geh zur Tanzstunde, wasch den Wagen, undwenn Friederike Hausmann zusammen mitihrem Freund in ein Hotelzimmer wollte,wies man ihr die Tür, und wenn sie im Hausihrer Eltern übernachteten, hätten dieNachbarn Anzeige erstatten können wegenKuppelei.
Um Distanz zu bekommen zu diesemLeben, das nicht ihr Leben war, sonderndas Leben ihrer Eltern, zogen in den sech-ziger Jahren immer mehr Westdeutsche indie großen verlassenen Wohnungen West-Berlins und begannen, ein neues Zusam-menleben auszuprobieren. Sie saßen inKlubs herum, sie lasen Sartre und Camus,sie verschlangen Marcuse, Marx und Freud,sie hörten Dylan und die Doors, sie tran-ken Rotwein und Cola-Rum, sie schlucktenCaptagon und Rosimon Neu, sie empörten
daß dieser Dutschke als gefährlicher Auf-hetzer galt, war genauso klar. Im einzelnenmochten die Studenten recht haben, imganzen schienen sie ihm größenwahnsinnig.
Das Zentrum der Bewegung, die Führungdes Berliner SDS, tagte gelegentlich in Lön-nendonkers Zimmer, wenn dieser spät-abends in seine Wohngemeinschaft kam.Den Schah aus Persien wollten die SDSlereigentlich ungeschoren davonkommen las-sen, weil man gerade damit beschäftigt war,den US-Imperialismus und seine Verbre-chen in Vietnam zu bekämpfen.
Aber die Journalistin Ulrike Meinhofhatte in einem offenen Brief an die Kaiser-gattin Farah Diba Hunger, Folter, Mord undRauschgiftsucht in Persien angeprangert;auch die persischen Exilstudenten hattenStimmung gemacht gegen den verschwen-dungssüchtigen Diktator; Rainer Langhans,Fritz Teufel und andere Kommunarden mo-bilisierten, und deshalb rief schließlich auchder SDS zu jener Demonstration, auf derdas alte wilhelminische Deutschland unddas neue moderne Deutschland aufeinan-derkrachten.
Was sich jahrelang an Spannungen auf-gebaut hatte im Wirtschaftswunder-deutschland, entlud sich an diesem heißenJuniabend gewaltsam. Auf alles, was dieJugendlichen haßten an der Welt, konntensie vor der Oper Parolen und Farbeierschleudern – auf den Pomp lächerlicherAutoritäten, auf die Gewalt der Staatsdie-ner, auf die Armut in der Dritten Welt, aufdie dunkle Vergangenheit der deutschenElite. Und auf alles, was die Staatsdienerhaßten an diesen respektlosen Untertanen,konnten sie ihre Gummiknüppel nieder-sausen lassen – auf ihre dämlichen Sprech-chöre, auf ihre ungewaschenen Haare, aufihr Geschwätz, auf ihre überheblichenBlicke, auf ihre Schlaumeier-Fressen.
„Heute gibt’s Dresche“, hatten Polizi-sten schon versprochen, als der Schah nochgar nicht zu sehen war, und einem Festge-nommenen hatten die Polizisten zugeru-fen: „Wenn du noch ein Wort sagst, schlag’ich dich tot, du Schwein.“ Vorm Betretender Oper hatte Berlins empörter Bürger-meister Heinrich Albertz seinem Polizei-präsidenten zugezischt: „Wenn ich her-auskomme, ist alles sauber“, und so stürm-ten seine Männer, kaum erklangen die
sich über das schlechte Mensaessen undBomben auf Hanoi, sie stürzten den Asta-Vorsitzenden Eberhard Diepgen, der Stu-denten in einer „freiwilligen Polizeireser-ve für Krisenzeiten“ organisieren wollte,sie sprengten Vorlesungen in Polizeiuni-formen und gingen dafür ins Gefängnis, siebejubelten The Who und den GitarristenPete Townshend, weil für ihn der Konfliktzwischen den Generationen „der Beginneiner großen gesellschaftlichen Revolu-tion“ war, sie hatten ihren Spaß und brach-ten alle Autoritäten zum Tanzen.
Wenn Friederike Hausmann, erschöpftvom Studium der Altphilologie und vomRebellenleben, um vier Uhr morgens mitdem Nachtbus nach Hause fuhr, blickte sievoller Verachtung und Mitleid auf die Men-schen, die zur Arbeit fuhren. So zu leben,als „Spießer“, als „Konsumtrottel“, als„Deutscher“, schien ihr unmöglich; sie leb-te in dem Gefühl, ehrlicher zu leben, sinn-voller und moralischer, und zu denen zugehören, die zur richtigen Zeit am richtigenOrt das Richtige tun, wie ein Surfer, der aufeiner gewaltigen Welle vor Glück brüllenddem Strand entgegenfliegt.
Auch der Polizist Moldenhauer spürte dieKraft dieser Bewegung, die ihn ratlos mach-te und kraftlos und so neugierig, daß er nachDienstschluß in Teach-ins in der Techni-schen Universität schlich. Daß das Hoch-schulgesetz reformiert werden mußte,leuchtete ihm schließlich ein, daß der Viet-namkrieg beendet werden sollte, auch, aber
* Wilhelmine Lübke, Rut Brandt, Schah MohammedResa Pahlewi,Willy Brandt, Kaiserin Farah und Bundes-präsident Heinrich Lübke.
110
Staatsempfang im Schloß Augustusburg (1967)*: Der alte Obrigkeitsstaat
DPA
Frühere Apo-Aktivistin Hausmann (1997)Ausweg aus der trampelnden Menge
U.
MAH
LER
/ O
STK
REU
Z

d e r s p i e g e l 2 3 / 1 9 9 7
ersten Takte von Mozarts „Zauberflöte“,auf die „Störer“ los.
An die große Panik kann sich Friederi-ke Hausmann erinnern, an das verzweifel-te Suchen nach einem Ausweg aus derschreienden, blutenden, trampelnden Men-schenmenge, und diesen fand sie durcheine Gasse von prügelnden Polizisten ineinem Hinterhof.
Dort standen sich dann plötzlich imDämmerlicht gegenüber der Student Ben-no Ohnesorg und der Kripobeamte Karl-Heinz Kurras, zufällig, und doch so logisch,als hätte sie jemand dorthin befohlen. Dereine, der Germanistik und Romanistik stu-dierte, wollte sich zum erstenmal selbst einBild machen von dem Treiben der rebel-lierenden Studenten; der andere, der als zi-viler Greifer „Rädelsführer“ festnehmensollte, fürchtete, „daß die Demokratie beidieser weichen Welle zugrunde gehen“könne. Beim Aufeinandertreffen des einenDeutschen mit dem so ganz anderen Deut-schen löste sich auf seltsame Weise einSchuß (siehe Seite 114).
Der Tod des Studenten, über den seineProfessoren sagten, er sei ein zurückhal-
müsse man alles politisch sehen und natür-lich alles befreien. „Es lebe die Weltrevo-lution und die daraus entstehende freieGesellschaft freier Individuen“, formulier-te Rudi Dutschke das Programm dieser Re-volte, die kein Programm hatte.
„Es handelt sich nicht umeinzelne Verrückte“, hieß esin einem Analysepapier einesBerliner Senatsdirektors, „essind die fleißigsten und tüch-tigsten Studenten, es ist die allgemeine Grundstimmungunter jungen Leuten. Wennnicht auf breiter Front dasNötige und Geeignete ge-schieht, wird Berlin sehr
schnell eine existentielle Krise erle-ben können.“
Man sei durch das Verhalten der Staats-macht mehr oder minder gezwungen wor-den, revolutionär zu werden, so beschreibtFriederike Hausmann die Entwicklung derzunächst vorpolitischen Bewegung zumpolitischen Aufstand.
Während einer der vielen Vollver-sammlungen in der FU stand ein Student
tender, höflicher, neugieriger und gewis-senhafter Student gewesen, machte aus einer antiautoritären Revolte in West-Berlin die Protestbewegung der 68er, diedas Land umkrempelte und bis heuteprägt. Für die Zehntausende, die sich invielen Städten zu Trauermär-schen zusammenfanden, wardieser Tote der Beweis dafür,daß die westdeutsche „De-mokratie“ nur auf dem Papierdes Grundgesetzes existierteund daß „die Verwirklichungdemokratischer Freiheit in allen gesellschaftlichen Be-reichen“ erkämpft werdenmüsse.
65 Prozent der Studenten gaben späteran, in den Wochen nach dem Tod seien siepolitisch geworden. „Ich bin politisiert wor-den“, sagten sich die Leute damals, und daswar eine Art Eintrittserklärung in eine da-mals weltumspannende Sekte, deren Be-kenntnis war: Alles ist politisch, die Ge-sellschaft sowieso, die Polizei, die Hoch-schule, das Theater, die Literatur, die Mu-sik, die Familie, der Orgasmus, und darum
111
Kommune-Happening 1967 in Berlin mit Baader (l.): Alles ist politisch, die Musik, die Familie, der Orgasmus ULLSTEIN
Voller Verachtungund Mitleid
blickte sie auf dieMenschen, die
frühmorgens zurArbeit fuhren

d e r s p i e g e l 2 3 / 1 9 9 7
der Germanistik auf und hielt eine langeflammende Rede, die so etwas wie das Ma-nifest der 68er wurde und die mit den Wor-ten endete: „Wir haben ruhig und ordent-lich eine Universitätsreform gefordert, ob-wohl wir herausgefunden haben, daß wirgegen die Universitätsverfassung redenkönnen, soviel und solange wir wollen,ohne daß sich ein Aktendeckel hebt, aberdaß wir nur gegen die baupolizeilichenBestimmungen zu verstoßen brauchen, umden ganzen Universitätsaufbau ins Wan-ken zu bringen. Da sind wir auf den Ge-danken gekommen, daß wir erst den Rasen zerstören müssen, bevor wir die Lü-gen über Vietnam zerstören können, daßwir erst die Hausordnung brechen müs-sen, bevor wir die Universitätsordnungbrechen können. Da haben wir es endlichgefressen, daß wir gegen Prüfungen, in de-nen man nur das Fürchten, gegen Semi-nare, in denen man nur das Nachschlagenlernt – daß wir gegen den ganzen altenPlunder am sachlichsten argumentieren,wenn wir aufhören zu argumentieren unduns hier in den Hausflur auf den Fußbodensetzen.“
Der Name des Studenten: Peter Schnei-der, später bekannt geworden als Schrift-steller, Essayist und Kritiker der 68er.
Zehntausende Schüler, Lehrlinge undStudenten in Bremen, Mönchengladbachund sonstwo verfielen in den folgendenMonaten und Jahren dem Rausch, den„Kampf gegen das Establishment“ aufzu-nehmen, überall „Manipulation“ zu wit-tern und mit ätzender Kritik das Weltbildder Autoritäten lächerlich zu machen.
„Wir wußten alles“, sagt Lönnendon-ker, „wir konnten erklären, wie der Kapi-talismus funktioniert und warum er über-
Sie konnten gleichzeitig narzißtisch undsolidarisch sein, weil Arbeitslosigkeit, Dro-gentod und Aids noch weit weg waren undweil Atomstrahlen, Umweltgifte und dasOzonloch noch keinen ängstigten. Sie leb-ten in einer heilen Welt und in der Ge-wißheit, den Sex, die Schule, das Wohnen,die Musik und die Demokratie neu erfindenzu dürfen; und nur eine Macht konnte siedaran hindern, ihren Menschenversuch zumglücklichen Ende zu bringen: das Kapital.
Mit ihren Demonstrationen, Besetzun-gen, Love-ins und Go-ins setzten dieseTräumer des Absoluten der Gesellschaftso zu, daß der Berliner Justizsenator vor-schlug, verhaftete Demonstranten generellauf ihren Geisteszustand untersuchen zulassen. Vermieter in Berlin begannen, be-vorzugt an linke Wohngemeinschaften zuvermieten, damit die Wohnungen nach derRevolution nicht mehr beschlagnahmt zuwerden brauchten.
Bei Moldenhauer ließ der allgemeineUngehorsam die Haare über seinen Uni-formkragen wachsen und auf der Oberlip-pe einen Bart sprießen, sehr zum Mißfal-len seiner Vorgesetzten und Kollegen. Erwar in vorderster Reihe im Studentenkriegeingesetzt, er gehörte zur „Gruppe 47“,einem Diskussionskommando aus 47 Poli-zisten, das 1969 nach zwei Jahren vollerStraßenschlachten, Knüppelfesten undWasserwerferorgien gebildet worden war,um die Fronten aufzulockern.
Der Staat war nun hochgerüstet, dieStaatsdiener liefen voll verpanzert hinterden Störern her. Moldenhauer spürte beiseinen Diskussionseinsätzen, wie sich dieStudenten zu trennen begannen in solche,mit denen man reden konnte, und solche,die in ihm, egal was er sagte, den Hand-
flüssig war, wir hatten den Marxismus undFreuds Psychoanalyse, und wir hatten aufalles eine Antwort.“ Wie Vollstrecker desWeltgewissens fühlten sich die 68er, wiePartisanen einer neuen Weltordnung, dievon Frieden, Liebe und Gleichheit zusam-mengehalten wird. Wo sie hinblickten, obnach San Francisco, Havanna, Paris oderTokio, entdeckten sie Mitkämpfer, und woimmer sie hinkamen, konnten sie ihrenSchlafsack ausrollen und eine selbstge-drehte Zigarette schnorren.
112
Polizist Moldenhauer (1997)Mitglied im Diskussionskommando „47“
U.
MAH
LER
/ O
STK
REU
Z
M.
EH
LER
T /
DER
SPIE
GEL
Journalistin Meinhof (1962), Demonstrantin Meinhof (1970), Terroristin Meinhof (1972): Die Mao-Bibel auf dem Nachttisch, das Rezept für

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 3 / 1 9 9 7
langer eines Staatsapparates sahen, den eszu zerschlagen galt.
Daß die Bundesrepublik wirklich imBürgerkrieg versinken könnte, fürchtete ernie, aber daß bestimmte Gruppen derAußerparlamentarischen Opposition (Apo)bereits in dieser Wahnvorstellung lebten,merkte er schon. Spätestens als in Frank-furter Kaufhäusern Brandsätze hochgin-gen und einer der Täter, Andreas Baader,mit Ulrike Meinhofs Hilfe aus dem Ge-fängnis befreit wurde, war klar, daß diezweijährige Straßenparty zu Ende war. DieApo begann, sich selbst zu zerstören.
Die wenigsten griffen zur Kalaschnikow,viel mehr gingen in realistischer Einschät-zung der Schwäche studentischer Kampf-verbände auf die Suche nach dem revolu-tionären Proletariat. Die einen glaubten, esin der 1968 neu gegründeten DeutschenKommunistischen Partei (DKP) zu finden,die anderen gründeten die Kommunisti-sche Partei Deutschlands/Aufbauorganisa-tion (KPD/AO), wieder andere die Prole-tarische Linke/Parteiinitiative (PL/PI) oderden Kommunistischen Bund Westdeutsch-land (KBW); etwa hunderttausend 68ermachten sich auf den Marsch in die SPD.
392 sogenannte linksextremistische Or-ganisationen zählte das Innenministerium1971. Bis 1976 wurden fast ein halbe Milli-on Lehrer und andere Beamtenanwärterauf ihre Verfassungstreue überprüft – soversuchte der Staat den von Rudi Dutsch-ke angekündigten „Marsch durch die Insti-tutionen“ aufzuhalten. Friederike Haus-mann durfte nicht Lehrerin werden, weil sieMitglied in der „Liga gegen den Imperia-lismus“ war und das Nummernschild ihresAutos ein paarmal in der Nähe verbotenerDemonstrationen notiert worden war. Sie
nige SDSler um Bommi Baumann das dortgesammelte Geld in Bomben (und LSD).„Die Konfrontation mit der Staatsgewalt istzu suchen“, hatte Dutschke formuliert, unddie bewaffnete Fraktion der Apo suchtediese Konfrontation so lange, bis der Ob-rigkeitsstaat durch neue Gesetze und neueWaffen besser gerüstet war als vor der Re-volte.
Zwei Jahre lang hatte die Party gedauert,acht Jahre lang wurde aufgeräumt, spä-testens nach dem deutschen Herbst von1977 herrschte wieder Ruhe im Land. Diebrutalsten Rebellen waren tot, die größ-ten Dogmatiker waren zu Clowns ge-schrumpft, die Haschrebellen zogen voneinem Open-Air-Festival zum nächstenoder in die Entziehungskuren, und dasHeer der Ho-Ho-Ho-Tschi-minh-Sprintersaß nun in Lehrerzimmern und Kinder-gärten, auf Richterstühlen und in Anwalts-kanzleien, in Redaktionen, in Volkshoch-schulen und Universitäten.
Eine geschlossene Bewegung sind die68er nie gewesen, und deshalb mußten sieals politische Bewegung scheitern, gleichmehrfach. Das erstemal 1968, als der revo-lutionäre Sturz des Kapitalismus scheiter-te und in der Modernisierung desselbenendete. Das zweitemal in den Siebzigern,als der Zukunftsglaube der 68er im Lochder ökologischen Bedrohung verschwand.Das drittemal in den Achtzigern, als im he-donistischen Wirbel der Moden auch dem
letzten klar wurde, daß das, was als politi-scher Aufstand gegen „den Westen“ be-gonnen hatte, kulturell zu dessen Voll-strecker geworden war.
Die Verwestlichung des Alltagslebens inder Bundesrepublik ist der große (unge-wollte) Erfolg der 68er; der Sieg von Jeans,Mini-Rock und Beat über das dumpfeDeutschtum der frühen Sechziger, die Ver-mehrung des multikulturellen jungenDeutschen, der sein Lebensgefühl zusam-menbaut aus den Kulturen junger Englän-der, Franzosen und Amerikaner, weil ersich denen näher fühlte als seinen Eltern.
Erfolgreicher als alle Re-education-Ver-suche der Amerikaner sei die 68er-Bewe-gung gewesen, bilanzierte ein ehemaliger
zog 1977 als Übersetzerin nach Italien undkehrte erst 1984 nach München zurück.
Ihre Jahre in ihrer antiimperialistischenSekte sind ihr um so unheimlicher, je wei-ter sie zurückliegen. Der Realitätsverlust,die Ergebenheit und die Kritiklosigkeit ma-chen ihr angst; über das Leben, das sieführte – nach drei Stunden Schlaf um vierUhr aufstehen, um Flugblätter an schimp-fende Arbeiter zu verteilen –, kann sieheutzutage immerhin lächeln.
Warum eine mächtige, lustvolle Bewe-gung, die alle Autoritäten in Frage stellte,zerfiel in autoritätsgläubige, schlechtge-launte Kleingartenvereine, versteht sie so-wenig wie Lönnendonker. Er mußte, zumZwecke der Arbeiteragitation, ein halbesJahr in einem Stahlbetrieb arbeiten, zog esaber dann doch vor, aus der PL/PI auszu-scheiden, sich fortan und bis heute mit demSchicksal seiner Kampfgenossen zu be-schäftigen und an der FU das Archiv „Apound soziale Bewegungen“ aufzubauen.
Das Ende der Apo, so sieht es ihr gründ-lichster Erforscher, kam, als sie anfing, dieAntworten zu geben auf die Fragen, die sieaufgeworfen hatte. Wie können Kindergär-ten kindgemäßer sein, wie können die Schu-len lebensnäher, wie können die Hoch-schulen berufsorientierter und demokrati-scher werden – darauf Antworten zu gebenwar noch relativ einfach. Wie kann die De-mokratie weniger parteienbeherrscht sein,wie kann der Wohlstand gerechter verteilt,wie kann die Wirtschaft kri-senfester, wie kann die Ge-sellschaft durchlässiger wer-den – darauf fiel den Chef-ideologen der Apo nichts ein,nur immer: Sozialismus. Undwie der auszusehen habe undwie man ihn erreichen könn-te, darüber stritten sich diekommunistischen Gruppenso lange, bis von ihnen nichtsmehr übrig war und schließ-lich auch der Sozialismus vonder Erde verschwunden war.
Die simpelste Antwort aufalle Fragen und das radikalsteAusleben aller Gewaltphan-tasien der 68er muß man denFrauen und Männern bescheinigen, derenBilder schnell in mehr Amtsstuben hingenals das Bild des Bundespräsidenten. UlrikeMeinhof hatte gegen den Schah mobilisiert,Holger Meins saß im Ermittlungsausschußzur Aufklärung des Todes von Ohnesorgund drehte anschließend einen Lehrfilmüber die Herstellung von Molotow-Cock-tails,Andreas Baader saß am 2. Juni im Ge-fängnis wegen Motorraddiebstahls, und Gu-drun Ensslin sagte in jener Todesnacht imSDS-Zentrum: „Dies ist die Generation vonAuschwitz, mit denen kann man nicht ar-gumentieren.Wo kriegen wir Waffen her?“
Es dauerte noch einige Zeit, bis sie Waf-fen hatten, aber bereits nach dem Vietnam-Kongreß im Februar 1968 verwandelten ei-
113
Apo-Forscher Lönnendonker: „Wir wußten alles“
U.
MAH
LER
/ O
STK
REU
Z
(L.)
K.
MEH
NER
, (R
.) D
PA
den Molotow-Cocktail im Kopf

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 3 / 1 9 9 7114
Im Weinmeisterhornweg wirken die Jä-gerzäune spitzer, die Rasen strengergestutzt als anderswo in Berlin-Span-
dau. Vielleicht ist das so, wenn man inunmittelbarer Nähe zur Mauer gelebt hat.Hier im äußersten Zipfel der freien Welthat man zusammengehalten, und nochimmer wird ein Fremder nach dem Wohinund Woher gefragt.
Karl-Heinz Kurras ist längst pensio-niert, aber immer noch geht er jeden Mit-tag in Freizeitkleidung zum Dienst. Er istein braungebrannter, drahtiger Mann,knapp 70 Jahre alt, und er hält sich gut.Aber es fehlt etwas an seiner Erschei-nung. Erst in Uniform wirkt er komplett.
Er trug Zivil, einen graublauen Anzug,als er am 2. Juni 1967 den Schuß abgab, andem der Berliner Student Benno Ohne-sorg starb. Danach hat er zunächst seine„Waffe in Ordnung gebracht“, sagt erspäter vor Gericht, und seine „Kleidungein wenig geordnet“.
„Ohnesorg rannte davon“, erinnertsich der pensionierte Polizist Horst Gei-er, „verfolgt von zwei Schutzpolizisten,links und rechts, die ihn festnehmen woll-ten. Sie hatten ihn schon fast.“
Die Augenzeugin Erika S. beobachteteebenfalls den Fluchtversuch und „zweiuniformierte Beamte, mit Schlagstöcken
in den Händen“, die „versuchten, ihn dar-an zu hindern“. Doch „von hinten tauch-te plötzlich ein uniformierter Beamter aufaus dem Dunkel und schlug dem Mann imroten Hemd mit dem Schlagstock von hin-ten auf den Kopf. Der Getroffene sanklangsam in sich zusammen, und nun ka-men die beiden Polizisten hinzu, und zudritt schlugen sie auf ihn ein“. Irgend-wann „zwischen all diesen Geschehnis-sen“ hat sie „einen Knall gehört“, abernicht als Schuß interpretiert.
Auch Geier vernahm den Knall. Erstand „etwa einen halben Meter links hin-ter Kurras“, so erinnert er sich, sah denSchützen aufrecht dastehen, mit der Waf-fe in der Hand, und schrie: „Bist du wahn-sinnig, hier zu schießen?“ „Die ist mirlosgegangen“, hörte er Kurras stammeln.Er selbst habe „Angst gehabt“, sagt Gei-er heute, „daß der einen Polizeibeamtentrifft. Wenn er sich ein bißchen gedrehthätte, hätte er mich erwischt“.
In jenem Hinterhof, sagt Kurras im No-vember 1967 vor der 14. Großen Straf-kammer des Berliner Landgerichts, sei er„von zehn oder elf Personen brutal nie-dergeschlagen worden“, er wurde von„zwei jungen Männern mit Messern“ be-droht. Also zog er „im Liegen meineDienstpistole hervor“ und gab „mit derlinken Hand den ersten Warnschuß in dieLuft ab“. Allerdings sei der Kampf umseine Pistole dann noch heftiger ent-brannt. Er habe noch einen Warnschußabgeben wollen, doch „durch das Zerrenund Ziehen löste sich der verhängnis-volle zweite Schuß“. Er beruft sich aufNotwehr.
Seltsam: kein einziger Zeuge hat dieMänner mit den Messern gesehen. Nie-mand hat den Warnschuß registriert, nie-mand kann bestätigen, daß sich Kurrasin Bedrängnis befand, als er den hörbarenSchuß abgab – nicht einmal Geier, der innächster Nähe stand. Kurras will in die-sem Moment massiv bedroht und verletztworden sein, der Polizeiarzt findet auchPrellungen im Schulter- und Nackenbe-reich („wie von Handkantenschlägenoder Stockschlägen“) – aber als er dieWaffe benutzte, versichert eine Vielzahlvon Zeugen, hatte die Polizei die Lageim Hinterhof längst im Griff.
Kurras, merkte der psychiatrische Gut-achter an, habe sich in höchster Erregung,
in einem „vorübergehenden psychoge-nen Ausnahmezustand“ befunden – viel-leicht habe er Messer gesehen, wo es kei-ne gab, und sich dementsprechend be-droht gefühlt.Als „Putativ-Notwehr“ be-zeichnet der Verteidiger den tödlichenSchuß.
Daß Kurras „in seiner Kritik- und Ur-teilsfähigkeit erheblich eingeschränkt“war, glaubt auch der Vorsitzende Rich-ter. Letztlich sei „nicht mit Sicherheit zuklären, was der Angeklagte falsch ge-macht habe und daß er dies anders hättemachen können“, entscheidet das Gerichtund spricht Kurras frei. „Wenn eine Pi-stole der Polizei losgeht“, war daraufhinin der welt zu lesen, „dann schießt derStaat und nicht der Polizeibeamte.“
Schoß er in Panik? In Wut? Was hat ergesehen in jenem Moment, als er abge-drückt hat?
Der Beschuldigte sei ein ausgegliche-ner Mensch, befand der Gutachter, leichtlabil, aber nicht sonderlich aggressiv. Kur-ras stammt aus Ostpreußen, der Vater warDorfgendarm. 1944 meldete er sich frei-willig in den Krieg, kehrte verwundetzurück, erlebte das Kriegsende als Soldatin Berlin. Danach, ein einziges Mal wohl,protestierte er gegen die vorgegebeneOrdnung: 1946 verteilt er politischeSchriften in Ost-Berlin. Drei Jahre saß erwegen „antisowjetischer Propaganda“ imstalinistischen Internierungslager Sach-senhausen. Die Lust am Widerstand hat-te er verloren.
Er brauchte sie auch nicht mehr: DieOrdnung, die er nach 1949 in West-Berlinvorfand, war ganz und gar seine. Er gingzur Schutz-, später zur Kriminalpolizei,wo er als guter Schütze galt.
Mord ohne MörderWarum der Mann, der den Studenten Benno Ohnesorg
erschoß, nie verurteilt wurde
Schütze Kurras nach dem Freispruch (l.)„In seiner Urteilsfähigkeit eingeschränkt“
FO
TO
S:
ULLS
TEIN
Ohnesorg (r.) kurz vor und nach dem tödlichen

d e r s p i e g e l 2 3 / 1 9 9 7
setzen. Die Punks der Siebziger hattennoch brav ihre Rebellenrolle erfüllt, diealle Welt seit den Sechzigern von Heran-wachsenden erwartete. Die Aufsässigen derAchtziger fanden es rebellischer, nicht re-bellisch zu sein. Rebellisch war nur, wer dierichtigen Platten hörte und die richtigenSchuhe trug und das richtige Leben imfalschen genoß. Der 68er wurde vom Guer-rillero zum Trottel, zum Moralisten imselbstgestrickten Pullover, zum Mahner mitBee-Gees-Frisur, zum ewig jungen Spaß-verderber.
Nachdem die Nach-68er fertig waren mitden 68ern, fielen die Vor-68er über die 68er
her, pünktlich zum 25jährigenJubiläum der Revolte. Die„antiautoritäre Erziehung“der 68er sei verantwortlichdafür, daß sich rechte „Mord-brenner als Avantgarde“ (Hel-mut Schmidt) fühlen können;die „Maßstäbe“ hätten sich„im ätzenden Säurebad derKritik aufgelöst“, die „morali-sche Eigenbrötelei der 68er-Rebellen“ habe „die Gemein-schaft auf dem Altar der Ge-
sellschaft geopfert“ (Theo Sommer); dieseGeneration habe „das Fehlen einer mora-lischen Substanz in der deutschen Gesell-schaft“ zu verantworten, habe „das Ge-fühl für Solidarität“ geschwächt und den„moralischen Grundkonsens, auf dem dieEntwicklung der Nachkriegszeit in derBundesrepublik beruhte, in Frage gestellt“(Kurt Sontheimer).
Als wäre Rudi Dutschke Bundeskanzlergewesen und er selber SDS-Führer, somacht Helmut Schmidt die „Entwicklungan unseren Schulen und Hochschulen“ fürdas gegenwärtige „rücksichtslose Speku-lantentum in Unternehmen“ verantwort-
SDS-Sprecher, und Richard von Weiz-säcker attestierte der „Jugendrevolte“, eine„Vertiefung des demokratischen Engage-ments in der Gesellschaft“ bewirkt zu ha-ben. Der radikal vertretene Anspruch,mehr sein zu wollen als Stimmzettelan-kreuzer, und die mittlerweile utopisch an-mutende Erfahrung, etwas bewegen zukönnen, obwohl es immer so ausgesehenhat, als würde sich nie etwas bewegen, ha-ben die Bürgerinitiative der Apo zum Vor-bild für Hunderte und Tausende großerund kleiner Bürgerinitiativen gegen Tier-versuche, Atomkraftwerke und Hundekotwerden lassen.
Die Kulturrevolution der68er ist eine Kette erfolgrei-cher Niederlagen: Durch denAufstand gegen die Erwachse-nenwelt und die Falten-rockordnung verhalfen die,die den Konsumterror mitWort und Flamme bekämpf-ten, der Jugendindustrie undihrem Rauch-, Sauf-, Mode-und Musikfetischismus zumDurchbruch. Es wird die Re-bellen, die den Kapitalismusstürzen wollten, nicht glücklich machen,daß man ihr Wirken mißt an der Verände-rung des Rocksaums und der Kleiderord-nung, aber tatsächlich war die Bewegungder 68er ein erfolgreiches Innovationspro-gramm eines Kapitalismus, der an Hierar-chie, Bürokratie und Spießigkeit zu er-sticken drohte.
Ein wunderbares Sackhüpfen sei „68“gewesen, sagt der große italienische Links-radikale Adriano Sofri über den zwei-felhaften Sieg, „ich glaube, wir wurdenZweite“.
Die Jugendlichen der achtziger Jahrehatten keine Lust, das Sackhüpfen fortzu-
115
Vielleicht war er am 2. Juni 1967 wirk-lich „benommen“, wie der Zeuge Geiernoch heute glaubt. Und womöglich fürch-tete er sich tatsächlich: nicht vor konkre-ten Personen, sondern vor dem Chaos,dem Protest an sich.
Es sei „nicht widerlegbar, daß er sich ineiner lebensbedrohlichen Lage“ glaubte,entscheidet im Dezember 1970 auch die10. Große Strafkammer, als Revisionsin-stanz: Wieder folgt Freispruch, der imMärz 1971 rechtskräftig wird. Nach vierJahren Suspendierung darf er zwar wie-der im Polizeidienst arbeiten, aber nurim Innendienst an der Fahndungskartei.Seine Dienstwaffe gibt er in Absprachemit dem Polizeipräsidenten „freiwillig“unter Verschluß.
Er hält das nicht lange aus. Im Sommer1971 verliert Kurras ein zweites Mal dieKontrolle über sich selbst: Er wird be-trunken im Park aufgegriffen, und in sei-ner Aktentasche finden sich ein Stich-messer und die Dienstwaffe, die er nichttragen darf. Er habe sich bedroht gefühlt,gibt er zu Protokoll. Nachdem Polizistendie junge Terroristin Petra Schelm er-schossen hatten, fürchte er wieder umsein Leben.
Die Polizei verstößt ihn nicht. Er wirdzum Kriminaloberkommissar befördert,geht Ende 1987 in Rente, lebt ein mög-lichst unauffälliges Leben mit seiner Frauim vierten Stock eines Spandauer Miets-hauses. Hier im Weinmeisterhornweg ister sicher. Die Wohnungstür ist tresorartiggeschützt mit besonders sicheren Sicher-heitsschlössern. Über den 2. Juni 1967, je-nen Tag, als ein deutscher Beamter kurzdie Haltung verlor, möchte Karl-HeinzKurras nicht reden.
Es wird dieRebellen nicht
glücklich machen,daß man ihr
Wirken an derVeränderung desRocksaums mißt
Schuß: „Wenn eine Pistole der Polizei losgeht, dann schießt der Staat und nicht der Polizeibeamte“

Gesellschaft
d e r s p i e g e l 2 3 / 1 9 9 7
lich, natürlich auch für die „Gewalt imFernsehen“.
Für die vielen Talkshows sollen die 68erauch verantwortlich sein, weil sie ja sovieldiskutierten damals, für die Rauschgiftto-ten sowieso, für die Politikverdrossenheit,für Aids, sicher wird man ihnen irgend-wann auch den Zweiten Weltkrieg anhän-gen, weil es ja die Eltern der 68er waren,die in den Krieg gezogen sind. So gern derAlt-68er verantwortlich wäre für allesBunte, Schöne, Zivilisatorische, was dieseRepublik hat, so gern möchte der 68er-Hasser die Rebellion gern verantwortlich
machen für alles Böse, Kaputte und Ver-fluchte.
Nur wenige gingen so weit wie der kon-servative Publizist Ludolf Herrmann undbehaupteten, die Rebellion von 1968 habemehr Werte zerstört als das Dritte Reich.Aber Haß auf ’68 ist ein weitverbreitetesHobby und ist unter Alt-68ern, die sich ih-rer Irrtümer schämen, ebenso verbreitetwie unter denen, die ihre Verachtung andem Leben abarbeiten, das sie nicht ge-führt haben, als sie jung waren.
Zwischen „nichts bewirkt“ und „allesruiniert“ pendeln die Rückblicke im Fünf-Jahres-Rhythmus der Gedenktage hin undher, und daß auch 1998 wieder alle auf 1968starren und herumprügeln werden, liegtdaran, daß die Nach-68er von der Vergeb-lichkeit aller großen Alternativen über-zeugt waren und sind.
gelassen hat, da gab es keine Berufsverbo-te.“ Einige ihrer SDS-Freunde hätten inder deutschen Wirtschaft Karriere ge-macht, aber von denen spricht sie nicht mitRespekt, sondern mit Ironie.
Distanz zu halten „zum System“ ist fürviele 68er wichtig geblieben, also analy-sierende Voyeure der Gesellschaft zu sein,sich im Milieu der enttäuschten großenHoffnung zu bewegen, wie eine Frau, derdie große Liebe ihres Lebens davongelau-fen ist und die sich nun mit einem Lang-weiler in einem Reihenhaus durchs Lebenschlagen muß.
Die Ansprüche an das Le-ben, gewachsen in den Jahren,als Geschichte wie das Pro-dukt der eigenen Selbstver-wirklichung schien, sind diewenigsten wieder losgewor-den, die Karrieristen nicht, dieVerweigerer nicht, die Verlie-rer nicht – sie unterscheidensich nur dadurch, wie oft siedie Konfrontation mit diesenAnsprüchen zulassen.
Als kreative Unternehmersind nur ein paar aufgefallen,einer ließ Brillen in Nicaraguafertigen und zum Nulltarif ver-kaufen, ein anderer produziertökologische Putzmittel, dochbekannter sind die Unterneh-merkinder geworden, die ihreMillionen beim Vietcongließen oder in die Erforschungder Gesellschaft investierten.Diejenigen, die sich als Mana-ger in den Kampf gegen dasGroßkapital stürzten, trafen inden Unternehmen auf eineFührungselite, die durch dieNazis darauf getrimmt waren,„nach den Maximen eines Ge-nerals“ (capital) zu handeln:„Pflichterfüllung und letzterEinsatz“; 25 Jahre nach demBeginn ihres langen Marschesmußten sich die Apo-Ökono-
men vom Chef-Volkswirt der DeutschenBank bescheinigen lassen, es sei „eine Ka-tastrophe, daß jetzt im mittleren Manage-ment lauter ehemalige 68er sitzen“, die faulseien und träge und auf staatliche Kon-junkturprogramme hofften.
Als die Konrad-Adenauer-Stiftung dieKarrieren von hundert Apo-Veteranendurchleuchtete, fand sie keine „spekta-kulären Karrieren im Staatsdienst oder inder Wirtschaft“; bei einer Untersuchungder Lebensläufe deutscher Hochschulleh-rer fielen 25 ehemalige SDS-Aktivisten auf– nur Kämpfer „aus der dritten Reihe“,wie Lönnendonker meint, die aus der er-sten Reihe hätten keine Chance gekriegt.
Eine neue Elite habe sich „die Wirt-schaft“ erhofft, als die Studenten Mitte dersechziger Jahre aufbegehrten, sagt Lön-nendonker, also besser ausgebildete Hoch-
Auch die Techno-Bewegung, die antrat,„die Gesellschaft mehr zu verändern alsdie 68er“ (frontpage), und die eine Zu-kunft ohne Rassismus, ohne Sexismus undohne Gewalt vorleben wollte, ist nichtmehr als eine Partymaschine, aber auchnicht weniger.
Jede Generation ist fest davon über-zeugt, daß die nachfolgende Generationverkommener und dümmer ist – und ent-behrlich. Man mag darum Helmut Schmidtnachsehen, wenn er den „25jährigen von1968“ attestiert, „als 50jährige“ hätten sie „keine ausreichende Führungskraft“.
Schon damals, nach dem Tod von BennoOhnesorg, hatte ein besorgter West-Berli-ner in einem Brief an den Asta der FU daskommen sehen: „Man bekommt Angst vorder Zukunft, weil man sich fragt, soll daseinmal unsere führende Schicht werden?Heute stellen sie sich gegen Sicherheit undOrdnung mit Eiern und Tomaten, sie ran-dalieren gegen jeden und alles.Was werdensie erst tun, wenn sie in den führenden Po-sitionen stehen?“
Daß die Aktivisten des Aufstandes heu-te in diesen Höhen nicht zu finden sind, seinicht verwunderlich, findet Apo-ForscherLönnendonker, schließlich sei es ein Lob,den Wortführern einer antiautoritären Be-wegung vorzuwerfen, sie hätten keineFührungsqualitäten. „In Italien“, sagt Frie-derike Hausmann, „sind die Apo-Führernach oben gekommen, weil man sie rein-
116
Osterunruhen in Berlin (1968): „Gemeinschaft auf dem Altar der Gesellschaft geopfert“
SÜ
DD
. VER
LAG

d e r s p i e g e l 2 3 / 1 9 9 7
schulabsolventen, praxisorientierter, welt-offener, selbständiger, deshalb habe dieWirtschaft mit der Hochschulreform sym-pathisiert. Denn mit den Ordinarienuni-versitäten, mit der Hierarchiegesellschaft,mit den ständischen Strukturen der Ade-nauer-Republik war die beginnende neueindustrielle Revolution nicht zu meistern.
Von „Reformstau“ redeten damals dieGesellschaftskritiker und vom „Bildungs-notstand“; die Leitartiklerin Ulrike Mein-hof forderte „wirtschaftliches Wachstum“und „mehr Gemeinwohl“ und „mehrRechtsstaat“; Rudi Dutschke kritisierte feh-lende Demokratie in den Par-teien, sie seien „nur nochPlattformen für Karrieristen“;Karl Jaspers beklagte „dasFortwursteln der Regierung“und die „Parteienoligarchie“und fragte ängstlich: „Wohintreibt die Bundesrepublik?“;all das liest sich heute wie einZusammenschnitt aus dem,was die beiden höchsten Kri-tiker der Republik, Richardvon Weizsäcker und RomanHerzog, in den letzten Jahrenan Politikschelte abgefeuerthaben.
In ihrer innenpolitischenRatlosigkeit gleicht die heuti-ge Republik jener Mitte dersechziger Jahre. Der Polizist,sagt der Polizist Moldenhau-er, sei der Seismograph derGesellschaft, der merke als er-ster, wenn etwas schieflaufe imLand. 1966 hat er das gespürt,dann später mit den Atom-kraftgegnern, dann mit denHausbesetzern, aber jetzt seida ein Beben in der Stadt, dasihn unruhig mache.
Er ist seit 35 Jahren Polizistund ist stolz darauf, nie einenMenschen mit dem Knüppelgeschlagen zu haben, „nur maleinen Besoffenen mit demHandschuh ins Gesicht“. Irgendwo zwi-schen Ordner, Sozialarbeiter und Pfarrersieht er seinen Job, ein Polizist brauche„soziales Empfinden“ und müsse „Ag-gressionen abbauen“; das klingt, als redeDutschke. Moldenhauer ist Leitender Poli-zeidirektor und plant die Großeinsätze in Berlin, auch jedes Jahr die Schlacht zum 1. Mai.
Das ist immer wie ein Geländespiel, wieein Videospiel, mit Scharen von Kindernhat man es da zu tun, und die werden im-mer jünger, aber nicht das ist es, was ihnunruhig macht. Da wachse etwas heran inden nächsten Jahren, das gefährlicher seials ’67, und dem ist er begegnet, als er amReichstag den Haß in den Gesichtern derdemonstrierenden Bauarbeiter gesehenhat. „40000 von denen sind hier arbeitslos,und 35000 ausländische Arbeiter arbeiten
SPD gesickert war, also vor allem die Hoff-nung, der Staat könne immer mehrSchreibtische hinstellen, und die Illusion,der Kapitalismus könne auf dem Verwal-tungswege sozialistisch werden.
Schröder gehöre zu den Menschen, sagtFriederike Hausmann, bei denen es ihrnoch immer kalt den Rücken runterlaufe.Moderner als Kohl, glatter als Clinton, blas-ser als Blair, „der Gegentyp zu einem68er“. Dem könne man nicht böse sein,sagt Lönnendonker, „der ist sich treu ge-blieben“, der sei schon damals so gewe-sen. Man brauche einen Feind, predigt er
seinen Studenten, wenn sie bei ihm imApo-Archiv sitzen und fragen, was man alsStudent heute von ’68 lernen könne. DerenSituation sei so mies, die rechtfertige jedeRevolte, „aber sie ist so mies, da machtkeiner eine Revolte, da reißt er lieber Sei-ten aus den juristischen Lehrbüchern, da-mit sie der andere nicht lesen kann“.
Die Tür fliegt auf, sein BüronachbarBernd Rabehl, ein alter Kampfgefährte vonDutschke und jetzt Archivar dank Lön-nendonkers Fürsprache, schaut herein undfragt: „Was bist du so erregt, was ist los, ichdachte schon, du telefonierst mit deinemSteuerberater.“
Im nächsten HeftFritz Teufel, der 68er, der vom Spaß-Guerrillero erst zum Terroristen und dannzum Fahrradkurier wurde.
auf den Baustellen. Das war diesmal schonhaarscharf am Rand, das hätte schon jetztexplodieren können.“ Wenn es soweit ist,möchte er nicht mehr Polizist sein.
Einen Teil seiner Probleme hat diesesLand trotz ’68, einen Teil wegen ’68. Trotz’68, weil der Abbau des bürokratischen Ob-rigkeitsstaates irgendwo steckenblieb zwi-schen RAF-Terror und Staatsschutz undweil die Apo daran scheiterte, Partei zuwerden und die Parteienoligarchie aufzu-brechen; wegen ’68, weil sich aus der Kon-kursmasse der kritischen Bewegung einzäher kritischer Brei entwickelt hat,
der sofort und automatisch über allesschwappt, was neu ist, seien es neue Ideen,Anrufbeantworter, Hollywood-Filme,Schulcomputer oder Handys.
Die Deutschen vom Prinzip „Mißtrau-en“ wieder auf das Prinzip „Hoffnung“umzustimmen, hat Gerhard Schröder über-nommen, er möchte nun in den Gen-, Bio-und sonstigen Technologien vor allemChancen und nicht Risiken sehen.Auf demSPD-Kongreß „Innovationen für Deutsch-land“ redeten er und andere führende So-zialdemokraten zwar viel von „Zukunft“,„Modernisierungsstrategie“ und „2000“,aber es klang mehr nach „1960“ und „Lud-wig Erhard“.Vor allem auf Wachstum setztSchröder wieder, an den Unternehmer undden Markt glaubt er, und auf die USA läßter nichts kommen. Fast nebenbei räumte erdas ab, was durch ’68 und danach in die
117
Love Parade in Berlin (1995): Für eine Zukunft ohne Sexismus und Gewalt
J. P
. BÖ
NIN
G /
ZEN
IT

Juso-Aktivisten Wieczorek-Zeul, Scharping*: Von den Personen bis zu den Allüren – alles noch wie damals
.
J.K
ÖH
LER
-KA
ES
S
.
26 DER SPIEGEL 46/1995
S P D
Die ewigen RebellenJürgen Leinemann über die 68er-Generation der Sozialdemokraten und ihre Schaukämpfe um die Macht
anchmal singen sie noch. „Brü-der, zur Sonne, zur Freiheit“,M klingt es eher zage als freudig
über die Alpenveilchen auf den weißge-deckten Kaffeetischen des RestaurantsLegienhof in Kiel. Nur die Frauen undMänner in der ersten Reihe, die zusam-men über 2000 Mitgliedsjahre in der SPDrepräsentieren, atmen kräftig. Vielekämpfen sich durch Tränen in der Stim-me.
Was sie bewegt, ist nicht Sentimentali-tät. „Der Zerfall dieser Partei“, hat ihnendie 80jährige Genossin Rosa Wallbaueraus der Seele gesprochen, „macht unstraurig, bringt uns zum Weinen.“
Da nicken mit den Alten auch die paarJungen im Saal. „Zweifel kommen mirimmer häufiger“, sagt Melanie Hein, 24.Die flottgrauen Macher der Partei aber,die etwa so alt sind wie die nach der Nazi-Zeit wiedergegründete SPD, die sie andiesem Tage feiern, blicken verdruckstvor sich hin. In vorausahnender Defensi-ve hat der SPD-Landesvorsitzende vonSchleswig-Holstein, Willi Piecyk, 47, be-reits ihre wunderbare „politische Kultur“gefeiert: „Bei uns macht man sich nichtgegenseitig fertig“, tönt er. Und: „Wirlassen keinen fallen.“
Ja, aber wo mag nur Björn Engholmsein? Warum wird sein Name so ver-schämt erwähnt? Und warum deutetPiecyks Vorgänger Günther Jansen, 59,bitter seinen Parteiaustritt an?
Ministerpräsidentin Heide Simonis,52, die sich – wohl in Vorfreude auf denvon ihr gewünschten „Zoff“ auf demMannheimer Parteitag in dieser Woche– höchst unfein mit ihrem Bonner Vor-sitzenden angelegt hatte, schweigt viel-sagend. Norbert Gansel, 55, der sichvon den Genossen in Kiel wie in Bonnum seine politische Zukunft gebrachtwähnt, brütet düster vor sich hin. GertBörnsen, 52, der Kieler Fraktionschef,der gerade abgesägt wird, streift vor-wurfsvoll durch den Saal.
„Politische Kultur“? Auch in Kiel istEnde Oktober zu besichtigen, was dereinst kräftig mitraufende Johano Stras-ser, stellvertretender Juso-Vorsitzenderder Jahre 1971 bis 1975, der freilichlängst vom Rivalen-Karussell der Ge-nossen abgesprungen ist und als freierSchriftsteller kenntnisreich zuguckt, inBayern wie in Bonn bemerkt hat: daß
* Mit Hermann Scheer (l.) in Dortmund im März1976.
nämlich „meine Generation, die jetzt50jährigen, in der SPD doch in auffälligerWeise versagt“.
Sie wollten die SPD der Achtziger sein.Nun, in den Neunzigern, drohen die Ma-cher ihrer Partei den Garaus zu machen.
Gewiß, mit dem Zusammenbruch desOstblocks scheint der sozialistische Welt-entwurf endgültig diskreditiert. InDeutschland sind die großen Milieus derArbeiter- und Angestellten-Gesellschaftzerfallen, das Land quält sich aus dem In-dustrie- ins Informationszeitalter, mitschmerzhaften sozialen Kosten. Anstattaber in dieser Situation alle Kräfte zusam-menzuraffen, agiert die SPD nach denWorten Oskar Lafontaines, „als ob sieder Rinderwahnsinn erfaßt hat“.
Jeder gegen jeden und alles hausge-macht. Ob Gerhard Schröder im Streitmit Rudolf Scharping in Bonn, ob AlbertSchmid in Konkurrenz zu RenateSchmidt in München – allzu viele wollensich im Zusammenspiel mit den Medienihrer Partei als Handlungsträger aufzwin-gen. Allzu viele glauben offenbar, daß ihrLeben verpfuscht wäre, wenn sie nichtjetzt noch ganz schnell Staatssekretär,Minister, Ministerpräsident oder garKanzler würden.

D E U T S C H L A N D
27DER SPIEGEL 46/1995
Torschlußpanik? Daß es diesen he-chelnden Konkurrenzkampf gibt, be-streitet auch Heide Simonis nicht, die –sollte sie „erst mal“ die Wahl in Schles-wig-Holstein gewonnen haben – BonnerAmbitionen nicht leugnen mag. Nur deu-tet sie den lähmenden Wettbewerb posi-tiv: „Wir sind zu viele, zu ehrgeizig, zugleichaltrig und zu gut.“ Mit einer gewis-sen Berechtigung glaube jeder, er sei derRichtige.
Wahr ist ja – wenn das inzwischen auchfast untergeht im allgemeinen Erschrek-ken über den jähen Sturz der Partei insBodenlose, über den Zynismus im Um-gangston und die erbarmungslose Selbst-zerfleischung –, daß die „Enkel“-Gene-ration, die als Schüler und Studenten inVerehrung für Willy Brandt vor 25 bis 30Jahren in die SPD eintraten, der Parteiauf Landesebene spektakuläre Erfolgeverschafft haben.
Noch zum Zeitpunkt des Rücktrittsvon Willy Brandt – 1987 – stellte die SPDlediglich 4 Ministerpräsidenten. Heuteregieren seine „Enkel“ in 10 von 16 Bun-desländern, in 4 weiteren sind Sozialde-mokraten an Koalitionen beteiligt. Nievorher war die SPD im föderalistischenSystem so stark. Kein Wunder, daß sie1991 auf dem Parteitag in Bremen ihre„schmucke Riege“ von Regionalfürstenvoller Stolz den Medien präsentierte: al-les potentielle Kanzlerkandidaten.
Die meisten finden sich noch immerganz toll. Schließlich ist in Bonn dieMacht seit 13Jahren weg, und zwar jenemHelmut Schmidt entglitten, gegen den siein den siebziger Jahren angerannt sind.Sie aber haben durchgezogen: Scharping,Schröder, Lafontaine, Engholm, Vo-scherau, Simonis, Beck, Eichel, Wede-meier und Scherf. In eine siegessatte Um-gebung sind die nach der Wende dazuge-stoßenen Ost-Regierungschefs ManfredStolpe und Reinhard Höppner da gera-ten.
Inzwischen sind nicht nur die Zeitenumgeschlagen, der Glanz der Strahle-
frauen und -männer ist auch durch eige-nes Zutun beträchtlich getrübt. Das Bildist so gründlich verwackelt, als sei dieErfolgsriege plötzlich vor einen Zerr-spiegel geraten: eben noch pathetischeSieger, nun ein zänkischer Haufengrämlicher Wichtigtuer, die in verbisse-nen Eifersüchteleien mit sich selbst be-schäftigt sind.
Ausgedörrt wirken sie jetzt als Grup-pe, bitter geworden und kindisch ver-greist über dem angestrengten Versuch,für immer jung zu bleiben. „Wir verbrei-ten alle den Eindruck tiefer Melancho-lie“, räumt Heide Simonis selbstkritischein: „Ich glaube, wir nehmen uns auswie die Greise des Nationalen Olympi-schen Komitees beim Betriebsausflug.“
So freundlich mag der alte Gewerk-schaftsrechte Hermann Rappe den Le-bens- und Politikstil der heutigen SPD-Führer nicht sehen. Für ihn sind undbleiben seine Gegner von einst „dieserJuso-Vorstand da vorne“.
„Der ewige Juso“ – ist das der Titel je-ner Posse, die den Bundesbürgern alsDauertheater vorgeführt wird?
Dem Niedersachsen Gerhard Schrö-der, der nahezu alle Haupt- und Neben-rollen mit sich selbst besetzt – „nebstHillu und Handy“, wie ein Präside spot-tet –, erscheint sein Bubenstück imnachhinein so dramatisch und schicksal-
haft wie eine griechische Tragödie. Er-hard Eppler, 68, Minister unter Brandtwie Schmidt und damals einsamer Mah-ner gegen Rüstung und für Ökologie, er-lebt die Vorstellung dagegen wie ein Bal-lett: als „Tanz um das vergoldete Ego“.
Daß die Inszenierung an das Juso-Theater der siebziger Jahre erinnert, be-streitet niemand. Von den Personen biszu den Allüren ist alles noch wie damals.Hier der wackere Schröder, dort die kon-spirative Feind-Truppe: Scharping, die„rote Heidi“ und Ulrich Maurer.
Damals „Refos“ gegen „Antirevis“.Heute „Sozialfuzzis“ gegen „Medien-hüpfer“. Nichts ist vergessen. Jede Ver-letzung von früher schmerzt weiter undmuß immer aufs neue gerächt werden.Jeder taktische Winkelzug ist geläufig,jede Floskel bekannt.
Verhaltensmuster laufen ab wie einge-stanzt. Proteste gegen Atomversuche?Heidemarie Wieczorek-Zeul, 52, schip-pert anklagend nach Mururoa, als wäresie noch heute unter 30 und amtierendeJuso-Funktionärin. Sie ist aber stellver-tretende Vorsitzende der Sozialdemo-kratischen Partei Deutschlands, die siemit ihren Abenteuern lächerlich macht.
Einmal „Stamokap-Arsch“, immer„Stamokap-Arsch“. Juso-Rivalen voneinst reagieren auf die Wahl des neuenBremer SPD-Landesvorsitzenden Det-lev Albers auch heute noch mit zornroterFassungslosigkeit. „Die achten nie aufdas, was einer sagt“, staunt ein Präside,„sondern nur darauf, wer gemeint seinkönnte.“
So giftig wie die Reden kann dasSchweigen sein. Sitzungen der Führungs-gremien in der Bonner Baracke – ge-dacht zum Austausch von Meinungenund Informationen – gelten eingefleisch-ten Ex-Jusos als untauglich zur Kommu-nikation: „Da sind doch die anderen da-bei.“
Und doch sind solche Juso-Kinde-reien, unter denen die Sozialdemokratiederzeit leidet, nicht die eigentlichen Ur-
CDU/CSU-
Wähler
Grüne-Wähler
Männer
Frauen
kompetent
kann sich durchsetzen
sympathisch
GERHARDSCHRÖDER
RUDOLFSCHARPING
HEIDESIMONIS
HEIDEMARIEWIECZOREK-ZEUL
5552
34
5260
57
4642
38
3032
24
636968
4863
57
576668
5156
51
Emnid-Umfrage für den SPIEGEL; 1400 Befragte, 6. bis 8. November 1995
bei 42% der befrag-ten SPD-Wähler nichtbekannt
bei 53% der befrag-ten SPD-Wählernicht bekannt
„Welche Eigenschaften können Sie denfolgenden Politikern zuordnen?“
Schröder-Fans in der Union
OSKARLAFONTAINE
JOHANNESRAU
8683
65
6172
70
SPD-Wähler
SPD-Wähler

Genossinnen Wieczorek-Zeul, Schmidt*: Immer vorwärts gegen „meine blöde SPD“
.
R.
WA
LTE
R/
X-P
RE
SS
..
F.H
ELL
ER
/A
RG
UM
.
D E U T S C H L A N D
28 DER SPIEGEL 46/1995
sachen der Führungskrise. Sie sind le-diglich die extremen Symptome einerLähmung, die viel umfassender ist: ei-nes Generationenbruchs.
Der Kieler Sozialdemokrat Hans-Pe-ter Bartels benennt so die Tatsache,daß die SPD auf nahezu allen Ebenenvon einer schmalen Alterskohorte derNachkriegsgeneration dominiert wird,die als „Juso“ oder „68er“ nur unzurei-chend beschrieben wäre. Auf der Vor-standstribüne des Parteitages ist dasPhänomen in dieser Woche zu besichti-gen.
Noch immer spannt sich die Mitglied-schaft der Volkspartei SPD über alleGenerationen. Man mag sich zwar fra-gen, wo die sich verstecken, aber am 31.Dezember 1994 zählte die Partei unterihren damals 849 374 Genossinnen undGenossen noch immer 128 041, die jün-ger waren als 36 Jahre. Und 224 195 wa-ren älter als 60.
Im Bundesvorstand aber, dem umfas-sendsten Führungsgremium der SPD, indem sich die Partei nicht nur durch Pro-mis wie Ministerpräsidenten und Frakti-onschefs repräsentiert sehen will, son-dern auch durch Funktionsträger undgewählte Frauen und Männer aller Ebe-nen, Regionen und Interessenbündnis-se, gibt es praktisch nur eine Altersgrup-pe: jene Kriegs- und Nachkriegskinder,die zwischen 1938 und 1948 geboren
* Auf Tahiti im September; in einem Bierzelt imbayerischen Mallersdorf 1994.
wurden. 35 von 45 Vorständlern gehö-ren dieser Generationskohorte an, dieAbweichler – vier jünger, sechs älter –variieren um zwei bis drei Jahre.
Allein Johannes Rau, Jahrgang 1931,zählt mehr als 60 Jahre, keiner ist unter35. Die Genossin Ruth Winkler, die alsJüngste im Alter von 34 Jahren in denVorstand gewählt wurde, scheidet nun –als immer noch Jüngste – mit 41 aus.
Alle sind sie kurz vor oder nach 1968in die SPD eingetreten. Alle empfandensie – wie aktiv sie auch selbst an der Stu-dentenrebellion beteiligt gewesen sein
mochten –, daß Schluß sein müsse mitder Adenauer-Zeit und ihrem unpoliti-schen Motto: keine Experimente. Undalle erlebten sie ihr politisches Engage-ment zugleich als individuellen Auf-bruch.
Sie sind trinkfest geworden und habengelernt, sich gegen beunruhigendeNeuigkeiten durch den Aktionismus ei-nes 14-Stunden-Tages abzuschirmen.Jeder redet im Vorstand über sein Beetim Schrebergarten des Lebens und ach-tet sorgsam darauf, daß kein anderer aufdie Rabatten tritt. Ihre Aufregungenund Entrüstungen sind seit langem ri-tualisiert.
Diskussionen? Konzepte? SachlicheStatements? Faire Auseinandersetzun-gen? Jeder ist sich selbst der Wichtigste.Der rebellische Gestus, mit dem sie voreinem Vierteljahrhundert die Türen zurPartei aufzutreten bereit waren, wärendie nicht längst sperrangelweit offen ge-
wesen, ist ihnen als Attitüde geblieben.Immer vorwärts, „gegen meine blödeSPD“, wie es Renate Schmidt sarka-stisch ausdrückt.
Daß diese Generation sonderlich pro-gressiv gewesen wäre, läßt sich gewißnicht behaupten. Von Ausnahmen ab-gesehen, sind sie nicht die Akteure der68er-Revolte gewesen, sondern Mitge-zogene, die sich den bürokratischenVollzug der Kulturrevolution zur Auf-gabe machten.
„Das Machtzentrum der Partei sinddie gewählten Gremien“, sagt noch heu-
te Rudolf Scharping, der – ganz wie sei-ne innerparteilichen Konkurrenten –den avantgardistischen Anspruch derüberschwenglichen frühen siebziger Jah-re durch Standhaftigkeit im innerpartei-lichen Wettbewerb aufrechterhält.
Natürlich hat der Beitritt von Zehn-tausenden jungen Akademikern der ge-werkschaftlich geprägten und sozialorientierten Traditionspartei SPD ur-sprünglich nicht nur Schwierigkeiten be-reitet. Er hat „diesen uralten Laden“(Schröder) entscheidend verjüngt undmodernisiert. Die intellektuellen Wort-führer unter den jungen Genossen dien-ten als Moderatoren für die neuen sozia-len Bewegungen in der Gesellschaft.Die Jusos hielten die Brücken zu denAltersgenossen offen.
Die neuen Sozis trugen pazifistischeElemente in die Partei, bestanden spä-ter auf ökologischem Umbau und öffne-ten die Gremien – was auf den Partei-

„Die SPD auf dem Weg zum Parteitag“ Hamburger Abendblatt
29DER SPIEGEL 46/1995
tagstribünen in Mannheim eher optischals politisch erkennbar sein wird – fürdie Mitwirkung von Frauen.
Ihr Pech ist, daß sie sich innerpartei-lich vollständig durchgesetzt haben.
Außer im klassisch-gewerkschaftli-chen Traditionsgebiet Nordrhein-West-falen prägen sie schon seit Jahren denDiskussionsstil der SPD. Sie verkörpernden Erfolgstypus, sie bestimmen dieLebensart. Ihr Tonfall und ihr Habitushaben der Partei eine Aufsteigerdyna-mik aufgenötigt, die längst zu krampf-hafter Pose erstarrt ist.
Natürlich gibt es Ausnahmen. Minde-stens ein Drittel der altersgleichenSPD-Vorständler behaupten von sich,daß sie weder mit der Studentenrevoltevon 1968 noch mit den Juso-Spielchender siebziger Jahre direkt etwas zu tungehabt hätten – der ritualisierte Sog derMehrheit ist jedoch stärker.
Er ebnet persönliche Unterschiedeein. Daß sich etwa Rudolf Dreßler oderOskar Lafontaine oder Renate Schmidtvom „spontihaften Gerede“ (Dreßler)oder von der Neigung zum „Abmes-sern“ (Scharping) ihrer Kollegen allzusehr unterschieden, würden sie wohlnicht einmal selbst behaupten.
Solche Entkernungen der Individuali-tät gehören zu den paradoxen Ergebnis-sen des Erfolgszwanges dieser Politiker,die sich zunehmend miteinander vomRest der Welt isolieren. Mit Erstaunenhat der Freiburger Politologe DieterOberndörfer registriert, „wie schnellsich diese Burschen von der Universitätweg an die Macht gewöhnt haben“, alsdie Partei in den frühen achtziger Jah-ren noch viele Regierungsjobs in Bonnzu verteilen hatte.
Viel zu früh vom Alltag abgeschottet,verloren sie das Gespür für ihre Mit-menschen. Der Umgangston dieser Po-litikergeneration wirkt rüde, ihre Um-gangsformen sind oft rüpelhaft.
Die Realität bietet sich den Elitege-nossen nur in vorsortierter Form dar.„Sie behaupten zwar alle“, hat ein Par-teifreund in der Bonner Parteizentralebeobachtet, „sie fänden sich im Alltagwunderbar zurecht. Sie merken abernicht einmal mehr, daß ihnen dieMarktfrau, die sie natürlich vom Fern-seher kennt, immer nur die besten To-maten aussucht.“
Daß sich mit dem Ende der SPD-Herrschaft in Bonn Karrieren und poli-tische Spielräume in den Ländern öff-nen, hat den Machtvormarsch der En-kelgeneration gewiß befördert. Daßsich aber ihr Gesichtskreis durch denBlick von den heimischen Kirchtürmenerweitert hätte, läßt sich nicht behaup-ten.
Keine soziale Gegenbewegung, keinezündende Reformidee, kein außenpoli-tischer Anstoß ist aus Hannover, Kiel,Mainz oder Saarbrücken zu vermelden.
Aus Bonn kommt erst recht nichts.Die Bundestagsfraktion ist nach der lan-gen Oppositionszeit ausgedünnt, „Mit-telmaß“, wie der Genosse Schröder ver-ächtlich mitteilt. Und der Mann im Zen-trum, gegen den nun die Pfeile der Riva-len aus den Ländern gerichtet sind, istauch im Bundestag Landespolitiker ge-blieben.
Doch die Gefahren, die sich aus derAuslieferung der Partei an seine Gene-ration ergeben, hat Rudolf Scharpingerkannt: „Wir um die 50 haben jetzt dieeigentliche Aufgabe, ganz systematisch
die um 30 reinzuholen in die politischeVerantwortung.“ In Mannheim wird derVorstand verjüngt werden. Mit KerstinGriese, 28, und Benjamin Mikfeld, 23,aus Nordrhein-Westfalen sollen nochzwei Jusos der neunziger Jahre ihre Vor-sitzende Andrea Nahles, 25, unterstüt-zen, die inzwischen schon mitredendarf.
Norbert Gansel aber, der nicht wiederantreten soll für den Vorstand, fragtskeptisch, was sich durch Verjüngungwohl ändern solle. Das verletzende Kli-ma etwa? „Ja, willst du denn warten“,kriegt er darauf von der neuen Juso-Chefin zu hören, „bis die ersten mit derBahre rausgetragen werden?“
In Wahrheit hält sich mit einemDurchschnittsalter von 50,5 Jahren imStichjahr 1991 das Altersniveau im SPD-Vorstand nur unwesentlich über dem inden Spitzengremien der Wirtschaft oderder Medien. Doch bewirkt der krampfi-
ge jugendliche Gestus der Führungsrie-ge, daß die Partei noch immobiler, ver-greister und starrer wirkt, als sie ohne-hin ist. „Wenn ihr Enkel daran denkt,Posten zu besetzen, dann denkt ihr nuran die, mit denen ihr in den siebzigerJahren Politik gemacht habt“, warf Hu-bertus Heil, 22, aus Brandenburg un-längst dem Parteivorsitzenden vor.
Solche Hinweise, kopfnickend undwohlwollend zur Kenntnis genommen,bleiben gleichwohl ohne Eindruck. Sojung, links, politisch bewußt und lebens-froh wie die Jungen heute fühlen sich
die braungebrannten Alterslosen in denFührungsebenen noch allemal.
Sind sie nicht noch genauso lümmel-haft provokant wie eh und je? Sind sienicht noch heute so chaotisch und groß-mäulig wie einst? Nennt man sie nichtwegen ihrer Lebenskunst die Toskana-Fraktion?
Es ist dieser Generation gelungen,sich den Generationskonflikt mit denNachwachsenden zu ersparen. Die risi-kobereiten Altersgenossen und die ih-nen folgende politische Generation aufDistanz zu halten war leicht. Da die sichbei den Grünen in einem organisiertenKonkurrenzunternehmen zusammen-fanden, durften sie, parteipolitisch legi-timiert, bekämpft werden. Die nächstenJahrgänge in der eigenen Partei nahmendie ewigen Berufsjugendlichen schongar nicht mehr wahr.
Waren 1974 noch 30,9 Prozent allerSPD-Mitglieder in der Bundesrepublik

Lafontaine beim SPIEGEL-Gespräch*: „Ohne Darstellung ist alles nichts“
.
FOTO
S:
J.H
.D
AR
CH
ING
ER
.
D E U T S C H L A N D
32 DER SPIEGEL 46/1995
unter 36 Jahre, sind es 1994 noch 15,1Prozent. Bei Wahlen erreichen die Sozi-aldemokraten nur noch jeden dritten bisfünften Jungwähler. Einladend wirkendie Enkel, die längst Väter und Großvä-ter sind, auf den Nachwuchs wahrlichnicht.
Im Jahr 1995 sind den Sozialdemokra-ten nicht nur die Wähler, sondern bisherauch 20 000 Mitglieder weggelaufen.„Nicht nur solche mit roten Parteibü-chern, sondern auch viele mit blauen,den alten, von vor Godesberg“, wie einGenosse klagt. Daß in dieser SituationGerhard Schröder als Herausfordererseinem Parteirivalen Scharping einenWettbewerb um Fernseh-Popularitätaufnötigen will, betrachten die Jusos ineinem Thesenpapier als „medialenShowdown eines schleichenden Auflö-sungsprozesses der SPD als Mitglieder-und Reformpartei“.
Als ob es ein Delikt wäre, mit denMedien umgehen zu können, wehrt sichder Niedersachse. Als ob man in derEgo-Gesellschaft der Postmoderne nochden traditionellen Schulterschluß derGenossen aus der antikapitalistischenKampfzeit einfordern könne, spottetOskar Lafontaine. Haben denn nichtauch die Alten gestritten, daß die Fet-zen flogen? Mit Legenden soll keinerden Machern von heute kommen.
Die Partei, die in diesen Wochenlandauf, landab ihren 50. Geburtstagnach der Wiedergründung feiert, mitechten Tränen und falschem Efeu, Tra-ditionsfahnen und Kleinbürgermuff –„die gibt es in Wahrheit gar nichtmehr“, meint der Schröder-Vorgängerbei den Jusos, Klaus-Uwe Benneter, 48,der heute Schatzmeister der SPD in Ber-lin ist.
So mag es sein. Und doch könnte essich als ein Irrtum der Medienstars er-weisen, wenn sie ihre Seifenopern-Po-pularität mit politischem Gewicht ver-wechseln.
„Wer eine Volkspartei, zumal einelinke, zusammenhalten und zum Erfolgführen will“, warnt Erhard Eppler,„muß auf das Verbindliche setzen, mußdafür sorgen, daß es respektiert wird.“Daß der SPD die Begriffe Freiheit, Ge-rechtigkeit und Solidarität nicht nurPhrasen sind, habe die Partei in ihrerGeschichte durch leidvolle Schicksalebewiesen.
Langweilig? Unoriginell? Vorgestrig?Die bayerische SPD-Vorsitzende Rena-te Schmidt – im Talkshow-Business eineZugnummer – hat gerade schmerzlichdie Differenz zwischen persönlichen Po-pularitätswerten und Prozentpunktenfür die Partei kennengelernt. Sie erin-nert der persönliche Ehrgeiz ihrer Kol-legen an das Märchen vom „Fischer undsin Fru“, die auch immer mehr undmehr und mehr wollte: „Am Ende sit-zen wir, wie die, wieder im Pißpott.“
S P I E G E L - G e s p r äc h
„Aus der Deckung“SPD-Vize Oskar Lafontaine über den Mannheimer Parteitag
SPIEGEL: Herr Lafontaine, folgen Sieden Empfehlungen von Henning Vo-scherau und Heide Simonis und tretenauf dem Mannheimer Parteitag dochnoch zur Wahl um den SPD-Vorsitzan?Lafontaine: Der Parteivorstand hat ein-stimmig Rudolf Scharping zur Wieder-wahl vorgeschlagen.SPIEGEL: Warum geben Sie sich mit ei-ner Lösung zufrieden, die Sie dochkaum für die beste halten?Lafontaine: Ich habe für einvernehmli-che Lösungen bei der Verteilung vonAufgaben in der Führung plädiert.SPIEGEL: Einvernehmen schließt eineKampfkandidatur gegen Scharpingaus?Lafontaine: Einvernehmen ist besserals eine Kampfkandidatur.SPIEGEL: Voscherau hatte speziellSchröder und Sie im Auge, als er fest-
* Das Gespräch führten die Redakteure Olaf Ihlauund Klaus Wirtgen.
stellte: „Die Enkel haben viel vergurkt“und von Ihnen beiden verlangte, aus derDeckung herauszukommen.Lafontaine: Ich bin mehrmals aus derDeckung hervorgekommen, bei der Au-ßenpolitik, der Energiepolitik und derWirtschaftspolitik. Über Personalia re-de ich in den Parteigremien.SPIEGEL: Wird man Ihnen nicht Untä-tigkeit oder Feigheit vorwerfen, wennder negative Bundestrend im März auchnoch auf die Landtagswahlen in Kiel,Mainz und Stuttgart durchschlägt?Lafontaine: Ich habe in der vergangenenWoche mit anderen ein Wirtschaftspa-pier vorgelegt, die Steuerverhandlungenmit der Bundesregierung aufgenom-men, und ich führe ein SPIEGEL-Ge-spräch. Mir bei soviel Fleiß Untätigkeitvorzuwerfen, geht zu weit.SPIEGEL: Warum schafft es die SPDnicht mehr, mit ihren Themen anzu-kommen?Lafontaine: Die SPD hat ein modernesProgramm . . .